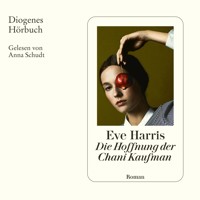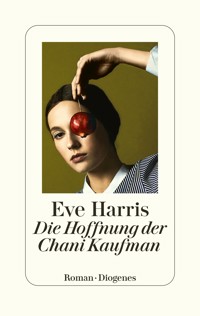11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sie haben sich dreimal gesehen, sie haben sich noch nie berührt, aber sie werden heiraten: die neunzehnjährige Chani Kaufman und der angehende Rabbiner Baruch Levy. Doch wie geht Ehe, wie geht Glück? Eine fast unmögliche Liebesgeschichte in einer Welt voller Regeln und Rituale. Das freche und anrührende Debüt von Eve Harris.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 489
Veröffentlichungsjahr: 2015
Sammlungen
Ähnliche
Eve Harris
Die Hochzeit der Chani Kaufman
Roman
Aus dem Englischen von Kathrin Bielfeldt
Diogenes
Für Jules und Rosie
»Darum wird ein Mann Vater und Mutter
verlassen und an seinem
Weibe hangen, und sie werden sein
ein Fleisch.«
(Genesis 2:23, 24)
1Chani – Baruch
November 2008 – London
Reglos stand die Braut da, unter Lagen kratziger Petticoats wie zur Salzsäule erstarrt. Schweiß lief ihr den Rücken hinunter, sammelte sich in den Achselhöhlen und hinterließ Flecken auf der elfenbeinfarbenen Seide. Sie schob sich näher an die Tür des Bedeken-Raumes heran und presste ein Ohr dagegen.
Sie hörte die Männer singen. Ihre »Lai-lai-lai«-Rufe rollten den staubigen Korridor der Synagoge herunter. Sie kamen, sie abzuholen. Jetzt war es so weit. Dies war ihr Tag. Der Tag, an dem ihr Leben endlich begann. Sie war neunzehn und hatte noch nie die Hand eines Jungen gehalten. Der einzige Mann, der sie berühren durfte, war ihr Vater gewesen, und seine körperlichen Zuwendungen hatten abgenommen, als ihr Körper rundlicher und reifer wurde.
»Setz dich, Chani-leh, zeig ein bisschen Anstand. Komm, eine Kalla steht nicht an der Tür. Los, setz dich hin!«
Das Gesicht ihrer Mutter war grau geworden. Die Falten traten umso deutlicher hervor, als ihr das Make-up den Hals hinunterglitt. Die gezupften Augenbrauen verliehen ihrem Gesicht den Ausdruck ständiger Überraschung, und der Mund war zu einer Linie eisigen Pinks zusammengepresst. Mrs Kaufman schien unter dem Gewicht ihrer farblosen Perücke regelrecht zusammenzusacken, das Haar darunter ebenfalls grau und dünn. Mit fünfundvierzig eine alte Frau: müde. Chani war ihre fünfte Tochter, die Fünfte, die im Empfangszimmer auf die Bedeken-Zeremonie wartete, die Fünfte, die das Kleid trug. Und sie würde nicht die Letzte sein. Wie Matrjoschka-Puppen kamen nach ihr noch drei jüngere Töchter.
Chani blieb auf ihrem Posten. »Müssten sie nicht längst hier sein?«
»Sie kommen noch früh genug. Du solltest für deine unverheirateten Freundinnen beten. Nicht alle haben so ein Glück wie du heute, Baruch HaSchem.«
»Aber wann kommen sie denn? Es fühlt sich an, als würden wir schon ewig warten.« Chani stieß einen langen, gelangweilten Seufzer aus.
»Wenn sie so weit sind. Und nun ist Schluss, Chani-leh.«
Von Mutter zu Tochter und von Schwester zu Schwester war das Kleid allen immer ein treuer Freund gewesen – es schrumpfte oder wuchs mit den Erfordernissen einer jeden Braut. Die silbernen Stickereien und unzähligen Perlen kaschierten Narben und schartige Säume der verschlissenen Hülle. Jede Änderung zeugte von der Reise einer weiteren Braut, zeichnete ihre Hoffnungen und Wünsche nach. Die gelbgewordenen Achseln, die schon so oft chemisch gereinigt wurden, erzählten von ihren Ängsten. Kalte, kribbelnde Spannung, das Aufblitzen weißer Laken und das riesige Bett, das auf sie wartete, erfüllten die Gedanken jeder Braut. Wie wird es sein? Wie wird es sein? Diese Frage pulsierte in Chanis Kopf.
Sie ging zögerlich über den Teppich. Als würde sich das Rote Meer teilen, rutschten die Mutter und die Schwestern mit ihren üppigen Hinterteilen zur Seite, um auf dem Diwan für ihren kleinen hübschen Po Platz zu machen. Das weiße Braut-Gebetbuch wurde ihr behutsam in die Hände geschoben. Die Frauen flüsterten und murmelten, die Gebete hoben und senkten sich im Rhythmus ihrer Atemzüge und dem Klopfen ihrer Herzen. Das Hebräische ergoss sich in sanftem, weiblichem Keuchen. Chani stellte sich vor, wie die Worte hoch, hoch und immer höher schwebten – geflügelte Briefe, die mit der Zimmerdecke verschmolzen.
In der warmen Luft mischten sich die verschiedenen Parfums mit Körperausdünstungen und schlechtem Atem. Getrockneter Lippenstift verklebte die ausgedörrten Münder der Frauen, und verborgen unter vielen Kleiderschichten, knurrten ihre Mägen. Einige trugen Zweiteiler, bestehend aus langen Röcken und passenden Jacken, zugeknöpft, soweit es nur ging. Andere hatten den obligatorischen langen Rock mit einer weißen hochgeschlossenen Bluse unter einem schlichten blauen Blazer kombiniert. Die Farben waren absichtlich trist, belebt höchstens von einer kleinen Brosche oder etwa cremefarbenen Paspeln um die Taschen. Eine selbstauferlegte Uniform, die sogar die Jüngste unter ihnen wie eine Witwe erscheinen ließ.
Genau wie Mrs Kaufman trugen die verheirateten Frauen ihre besten Perücken – schwere, glänzende Strähnen, die ihr Haar vor dem anderen Geschlecht verbargen, die falsche Pracht dichter und farbiger als die Natur. Junge, unverheiratete Frauen bekundeten ihren Familienstand, indem sie barhäuptig gingen, doch selbst die prächtigste Mähne war gebändigt und zurückgebunden oder zu einem ordentlichen Bob geschnitten.
Die drallen Rücken und Schultern derer, die schon vor ihr Bräute gewesen waren, wiegten sich vor und zurück, mit knackenden Knien, wenn sie sich tief verbeugten. Sie beteten und seufzten für Chani, dafür, dass diese Ehe eine gute und treue werde und dass HaSchem wohlwollend auf sie und ihren Ehemann herabblickte. In Chanis Augen brannten Tränen angesichts ihrer Loyalität und Güte.
Doch wo war die Rebbetzin? Nachdem der Unterricht beendet war, hatte sie versprochen, zur Hochzeit zu kommen. Chani sah sich ein weiteres Mal um, bevor sie die Enttäuschung zuließ. Sie tröstete sich mit dem Gedanken, dass die Rebbetzin bereits in der Schul war und sie von der Frauengalerie aus beobachten würde. Chani schwor sich hinaufzuschauen, bevor sie unter die Chuppa trat.
Stattdessen war ihre zukünftige Schwiegermutter hier. Als ihre Blicke sich trafen, bedauerte Chani, nicht ins Gebet versunken zu sein. Mrs Levy war prachtvoll in ein dunkeltürkisfarbenes Seidenkleid gehüllt. Ein passender Pillbox-Hut vervollständigte das Ensemble und ließ sie wie einen glitzernden Eisvogel aussehen. Sie schlängelte sich herüber und atmete auf widerliche Art in Chanis Ohr.
»Entzückendes Kleid, Chani – obwohl es für meinen Geschmack ein wenig zu altmodisch ist. Aber dennoch, sehr hübsch. Es steht dir, meine Liebe.«
Der Hut ihrer Schwiegermutter war verrutscht, was irgendwie keck wirkte. Chani unterdrückte ein Grinsen. Mrs Levys extravagante kupferfarbene Perücke war zu einem aalglatten Vorhang getrimmt worden, der ihr hinterlistiges Lächeln umrahmte. Das hämische Grienen eines Leopards, bevor er zum Sprung ansetzt. Chani würde nicht darauf hereinfallen. Sie ließ sich nicht unterkriegen.
»Danke, Mrs Levy, es ist ein Familienerbstück. Meine Großmutter hat in diesem Kleid geheiratet. Es ist eine große Ehre für mich, es tragen zu dürfen.« Kess lächelnd wandte sie sich Richtung Diwan und ließ Mrs Levy mit offenem Mund stehen. Sie war schon so weit gekommen, dass sie sich von dieser Frau jetzt nicht mehr angiften ließ. Mit der Zeit würden sie lernen müssen, einander zu tolerieren. Die tiefe Abneigung beruhte auf Gegenseitigkeit, doch es war Chani, die den Sieg davongetragen hatte, und heute war ihr Tag.
Das Kleid knarrte, als sie sich setzte. Es floss über ihre Knie und sank in glänzenden Wogen um ihre Füße. Nur ihr Gesicht und die Hände bekamen Luft. Der Stoff kroch über das Schlüsselbein und umklammerte ihre Gurgel, der Hals unter der straffen Seide lang und elegant. Über ihren kleinen, festen Brüsten funkelten Blumen und Vögel in silbernen Bögen, die sich wie ein Spinnennetz über ihren Oberkörper zogen. Ihre Wirbelsäule war in eine aufrechte Haltung gezwungen, das Mieder so straff geschnürt, dass ihre Rippen nach Erlösung schrien. Eine doppelte Reihe Perlenknöpfe kletterte, einer Leiter gleich, ihren Rücken hinauf. Von der Taille abwärts bauschte sich das Kleid ausladend. Mehr und mehr silberne Blätter entfalteten sich, je näher die Stickereien dem Saum kamen.
Chanis Füße zappelten in Satinballerinas, sie schwitzte in den Strümpfen. Dicke Manschetten aus Zuchtperlen fesselten ihre Handgelenke, Hunderte lidloser Augen mit durchstochener Pupille. Sie war eine wahrhaft züchtige Braut, ihr Schlüsselbein, Hand- und Fußgelenke meisterhaft vor männlichen Blicken verborgen. Doch der unnachgiebige Stoff unterstrich ihre mädchenhaften Kurven und deutete das unerforschte Fleisch an, welches sich darunter verbarg.
Das Kleid war ihr Weg hinaus, ihre Chance, den klebrigen Türgriffen und dem ewig währenden Chaos ihres Elternhauses in Hendon zu entfliehen. Sie hatte noch nie ein eigenes Zimmer besessen oder neue Kleidung. Alles war immer aus zweiter Hand. Wie das Kleid. Selbst die Liebe, die man ihr entgegenbrachte, war irgendwie abgetragen.
Er konnte sich nicht mehr an ihr Gesicht erinnern. Ein kleines Problem. Denn Baruch war gekommen, um seine Braut zu identifizieren, sicherzustellen, dass er das richtige Mädchen ehelichte. Und nicht in die Irre geführt wurde wie Jacob, als Laban am Tag ihrer Hochzeit Rachel durch Leah ersetzte. Hilf mir, HaSchem. Wie sah sie aus? Bis zu diesem Augenblick war ihr Gesicht in seinem Gedächtnis eingebrannt gewesen, doch jetzt war sein Kopf leer. Drei breite Fedoras versperrten ihm die Sicht, als der Rabbi, der Kantor und sein Schwiegervater auf die Tür des Empfangszimmers zuhasteten. Er hatte sie dreimal getroffen und ihr beim vierten Mal einen Antrag gemacht – aber wie um alles in der Welt sah seine Braut bloß aus? Vor Hunger vernebelt, rebellierte sein Gehirn und lieferte ihm ihre Gesichtszüge nur als verschmierten Fleck. Die Hitze hatte ihn regelrecht im Schwitzkasten; unter den erstickenden Kleiderschichten begann er zu schwanken. Sein Onkel und sein Vater stützten ihn wie einen Betrunkenen, der aus einer Bar geführt wird. Sie schleppten ihn weiter, erst einen Schritt näher, dann noch einen. Seine Brillengläser beschlugen, so schwitzte er. Jetzt hatte er keine Chance mehr; die Tür schwang auf.
Chani konnte sich erinnern, wie es war, als ihre Eltern noch Zeit hatten, als ihre Mutter am Tor des Kindergartens auf sie wartete. Auf dem Weg nach Hause hatten sie die ganze Zeit über miteinander geredet; ihre Hand fest in der ihrer Mutter, die ihrem Geplapper aufmerksam lauschte. Fast verblichen das Bild, wie ihre Mutter mit ihr im Garten Himmel und Hölle spielte, die Röcke hob und geschickt von Stein zu Stein hüpfte. Doch dann waren in schneller Folge noch drei Babys gekommen. Ihre Eltern taumelten durch einen Morast von Milchfläschchen und stinkenden Windeln. Auf dem Heimweg von der Schule trug Chani nun die Einkäufe, während ihre Mutter den Buggy schob und auf die hinterhertrottende Kleine wartete. Als sie schließlich in die weiterführende Schule kam, holten ihre älteren Schwestern sie ab.
Ihr Vater war der angesehene Rabbi eines kleinen Schtiebl in Hendon mit einer bescheidenen Zahl von Mitgliedern. Er war ein sanfter, dünner, stiller Mann, vertieft in seine spirituelle Welt, der eher geistig als körperlich anwesend war. Sein Bart war lang und federleicht, wie graue Zuckerwatte. Er trug den in seinen Kreisen üblichen schwarzen Anzug, mit Hosenträgern unter dem Jackett, damit nichts rutschte. Ihre Mutter kaufte ihm immer Hosen, die ein wenig zu groß waren, vielleicht in der Annahme, er würde hineinwachsen. Doch während ihre Mutter immer beleibter wurde, schien ihr Vater zu schrumpfen.
Chani vergötterte ihn. Er war ein warmherziger, liebevoller Vater gewesen, strahlend und lachend. Sie erinnerte sich an das Gefühl, wenn er sie schnappte und an seinen dünnen Armen durch die Luft wirbelte. Je größer jedoch seine Familie wurde, desto mehr wurde seine Freude an ihr zu einer Zerstreutheit, die sich anfühlte wie Ablehnung. Er irrte durch das Haus im Nebel seiner nicht enden wollenden Vaterschaft.
Es waren nicht nur die Töchter, die nach ihr kamen. Die Gemeinde hatte ihn ihr gestohlen. Zu Hause, in der vernachlässigten Doppelhaushälfte, klingelte es ständig an der Tür. Ein unaufhörlicher Strom an unglücklichen Ehefrauen, verstörten Vätern und eifrigen Schülern marschierte durch ihren Flur auf der Suche nach Rat. Ihr Vater bugsierte sie eiligst zu seinem Arbeitszimmer, dessen Tür dann über Stunden verschlossen blieb. Als Kind spielte Chani direkt davor, nur um das Auf und Ab seiner Stimme zu hören. Wenn er wieder herauskam, wurde ihre Geduld mit einem Kopftätscheln belohnt. Seine Hosenbeine erkannte sie überall wieder. Wenn sie die Augen schloss, sah sie die gebeugten Schultern und die Samtkappe vor sich, die von seiner Glatze rutschte, wenn er treppabwärts verschwand.
Ihre Mutter war zu einer Maschine geworden, deren Teile abgenutzt waren und knirschten. Früher war sie schlank gewesen, eine geschmeidige junge Frau, fröhlich und flink. Über die Jahre hatte sich ihr Bauch aufgebläht und war wieder erschlafft, wie der Kehlsack eines Ochsenfrosches. Heute war das Licht in ihren Augen verloschen. Sie war eine Fremde geworden, ein erschöpfter Berg erschlafften Fleisches, der ohne Pause stillte, beruhigte, tätschelte oder fütterte.
Ihr Vater hatte seinen Samen immer und immer wieder in den verschlissenen Unterleib seiner Frau gesät. Chani schauderte, wenn sie an die schmerzvollen Geburten dachte, mit denen Baby um Baby auf die Welt gedrängt wurden. Sie schwor sich, dass alles anders sein würde, wenn sie an der Reihe war. Ihre Kinder würden sich nie nach Zuwendung sehnen. Und obwohl sie eigentlich kaum etwas über Empfängnisverhütung wusste, hatte sie sich gelobt, dass sie nach vier Kindern irgendwie aufhören würde.
Doch sie hatte Geduld beweisen und in der Schlange warten müssen, bis für ihre älteren Schwestern passende Gatten gefunden waren. Die temperamentvollen Mädchen, die treppauf, treppab durchs Haus getrampelt waren, sich um das Telefon stritten und abwechselnd liebevoll oder gemein zu ihr waren, waren verschwunden. Familienfotos trudelten ein, aus Brooklyn und Jerusalem. Mit dem Vermehren ihrer eigenen Brut verblassten die Schwestern wie Geister.
Am Telefon waren ihre Stimmen tonlos und rauh. Zum Reden war keine Zeit; keine Zeit, all die Fragen zu stellen, auf die Chani Antworten brauchte. Nun war sie an der Reihe.
Chani trug keinen Schmuck, ein Verbot der Tora. Eine Kalla, eine jüdische Braut, musste ohne Ringe und ohne Ohrschmuck unter dem Hochzeitsbaldachin stehen, als Zeichen, dass die bevorstehende Vereinigung geistig und nicht materiell begründet war. Sie blickte auf ihre Hände herab, die sich leuchtend gegen ihr Gebetbuch abhoben. Die Nägel waren manikürt und in fast durchsichtigem Pink lackiert worden, doch sie waren hässlich und zu kurz. Sie hatte sie bis zum Ansatz abgeknabbert. Ihre Hände wirkten kindlich, die Finger stummelig. Sie vermisste das Lodern ihres Ringes – des glühenden Diamanten, eine Kugel von obszöner Größe, die an ihren feuchten kleinen Fäusten noch größer wirkte. Sie hatte ihn liebend gern aufblitzen lassen und sich angewöhnt, wann immer es ging, mit der linken Hand zu gestikulieren oder auf etwas zu zeigen.
Sie öffnete das Buch, doch die uralten Buchstaben flitzten umher, anstatt stillzustehen. Wo blieben die Männer? Warum hatten sie noch nicht geklopft? Das Singen wurde doch lauter, oder? Sie konnte nicht mehr warten. Aber sie musste. Letztlich hatte sie ihr ganzes Leben lang gewartet. Sie wünschte sich einen Spiegel, um ihr Make-up zu kontrollieren. Vorsichtig stupste sie gegen die Haarspange, die den bodenlangen Schleier hielt und sich in ihre Kopfhaut krallte. Der Schleier strömte über ihre Schultern und fiel ihr in Kaskaden den Rücken hinunter. Saß sie aufrecht? Sie drehte sich um, um zu fragen, als die Tür in ihrem Rahmen erzitterte. Der Stoß ließ ihre Mutter auf die Füße schnellen. Mit quietschenden Schuhen und vor Schmerz pochenden Fußballen schoss Mrs Kaufman zur Tür.
Mit gesenktem Blick trat sie zurück, als die Tür aufschwang. Die beiden Parteien, draußen die Männer, drinnen die Frauen, starrten einander an. Einen Augenblick lang herrschte Schweigen, eine Stille, als lausche jeder auf einen einzelnen Akkord, der in der von Staubpartikeln wimmelnden Luft nachklang.
Baruch fiel fast vornüber in den Raum. Er richtete sich auf, wischte die Brillengläser an seinem Tallit ab und setzte sie wieder auf seine verschwitzte Nase. Jemand gab ihm einen kleinen Schubs, und er wurde weiter hinein in das Zimmer voller berauschender, fremdartiger, weiblicher Aromen befördert.
Und da war sie. Sein Blick traf ihren, und er nahm die Farbe Roter Bete an. Baruch beugte sich ein wenig hinunter, um das Gesicht vor ihm zu begutachten. Ihre großen Augen waren von einem verschmitzten Braun, mandelförmig und kunstvoll mit Kajal betont, die Wimpern lang und glatt. Sie hatte eine schmale, aber gerade Nase und milchfarbene Haut. Das Gesicht wirkte schlau und wachsam, nicht die Maske einer Puppe, sondern lebendig und ausdrucksvoll. Ihr Haar war so kohlschwarz, dass es wie lackiert aussah, und war mit Perlen festgesteckt. Nur wenige Augenblicke nach der Hochzeitszeremonie würde eine Perücke den lakritzfarbenen Glanz verbergen. Sie war sehr anziehend. Er hatte eine gute Wahl getroffen. Doch sollte ein gutes jiddisches Mädchen so zurückstarren? Ein angedeutetes Lächeln umspielte ihren Mund, und er wusste wieder, warum er sie ausgewählt hatte.
Seine Hände zitterten, als er ihr den Schleier über das Gesicht zog. »Amen!«, donnerten die Männer hinter ihm. Sie war das richtige Mädchen – doch wer war sie wirklich? Angesichts dessen, was er gerade im Begriff stand zu tun, wurde ihm schwindelig.
Chani hatte ein Date nach dem anderen gehabt. Alle arrangiert, jeder angehende Bewerber sorgsam erwogen von den Eltern und der Heiratsvermittlerin. Etliche Stunden hatte sie so bei kaltem Kaffee und schwerfälligen Unterhaltungen zugebracht. Den Männern, die ihr gefielen, gefiel sie nicht, und jene, die sie wollten, fand Chani langweilig oder unattraktiv. Nach jedem Treffen rief die Mutter des jungen Mannes an und teilte ohne Umschweife das Urteil mit. Ihre Mutter gab am Hörer höfliche Laute von sich. Dann hängte sie auf, das Gesicht eine einzige geduldige Enttäuschung. Es war schwer genug, abgelehnt zu werden, doch es war entwürdigend, von einem Jungen abgelehnt zu werden, den man nicht einmal wollte. Mit der Zeit verlobten sich alle ihre Freundinnen. Verzweifelt wünschte sie sich, nicht die Letzte zu sein. Sie wollte sich nicht einfach nur mit irgendwem begnügen, doch es wurde immer klarer, dass sie kaum eine Wahl hatte.
Welchen Sinn hatte es, ein unverheiratetes jüdisches Mädchen zu sein? Sie wollte nicht wie Miss Halpern enden, die Religionslehrerin in der Schule, deren langes, blasses Gesicht mit jedem Jahr säuerlicher wurde, den unbedeckten Kopf über verschlissene Lehrbücher gebeugt, das Gekicher jener Mädchen ignorierend, die sie unterrichtete; Mädchen, die an der Schwelle zur Frau standen, voller Lebendigkeit angesichts der Hoffnungen und Versprechungen. Also biss Chani die Zähne zusammen und zeigte Ausdauer.
Nach einer Weile hatte sie alle abgelehnt, selbst jene, die Chani wohlgesinnt waren. Käsige Studenten, der plumpe Lehrer oder der melancholische Witwer – sie konnte sich nicht dazu durchringen, ja zu sagen. Alle höchst fromm, alle auf der Suche nach einem guten jiddischen Mädchen, die ihnen Tscholent kochte und ihnen am Schabbes die Kerzen anzündete. Eine Instantfrau – bloß noch Wasser hinzufügen. Keiner von ihnen interessierte sich dafür, wer sie war.
Abends erforschten Chanis Hände in ihrer unförmigen weißen Unterhose die eigene Nacktheit, und sie genoss den Duft und erspürte die so verschiedenen Stellen ihres Körpers. Sie drückte und streichelte und spürte das flüchtige, elektrisierende Pochen. Doch all das blieb ihr ein Rätsel.
Unsichtbare Grenzen umgaben sie. Als kleines Mädchen hatte sie ihren altmodischen Rock raffen wollen, um mit Beinchen wie stampfenden Kolben dem Bus hinterherzujagen. Stattdessen wurde sie gelehrt zu gehen, nicht zu rennen, die Arme steif an die Seiten gepresst. Sie hatte sich nach Ausgelassenheit gesehnt, doch ihr wurde beigebracht, ihren Gang zu zügeln.
Mit fünfzehn hatte sie ihre Geschwätzigkeit in der Schule in Schwierigkeiten gebracht. Als Reaktion darauf füllte sie alte Schulhefte mit wütenden Kritzeleien. Man hielt sie für frech, aber talentiert. Ihre Noten wurden besser. Alles interessierte sie – zumindest das wenige, das sie in die Hände bekam. Internet oder Fernsehen gab es weder in der Schule noch zu Hause. »Ein Fernseher ist eine offene Kloake im Wohnzimmer«, knurrte ihr Vater. Nach der Schule drückte sie sich im Brent Cross Shopping Centre vor Dixons herum, fasziniert von den flackernden Bildschirmen und grellen Farben einer Welt, in die sie sich hineinstürzen wollte.
Im Unterricht verschandelte dicker schwarzer Filzstift Shakespeares Texte. Brandneue Ausgaben von Julius Caesar waren entweiht worden, hässliche Flecken verbargen die »unangemessene Sprache« darunter. In Kunst, ihrem Lieblingsfach, waren Gauguins Nackte gekonnt kaschiert worden. Da Vincis Zeichnungen sahen aus wie Patchworkdecken. Hinterteile, Brüste und Genitalien zierten weiße Aufkleber.
Einmal war sie dabei erwischt worden, als sie einen der Sticker abpulte, und wurde zur Direktorin beordert. Niemand wusste genau, wie alt Mrs Sisselbaum war. Es wurde gemeinhin angenommen, sie sei schon uralt auf die Welt gekommen und dann auf ihre winzige Gestalt geschrumpft. Ihre aschblonde Perücke war zur Thatcher-ähnlichen Welle frisiert. Das Haar sah aus, als wäre es auf dem Kopf zu Eis erstarrt. Die riesigen Brillengläser vergrößerten ihre Augen unnatürlich, und sie blickte unverwandt zu Chani auf. Mrs Sisselbaum erinnerte Chani an ein Albinokaninchen. Eine solche Neugier sei widernatürlich für ein jüdisches Mädchen. »Mach das noch mal, und du findest dich auf der Suche nach einer anderen Schule wieder, einer Schule für schamlose Mädchen wie dich.« Mit rebellisch klopfendem Herzen war Chani aus dem Büro geflüchtet. Wenn HaSchem die nackte menschliche Gestalt erschaffen hatte, warum verbannte man dann deren Anblick?
Sie lebte unter einer Glasglocke.
Aber schließlich, trotz aller Einwände und Hürden, war es so weit. Schließlich sagte sie ja. Sie kannte ihn nur von den wenigen verkrampften Treffen, bei denen sie sich auf die Zunge gebissen und nur gestelzte Sätze von sich gegeben hatte. Ein nervöser, schlaksiger Jeschiwa-Junge, der jedoch überaus freundlich und aufmerksam wirkte. Sie hoffte, dass sich die Glasglocke endlich hob. Oder dass sie sie zumindest mit jemandem teilen konnte.
Über ihren Köpfen ragte der mitternachtsblaue Baldachin empor; seine goldenen Fransen zitterten, als sich das Hochzeitspaar darunter zusammendrängte. Cremefarbene Rosen und Lilien wie Wachsblüten schmückten jede Stange und verströmten einen schweren Duft. Für einen Augenblick hielt sie an seiner Seite inne.
Es fühlte sich seltsam an, so dicht beieinanderzustehen. So nahe waren sie einander noch nie gekommen. Trotzdem berührten sie sich nicht. Noch nicht. Zwischen ihnen lag nur ein Atemhauch. Chani war sich Baruchs physischer Nähe intensiv bewusst. Sie spürte, wie erhitzt und angespannt er unter seinem schwarzen Anzug und dem Gebetsmantel war. Die schwarze Hutkante verbarg sein Gesicht. Seine Füße zuckten, und er klopfte mit der Schuhsohle leicht auf den Boden. Doch er sah sie nicht an. Schon gar nicht direkt. Sie wusste, dass er sie heimlich beobachtete. Hysterie stieg in ihr auf, und ihrem Mundwinkel entwich ein Quieken. Der Rabbi warf ihr mit missbilligend gesträubten Augenbrauen einen warnenden Blick zu.
Im Kreis, im Kreis und weiter im Kreis. Chani umrundete Baruch und zählte im Kopf bis sieben, während sie mit jedem Schritt die Schranken zwischen ihnen zerbrach. Sie erinnerte sich, wie sie beide zusammengezuckt waren, als ihre Finger sich im Foyer des Hotels versehentlich streiften. Der Zucker hatte sich über den ganzen Tisch verteilt. Wie erstarrt, hatte keiner der beiden Anstalten gemacht, das Malheur wieder in Ordnung zu bringen. Beide befolgten das Schomer Negia – das Gebot der Keuschheit.
Doch heute Nacht würden die Verbote aufgehoben.
Baruchs Fuß krachte auf das Weinglas. Es zersprang in Scherben, und in der Schul verfiel man in lautstarken Freudentaumel. »Masel tov!«, brüllte die Gemeinde. Mit einem Ruck hoben die Männer ihn hoch, und in einem rasenden Tanz wurde er umhergeworfen. Jemand trat ihm auf den Fuß. »Zimmen tov und Masel tov! Masel tov und Zimmen tov!«, riefen sie und stampften. Die Frauen auf der Galerie klatschten. Bärte flatterten, Schultern krachten aneinander, die Männer jauchzten und drehten sich wild um die Chuppa. Schneller und schneller wurde der Reigen. Chani war nur noch ein verschwommener weißer Fleck am Rande seines Blickfeldes. Er versuchte, ihren Gesichtsausdruck zu erkennen, wurde jedoch fortgewirbelt. Süßigkeiten prasselten auf sie nieder, von Kindern geworfen, denn das brachte Glück. Etwas traf ihn hinten am Kopf.
Er war zwanzig Jahre alt. Sein Leben verlief in engen Grenzen: der Druck, erfolgreich zu sein, ein Rabbi zu werden, seinem Vater zu gefallen. Seine schnelle Auffassungsgabe wurde an den Talmud gekettet. Dass er gern Englisch studieren wollte, blieb als frevlerisches Geheimnis in seinem Herzen vergraben. Er hörte auf seinem iPod Coldplay, während sein Vater glaubte, dass die Weisheiten von Rabbi Shlomo seine Ohren füllten. Unter seiner Matratze lagen verbotene Romane – Dickens, Chandler, Orwell –, doch sie reichten ihm nicht mehr aus. Er fühlte sich kontrolliert – es gab keine Erleichterung, kein Entrinnen.
Eines Abends hatte er nach dem Unterricht die U-Bahn genommen. Ihm gegenüber saß eine Frau. Sie war dick. Ihre Bluse war weit aufgeknöpft und enthüllte zwei Hügel sonnengebräunten Fleisches. Er hob seinen Blick zu der Werbung über ihrem Kopf. Dort prangte ein aufreizendes Mädchen im Bikini. Er wusste nicht, wo er hinschauen sollte. Er murmelte ein Gebet, und trotzdem glitten seine Augen immer wieder zurück zu den goldenen Wölbungen vor ihm, die in ihrer Unvollkommenheit alarmierend real waren. Am Hals der Frau kräuselten sich feine Falten wie Krepppapier. Die Brüste hielten ihn mit einer Urgewalt in ihrem Bann. Er ertrank in der dunklen Spalte dazwischen. Die Bahn ratterte über die Schienen. Die Brüste erbebten. Er bekam einen Steifen. Die Frau starrte ihn an. Er drückte das Gebetbuch über seine Erektion. Die Türen öffneten sich, und er hastete hinaus.
Nachts presste er sein Verlangen in die Matratze. Er hoffte, seine Mutter würde den verschwendeten Samen nicht bemerken, wenn sie die Wäsche wusch. Er hatte versucht, sich zurückzuhalten, indem er Handschuhe anzog und zwei Paar Unterhosen, doch nun waren seine Träume eine verbotene Landschaft aus enormen Brüsten, die sich wie Dünen in der Wüste erhoben. Er war einsam und sehnte sich nach etwas, nach jemandem.
Verheiratet. Zehn Minuten zusammen im Jichud-Raum, allein. Plötzlich vermisste Chani das Gedränge weiblicher Körper und das Rascheln von Röcken. Sie wusste weder, was sie tun, noch, was sie sagen sollte, was ungewöhnlich war. Sie versuchte, sich vorzustellen, was die Rebbetzin ihr in dieser Situation raten würde, doch keiner ihrer sanften Sätze kam ihr in den Sinn. Sie hatte zur Galerie der Frauen hochgeschaut. Wo war sie?
Chani konnte Baruch nicht in die Augen sehen. Ihre Freundinnen hatten darüber gekichert, dass diese kurze Pause für die Frischvermählten, direkt nach der Zeremonie, eigentlich dazu da war, es zu tun. Sie wurde starr vor Angst und fragte sich, ob Baruch dasselbe dachte.
Eine Kuchenetagere war aufgestellt worden, Stufe um Stufe glänzten auf Spitzendeckchen Köstlichkeiten aus Blätterteig. Am Fuße standen zwei Flaschen Mineralwasser und zwei Kristallkelche. Weder Chani noch Baruch hatten seit dem vorherigen Tag gegessen oder getrunken. Sie starrten auf die Kuchen. Instinktiv griffen sie nach demselben Stück Mandelkuchen.
»Nein, mach ruhig … Nimm du es. Bitte«, krächzte Baruch.
Chani murmelte einen Dank und einen Segen und nahm einen bescheidenen Bissen. Am liebsten hätte sie alles auf einmal in sich hineingestopft. Sie vermieden Blickkontakt und kauten schweigend.
»Fühlt sich seltsam an, verheiratet zu sein, oder?«
»Mmm.« Sie hatte immer noch den Mund voll.
»Ist es so, wie du es dir vorgestellt hast?«
Heftig schüttelte sie den Kopf. »Ich bin nicht sicher, was ich erwartet habe«, sagte sie. »Es ging so, ähm, schnell.«
»Ja, stimmt. Ich glaube, das geht allen so.«
»Wahrscheinlich.«
»Nun, sie werden jetzt jeden Moment kommen, vielleicht …« Er verstummte und schwieg.
Baruch ahnte, dass er sie küssen sollte, hatte aber keine Ahnung, wie. Er hatte sich sowieso den ganzen Tag nicht die Zähne geputzt, also entschied er sich gegen den Versuch.
Chani spürte, wie sich eine große, knöcherne Hand um die ihre schloss. Sie wünschte, die Hand wäre nicht so schweißnass. Seite an Seite standen sie da und aßen jeder noch ein Stück Kuchen, bis die Tür aufging und sie sich schnell losließen.
In der Woche vor der Hochzeit saß Baruch in Rabbi Zilbermans Büro. Das Zimmer war eine staubige, graue Schachtel. Es gab zwei Türen, beide verschlossen, aber keine Fenster. Der Schreibtisch war von Papieren bedeckt. Bücher füllten die Regale und lagen verstreut auf dem Boden. Es war kaum genug Platz für die beiden Plastikstühle. An der Wand hing das riesige Foto eines verehrten Weisen. Der alte Mann darauf starrte ihn aus milchig-blauen Augen an, die Hände staken wie gefrorene Klauen aus Fledermausärmeln. War er wohl auch nervös gewesen wegen der Hochzeitsnacht?
Unter dem Foto saß Rabbi Zilberman, eine Studie in Schwarzweiß; der Bart ein schlieriges Dunkelgrau, und die Schultern des schwarzen Anzuges voller Schuppen. Seine traurigen grauen Augen betrachteten Baruch. Er stand der Synagoge in Golders Green vor, in die Baruchs Familie ging. Sein runder Rücken, wenn er sich vorne in der Schul zum Gebet beugte, war Baruch vertrauter als das Gesicht. Avromi, der Sohn des Rabbis, hatte dieselbe Schule in Hendon besucht wie Baruch und war der engste seiner wenigen Freunde. Doch das Verhältnis zu Rabbi Zilberman war immer von Ehrerbietung und Formalität geprägt gewesen. Wann immer er Avromi besuchte, hatte der Rabbi seine Anwesenheit mit einem kurzen Nicken und einem kaum angedeuteten Lächeln quittiert. Seine Mundwinkel bewegten sich kurz nach oben, doch der Gesichtsausdruck blieb düster. Wenn er sich höflich nach Baruchs Eltern erkundigt hatte, eilte er weiter, ein Wirbel aus dunkler Wolle und weißem Hemd, der die Jungs schweigend und verlegen hinter sich zurückließ. Bis diese eigenartigen, obligatorischen Tutorenstunden begannen, war der dünne, graubärtige Mann, der ihm nun gegenübersaß, ein Fremder für ihn gewesen.
Der Rabbi begann. »Du bist für alle Bedürfnisse deiner Frau verantwortlich«, sagte er. »Du musst sie ernähren, sie kleiden, ihr ein Dach über dem Kopf bieten und ihr auch sonst alles materiell Notwendige zur Verfügung stellen. Aber du musst ihr auch beim Beischlaf Vergnügen bereiten.«
Baruch rutschte auf seinem Sitz hin und her. Vergnügen. Das hörte sich so einfach an. Er war sogar so weit gegangen, einige private Nachforschungen zu dem Thema in der Swiss Cottage Library anzustellen, weit weg vom Schtetl Hendon. Er hatte sogar seine Jarmulke gegen eine Baseballkappe getauscht, um noch anonymer zu sein. Zu schüchtern zum Fragen, war er durch die Regale gestreift, so verloren wie Moses in der Wüste, bis er die richtige Abteilung gefunden hatte. Dort setzte er sich hin und vertiefte sich in Sexratgeber, aus einer Welt, die so tabu für ihn war, dass sein Herz vor Schuldgefühlen raste. Doch er konnte nicht aufhören. Fasziniert las er weiter und starrte auf die Darstellungen, bei denen er heiße Ohren bekam. Klitoris, stimulieren, Schamlippen, Klimax – der weibliche Körper ergab keinen Sinn.
In der Schule hatte er sich die schmuddeligen Männermagazine angesehen, die von Tisch zu Tisch gereicht wurden. Bei den Bildern wurde ihm ganz wirr im Kopf – die Frauen so schamlos, die Münder schimmernd und offen, ihre Körper geschmeidig und nachgiebig. Wie sollte er sie mit Chani vergleichen, von der er noch nicht einmal die Ellbogen gesehen hatte? Trotzdem war es seine Pflicht, ihr Vergnügen zu bereiten.
»Einen Orgasmus, Rabbi?«, schlug er vor. Als er seinen Patzer bemerkte, wurde er rot, und der Akneausschlag auf seiner linken Wange schien zu leuchten.
Rabbi Zilberman hob eine Augenbraue. »Ja, ich glaube, so nennt man das heute.« Aber er bohrte nicht weiter.
»Wie weiß ich, ob ich meiner Frau Vergnügen bereitet habe?« Er musste es fragen. Das war seine Chance. Sein Mund war trocken, doch die Worte flutschten einfach heraus.
»Mit der Zeit und mit Übung wirst du es irgendwann wissen. Sie sagt es dir vielleicht sogar, aber verschwende keine Zeit damit, über frivole Sachen zu schwatzen. Entscheidend sind die Taten, nicht die Worte. Ein Kind ist eine wundervolle Mizwa. Und Beischlaf mit ihr, während sie schwanger ist, ist eine Doppel-Mizwa!«
Schwanger. Baruch hatte fast vergessen, dass diese mysteriöse Beziehung zu so etwas führen konnte. Er war noch nicht bereit, Vater zu werden.
Der Rabbi schien sich auszudehnen und den Raum auszufüllen. »Und, Baruch, genau so, wie wir nicht wie die Tiere essen, haben wir auch keinen Beischlaf auf ihre Art. HaSchem hat uns mit physischem Verlangen geschaffen, und die Ehe erlaubt uns, dieses Verlangen auf die richtige Art und Weise zu genießen. Nicht wie die wilden Tiere.« Rabbi Zilberman glotzte ihn an.
Wie die wilden Tiere? Aber wie sollte das anatomisch möglich sein? Er erinnerte sich an die Bilder – aber das Hinterteil war doch sicherlich die falsche Stelle? Baruch war sehr erleichtert, dass HaSchem dieses Problem für ihn gelöst hatte.
Doch der Rabbi war noch nicht fertig. »Und wenn deine Frau nidda ist, wirst du dich ihr nicht nähern. Du darfst sie nicht berühren, bis ihre Blutung aufgehört und sie sich in der Mikwe gereinigt hat. Dann könnt ihr wieder Freude aneinander haben, genau wie in der Hochzeitsnacht. Aber deine Frau wird das alles wissen. Sieh die Zeit, in der du keinen Beischlaf mit ihr haben kannst, als Zeit an, in der ihr euch wieder wie Bruder und Schwester kennenlernt; in der ihr alle Meinungsverschiedenheiten regelt und eure Freundschaft vertieft.« Der Rabbi sprach ruhig und ungeniert.
Baruch starrte auf sein Ohr. Es hörte sich alles sehr weise und einfühlsam an, und es war für ihn nichts Neues. Er hatte die Traktate der Familienreinheit in der Gemara studiert, ein Text, so trocken und unnahbar, dass Erotik gar nicht erst aufkommen konnte. Er hatte in der Schule Biologie gehabt, doch die mechanischen Fakten verblüfften ihn immer wieder.
Wie konnte sie da unten jeden Monat bluten? Bei dem Gedanken daran wurde ihm übel.
Zwei Tage vor der Hochzeit. Chani wusch, kämmte und bürstete sich, sie schrubbte sich beinahe wund. Sie saß in der kleinen Kabine und wartete darauf, dass das Licht über der Tür anging. Das Badezimmer war eine Wonne. Makellos sauber, mit glänzenden Oberflächen, ganz anders als zu Hause. Die Wände waren pastellrosa gestrichen. Passende rosa Handtücher lagen ordentlich gefaltet über einer geheizten Stange. Es gab sogar eine nagelneue Zahnbürste und eine frische Tube koschere Zahnpasta, ein winziges Paket Wattestäbchen, eine Nagelfeile, Nagelschere und Pinzette. Alles nur für sie.
An diesem Morgen hatte Chani sich zum letzten Mal innerlich kontrolliert, genau so, wie Rebbetzin Zilberman sie instruiert hatte. Das weiche Bedika-Tuch war strahlend weiß geblieben. Nicht ein Tropfen Blut. Sie war bereit für die Mikwe, das rituelle Bad. Die Rebbetzin hatte sie begleitet und wartete jetzt am Empfang. Chani las den gerahmten Hinweis an der Wand:
Bevor Sie mit den Reinigungsvorbereitungen beginnen, entfernen Sie:
Schmuck
Gebisse und Zahnprothesen (bei Zahnprovisorien fragen Sie Ihren Rabbi)
falsche Wimpern
Verbände, Pflaster
Make-up
Nagellack
Dann schneiden und feilen Sie Hand- und Fußnägel. Putzen Sie Ihre Zähne, spülen Sie den Mund aus, und benutzen Sie die Toilette (wenn notwendig).
Baden und duschen Sie vor dem Tauchbad. Untersuchen Sie sich und entfernen Sie getrocknete Blutreste oder Eiter, getrocknete Muttermilch an den Brustwarzen, Reste von Teig, Nissen oder Kopfläuse, Splitter, Tusche oder Farbreste.
Chani war sich sehr sicher, dass sie getrocknete Muttermilch und Kopfläuse ausschließen konnte. In ein flauschiges Handtuch gehüllt, setzte sie sich auf den Badewannenrand. Flüsternd sprach sie das Gebet vor dem Tewila – dem Eintauchen.
Mögen die Augen meines Ehemannes nur auf mich blicken und meine Augen nur auf ihn … Möge mein Mann sich meinetwegen glücklicher schätzen als wegen jedes anderen Segens in der Welt …
Sie stellte sich vor, dass hinter den Türen der anderen Kabinen auch junge Bräute warteten, genau wie sie. Wissen konnte man es nicht. In der Mikwe war man immer allein.
Bing! Die Lampe ging an. Chani sprang auf die Füße, kontrollierte, ob das Handtuch richtig saß, und öffnete die Tür. Draußen schimmerte der Mikwe-Pool einladend blau. Die Oberfläche des tiefen Wassers kräuselte sich und warf glitzernde Reflexe gegen die weiße Decke und die weißgefliesten Wände. Er war größer, als sie gedacht hatte, und füllte den leeren Raum fast vollständig aus.
»Hallooo, Schätzchen, mach dein Handtuch auf, und lass mich dich ansehen.«
Chani machte einen Satz. Hinter ihr stand die MikweFrau. Sie war eine schrumpelige, alte Irre. Ihr Haar war in ein verblasstes blaues Kopftuch gehüllt. Sie trug Clogs und dunkelblaue Leggins. Ihr Lächeln war warm und ehrlich, ihre Blicke jedoch messerscharf.
Chani öffnete das Handtuch und wurde einer aufmerksamen Musterung unterzogen.
»Was du bist für eine süße, kleine Braut«, flötete die Mikwe-Frau. Chani fühlte sich bloßgestellt. Ihr ganzes Leben lang hatte sie ihre Nacktheit vor neugierigen Augen verborgen, und nun gab sie sie einer vollkommen Fremden preis.
Die Mikwe-Frau bat sie, sich umzudrehen, damit sie den Rücken nach ausgefallenem Kopfhaar absuchen konnte.
»Nägel, Schätzchen?«
Chani zeigte ihre Hände vor. Die Mikwe-Frau inspizierte jeden der abgebissenen Nägel. Dann besah sie sich die Handinnenflächen.
»Füße?« Chani hielt jeden Fuß hoch.
»Und hast du deine Haare da unten gekämmt?«, fragte die Mikwe-Frau.
Chani war nicht sicher, was um alles in der Welt sich dort verstecken sollte, also nickte sie pflichtschuldig.
»In Ordnung, Schätzchen, also rein mit dir. Weich dich richtig ein, meine Kleine. Tauch gaaanz unter.«
Drei Stufen, dann zwei Schwimmzüge, und sie war in der Mitte des Pools. Das Wasser war warm. Sie sank hinab, und die Oberfläche schloss sich über ihrem Kopf. Ihr Herz pochte in den Ohren. Als sie wieder aufstieg, erkannte sie verschwommen zwei dunkle Gestalten am Rande der Mikwe. Sie tauchte auf und schnappte nach Luft. Als sie die Augen öffnete, sah sie Rebbetzin Zilberman auf sich herablächeln. Daneben stand die Mikwe-Frau, mit demselben verzückten Lächeln auf dem Gesicht.
Chani umklammerte ihren mageren Busen mit den Händen. Sie hatte nicht erwartet, dass die Rebbetzin hereinkam und zusah. Eine kleine Luftblase schoss hinter ihr auf. Sie betete, dass es niemand bemerkt hatte.
Sanft sagte die Rebbetzin zu ihr: »Chani, du musst dreimal ganz untertauchen und dann den Segensspruch aufsagen. Nicht die Beckenwände berühren, denn dann werden deine Handflächen nicht vollständig gereinigt. Spreize deine Finger und Zehen so weit auseinander, wie du kannst. Lass das Wasser jede Spalte waschen. Bist du so weit?«
Chani nickte und sank tief in die Mikwe. Sie wusste, wenn eine Frau unter Wasser betete, flogen ihre Gebete direkt zu HaSchem. Sie ließ sich zwischen Zeit und Raum treiben. Sie öffnete die Augen, das Wasser brannte nicht. Es war rein und natürlich.
Bitte, HaSchem, mach, dass es in meiner Hochzeitsnacht nicht weh tut. Bitte, HaSchem, lass es leicht und schnell vorübergehen.
Sie tauchte noch zweimal unter. Schließlich kam sie an die Oberfläche und sagte den Segensspruch. Wiedergeboren. Sie war bereit zur Hochzeit.
2Die Rebbetzin
November 2008 – London
Ein weiterer Tag. Ein weiteres Tauchbad. Eine weitere Braut.
Die Rebbetzin und Chani gingen an den Bögen der Eisenbahnbrücke entlang bis zum Ende der Gasse. Der Himmel über ihnen war stürmisch und grau, und ein kalter, peitschender Wind verhedderte ihre langen Röcke. Das geduckte, flache Mikwe-Gebäude befand sich neben einer Autowerkstatt und einem Parkplatz. Versteckt und unauffällig, ohne ein Hinweisschild, doch die Frauen der Gemeinde wussten, wo es war, und schätzten die abgeschiedene Lage.
»Wie wäre es, wenn du Baruch in eurer Hochzeitsnacht ein kleines Geschenk machst, als Symbol für den Beginn eures neuen Lebens?«
»Was denn?«
»Eine kleine Schachtel Pralinen oder neue Manschettenknöpfe? Oder ein neues Siddur, auf den sein Name geprägt ist?«
»Aber er bekommt doch mich. Bin ich nicht genug?«
»Ich bin sicher, dass du mehr als genug bist, Chani – ich habe nur einen Vorschlag gemacht.«
Die Rebbetzin lächelte, doch sie hatte die Angst in den Augen des Mädchens gesehen. Das war auch kein Kunststück. Sie hatte schon so vielen von ihnen beigebracht, wie man die Tage und Nächte zählte und wie man sich selbst für die Mikwe vorbereitete. Selbst diejenigen, die panische Angst vor dem Wasser hatten, die nicht schwimmen konnten – selbst sie hatten sich irgendwann gefügt. Und es war gut gewesen. Mehr als gut. Die Bräute tauchten träumerisch wieder auf und lächelten sanft, während das Wasser ihre bleiche, weiche Haut herabrann und sie züchtig die Oberschenkel unter dem dunklen Haardreieck zusammenpressten.
Aber Chani war anders. Ihr fehlte die einfältige Passivität, die für viele andere Mädchen so typisch war. Sie sehnte sich nach Antworten, doch die Rebbetzin war sich nicht sicher, ob es ihr zustand, sie zu geben. Sie dachte an Mrs Kaufman, Chanis Mutter. Sie war nicht sonderlich überrascht gewesen, als die Frau angerufen hatte und atemlos erklärte, sie schaffe es heute nicht. Die zweitjüngste Tochter sei die Treppe hinuntergefallen und müsse ins Krankenhaus – ob die Rebbetzin Chani bitte in die Mikwe begleiten könnte? Als Chani ankam, war sie niedergeschlagen gewesen, und die Enttäuschung spiegelte sich in ihren Augen wider.
Und wer würde nun Chanis Fragen beantworten? Die Rebbetzin entschied sich zu reden. Es war ihre Pflicht. »Chani, beim ersten Mal wird es ein bisschen weh tun, aber lass es einfach geschehen. Versuch dich zu entspannen und atme tief und langsam. Mit der Zeit wird euer Beischlaf schöner. Es ist für euch eine ganz neue Welt. Die Bedürfnisse eines Mannes überwiegen oft gegenüber denen der Frau. Wenn du nidda bist, kannst du dich ausruhen. Aber eine Frau kann dennoch großes Vergnügen bei ihrem Mann finden, erforscht einander …«
Die Rebbetzin hatte schon zu viel gesagt und war peinlich berührt. Chani starrte sie an. Im Licht des Brückenbogens glänzten ihre Augen. Ein Zug zerriss die Luft über ihnen. Die Rebbetzin dankte HaSchem für die willkommene Ablenkung.
Schweigend gingen sie weiter, jede in ihre eigenen Gedanken vertieft. Die Rebbetzin dachte an Baruch. Ein talentierter Jeschiwa Bocher und ein wirklich guter Fang. Vielleicht ein bisschen neurotisch, das musste man zugeben, aber welcher Junge war das nicht? Er war mit Avromi befreundet, ihrem Ältesten. Sie waren auf dieselbe Schule gegangen, genau genommen in dieselbe Klasse. Baruch kam aus einer guten, reichen Familie. Seine Eltern besuchten regelmäßig die Schul ihres Mannes. Es war auch insgesamt eine gesunde Familie. Ein wenig Diabetes väterlicherseits, aber wer hatte heutzutage keinen Diabetes? Chanis Familie dagegen war arm, aber von hervorragender Abstammung; voller Zaddikim und daher traditioneller. Aber leider zu viele Töchter. Die arme Mrs Kaufman, was für Kopfschmerzen es ihr bereiten musste, Ehemänner für sie zu finden. Wie sehr sie sich nach einem Sohn gesehnt haben musste.
Die Rebbetzin war über den Schidduch etwas überrascht gewesen. Nicht nur wegen des so unterschiedlichen familiären Hintergrundes, Chani war auch nicht die formbare Schwiegertochter, die Mrs Levy im Sinn gehabt hatte. Es fing damit an, dass das Mädchen nicht die Sem besucht hatte, obwohl das in den Augen der Rebbetzin kein unüberwindbares Hindernis darstellte. Mrs Levy jedoch hatte es ziemlich gewurmt. Chani war außerdem recht temperamentvoll und hatte an der Schule einen gewissen Ruf, aber andererseits wurde ein lebendiges, neugieriges Mädchen schnell einmal auf diese Weise von der Gesellschaft gebrandmarkt. Warum hatte Baruch sie also gewählt?
Aber noch mehr irritierte sie, dass die Eltern der Verbindung schließlich zugestimmt hatten. Die Rebbetzin wusste, dass Mrs Levy absolut dagegen gewesen war. Waren sie von Mrs Gelbman überredet worden? Die Frau war eine geschickte Eheanbahnerin und machte selten Fehler. Vielleicht kannte sie auch ein passendes Mädchen für Avromi. Ein gutes, heimisches Mädchen aus einer entsprechenden Familie. Ja, das war genau das, was sie brauchten. Oder war es dafür schon zu spät? War er über diese Art Mädchen schon hinweg? Ihre Stimmung wurde düsterer, als sie an ihren verwirrten, verlorenen Sohn dachte.
Sie passierten die Werkstatt und wurden wie üblich von den Mechanikern begafft. Zwei fromme Frauen in wenig eleganter Kleidung, deren lange, dunkle Röcke sie beim Gehen behinderten. Chanis nasses Haar hatte einen Fleck auf ihrer Jacke hinterlassen. Wie mochten sie auf die Außenwelt wirken? Auf Männer, die es gewohnt waren, dass sich ihnen weibliche Körper zur Schau stellten?
Die Rebbetzin zog ihre Strickjacke fest um sich zusammen, verschränkte die Arme und eilte weiter. Sie ging erhobenen Hauptes und schaute nicht nach links oder rechts. Sollten sie doch starren. Es gab nichts zu sehen.
An der nächsten Kreuzung blieben sie stehen. Die Rebbetzin umarmte Chani sanft. »Melde dich vor Schabbes bei mir, wenn du irgendetwas brauchst«, sagte sie.
»Aber Sonntag sehe ich Sie doch, oder?«
Die Rebbetzin löste sich von Chani und hielt sie eine Armeslänge von sich fort. Forschend blickte sie das kleine, verunsicherte Wesen vor sich an.
»Natürlich werde ich da sein. Nun hör auf, dir Sorgen zu machen, und genieße diese letzten paar Tage zu Hause bei deiner Familie. Ich bin für dich da, wenn du mich brauchst, Chani.«
Und dann waren sie jede ihrer Wege gegangen. Langsam schritt die Rebbetzin die Golders Green High Street hinauf. Sie fühlte sich wie eine Heuchlerin, weil sie seit Monaten nicht mehr in der Mikwe gewesen war. Sie hatte ihre Gründe. Die Wärterin hatte auf ihren Bauch gestarrt, doch die Rebbetzin hüllte sich in ihre weiteste, dunkelste Kleidung, die sie in eine riesige Krähe verwandelte. Sollte sie doch denken, was sie wollte.
Um sie herum dröhnte der Verkehr. Ein Chassid, in tristes Schwarz gekleidet wie ein Gespenst aus der polnischen Vergangenheit, brabbelte Jiddisch in sein Handy und schlängelte sich zwischen zwei roten Bussen durch. Als er weiterhastete, blitzten seine wollenen Strümpfe auf. Einer der Busfahrer musste voll bremsen und hupte. Der Chassid ignorierte ihn, hüpfte auf den Bordstein und begann, sich auf dem überfüllten Bürgersteig geschickt den Weg durch die Menge zu bahnen, wobei er immer noch aufgebracht redete und seine Schläfenlocken im Rhythmus seines abgehackten Gangs wippten. Mit der rechten Hand umklammerte er eine gutgefüllte Plastiktüte, in der sich Gebäck oder eingelegte Heringe befanden. Er sah zu Boden, um Blickkontakt mit Frauen zu vermeiden, und hastete und hastete, denn um all das zu tun, was HaSchem befahl, war nie genug Zeit.
Die Welt der Gojim zog achtlos an ihm vorüber. Manche starrten ihn kurz an, doch die meisten Nichtjuden waren an die Hut und Perücke tragenden Mitglieder der Chassiden-Gemeinde in ihrer Mitte gewöhnt. Die Rebbetzin beobachtete, wie er in einem Judaika-Laden verschwand. Zwei japanische Frauen blieben am Eingang eines chinesischen Restaurants stehen, um sich zu unterhalten. Hinter ihnen hockten kopflose, plumpe Pekingenten auf ihren Spießen und glänzten in all ihrer nicht koscheren Herrlichkeit unter den Wärmelampen. Ein älterer Farbiger, in einen blauen Wollmantel gehüllt, schob sich mit einem Weidenkorb an einem Obdachlosen vorbei, der, abgestumpft von Langeweile und Verzweiflung, am dunklen Fenster einer Pizzeria lehnte und die Big Issue verkaufte. Sie betrat das jüdische Viertel.
Vorbei an den kleinen koscheren Cafés. Vorbei an dem Bäcker Carmelli. Drinnen schoben und drängelten die Leute und reichten Geld über den Tresen im Tausch gegen pralle Tüten voll süßen, warmen Brots und Mohn-Bagels. Die Tür öffnete sich, und ein warmer, stickiger Teiggeruch strömte nach draußen. Zimt-Rugelach, Sirup-Baklavas, Donuts, aus denen die Marmelade quoll, Marzipanrollen, knusprige Florentiner, riesige Makronen, jede mit ihrem eigenen Kirschnippel obenauf. Die Tabletts leerten sich schnell. In ein paar Stunden würde der Ansturm vorbei sein und nur noch Kassenzettel und fettige Servietten zurücklassen, die den Rinnstein verstopften. Es war Freitag, und das bedeutete nur eines.
Schabbes. In sechs Stunden war es so weit, und die Rebbetzin hatte noch keinerlei Vorbereitungen getroffen. Und Schabbes wartet auf niemanden. Am siebten Tag ließ HaSchem von all seiner Arbeit ab und segnete den siebten Tag und erklärte ihn für heilig – ein Tag des Ausruhens. Er begann exakt um 16:12 Uhr. Um 16:13 Uhr durfte sie noch nicht einmal mehr einen Lichtschalter bedienen. Selbst das wurde als Arbeit angesehen. Sie musste zehn Leute verköstigen, fünf davon Gäste. Sie hatte noch nicht einmal Challot gebacken. Es waren noch ein paar honigfarbene, geflochtene Laibe übrig. Sollte sie zwei kaufen?
Die Gojim trödelten vorbei, ohne den wachsenden Druck, unter dem sich ihre jüdischen Mitmenschen befanden, auch nur zu bemerken. Die Frauen waren bereits in den Küchen und bereiteten das abendliche Festmahl vor. Eine Horde Schulmädchen schwatzte und lachte und drückte sich um den unvermeidlichen Berg an Aufgaben, der zu Hause auf sie wartete. Die Rebbetzin ging weiter und überquerte die Straße. Sie nickte vorbeieilenden Bekannten kurz zu. Die Hektik des Schabbes erfüllte die Luft. Vorbei an Yarok, dem Lebensmittelhändler, dessen Früchte in obszönen Farben strahlten und eine lange Schlange von Kunden in Versuchung brachte. Die Möhren sahen aus wie riesige Finger, die man in einer Kiste aufgehäuft hatte. Sie brauchte Kartoffeln und Zwiebeln für den Tscholent, doch sie hielt nicht an.
Kosher Kingdom lockte. Das Supermarktfenster war voller neonfarbener Angebote. Sie hatte weder Kiddusch-Wein für die Segenssprüche noch Knödel für die Hühnersuppe. Doch die Rebbetzin bog in ihre kleine Straße ab und trottete die ruhige Gasse hinunter. Man konnte sie hinter der Ligusterhecke nicht sehen, doch sie spürte, wie die Blicke ihr folgten. Die Gardinen zuckten. Da geht die Rebbetzin Zilberman, murmelten die Münder. Sollten sie doch murmeln. Die Mülltonnen quollen über, die Vorgärten waren entweder kleine Urwälder oder hässliche kahle Quadrate aus praktischem Beton. Ulmen, ihrer Blätter beraubt, streckten ihre amputierten Glieder Richtung Himmel und boten die einzige Abwechslung im Grau des Pflasters und der sich wiederholenden bescheidenen Doppelhäuser. Die Häuser lehnten sich aneinander, niemand kümmerte sich darum, wie es hier aussah. Wer hatte die Zeit und Energie dazu, wenn es so viele wichtigere Dinge zu tun gab?
Die Haustür fiel hinter ihr ins Schloss. Der dunkle Korridor schien sie einzuhüllen, der vertraute Geruch beruhigte sie. Für den Moment hatte sie das Haus für sich allein; ihr Mann war in seinem Büro in der Schul, und Michal und Moishe waren noch nicht aus der Schule zurück. Sie hatte keine Ahnung, wo Avromi stecken könnte, und unterdrückte den wohlbekannten Anflug von Unruhe. Um ihn würde sie sich später Sorgen machen.
Frieden. Stille. Das Haus seufzte, als sie die Schuhe abschüttelte und auf Strümpfen durch den Flur ging. Jeder Schritt hinterließ einen Schweißabdruck auf dem staubigen Holzboden.
Nach der Dunkelheit im Flur blendete sie das Sonnenlicht in der Küche. Sie blinzelte. Die Kühlschränke brummten, der Eisschrank für das Fleisch klickte und gurgelte. Fleisch links. Milch rechts. Der Fleischkühlschrank glänzte silbern, der Milchkühlschrank war weiß. In getrennten Schränken waren die Töpfe und Teller aufgereiht wie gegnerische Truppen, bereit zum Angriff. Die Fleischteller hatten goldene, gewellte Ränder, während ihre Feinde im Milch-Camp in Grün getarnt waren. In separaten Besteckschubladen schliefen unruhig die Fußsoldaten. Die Milchlöffel waren in ihrem eigenen Kasten sicher aufeinandergestapelt. In der Dunkelheit nebenan funkelten die Fleischmesser in dem Wissen, dass ihre Stunde noch kommen würde.
Sie öffnete den Fleischkühlschrank. Das Loch in einem riesigen Hühnchen klaffte wie ein höhnischer Mund.
Grill mich! Iss mich!, kreischte der Mund.
»Grill dich selbst«, murmelte die Rebbetzin und knallte die Kühlschranktür zu.
Ihre Perücke juckte. Sie brauchte ihre Stricknadel, um darunter herumzustochern und sich gründlich die heiße, fest umschlossene Kopfhaut zu kratzen. Mit schweren Schritten nahm sie die Treppe nach oben, eine Hand glitt das angeschlagene Geländer entlang. Durch die dünne Strumpfhose spürte sie den ausgetretenen Teppich.
Das Schlafzimmer war unordentlich. Es roch nach Morgenatem und Gleichgültigkeit. Eine Socke hier, eine Socke dort – ihr Mann war zu müde gewesen, sie in den Wäschekorb zu stecken. Der Rock von gestern lag zerknüllt am Boden. Die Vorhänge waren immer noch zugezogen. An einigen Stellen hatte sich der schwere Stoff von den Haken gelöst und hing ungleichmäßig herunter. Lichtstreifen liefen über die Zimmerdecke. Mit einem Ruck zog sie die Vorhänge zur Seite und riss ein Fenster auf.
Besser. Sie bekam wieder Luft.
Der Kleiderschrank stand offen. Auf ihren Bügeln schaukelten die Anzüge ihres Mannes leicht hin und her. Sie gab ihnen einen Schubs und ließ sie tanzen wie fröhliche Chassidim auf einer Hochzeit. Alle schwarz, alle derselbe Schnitt. Die dunkelblauen Nadelstreifenanzüge, die dunkelgrauen Anzüge und die aus sommerlichem Leinen hatte ihr Mann vor Jahren aussortiert.
Die Rebbetzin seufzte. Auf ihrer Seite des Kleiderschranks sah es nicht anders aus. Die üblichen langen trostlosen Röcke waren in einer prickelnden Palette von Dunkelblau, Schwarz und Taubengrau hintereinander aufgereiht. Ihre Schuhe standen paarweise brav darunter; es waren alles die gleichen weichen schwarzen italienischen Slipper; bis auf ein weißes Paar für den Sommer. Die Rebbetzin dachte wehmütig an all die Schuhe, die sie früher getragen hatte. Die lasterhaften Pikes mit ihren glänzenden Silberschnallen; rote Lackpumps, in denen sie kaum gehen konnte; freche gelbe Turnschuhe mit neongrünen Schnürsenkeln, Flipflops und kippelige Korkplateaus.
Die Frisierkommode quetschte sich gegen das Erkerfenster. Dort ruhten ihre Perücken auf den Ständern, auf harten, gesichtslosen Ballons. Sie setzte sich vor den Spiegel. Er reflektierte ihr Bett, ein riesiges Mahagoni-Wunder, dass sich in zwei Hälften teilen ließ, wenn sie nidda war. Dann wurde es auf geölten Rollen fast geräuschlos auseinandergeschoben. Unter der schweren Matratze verbarg sich ein Reißverschluss, den man nicht fühlte, wenn er geschlossen war. Es war ein Hochzeitsgeschenk ihrer Eltern gewesen. Ihre Großzügigkeit hatte sie überwältigt, denn ein Bett wie dieses musste einige Tausend gekostet haben. Auch ihre Einfühlsamkeit hatte sie sehr bewegt.
Das Bett war inzwischen seit Wochen geteilt, und die Kiefernholzkommode dazwischen war von einer dünnen Staubschicht bedeckt.
Vor einigen Wochen. Leichte Tritte. Den ganzen Tag lang. Die Rebbetzin war vierundvierzig und wusste, dass dieses Kind ihr letztes sein würde. Die Schwangerschaft war ein Geschenk. Nach Moishe hatte sie es nicht mehr für möglich gehalten. Sein Körper hatte sich seinen Weg durch sie hindurchgerissen, und sie hatte angenommen, die Schäden wären unwiderruflich. Eine Weile glich die Unfruchtbarkeit einer Erlösung, bis die alte Sehnsucht heftiger zurückkehrte als vorher und viele lange Jahre unerhört blieb. Doch nun schwoll ihr Bauch erneut an, wie Teig in einer Blechbüchse. Die alten Schwangerschaftsstreifen spannten sich wie Gummibänder. Grenzenlose Freude ließ ihr Herz höherschlagen, ließ die Falten in ihrem Gesicht weich und ihr Lächeln strahlender erscheinen. Sie hatte die alten Ängste beiseitegeschoben, das Reißen und Zerren in ihrem Inneren, das Bersten ihres Körpers. Es war gewesen, als würde man sterben.
Dieses letzte würde sie zur Welt bringen, und wenn sie dabei draufging.
Etwas stimmte nicht. Das Bett war nass. Die Rebbetzin setzte sich auf. Ein Krampf. Dann kehrte der Schmerz als dumpfes Pochen zurück.
»Chaim? Chaim!«
»Wasisn?«, grummelte Rabbi Zilberman.
»Etwas stimmt nicht – das Baby – es fühlt sich alles ganz nass an –«
Eilig knipste der Rabbi das Licht an und stieß die Bettdecke zur Seite. Ein dunkler Fleck hatte sich zwischen den Beinen seiner Frau ausgebreitet. Sie lagen darin.
Er machte einen Satz aus dem Bett und starrte an seinem Pyjama hinab. Die Flüssigkeit war durch das dünne Material gedrungen und klebte an seiner Haut. Er zitterte. Ihr Blut war nidda, und deshalb war sie es auch. Im Notfall würden doch sicher alle Gesetze aufgehoben, oder? Er war hin- und hergerissen. Ein Gesetz verbot ihm, sie zu berühren, und ein anderes besagte, dass er um jeden Preis ihr Leben retten musste. Er wusste nicht, was er tun sollte. Das war vorher noch nie passiert. Das hier war Frauensache.
»Wa-was sollen wir tun?«, stotterte er.
Ihr Baby sickerte aus ihr heraus, und Chaim fragte sie, was sie tun sollten. Was für ein Ehemann. Sie wuchtete sich auf alle viere, ihre Hände wühlten in den Laken. Wo war es? Ihre Finger berührten etwas Klebriges.
»Ruf einen Krankenwagen!«, schnauzte sie. Nein. Nein. Bitte, HaSchem. Aber sie wusste, dass sie das Baby verloren hatte.
Rabbi Zilberman stand stocksteif. Welches Gesetz war zu befolgen? Ihm wurde übel von all dem Blut. Er musste ihr helfen, aber seine Beine versagten ihren Dienst. Er blieb, wo er war.
»Chaim, tu etwas!«
»Ich werde – ich werde Hatzolah anrufen«, murmelte er.
Er stolperte zum Telefon auf dem Nachttisch und wagte dabei nicht, auf das Bett zu sehen. Er nahm den Hörer. Doch er konnte sich nicht an die Nummer des Chassidim-Unfalldienstes erinnern. Die Rebbetzin stöhnte.
»Ich weiß die Nummer nicht mehr!«
Seine Frau drehte sich um und starrte ihn an. Sie rollte über das Bett, riss ihm den Hörer aus der Hand und wählte 999. Eine Woge von Schmerz erfasste sie. Ihre Oberschenkel fühlten sich warm und nass an. Dazwischen schlabberte das Nachthemd, der Stoff so dunkel, dass er schwarz wirkte.
»Hallo – hallo – ja, ich brauche einen Krankenwagen. Ja, er ist für mich. Für mein Baby. Nein, keine Wehen – bitte sofort. The Drive, Nummer sechsunddreißig, Golders Green. Mein Name – ja – Rebbetzin – ich meine, Mrs Zilberman – danke, ja – werde ich – danke.«
Sie ließ sich zurücksinken und wartete. Es gab nichts mehr zu tun. Ihr Ehemann stand immer noch da, in Unentschiedenheit erstarrt.
Chaim fühlte sich wie ein Idiot. Wie egoistisch war er gewesen, sich um die Gesetze zu sorgen. Das Leben eines anderen zu retten sollte immer an erster Stelle stehen. Instinktiv war er vor ihrem Blut zurückgewichen, doch es war mehr als das. Es hatte ihn angeekelt. Ihr Bauch war so glatt gewesen, so perfekt, eine sanfte kleine Kugel. Das Leben, sorgsam verborgen, hatte sich aus ihr ergossen und solch ein Chaos erzeugt. Doch diese Geborgenheit war nur eine Illusion gewesen und die nasse, schmutzige Wahrheit ihres Leibes zu viel für ihn. Vom Ekel abgesehen, hatte er Angst. Mehr noch als der Verlust seines Kindes schien von dem Blut eine unheilvolle Bedeutung auszugehen, die sein Verstand nicht fassen konnte.
Er hasste sich selbst angesichts so viel Feigheit. Warum hatte er nicht einfach 999 gewählt? Es war ein furchtbarer Fehler gewesen, er hatte die Kontrolle verloren, und nun musste er die Sache wieder geradebiegen. Er versuchte, im Kopf eine Entschuldigung zu formulieren, doch es hatte keinen Sinn. Die Worte hörten sich pathetisch an.
Er schob sich näher ans Bett.
»Rivka –«
Mehr als ihren Namen brachte er nicht heraus. Stattdessen streckte er eine feuchte Hand aus und tätschelte ihre Schulter. Sie starrte zu ihm hoch, ihr Mund vor Abscheu zu einer schmalen Linie zusammengepresst.
Sie schlug seine Hand fort.
»Rivka – ich weiß nicht, was über mich gekommen ist – die Weisen sagen –«
»Es ist mir egal, was sie sagen! Das ist jetzt nicht der Zeitpunkt –« Sie verzog das Gesicht vor Schmerzen. »Bring mir ein Handtuch – zwei … und hol mir aus meiner Kommode ein frisches Nachthemd.«
Die Rebbetzin Zilberman sackte tiefer ins Bett. Er gehorchte der Anweisung, erleichtert, sich nützlich machen zu können. Mit einem Haufen Handtücher im Arm kam er aus dem Badezimmer. Er riss sich zusammen, um mit dem Massaker umgehen zu können, und zog die Bettdecke seiner Frau ab. So viel Blut. Wer hätte gedacht, dass so ein winziges Baby die Ursache für so viel Blut sein konnte? Er hätte bei dem Anblick am liebsten die Augen geschlossen, doch er zwang sich weiterzumachen. Sie öffnete die Beine, und er schob ein aufgerolltes Handtuch dazwischen. Dann hievte er sie hoch. Das Nachthemd war ihr über die Hüften gerutscht. Sie hob die Arme, und er zog es ihr über den Kopf. Dann streifte er ihr ein sauberes über und half ihr in die Ärmel.
Er war dankbar, wenigstens etwas für sie tun zu können, obwohl er sich immer noch zutiefst unbehaglich fühlte. Aber es war nicht genug. Es würde nie genug sein.
»Was kann ich noch tun?«
»Nichts. Zieh dich an – sie werden jeden Augenblick hier sein«, presste sie hervor.
»Ja, okay.«
Seine Stimme bebte. Rabbi Zilberman fühlte sich ohnmächtig angesichts des schmerzhaften weiblichen Mysteriums, das sich vor ihm enträtselte. Noch vor wenigen Minuten war sie schwanger, und alles war gut gewesen. Es war schwer zu verstehen, wie das Glück sich so plötzlich auflösen konnte. Das Kind musste wahrlich heilig gewesen sein, wenn HaSchem es zurückrief, noch bevor es seinen ersten Atemzug getan hatte. Sein Kind wäre vielleicht ein großer Zaddik oder ein großer Rebbe geworden. Er hätte es gern gesehen, sein winziges Gesicht, wie es sich zusammenzog, und sein Sohn dann zu schreien begann. Ihn im Arm gehalten. Denn er war sicher, dass es ein Sohn gewesen war.
Die Erinnerungen an einen früheren Verlust kehrten zurück, schneidend und scharf wie ein Schlachtermesser, und der Geist eines anderen Kindes hing zwischen ihnen in der Luft, ein kühler Hauch.
Sie sah zu, wie er sich anzog. Es gab nichts mehr zu sagen. Er hatte sie im Stich gelassen, seine Frau, seine geliebte Gefährtin und beste Freundin in all diesen Jahren. Vielleicht war sie zu alt gewesen, um ein weiteres Kind auszutragen, doch Isaac wurde geboren, als Sarah schon neunzig war. HaSchem hatte es möglich gemacht.
Als er sich umdrehte, waren ihre Augen geschlossen. Die Augenlider hoben sich violett von ihrer blassen Haut ab. Sie bewegten sich zuckend, doch ihr Gesicht glich einer Maske. Erst in diesem Moment bemerkte er, dass ihr Haar unbedeckt war. Sie jetzt zu belästigen schien lächerlich, doch ihre Unanständigkeit störte ihn. Andere Männer würden ihr Haar sehen. So ein Unsinn. Was machte das schon – sicher würde HaSchem –
Die Klingel schellte, und er rannte zur Tür.