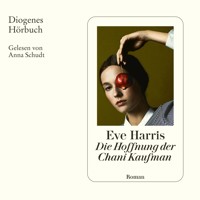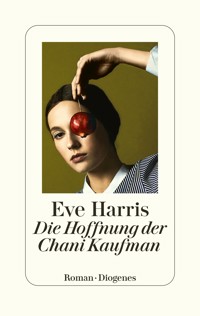
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Chani hat es geschafft. Sie hat den Mann geheiratet, den sie sich ausgesucht hat – nicht selbstverständlich, wenn man in einer jüdisch-orthodoxen Gemeinde lebt. Und was nun? ›Seid fruchtbar und mehret euch‹, natürlich, aber genau das funktioniert eben nicht. Chani ist verzweifelt, denn ihr Mann Baruch kann sie verstoßen, wenn sie ihm keine Nachkommen schenkt. Und wer wäre sie dann noch unter ihresgleichen? Zwischen Rabbi, Fruchtbarkeitsklinik und ihrer Schwiegermutter muss Chani ›HaSchem‹ ein Schnippchen schlagen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 536
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Eve Harris
Die Hoffnung der Chani Kaufman
Roman
Aus dem Englischen von Kathrin Bielfeldt
Diogenes
1
Chani. Baruch.
November 2009 – London
Erst hatte sie auf einen Mann gewartet, nun wartete sie auf ein Baby. Da saß sie, in diesem Foyer, umgeben von Fremden, die alle auf dasselbe hofften. Auf das Zusammentreffen von Sperma und Ei, auf einen winzigen Haufen Zellen, der sich zur richtigen Zeit am richtigen Ort einnistete. Das Wunder der menschlichen Fortpflanzung war Chani und Baruch versagt geblieben. Etwas war schiefgegangen. Bei ihnen war das Mysterium des Lebens ins Straucheln geraten.
Also wartete sie, ein gutes jiddisches Mädchen, dass ihr guter jiddischer Ehemann von seinen Bemühungen zurückkehrte. War es sein Fehler oder ihrer? Wessen Körper wohl schuld war? Tief im Inneren wusste sie, dass es ihrer war. Sie musste so abscheulich gesündigt haben, dass HaSchem sie unfruchtbar gemacht hatte. Unfruchtbar – was für ein hässliches Wort. Es hallte wie das Echo eines Albtraums in ihrem Kopf wider. Sie hörte es ununterbrochen – ein leises, entschiedenes Flüstern, das all ihren Hoffnungen, all ihren Träumen ein Ende setzte.
HaSchem wollte nicht, dass Baruch und sie hingingen und sich vermehrten. War es wegen irgendeines spirituellen Irrtums, der ihr unterlaufen war? Sie hatte doch auf die richtige Anzahl von Tagen geachtet, bis sie in die Mikweging. Baruch und sie hatten doch immer auf die Reinheit der Familie gehalten.
Eine solche Angst hatte sie noch nie gespürt. Ein unverheiratetes Mädchen war wie ein ruderloses Schiff oder ein Topf ohne Deckel, doch eine unfruchtbare Frau war schlimmer. Ihr Mann konnte sie verstoßen. Er konnte sich neuen Weidegrund suchen, während sie hier verrotten würde, allein, abgehängt, ein verdorbener Apfel ganz unten in der Kiste.
Aber das würde ihr Baruch nicht antun. Schließlich sagte er ihr jeden Tag, dass er sie liebte. Doch um ihre Angst zu lindern, reichte das nicht. Sie konnte weder schlafen noch essen, und das nun schon seit Monaten.
Noch schlimmer war es geworden, als sie sich nach acht fruchtlosen Monaten an Baruchs Eltern gewandt und um Hilfe gebeten hatten. Wie sehr sie es gehasst hatte, doch es war der einzige Weg, der ihnen noch blieb. Ihre eigenen Eltern hatten kein Geld. Chani fröstelte bei dem Gedanken an Mrs Levy, ihre säuselnde Stimme, die den Triumph in ihren harten hellen Augen nicht verbergen konnte.
Der Fernsehbildschirm im Warteraum war defekt. Das Gesicht des Nachrichtensprechers zitterte und wurde von gezacktem statischen Rauschen durchzogen. Die anderen Paare rund um Chani hockten eng beieinander. Niemand sprach oder suchte Blickkontakt. Jede Frau war in ihre eigene Welt aus Angst und Hoffnung versunken, und die Verzweiflung legte sich wie eine Glückshaube um ihre Schultern. Die Männer wiederum beschäftigten sich mit ihren Handys oder lasen die Zeitung, heuchelten Normalität, um das endlose Warten zu überstehen.
Chani wusste, sie sollte nicht hinsehen, aber die bunte Mischung unterschiedlicher Kleidung und Kulturen um sie herum bot wenigstens Abwechslung. Ihre Augen glitten unwillkürlich zu der attraktiven Muslima hinüber, die rechts von ihr saß. Sie bewunderte den eleganten Schwung ihres schwarzen Hijabs. Er erinnerte sie an die Hauben mittelalterlicher Nonnen, die den Hals und das Schlüsselbein verbargen. Ihre Fingernägel hatten die Form winziger scharlachroter Särge und passten farblich zu ihrem Lippenstift. Die Frau hatte etwas Glamouröses, das es bei Charedi-Frauen nicht gab. Im Vergleich dazu fühlte Chani sich grau und schäbig. Der Ehemann dagegen war plump und in seiner Rundlichkeit beinahe feminin. Er trug eine Baseballkappe, eine Brille, und an seinem Hemd fehlte ein Knopf. Durch den Schlitz guckte ein Stück braune Haut hervor. Chani wandte den Blick ab. Der Mann bekam davon nichts mit, sondern ließ sich vom Schein seines Handybildschirms in den Bann ziehen.
Plötzlich kam ein älterer Herr aus dem Nichts durch die gläsernen Schiebetüren und ging mit unsicherem Schritt zur Rezeption.
»Kann ich Ihnen helfen, Sir?«
»Ich bin hier wegen meiner Zähne. Ich habe heute einen Termin bei Dr. Pradesh, um, lassen Sie mal sehen –«, er tastete die Taschen seines Tweedsakkos ab, und nachdem er fündig geworden war, wedelte er mit einem Stück Papier vor der Nase der Krankenschwester herum.
»Sehen Sie hier. Da steht es. Vierzehn Uhr, in der Eastman Dental Clinic!«
Während er sprach, klapperte sein Gebiss im Takt seiner Worte, und jede Silbe fiel etwas klebrig aus seinem Mund. Für einen Moment hob sich die Stimmung im Wartebereich. Die private Kinderwunschklinik befand sich im linken Flügel der weitläufigen Eastman Dental Clinic an der Gray’s Inn Road.
Die Muslima schaute zu Chani herüber, und sie tauschten ein amüsiertes Lächeln.
»Es tut mir leid, Sir, aber Sie befinden sich im falschen Teil des Gebäudes. Kommen Sie, ich zeige Ihnen, wo Sie hingehen müssen.« Die Krankenschwester nahm den alten Mann sanft am Arm und führte ihn weg.
Das Zischen der sich schließenden Türen bedeutete auch die Rückkehr in den Trübsinn des Wartezimmers. Vergangen war der kurze Moment der gemeinsamen Heiterkeit. Chani war wieder allein mit ihren Ängsten.
Sie tastete in der Tasche nach ihrem winzigen Siddur und zog ihn heraus. Er klappte bei dem Gebet um ein Kind auf, wo ein Leseband die nur allzu vertraute Stelle markierte. Chani senkte den Kopf und sprach tonlos die hebräischen Worte. »Vater unser, o gnädiger Vater! Erhöre unsere Gebete, und beherzige unser Rufen, dass alle kinderlosen Frauen des Guten erinnert werden und mit Deiner Barmherzigkeit – rasch, leicht und schnell – lebende, gedeihende Kinder gebären. Möge sich Dein Volk, Israel, vermehren wie der Sand des Meeres, der weder gemessen noch gezählt werden kann.« In der Wiederholung, und darin, HaSchem ihre Sorgen zu übergeben, lag ein Trost. Sollte Er sich darum kümmern. Oh, bitte, HaSchem, beeil dich, dachte Chani, denn jede Schwangerschaft, die um sie herum verkündet wurde, machte es nur noch schlimmer. Sie hatte das Gefühl, eine entsetzliche Versagerin zu sein, und sie wusste nicht, ob sie noch eine einzige Nachricht über das Mutterglück anderer Frauen ertragen konnte. Doch in ihrer Welt war das unausweichlich. Gebären war die Aufgabe einer Frau, und wo immer sie hinsah, war sie mit einem weiteren prallen stolzen Bauch konfrontiert. Die Schwangeren der Kehilla segelten an ihr vorbei, die Bäuche wie Bugspriete vor ihnen, sicher in dem Wissen, dass sie die unerlässliche Mizwa vollbrachten, weitere kleine jüdische Seelen in der Welt zu verbreiten. Genau, wie HaSchem es bestimmt hatte.
Die Muslima beobachtete Chani vorsichtig, während sie betete. Reflexartig berührte sie ihren eigenen Bauch. Sie wusste noch nicht, dass sich unter den weichen, geheimnisvollen Falten ihrer schwarzen Abaya gerade eine winzige Zellkugel vervielfachte.
»Hannah Levy? Hannah?«, rief die Krankenschwester.
Chanis Kopf fuhr ruckartig auf wie bei einer Marionette.
»Ja, ich bin hier!« Sie küsste den Siddur, steckte ihn ein und stolperte über ihre Tasche auf die Füße.
An der Tür des Wartebereichs stand eine Krankenschwester, ein Klemmbrett in der Hand, das Haar straff zurückgebunden, das Gesicht von einem geschäftsmäßigen Lächeln erhellt – ein Hoffnungsfunke in Kobaltblau. Die anderen Frauen schauten Chani hinterher, wie sie vorbei an ihren Knien und Handtaschen ging.
»Hier entlang, Hannah. Dr. Duval erwartet Sie schon.«
Chani folgte der Krankenschwester durch die schweren Schwingtüren ins Innere des Krankenhauses.
Die Tür schloss sich, und Baruch war allein in dem grauen fensterlosen Raum. Im Flur davor wartete Rabbi Pinsk. Er saß geduldig auf einem Plastikstuhl, der ihm eigens von der freundlichen Krankenschwester gebracht worden war. Rabbi Pinsk kannte die Übung. Er saß nur wenige Schritte von Baruchs Tür entfernt – nicht zu nah und nicht zu weit weg. Dort zog er seinen Siddur heraus und begann, sich vor und zurück zu wiegen. Er betete für Baruch und seine gesegnete Frau Chani. Rabbi Pinsk war sechsundzwanzig, hatte aber bereits drei Kinder gezeugt. Sein ernstes Gesicht war in der Wärme des Krankenhauses pink und feucht, und seine blonden Augenbrauen unter dem Fedora schwitzten leicht. Ein leichter goldener Flaum, fast durchsichtig auf seiner hellen Haut, gab ihm das zarte Aussehen der Jugend.
Die Schritte der Krankenschwester verhallten. Baruch war die Anwesenheit von Rabbi Pinsk mehr als bewusst. Aber der Mann tat nur seine Pflicht. Baruch hatte sein ganzes Leben in Räumen wie diesen verbracht. Ein Leben drinnen, mit recycelter Klimaanlagenluft im Sommer und ermüdender Heizung im Winter – temperaturregulierte, neonbeleuchtete Kästen. Aber hier gab es keine Bücher, keine Tora oder keinen Talmud, die man wälzen konnte. Kein Krümel Staub. Innerhalb dieser vier Wände war er allein. Was, wenn man es genau bedachte, eine Erleichterung war.
Ein hellgelber Behälter für medizinischen Abfall hob sich leuchtend von der weißen hygienischen Anonymität ab. Zu seiner Linken befand sich ein Waschbecken, zur Rechten ein grauer Plastikstuhl. Ein niedriges Regal, eine Taschentuchbox, ein Metallspender, in dem sich Latexhandschuhe der Größe »Mittel« befanden. Der Raum war behaglich, warm und roch beruhigend nach Wundbenzin. Baruch fühlte sich plötzlich erschöpft und ließ sich schwer auf den Stuhl sinken. Am liebsten hätte er ein kleines Nickerchen auf dem schmalen Krankenhausbett ihm gegenüber gemacht. Er schloss kurz die Augen, nahm den Fedora ab und lehnte seinen Kopf an die Wand hinter sich.
Ein Rumpeln und das Rattern eines Krankenhaustrolleys, der an der Tür vorbeigerollt wurde, holten ihn aus seinen Träumen. Er hatte etwas zu erledigen. Er zog die Plastiktüte mit dem Probenbecher aus seiner Anzugtasche und stand auf, um die gerahmte Hinweistafel zu lesen.
Waschen Sie Ihre Hände mit Wasser und Seife.
Benutzen Sie kein Gleitgel, Speichel oder irgendein anderes Produkt, das samentötende Mittel enthalten könnte.
Ejakulieren Sie direkt in den sterilen Samenbecher.
Versuchen Sie, den ersten Teil des Ejakulats aufzufangen, und versuchen Sie nicht, verschüttetes Sperma einzusammeln.
Verschließen Sie den Behälter, sobald Sie fertig sind.
Vergewissern Sie sich, dass Ihr Name, die Zeit und das Datum auf dem Deckeletikett gut lesbar sind.
Die Hinweise erinnerte ihn an die Fülle laminierter Gebetskarten, die die Wände seiner Jeschiwa dekorierten – die korrekte Art, seine Hände zu waschen; nach dem Stuhlgang Dankbarkeit für ein weiteres reibungsloses Funktionieren der Körperfunktionen zu zeigen –, es gab für alles unter der Sonne und dem Mond ein Gebet; und dieser Akt der Blasphemie, den er im Begriff war zu vollziehen, war im Grunde nur ein weiteres Gebet. Bitte, HaSchem, sieh es so. Es sind nicht nur verschwendete Samen, HaSchem. Es dient einem Zweck.
Er dachte an Chani, die im Wartebereich der Klinik saß, ihr bleiches Gesicht gerahmt von den glänzenden Vorhängen ihres Scheitels. Sie hockte zusammengekauert in der Höhle ihres langen schwarzen Blazers, die Knie sittsam aneinandergepresst. Ihre Sehnsucht nach einem Kind hatte sie ausgezehrt, zerfraß sie von innen. Er hatte den scharfen Geruch ihrer Angst wahrgenommen, der ihr aus allen Poren zu sickern schien. Etwas, das von ihr ausströmte, wann immer sie sich bewegte.
Ein vorsichtiges Klopfen an der Tür ließ ihn zusammenfahren. Baruch HaSchem war die Tür abgeschlossen.
»Bei Ihnen alles in Ordnung, Mr Levy?«, hörte er die fröhliche Stimme der Krankenschwester gedämpft durch die Tür. Aus der Fassung gebracht, drehte er sich, stieß mit dem Ellenbogen gegen das Waschbecken und fluchte leise auf Jiddisch, dann rief er: »Ja, alles in Ordnung, danke. Ich bin in einer Minute draußen!«
»Lassen Sie sich Zeit, Mr Levy, keine Eile, ich wollte nur wissen, ob es Ihnen da drinnen gut geht.«
»Danke, ja, alles okay, ich mache dann mal weiter, danke, Schwester!«
Also gut, dann mal los. Er wusch sich die Hände und murmelte ein Gebet.
Auf dem niedrigen Regal neben der Taschentuchbox lag ein Stapel Männermagazine. Er hatte es vermieden, sie anzusehen. Doch ihre grellen Farben erinnerten ihn jetzt laut wie ein Hupsignal an seine Aufgabe. Fleischige, gebräunte Lenden, Brüste so aufgeblasen, dass sie davonzutreiben schienen, vollkommen losgelöst von ihren Besitzerinnen. Katzenhaft verengte Augen sahen ihn unter schweren Wimpern an, volle Lippen schimmerten. Die Frauen auf den Bildern waren wie Sirenen, bereit, ihn zu verschlingen. Er hatte seit Jahren nicht mehr in solche Zeitschriften gesehen, seit der Schule.
Er nahm eine vom Stapel und blätterte die Seiten durch. Seine Wangen brannten vor Scham, während sein Penis zuckend darauf reagierte. Doch die Bilder widerten ihn an, sie waren zu intensiv, zu viel. Er warf die Zeitschrift auf den Boden. Dann dachte er an Chani. Nein. Er wollte sie nicht beflecken. Ihre weiche, blasse Haut und die schmalen Gliedmaßen, die unter ihm so warm und lebendig waren, ihn umschlossen. Nein, nicht hier. Es fühlte sich so falsch an.
Durch die dünnen Wände konnte er das entfernte Lachen und Geplauder der Krankenschwestern hören. Die Schwester, die ihn hinein begleitet hatte, war sehr hübsch gewesen. Asiatin, große braune Augen, gelbbraune Haut, volle rosige Lippen, die beim Lächeln eine Reihe gerader Zähne entblößten. Der Ausschnitt ihrer Uniform hatte ein schimmerndes Schlüsselbein offenbart, über einem kecken wohlverpackten Busen. Als sie sich nach vorn gebeugt hatte, um ihm die Tür zu öffnen, hatte sie ihn kurz berührt, und für einen Moment hatte er die fremde und verbotene Wärme einer anderen Frau gespürt.
Er stand auf, löste seine Gürtelschnalle und ließ seine Hose zu den Knien herunterrutschen. Er schlurfte zu dem Plastikbecher, die Ziziot, die Schaufäden seines Unterhemdes, kitzelten ihn am Hintern. Sein Penis guckte zwischen den Hemdzipfeln hervor. Er schloss die Augen und begann, sich zu streicheln.
2
Rivka
November 2009 – London
Die Konsequenzen waren erheblich gewesen. Nachdem das euphorische Gefühl der Freiheit sich verflüchtigt hatte, saß Rivka in ihrer schäbigen Einzimmerwohnung in Archway und brütete über den unüberwindbaren Hürden, die ihrem neuen Leben jegliche Freude abpressten. Sie war allein und hatte keine Freunde. Die zermürbende Einsamkeit war schlimmer als alles, was sie sich vorgestellt hatte. Bis auf Avromi weigerten sich ihre Kinder, oder es war ihnen verboten, mit ihr zu sprechen. Der Schmerz darüber war beinahe unerträglich. Wenn sie in ihrem alten Zuhause anrief, wurde der Hörer aufgeknallt, und sie hörte nur noch das monotone Tuten. Chaim war der Einzige, der sich dazu herabließ, mit ihr zu reden, einmal pro Woche, kurz vor Schabbes, um sie zur Rückkehr zu bewegen.
Ihre Eltern waren tot; ihre Mutter war vor einigen Monaten in einem Altersheim gestorben. Sie hatte keine Geschwister und stand dem Rest ihrer säkularen Familie nicht nahe. Die Energie, das zu ändern, besaß sie nicht. Seit sie in der Kehilla lebte, waren auch ihre Schulfreunde nach und nach aus ihrem Leben verschwunden.
An einem trostlosen Nachmittag, mehrere Wochen nachdem sie gegangen war, hatte Rivka an der Mauer gegenüber der Queen Esther School gewartet. Als sie da stand, hatte sich ein robuster Volvo am Bürgersteig entlanggeschoben und war mit einem Ruckeln zum Stehen gekommen. Die beiden Frauen im Wagen redeten wie Wasserfälle. Sie bemerkten gar nicht, dass das Heck des Wagens noch immer in die enge Straße hineinragte. Rivka wappnete sich. Und da stiegen auch schon Mrs Wasserman und Mrs Zelder aus, zwei fromme Mütter, die ihre Kinder von der Schule abholten. Zunächst schien keine der beiden Frauen Rivka zu bemerken. Sie zog sich tief in ihren Regenmantel zurück, senkte den Kopf, beschäftigte sich mit ihrem Handy und betete, dass sie unerkannt davonkam.
»Die Rebbetzin Zilberman?«
Rivka sah auf und stellte fest, dass Mrs Zelder sie zwischen den wogenden Flügeln ihres schweren brünetten Scheitels beklommen ansah. Eine freundliche, gutherzige Frau, die stets bestrebt war, allen in Not zu helfen, selbst wenn die sich ihrer Not gar nicht bewusst waren. Ihr Ziel war zu gefallen, und Gnade HaSchem, wenn jemand versuchte, ihre Bemühungen abzuwehren. Neben ihr stand Mrs Wasserman, mit schräg geneigtem Kopf, und musterte die in Ungnade gefallene Rivka.
»Hallo, Mrs Wasserman und Mrs Zelder, wie geht es Ihnen beiden?«, versuchte es Rivka schwach.
Mrs Wasserman spitzte die Lippen und bot keine Antwort an. Sie wandte den Blick ab. Mrs Zelders sanfte braune Augen glänzten vor Mitleid.
»Ah, uns geht es recht gut, Baruch HaSchem, aber was ist mit Ihnen? Wir haben gehört, also, es wurde auf dem letzten Monatstreffen der Frauen erwähnt, dass Sie – ähm – weggezogen sind?«
Mrs Wasserman heuchelte Desinteresse, aber ihre Ohren waren gespitzt, wusste Rivka.
»Das stimmt, Mrs Zelder. Ich wohne inzwischen nicht mehr in Golders Green. Wie es aussieht, scheint HaSchem andere Pläne für mich zu haben.«
Mrs Wasserman schnaubte. Mrs Zelder sorgte sich weiter.
»Aber, Rebbetzin, ich meine, Mrs Zilberman, Sie sehen so dünn und blass aus, geht es Ihnen wirklich gut? Man hört ja so vieles. Ich will natürlich keinen Laschon Hara wiederholen«, schwatzte Mrs Zelder. An dieser Stelle schnaubte Mrs Wasserman erneut.
HaSchem musste zugehört haben, denn plötzlich läutete die Glocke durchdringend und schrill. Die Glastüren schwangen auf und entließen einen dunkelblauen Strom Hunderter schnatternder Mädchen, die auf der anderen Straßenseite an Rivka vorbeirauschten. Die Jüngeren liefen unter ihren schweren Schultaschen vornübergebeugt wie kleine Käfer, und ihre Röcke spielten um spindeldürre Waden. Nach und nach erschienen auch die älteren Mädchen, still und gezügelt, ihre schlanken Körper verborgen von schwingenden schwarzen Faltenröcken, weißen Blusen und pastellfarbenen Pullovern mit V-Ausschnitt, Brausebonbons, die aus einem Glas kullerten.
Michal tauchte auf, flankiert von zwei Freundinnen. Sie erkannte ihre Mutter, drehte sich weg, senkte den Kopf und beschleunigte ihren Schritt, sodass die Freundinnen ihr hinterhereilen mussten.
Rivka bewegte sich schnell, vergessen waren Mrs Zelder und Mrs Wasserman. Sie überquerte mit großen Schritten die Straße und rief den Namen ihrer Tochter. Die Köpfe der Mädchen fuhren herum, sie schauten flüchtig zurück auf die ehemalige Rebbetzin Zilberman und scheu wieder weg. Sie trug keine Kopfbedeckung, und ihr langes braunes Haar war zu einem unordentlichen Zopf geflochten. Ihr dünner Körper war in einen beigen Regenmantel gewickelt, doch beim Gehen flatterte er auf, und darunter sah man Beine in Jeans. Die ehemalige Rebbetzin Zilberman trug Jeans! Die Mädchen drängten sich enger aneinander, und als sie eilig weitergingen, brach ein heftiges Getuschel aus. Rivka fing an zu laufen.
»Michal! Warte! Bitte, ich möchte mit dir reden!«
Michal ging schneller.
»Michal!«
Michal blieb stehen und fuhr herum. Ihre Freundinnen gingen noch ein kleines Stück weiter, kehrten dann zurück, um an ihrer Seite zu warten, und starrten zu Boden.
»Warum glaubst du, dass ich mit dir reden will? Schau dich mal an! Wie kannst du es wagen, hier aufzutauchen und auszusehen wie eine Goje? Dich hier so peinlich aufzuführen!« Die Worte spritzten ihr entgegen wie Fett aus einer Pfanne.
»Ich wollte dich nur sehen, Michal.«
»Wenn ich dir wirklich wichtig wäre, dann wärst du jetzt nicht hier!« Michals Gesicht war weiß vor Zorn.
»Ich weiß, dass du wütend bist, Michal. Ich wollte nur –«, setzte Rivka an und rang darum, ruhig zu bleiben.
»Ich-ich-ich! Es geht nur um dich, stimmt’s, Mum? Hast du überhaupt mal an uns gedacht? An Dad, Moishe und mich? Hast du darüber nachgedacht, wie du meine Chance auf die Sem oder einen guten Schidduch ruinierst? Glaubst du, dass irgendein anständiger Junge mich jetzt noch will? Du hast meinen Ruf kaputt gemacht!«
»Michal«, sagte Rivka mit brechender Stimme, »bitte, würdest du mir nur eine Chance geben? Können wir an einen ruhigeren Ort gehen und reden?«
Rivka trat einen Schritt vor und wollte ihrer Tochter die Hand auf die Schulter legen. Das Mädchen schob sie weg. Sie starrte diese Verrückte in ihren Goje-Klamotten an, drehte sich dann auf dem Absatz um und ging auf den wartenden Bus zu. Ihre Freundinnen beeilten sich, mit ihr Schritt zu halten, und blickten noch einmal neugierig zurück.
Heute Abend würden die Telefonleitungen in der Kehilla heißlaufen, man würde tuscheln und abfällig schnalzen, die Köpfe schütteln, und alle wären sich einig, dass die ehemalige Rebbetzin Zilberman eigentlich nie eine von ihnen gewesen war.
3
Mr und Mrs Levy
Oktober 2009 – London
Der Anruf kam während des Abendessens. Was nicht ungewöhnlich war, denn Baruch meldete sich jede Woche um diese Uhrzeit bei ihnen. Mr Levy war ans Telefon gegangen, doch innerhalb von Sekunden verstummte er und lauschte konzentriert, und Mrs Levy wusste, dass bei ihrem Sohn nicht alles so war, wie es sein sollte.
»Was ist passiert? Nu? Sag’s mir!«, zischte sie, doch Mr Levy bedeutete ihr, sie solle still sein. Zu schweigen gehörte jedoch nicht zu Mrs Levys Aufgaben.
»Dovid, nu? Was ist los? Lass mich mit ihm sprechen!«
Aber Mr Levy stand auf und verließ die Küche, das Telefon ans Ohr gedrückt. Mrs Levy tappte in ihren Samtpantoffeln hinter ihm her. Im Wohnzimmer sank er in einen der weißen Ledersessel, der unter seinem Gewicht ein leises Zischen von sich gab. Seine Frau flatterte aufgeregt vor ihm herum. Er verscheuchte sie mit einer Handbewegung, doch es war zwecklos. Schließlich hockte sie sich neben ihn und versuchte, ihr Ohr an den Hörer zu pressen.
»Was immer du brauchst, wir werden dir dabei helfen, im jirtse HaSchem. Kommt nach Hause, und wir reden darüber. Ihr beide.«
»Was ist los? Warum sind sie –«
»Psst, Berenice, ich erzähl’s dir gleich. Entschuldige, Baruch, deine Mutter macht mich ganz meschugge, sie will alles wissen. Mmmh, ja, natürlich kannst du. Kein Problem.«
Sie konnte Baruchs Stimme hören, blechern und leise, doch sie verstand nicht, was er sagte, bevor der Anruf abrupt endete. Mr Levy wandte sich seiner Frau zu, die ihn mit weit aufgerissenen Augen unter den Fransen ihres dichten kupferfarbenen Scheitels ansah.
»Dovid, was ist denn? Ist er krank? Sag es mir!«
Mr Levy seufzte. Von der gefurchten Narbe auf seiner Stirn breitete sich ein Netz feiner Falten aus wie Nebenflüsse von einer Quelle. Seine Wangen hingen ihm weich über die Kinnpartie, und inzwischen war sein Bart – obwohl ordentlich geschnitten und getrimmt wie immer – grau meliert. Ihr Ehemann, der stets Robustheit und Kraft ausgestrahlt hatte und von ebensolcher Statur gewesen war, so lebendig und heiter in seinem Reden und Tun, war von einem müden, alten Mann verdrängt worden.
Mrs Levy hatte Angst. Was verschwieg er ihr?
»Erzähl’s mir! Bitte!«
»Baruch und Chani haben ein paar Probleme mit der Fruchtbarkeit.«
»Ich wusste es!« Sie sprang von der Sessellehne hoch und begann, auf und ab zu tigern, was ihr hämisches Grinsen jedoch nicht verbergen konnte. »Habe ich’s nicht gesagt? Selbst mit dem dreimonatigen Dispens durch den Rabbi hätte sie inzwischen schwanger sein müssen? Schon längst schwanger! Nu? Das muss an ihr liegen, ganz bestimmt liegt es an ihr. Wir hatten doch nie irgendwelche Probleme, genauso wenig wie Yisroel oder Ilan.«
»Hör auf, Berenice, bitte, hör damit auf. Was wissen wir denn schon von diesen Dingen? Was wissen sie? Es könnte auch nur am Timing liegen.«
»Das Mädchen war von Anfang an nicht die Richtige. Er hätte sie nie heiraten dürfen, und das hier beweist es. HaSchem hat es uns bewiesen.«
»Das darfst du so nicht sagen. Welche Pläne HaSchem hat, können wir nicht wissen.«
»Aber, aber – es ist doch nur ein weiterer Beweis dafür, dass dieses dürre, kleine Kaufman-Mädchen nichts für ihn – nichts für uns ist. Und wenn er ein großer Rabbi werden soll, dann muss er Kinder haben! So steht es in der Tora. Ein Mann muss Kinder haben, es ist seine Pflicht, HaSchem zu gehorchen, und warum sollte irgendwer einen Rabbi ohne eigene Kinder respektieren? Wie soll er all die Probleme verstehen, die man mit Kindern hat? Wie soll er in seiner Kehilla Rat geben, wenn er keine Erfahrung damit hat? Vom Gebot der Mizwa, hinzugehen und sich zu vermehren, mal ganz abgesehen!«
Seine Frau stand in der Mitte ihres Schaffellteppichs, die Hände in den Hüften, mit bebendem Scheitel. Ihre Augen blitzten vor Erregung, und sie sah ihn erwartungsvoll an. Mr Levy blieb hart. Ihm war schwer ums Herz, ein dumpfes Mitleid regte sich darin für seinen armen Sohn und seine Schwiegertochter.
»Berenice, wir müssen ihnen helfen. Baruch hat uns um Hilfe gebeten. Er möchte mit Chani deswegen zum Arzt gehen. Das können wir ihnen nicht abschlagen – das wäre in so vieler Hinsicht falsch«, sagte Mr Levy langsam und behutsam in der Hoffnung, dass die Worte richtig ankommen würden.
»… und man würde es ja auch bei der Bilanz ihrer Mutter nicht annehmen, ich meine, bei welchem ist sie inzwischen – dem achten oder neunten?«
Mrs Levy hörte überhaupt nicht zu. Sie lief noch immer hin und her und gestikulierte wie eine Meschuggene. Woher um alles in der Welt nahm seine Frau diese Energie? Sie war ganz aufgewühlt von ihren Gefühlen, von der Möglichkeit –
»Wenn sie ihm keine Kinder schenken kann, dann müssen sie sich scheiden lassen, und das schnell – damit er eine andere findet, die das kann!«
»Be-re-nice!« Mr Levy schlug mit der Hand auf seinen Sessel. Sie blieb plötzlich stehen.
»Es reicht. Setz dich hin, und lass uns das besprechen.« Er zeigte auf den Sessel gegenüber.
»Was gibt es da zu besprechen? Wir müssen handeln! Libby Zuckerman hat eine jüngere Schwester, und ich habe gehört, sie ist –«
Mr Levy stand auf.
»Berenice, wir reden hier nicht über Scheidung. Wage es noch nicht einmal, darüber nachzudenken. Wir verhalten uns wie die Mentschen, die wir eigentlich sind.« Er sah seine Frau böse an und hoffte, sie zur Besinnung zu bringen. »Und wir helfen ihnen, wo immer wir können. Wenn du deinen Sohn wirklich so sehr liebst, wie ich weiß, dass du es tust, dann stehst du über dieser – dieser«, sein Mund verzog sich angewidert, »armseligen Abneigung, die du für deine Schwiegertochter empfindest, und tust das Richtige und bist für sie die beste Schwiegermutter, die du ihr sein kannst. Wir werden das hier um Baruchs Willen durchstehen. Na komm, hab ein bisschen Rachmones. Bitte.«
Das brachte Mrs Levy nur für einen winzigen Moment zum Schweigen, bevor sie wieder zum Angriff überging.
»Und wie lange willst du warten?«, fragte sie energisch, die Füße in den Pantoffeln fest auf dem Boden.
»Und wie kannst du so sicher sein, dass es Chani ist, die das Problem hat, nu?«, konterte er.
»Ach, komm, Dovid. Wir hatten keine Schwierigkeiten.«
»Oh, oh.« Er wackelte mit dem Finger in ihre Richtung. »Ah, man vergisst so leicht, nicht wahr?«
»Vergisst was?«, fragte Mrs Levy leichthin, während sie sich mit den Fingern durch die Fransen ihres Scheitels fuhr. Sie kniff die Augen zusammen.
»Wir haben zehn Monate gebraucht, bis du mit Yisroel schwanger warst, weißt du noch?«
Mrs Levy versteifte sich. Diese düstere Episode hatte sie vergessen. Viel lieber erinnerte sie sich nur an die guten Zeiten. Baruch HaSchem.
Er sah, wie ihre Augen das Funkeln verloren, als sich ihr erhitztes Gesicht beruhigte.
»Was für eine schreckliche Zeit das war. Alle wussten Bescheid. Und wirklich jeder hat sich eingemischt. Ich konnte nicht mal die Straße hinuntergehen, ohne dass mich irgendeine Klatschtante gefragt hat, ob ich bereits schwanger sei. Baruch HaSchem!«
Er lächelte traurig. »Ja, das war ein Albtraum. Aber wir haben es durchgestanden, mit HaSchems Hilfe.«
»Schlussendlich.«
»Schlussendlich«, pflichtete er ihr bei.
»Aber wir brauchten keinen Arzt. Es ist einfach passiert.«
»Genau, also passiert es auch bei Baruch und Chani einfach. Aber wenn es wirklich ein Problem gibt, dann müssen wir ihnen jede Möglichkeit geben, das zu richten.«
»Natürlich. Und wir müssen die Rechnung bezahlen. Ihre Familie wird nichts beisteuern«, murrte sie. Sie dachte an die peinlichen Schwiegereltern ihres Sohnes, den verarmten, mittelmäßigen Clan der Kaufmans, mit dem sie jetzt unwiderruflich verwandt war.
»Ja, es ist unsere Pflicht.«
»Gut, aber unter einer Bedingung.«
»Nu?«
»Wir geben ihnen sechs Monate, um das in Ordnung zu bringen. Sie bekommen alle Ärzte und Tests, die sie brauchen, und wenn dann immer noch kein Baby unterwegs ist, dann sprechen wir mit Baruch über Scheidung.«
Mr Levy ließ den Kopf auf seinen Fäusten ruhen. Er seufzte lang und streckte sich, als er über ihren Vorschlag nachdachte.
»Okay, Berenice, in dem Punkt hast du gewonnen.«
Sie belohnte ihn mit einem zahmen Lächeln.
»Du wirst schon sehen, dass ich recht habe. Du kannst mir später danken.«
»Chas we Shalom! Geh, und hol mir bitte ein Glas Whisky.«
Mrs Levy schlenderte in bester Laune davon, um der Bitte ihres Mannes nachzukommen. Am Ende bekam sie immer ihren Willen.
Mr Levy ließ sich wieder in seinen Sessel fallen. Er liebte seine Frau, aber manchmal war sie eine wahre Nervensäge.
4
Baruch
Oktober 2009 – Jerusalem
Chani stand in Pantoffeln im Türrahmen ihrer Wohnung im obersten Stock, gegen die morgendliche Kälte eingewickelt in ihren Hausmantel, und hob zaghaft die Hand, als Baruch ging. Ihr Gesicht lag im Schatten, doch selbst im Halbdunkel sah Baruch, dass sie sich auf die Unterlippe biss.
»Chani, beeil dich, sonst kommst du zu spät zur Arbeit!«
»Zuerst muss ich Mum anrufen«, sagte sie. Ihr Haar war straff zurückgekämmt und unter einem schwarzen, eng anliegenden Tuch verborgen, dessen Strenge ihre Jugend und Blässe unterstrich.
»Ruf sie nachher an, nun mach schon, du kannst im Bus beten, nu!«
»Wenn ich sie jetzt nicht anrufe, fängt der Schabbes an. Wir sind ihnen doch zwei Stunden voraus.«
»Dann versuch, dich kurz zu fassen. Tsippi wird schon im Laden auf dich warten, und du bist letzte Woche schon zu spät gekommen.«
Chani verdrehte die Augen. »Ich tu mein Bestes. Ist ja nicht so, als würde ich Pizza bestellen, oder?«
Baruch grinste. »Ich weiß. Viel Glück, lass mich wissen, wie es läuft.«
»Okay. Lern fleißig.«
»Ich komme am Shuk vorbei, bevor er schließt, und bringe Challa mit.«
Chanis Augen leuchteten. Sie verlagerte ihr Gewicht von einem Fuß auf den anderen.
»Ja, bitte, ich werde heute keine Zeit zum Backen haben – oh, und wenn du zufällig Schoko-Babka siehst …«
Er freute sich über diese Bitte, denn Chanis schwindender Appetit bereitete ihm Sorgen.
»Hol ich dir. Noch was?«
Chani schüttelte den Kopf.
»Und jetzt beeil dich, Chani. Es wird dir guttun, mal rauszukommen.«
»Mach ich. Vergiss du nicht, dein Mittag zu essen. Ich habe dir Couscous und Gemüse gemacht, du kannst es in der Mikrowelle aufwärmen.«
»Habe ich eingepackt! Tschüss!« Er klopfte auf seine braune Tasche, schob sie höher auf die Schulter und galoppierte die Treppen hinunter.
Er hörte, wie die Wohnungstür mit einem soliden Knall zufiel, gefolgt vom Schaben der Sicherheitsriegel. Er fühlte sich immer besser, wenn er die Tür gut verschlossen wusste. Nicht, dass Rechavia ein unsicheres Viertel wäre, sonst hätten seine Eltern auch nicht die Miete übernommen. Doch er machte sich Sorgen.
Für einen Blick in den Briefkasten war keine Zeit mehr, als er in den üppigen Vorgarten der Elcharizi Street 19 eilte. Es war kühl und diesig, die Pflanzen noch tropfnass vom Regen der vergangenen Nacht, der auch die Pflastersteine glitschig machte. Im dichten Buschwerk stank es nach Katzenpisse, und er hielt den Atem an, bis er das Tor aufgeschoben hatte und draußen auf der ruhigen Straße war.
Er liebte die Elcharizi Street. Es war eine schmale, gewundene Straße mit Mietshäusern aus Jerusalem-Stein – wie ihres auch –, die ein ganzes Stück zurückgesetzt standen. Ihre Ecken und Kanten wurden von Schlingpflanzen und überhängendem Grün verwischt. Die Straße war alt und wohlsituiert. Geheimnisvolle Herrenhäuser mit hohen Mauern sorgten für ein Gefühl von Abgeschiedenheit, und hohe Palmen und majestätische Kiefern spendeten im Sommer willkommenen Schatten. Im verworrenen Dickicht gurrten Tauben, und verrottende Blätter machten den Asphalt schlüpfrig. Man fühlte sich, als wäre man aus der Zeit gefallen, auch, weil die Straße zu eng war für viel Verkehr, kein Taxi suchte hier nach einer Abkürzung.
Hinter ihrem Mietshaus befand sich eine kleine öffentliche Bibliothek, die Baruch, trotz der verbotenen säkularen Literatur in den Regalen, mit Vergnügen besuchte. Die meisten Bücher waren auf Hebräisch, doch er stöberte gern in den wenigen englischen Werken, saß an einem der Metalltische und atmete den Bücherstaub und die Stille ein. Er konnte lesen, was er wollte, solange das College, an dem er studierte, davon nichts erfuhr.
Zu Hause präsentierte er seine wachsende Sammlung an Taschenbüchern stolz auf einem Regal im Wohnzimmer. Er hatte neue Autoren entdeckt: Murakami, Huxley, Roth und Amos Oz. Er verschlang diese Romane; sie waren das Gegengewicht zur endlosen Tora, dem Talmud und den Weisen. Er brauchte beides, und obwohl diese Art von Literatur als bösartiger Einfluss angesehen wurde, den es um jeden Preis zu vermeiden galt, konnte Baruch den Seiten, die ihm so viel Freude bereiteten, nicht den Rücken kehren. Sein Verstand war ohne Weiteres in der Lage, das Heilige und das Profane voneinander zu trennen.
Direkt gegenüber ihrem Haus führte eine breite Steintreppe zu einem Plateau mit einem Kinderspielplatz, der aus einer Schaukel, einer kleinen Rutsche und einer Wippe bestand. An nicht allzu heißen Sommernachmittagen saßen Mütter auf der niedrigen, geschwungenen Mauer und sahen zu, wie ihre Kinder Fangen spielten und fröhlich kreischten. An jenem Morgen war am Ende der Rutsche eine große Pfütze. Baruch lief die restlichen Stufen hinauf und bog rechts auf die Ramban Street ein. Der Kiosk war geöffnet, ein kleiner Eckladen, der aus einem Stahltresen und einer Kaffeemaschine bestand. Hinter einer Scheibe waren riesige Zimtschnecken aufgetürmt. Obwohl Chani ihm ein Omelett zum Frühstück zubereitet hatte, konnte er nicht widerstehen. Gegen die Schuldgefühle gab er sich selbst das Versprechen, zu Fuß nach Hause zu gehen, wusste aber nur zu gut, dass er das nicht tun würde. Er trat ein, und Mrs Pinsky, eine Frau, so rund wie ihr Gebäck, nickte zur Begrüßung.
»Wie geht es Ihnen, Mrs Pinsky?«, fragte er wie jeden Morgen.
»Gut, Baruch HaSchem«, erwiderte Mrs Pinsky mit einem Märtyrerlächeln. »Bis auf den Regen, der mir Probleme mit dem Dach bereitet.«
»Das tut mir leid«, antwortete er wie aufs Stichwort, stolz auf sein Hebräisch. In seinem Kolel dachte man fortschrittlich, und modernes Hebräisch zu lernen gehörte zur Pflicht.
»Was soll man machen?« Mrs Pinsky zuckte tragisch mit den rundlichen Schultern. »Und was hätten Sie gern?«
Jeden Morgen stellte Mrs Pinksy ihm dieselbe Frage, und Baruch antwortete stets dasselbe. »Eine Zimtschnecke bitte.«
Inzwischen lief Baruch die Spucke im Mund zusammen. Er versuchte, nicht allzu gierig auf die glänzenden Gebäckstücke zu starren, die mit Zuckerguss verziert waren. Er sah genau zu, wie Mrs Pinsky mit einer Zange gekonnt die größte Schnecke in eine braune Papiertüte legte. Mit einem kurzen Ruck ihrer Handgelenke war die Tüte verschlossen.
»Vielen Dank«, sagte Baruch.
Mrs Pinsky neigte betrübt den Kopf.
Baruch bezahlte und ging, die Tüte fest in der Hand. Er lief zügig die Ramban Street hoch und dankte HaSchem für seine langen Beine. Die Gebäude links und rechts wurden immer größer und prächtiger, ein Spiegelbild ihrer Bedeutung. Er ging am Prima Kings Hotel vorbei, wo viele Schidduchim stattfanden, und eilte weiter zur Bushaltestelle an der King George Street.
Ein Windstoß blies ihm den Mantel gegen die Beine. Er hielt seinen Fedora fest und schob die Papiertüte in die Manteltasche. Der Bus kam gerade, und als er eine Lücke im Morgenverkehr entdeckte, stürzte er zwischen zwei Wagen hindurch, was ihm ein Hupkonzert einbrachte. Im Bus ging er nach hinten durch, wobei er ein anmutiges Tänzchen vollführte, um die weiblichen Fahrgäste nicht zu berühren. Er fand einen Platz neben einem jungen Chassid, der grüßend nickte.
Der Bus schlängelte sich die King George entlang und fuhr dann den Hügel nach Ge’ula hoch. Baruch sagte ein Gebet und biss genüsslich in die Zimtschnecke.
»Guten Appetit«, sagte der junge Chassid auf Hebräisch. Mit vollem Mund nickte Baruch und versuchte zu lächeln. Er genoss den Zuckerrausch. Baruch HaSchem hatte er bereits zu Hause gebetet. Er würde zu spät kommen. Baruch stieß leise auf und spürte plötzlich den Hosenbund am Bauch. Chani war eine gute Köchin. Es machte ihr Spaß, neue Rezepte auszuprobieren, obwohl sie von ihren Kreationen nur wenig aß. Er war ihr williges Versuchskaninchen und sah ihr gern zu, wie sie in ihrer winzigen Küche eine herrliche Sauerei veranstaltete.
Seine Haltestelle kam, und es begann zu regnen. Schnell schob er sich zum Ausgang durch, die frommen Frauen lehnten sich instinktiv von ihm weg.
Seine Komillitonen hatten sich bereits um Tische und auf Bänken zusammengeschart und waren in Diskussionen über das Fußballspiel gestern Abend vertieft. Die elektrischen Heizungen waren eingeschaltet, und im Raum war es trotz des regnerischen Wetters draußen feuchtwarm. Das Kolel-Leben hatte eine Ungezwungenheit, die Baruch genoss – kleine Gruppen verheirateter Männer, die ihre Tage damit verbrachten, sich in den Talmud zu vertiefen, um später Rabbis zu werden. Eine Welt, weit weg von der Hektik und Einsamkeit der Jeschiwa.
»Na endlich, Baruch. Du hast es noch vor dem Moschiach geschafft«, witzelte Shimshom Meirovsky.
»Tut mir leid, dass ich zu spät bin. Der Bus hat ewig gebraucht«, sagte Baruch, während er seinen feuchten Fedora und den Mantel aufhängte und seinen Platz neben Shimshom einnahm. Baruch zog ein Taschentuch heraus und begann, seine fleckige Brille zu putzen.
»Es ist jedes Mal dasselbe, wenn es regnet«, pflichtete Yechezkel Zimmer trübsinnig bei.
»Wir brauchen den Regen. Im jirtseHaSchem muss Israel dieses Jahr hoffentlich kein Extrawasser aus der Türkei kaufen, eh?«, sagte Daniel Halpern.
»Im jirtseHaSchem«, sagten die anderen Männer im Chor.
»Nun dann, meine Freunde, Zeit zum Studieren!«, ermahnte Rabbi Gruss gutmütig seine Schüler. Es folgte ein Gestöber aus umgeblätterten Seiten, Hintern, die zurechtrutschten, und dann saß Baruch über den Talmud gebeugt, der aufgeschlagen vor ihm lag.
Um halb drei, im Anschluss an das Nachmittagsgebet, schloss das Institut wegen des Schabbes etwas früher. Baruch trat hinaus auf die vom Regen gesäuberten Bürgersteige und sog die frische Luft ein. Sein Kopf schwirrte noch von dem Stimmengewirr leidenschaftlicher wissenschaftlicher Diskussionen, und er hatte vergessen, zu Mittag zu essen. Er machte sich zu Fuß auf den Heimweg, doch nach zwanzig Minuten hörte er das Zischen des Busses hinter sich und stieg ein, weil ihm eingefallen war, dass er vor Ladenschluss noch wie versprochen Challa und Babka kaufen wollte. Er lehnte sich gegen das Fenster und versuchte, nicht daran zu denken, was sie in der kommenden Woche in London erwartete. Er hasste es, dorthin zu fahren, aber es blieb ihnen nichts anderes übrig. Sie brauchten Hilfe. Er kam bis auf Weiteres ohne ein Baby aus, aber Chani nicht. Sein Leben breitete sich vor ihm so geradlinig aus wie ein Pfeil. Mit seiner Weihe zum Rabbi würde seine Zeit am Institut ihren Höhepunkt erreichen. Eine endlose Straße aus Tora-Studien und Andacht, was ihm beides leichtfiel. Sein Glaube war stark, schließlich hatte HaSchem ihm Chani gebracht.
Es hatte aufgehört zu regnen, und der Bus kletterte bergauf. Er erhaschte einen Blick auf die weißen Universitätsgebäude auf dem Mount Scopus und fragte sich, wie er es immer tat, wie es wohl wäre, ein Fach zu studieren, das man selbst ausgewählt hatte. Englische Literatur zu studieren. Der Bus fuhr den Hügel wieder hinunter, und die Universität verschwand aus seinem Blickfeld. Ihre weißen Bögen und Gärten blieben vor seinem inneren Auge, blieben eingebrannt auf seiner Netzhaut wie das Nachglühen eines Blitzlichtes.
Das Beste an seinem Leben in Jerusalem war das Nachhausekommen zu seiner Frau. Er küsste die Mesusa, trat ein und nahm Chani schwungvoll in den Arm, sodass ihre Füße vom Boden abhoben. Sie lachte, und einen Moment lang verlor ihr Blick die Anspannung. Ihr Gesichtsausdruck wurde weich, und sie ähnelte wieder dem munteren und neugierigen Mädchen, dem er vor etwas über einem Jahr unter der Chuppa gegenübergestanden hatte.
»Hast du zu Mittag gegessen?«
»Habe ich nicht, das tut mir leid«, sagte er ernst. »Ich werde für mein Fehlverhalten büßen, indem ich vor Schabbes-Beginn sämtlichen Abwasch erledige.«
Chani gab ihm einen liebevollen Klaps. »Du warst wieder bei Mrs Pinsky, oder? Ich sollte dich zwingen, dein Mittagessen kalt zu Abend zu essen. Aber ich habe Hühnchen mit Süßkartoffeln gekocht.«
»Lecker. Und was gibt’s als Nachtisch?«
»Apple Pie.«
»Oder Schoko-Babka …«, neckte Baruch und hielt eine fettige Tüte hoch.
Chani quiekte und brach dann ab.
»Ist es parve? Wenn nicht, können wir es immer noch morgen essen.«
»Ich hab eins genommen, das parve ist. Und ein Challa.«
»Baruch HaSchem!«, hauchte Chani, griff nach dem Päckchen und schnupperte anerkennend daran.
Baruch seufzte vor Freude und küsste Chani auf den Kopf. Ihr Haar duftete nach gebratenem Hühnchen.
»Hast du mit deiner Mum gesprochen?«
»Ja. Sie ist sauer, weil wir nicht bei ihnen übernachten. Vermutlich fühlt sie sich übergangen. Was soll ich machen, B’ruch? Ich habe versucht, es ihr zu erklären, aber ich glaube, sie hat es trotzdem in den falschen Hals gekriegt.«
Chani drehte sich zu den blubbernden Töpfen und Pfannen in der Küche um, und ihre eckigen Schultern hoben sich, während sie herumklapperte. Eine weitere verwelkte Topfpflanze war auf der Fensterbank aufgetaucht. Die Wohnung war voller Pflanzenschützlinge.
»Chani, wir fahren unseretwegen hin. Das ist kein gewöhnlicher Besuch. Deine Mum wird sich schon wieder beruhigen.«
»Ich weiß. Ich wünschte nur, wir müssten überhaupt nicht fahren«, grummelte sie und bückte sich tief nach unten, um das Hühnchen im Ofen zu begutachten. Baruch zog sich eine Schürze an und begann, heißes Wasser ins Fleischwaschbecken einzulassen.
»Ich auch. Aber lass uns versuchen, die Sache positiv zu sehen. Es ist ja hoffentlich nicht für lange. Vielleicht kommen wir mit guten Neuigkeiten zurück.«
»Im jirtse HaSchem«, sagte Chani, während sie den Deckel des Topfes mit Möhrensuppe hob und aufs Geratewohl darin herumrührte. Orange Spritzer zischten auf der Herdplatte. Ein Tropfen landete auf ihrer Hand. Sie schrie kurz auf und saugte an der Verbrennung. Baruch befeuchtete ein Geschirrtuch unter kaltem Wasser. Sie ließ sich einen Moment von ihm umsorgen und schob ihn dann weg, um an den Herd zurückzukehren, wo sich ihre Stimmung weiter verdüsterte.
5
Rivka
November 2009 – London
Rivka ging weiter. Sie fühlte sich ungeheuer verletzt. Nichts war so bitter, wie von einer Tochter zurückgewiesen zu werden. Sie und King Lear hatten viel gemeinsam.
Sie dachte an Michal als kleines Mädchen: das schlichte Vergnügen, sie an der Hand zu halten; das Vertrauen, die Streitereien, die kamen und vorbeizogen wie Wolken vor der Sonne; das endlose Genörgel und die Aufregung, die jede Veränderung und jeder Entwicklungsschritt mit sich brachte. Sie hätte nie gedacht, dass Michal und sie sich je entfremden könnten. Die Vehemenz ihrer Tochter klang in ihren Ohren nach, als Rivka in Richtung Golders Green trottete und langsam die Treppe der Autobahnbrücke erklomm. Grell blitzten unter ihr die Scheinwerfer der Wagen auf, der Verkehr wand sich wie eine Schlange aus knurrenden Wagen voran. Es wurde schnell dunkler. Der Himmel war verhangen blau, und jede Straßenlaterne trug einen orangefarbenen Nimbus. Die Läden waren noch geöffnet; um sie herum ging das geschäftige Treiben der eigenen kleinen Welt von Golders Green weiter. Sie kam an der Straße vorbei, in der sie einmal mit ihrer Familie gewohnt hatte, und musste sich zwingen, nicht einzubiegen. Die Schlüssel klimperten in ihrer Tasche. Michal würde inzwischen zu Hause sein. Ihre Tochter würde in der Küche stehen, den Kühlschrank plündern und den Wasserhahn laufen lassen. Würde sich eine Tasse Tee machen und Kekskrümel verstreuen. Oder mit einer Freundin telefonieren, ein Glas eingelegtes Gemüse in der Hand. Im Geiste folgte Rivkas Blick ihrer Tochter wie Suchscheinwerfer.
Ihre Füße hatten sie zu dem kleinen koscheren Supermarkt geführt, in dem sie häufig eingekauft hatte. Sie betrat das Labyrinth aus importierten Produkten, die vom Beth Din gestempelt und zugelassen waren. Wie sehr sie die ekelhaft süßen israelischen Schokoriegel vermisst hatte und die bunten Dips und Salate, von denen sie sich früher ernährt hatte – geräucherte Auberginen, zu einem cremigen Mus zerstampft, Hummus, der in Öl und Pinienkernen schwamm. Sie griff sich eine Tüte Pitabrot, jedes davon eine weiche, dichte Wolke, das so anders war als die trockenen Möchtegerns aus dem Co-op bei ihr um die Ecke. Mit dem Brot und ein paar weiteren Lebensmitteln ging sie zur Kasse, wo sich eine Schlange gebildet hatte. Sie stand mit erhobenem Kopf da, sich der neugierigen Blicke bewusst. Sie war die einzige Kundin, die Jeans trug, genau genommen die einzige Frau in Hosen.
Ein alter Mann ließ sich beim Zählen seiner Pennys Zeit und nuschelte der Kassiererin auf Jiddisch etwas zu. Schließlich schlurfte er weiter, und Rivka legte ihre Sachen aufs Band. Die junge Frau an der Kasse warf einen kurzen Blick auf Rivka und erstarrte. Es war Mitty Neuberger, eine von den Mädchen, die sie unterrichtet und in die Mikwe begleitet hatte. Mitty war ein warmherziges, unbekümmertes Mädchen mit einem charmanten Lächeln, das sie stets freundlich gegrüßt hatte. Doch nun lächelte sie nicht. Beim Anblick ihrer ehemaligen Lehrerin, die keine Kopfbedeckung trug, wusste sie weder, wo sie hinschauen, noch, was sie sagen sollte, und blickte schließlich auf ihre Hände, die Rivkas Sachen über den Scanner zogen.
Rivkas Magen verkrampfte sich. Sie starrte auf Mittys hellgrünes Kopftuch und bemerkte dann die kleine Schwellung unter ihrer Ladenschürze.
»Hallo, Mitty, wie geht es dir? Was gibt es Neues?«, fragte sie.
Mitty versteifte sich. Ohne zu Rivka aufzublicken, erwiderte sie mit leiser, kalter Stimme: »Baruch HaSchem, sehr gut, danke.«
Ein Schweigen breitete sich zwischen ihnen aus, das nur durch das aufdringliche Piepen des Scanners gefüllt wurde. Als Rivka ihren Einkauf gerade in eine Plastiktüte gepackt hatte und ihre Kreditkarte hinüberreichte, passierte es.
»Treif!«
Etwas oder jemand, der verboten ist, aber auch unrein und ekelhaft. Liederlich. Verabscheuenswürdig. Jemand hatte das Wort laut in ihre Richtung gezischt. Mitty keuchte. Rivka zuckte zusammen. Sie drehte sich um und schaute auf die Schlange der Frommen. Fast nur Frauen. Ein kleiner Schuljunge am Ende. Alle hatte den Blick abgewandt und vermieden es, ihr in die Augen zu sehen. Sie starrte sie an, ihr Gesicht brannte, doch niemand trat vor. Sie drehte sich wieder um und bezahlte. Als sie zum Ausgang ging, hörte sie das schreckliche Wort noch einmal, wie einen Fluch.
»Treif!«
Rivka fuhr herum. Wieder begegneten ihr nur gesenkte Köpfe. Die Frauen standen dort wie Schaufensterpuppen. Bis auf eine. Eine Frau guckte zornig zurück, und ihre Augen blitzten herausfordernd.
Rivka ging zu ihr hin. »Entschuldigung, aber kennen wir uns?«
Das Gesicht der Frau verzerrte sich verächtlich. Sie verengte die Augen, hob ihr Kinn und sagte eisig: »Vielleicht. Ich dachte, Sie wären die Rebbetzin Zilberman, aber Sie sehen eher aus wie meine gojische Putzfrau.«
Es war wie eine Ohrfeige. Rivka stand einen Moment benommen da, während sich um sie herum Gemurmel erhob. Ein älterer Mann hatte begonnen, die Frau auf Jiddisch zu beschimpfen. Rivka griff nach ihrer Plastiktüte und floh auf die Straße. Sie fühlte sich besudelt, verabscheuenswert und – zum ersten Mal, seit sie ihre Familie verlassen hatte – beschämt. Mit von Tränen verschwommenem Blick eilte sie in die Sicherheit des Untergrundes.
6
Chani. Mrs Kaufman.
Oktober 2009 – London, Jerusalem
»Chas we Shalom! Was meinst du damit, du kannst kein Baby bekommen, Chanaleh? Natürlich kannst du. Manchmal brauchen diese Dinge einfach ein bisschen Zeit.«
Mrs Kaufman stand in ihrer Küche, das Telefon zwischen Ohr und Schulter geklemmt, während sie den Teig für das Challa klatschte und knetete. Ihr Kinn wackelte bei der Arbeit. Heute Abend war Schabbes, und als hätte sie das bereits vergessen, rief ihre fünfte Tochter ausgerechnet jetzt mit einer solchen Nachricht an. Nun weinte Chani. Mrs Kaufman konnte ihre Trauer spüren – sie nagte an ihrem großen Herzen, und ihre eigenen Augen begannen zu brennen. Hastig wischte sie sich die tropfende Nase am Ärmel ab.
»Chani, hör bitte einen Augenblick auf zu weinen. Du hast nur etwas Pech gehabt, sonst hättest du schon längst ein Baby, und du wirst ein Baby bekommen, Chanaleh, denn du bist meine Tochter, und niemand kann behaupten, dass dein Vater und ich je Probleme gehabt hätten, Kinder in die Welt zu setzen. Keinehora.«
Wahrere Worte waren nie gesprochen worden. Unter ihrem lockeren Hauskleid war in Mrs Kaufmans ewig fruchtbarem Leib gerade schon wieder ein neues Leben aufgeflackert. Im Alter von sechsundvierzig Jahren bereitete sich ihr müder, alter Körper darauf vor, ein neuntes Kind zur Welt zu bringen. Aber diesmal, Besrat HaSchem, würde es ein Junge sein. Da war sich Mrs Kaufman sicher. Das hatte sie im Urin. Doch Taktgefühl und Sorge hielten sie davon ab, diese besondere Freude mit ihrer Tochter zu teilen. Stattdessen schickte Mrs Kaufman ein stilles Gebet gen Himmel und drängte HaSchem, Chani so schnell wie möglich mit einem Kind zu segnen. Am besten gleich.
»Keine deiner Schwestern hat Probleme, Kinder zu bekommen, und du auch nicht. Du wirst schon sehen, Chani, du wirst viele Kinder bekommen, Besrat HaSchem. Habt ihr eure Mesusas überprüfen lassen? Wenn damit etwas nicht stimmt, kann das euer Masel beeinträchtigen.«
Chani verdrehte die Augen. »Ja, Mum, wir haben sie alle überprüfen lassen. Sie sind in Ordnung.«
»Wart ihr schon bei eurem Rabbi in Jeruschalajim? Was hat er gesagt?«, fuhr Mrs Kaufman fort. Ihre geschwollenen Füße brachten sie fast um. Eine Frau musste viel erdulden. Sie zog sich einen Hocker heran, ließ sich schwerfällig darauf nieder und schloss erleichtert die Augen.
»Er sagte, wir sollen weiter beten, es weiter versuchen, und ich solle das Grab der Matriarchinnen in Tiberias besuchen und um Hilfe bitten. Nach den letzten Angriffen auf die Checkpoints ist es aber zu gefährlich, dorthin zu reisen. Baruch fürchtet sich davor zu fahren, und davon abgesehen, beten wir wie meschugge, und nichts passiert!«
Sie begann wieder zu schluchzen, und das unbarmherzige Elend überwand Tausende von Meilen. Mrs Kaufmans Herz schmerzte vor Mitleid. Ihre Chani, immer ein wenig anders, immer etwas widerspenstig, litt. Und wenn ein Kind leidet, dann leidet auch die Mutter. Mrs Kaufman wechselte das Ohr und begann, den Teig in drei gleich große Portionen zu teilen.
»Komm nach Hause, Chanaleh. Bring Baruch mit, und bleib bei uns, wir fragen Dr. Weinstein um Rat.«
»Also, Mum, genau genommen fliegen wir nächsten Dienstag. Baruchs Dad hat unsere Flüge bereits gebucht. Er kennt einen Top-Kinderwunsch-Spezialisten und hat uns bereits einen Termin bei ihm gebucht.« Chanis Stimme klang tonlos.
Mrs Kaufman erstarrte. Wie üblich waren die Levys ihnen zuvorgekommen.
»Oh, okay. Und wo werdet ihr übernachten? Ich kann Devorahs altes Zimmer für euch herrichten.«
Chani biss sich auf die Lippe. Sie wollte ihre Eltern nicht verletzen, indem sie ihre Gastfreundschaft zurückwies. Doch sie konnte sich Baruch unmöglich im Chaos ihres Elternhauses vorstellen, mit den schäbigen Zimmern, dem feuchtkalten Bad im Obergeschoss und den Wänden, die jedes Knarren preisgaben. Baruch war schon dort gewesen, aber es war dennoch peinlich – und er war noch nie über Nacht geblieben. Sie schämte sich, dass sie sich schämte.
»Mum, öhm, Dovid – ich meine, Mr Levy – hat uns eine Unterkunft besorgt. Wir können in einem seiner leer stehenden Apartments wohnen. Es ist in einem Mietshaus in Golders, also ganz in der Nähe, und wir können euch jeden Tag besuchen«, schloss sie wenig überzeugend.
Mrs Kaufmans Hände begannen ihren wöchentlichen Tanz und flochten die Teigstränge zu einem ordentlichen saftigen Laib.
»Das dachte ich mir schon. Unser Haus ist also nicht mehr gut genug für Eure Hoheit?«
Chani rollte mit den Augen. »Ach, komm, Mum. Mach es nicht noch schlimmer. Bitte, tu mir das nicht an. Hier geht es nicht um euch gegen die Levys. Aber wir brauchen ein bisschen Privatsphäre, weil alles schon schwer genug ist.«
Mrs Kaufman strich mit einem in Eigelb getauchten Backpinsel über den Brotlaib, schob ihn in den Ofen und knallte die Tür zu. Bei dem vertrauten metallischen Scheppern zuckte Chani zusammen. Als Nächstes würde ihre Mutter sich die Hände an einem Geschirrtuch abwischen, nach einer Flasche Reinigungsspray greifen und den verschmierten Küchentresen in weiten, großzügigen Bögen einsprühen.
Mrs Kaufman schniefte. »Wie du willst, Chanaleh. Wir warten hier auf dich. Sie können euch geben, was wir euch nicht geben können, und dafür, Baruch HaSchem, sollte ich vermutlich dankbar sein.«
»Mum, das weiß ich sehr zu schätzen. Tue ich wirklich. Ich kann es kaum erwarten, euch alle wiederzusehen.«
»Oh, Chanaleh, Schabbes steht vor der Tür, und ich habe noch so viel zu tun. Darf ich deinem Vater erzählen, dass ihr kommt? Und warum?« Oben hatte ein Kind angefangen zu heulen, und Mrs Kaufmans Aufmerksamkeit kehrte zum Naheliegendsten zurück.
Chani dachte an ihren Vater. Sie wollte ihn nicht traurig machen. Und sie kannte den Hang ihrer Mutter zur Melodramatik.
»Natürlich, aber beunruhige ihn nicht so sehr. Spiel es vielleicht ein wenig runter, nu? Wir sehen uns bald. Einen schönen Schabbes.«
»Ich geb mein Bestes. Besrat HaSchem – all das wird bald nur noch wie ein schlechter Traum sein, nu? Einen schönen Schabbes, Chanaleh. Ruf mich an, wenn ihr gelandet seid, ja?«
»Okay, Mum. Besrat HaSchem.«
7
Chaim
November 2009 – London
Rabbi Zilberman stand vorn in seiner Schul, eingehüllt in den Tallit. Die schwarze Kapsel der Tefillin war fest an seine Stirn gebunden, und um den rechten Arm war der schwarze Lederriemen geschnürt. Die übliche Gruppe frühmorgendlicher Betender hatte sich versammelt, Männer im Tallit und genauso verschnürt. Sie hielten ihre Gebetsbücher in der Hand, während sie schwankten und wippten. Die Schul war in morgendlichen Sonnenschein gebadet. In der schläfrigen Stille begann Rabbi Zilberman, flüsternd die Amida zu rezitieren. Die Betenden wiederholten seine Worte in ihrem eigenen Tempo. Der alte Mr Ackerman, schwerhörig und für das generelle Gebot der stillen Hingabe nicht zugänglich, sang klangvoll.
»Herr, öffne meine Lippen, so wird mein Mund dein Lob verkünden.«
Rabbi Zilberman beugte die Knie und verneigte sich, die Füße ordentlich nebeneinander.
Man hörte ein leises Glucksen. Sein Kopf fuhr von seinem Siddur hoch, und er erwischte zwei junge Männer ganz hinten, die unter der Abgeschiedenheit ihrer Gebetsschals prusteten und kicherten. Sie stießen sich gegenseitig mit den Ellenbogen an, und als sie aufsahen, erhaschte Rabbi Zilberman einen Blick auf ihre von verbotener Schadenfreude verzerrten Gesichter. In der ersten Reihe lachte jemand, als Mr Shtein, ein ältlicher Buchhalter, dessen missmutige Natur so etwas wie Unbeschwertheit eigentlich verbot, etwas so amüsant fand, dass er sich nicht zurückhalten konnte. Das Gelächter schwoll zu ansteckenden Wellen hysterischen Gekichers an. Männer rollten sich in den Bankreihen herum, wischten sich mit den heiligen Zipfeln ihrer Schals die Lachtränen ab. Junge und Alte sackten gegeneinander, prusteten, zeigten, hielten sich die Bäuche und schnappten nach Luft.
»Halt!«, schrie Rabbi Zilberman. »Hört sofort mit diesem Unsinn auf!«
Doch das Lachen schwoll an, bis es ein Dröhnen war. Die Männer stampften und johlten, Kippot verrutschten, Tallitot glitten zu Boden. Sie konnten einfach nicht mehr an sich halten, und einige rannten hastig zu den Türen. Rabbi Zilberman wandte sich Hilfe suchend seinem Gabbe und seinem Kantor zu, doch beide Männer lagen sich auf dem weichen blauen Teppich der Bima in den Armen und strampelten mit den Beinen wie Babys in ihrer Wiege.
Rabbi Zilberman stand ganz allein da. Er schaute langsam an sich herunter – abgesehen von seinem Gebetsschal war er nackt. Sein Bart kitzelte ihn an den Rippen, als er sich vor Scham hinkauerte. Er wickelte seinen Schal so gut es ging um sich und stolperte die Stufen Richtung Mittelgang hinunter, auf die hinteren Türen der Synagoge zu. Das Gespött und Gekreische drang verletzend in seine Ohren. Als er es wagte, ins Gesicht des am nächsten Stehenden zu schauen, sah er die Züge seiner geliebten, von ihm getrennt lebenden Frau.
Sie stand vor ihm, hielt sich den Bauch und kicherte hämisch. Rivka trug einen Herrenanzug, mit einem Gebetsschal um die Schultern. Noch seltsamer war, dass die untere Hälfte ihres Gesichts von einem prächtigen Bart verborgen war, der sich mit ihrem offenen Haupthaar mischte und die gleiche Textur und Farbe hatte. Ihr weicher, rosiger Mund stand offen, und die Zähne blitzen auf, doch ihre Augen lächelten nicht. Sie blieben kalt und musterten ihn mit bitterer Gewissheit, während Welle um Welle der Heiterkeit sie überkam wie ein endloser Orgasmus.
Chaim wachte auf. Sein Herz pochte wie ein Fleischklopfer, der ein Schnitzel bearbeitete, und er war schweißgebadet. Er stieß die Bettdecke weg und lag in der kalten Luft des Schlafzimmers, während er darauf wartete, dass sein Atem sich beruhigte. Es war noch dunkel. Die ersten Vögel hatten zaghaft zu singen begonnen. Auf der Straße war es still, und die kleinen Häuser mit ihren Terrassen schlummerten noch im Schein der Straßenlaternen. Seine Kinder schliefen, Michal im Mansardenzimmer und Moishe in dem winzigen Zimmer nebenan. Durch die dünne Wand konnte er Moishes leises Schnarchen hören.
Chaim rollte sich zur Seite und begann mit dem Morgengebet. »Ich danke Dir, ewig lebendiger König, dass Du mir in Liebe meine Seele wiedergegeben hast, groß ist Deine Treue.«
Doch seine Seele war weit entfernt davon, erfrischt und verjüngt zu sein. Er hatte sie HaSchem während des Schlafs anvertraut, und doch war er von diesem grotesken, gottlosen Terror eines Traumes heimgesucht worden. Was wollte HaSchem ihm damit sagen? Nu? Sein Geist war immer noch in Aufruhr, und er war müde bis auf die Knochen. Er setzte sich auf, schwang die Beine über die Bettkante und griff nach einem kleinen Plastikbecken, in dem sich ein Krug mit zwei Henkeln und sauberes Wasser befanden. Chaim wusch sich die Hände und betete.
Seit Rivka ihn verlassen hatte, wurde er jede Nacht von denselben Bildern heimgesucht, bis er eine Schlaftablette nahm. Dann schlief er tief und traumlos wie ein Toter und wachte erschöpft und mit trockenem Mund wieder auf. Die Bedeutung des Traums war ihm vollauf bewusst. Die Gerüchteküche der Kehilla brodelte, die Leute redeten. Wo war die Rebbetzin Rivka? Wann würde sie zurückkommen? Warum war sie verschwunden? Zuerst hatte er die höflichen, besorgten Nachfragen mit Lügen abgewimmelt, wegen der er sich bitterlich schämte. Er hatte freundlich gelächelt, sich bedeckt gehalten und geantwortet: »Danke, dass Sie fragen, Baruch HaSchem geht es ihr gut, sie ist nur zu Besuch bei ihrer Familie in Eretz Israel. Ihr Onkel ist sehr krank.«
Irgendwann hatte sich das Mitgefühl abgenutzt, und die Leute fragten nicht länger nach ihr. Dann begann man zu munkeln. Gespräche verstummten abrupt, wenn er einen Raum betrat, und er spürte, wie die Blicke der Kehilla fragend und erwartungsvoll auf ihm lagen.
Bis er schließlich eine Vorladung des Beth Din erhielt, des Rabbinergerichts. Die Abwesenheit seiner Frau sorge für Anspannung innerhalb seiner Gemeinde. Wenn ein Rabbi mit gutem Beispiel vorangehen sollte, dann musste seine Frau bei ihm bleiben und sich nicht in Luft auflösen. Er hatte den Brief in der Innentasche seiner Jacke vor den Augen von Michal verborgen, die nun die Wäsche sortierte. Dort steckte er, zerknittert und nachdrücklich, und jedes Mal, wenn er seine Jacke überzog, hörte er das vorwurfsvolle Knistern. Er hatte ihn nur einmal gelesen, doch die beschämenden Details hatten sich ihm ins Gedächtnis gebrannt. Er hatte noch zwei Wochen, bevor er vor Gericht erwartet wurde.
Der Ruf der Natur zwang ihn aufzustehen. Er antwortete ihm, dankte HaSchem, wusch sich die Hände und sagte das Waschgebet. Heute war es so weit, entschied er. Während er am Fußende seines Einzelbettes stand und sich tief in Richtung Jerusalem verbeugte, kniff er die Augen fest zu, um das Bett seiner Frau nicht sehen zu müssen. Der Bezug war nach wie vor straff und das Kissen prall. Die Kiefernholzkommode stand weiterhin zwischen den Betten, ein plumper hölzerner Posten, der einen hohlen Bund bewachte.
8
Rivka
November 2009 – London
Rivka schnitt durch den Kunststoff und befreite Hunderte von Dosen mit Baked Beans. Sie räumte sie methodisch ein, die Etiketten nach vorn, arbeitete effizient, und innerhalb von fünf Minuten war die ganze Einheit aufgefüllt. Rivka trat zurück, um ihre Arbeit zu bewundern und die Ordnung ihrer Reihen zu überprüfen.
»Probieren Sie an unserer Fischtheke das frische Seehechtfilet aus nachhaltigem Fang in britischen Gewässern. Beim Kauf von einem erhalten Sie das zweite zum halben Preis! Nur heute!«, sang die Lautsprecheranlage.
Rivka schob ihren Palettenwagen die Gänge entlang, überprüfte Mindesthaltbarkeitsdaten und räumte umgefallene Waren auf. Sie mochte ihren Job. Die Schichten waren lang und anstrengend, doch die geistlose und monotone Arbeit beruhigte sie. Hier konnte sie in Ruhe nachdenken. Und es bezahlte ihre Miete.
Als Mitarbeiterin bekam sie außerdem Vergünstigungen, und das Personal war freundlich. Niemand kannte sie als die Rebbetzin, sie war Rivka. Niemand urteilte über sie. Die Pausen bestanden entweder aus einer Tasse Tee in geselligem Schweigen oder einem stetigen Strom an vergnügten Scherzen. Jede Schicht bestand aus einer Gruppe zufällig zusammengewürfelter Leute. Da war Gladys, Mitte siebzig, die seit zwanzig Jahren an der Kasse arbeitete. Sie wusste alles, was es über die Kassen zu wissen gab, und hatte jeder einen Spitznamen gegeben. Gladys hatte Rivka beigebracht, wie man mit dem »Alten Miststück« umging, einer zuverlässigen Kasse, die allerdings die schlechte Angewohnheit hatte, die Bonrollen zu zerkauen. Gladys trug eine Dauerwelle mit gefärbten Haarspitzen und eine pinkfarbene Brille. Die jüngere Belegschaft nannte sie liebevoll Omi, selbst in ihrer Anwesenheit, und es schien ihr nichts auszumachen. Gladys schwatzte mit allen und jedem. Sie war ein fröhlicher, optimistischer Mensch, bis ein Kunde, oder, schlimmer noch, jemand aus der Belegschaft, beim Klauen erwischt wurde, was zu traurigem Kopfschütteln führte.
»Es gibt immer jemanden, der nicht widerstehen kann«, murrte sie dann, die Lippen zu einer schmalen Linie gekniffen.
Dann war da Kaleesha. Mit achtzehn lebte sie mit zwei jüngeren Schwestern bei ihrer Mutter. Kaleesha besaß die ruhige Gelassenheit eines weitaus älteren Menschen. Sie arbeitete, um ihre Mutter zu unterstützen, aber träumte davon, Rechtsanwältin zu werden.
»Ich habe nicht vor, ewig diesen Job zu machen«, hatte sie Rivka eines langen Nachmittags anvertraut. Sie hatten die Brotregale sortiert und die Ware gekennzeichnet, die reduziert werden würde. Umgeben von Hovis-Laiben und Warburton-Crumpets, hatte sie ihre Ziele umrissen. »Ich möchte ein schönes Haus, ein schönes Auto, ich möchte nicht bloß einen Job, sondern eine Karriere, und ich möchte in der Lage sein, mich um meine Mutter und meine Schwestern zu kümmern. Ich wünsche mir Stabilität. Die Noten dafür habe ich. Alles Einser in Englisch, Geschichte und Wirtschaft. Ich muss mich nur fürs nächste Semester bewerben.«