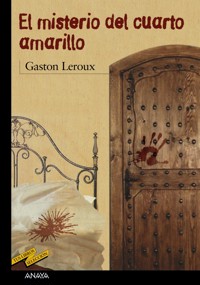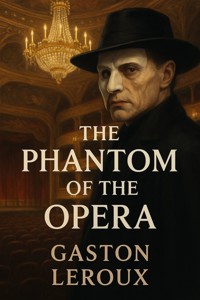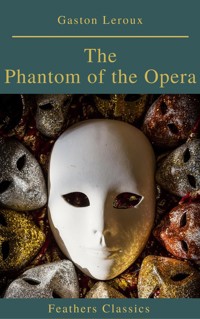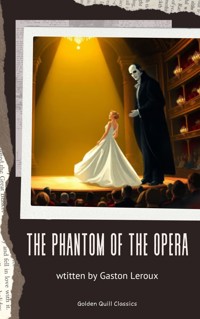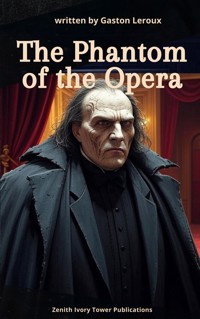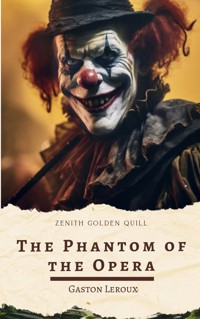Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Königin des Sabbats
- Sprache: Deutsch
Fanatischer politischer Hass, kriminelle Energien und politisches Kalkül prägen den autoritär regierten Vielvölkerstaat "Austrasien". Unter Führung einer mysteriösen"Königin des Sabbats" bereiten ethnische Minderheiten einen Aufstand vor. Ausgangspunkt des Romans ist der im Prolog geschilderte Mord an dem moldawischen Fürsten Réginald Rakovitz-Yglitza: ein persönlicher Racheakt und zugleich eine politisch motivierte Hinrichtung, die verhindern soll, dass im Südosten Europas ein autonomer Staat der "bohémiens" (im Französischen synonym "Zigeuner" und "Böhmen") ausgerufen wird. Es entsteht ein weit gespanntes Netz undurchsichtiger Intrigen und Gegenintrigen. Groteske Gestalten und skrupellose Geschäftsreisende, unscheinbare Handwerksleute und gewissenlose Spitzel sind in die unheimlichen Begebenheiten verstrickt. Wie in seinem Erfolgsroman "Das Phantom der Oper" gelingt es Gaston Leroux, seine Leserschaft schon auf den ersten Seiten in den Bann zu schlagen. Mit der ihm eigenen Lust am Fabulieren hat der Autor einen fantastischen Mikrokosmos aus Sonderlingen, Außenseitern, gemeingefährlichen Militärs, Künstlern und Heroinen geschaffen. Zwischen Paris und Wien, zwischen Camargue und Schwarzwald, auf unterschiedlichen Schauplätzen und in wechselnden Konstellationen agieren zwielichtige Charaktere wie der "Uhrmacher" Baptiste, der namenlose "Regenschirmhändler", die uralte "Bäuerin des Schwarzwalds" oder auch der "parallelepipedische Zwerg" Magnus mit seinen fünf Gliedmaßen und der kleptomanisch veranlagte Petit-Jeannot. Die "Königin des Sabbats" ist eine Parabel auf die Habsburger Monarchie wie auf das zaristische Russland um 1900. Der Autor, der mit den politischen Verhältnissen in beiden Reichen gut vertraut war, beschreibt in fantasievoller Einkleidung die ethnischen Konflikte in Mittel- und Osteuropa, die das überkommene monarchische Gefüge zum Einsturz bringen werden. Entsprechend fehlt es der Erzählung nicht an historischen Schlüsselfiguren oder Anspielungen auf konkrete Begebenheiten wie etwa die Skandale um die Erzherzöge Friedrich und Albert, die Kaiserin Sissy, das "Verbrechen" in Mayerling u.a.m. Der multi-kulturelle Reigen, den die "Königin des Sabbats" anführt, ist ein Tanz auf dem Vulkan, der zu einem allgemeinen Totentanz zu eskalieren droht. Der Roman ist ein unterhaltsames Meisterwerk der französischen Literatur. Er liegt hiermit erstmals in deutscher Übersetzung vor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 289
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gaston Leroux (1868-1927) war als Rechtsanwalt tätig, bevor er sich als politisch engagierter Journalist einen Namen machte. Dem deutschsprachigen Publikum ist er vor allem durch seinen 1910 erschienenen Roman ›Das Phantom der Oper‹ bekannt geworden. Im selben Jahr publizierte er mit ›La Reine du Sabbat‹ einen weiteren fantastischen Roman, der heute als sein »absolutes Meisterwerk« (Alain Fuzellier) gilt und nun erstmals in deutscher Übersetzung vorliegt.
Heinz Georg Held war Fremdsprachenlektor und Professor für deutsche Literatur an der Università degli Studi di Pavia. Er lebt heute als freier Schriftsteller in Italien. Übersetzt hat er u.a. Werke von Alphonse Allais, Carlo Collodi, Roberto Longhi, Umberto Eco, Claudio Magris und Salvatore Settis.
HINWEIS
Der vorliegende fantastische Roman, der kurz vor dem Ersten Weltkrieg erschienen ist, verwendet den damals geläufigen Begriff ›Zigeuner‹ und rekurriert auf seinerzeit gängige Vorurteile und Stereotypen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die sogenannten ›Zigeuner‹ dieser Geschichte die unterschiedlichen Völker der südlichen Balkan repräsentieren, die sich gegen die Vorherrschaft der Habsburger auflehnen. Es ist möglich, dass vor allem Angehörige der Sinti und Roma einige Textpassagen als diskriminierend empfinden werden.
INHALT
PROLOG
1. Réginald
2. Ein intimes Fest in der Botschaft von Austrasien
3. In den Fluren der austrasischen Botschaft
4. Das Lachen der Königin
ERSTER TEIL: DIE MYSTERIEN DER KRYPTA
1. Saintes-Maries-de-la-Mer
2. Im Innern der Krypta
3. Petit-Jeannot bereut seine Neugier
4. Wettlauf mit dem Stern
ZWEITER TEIL: DIE GÖREN UND GEISTER DES SCHWARZWALDS
1. Die Postkutsche des Höllentals
2. Die Puppen
3. Zwei alte Freunde
4. Bekanntschaft mit dem ›Vater Viertel nach Zwei‹
5. Jakob Ork
6. Der Kurier von Schaffhausen
7. Die Hatz
8. Petit-Jeannot fürchtet um sein Leben
PROLOG
Jesus sei
wie zu allen Stunden
um Viertel nach Zwei
deinem Herzen verbunden!
1. Kapitel
Réginald
Das Palais Royal schien geradezu menschenleer. Es war zwei Uhr nachmittags, und die klaren Strahlen der Herbstsonne vergoldeten die Stille des weitläufigen und zu dieser Stunde vollkommen verlassenen Gartens. Ein Schatten glitt an der Galerie der Rue des Bons-Enfants entlang, als auf dem Steinpflaster, das die kleine Geschäftsstraße säumte, die festen Schritte eines Mannes erklangen.
Es war die Stunde der Mittagsruhe. Nicht ein einziges neugieriges Gesicht zeigte sich hinter den Fensterscheiben, um diesen einsamen Passanten in Augenschein zu nehmen, obwohl man seinen Aufzug als durchaus ungewöhnlich bezeichnen durfte. Ein schwerer, sorgfältig plissierter und mit scharlachrotem Futter versehener Mantel aus schwarzem Velours umhüllte ihn von Kopf bis Fuß; ein schwarzer Filzhut, dessen Vorderseite ein Veloursknoten und eine Silberschnalle im Stil des Directoire zierten, bedeckte einen Kopf, wie man ihn sich edler kaum hätte vorstellen können: ein Profil von königlicher Aristokratie, ein Gesicht, dessen matt-blasser Teint vom Feuer eines leuchtenden Blicks erhellt wurde. Es schien, als sei die ganze Gestalt des mysteriösen Unbekannten von einer äußerst heftigen Erregung erfasst. Er öffnete die Lippen und stieß seltsame Worte halblaut hervor, während seine Hände ein Papier zerknüllten, das er schließlich zerriss; die Fetzen warf er verächtlich in den Wind.
Er hatte die Ecke zur Galerie d’Orléans erreicht; dort hielt er sich links und blieb schließlich in einem Gang des Palais vor der Auslage eines Uhrmachers stehen. Es war ein bescheidener Laden. Auf dem Schild stand: ›Monsieur Baptiste, Uhrmacher‹.
Hinter dem Schaufenster erblickte man »Monsieur Baptiste« bei seiner Arbeit. Eine Lupe vor das eine Auge geklemmt, hatte er sich über einen Uhrenkasten gebeugt, der seine ganze Aufmerksamkeit beanspruchte. Auf einer Werkbank neben ihm lagen die Instrumente, die er für sein Handwerk benötigte: Radiernadeln, Eisenspitzen und Feilen. Im Schaufenster hingen einige Silberketten, einige Uhren sowie einige ›Zwiebeln‹. Die Auslage war armselig und keineswegs die eines Juweliergeschäfts.
Der Mann stieß die Ladentür auf und trat ein. In diesem Moment war es genau zwei Uhr und zehn Minuten. Monsieur Baptiste blickte auf und zeigte dem Besucher sein ruhiges, von Falten durchzogenes und allem Anschein nach frühzeitig gealtertes Gesicht, das von einem mächtigen grauen Bart vollständig gerahmt wurde.
»Guten Tag, Monsieur Baptiste«, sagte der Mann, indem er sich mit einer vornehmen Gebärde gleichwohl tief verbeugte. »Ihr seid nach wie vor bei guter Gesundheit?«
»Bei bester Gesundheit ...«, antwortete der Uhrmacher, indem er seine Lupe ablegte und sich in seinem langen schwarzen Kittel aufrichtete. »Es geht mir ausgezeichnet ... und gerade heute, zu dieser Stunde, geht es mir ganz besonders gut ... Monseigneur kommen gewiss aufgrund seiner kleinen Bestellung? Wenn Monseigneur mir bitte folgen wollen ...«
Während sie auf den hinteren Teil des Ladens zuschritten, hob ein Lehrling seinen Kopf, der die ganze Zeit in einem schattigen Eckchen über einen Tisch gekrümmt kleine stählerne Instrumente gereinigt hatte. Zweifelsohne war er neugierig, einen Kunden in diesem Laden zu erblicken, der in der Tat nur selten Kundschaft sah.
»Willst du wohl arbeiten, du Taugenichts, du Faulenzer, du Bandit!«, rief der Uhrmacher und versetzte dem Kopf des Jünglings einen leichten Schlag, damit er sich wieder über seine Arbeit beugte.
Der Besucher konnte sich eines mitleidigen Blicks auf den jungen Lehrling nicht erwehren, der nun unversehens ein überaus seltsames Schauspiel bot: Unter dem Schlag, der ihn traf, war er vom Sitz emporgeschnellt und streckte sich kerzengerade in die Luft wie einer jener federnden Hampelmänner, die, wenn man sie mit einem Faustschlag auf den Kopf traktiert, einen Satz aus ihrem Kasten machen und dabei in diabolische Zuckungen verfallen. Häufig strecken diese spiralförmigen Korkenzieherpuppen auch noch dreist die Zunge heraus; und tatsächlich zeigte auch der Lehrling dem Uhrmacher seine Zunge, deren kräftiges Scharlachrot seine vollkommene Gesundheit unter Beweis stellte, und nachdem er sich zu einer unglaublichen Länge gereckt hatte, wobei sein kleiner Jünglingskopf beinahe gegen das Deckengebälk gestoßen wäre, krümmte er sich wieder oder vielmehr: schrumpfte er regelrecht in sich zusammen und fiel auf seinen Sitz zurück.
»Was ist denn das für ein seltsamer Mechanismus?«, fragte ›Monseigneur‹.
»Ach, Monseigneur, das ist mein neuer Lehrling; er heißt Jeannot, ist keine sechzehn Jahre alt, misst zwei Meter fünfzehn und treibt seine Eltern zur Verzweiflung. Er wird zweifelsohne auf dem Schafott enden.«
Genannter Jeannot beschränkte sich darauf, zum Zeichen seines Protestes mit den Ohren zu wackeln. Doch waren die beiden Männer bereits vor einer Tür angelangt, auf die offenbar ihr ganzes Interesse gerichtet war. Monsieur Baptiste öffnete sie mit einem Schlüssel, den er aus seiner Tasche zog. Daraufhin wurden einige Höflichkeiten ausgetauscht, doch war der Fremde partout nicht dazu zu bewegen, vor Monsieur Baptiste einzutreten. Sodann wurde die Tür wieder geschlossen.
Sie befanden sich nun in einem engen Raum, der nur von einem einzigen Fenster erhellt wurde, einer Art Dachluke, die sehr hoch angebracht war und die ihre wenigen Lichtstrahlen auf ein großflächiges Gemälde fallen ließ, das die gegenüberliegende Wand nahezu vollkommen einnahm. Die restlichen drei Wände waren von oben bis unten mit Uhren von der Größe eines Fünf-Francs-Stücks bedeckt, die einander vollkommen zu gleichen schienen: Insgesamt waren es sicherlich dreihundert.
Das Gemälde stammte aus einer guten Werkstatt und zeigte einen Exerzierplatz: Truppen einer ausländischen Nation in Paradeaufstellung, Generalstabsoffiziere, die in weiße Waffenröcke gekleidet an den Reihen entlanggaloppierten, an ihrer Spitze eine Persönlichkeit, die ihrer eindrucksvollen Erscheinung wegen und aufgrund des Respekts sowie der begeisterten Hochrufe der dargestellten Zuschauer zumindest den Rang eines Erzherzogs bekleiden musste. Im Vordergrund dieses hurrapatriotischen und zugleich sentimentalen Gemäldes war eine junge Schönheit dargestellt, welche die Augen starr auf den vorbeiziehenden Prinzen gerichtet hielt, dabei in Ohnmacht und geradewegs in die Arme ›ihrer in Tränen gebadeten Eltern‹ fiel.
Sowie sie den Raum betreten hatten, vertiefte sich Monsieur Baptiste in die Betrachtung des Bildes, während der Besucher die Uhren in Augenschein nahm, die alle dieselbe Zeit – nämlich die korrekte Uhrzeit – anzeigten: Es war Viertel nach Zwei. Und genau in diesem Augenblick begannen alle gleichzeitig Zwölf zu schlagen. Weder Monsieur Baptiste noch sein Kunde zeigten sich jedoch im mindesten davon überrascht, diese Uhren unisono die Mittagszeit schlagen zu hören, obwohl es eigentlich Viertel nach Zwei war.
Als das Getöse verstummte, nahm der Fremde eine der Uhren zur Hand und studierte sie aufmerksam. In die weiße Emaille des Ziffernblattes war eine rote Inschrift eingraviert:
Jesus sei
wie zu allen Stunden
um Viertel nach Zwei
deinem Herzen verbunden!
Der Unbekannte steckte die Uhr in seine Tasche und fragte, indem er auf die anderen Uhren wies, welche dieselbe Inschrift in Blau trugen:
»Liegt die Rechnung bei?«
Monsieur Baptiste bejahte mit einem kurzen Kopfnicken. Er sah seinem Besucher jetzt direkt ins Gesicht, und in seinem traurigen Blick lag die Ahnung eines drohenden Unheils.
»Réginald, sagte er, sind deine Leute bereit?«
»Sie sind bereit und warten nur auf ein Zeichen.«
»Sie sollen sich gedulden ... und du – sei vorsichtig.«
Bei dieser Warnung fuhr der Mann zusammen, doch er erwiderte nichts. Monsieur Baptiste schüttelte den Kopf. Mit einem Seufzer fragte er:
»Wirst du heute Abend hingehen?«
»Ja«, antwortete Réginald mit belegter Stimme, »ja, ich gehe. Obwohl ich eine anonyme Warnung erhalten habe. Man lässt mich wissen, dass ich dort ermordet werden soll.«
»Ja, du weißt, sie sind zu allem fähig! Nimm dich in Acht!«
»Aber warum denn? Sie werden mich wohl nicht mitten im Salon ermorden.«
»Sei auf der Hut und gehe bewaffnet hin!«
»Aber gewiss doch: mit meiner Geige bewaffnet!«, entgegnete der Angesprochene stolz.
Liebevoll ergriff Monsieur Baptiste seine Hände. Er unternahm einen letzten Versuch:
»Réginald, wenn du nicht hingingest ...«
Sein Gegenüber verfärbte sich wachsbleich.
»Ihr wisst, dass ich sie seit zwei Jahren nicht gesehen habe«, erwiderte er, »lieber würde ich sterben.«
Nunmehr verloren sie kein weiteres Wort. Sie begannen damit, die Uhren von den Wänden zu nehmen und in zwei auf dem Boden liegende Kisten zu verpacken, die ganz so aussahen, als wären sie für Musterwaren von Handlungsreisenden bestimmt. Die doppelte Last musste von beträchtlichem Gewicht sein, doch trug Réginald sie mit ungezwungener Leichtigkeit. Der Uhrmacher begleitete seinen Besucher bis zur Schwelle des Ladens. Nachdem Réginald seine Bürde einen Moment lang abgestellt hatte, gaben sich die beiden Männer zum Abschied die Hand; kaum vermochten sie dabei ihrer Bewegung Herr zu werden. Endlich trat Monsieur Baptiste in das Ladeninnere zurück und nahm seine Arbeit wieder auf, indem er leise murmelte: »Wie dem auch sei, sie werden es nicht wagen!«
Réginald hatte unterdessen mit seinen beiden Kisten die Straße erreicht. Er folgte ihr, bis er das Palais Royal hinter sich gelassen hatte. Auf der Höhe der Rue de la Banque hielt er kurz inne, betrat, nachdem er sich umgeblickt hatte, wiederum die Galerien und stieg dann durch eine Art Treppenhaus zu jenen unterirdischen Gewölben hinab, in denen man noch heute Pilsener Bier vom Fass verkauft. Als Réginald wieder auftauchte, trug er nur noch eine der beiden Kisten. Er rief eine Droschke. In dem Moment, da er das Gefährt besteigen wollte, fiel sein Blick auf einen hausierenden Regenschirmverkäufer.
Wo habe ich diese Gestalt schon einmal gesehen? fragte er sich.
Er sagte dem Kutscher, er solle ihn zum Splendid Hotel fahren. Dort erwartete ihn ein prächtig aufgeschirrter herrschaftlicher Wagen. Er ließ es sich nicht nehmen, die ihm verbliebene Kiste eigenhändig bis zu diesem Gefährt zu tragen; daraufhin gab er dem Diener eine Anweisung. Die Equipage setzte sich in Bewegung, sie fuhr in Richtung Seine, dann überquerte sie den Fluss und schoss pfeilschnell durch den Vorort Saint-Germain, fuhr durch die Rue des Écoles und erklomm die Höhen der Gobelins, bis sie Paris schließlich durch die italienische Schranke verließ. Erst drei Kilometer weiter hielt die Kutsche, am Rande eines kahlen Feldes, das dem Blick nichts anderes bot als Unrat und Flaschenscherben. Inmitten dieses öden Geländes stand ein erbärmlicher Karren, an dem ein Schild angebracht war: »Hier wohnt die Bäuerin vom Schwarzwald«.
Wenn sie es in eigener Person war, die hier, das Kinn in die Hände gestützt, auf den Stufen der Holztreppe saß, so hatte die ›Bäuerin des Schwarzwaldes‹ tatsächlich das wohlbekannte Aussehen einer Hexe. Mit scheuem Blick sah sie, wie der Mann näherkam. Als er die Treppe erreicht hatte, die ihr als Sitzgelegenheit diente, erhob sie sich und sagte mit einer Stimme, die erschreckend hohl klang:
»Komm herein! Ich habe auf dich gewartet. Die Vorzeichen sind schrecklich.«
Er folgte ihr und betrat mit seiner Kiste den Wagen. An allen Wänden und auch von der Decke herab hingen unzählige aromatische Pflanzen, hustenstillende Mittel, FrauenhaarWurzeln, wildgewachsene Stiefmütterchen und allerlei andere Kräuter mit mysteriösen Eigenschaften, deren Geheimnisse der ›Bäuerin vom Schwarzwald‹ zweifelsohne bekannt waren.
»Hier sind die Stunden!«, verkündete der Mann, indem er die Kiste abstellte. »Du kennst deine Aufgabe, Giska. Ich kann jetzt keine Zeit mit deinem Salem Aleikum vergeuden. Adieu!«
Aber die Alte packte ihn am Handgelenk.
»Warte«, sagte sie, »ich habe etwas für dich vorbereitet. So wahr, wie ich in eine Katze verwandelt worden bin, wirst du nicht von hier fortgehen, ohne zu wissen.«
Und bevor er noch Zeit finden konnte, sich zu widersetzen, hatte sie bereits eine Handvoll Körner auf ein glühendes Kohlenbecken geworfen, was den Wagen augenblicklich mit dichtem Rauch und unerträglichem Gestank erfüllte. Die Hexe hatte sich sogleich auf eine Art Dreifuß geworfen, der aus drei Haselnussruten gefertigt war, und wie bei einer antiken Sibylle begannen die Dämpfe auf sie zu wirken. Sie stieß eine Reihe fremdartiger Worte hervor, die von seltsamen kehligen Schreien begleitet wurden und offenbar von unheilvoller Bedeutung waren, denn Réginald schien davon zutiefst bewegt.
Als die Hexe verstummte, warf er sich seinen Mantel über, und Giska, die ihn mit den geistesabwesenden Augen einer Priesterin anblickte, die mit ihrer Gottheit spricht, erkannte in diesem Moment die Peitsche mit dem Kupfergriff und den langen, zu einem Kreuz verknoteten Riemen an seiner Brust: die Peitsche des Grand Coesre1. Da stieg sie von ihrem Dreifuß herab und kniete nieder. Réginald reichte ihr die Peitsche.
»Giska«, sagte er, »wenn du mich nicht wiedersiehst, musst du ihnen das hier bringen – bring es nach Saintes-Maries-dela-Mer!«
Damit verließ der Mann ihren Wagen und ging zurück zu seinem Gefährt, das gleich darauf eilig in Richtung Paris aufbrach. Da ertönte plötzlich ein gewaltiger Schrei über der nackten, frostigen, verlassenen Ebene, ein Schrei, der in den Lüften widerhallte, der die Pferde erreichte und der bis zu Réginald ins Innere der Equipage drang:
»Geh‘ heute Abend nicht dorthin!«
1 »Grand Coesre« ist der Titel des Königs, der vom gesamten Volk der Zigeuner gewählt wird.
2. Kapitel
Ein intimes Fest in der Botschaft von Austrasien
Am selben Abend gegen zehn Uhr stieg der Kunde von Monsieur Baptiste vor der erleuchteten Fassade der Botschaft von Austrasien aus seinem Wagen. Ein Adjutant näherte sich ihm mit beflissenem Diensteifer und führte ihn eiligst in einen kleinen Salon, der als Kulissenraum eines in dem großen Saal der Botschaft provisorisch aufgebauten Theaters diente. Dort warf der Mann seinen Umhang ab, unter dem er einen schlichten, aber tadellosen schwarzen Frack trug; er hatte eine Querschleife mit dem Schwarzen Adler von Karantanien umgebunden und trug auf der Brust das Kreuz der Ehrenlegion. Mit einer Kopfbewegung warf er die Locken aus dem Gesicht, und indem er rasch die Saiten einer Violine gestimmt hatte, die von seinem Kammerdiener aus ihrem Kasten genommen worden war, gab er das Signal, dass er bereit sei.
Man hörte eine Ansage auf der Bühne, und tosender Beifall brach aus, was auf königlichen Soireen eher selten geschieht; allerdings hatten der König und die Königin von Karantanien höchstpersönlich mit einem Zeichen diese Ovationen veranlasst. Und nun betrat – würdevoll wie der Edelste aller Hospodaren – der berühmte Professor Réginald Rakovitz-Yglitza die Bühne. Er begrüßte die Fürsten und Fürstinnen, und sogleich begann er sein schwindelerregendes Spiel.
Mit dem verklingenden Schlussakkord hatte ein allgemeines Delirium den Saal erfasst. Die Kunst hatte die Etikette überwunden. Der Künstler selbst, der sehr blass geworden war, musterte aufmerksam die königlichen Gäste. Vor allem aber wagte er es, der Königin ins Gesicht zu sehen, seiner angebeteten Maria Silvia, seiner Geliebten. Es war ein Blitz, in dem ihre beiden Seelen verbrannten.
Während die leidenschaftlichen Beifallsbekundungen ihn wie einen Flammenmantel umhüllten, der ihn in seinem ganzen Ruhm erstrahlen ließ, waren seine Augen nur auf sie gerichtet, auf seine große Liebe, die Königin Maria Silvia! Die Huldigungen des Publikums nahm er mit schlichtem und stolzem Herzen entgegen, wie es einem so bedeutenden Künstler, der er zweifelsohne war, und zugleich dem edelsten Vertreter des Zigeunervolkes, einem Nachkommen der Königinnen von Buda, geziemte. Er selbst ließ sich wie ein Fürst behandeln und beanspruchte, auf gleiche Stufe mit jedweder Hoheit gestellt zu werden. Doch ein wahrer Herrscher war er vor allem durch seine Kunst, denn im Spiel der Violine gab es niemanden, der sich ihm vergleichen konnte. Man erzählte, dass er bereits als Kind mit seinem Bogen den Walachen zum Sieg gegen die Türken verholfen habe und dass seine Geige trotz des Kanonendonners in der Schlacht zu hören gewesen sei. Seitdem hatte sich sein Ruhm in ganz Europa verbreitet, und sämtliche Höfe wetteiferten um seine Gunst ... Doch was galt in den Augen Réginalds all dieser Ruhm im Vergleich zu seiner Liebe?
Der Vorhang war gefallen; und schon umringte man den Zigeuner, der jedoch durch eine der Spalten des herabhängenden Velours weiterhin in den Saal blickte. Man sprach ihn an, beglückwünschte ihn, doch er sah und hörte niemanden. Nichts anderes existierte für ihn als Maria Silvia mit ihrem schönen, sanften, leidenden Gesicht, ihren großen, wundervoll traurigen Augen. Maria Silvia: Königin und Märtyrerin zugleich. Er hatte sie gesehen. Endlich hatte er sie wiedergesehen! Nach zwei langen Jahren. Vor zwei Jahren hatte er ihr Lebewohl sagen müssen, um sie vor den Verdächtigungen Leopold Ferdinands zu schützen. Leopold Ferdinand: ein brutaler Haudegen mit einer Herkulesgestalt, der keinen Schritt ohne seinen Säbel tat, ein furchtbarer Jäger, ein furchtbarer Trinker und ein furchtbarer Ehemann, dem Maria Silvia gegen ihren Willen auf Befehl von Kaiser Franz, dem Herrscher von Austrasien, vermählt worden war.
Der König von Karantanien saß an der Seite seiner Gemahlin, doch drehte er ihr flegelhaft den Rücken zu, um sich lautstark mit dem jungen Prinzen Karl von Bamberg zu unterhalten, der wegen seiner kriegerischen Gelüste und seiner Grausamkeit bereits den Beinamen Karl der Rote erhalten hatte. Maria Silvia dagegen schien mit ihren Augen den Zigeuner noch hinter dem Vorhang erspähen zu wollen. Und als sei sie sicher, dass ihr Blick von dem seinen bemerkt werde, lenkte sie ihn mit einer kurzen Bewegung ihrer schönen Augen zu den Köpfen der beiden zärtlich geliebten Zwillinge, der Prinzessinnen von Karantanien, die darauf bestanden hatten, ihrem Freund Réginald, den sie so lange schon nicht mehr gesehen hatten, ebenfalls applaudieren zu dürfen.
Der Zigeuner konnte einen tiefen Seufzer nicht unterdrücken; ein Gefühl von Liebe und Schmerz bewegte ihn beim Anblick dieser beiden wunderbaren Kinder, die sich an den Händen hielten und lachten. Sie mochten zwölf oder dreizehn Jahre alt sein und glichen einander auf so ungewöhnliche Weise, dass es das überraschte und verwirrte Auge kaum fassen konnte, zumal sich auf ihren Gesichtern das verdoppelte Abbild der bezaubernden Züge Maria Silvias abzeichnete. Es war nicht zu verkennen, dass sie Zwillinge waren; doch noch nie hatten zwei Schwestern, die zur selben Zeit das Licht der Welt erblickten, eine so vollkommene Ähnlichkeit ihrer anmutigen Gestalt, ihres tiefen, intelligenten Blicks entwickelt, der noch dazu von einem so einzigartigen und dabei vollkommen gleichen Lächeln ihrer rosigen Lippen untermalt wurde.
Beide hatten das gleiche schwarze Lockenhaar; die Ähnlichkeit war so vollkommen, dass es schien, als hätte die Natur, die doch auf der ganzen Welt kein Blatt dem anderen vollends gleichen lässt, zwei kleine Mädchen schaffen wollen, die man unmöglich voneinander hätte unterscheiden können. Sie lachten. Sie waren glücklich über den großen Erfolg ihres Freundes Réginald. Sie hielten einander die ganze Zeit bei der Hand, als ob es ihnen unmöglich wäre, sich auch nur für einen Augenblick zu trennen. Der Zigeuner flüsterte mit erstickter Stimme:
»Regina! Tania!«
Er sah, wie sie aufstanden und dem Wink einer würdigen alten Dame folgten, die ganz in schwarz gekleidet war und deren prachtvolles weißes Haar ihren Kopf wie eine Krone umgab: zweifelsohne ihre Gouvernante. Auch sie musste Réginald bekannt sein, denn als die kleine Gruppe an der Bühne vorbeikam, murmelte der Zigeuner einen Namen und eine Träne stand in seinem Auge. Selbst den Namen seiner Mutter hätte Réginald nicht mit mehr Bewegung aussprechen können als diese drei Silben: Orsova. Die vornehme alte Dame erbebte, als hätte sie es gehört, und ihr schönes betagtes Gesicht mit den harten Zügen und ihre ganze prächtige moldauwalachische Zigeunergestalt wurde wie von einem Aufflammen erhellt: »Pass gut auf sie auf, Orsova!«
Doch in diesem Augenblick wurde der Zigeuner brüsk aus der Betrachtung dieses ihm vierfach teuren Schauspiels gerissen; eine kecke Soubrette lief mit einer Handvoll Accessoires quer über die Bühne des kleinen Theaters, und indem sie ihn anrempelte, erkannte Réginald die kleine Milly, die zweite Kammerzofe der Königin, ihre aufrechte und ihnen beiden treu ergebene Freundin. Und während man in aller Eile die Dekoration für ein Gelegenheitsstück aufbaute, das von den Künstlern der Comédie Française aufgeführt werden sollte, flüsterte sie ihm eine Warnung zu:
»Geht, geht sofort! Der König wird nach Euch rufen lassen, um Euch zu beglückwünschen. Geht! Ihr werdet Nachricht erhalten ...«
Kaum dass sie dies gesagt hatte, war sie schon wieder verschwunden. Réginald warf einen letzten Blick auf Maria Silvia, dann verließ er, der Warnung Millys folgend, sogleich die Botschaft. Auf keinen Fall wollte er mit Leopold Ferdinand zusammentreffen; er fürchtete, dass die in seinem Herzen auflodernde Leidenschaft offen vor aller Augen zutage treten könnte.
Er hatte seinen Wagen fortgeschickt und ging zu Fuß die Champs-Elysées hinunter, er war glücklich, mit seinen Gedanken allein zu sein. Was für eine wunderbare Liebe war das! Welche furchtbaren Leiden, wie viele sublime Lügen, welche herzzerreißenden Abschiede, heimliche Wiedersehen und dann wieder endlose Zeiten der Trennung. Denn sie liebten sich schon seit vielen Jahren, sie hatten sich lange schon geliebt, bevor Réginald offiziell am Hof von Karantanien eingeführt worden war. Sie hatten sich geliebt, und erstaunlicherweise war ihr Geheimnis niemals entdeckt worden, so dass sie darin die Hand Gottes zu erkennen meinten. Dennoch mussten sie ihr furchtbares Glück in der Tiefe der Finsternis suchen, mussten die Gesellschaft belügen und hintergehen. Wie oft, wenn sie alles um sich vergaßen, waren sie versucht gewesen, bis ans Ende der Welt zu fliehen. Doch hatten sie diesen unvernünftigen Traum wegen der Kinder nie verwirklicht. Und er, der Löwe, Réginald der Zigeunerfürst, der von seinem Volk erwählt worden war und dessen ganze Hoffnung sich in ihm verkörperte – er hatte wie ein Räuber Grenzen passieren und Städte wie ein Schakal umschleichen müssen.
»Mein Herr! Eine Nachricht für Euch ...«
Der Schatten einer kleinen Frau, deren Kopf gänzlich von einer Haube verhüllt war, hatte sich schon wieder entfernt und, sowie dieser Auftrag erledigt war, die verwaisten Champs-Élysées hinauf verflüchtigt. Für Réginald konnte es indessen keinen Zweifel geben. Es war ihm, als ob er deutlich die Gestalt und die Stimme von Milly erkannt hätte. Er blieb unter einer Gaslaterne stehen und sah sich um. Er war allein. Sogleich erkannte er ihr Papier, erkannte ihr Parfum. Er entsiegelte den Brief, und er erkannte ihre Handschrift. »Um zwei Uhr, heute Nacht, an der kleinen Pforte hinter der Botschaft, an der Ecke Rue Balzac«.
Er zerriss das Billet und schluckte die Papierfetzen hinunter. Nicht einen Moment lang gedachte er der dunklen Prophezeiungen, die ihn während des Tages beunruhigt hatten. Er träumte von nichts anderem als von der Königin. Sein entflammter Sinn begehrte sie wie ein jugendlicher Liebhaber.
Um zwei Uhr passierte er die kleine Pforte der austrasischen Botschaft in der Rue Balzac. Die Schattenfrau mit der Haube war bereits dort und bedeutete ihm mit einer Geste, stehen zu bleiben. Sie stieß die Tür auf, horchte und machte ihm ein Zeichen. Er erklomm hinter ihr eine steile Treppe. Eine Hand hatte die seine ergriffen, er ließ sich von ihr durch die Dunkelheit führen.
Die Grabesstille, die sie umgab, bemerkte er nicht.
»Bist du es, Milly?«
Der Schatten antwortete nicht. Seine Hand lag weiterhin in der des Schattens, und es war die Hand des Schicksals. Eine Tür öffnete sich und wurde wieder geschlossen, und er befand sich plötzlich in einem Gemach, das sanft von einem Nachtlicht erhellt wurde. Eine dumpfe, schwere Luft, die vom Hauch eines Parfums erfüllt war, brachte alle seine Sinne in Aufruhr. Er verharrte regungslos.
»Wer ist da?«
»Silvia!«
»Réginald!«
Es war ein Schrei unbeschreiblicher Furcht, mit dem sie seinen Namen ausrief.
Sie hatte sich in ihrem Bett aufgerichtet; es war, als wollten ihre schönen Arme, die sie ihrem Liebhaber entgegenstreckte, diesen nicht an sich ziehen, sondern in die Nacht zurückwerfen, aus der er hervorgetreten war.
»Warum bist du hier?«
»Du hast mich gerufen!«
»Ich?!«
»Du hast mir geschrieben!«
»Ich?!«
»Ja, nur wenige Worte, um mir zu sagen, dass ich heute Nacht kommen sollte.«
Sie sprang auf, halbnackt, stieß atemlos die Fragen hervor:
»Wer hat dich hierher geführt? Wer? Wie bist du hierher gekommen? Wie konntest du überhaupt hereinkommen?«
Er begriff, dass sich in der Dunkelheit etwas Grauenhaftes gegen sie verschworen hatte. Er kniete vor ihr nieder und sagte nur:
»Meine Königin!«
Sie hob ihn auf und presste ihn, nach Atem ringend, mit einer mutlosen Gebärde an ihre Brust.
»Unglücklicher, wir sind verloren.«
Sie gaben sich einen verzweifelten Kuss, dann versuchten ihre fiebrigen Hände, die Tür wieder zu öffnen, durch die Ré-ginald eingetreten war. Aber die Tür war verschlossen. Mit verhaltener Stimme sagte Maria Silvia:
»Milly ... Milly ... Wie kommt es, dass ich Milly heute noch nicht gesehen habe?«
»Du hast Milly heute nicht gesehen?«, rief Réginald aus. »Sie war es doch, die mir den Brief gebracht hat. Sie hat mich hierher geführt!«
Erregt zog die Königin Réginald an das andere Ende des Zimmers, öffnete eine Tür, die zu der Kammer führte, in der Milly schlief. Die Kammer war leer.
»Hier entlang!«, befahl sie.
Energisch durchschritt sie die Kammer, die auf der anderen Seite zur Treppe der Dienstboten führte, doch in diesem Augenblick öffnete sich die gegenüberliegende Tür und Milly erschien. Sowie sie Réginald erblickte, entfuhr dem Mädchen ein erstickter Schrei; sie versperrte den beiden Liebenden den Durchgang.
»Nicht hier entlang! Zwei Offiziere warten am Ende der Treppe!«
Milly schloss die Tür hinter sich und verriegelte sie. Sie war genauso bleich wie die Königin.
Réginald stürzte sich auf sie.
»Ach, mein Herr«, sagte sie dumpf, »warum seid Ihr hierher gekommen? Ich hatte Euch doch gesagt, Ihr solltet fliehen.«
»Und dann hast du mich hierher geführt!«, keuchte Réginald, indem er ihr beinahe die Handgelenke brach. Unterdessen war Maria Silvia zu den Fenstern gelaufen. Milly fiel auf die Knie. Réginald hatte sie losgelassen. Wie irrsinnig bohrten sich die Nägel ihrer zitternden Finger in die Wangen. Sie stöhnte:
»Seit heute Morgen hatte ich den Verdacht, dass man Euch verderben will!«
»Und du hast mir nichts davon gesagt!«, keuchte Maria Silvia, die im Zimmer auf und ab lief wie eine Wölfin in ihrem Käfig.
»Majestät, ich habe mich Euch nicht nähern können. Ich wurde bewacht. Es war mir verboten, mit Euch zu sprechen ... Doch habe ich den Herrn warnen lassen ...«
»Du hast uns verraten! Du hast uns doppelt und dreifach verraten!«, empörte sich Réginald. Er schritt auf eine Tür zu, deren Doppelflügel sich zu einem Vestibül öffneten, hinter dem sich Räume der Königin anschlossen, doch Maria Silvia hielt ihn zurück:
»Nicht dort entlang. Da ist die Ehrentreppe. Du könntest keine zwei Schritte machen, ohne angehalten, ohne erkannt zu werden!«
Milly hörte nicht auf zu schluchzen:
»Mein Herr, mein Leben gebe ich für Euch, für die Königin.«
»Schweig, schweig still. Du hast mich vorhin eingelassen!«, sagte Réginald noch einmal. Mit aller Kraft versuchte er, die Tür aufzureißen, durch die er eingetreten war.
»Bei der heiligen Jungfrau und meinem Seelenheil, das ist nicht wahr!«
Réginald ließ von der Tür ab und ging zu einem der Fenster, das er sehr sacht öffnete. Es führte auf einen Hof, und in diesem Hof sah er zwei reglose Schatten, die offenbar auf ihn warteten. Er schloss das Fenster wieder.
»Die Königin retten!«, rief er aus. »Nur die Königin müssen wir retten!«
Und er sah Maria Silvia an, die sich bemühte, ein wenig Ruhe zu gewinnen. Sie hatte sich einen Morgenrock über die nackten Schultern geworfen.
Millys Tränen tropften auf den Fußboden. Von Angesicht zu Angesicht, von Frau zu Frau, flehte die Königin sie an:
»Du wirst ihn retten!«
Milly zitterte, ihre Zähne schlugen aufeinander. Es gelang ihr dennoch zu sagen:
»Es gibt nur ein Mittel ... ein einziges! Die große Galerie zu durchqueren und von dort die Dienstbotentreppe zu nehmen. Wenn wir so weit kommen, ohne jemandem zu begegnen, dann garantiere ich ...«
»Aber man muss über die Ehrentreppe gehen!«, erwiderte Maria Silvia. »Und ihr werdet dort unweigerlich auf jemanden treffen, ganz gewiss!«
»Ruhe!«, gebot Réginald unvermittelt.
Er beugte sich hinter die Tür, die zu Millys Zimmer führte. Alle drei lauschten. Man hätte ihren dreifachen Herzschlag hören können. Die Schritte auf der Dienstbotentreppe hatten angehalten. Sie horchten weiter. Nichts! In dem immensen Gebäude schien sich erneut vollkommene Stille auszubreiten.
Mit unendlicher Vorsicht öffnete Réginald die große Tür, welche die Wohnräume der Königin mit dem Korridor verband, von dem aus die Ehrentreppe zu erreichen war. Wollte man auf diesem Wege hinausgelangen, musste man alles riskieren. Und hatte es nicht den Anschein, dass dieser Ausweg, gerade weil er frei gelassen worden war, unmittelbar in eine Falle führte? Hinter dieser Tür erwartete ihn die Nacht, die Finsternis, das Unbekannte. Es war seltsam: kein einziges Licht ... Doch Réginald wollte diesen Versuch wagen, sofort. Er sagte zu Maria Silvia, die er heftig mit seinen Armen umschlang:
»Wenn man sich meiner bemächtigt, wird es zumindest nicht in deinem Zimmer sein.«
»Wir wären gleichwohl verloren, du ebenso wie ich«, erwiderte sie, am ganzen Körper zitternd. »Nur Milly kann uns retten. Und vielleicht will sie uns verderben!«
Milly schlug ein Kreuz, dann ergriff sie Réginalds Hand.
»Kommt, mein Herr!«, sagte sie. Sie hatte sich inzwischen wieder etwas gesammelt. »Kommt! Wenn man uns überraschen sollte, werde ich schwören, dass Ihr aus meiner Kammer kamt, und wenn man Euch töten sollte, so sei Gott mein Zeuge, dass ich Euch nicht überleben werde.«
»Gehen wir!«, befahl Réginald.
Die Königin streckte die Arme nach ihm aus, doch sah er sie nicht mehr, da er bereits hinter Milly in die schwarze Nacht des Korridors eingetaucht war.
Maria Silvia beugte sich hinaus und lauschte in die Finsternis. Sie fürchtete, plötzlich hastende Schritte, Geräusche eines Kampfes, einen verzweifelten Schrei, vielleicht sogar ihren Namen zum Zeichen eines ewigen Abschieds rufen zu hören – doch nichts ließ sich vernehmen ... Die Minuten verstrichen, furchtbar zunächst, dann nach und nach beruhigend, dann voller Hoffnung ... Maria Silvia begann wieder zu atmen, zu leben ...
Ganz sacht schloss sie die Tür zu ihrem Zimmer und ließ sich dann vor einem kleinen Bild der heiligen Jungfrau, das sie immer bei sich führte, auf die Knie fallen. Ihr Gebet war ebenso lang wie inbrünstig, und unaufhörlich mischten sich auch die angebeteten Namen von Réginald, von Tania und Regina in ihre leisen Seufzer ...
Als sie wieder aufstand und sich umdrehte, sah sie sich unvermittelt Leopold Ferdinand gegenüber, der ruhig in einem Sessel an der Ecke des Kamins saß und sie anblickte, während er mit seiner weichlichen Hand über den gewaltigen Schnurrbart strich.
3. Kapitel
In den Fluren der austrasischen Botschaft
Ohne irgendeinem Hindernis zu begegnen, waren Milly und Réginald bis zur ersten Etage vorgedrungen. Mit der größten Vorsicht hatten sie sich fortbewegt, um mit keinem Geräusch ihre Anwesenheit zu verraten. Den rasch geflüsterten Worten Millys zufolge war es sehr gut denkbar, dass alle Ausgänge des Gebäudes bewacht wurden. Réginald konnte nicht hoffen, diese Wachen zu überwinden, denn er hatte keine Waffe bei sich. Seine Situation schien aussichtslos. Von einem Mann wie Leopold Ferdinand musste er einer grauenvollen Rache gegenwärtig sein, sollte dieser ihn in der Botschaft von Austrasien in seine Gewalt bekommen; es würde bedeuten, dass Réginald vollkommen seiner Willkür ausgeliefert wäre, da in dem umfriedeten Bereich dieses Gebäudes die Fürsten des austrasischen Reichs durch den Grundsatz der diplomatischen Exterritorialität geschützt waren und daher unbesorgt um etwaige Folgen Gewalttaten begehen konnten. Was sich hinter dieser Schwelle abspielte, ging die französische Polizei nichts an. Doch das bekümmerte Réginald nicht weiter, er dachte noch immer und immer nur an seine königliche Geliebte ... Sein eigenes Leben zählte für ihn nicht, wenn nur Maria Silvia gerettet werden konnte. Er hatte unaussprechliche Angst um sie. Und er folgte Milly weiter hinein in die vollkommene Finsternis. Sie hielten sich bei der Hand. Die des jungen Mädchens war eiskalt und zitterte. Ihr Zögern erschien Réginald verdächtig. Wohin gingen sie? Wohin führte man ihn? Was hatte man mit ihm vor? Auf keine dieser Fragen wusste er eine Antwort. Er kannte die Örtlichkeit nicht. Es war das erste Mal, dass er in die Botschaft von Austrasien gekommen war.
Tiefste Dunkelheit, schwärzeste Nacht und vollkommene Stille. Eine Tür wird langsam geöffnet und knarrt. Sie verharren reglos, halten den Atem an, lauschen. Nichts. Sie gehen weiter. Immer weiter durch die Dunkelheit. Nun ist es das Parkett, das knarrt! Noch eine Tür, die sie durchschreiten. Und dann plötzlich, unmittelbar hinter ihnen, merken sie, wie sich die Tür von allein schließt ... Milly stößt einen leisen Schrei aus, und nun hört man nur noch die dumpfen Geräusche eines verzweifelten Kampfes in der Finsternis.
***
Und endlich Licht, dort hinten, ganz am Ende des Zimmers ... eine Lampe, deren Licht durch den Lampenschirm gebündelt auf die strahlend weiße Uniform und den kahlen Schädel eines Offiziers fällt, der über Akten gebeugt ist ... Im Halbschatten errät man rechts und links davon zwei weitere Uniformen, in deren Knöpfen, Achselschnüren und Schulterstücken sich einige Lichtstrahlen fangen. Noch spürbarer wird die Finsternis durch das gelbe Licht einer winzig kleinen Lampe auf der rechten Seite. Und hinter diesem dünnen gelben Schein steht ein Schatten, von dem man nichts weiter erkennen kann als den blendenden Glanz eines Säbelblatts.
Die Anordnung dieser nur halb wahrnehmbaren Gestalten erscheint einem Militärgericht zum Verwechseln ähnlich: ein Tribunal, das aufgrund hoher Dringlichkeit mitten in der Nacht zusammengekommen ist, um in irgend einer geheimen Angelegenheit ein rasches und unwiderrufliches Urteil zu fällen, das nur ein Todesurteil sein kann und den Angeklagten dazu verdammen wird, im Morgengrauen auf dem Grund eines Festungsgrabens oder noch in derselben Nacht in der Tiefe eines Kellers in aller Stille erschossen zu werden.
Ein Verbrechen mehr oder minder zählte für das furchtbare Geschlecht der Wolfenburger nicht, die seit Jahrhunderten über Austrasien herrschten. Die Säle ihrer Paläste, die Mauern ihrer Feudalschlösser tragen die Spuren ihrer blutigen Politik und sind seit jeher bevölkert von den Geistern ihrer Opfer ...
Réginald, jetzt aufrecht stehend, doch mit gefesselten Händen und umgeben von vier Leibgardisten, die ihren blanken Degen aus dem Futteral gezogen haben, hat alles erraten, er hat begriffen, dass er ans Ende des ihm gelegten Hinterhalts gelangt ist. Zu feige, seine Sache selbst auszutragen, wird Leopold Ferdinand ihn durch seine Leute exekutieren lassen.