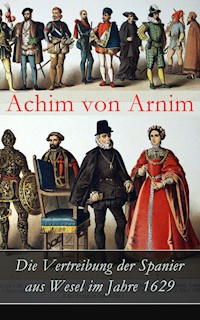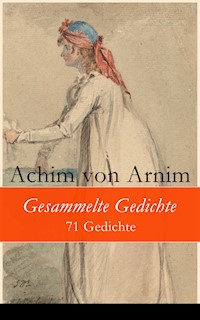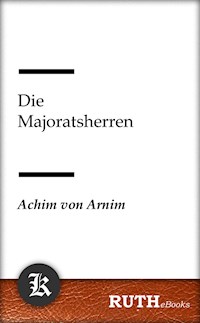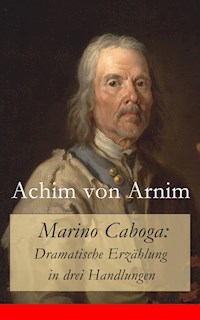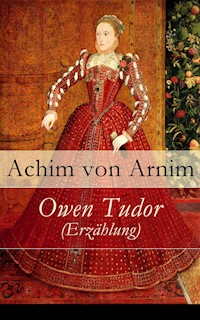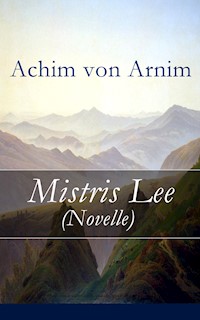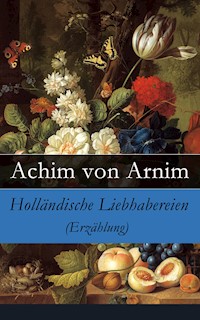Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Südwestdeutschland, um 1500: Die Kronenwächter gehören einem Geheimbund an, um den viele Mythen kursieren. Sie sind die Hüter der Kaiserkrone in einer alten Burg auf einer Insel im Bodensee. Diese Krone soll dort in Sicherheit auf einen neuen würdigen Herrscher warten, bis dieser sich ihrer annimmt. Für Berthold, einen Nachfahren der Hohenstaufen, ist dieser Anspruch jedoch eine große Hürde...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 682
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Achim von Arnim
Die Kronenwächter
Erster und zweiter Band
Saga
Die KronenwächterCoverbild/Illustration: Shutterstock Copyright © 1817, 2020 Achim von Arnim und SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788726642704
1. Ebook-Auflage, 2020
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit Zustimmung von SAGA Egmont gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk
– a part of Egmont www.egmont.com
EINLEITUNG
Dichtung und Geschichte
Wieder ein Tag vorüber in der Einsamkeit der Dichtung! Die Glocke läutet Feierabend, und die Pflüger ziehen heim mit dem Gespann, führen und tragen behaglich die Kinder, die ihnen entgegengegangen, und freuen sich ihrer Mühe in der Ruhe. Der Pflug ruht nicht verlassen auf der letzten Erdscholle, die er überstürzte, denn notwendig wie die Sonnenbahn scheint der Bedürftigkeit sein Furchenzug, und ein heilig strenges Gesetz bewacht ihn in der Nacht gegen Frevel. Am Morgen setzt der Pflüger seinen Weg ohne Störung fort, mißt nach der Länge seiner Furchen den trüben Morgen, wie er die helle Mitte des Tages an seinem eigenen Schatten zu ermessen versteht, und teilt nach seinen Morgenwerken die Erdfläche in festbegrenzte Morgen, wie er nach dem Tagewerke der Sonne die unendliche Zeit in Stunden teilt. Die Sonne und der Pflüger kennen einander und tun beide vereint das ihre zum Gedeihen der Erde. Fest fortschreitend, von allen geschätzt und geschützt, sehen wir die Tätigkeit, die sich zur Erde wendet; sie ist auch dauernd bezeichnet und gründet, so lange sie sich selbst treu bleibt, mit unbewußter Weisheit das Rechte, das Angemessene, im Bau des Ackers wie des Hauses, in der Beugung des Weges wie in der Benutzung des Flusses. Die Zerstörung kommt von der Tätigkeit, die sich von der Erde ablenkt und sie noch zu verstehen meint. Aber nach Jahrhunderten der Zerstörung erkennen die einwandernden Anbauer des Walds mit Teilnahme die Unvergänglichkeit der Ackerfurchen und Grundmauern untergegangener Dörfer und achten sie als ein wiedergefundenes Eigentum ihres Geschlechts, das der Gaben dieser Erde nie genug zu haben meint. . .
Auch das Wesen der heiligen Dichtungen ist wie die Liederwonne des Frühlings nie eine Geschichte der Erde gewesen, sondern eine Erinnerung derer, die im Geist erwachten von den Träumen, die sie hinübergeleiteten, ein Leitfaden für die unruhig schlafenden Erdbewohner, von heilig treuer Liebe dargereicht. Dichtungen sind nicht Wahrheit, wie wir sie von der Geschichte und dem Verkehr mit Zeitgenossen fordern, sie wären nicht das, was wir suchen, was uns sucht, wenn sie der Erde in Wirklichkeit ganz gehören könnten, denn sie alle führen die irdisch entfremdete Welt ewiger Gemeinschaft zurück. Nennen wir die heiligen Dichter auch Seher, und ist das Dichten ein Sehen höherer Art zu nennen, so läßt sich die Geschichte mit der Kristallkugel im Auge zusammenstellen, die nicht selbst sieht, aber dem Auge notwendig ist, um die Lichtwirkung zu sammeln und zu vereinen; ihr Wesen ist Klarheit, Reinheit und Farbenlosigkeit. Wer diese in der Geschichte verletzt, der verdirbt auch Dichtung, die aus ihr hervorgehen soll, wer die Geschichte zur Wahrheit läutert, schafft auch der Dichtung einen sichern Verkehr mit der Welt. Nur darum werden die eignen unbedeutenden Lebensereignisse gern ein Anlaß der Dichtung, weil wir sie mit mehr Wahrheit angeschaut haben, als uns an den größern Weltbegebenheiten gemeinhin vergönnt ist . . .
Waiblingen
Die Geschichten, welche hier neben der Karte von Schwaben vor uns liegen, berühren weder unser Leben noch unsere Zeit, wohl aber eine frühere, in der sich mit unvorhergesehener Gewalt der spätere und jetzige Zustand geistiger Bildung in Deutschland entwickelte. Das Bemühen, diese Zeit in aller Wahrheit der Geschichte aus Quellen kennen zu lernen, entwikkelte diese Dichtung, die sich keineswegs für eine geschichtliche Wahrheit gibt, sondern für eine geahndete Füllung der Lücken in der Geschichte, für ein Bild im Rahmen der Geschichte. Die Karte von Schwaben, wie sie Homanns Erben im Jahre 1734 herausgaben, muß noch jetzt, nach so vielen Veränderungen, wohlgefallen. Diese sinnreichen Nürnberger haben alle Farben ihres weltberühmten Muschelkastens benutzt, die Grenzen der vielen Staaten augenscheinlich zu machen, auf daß ein jeder in dieser Farbenpracht den Bogen der Gnade erkennen möge, den Gott über dieses herrliche Land gestellt hatte, als er es nach freier Entwickelung durch Krieg und Friede mit der Kraft seines heiligen, deutschen Reichs für Jahrhunderte schützte. Ein mächtiger Strom, die Donau, entspringt in Schwaben, begrenzt den Erbfeind der Christenheit, den Türken. Ein anderer, der Rhein, findet erst im Bodensee seinen rechten Boden, der ihn zur Größe erzieht, wofür er die Grenze, von der er ungern scheidet, zu einer Inselwelt durchflicht. Der Bodensee selbst, ein sanftes Ab-
Lebensereignisse: Anspielung auf Goethes „Dichtung und Wahrheit “ (1. Teil 1811)
bild des Meeres, bezeichnet neben den Höhen eine reiche Tiefe des Landes. Wer nennt alle lieblichen Ströme, welche das Land durchrauschen! Wer nennt alle Berge, von Schlössern gekrönt, von denen die Ströme entspringen, von denen die Heldengeschlechter herrschend zu den fernen Ebenen niedergezogen sind! Ganz Schwaben ist dem Reisenden ein aufgeschlagenes Geschichtsbuch, hier war der früheste Mittelpunkt deutscher Geschichte, und so seltsam alles umfassend die Deutschen sich später schaffend und zerstörend geregt haben, diese Vollendung in einem gewissen Sinne erreichten sie nicht wieder, und so reiht sich das Bild des Unterganges unmittelbar an den Glanz der Hohenstaufen. Schöner ist das dauernde Steigen eines Landes, das in jeder Einrichtung das ungestörte Erbe der Jahrhunderte aufweisen kann, aber menschlich näher tritt uns als ein Bild des eignen Geschicks diese Berührung mit großen Hoffnungen aus früheren Tagen in einem Volke, das bewahrsam und achtend gegen seine Vorzeit in Urkunden, Erinnerungen und Gebräuchen jedem Dorfe seine Denkwürdigkeiten erhalten hat. Suchen wir auf unsrer Karte den Neckarfluß und gehen wir mit Behagen an seinem Ufer, von Reben umgrünt, zum Einflusse der Rems und da hinauf durchs reiche Wiesental nach Waiblingen, so befinden wir uns auf dem Schauplatz unsrer Geschichte. Waiblingen versteckt sich jetzt, wie wir von Reisenden hörten, ungeachtet es an einem Hügel hinangebaut ist, hinter umgebenden Weinbergen. Ehemals ragte am Tore ein hoher Wachtturm hinaus, der mit vier kleinen Türmchen und einem höhern in der Mitte, alle fünf mit Schiefer wohlgedeckt, der Stadt schon aus der Ferne ein wehrhaftes Ansehen gab. Dieser Turm ist die Bühne, welche den Anfang unsrer Geschichten aus den engen Verhältnissen eines kleineren Städtleins zum Seltsamen erhebt; so verdient er eine nähere Beschreibung. Die vier Türmchen traten an den vier Ecken des Mauerwerks von Werkstücken heraus, auch ein gezähnter Gang zwischen ihnen war zur bessern Verteidigung hinausgebaut. Unter dem mittleren Turme befand sich das Wachtzimmer, in dessen Mitte eine große Wurfschleuder gegen andringende Feinde aufgerichtet war, während die Wände hinlänglich mit Armbrüsten und Harnischen behangen waren, um bei raschem Angriff gleich eine bedeutende Zahl Bürger zu rüsten. Als Wächter wurde immer ein alter Kriegsmann gelöhnt, der, des Schlafes entwöhnt, mit den Seinen abwechselnd eine ununterbrochene Wacht unterhalten mußte. Auf seinem Büffelhorne zeigte er mit allgemein bekannten Zeichen an, wenn sich Not und Sorge, sei es durch Kriegsscharen und Räuber oder durch Feuer und Wasser, dem Stadtgebiete näherten. In solchem Fall kamen viel neugierige Gesellen zum Besuch, sonst mied jeder die enge Windeltreppe des Turms, der nicht besondere Freundschaft zu dem Wächter trug. Eine Winde im Wächterzimmer war zu doppeltem Gebrauche eingerichtet: sie hob in einem großen Eimer von der Stadtseite zu bestimmten Stunden seine Lebensmittel empor und nahm in demselben Eimer von der Landseite nach dem unerbittlichen Torschluß alle verspätete Sendungen an Rat und Bürger der Stadt gegen mäßigen Lohn auf. Bei dem lebhaften Verkehr, dessen sich die Stadt jetzt als Vorratskammer der Neckarweine für Augsburg, durch Gerbereien und Ankauf von Schlachtvieh erfreute, war diese Art Nebengewinn ein Hauptunterhalt des Wächters geworden, der nach dem frühen Torschlusse mit Sehnsucht nach verspäteten Boten auf die Straße von Augsburg herunterblickte. Von Augsburg war das Tor genannt, so weit Augsburg davon entlegen sein mochte. Augsburg war damals gleichsam ein heiliger Name, weil die sichtbaren Quellen des Wohlstandes, das Geld und die Reisenden, die es brachten, von Augsburg entsprangen und nicht immer wieder dahin zurückkehrten: im zweiten Buche führt uns die Geschichte nach diesem Mittelpunkt des Handels, zu den reichen Geschlechtern, die, das neu entdeckte Amerika mitzuerobern, Schiffe ausrüsteten und die Kaiser durch Glanz und Erfindung froher Feste sich zu geselliger Freude verbanden.
Bertholds erstes und zweites Leben
Des Romans erster Teil
ERSTES BUCH
Erste Geschichte: Die Hochzeit auf dem Turme
Der Bürgermeister von Waiblingen, Herr Steller, und der Vogt des Grafen von Wirtemberg, Herr Brix, führten einander in der Neujahrsnacht mit ungewissen Schritten durch die glatten Gassen, nachdem sie einander beim Schlage der zwölften Stunde vor dem Ratskeller den flockig fallenden Schnee vom Barte geküßt und alles gute Glück angewünscht hatten. „Der Wein erweicht des Menschen Herz“, dachte der Bürgermeister, „ich hätte nimmermehr geglaubt, daß ich den Vogt so lieb hätte“; dann fuhr er fort: „Schade, daß es so dunkel am Himmel und so weiß an der Erde ist, kein Sternlein ist zu sehen, das uns ein Zeichen gäbe vom neuen Jahre.“ „Kein Stern?“, fragte der Vogt mit schwerer Zunge, „was sind denn das für ein Paar rote Sterne am Himmelsrande?“ „Das sind die Fenster des Wachtturmes“, antwortete Herr Steller lachend, „kennt Ihr die nicht, aber sie leuchten heute wohl heller als sonst, denn da ist Bettelmanns Hochzeit: der neue Turmwächter, der Martin, hat heute die Witwe des vorigen geheuratet, weil sie oben zu stark geworden, um die enge Windeltreppe herunterzusteigen. Wir konnten doch wahrhaftig der Frau wegen nicht den Turm abbrechen lassen, und so mußte sie sich dazu bequemen, sonst hätte sie lieber unsern Schreiber, den Berthold, geheuratet. Der Pfarrer hat sie oben müssen zusammengeben.“ „Aber um Gottes willen“, fragte der Vogt, „wie soll die Frau hinunterkommen, wenn sie erst tot ist? Da wird ein Mensch doch noch ungeschickter, als er bei lebendigem Leibe war!“ „Das würde sich finden, wie’s Sterben, meinte sie“, sprach Steller; „solch armes Volk lebt in die Zeit hinein, wie’s liebe Vieh, wenn es nur Futter hat. Gute Nacht, Gevatter, viel Glück zum neuen Jahre; Ihr werdet doch allein fortkommen?“ So taumelten sie auseinander, der Vogt ging den beiden roten Sternen nach, und der Bürgermeister gab Achtung, daß sie ihm im Rücken blieben, und so führte das Glück der Armen die beiden Reichen wie eine Vorbedeutung in ihre Häuser heim.
Auf dem Turme saß der alte, trockene Martin, der neue Turmwächter, im verschossenen roten Wams, den er noch aus dem italienischen Kriege mitgebracht hatte, zwischen Frau Hildegard, mit der er heute vermählt war, und Berthold, dem Ratsschreiber, wie auf dem Felde des Schachbretts zwischen Schwarz und Weiß, denn jene war reinlich in weißem selbstgewebten Leinen, dieser sehr anständig in schwarzem Tuch gekleidet. Martin sprach davon, wie er sonst auf Schlachtfeldern zwischen Tod und Teufel und jetzt wie im Schachspiel fröhlich zwischen Freund und Frau sitze, und habe sich das nicht träumen lassen voraus, dabei umfaßte er beide und drückte beiden die Köpfe aneinander, daß sie sich küssen mußten, und trank dann seinen Wein auf die Erinnerung einer Neujahrsnacht, wo er und Berthold auf den Turm stiegen und Frau Hildegard belauschten, wie sie mit ihrer Base Zinn gegossen. Berthold: „Das war eine schöne Nacht, klar und warm, die Witterung wird immer rauher in Waiblingen, und die Welt geht endlich gewiß in Eis unter.“ Martin: „Kalt oder warm, untergehn muß sie doch bald, wenn nur Hildegard so lange lebt, um den Lärmen mit uns zu beschauen. Ja, in der Nacht ging mir das Herz auf gegen dich, und es zuckte mir in dem Arme, was hilfts verhehlen, Gott weiß es doch und schreibt sich alles auf.“ Berthold: „Du wolltest der guten Frau um den Hals fallen? Die Sünde vergibt der Küster!“ Martin: „Nein, Berthold, ihren Mann wollte ich zum Turm hinunterwerfen, er stand auf der Mauer und blies das neue Jahr an, er wollte sich recht hören lassen, da tratest du zwischen uns, und so wurdest du mein guter Engel und bist es immer geblieben und hast bei Hildegard für mich geworben. Das kam alles vom Zinngießen.“ Hildegard: „Habe dich damals am Fenster nicht beachtet, aber den Zinnguß habe ich aufgehoben, wie ich alles aufhebe; seht da, drei Kirchtürme im Zinn, was deutet mir das?“ Martin: „Der eine bedeutet deinen ersten Mann, der zweite deutet auf mich, und der dritte, das ist dein dritter Mann Berthold.“ Hildegard: „Der Tod ist der dritte Mann.“ Berthold: „Hör, Martin, ich mag auf deinen Tod zu meiner Seligkeit nicht warten; dir schadets noch nicht, wenn du ein paar Stunden mit offner Brust im Schneegestöber auf ein Wild lauerst; ich muß mir schon Kopf und Füße warm halten, am Schreibtische altert ein Mensch früher als auf dem Rosse.“ Martin: „Mit dem Reiten und Fechten ist es jetzt aus, bin ärgerlichen Gemüts, und das gedeiht nicht im Alter; kann ich die Armbrust nicht mehr spannen und keinen Vogel im Fluge sehen und treffen, dann stößt mir der Gram das Herz ab. Sieh, Berthold, so gräm ich mich auch, daß wir voneinander ziehen sollen und haben so lange miteinander hausgehalten: ich sorgte fürs Wildbrett und du für die Fische aus dem Ratsweiher. Es liegt wenig daran, ob einer in Seide oder nackt wie auf dem Schlachtfelde begraben wird, aber daß wir nicht in alten Tagen einsam leben müssen, davor behüte der Himmel jeden. Hör, Berthold, wir sind heute bei deinem Wein lustig, sei künftig auch vergnügt bei unserer alltäglichen Hausmannskost, zieh herauf zu uns, Hildegard wird dir mit keiner doppelten Kreide anschreiben.“ Berthold: „Du kannst meine Gedanken lesen, dachte schon lange daran, ob ich mir nicht dort auf der wüsten Brandstelle ein Haus in eurer Nähe errichten könnte, wo wir zusammen aus einer Kasse lebten und miteinander teilten, was wir verdienen.“ Martin: „Damit alles gleich wird, teilen wir auch die Frau .“Hildegard: „Sonst bin ich mit allem zufrieden, aber das ist gegen die zehn Gebote.“ Martin: „Und er soll dein Herr sein, hat der Pfarrer gesagt, und dabei bleibts, Berthold schläft hier, du nennst ihn Du wie mich, du sorgst für ihn wie für mich und schlägst ihm nichts ab, er wird nichts Ungebührliches von dir fordern. Und hier ist deine Schlafstelle auf der alten Wurfschleuder, die doch nimmermehr gebraucht wird, hier ziehen wir eine Wand von Latten, und du überziehst sie mit Papier, so hast du dein Haus da drin und dein Fenster, und deine Schreibereien liegen da ungestört, und wenn wir nachts nicht schlafen können, so können wir wie bisher miteinander reden; du sagst, was du Neues gelesen, und ich, was ich in jungen Tagen bei den Franzosen und Italiener erlebt habe.“ Berthold: „Du sprichst wie aus himmlischer Eingebung, wie kann ich mich widersetzen? Seht, da kehre ich meine Tasche um in den Topf, das ist meine ganze Habe, so tut desgleichen, und solang der Topf nicht leer ist, greife ich dreist in eure Schüsseln.“ Martin: „Halt, Bruder, du hast schon zuviel voraus, gleiche Brüder, gleiche Kappen, fort mit den Batzen, bis ich auch welche verdient habe und gleich einlegen kann.“ Berthold: „Hör nur da ruft’s vor dem Tore, da kommt ein reiches Trinkgeld, das setzest du gegen meinen Sparpfennig; was der bringt, gehört uns auch zusammen.“ Martin: „Das wird nicht viel sein, aber du sollst deinen Willen haben; rückt nun den Tisch, hebt den Eimer über, nun laßt die Winde langsam ablaufen: das mußt du alles lernen, Bruder Berthold, wenn du mit uns im Adlerneste hausen willst; die Krähen werden dir oft genug den Käse vom Brot stehlen.“
Berthold hatte das alles schon gelernt, und während Martin die Winde in Ordnung brachte, hatte er schon den wohlbeschlagnen Eimer auf die andere Rolle übergelegt. Frau Hildegard erinnerte Martin, seinen Schafpelz anzuziehen, er aber lachte und sprach: „Hab eher im Schnee geschlafen, als wärens Daunen, als ich noch bei den Kronenwächtern diente, doch halt, davon darf ich nicht schwatzen, ich habs geschworen.“ Der Reiter unter dem Tore fluchte, daß es so lange daure, und Martin wollte ihm eben in alter Kriegsmanier antworten, da bat jener sorglich, er möchte den Eimer nicht anstoßen lassen, es sei zerbrechliche Ware darin, und Martin verschluckte seine Antwort und sprach: „Zu meiner Hochzeit hättet Ihr wohl das Fluchen vergessen können.“ Der Reiter schrie herauf: „Nimm das, was im Eimer liegt, zum Hochzeitsgeschenk, sei eingedenk deines Schwures, kein Turm ist zu hoch, kein Grab zu tief für Gottes Richterschwert und für unsern Pfeil!“ Martin trat ernst mit dem Kasten ins Zimmer, den er aus dem Eimer genommen, setzte ihn in der Zerstreuung auf den Apfelkuchen und brummte vor sich: „Wäre ich nur nie bei den alten Mördern gewesen!“ Als Frau Hildegard wegen des Apfelkuchens schalt, sagte er: „Es ist auch ein Hochzeitgeschenk, mit dir, Berthold, wird es geteilt, vielleicht ists ein feinerer Kuchen, macht es sorglich auf, es soll sehr zerbrechlich sein.“ Frau Hildegard schob den durchlöcherten Deckel auf, hob eine Pelzdecke auf und sah mit großem Erstaunen einen kleinen Knaben, der auf einem Totenschädel, halb mit einem weichen Kissen bedeckt, ruhte und schlief. „Ha“, fuhr Martin bei dem Anblick auf, „es hat das Zeichen?“ Bei dem Worte sprang er hinaus, sah aber nur noch in bedeutender Entfernung den Reiter auf seinem Schimmel, wie sein weißer Mantel im Winde gleich einem Segel aufbauschte, und wie er sich bald gleich einer Schneewolke unter den stumpfen Weiden der Straße verlor. Er kam zurück, als Berthold mit überwundener Sorge sprach: „Es ist nicht tot, es schläft nur, tragts ins Bette, Frau Hildegard, aber denkt nicht, daß dies liebe Kind Euch allein gehört, mein ist die Hälfte, Martin hats versprochen.“ Martin: „Du sprichst ja wie ein Versucher, dem ich des Kindes Seele verschrieben habe.“ Berthold: „Ich brauche nicht seine Seele, ich brauche nur seine Hand, ich wills zum Schreiber aufziehen.“ Martin: „Versuchs nur; wenn der Knabe älter wird, da merkt er schon in sich, daß er nicht zum Schreibtisch, sondern unter den Helm gehört; aber Hildegard, ist es dir denn lieb, ein Kind zu haben, bist ja so still emsig, es einzupacken, als ob du es im Federbett ersäufen wolltest.“ Hildegard: „Still, hab nie ein schöneres Kind gesehen, alle andern sind Holzklötze dagegen, ein feines Bild aus Elfenbein ist dies, das muß aus hohem Geschlechte stammen; wenn wir nur reich wären, um es fein ordentlich aufzuziehen!“ Martin: „Gott sorgt für die Gemslein auf den Felsenspitzen, sieh her, Hildegard, sieh den Schatz, der bei dem Kinde im Kästchen liegt.“ Berthold: „Fünf Goldgülden, alle mit dem Stempel unsres letzten Schwabenherzogs Konradin, die sollen wunderselten sein, die mögen in einer recht alten Sparbüchse gerostet haben, bis die grimme Not, die das liebe Kind verstoßen, sie in die Welt trieb. Der Schatz soll dem Kinde bleiben, ich sorge mit Abschreiben in den Abendstunden für das Kind.“ Martin: „Ich sorge für meine Hälfte, sonst hau ich sie mir von dem Kinde ab, hab wohl keine Kinder mehr zu erwarten, will mich auch von einem Kinde streicheln lassen: ob ich mir hier ein Kind oder einen Hund futtre, das kostet gleich viel!“ Das Kind war von dem Streite aufgewacht und forderte schreiend seine Nahrung, die Frau war in großer Sorge, was sie ihm geben sollte, sie hoffte, daß ein gläubiges Gebet zur heiligen Mutter ihre Brust mit Milch füllen könnte, aber Martin schüttelte mit dem Kopfe und sprach: „In unsrer Zeit geschehen keine Wunder.“ Frau Hildegard ließ sich aber nicht stören in ihrem Glauben, sondern betete an ihrem kleinen Altare, und wie sie noch so betete, da hörte sie das Kind schlucken, das ganz allein lag, weil die beiden Männer an den Herd gegangen waren, um Feuer zu einem Brei anzuschüren. Sie sah sich um und erblickte ihre große schwarze Ziege, die sich aus dem Stall losgerissen und auf das Bette gesprungen war, und das Kindlein sog mit freudiger Begierde an der Ziege. Hildegard richtete sich mit gefaltenen Händen auf und rief die Männer: „Seht, seht, dem Frommen geschehen alle Tage Wunder!“ Berthold faltete gleichfalls verwundert die Hände, aber Martin sprach gleichgültig: „Es ist doch gut, daß wir heut das Zicklein zum Hochzeitbraten opferten, die Ziege wäre sonst mit keiner Gewalt zum Stillen des Kinds zu zwingen gewesen, jetzt drängt es sie dazu: es ist nicht alles Liebe, was die Menschen so nennen!“ Dann nahm er Berthold bei der Hand und führte ihn an die andere Ecke des Zimmers, wo der Kasten stand, und sprach wehmütig und leise: „Sieh da das weiße Kind unter dem gehörnten schwarzen Tiere, das dem Teufel ähnlich sieht; so kommt die Unschuld zur Schuld und nährt von ihr, so soll auch ich das Kind ernähren und bin nicht wert solcher himmlischen Gnade. Ich halts nicht aus! Habe so viele blühende Jünglinge in Feldschlacht und Fehden erschlagen und werde nun zum Narrn vor Freude, daß ich der Welt ein Kind zum Ersatz aufziehe, o ich wollte, daß ich bei meinem Vater am Webstuhl ausgeharrt, oder daß ich gar nicht gelebt hätte. Wer weiß, wem der Schädel gehört, der bei dem Kinde liegt, er trägt eine schwere
Konradin: 1268 in Neapel enthauptet, der letzte Staufe
Narbe, wie ein Fenster, durch welches der Geist zum Himmel geflogen; vielleicht habe ich ihm die geschlagen. Ich mußte meinen Herren folgen auf den Fehden, und sie fragten mich nicht, ob sie ein Recht hätten zum Blutvergießen, es hieß nur: hier gilts, hier mußt du vor, Martin! Es sind jetzt noch keine sechs Monat, da focht ich mit einem jungen Ritter, er wehrte sich entsetzlich, da fiel ihm der Helm ab, ich hatte ihm die Schienen durchhauen, und mein Schwert drang tief in sein Haupt, er war schön wie eine Jungfrau, meinen Hals hätte ich abschlagen lassen, um ihn zu heilen, aber der Tod läßt sich nicht wieder gutmachen. Ich sagte den Kronenwächtern mit Abscheu meinen Dienst auf, sie ließen mich ziehen. Das Kind gleicht dem Ritter, sie habens mir geschickt. Berthold, zieh es zum Frieden auf, es soll für mich beten.“ Berthold sah verlegen nieder, es war ihm, als ob ein anderer als Martin mit ihm rede, so weich hatte er ihn nie gekannt, er sah nach dem Schädel und wies auf etwas Blinkendes, das darin steckte. Martin: „Wird wohl ein Splitter von meinem schartigen Doppelschwert sein oder ein Helmring; laß es stecken, so etwas, das einem Menschen den Tod brachte, muß vergraben sein, ich werds auch bald sein. Wenn einst andere Leute so in meinen Schädel hinein sehen, was werden sie darin lesen?“
Zweite Geschichte: Die Chronik der Stadt
Die Nacht verging unbemerkt in mancher Besorgung für das Kind, am Morgen bemerkte erst Frau Hildegard eine feine Schrift auf dem Kasten, der das Kind geborgen, und Berthold las da den biblischen Spruch auf das Kind angewendet: Gehet hin und taufet ihn im Namen des Vaters. Frau Hildegard erschrak, daß dies wohl sechs Monat alte Kind noch nicht getauft sei, und Berthold nahm es eilig mit dem Bette in seinen Mantel, da Martin von seinem Wachtposten nicht abkommen konnte. Erst lief er zum Bürgermeister und berichtete ihm den seltsamen Vorgang, indem er zugleich den zierlich mit blauer und roter Tinte geschriebenen Neujahrswunsch abgab. Der Bürgermeister war in sehr gnädiger Stimmung, dankte freundlich und sagte, daß er dieses Kind wohl zu sich nehmen würde, wenn er verheiratet wäre, jetzt könne es aber seinem Rufe bei den Eltern seiner Braut schaden, übrigens werde wohl zuweilen aus der Armenkasse etwas für das Kind zu erübrigen sein, und man müsse inzwischen nachforschen, wer des Kindes Eltern wären. Das alles hatte der Schreiber sich längst selbst bedacht, nahm es aber doch wie hohe Weisheit an und, entfernte sich demütig. Aber die Frühmesse war inzwischen schon längst zu Ende gegangen, als er nach der Pfarrkirche kam. Der Geistliche trat eben hinaus, ihn fror sehr, und er war nur mit Mühe zu überreden, die Taufe sogleich zu erteilen. In der Eile vergaß er, sich nach Vor- und Zunamen des Kindes zu erkundigen, und fragte während der Handlung, wie es heißen sollte! Berthold, der es auch nicht bedacht, antwortete Berthold, und weil der Pfarrer es für Bertholds Kind hielt, so taufte er es Berthold mit Vornamen und Berthold mit Zunamen, so daß es nun Berthold Berthold hieß, oder Berchtold Berchtold, wie andere den guten alten Namen schreiben. Der Tag durchbrach siegend die Schneewolken, als Berthold im Turme das Kind aus dem warmen Mantel hob und sich in dessen hellen Augen sonnte. Die lahme Elster, die in der vorigen Nacht alles unter dem Bette verschlafen hatte, sprang zum Kinde mit Hildegard und Martin und rief zu ihm: „Berthold, Berthold.“ „Sie weiß es schon“, rief Berthold verwundert, „das haben ihr gewiß die Sperlinge gesagt, die in der Kirche herumflogen.“ Martin aber ging ruhig zu seiner Arbeit an der neuen Lattenwand zurück und brummte vor sich: „Nenne ihn, wie du willst, er wird seinen rechten Namen doch erhalten, wenn seine Stunde schlägt, aber sieh hier, wie fleißig ich gewesen bin; die Wand ist gleich fertig, und nun schaffe Papier zum Überziehen.“ „Auch dafür habe ich in der Schreibstube gesorgt“, antwortete Berthold, „sieh die schönen großen Bogen, habe darauf in jungen Jahren, als ich noch mehr Freude am Schreiben hatte, die Chronik von unserm Städtlein geschrieben, der Knabe mag daran buchstabieren lernen.“ „Schade, daß wirs so zerreißen müssen“, sagte Martin, „habe oft darüber nachgedacht, wie die Leute auf den närrischen Einfall gekommen sind, sich hier niederzulassen, obgleich jedermann lieber in Augsburg wohnen möchte.“ „Ei“, sagte Berthold, „du denkst, das Glück hat immer auf dem Fleck wie jetzt gestanden, vielmehr rückt es immer von einem Platze zum andern, weil es nie sich festsetzen darf und des Stehens müde wird. Es gab eine Zeit, wo Augsburg kaum genannt wurde, und da stand hier eine Stadt, die auch niemand mehr zu nennen weiß, die war das Haupt von ganz Schwaben, zwei Meilen von hier nach Schorndorf soll noch ein Stück von unsrer alten Stadtmauer zu sehen sein, bei meinen Geschäften ist mir aber die Reise zu weit, um es zu besehen.“ „Und ich darf vom Turme gar nicht fort“, klagte Martin. „Tröste dich mit mir“, meinte Hildegard, „ich dürfte wohl herunter, aber bei meinem Schwindel darf ich die Windeltreppe nicht ansehen, sonst gehet alles mit mir um; da sagen denn die bösen Leute in der Stadt, daß ich zu stark geworden sei, um die Treppe zu steigen; wer weiß, ob solche Lügenreden nicht auch in die alten Geschichten gekommen sind, so daß kein Mensch jetzt mehr sagen kann, wo die Lüge aufhört, und wo die Wahrheit anfängt.“ „Aber ich habe es geschrieben funden auf altem Pergament“, rief Berthold; „wer würde sich die Mühe geben, Lügen aufzuschreiben? In diesem Pergament fand ich auch, was hier steht, daß der Attila, Gottes Geißel getauft, diese Hauptstadt der alten schwäbischen Herzoge bis auf den Grund ausbrannte, und daß wir entweder gar nicht lebten oder doch keine Waiblinger wären, wenn nicht die Frau des Frankenkönigs Klodwig hier drei Hirsche mit ihrer Armbrust erlegt hätte. Seinem Weibe zu Ehren baute der Frankenkönig die Stadt, nannte sie von ihr Waiblingen, versteht ihr wohl, weil dort einem Weibe gelingt, was sonst kaum ein Mann leisten kann auf der Jagd.“ „Und davon kommen wohl die drei Hirschhörner in unserm Stadtwappen?“ fragte Martin. „Ein schlimmes Zeichen für uns Ehemänner“, fuhr er fort; „muß nur die Wand hier recht dicht und fest zukleben.“ Berthold blätterte weiter und sagte: „Du hast mir ein Stück Geschichte zugeklebt, da stehe ich schon beim Kaiser Konrad, der so viel auf die Treue seiner Waiblinger hielt, daß er es zum Feldgeschrei der Seinen gegen die verräterischen Welfen machte. ,Hier Waiblinger‘, hieß es, wo es hart herging, und mit dem Feldgeschrei siegte er über alle Feinde. Der hörnerne Siegfried war ihr Anführer, der seinem Herrn die starke Braut bezwungen hatte und dafür durch den tückischen Hagen sein Leben einbüßte; nun, von dem Märchen singen ja noch die Fiedler auf den Straßen, und es wäre wohl gut, daß sie etwas Neues lernten, denn es will ihnen niemand mehr zuhören.“ „Was haben mir die Italiener von Ghibellinen oder Wibellinen erzählt!“, unterbrach ihn Martin; „sie schimpften sich noch so, obgleich keiner mehr wußte, was es bedeute, und da kommt all der Lärmen aus unserm Städtlein.“ „Ehre unsere Stadt, alter Martin“, sagte Berthold, „denn sie hat viel mehr Auszeichnung genossen zur Zeit der schwäbischen Kaiser. Vor allem liebte sie der hochberühmte Friedrich Barbarossa, erbaute auch hier einen
Konrad III. († 1152): in den Kämpfen mit dem welfischen Kaiser Lothar kamen die Rufe auf „Hie Welf!“, „Hie Waiblingen!“ / Ghibelline: ital, für „Waiblinger“, nach anderer Meinung von den Italienern übernommene sarazenische Übersetzung von „Hohenstaufen“ („Hoher Berg“)
Palast, gleich dem von Gelnhausen. Ich habe ihn oft gesucht dort unter den Trümmern, aber ich konnte nicht ohne Aufsehen über das alte Mauerwerk klettern, und die Leute hätten gemeint, ich sei auch so ein Schatzgräber, die immer noch bei den alten Häusern, welche die große Feuersbrunst einstürzte, nach Gold suchen und Kohlen finden. Die Beschreibung von dem Schlosse ist gar sehr prächtig. Hinter ihm war ein seltsamer Garten von fremden Pflanzen. Alle Zimmer waren kostbar mit Teppichen und Waffen des Morgenlandes verziert, aber am reichsten die Kapelle zu Ehren der heiligen drei Könige, deren Leichen dort eine Nacht geruhet, als sie der Kaiser von Mailand nach Köln sendete. In dem Hause hier sollen die Anhänger des schwäbischen Hauses noch lange Zeit ihre Zusammenkünfte gehalten haben, bis die große Feuersbrunst es mit aller Herrlichkeit gleich der ärmsten Hütte verzehrt hat.“ „So gehts auch Eurer saubern, schön gemalten Handschrift, habt sicher nicht gedacht, sie so zu verbrauchen, als Ihr Euch dem Schreiben unterzogen“, bemerkte hier Martin. „Ich erheiterte mich als Knabe“, erwiderte Berthold, „mit der gewissen Zuversicht, sie werde sich zum ewigen Andenken wie die alten Schenkbriefe der Stadt von einem Ratsschreiber zum andern vererben, aber der Bürgermeister warf sie neulich zornig dreinreißend vor die Tür, weil er etwas von den Seinen, die ich unter dem Namen nicht erkannt, darin gefunden, das ihm gar nicht lieb war, daß nämlich eine Jungfrau seines Geschlechts einen Löwen in unsrer Stadt geboren habe. Es hat sich damals ein Löwe hierher verlaufen gehabt, der viele Menschen würgte, bis diese Jungfrau ihm entgegentrat, der er geduldig den Kopf in den Schoß legte und sich von ihr mit gemeiner Kost abspeisen ließ. Da glaubten schon die Leute, sie sei eine Heilige, bald aber kam es heraus, daß sie sich ihm vermählt habe, als sie einen Löwen gebar, denn da zog der Alte mit seinem jungen Löwen fort, sie aber stürzte sich aus Gram in die Rems.“ „Sollte die Geschichte also doch wahr sein?“, brummte Martin; „hab sie den Kronenwächter nie glauben wollen, von dem Löwen stammten nachher viele Menschen, versteht Ihr mich, von ihren gelben, lockigen Haaren wurden sie Löwen genannt, auch von ihrer Stärke und königlichen Abkunft. Doch das stirbt hier unter uns, ich darf davon nicht reden, aber Ihr wißt doch von dem Feinde unsres Barbarossa, daß der Heinrich der Löwehieß; kein Stamm geht unter, aber erst, wenn
Heinrich der Löwe (1129–95) versöhnt sich erst 1193 mit Barbarossas Sohn, Heinrich VI.
feindliche Stämme sich innerlich versöhnen und verbinden, wird der Friede kommen auf Erden.“ – „Aber wie ist mir?“, rief Hildegard, verließ das schlummernde Kind und trat ans Fenster; „es ist, als ob es schon wieder Nacht werden wollte.“ „Es wird eine Schneewolke sein“, meinte Berthold. „Nein, nein“, seufzte Martin, „ich sagte wieder ein Wort zu viel, das geht mir nicht ungestraft hin, seht nur, die Sonne verliert ihren Glanz, daß jeder sie anschauen kann, wie ein verweintes Auge. Der schwarze Star deckt sie immer mehr, die wird nicht wieder scheinen, seht, wie die Vögel in den Tannen sich verstecken, auch unsre Elster geht schon unters Bette zum Schlafen, die Schatten der Bäume verschwinden vom Schneegrund, denn ein Schatten deckt alles, ich stehe vor der Sonne, daß sie nicht scheinen mag. Die Bürger laufen umher und wissen nicht, woher ihnen die Strafe kommt. Hört ihrs da unten, das brachte ich euch!“ „Schweig, Martin“, unterbrach ihn Berthold, „ich muß dir sonst den Mund zuhalten; mir ist nicht wohl in der Dunkelheit, und die Bürger läuten der Sonne die Sterbeglocke; jetzt ist sie kaum noch einer Mondensichel zu vergleichen, die am Tage da oben stehengeblieben, aber wartet geduldig, um einen Menschen geht die Welt nicht unter. Aus meiner Chronik erinnere ich mich einer Sonnenfinsternis, die so dunkel gewesen, daß die Arbeiter der großen Wollenwebereien in Augsburg aus Angst, zu den Ihren zu kommen, einander totdrängten, und nachher war alle Not verschwunden, nur die nicht, die sie selbst in der Angst geschaffen hatten.“ „Ihr habt recht“, sagte Hildegard, „mir ist, als ginge die Sonne mitten am Himmel wieder auf, als wäre ihr Licht tausendfach schöner als je; wie sich unsre Tauben erschwingen und Kreise um den Turm ziehen!“ „Die Bürger lachen ihrer Furcht“, fuhr Berthold fort, „schämst du dich nicht, Martin?“ „Wärs mit der Scham abgetan und mit der Furcht“, sprach Martin in sich, „ich wollte mich fürchten und meiner Furcht mich schämen und den Spott der Kinder tragen; mir aber ist es mehr als eine Sonnenfinsternis, was ich gesehen; vergebens ziehen die Tauben ihre Kreise um mich her, sie können mich nicht schützen!“
Dritte Geschichte: Der Palast des Barbarossa
Die Ehe des Turmwächters Martin blieb ohne Segen eigner Kinder, um so höher ehrten die beiden Eheleute den kleinen Berthold, und Frau Hildegard hatte eigentlich keinen Augenblick, wo sie ihn vergaß. Selbst im Schlafe reichte sie ihm noch die Hand, daß er damit spielen und sie erwecken könnte, wenn er einmal früher aufwachen sollte. Die Elster war aber des Kleinen Gespielin, die ihm nie etwas zu leide tat, aber durch ihr Geschrei warnte, wo das Kind sich einer Gefahr aussetzte. Martin fand sich in seiner schwarzen Seelentiefe durch den Anblick des Knaben erhellt, schnitzte ihm Stöcke und Degen, so bunt der Kleine sie verlangte, und Berthold war eifrig beschäftigt, daß der Kleine früher als andere Kinder Buchstaben kennen lernte und bald auch buchstabierte. „Das wird ein Gelehrter“, sagte er mit Zuversicht, und Martin lächelte, aber Berthold ließ sich dadurch nicht abbringen von seinem Unterrichte. Schon im siebenten Jahre schrieb der Kleine eine feste Hand, rechnete schon notdürftig und wäre in der Schule als ein Wunderkind aufgetreten, wenn er sie hätte besuchen dürfen. Aber Berthold setzte seinen Schreiberstolz darin, ihn allein weiter zu bringen, als die bequemen Geistlichen in der Stadtschule es mit allen Züchtigungen bei den Stadtkindern vermochten, und Frau Hildegard war es sehr zufrieden, weil er sonst Unarten und Ungeziefer mit annehmen könnte. Nur Martin schüttelte mit dem Kopfe und sagte, es werde der Junge zu nichts in der Welt taugen und die beste Zeit seines Lebens in dieser Einsamkeit verlieren, doch sah er ihn zu gern um sich, als daß er ihn mit Ernst entfernt hätte. Schon im zehnten Jahre wußte ihn Berthold mit schriftlichen Aufsätzen aller Art zu beschäftigen, indem er ihm einbildete, die Stadt habe ihn als Unterschreiber angenommen. Der Kleine arbeitete sich in alles mit einem Amtseifer hinein, daß Berthold schon im zwölften Jahre des Knaben ihn dem Bürgermeister zuführen konnte. Dem Bürgermeister gefiel seine gute Bildung, sein freundliches Auge, noch mehr seine Handschrift, in der er selbst dem alten Berthold überlegen war, so künstlich dieser die Anfänge der Kaufbriefe verzieren mochte. Der Bürgermeister strich ihm die langen gescheitelten, blonden Haare und versprach, ihn mit einem kleinen Gehalt zur Hülfe des alten Bertholds anzustellen. Der junge Berthold dankte, daß er ihn in seiner Stelle wolle fortbestehen lassen, und Berthold klärte mit Selbstzufriedenheit seine List auf, wie er dem Knaben durch eine eingebildete Anstellung Lust zur Arbeit gemacht habe. Dem Bürgermeister machte der Einfall viel Spaß, er erzählte ihn seiner Tochter Apollonia, die eben eintrat, ungefähr ein Jahr jünger als der junge Berthold, und seit dem Tode der Mutter des Vaters Augapfel, während der junge Berthold von tiefer Scham über seine Täuschung immer heißer erglühte und sich zuletzt des lauten Schluchzens und der Tränen nicht erwehren konnte. Der alte Berthold entschuldigte ihn mit einer ihm angeborenen Blödigkeit, und der Bürgermeister versprach ihm ein Kleid, wenn er etwas Altes ablegte, wo dann Jungfrau Apollonia an das grüne Tuch, welches vom Ratstische abgenommen war, erinnerte, das sich auf der linken Seite noch untadelig gefunden hätte. Der Bürgermeister schenkte es auf ihre Bitte dem Knaben, dem es zwischen den Arm von Apollonien geschoben wurde, die er dabei seitwärts durch die Tränen ganz freundlich ansah und sich dann mit dem Vater fortbewegte.
Als der Vater den Knaben in die Ratsstube führte, ihm seinen Platz anwies, und wie er die Schriften ordnen sollte, da mußte der Knabe wieder weinen. Als der Vater nach der Ursache fragte, antwortete der Knabe: „Ich habe nun schon seit Jahren etwas zu tun vermeint, es war aber lauter Nichts und nur zu meiner Übung; wenn nun das alles, was ich hier treiben soll, auch nur zu meiner Prüfung und an sich zu nichts dient?“ „Vielleicht, lieber Sohn“, antwortete der Alte leise; „zuweilen überkommt mich so eine tiefere Einsicht, und sie erschreckt mich nicht mehr wie sonst, du aber bist ein Kind, darum weine dich aus wie ein Kind, wirst immer noch früher wieder lachen als ich, wenn ich dich zum Schneidermeister Fingerling führe und dir das grüne Kleid anmessen lasse, was du mit deinem Schreiben dir verdienet hast. An dem Kleid magst du erkennen, daß dennoch nichts vergebens ist, was der Mensch in gutem Willen tut.“ Sie gingen zu Meister Fingerling, und der kleine Berthold ward in der Werkstätte vom Meister nach allen Richtungen gemessen. Seltsam war es ihm, als er den Arm mußte heben und krümmen, wie er es sonst nie getan, er meinte in dem neuen Rocke künftig immer so stehen zu müssen. Während der Meister die Umrisse des Kleids auf das Tuch nach dem Maße kreidete und zuschnitt, sah der junge Berthold mit großer Aufmerksamkeit der Schere nach. „Ich sehe es wohl an deiner Neugierde“, sprach Fingerling, „daß du Lust zum Handwerk hast, und daß du die spöttischen Reden der andern Gewerke über uns Schneider nicht achtest.“ Der junge Berthold antwortete darauf: „Ich verstehe nichts von Eurem Gewerke, lieber Meister, aber unbarmherzig scheint es mir, wie Ihr mit der großen Schere das schönfarbige Tuch zerfetzt; mir ists, als zerschnittet Ihr mir die Haut, so lieb habe ich diese grüne Wiesenfläche; ich hätte mir das Tuch bewahren sollen, statt es zerschneiden zu lassen, um das Geschenk der edlen Jungfrau mir auf immer zu bewahren.“ „Du mußt ein Tuchhändler werden“, sagte der fixfingrige Mann, ohne von der geheimnisvollen Bewegung seiner Schere aufzublicken; „wenn so ein Händler mit rechtem, eignen Wohlgefallen das Tuch aufrollt und mit der Hand sanft überfährt, als ob er des Käufers ganz vergessen, da gibt jeder einige Kreuzer mehr. Ich für mein Teil denke, das Tuch wird erst durch meinen Zuschnitt zu etwas, wie der Mensch durch die Erziehung, ja ich sehe dann schon im Geiste die goldne Ehrenkette in dem Wams verdienen und darauf prangen.“ „Ich würde lieber ein Tuchhändler“, sagte der junge Berthold und empfahl sich dem Meister mit besonderer Zuneigung.
Frau Hildegard ehrte den Knaben mit tausend Zärtlichkeiten und noch mehr Ermahnungen, als sie seine neue Würde vernahm, nur Martin schüttelte mit dem Kopfe und brummte vor sich: „Sie haben ihn ganz aufgegeben und vergessen.“ Der junge Berthold wußte schon, daß er um solche Redensarten den alten Martin nicht befragen durfte, daher war auch alle Neugierde über dergleichen Äußerungen bei ihm verschwunden; er meinte, das gehöre so zu einem alten Kriegsmann wie das Fluchen. Keiner verlor aber mehr bei dieser Äußerung als der Martin. Die Frau war jünger und konnte sich so nicht in seine Launen fügen, wenn sie ihn auch lieb hatte, und ihre Liebe selbst war doch nur seiner Anwartschaft zur Türmerstelle gewesen: was konnte da mit den Jahren viel übrigbleiben, außer der guten alltäglichen Gewohnheit, alles als gemeinschaftlich zu betrachten, ausgenommen das Herz und die Gedanken?
Alle Morgen, wenn der junge Berthold vom Rathause kam, ging ihm Martin ungeduldig entgegen, sah ihn an und ließ sich berichten, was vorgefallen sei. Auf nichts mochte er sonst hören, jetzt hatte er mit dem Liebling wieder Auge und Ohr in die Welt gestreckt und ärgerte sich an dem vielen Unrecht, was auf dem Rathause zur Sprache kam, und fluchte vom Jüngsten Tage. Der alte Berthold aber meinte: „Das Gute bringen sie nicht zum Rathaus, so wenig sie ihr Brot auf die Straße werfen; so wissen wir im Rathause nur von den Sünden und auf der Straße nur von der Unreinlichkeit der Menschen.“
Aber Martin wurde immer finsterer, seine Augen verdunkelten sich, und es mochte wohl ein Jahr seit der Anstellung des jungen Berthold verflossen sein, als er einmal ungeduldig auf ihn wartete und endlich Frau Hildegard die Wacht anvertraute, um ihm entgegenzugehen. Endlich kam der junge Berthold, aber nicht von der Seite des Rathauses, sondern von der Seite der wüsten Brandstätte. „Erst erkannte ich dich nicht“, rief ihm Martin entgegen, „ist mir doch jetzt beständig wie damals bei der Sonnenfinsternis, die Sonne hat einen Flecken, und alles umher hat auch Flecken, nachdem ich hineingesehen; wie kannst du mich so lange warten lassen, ich bin so neugierig, wie sich der Streit wegen des alten Fundaments geendet hat, worauf der Nachbar übergebauet hatte.“ Aber der junge Berthold hörte nicht auf ihn, sondern umarmte ihn voller Seligkeit und rief wiederholend: „Das Haus des Barbarossa!“ „Was weißt du denn von dem?“ fragte Martin. „Hab ich nicht täglich davon an der Papierwand von Vater Bertholds Schlafkammer gelesen, habe ich nicht lesen gelernt an der Stelle, wo der Palast in der Chronik steht, und habe immer heimlich daran gedacht, daß ich ihn finden müßte, und heute habe ich ihn gefunden, als mir die alte lahme Elster beim Heimgehen entlief. O, sie weiß nun alles, was ich denke, und so zeigte sie mir den Weg und ließ mich nahe kommen und hüpfte weiter, wenn ich ihr den Finger hinhielt, daß sie darauf springen sollte, und so kletterte ich ihr ärgerlich über drei Mauern nach – ohne mich umzusehen – da erst sah ich mich um, denn sie rief weit von mir ,Berthold, Berthold’ – und mit freudigem Erschrecken sah ich mich von den mächtigen Überbleibseln eines wunderbaren Gebäudes umgeben, eine Reihe ritterlicher Steinbilder steht noch fest und würdig zwischen ausgebrannten Fenstern am Hauptgebäude, ich sah auch das Seitengebäude, ich sah im Hintergrunde einen seltsamen, dicht verwachsenen Garten und allerlei künstliche Malerei an der Mauer, die ihn umgibt – das ist Barbarossas Palast!“ – „So seltsam rufen sie die Ihren“, sagte Martin in sich; „so viel Tausende haben als Kinder unter diesen Mauern gespielt, und keinem fiel dies Gebäude auf, keiner dachte des Barbarossa.“ „Es ist mein“, rief der Knabe, „ich will es ausbauen und will den Garten reinigen, ich weiß schon, wo die Mutter wohnen soll. Komm mit, Vater, sieh es an! Du wirst sie alle wieder kennen in den Steinbildern, unsre alten Herzoge und Kaiser, von denen du mir so viel erzählt hast.“
Bei diesen Worten zog er den alten Martin über die Trümmer der wüsten Stadtseite fort, und Martin folgte ihm willig, aber mit Mühe, denn in dem einsamen Wächtergange des Turms hatte er seine Sehnen zum Klettern allzusehr erhärtet.
Da stand er endlich atemlos in der grünen Wildnis vor den Steinbildern und rief: „Wie sie mit Efeu bewachsen sind, und ich erkenne sie doch, sieh, das ist Barbarossa, es ist mir doch nie so wohl geworden wie an diesem Flecke, fänden wir nur die Kapelle der heiligen drei Könige!“ „Ich war schon drin“, sagte der Knabe, „aber ich kann die Türe nicht wiederfinden, auch der Alte ist fort, der mich hinführte, und je mehr ich sein gedenke, desto sonderbarer fällt es mir auf, daß er dem Steinbilde des Barbarossa ähnlich war, Seht, hier saß ich und staunte alles an, da klopfte er mir auf die Schulter, der Alte in dem seltsam prächtigen Mantel, vorn mit einem roten Steine zugeheftelt, und fragte mich, ob es mir wohlgefalle, dieses Haus in den Trümmern, er habe ein steinern Bild, wie es gewesen, im kleinen ausgeführt, das wolle er mir zeigen, so solle ich es aufbauen, und ich würde viel Glück in dem Hause erleben, und wenig würde mir von meinen Wünschen unerfüllt bleiben.“ „Und du hast es gesehn?“ fragte Martin, indem er den Knaben auf andere Art als je ansah. „Freilich“, antwortete der junge Berthold, „und nimmer werde ich das kleine Steinbild vergessen, ich könnte es Euch, hier auf dem Boden herzeichnen. Könnte ich nur die Türe wiederfinden, wo er mich einführte, es ist, als ob der Alte sie mit Schutt bedeckt hat. Hier war es, meine ich, da führte er mich in einen gewölbten Gang, an dessen Ende er eine metallne Türe öffnete. Wie erschrak ich, als wir da eintraten! Das ganze hochgewölbte Zimmer, von zwei hängenden Lampen erleuchtet, schien mit Gold und Edelsteinen, wie andre Häuser mit Kalk, überzogen, in der Mitte stand ein Sarg, und darin lagen drei hochehrwürdige Männer mit Kronen, und als ich den Sarg näher betrachtete, war es dies Haus, schön neu und vollendet, und schien mir gewaltig groß, ob ich gleich drüber weg und hinein sehen konnte, und als ich die alten Männer näher betrachtete, so sah ich, daß der mittlere dem Alten glich, der mich hineinführte. Ich sah mich um nach dem Alten, es war mir, als wäre er es selbst, der da lag mit Königen, aber er war fort, eine Angst füllte mein Herz, ich weiß nicht warum, ich floh aus der Kapelle, aus dem Garten über die Mauer, und so fand ich Euch, Vater Martin.“ „Warum flohst du dein bestes Glück, unglücklicher Knabe?“ rief Martin. „Aber so ists mit dem Menschen, der bildet sich viel auf seine Natur ein und meint, seine Liebe und sein Haß, seine Furcht und Hoffnung müssen einen wahren Grund und Boden in der Welt haben.“ Der Knabe sah den Alten an und verstand ihn nicht, sondern fuhr in seiner Rede fort: „Mir ist noch immer so bange, ich fürchte, der Alte ist ein Geist gewesen.“ Martin fuhr ebenso in seinen Gedanken fort: „Wir schaudern vor den Geistern und gehen doch lange schon als abgeschiedne Geister umher, wenn uns die Lebenden noch für mitlebend halten. – Höre nicht auf mich, mein Sohn, ich bin hier so vergnügt, wie ich lange nicht gewesen, und da schwatze ich mit mir selbst. Wie die Linden schön herduften, die den Garten schließen, mir ist nie so wohlgemut gewesen. Gott führt auf immer neuen Wegen zum Heil, unser Leben ist wie ein Märchen, das eine liebe Mutter ihrem unruhigen Kinde erfindet.“ „Aber wird nicht Mutter Hildegard mit dem Essen auf uns warten?“ unterbrach ihn der Knabe. „Sie wird noch öfter auf mich warten“, antwortete der Alte, „und ich werde nicht kommen, die Treppen des Turms steige ich nicht mehr hinauf und lasse auch das Seil nicht mehr zur Erde laufen nach täglicher Notdurft, sehe mir auch nicht mehr die Augen aus, ob irgendein Strauchdieb unsern Fuhrleuten auflauert, das ist nun alles aus, und ich bin hier eingesetzt, dich, Berthold, den Abkömmling der Hohenstaufen, zu erziehen, dir den Gebrauch ritterlicher Waffen zu zeigen und dein Schwert zu wetzen, daß es schneidet, wenn du es brauchen sollst.“ Der Knabe wußte ihm nicht mehr zu antworten, sondern schmiegte sich an ihn, als er ihn aber über sich singen hörte, da erschrak er, denn so lange er um ihn gewesen, hatte Martin nie gesungen, obgleich ihm ein Wächterlied anbefohlen war, sondern sich immer am Gesange geärgert und oft mit Steinen nach Knaben und Handwerksgesellen geschleudert, die singend aus der Stadt zogen. Als aber der erste Schreck vorüber war, da hörte er dem Martin gern zu, nie hatte er eine so tiefe, ernste Stimme gehört, es war ihm, als ob er eine ganze Kirche aus der Ferne singen höre, und jedes Wort blieb seinem Gedächtnis eingeprägt.
Martin: Im See auf Felsenspitzen
Wird bald dein Schloß, die Pfalz,
So eckig weiß dir blitzen,
Als wärs ein Körnlein Salz,
Und rings in dem Kessel von Felsen,
Da siedet das Wasser am Grund,
Ich rat es euch Wagehälsen,
Verbrennet euch nicht den Mund!
Es glänzen da sieben Türme,
Von sieben Strudeln bewacht,
Und wie der Feind sie stürme,
Der alte Türmer lacht;
Die alten Salme lauern
Auf frische Helden voll Mut,
Wenn Heldenbräute trauern,
Da füttern sie ihre Brut.
Denn sieh, die Schiffe kommen
Gerüstet bis zum Schloß
Gar prächtig angeschwommen,
Da trifft sie Wirbelstoß,
Und wie ein Rad der Mühle,
So drehn sie sich geschwind,
Als wär es nur zum Spiele,
Bis sie verschwunden sind.
Doch willst du einen retten,
Dem wirft der Türmer dreist
Um den Leib den Haken an Ketten
Und ihn hinüber reißt;
Und zeigt ihm des Schlosses Türe,
Doch wer nicht fliegen kann,
Der braucht der Leitern viere,
Eh er zur Türe hinan.
Und ist er eingetreten,
Da stehn vier eiserne Mann,
Die stechen, eh er kann beten,
Hält sie der Türmer nicht an;
Sie scheuen keinen Degen
Und haben doch kein Herz,
Stahlfedern sie bewegen,
Sie sind gegossen aus Erz.
Und ist er da vorüber,
Im grünen ummauerten Platz,
Da wird ihm wohler und trüber,
Als wär er bei seinem Schatz;
Da stehen die Kirschen in Blüten
Und Kaiserkronen in Glanz,
Die Nachtigall singet im Brüten,
Kein Mädchen führt ihn zum Tanz.
Der Türmer nimmer leidet
Ein Mädchen in der Pfalz,
Und ist sie als Ritter verkleidet,
So kostets ihr den Hals.
Doch hat er den Bart gefühlet,
Dann läßt er ihn zu dir ein,
Zum Schloßhof, wo Wasser spielet,
Mit buntem Strahlenschein.
Da fließt ein Brünnlein helle,
Das wie der Himmel rein,
Wie auch der See anschwelle
Von irdisch gelbem Schein;
Der Blumen stehen da viele
Am schwarzen Gemäuer entlang,
Und eine kleine Mühle
Steht mitten in dem Gang.
Die Mühle drehet und netzet
Den Schleifstein grau und fein,
Ein Alter schleifet und wetzet
Beständig auf dem Stein:
Ein Heldenschwert am Stein,
Da schleifet er alle Stunden
Und hat nicht Zeit gefunden,
Daß alle würden rein.
Nun, Fremdling, geh nur vorüber,
Dir springen die Funken ins Aug,
Bald wäre es dir viel lieber,
Du lägst bei den andern auch,
Denn keiner kömmt zurücke,
Der einmal hier oben war,
Es sei denn, daß er sich bücke,
Und daß ihm gebleicht sein Haar.
Die Zimmer des Schlosses sind enge,
Gewölbt von Doppel-Kristall,
Und blankes Silbergepränge,
Das spielt mit den Strahlen Ball;
Da sitzet auf einem Löwen
Des letzten Grafen Sohn,
An solchen gefährlichen Höfen
Ist das der sicherste Thron.
Er ist so sicher in Kräften,
So herrlich von Angesicht,
So glücklich in allen Geschäften,
Des Unsterns achtet er nicht;
Ihm scheint der Tag der Sage
Schon freudig durch die Nacht,
Die Nacht vorm Jüngsten Tage
Wird schweigend zugebracht.
Vierte Geschichte: Schatz und Messer
„Du kannst nicht schweigen“, rief eine Stimme aus dem Gebüsche; „zum drittenmal hast du den Schwur gebrochen!“ „Fluch über euch“, antwortete der Alte ergrimmt, „die ihr mein freies Herz an unbesonnene Schwüre gekettet, ich breche die Kette, ich fürchte euch nicht mehr.“ In dem Augenblicke zischte ein Pfeil neben dem Knaben vorüber in Martins Herz; er sah Martins Blut aufspritzen, hörte seine dumpfen Flüche und stürzte besinnungslos über ihn her, als wollte er ihn mit seinem Leibe gegen jedes Wurfgeschütz seiner Feinde sichern: aber kein; zweiter Pfeil war nötig. Die lahme Elster erweckte den jungen Berthold gar bald aus seiner Bewußtlosigkeit, um ihn von der ernsten Wahrheit seines ersten großen Verlusts zu überzeugen. Sein Gram verwandelte sich in Zorn, er forderte den Mörder auf, sich ihm zu stellen, allen Schimpf häufte er laut auf ihn, aber gleichgültig hallte die Mauer von seiner Rede, und Martins Richter und Feind schien entweder gleich verschwunden oder gegen die Reden des Knaben gleichgültig. Die Besinnung erwachte weiter in ihm, wie er Martin, wenn ihm noch zu helfen wäre, über die Mauern, die er allein mühsam überstiegen, nach der bewohnten Stadt schaffen könnte. Er beschloß eben, Menschen herbeizuholen, als der alte Berthold über die Mauern suchend gestiegen kam, beim Anblicke Bertholds frohlockte, aber beim Anblicke Martins sich kaum fassen konnte. Er hatte beide vor dem Tore gesucht, wo ein Vetter Martins seinen Weinberg liegen hatte. Ein fremder geharnischter Mann, den er ansprach, hatte ihm den Garten unter der Brandstätte bezeichnet, wo er sie gewiß finden würde, da habe er vom Berge einen Mann im roten Wams mit einem Knaben im grünen Wams stehen sehen. So war er auf den rechten Weg geführt worden, seinem lieben Martin die letzte Pflicht zu erweisen. Seiner Verzweifelung ließ er keine Zeit, sondern mit rascher Eile suchte er einen bequemen Eingang und fand auch schnell das Tor, wo nur wenige Steine weggewälzt zu werden brauchten, um den Leichnam Martins hindurchzuschleppen. Er und der Knabe trugen ihn nach der Badestube. Da ward ein Aufsehen, denn es war ein Sonnabend, und alle Handwerker wollten zum Sonntag reinlich erscheinen; die rot angelaufenen Gestalten drangen neugierig aus der dampfenden Badestube heraus, mancher mit Schröpfköpfen besetzt, ein andrer mit halb beschnittenen Haaren, und allen tat der alte Martin leid, weil er ein stattliches Ansehen im Tode bewahrte. Aber der Bader untersuchte die Wunde und sagte traurig, da vermöge seine Kunst nichts mehr; der Schütze, der ihn getroffen, müsse das menschliche Herz wohl gekannt haben. Nun jammerte erst Berthold und sein Sohn, kaum konnten sie dem eintretenden Bürgermeister Antwort geben, der sie über den Vorfall befragte, denn schon hatte das Gerücht sich verbreitet, Berthold habe Martin aus Liebe zu dessen Frau umgebracht. Es drohte der Bürgermeister mit der Folter, als ein Bote von den Freigerichten einging, welche durch ein Schreiben an den Bürgermeister erklärten, Martin sei schon lange wegen einer Mordtat verurteilt gewesen, aber erst jetzt von ihnen erreicht worden. So kam nun Berthold mit seinem Sohne und seinem Jammer frei und eilte zur Frau Hildegard, die sie gefaßt und von allem durch die beredte Hökerfrau am Tore unterrichtet fanden; sie suchte Berthold damit zu trösten, daß sie versicherte, Martin hätte bei seinem Husten doch wohl nicht lange mehr leben können. Martin wurde mit Ehren begraben, und der am innigsten und längsten ihn betrauerte, war der junge Berthold.
Der junge Berthold hatte sich so treu fleißig in dem Jahre seinem Geschäfte ergeben, daß der Bürgermeister ihn jetzt schon brauchbarer als den Alten fand, der sich nur mit Mühe in eine neue Einrichtung versetzen konnte. Er gestattete daher gern, daß der Alte vorläufig die Geschäfte des Martin als Türmer besorgte, und daß die Schreibgeschäfte sämtlich dem jungen Berthold übertragen wurden. So hatte nun der junge Berthold viel mehr Freiheit in der Anwendung seines Tages, denn der Alte saß ihm nicht mehr zur Seite, und diese Freiheit benutzte er reichlich, den entdeckten Garten sich einzurichten. Der Eingang war beim Heraustragen Martins eröffnet, so daß er jetzt vom Rathause zu der wüsten Marktseite in seine Trümmerburg schnell hinübergehen konnte, wenn er mit angestrengter Eile seine Schreibereien beendet hatte. Er zimmerte sich eine Gittertüre, die den Eingang schloß, damit nicht mutwillige Knaben ihm seine Arbeit verderben könnten, doch besser als diese Tür schützte ihn die Furcht vor geheimen Mächten, die jeder nach seiner Art sich dachte, die aber seit dem gewaltsamen Tode Martins sich mit den alten Gerüchten und Sagen gepfropft hatte. Es tat ihm leid, daß der Alte ihn nicht wieder besuchte, und daß er die Kapelle der heiligen drei Könige nicht wiederfinden konnte, allmählich schien es ihm sogar, als sei er etwas eingeschlafen gewesen und ein Traum habe ihn getäuscht, denn die schmerzliche Wirklichkeit von Martins Tode hatte jene Anschauungen in Schatten ge-
Freigericht (Freiding): Arnim denkt an die spätere Feme
stellt. Als er den alten Berthold darüber befragte, antwortete ihm dieser: „Wir glauben, was etwas ist, und wissen, was etwas nicht ist; wir wissen nichts, wir müssen alles glauben, aber der Glaube ist ohne Wissen nichts.“ Er verstand das nicht, aber er merkte sich es doch auf spätere Tage, weil er wohl ahndete, daß etwas darin liegen müsse. Übrigens waren des jungen Bertholds Gartenanlagen verständig. Wie er gern auch das Halbverstandene sich lernend bewahrte, so verfuhr er mit dem verwilderten Gartenplane; ehe er gewaltsam Bäume umhieb, suchte er sich deutlich zu machen, was gepflanzt sei, und was wild aus Samen und Wurzeln aufgewachsen. Zwar schien manches von dem Gepflanzten untergegangen und abgestorben, aber auch mit diesen Stämmen bezeichnete sich die Anlage des Gartens. Allmählich trat alles an seine rechte Stelle, indem das Überflüssige hinweggenommen war. Brunnen und Gänge waren gereinigt, die ausgeschnittenen, alten Obstbäume trugen wieder, und edler Wein bezog die sonnigen Mauern. Ein wohlerhaltenes gewölbtes Zimmer bewahrte während des Winters Blumenpflanzen und Sämereien, und so war dem jungen Berthold das erste Jahr mit sichtbaren Zeichen seines Daseins und Wirkens vergangen.
Da kam er eines Tages zum Abendessen und fand Frau Hildegard in stiller Betrübnis, aber sie wischte ihm dennoch nach ihrer Gewohnheit den Schweiß von der Stirn, zog ihm die Schuhe aus und die Pantoffeln an und sagte ihm dann erst, daß sie sehr betrübt sei, weil sie schon wieder heiraten müsse; der Bürgermeister wolle dem Berthold nicht anders das Türmeramt und ihm den Ratsschreiberdienst geben. „Tut es doch mir zuliebe“, sagte Berthold, „heiratet den Vater, da brechen wir hier die Wand weg und haben mehr Raum.“ „Ja, wie du’s verstehst“, sagte Hildegard; „der Martin hats mir wohl prophezeit an unserm Hochzeitstage aus dem Zinnguß, aber wenn mein Schwindel nicht wäre, daß ich die Treppe hinuntergehen könnte, ich ginge lieber ins Kloster, als daß ich wieder ins Ehebette stiege.“ „Mutter, du mußt heiraten“, sagte der Sohn, „denn ins Kloster dürfte ich nicht mitgehen, und ich kann dich nimmermehr verlassen.“ Hildegard drückte den Knaben an ihr Herz, der alte Berthold trat vom Wächtergange herein, sie verlobten sich unter vielen Tränen. Wirklich setzte es der Bürgermeister aus Wohlgefallen gegen den alten Berthold bei der Bürgerschaft durch, daß diesmal der Mann von der Feder, statt eines Kriegsmanns, die Türmerstelle erhielt, als Grund führte er an, daß der alte Berthold in früheren Zeiten doch auch der Stadt mit dem Schwerte bei mehreren Fehden gedient habe. Der junge Berthold wurde nur vorläufig in Eid und Pflicht genommen, weil er noch zu jung war, und der Alte behielt immer noch Gehalt und Würde eines Ratsschreibers. Die dritte Hochzeit, welche Frau Hildegard feierte, war die stillste von allen, der alte Berthold gestand mit inniger Rührung, daß die Wege des Himmels unerforschlich wären, der ihm nach ruhigem Ausharren im Alter ein Glück aufdränge, wonach er in früheren Jahren vergeblich sich bemüht; wenn er es auch nicht lange mehr genieße, so müsse er doch die Fügung des Himmels preisen. – „So ist es doch wahr“, seufzte der junge Berthold, „daß du älter wirst und gebeugter gehst, seltener froh bist und öfter stille in dich versinkst; stirb nur nicht so bald wie Martin, dann wären wir ganz verlassen.“ „Jetzt haben wir uns noch!“ sagte der Alte und ging, das Wächterlied vom Turm zu blasen.