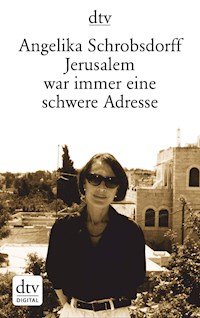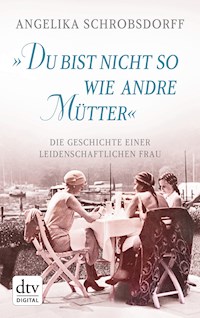6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine schicksalhafte Bekanntschaft in Jerusalem Ich beobachtete, wie er zielstrebig das Lokal durchquerte, und fragte, ohne die Augen von ihm zu nehmen: »Eli, wer ist dieser Mann?« Jerusalem - Paris - München: das sind die Städte, mit denen die Erzählerin schicksalhaft verbunden ist. Wahlheimat die eine, Wohnsitz des Geliebten und des Sohnes die beiden anderen. Doch egal, wo sich die ›Halbjüdin‹ aufhält, die Erinnerungen reisen mit ihr ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 721
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Angelika Schrobsdorff
Die kurze Stunde zwischen Tag und Nacht
Roman
Für Claude
Wenn die Sonne sich den Hügeln nähert und als rotglühende Kugel aus ihrem Strahlenkranz heraustritt, beginnt eine der schönsten Stunden und eine der einsamsten: die kurze Stunde zwischen Tag und Nacht, zwischen schrillem Licht und milder Dunkelheit, die lange Stunde zwischen schwindender Zuversicht und nahender Verzagtheit. Das Blau des Himmels vertieft sich, honigfarbenes Licht fließt auf die Stadt und läßt den bleichen, wuchtigen Stein der Häuser aufleuchten – jeder Stein Gold, das häßlichste Haus plötzlich verzaubert. Und dann wird zur Gewißheit, daß nichts in dieser Stadt ein Zufall ist, nicht das Licht, das auf sie herabfällt, nicht der Stein, aus dem sie gewachsen ist, nicht die Hügel, die sie umschließen; nicht die Menschen, die hier ihren Gott gefunden haben, und nicht die Menschen, die ihn noch manchmal finden – in der Stunde zwischen Tag und Nacht, in dem Licht, dem Stein, den Hügeln; in der Stadt Jerusalem.
1Jerusalem
Das Haus, in dem ich wohne, steht auf einem der zahllosen Hügel, die die Stadt umschließen. Auch dem Haus gegenüber, durch ein weites Tal von ihm getrennt, erhebt sich eine Hügelkette. All das war unberührt, als ich vor dreizehn Jahren das erste Mal nach Jerusalem kam. Das Ende der Gazastraße war auch das Ende der Stadt. Von hier ab gab es keine Straße mehr, keine Häuser und nur wenig Bäume. Es gab Steine und Erde, rostrot, elfenbein- und ockerfarben und ein altes griechisch-orthodoxes Kloster inmitten eines Olivenhains.
Ich war entzückt. Genauso hatte es sich mir in meiner christlichen Kindheit eingeprägt, das Heilige Land, genauso war es auf Kirchen-Krippen und Lesebuchbildern dargestellt worden. Ich dachte: »So war es vor zweitausend Jahren, und so wird es bleiben.«
Heute ist das Ende der Gazastraße der Anfang zu einem der vielen neuen Viertel, die sich kreisförmig um die Stadt legen und deren einziger Unterschied darin besteht, daß die früher gebauten Häuser noch häßlicher sind als die, die man später gebaut hat. Am griechisch-orthodoxen Kloster vorbei führt eine breite Ausfahrtsstraße, der die Olivenbäume zum Opfer fallen mußten. Die Hügelkette, auf der mein Haus steht, und die, die ihm gegenüberliegt, sind bis ins Tal hinunter mit Häuserblöcken gespickt worden, solchen, die hoch, und anderen, die lang sind. Durch das Tal windet sich das graue Band einer Straße.
Als ich meine Wohnung zum ersten Mal besichtigte, hatte ich, wenn auch keinen schönen, so doch immerhin freien Blick. Die Häuser, die den Hang hinabkletterten, waren nur drei bis vier Etagen hoch, und wenn ich es vermied, auf ihre flachen, mit Fernsehantennen verzierten Dächer zu sehen, konnte ich mir noch eine Illusion von Weite bewahren. Drei Wochen später, als ich die Wohnung bezog, blickte ich von meiner Terrasse auf die ersten Stockwerke eines Neubaus hinab.
»Noch eine, höchstens zwei Etagen höher«, dachte ich optimistisch und ertrug das höllische Trio aus Bagger, Zementmixer und Preßluftbohrer mit einem gewissen Gleichmut.
Doch das Haus wuchs. Mit dem fünften Stockwerk erreichte es die Höhe meiner Terrasse, mit dem siebenten die Höhe des gegenüberliegenden Hügelrückens, mit dem achten stemmte es, alles überragend, seine rechteckigen Schultern in den machtlosen Himmel.
»Aber Christina«, hatten mich meine zionistischen Freunde auf meine Beschwerde hin belehrt, »Jerusalem ist nicht nur eine historische Stätte, es ist auch eine lebendige, wachsende Stadt. Kahle Hügel sind wertlos, Bäume dagegen ziehen Feuchtigkeit an und Häuser Neueinwanderer.«
»Ja, aber die Schönheit«, hatte ich unter ihrem nachsichtigen Lächeln geklagt, »die Schönheit geht verloren.«
Die Illusion von Weite ist mir genommen und damit die Enge des Landes bewußt geworden. Und auch auf den romantischen Traum einer Touristin, die glaubte, Jerusalem sei unwandelbar, mußte ich verzichten. Jerusalem ist wandelbar. Es lebt, es wächst, einen der vielen Beweise habe ich, achtstöckig, vor meinem Fenster. Doch manchmal steuere ich meinen Blick an ihm vorbei und klammere ihn an das letzte Stückchen des kahlen Hügelrückens. Dort sinkt die Sonne, eine rotglühende Kugel, deren letztes Licht die Stadt verzaubert.
»Jerusalem ist unwandelbar«, denke ich dann, denn ich verzichte nicht gerne auf meine Träume.
Es ist heiß, ungebührlich heiß für Ende September. Die Hitze drückt auf die Stadt, nistet in den Wohnungen, staut sich in den Köpfen der Menschen. Es ist die dürre, knisternde Hitze, die der Kamsin direkt aus der Wüste liefert. Die Trockenheit kriecht in Nasenlöcher, Mund und Kehle. Man niest, hustet, schüttet literweise Flüssigkeit in sich hinein. Man läßt die Jalousien herunter, reißt die Fenster auf, hängt nasse Laken davor. Nichts hilft. Die Luft steht, elektrizitätsgeladen und entnervend, die Temperaturen steigen, die Luftfeuchtigkeit sinkt auf ein Minimum ab. Jerusalem ist eine Wüstenstadt, unberechenbar und extrem in seinen klimatischen Ausbrüchen.
Ich sitze, in ein Handtuch gewickelt, auf dem Sofa, feucht von einer Dusche, die hätte kalt sein sollen und warm war. Vor mir auf den Fliesen liegt meine Katze und sieht aus wie ein langhaariger Pelzkragen, den man aus unerfindlichen Gründen dort hingeworfen hat. Licht strömt ins Zimmer wie fahle Flüssigkeit. Der Ventilator, den ich neben mich auf den Tisch gestellt habe, pflügt einen Streifen heißer Luft um.
»An solchen Tagen«, hatte mir Ibi erklärt, »tut man am besten gar nichts. Man bleibt da liegen oder sitzen, wo einen der Kamsin gerade überrascht, und steht erst wieder auf, wenn er vorbei ist.«
Ibi gehört zu den wenigen Menschen, die mir aus der Vergangenheit geblieben sind. In Berlin war sie Freundin meiner Eltern, in Palästina wurde sie die Liebe meines Bruders, für mich ist sie, siebenundzwanzig Jahre später, Mutterersatz und Vertraute geworden. Sie hat sich in fast vier Jahrzehnten wenig verändert. Ihr feines Gesicht mit dem matten, olivfarbenen Schimmer ist immer noch schön; ihr helles, sprudelndes Lachen hat sich seine Kindlichkeit bewahrt, ihr Optimismus, mit dem sie den unerfreulichsten Situationen erfreuliche Lichtblicke abgewinnt, ist ungebrochen.
»Alles im Leben ist nur eine Frage der Anpassung und Organisation«, sagt sie, »in den großen Dingen muß man sich dem Leben anpassen, in den kleinen Dingen muß man sich das Leben so organisieren, daß es einem Spaß macht. Bei mir hat das immer geklappt. Die Jahre in Berlin waren schön und glücklich, die Jahre in Jerusalem noch schöner und glücklicher. Mein erster Mann war gut, mein zweiter besser, mein dritter am besten. In der Jugend hatte ich viele Freunde und Verehrer, jetzt habe ich viele Freundinnen und Enkel. Alles zu seiner Zeit, weißt du.«
Ja, ich weiß es, aber ich besitze leider nicht Ibis Talente. In den großen Dingen kann ich mich dem Leben nicht anpassen, und die kleinen Dinge so zu organisieren, daß sie mir Spaß machen, gelingt mir auch nie. Ich nehme an, das ist der Grund, warum es so selten bei mir klappt. Unlustig bohre ich den großen Zeh in das Fell meiner Katze. Sie öffnet ein Auge aus purem Gold und starrt mich vorwurfsvoll an. Ich glaube, sie hat mir nie verziehen, daß sie meinetwegen das zivilisierte Europa verlassen mußte.
»Mein kleiner Daunenbär«, sage ich entschuldigend, »meine Kirgisenfürstin, mein Katzenweibchen ...«, und sie schließt verächtlich das Auge. Ich bleibe, der bleiernen Schwere meines Körpers gehorchend, auf dem Sofa sitzen, doch innerlich laufe ich Amok. Wie man an solchen Tagen seine Gedanken in Schach hält, hatte mir Ibi nicht verraten. Vielleicht zählt sie sie zu den kleinen Dingen des Lebens, die man so organisieren muß, daß sie einem Spaß machen. Ich versuche also, meine Gedanken zu organisieren. Hoffnungslos! Sie irren, gemeinsam mit meinem Blick, durchs Zimmer und finden in nichts und allem einen Anlaß zur Verzweiflung. Da ist zum Beispiel die verstaubte Topfpflanze auf dem Fensterbrett, die mein spontanes Mitleid erregt, der Riß im Teppich, der heute, obgleich mir seit langem bekannt, das Ausmaß einer Katastrophe annimmt. Und schließlich sind da die vorsorglich bereitgestellten Koffer, der große weiße und die rote Reisetasche, die eine wahre Explosion unorganisierter Gedanken hervorrufen.
»Koffer«, denke ich, »Koffer, Koffer, Koffer! Ein Leben lang Koffer.« Ich kenne sie alle. Die Schrankkoffer und Hutschachteln, mit denen meine Mutter reiste, und die teuren, gefütterten Lederkoffer meines Vaters. Auch die schäbigen mausgrauen oder schokoladenbraunen aus Pappe kenne ich und später dann die kunstledernen.
Der erste Koffer, den mir meine Eltern schenkten, war schwarz und rechteckig, ein kleiner Kindersarg, auf den man in leuchtend gelber Farbe meine Initialen gemalt hatte. Ein schönes und sehr angebrachtes Stück, denn wir standen kurz vor der Emigration. Ich war sehr stolz auf ihn, konnte ja nicht ahnen, daß in ihm meine sorglose Kindheit zu Grabe getragen werden sollte.
Mit diesem Koffer begann es – Koffer und Kisten und Kartons und Taschen: auf den Schränken, unter den Betten, mit bunten Deckchen als Tische verkleidet. Koffer, die wir auspackten, Kisten, die wir einpackten, Kartons, die wir vergaßen, Taschen, die wir verloren. Immer war es so gewesen, vom Tag meiner Geburt an, ach nein, viel früher schon. Die Unruhe begann bereits im Leib meiner Mutter, die gezwungen war, mich, das illegitime Wunschkind, zu verbergen, sowohl vor den jüdischen Großeltern als vor den arischen Familienmitgliedern meines heiratsunschlüssigen Vaters. Als ich mich sichtbar zu machen begann, hetzten wir, meine unglückliche, enttäuschte Mutter und ich, von einem Ort zum anderen und konnten dem, der uns das angetan hatte, nicht verzeihen. Im letzten Monat wird es mir zuviel geworden sein, denn ich machte der unangenehmen Reiserei ein verfrühtes und abruptes Ende. Anstatt in Berlin wurde ich in Freiburg geboren, anstatt an irgendeinem normalen Tag am Weihnachtsabend, anstatt mit kahlem oder behaartem Kopf mit einem sogenannten Glückshäubchen.
»Ein Christkind mit Glückshäubchen«, sagte man entzückt, und mit dieser Belastung begann mein Leben.
Acht Tage später wurde ich, gut verpackt und immer noch unehelich, nach Berlin transportiert. Dort durfte ich zehn Jahre bleiben, das allerdings in sieben verschiedenen Häusern. 1939 machte ich, wie es meine Eltern nannten, eine »schöne, kleine Ferienreise« ans Schwarze Meer. Von dieser kleinen Ferienreise kehrte ich 1947 in ein mir fremd gewordenes Deutschland zurück, wurde nach München verpflanzt und wechselte innerhalb von zehn Jahren zehnmal die Wohnung. 1960 begann ich für weitere zehn Jahre den Pendelverkehr zwischen Deutschland und Israel. 1970 brach ich ihn endlich in Jerusalem ab. 1972 wurde ich ein Jahr lang nach Paris verbannt. Im Frühjahr 1973 flog ich mit dem Vorsatz zurück, Jerusalem nicht mehr zu verlassen. Ein halbes Jahr ist seither vergangen. Koffer und Reisetasche stehen vorsorglich bereit.
Ein Leben lang Koffer, Umzug, Reisen, Emigration, Exil, fremde Länder oder solche, die einem fremd geworden waren, fremde Sprachen, fremde Menschen, Bahnhöfe, Flugplätze, Hotelzimmer, möblierte Wohnungen, Zimmer, die einem Freunde zur Verfügung stellten. Das einzige, was mich seit Jahren in jedes Land, jede Wohnung begleitet, ist Bonni die Katze, eine elektrische Schreibmaschine, eine Menora aus Bronze, ein Koffer mit Briefen, Manuskripten und Lieblingsbüchern und die Fotografien meiner Familie. Diese Kostbarkeiten sind mein Zuhause. Wenn Bonni ihren Reisekorb verläßt und mit steil erhobenem Schwanz die Zimmer inspiziert, wenn ich die Gegenstände ausgepackt und aufgestellt habe, fühle ich, wie sich die unpersönlichste Wohnung meinem Leben anpaßt und sich um mich schließt.
»So kann es auf die Dauer nicht weitergehen«, sagen meine Freunde, »du brauchst endlich einen festen Rahmen.«
Ja, wahrscheinlich brauche ich den. Eine eigene Wohnung in Jerusalem, in einer der stillen, kleinen Straßen Rechavias; hohe große Räume, die ich Stück für Stück einrichte; ein breites Bett und bunte Teppiche auf hellen Fliesen; Regale, die ich mit Büchern, Wandschränke, die ich mit Kleidern fülle; ein Arbeitszimmer für Serge, einen kleinen Garten für Bonni; eine Abstellkammer für meine Koffer und Kisten, Kartons und Taschen. Dann hätte alles seinen festen Platz: die elektrische Schreibmaschine, die Menora aus Bronze, die Familienfotos und ich.
Ein schöner Traum. Ich träume ihn seit Jahren. Manchmal, wenn er besonders plastisch wird, lese ich Annoncen, gehe zu Agenturen, besichtige Wohnungen. Gefällt mir eine, was selten geschieht, weicht der Traum einer konkreten Vorstellung. Ich sehe den festen Rahmen, das Dach über dem Kopf, die eigenen vier Wände. Ich sehe mich in der Wohnung leben, und die Angst davor wird stärker als die Sehnsucht danach. Es ist die Angst vor dem Festen, dem Endgültigen, vor der Enge, der Stagnation, und der Wirklichkeit; die Angst vor der furchtbaren Entdeckung, daß ich zu nichts und niemand mehr gehöre, nicht zu diesem Land, an dem ich so hänge, nicht zu diesem Volk, mit dem ich mich identifiziere, nicht zu Serge, den ich liebe; die Angst vor der Gewißheit, daß es kein Zurück mehr für mich gibt, daß ich schon zu weit abgetrieben bin in den Hochmut selbstgewählter Einsamkeit.
Die Kinder unten im Treppenhaus haben angefangen, Fußball zu spielen. Das tun sie täglich zwischen vier und sechs. Sie schmettern den Ball gegen das Treppengeländer, so daß es bis in den letzten Stock hinauf zittert und klirrt. Jeden Aufprall begleiten sie mit gellendem Geschrei, das danach wieder in normales israelisches Kindergeschrei übergeht. Im Abstand von wenigen Minuten fliegt eine der acht Wohnungstüren donnernd ins Schloß. Die Türen sind das Betätigungsfeld der kleineren Kinder, die noch nicht Fußball spielen können. Eins dieser kleinen Kinder beginnt plötzlich zu kreischen. Vielleicht hat es sich beim Türenschmeißen ausgesperrt, vielleicht langweilt es sich auch nur. Auf jeden Fall kreischt es, schrill und zornig wie eine Kreissäge. Der Erfolg bleibt nicht aus. Türen werden aufgerissen, Füße in Sandalen schlappen die Treppe von unten hinauf, von oben hinab, Stimmen verschiedener besorgter Mütter werden laut. Es sind Stimmen, die die Fähigkeit haben, Kinder, Fernsehapparat und Radio zu überschreien, und die Unfähigkeit, sich auf eine normale Lautstärke einzustellen.
Ich habe mich an den Krach gewöhnt, wenn auch nicht damit befreundet. Früher gab es Tage, an denen ich meine eigene Tür zehnmal hintereinander ins Schloß knallte, um meine Mitbewohner darauf aufmerksam zu machen, wie unangenehm so etwas sein kann. Doch meine Erziehungsversuche mißlangen. Außer mir selber, die ich bei jedem Knall schmerzhaft zusammenfuhr, hat keiner je Notiz davon genommen.
Das Haus wird etwa je zur Hälfte von orientalischen und europäischen Juden bewohnt. Die orientalischen Juden haben eine sehr gesunde Einstellung zum Lärm – sie hören ihn gar nicht. Die europäischen Juden, wage ich zu behaupten, hören ihn zwar noch, nehmen ihn aber mit der Verklärung und dem Stolz von Menschen hin, die endlich ihr eigenes Land und dementsprechend komplexlose Kinder haben.
»In unserem Land«, sagen sie und blicken bewundernd auf die zukünftigen kleinen Makkabäer hinab, »wachsen sie in Freiheit auf, ohne Scham und ohne Angst.«
Ich weiß, wovon sie sprechen, diese Eltern und Großeltern, deren Vergangenheit ein einziges scham- und angsterfülltes Schweigen war, denn ich gehöre zu ihnen.
»Wenn wir überleben wollen«, hatte meine Mutter damals in einem Anfall verzweifelter Schonungslosigkeit zu mir gesagt, »müssen wir schweigen. Niemand darf erfahren, aus welchem Grund wir Deutschland verlassen haben, niemand darf wissen, daß ich Jüdin bin. Versprich mir, Christina, daß du schweigst.«
Und ich, verängstigt und bestürzt, hatte versprochen und geschwiegen.
Israels Jugend kennt nicht die Angst und Scham der alten Generation; doch für die Freiheit, in der sie als Kinder aufwachsen, müssen sie auch hier, in ihrem eigenen Land, einen hohen Preis zahlen. Sie opfern dafür Jahre ihres Lebens und manchmal das Leben selbst. Sie ist nüchtern, diese Jugend Israels, hart und selbstbewußt. Sie ist die massive, seit Jahrhunderten aufgestaute Reaktion auf das scham- und angsterfüllte Schweigen ihrer Vorfahren.
»Wir lassen uns nicht mehr abschlachten«, sagen sie, und in ihren Worten schwingt eine leise Verachtung für die mit, die sich haben abschlachten lassen. »Wir kämpfen um unser Leben. Wir sind nicht mehr wehrlos, wir haben eine Armee.«
»Was für eine komische kleine Armee«, hatte ich gedacht, als ich sie vor etwa elf Jahren zu Ehren des Unabhängigkeitstages an mir vorbeiziehen sah, »was für eine niedliche Parade!«
Ich hatte Deutsche marschieren sehen, Russen, Amerikaner, aber das, was ich hier sah, war neu für mich. Es waren Jungen und Mädchen, alle in denselben, einfachen Kakiuniformen, die Ärmel über den gebräunten Armen hochgekrempelt, die Kragen offen. Sie sangen, klatschten in die Hände, schlugen auf die Trommel und hatten ganz offensichtlich Spaß daran. Musikkapellen spielten Melodien, die entfernt an Märsche erinnerten, Soldaten trugen Fahnen, manche auch Maschinenpistolen zum Zeichen, so schien mir, daß sie nicht zu einem Picknick zogen.
Das Volk jubelte, winkte, rief den Namen einer vorbeimarschierenden Freundin, eines Sohnes oder Bruders. Sie waren zu Tausenden gekommen: Mütter mit Säuglingen im Arm, alte Herren mit Gelehrtengesichtern, Schwärme junger Mädchen mit langem schwarzem Haar und kurzem buntem Rock, orthodoxe Chassidim in Kaftan und steifem Hut, sephardische Familien mit einem Dutzend Kindern und Eßkörben, die sich am Straßenrand niederließen und harte Eier und Früchte verzehrten.
»Bravo«, schrie ein Mann, der in der Krone eines Baumes saß und mit jeder Kolonne in wildere Begeisterung geriet, »bravo, ihr Kinder Israels! Seid mir gesund und stark!«
Als die Artillerie heranrollte, wurde die Stimmung ernster. Die schwerbewaffneten Soldaten in ihren Jeeps blickten zu entschlossen geradeaus, und die Militärfahrzeuge großen und kleineren Kalibers machten einen bedrohlichen Eindruck.
»Ist es zu glauben, Siegfried«, sagte eine wohlbeleibte Dame auf deutsch zu ihrem Mann, »1948 hatten wir nur eine Kanone.«
Und Siegfried, in dunklem Anzug und zu eng geknüpfter Krawatte, tupfte sich den Schweiß von der Stirn und meinte versonnen: »Zweitausend Jahre haben wir darauf gewartet, zweitausend Jahre ...«
Dann, mit dem Nahen der Panzer, verstummte das Volk. Die Straße begann zu beben, füllte sich mit rasselndem Dröhnen und dichten Staubwolken. Die Menschen, von denen viele noch nie einen Panzer gesehen hatten, wichen zurück. Zwei, vielleicht drei Kolonnen rollten vorbei, und das Volk starrte ihnen beklommen nach.
Die Bangigkeit legte sich erst wieder, als die häßlichen Ungetüme in der Ferne verschwunden waren und die schönen Vögel der Luftwaffe in wirkungsvollen Formationen die Stadt überflogen. Das nun war zweifellos der Höhepunkt der Parade, und das Publikum wußte ihn mit vielen enthusiastischen Ausrufen zu würdigen: »Herrlich«, hörte man, »seht sie euch an, unsere Jungens ... ach, wie schön sie fliegen ... und so viele Flugzeuge haben wir, so viele ...!«
Sachlich gesehen waren es nicht viele, aber welcher Israeli wäre damals auf den Gedanken gekommen, eine jüdische Armee sachlich zu sehen.
»Baruch ha shem!« schrie der Mann in der Baumkrone, und seine Worte waren die Worte eines ganzen Volkes: »Gesegnet sei Sein Name! Unser Israel hat eine Armee!«
So war es damals. Naive Freude, Bewunderung, Staunen, Ehrfurcht, Dankbarkeit. Man hatte zweitausend Jahre Diaspora überlebt. Man hatte ein Land, und das Land hatte eine Armee. In sie setzte man seine ganze Hoffnung, sein Vertrauen, seinen Glauben. Sie war es, die ein menschenwürdiges Dasein garantierte. Sie war es, die vor neuen Angriffen, vor Verfolgung, Pogrom und Massenmord beschützte. Mit ihr stand oder fiel das Land. So einfach war das und so logisch – damals, als man noch sagte: »Gesegnet sei Sein Name, unser Israel hat eine Armee.«
Und mit dieser Armee nichts anderes verband, als den Wunsch zu leben.
Gegen halb fünf kommt Schoschi, um die Wohnung zu putzen.
»Hast du schon gehört?« ruft sie, noch bevor sie die Tür hinter sich geschlossen hat.
»Was?« frage ich, und ihre Aufregung läßt mich Böses ahnen.
»Wir haben dreizehn MiGs abgeschossen. Alle auf einmal. Tack, tack, tack, weg waren sie!«
Sie schaut mich erwartungsvoll an, und das verpflichtet mich, ein Zeichen der Überraschung von mir zu geben: »Kol hakavod – alle Achtung«, sage ich, denn dieser Ausdruck ist mir erstens sehr geläufig und zweitens scheint er mir der Nachricht angemessen. Aber Schoschi hat sich offenbar mehr versprochen. Sie bleibt vor mir stehen, eine sehr kleine, runde, orientalische Schönheit, in kurzem rotem Rock und zitronengelber Bluse.
»Dreizehn«, wiederholt sie und beginnt ihr schwarzes, glänzendes Haar zu einem dicken Strick zusammenzudrehen, »das ist doch nicht normal!«
»Lo normali« ist ein Schlagwort der jungen Generation geworden. Es ist in jedem Zusammenhang anwendbar und immer zutreffend. Ein besonders schönes Kleid kann »nicht normal« sein und ein schreckliches Verkehrsunglück auch. In diesem Fall sind die abgeschossenen MiGs gemeint.
»Du hast recht«, sage ich, »das ist nicht normal. Und wo sind sie ... tack, tack, tack?«
Mein hebräischer Wortschatz ist sehr begrenzt, und das Wort »schießen« ist mir, unerklärlicherweise, immer noch unbekannt. Zum Glück hat mir Schoschi das Ersatzwort geliefert.
»Über dem Meer«, erklärt sie, »man sagt, gar nicht so furchtbar weit von Haifa entfernt.«
»Und warum?« frage ich.
Ihre Augen, die mich immer an schwarzviolette Pflaumen erinnern, werden noch größer und runder.
»Warum was?«
»Warum hat man sie ...« Ich hebe die Hand und lasse sie wie ein abgeschossenes Flugzeug auf das Sofa zurückfallen.
»Du weißt doch, wie das ist«, belehrt mich Schoschi, »hier kommen die syrischen MiGs« – sie winkt die MiGs von der linken Seite herbei – »und da kommen die israelischen Phantomim« – jetzt werden von rechts die Phantome herangeholt –, »dann treffen sie sich in der Mitte und ...«
Sie hebt in einer resignierenden Gebärde Schultern, Arme und Augenbrauen: »So ist das eben. Sie können uns nicht friedlich leben lassen in unserem eigenen Land.«
Aus der zwanzigjährigen Schoschi spricht die Stimme des Volkes und nicht nur die des einfachen. Von einigen rühmlichen Ausnahmen abgesehen sagen sie, in mehr oder minder gewählten Worten, alle dasselbe. Einen Moment lang ist mir danach, Schoschi zu fragen, ob sie die besetzten Gebiete auch zum eigenen Land zählt, aber in Anbetracht der Hitze und Sprachschwierigkeiten gebe ich die Idee schnell wieder auf. Ich halte mich sowieso schon seit Jahren aus jeder politischen Diskussion heraus, ob mit Mädchen wie Schoschi oder mit einigen meiner besten Freunde. Warum jetzt plötzlich, unter den denkbar schlechtesten Umständen, damit beginnen?
»Mach heute bitte das Wohnzimmer gründlich sauber«, sage ich zu der Kleinen, »auch die Teppiche und Fenster.«
Enttäuscht über die Teilnahmslosigkeit, mit der ich das große Ereignis hinnehme, stapft sie ins Badezimmer, um sich für die Arbeit umzuziehen.
Jetzt bleibt mir endlich keine Wahl mehr. Wenn Schoschi mit sehr viel Lärm und Wasser die Wohnung putzt, kann ich nicht zu Hause bleiben. Ich blinzele zur offenen Verandatür hinaus. Die Sonne ist nicht mehr so grell und sieht aus wie ein Spiegelei mit halbgarem Dotter. In etwa eineinhalb Stunden geht sie unter, aber kühler wird es dadurch nicht werden.
»Kein Wunder«, denke ich, »daß Menschen, die während des Kamsins ein Verbrechen begehen, mildernde Umstände bekommen.«
Schoschi, barfuß und in Shorts, kommt auf stämmigen, kurzen Beinen ins Zimmer zurück und beginnt energisch die Teppiche zusammenzurollen.
»Du fährst weg«, stellt sie mit einem Blick auf meine Koffer fest, »wohin? Ins Ausland?«
»Ja«, sage ich.
»Zu deinem Sohn nach Deutschland oder zu deinem Freund nach Paris?«
»Zu beiden«, sage ich.
»Ich«, erklärt sie, »werde meinen Freund jetzt bald heiraten. Noch in diesem Jahr! Ob seine Eltern verrücktspielen oder nicht.«
»Wieso verrücktspielen? Sind seine Eltern dagegen?«
»Euwaweu1 und wie! Sie glauben, nur weil ich aus Marokko komme und sie aus Polen, daß sie was Besseres sind ...« Sie überlegt einen Moment und fragt dann mit einer Mischung aus Besorgnis und Empörung: »Glaubst du, daß sie was Besseres sind?«
Ich schüttele den Kopf, was ich nicht hätte tun sollen, denn jetzt dreht sich das Zimmer. Schnell hefte ich den Blick auf Schoschis Beine, das einzig Stabile, scheint mir, in dieser Welt, und sage: »Ich glaube, Motek2, sie sind einfach dämlich, das ist alles.«
»Richtig«, sagt Schoschi ernst, »das sind sie und böse noch dazu. Du siehst mich ja, Christina, du siehst ja, wie ich arbeite und sauber bin und anständig. Und so sind wir alle, meine Eltern und meine sieben Brüder und Schwestern. Aber so ist das eben. Sie wollen nicht, daß ihr Sohn eine Sephardin heiratet. Ich habe dir doch schon erzählt, daß mein Freund ein Aschkenasi ist, nicht wahr?«
Ich nicke. Sie hat es mir schon oft erzählt, denn die Tatsache, daß ein europäischer Jude bereit ist, sie, eine orientalische Jüdin, zu heiraten, erschüttert sie immer wieder aufs neue.
»Er ist groß und schlank«, hatte sie mir das erstemal berichtet, »und so hell wie du.«
Ich bin alles andere als hell, aber das ist Schoschi nicht klarzumachen. Ihre Ehrfurcht vor allem, was aus Europa kommt, äußert sich unter anderem in ausgesprochener Farbenblindheit. Ich bin blond, obgleich ich dunkelbraun bin, und sie ist schwarz wie ein Neger, obgleich ihre Haut die wunderschöne Farbe heller Bronze hat.
»Siehst du denn nicht«, hatte ich sie gefragt, »daß ihr sephardischen Juden viel schöner seid als die aschkenasischen?«
»Das sagt mein Freund auch, aber ...«
»Aber?«
»Aber wir sind eben arm und haben zu viele Kinder und zu wenig gelernt. Darum sind wir unten und die Aschkenasim oben. Nur in der Armee ist das anders. Als mein Bruder Soldat war, hatte er einen Haufen aschkenasischer Freunde. Aber dann, als er nicht mehr Soldat war, hatte er keinen einzigen mehr. Ich finde das nicht richtig.«
»Ist es auch nicht, Schoschi, aber es wird sich ändern.«
»Ja, ja«, hatte sie mit einer verächtlichen Grimasse gesagt, »das erzählt man uns schon lange.«
Sie hat jetzt die Stühle auf den Tisch gestellt und erscheint mit zwei Eimern Wasser.
»Wie lange bleibst du im Ausland?« fragt sie mich.
»Etwa einen Monat.«
»So lange! Also ich könnte das nicht. Ich möchte nicht weg von hier, nicht einen Tag. Erez Israel ist mein Land, was soll ich in einem anderen?«
Sie nimmt einen der Eimer und schüttet das Wasser mit entschlossenem Schwung auf den Boden. Die Katze und ich springen gleichzeitig auf. »Wasser ist gut bei der Hitze«, sagt Schoschi ungerührt und dann, einer Assoziation folgend: »Einer von den syrischen Piloten, der mit seiner MiG ins Meer gefallen ist, war noch nicht tot, und da haben wir ihn wieder rausgefischt.«
Sie bückt sich nach dem Scheuerlappen, richtet sich aber plötzlich wieder auf und schüttelt nachdenklich den Kopf.
»Was ist, Schoschi?« frage ich.
»Das ist doch eine schreckliche Meschugas3!« sagt sie in einer Art Erleuchtung. »Erst schießt man sie ab, dann rettet man sie, und danach fängt alles wieder von vorne an. Kannst du mir sagen, Christina, wozu das gut sein soll?«
»Nein«, sage ich und lege meine Hand auf ihre Schulter, »das kann ich wirklich nicht.«
Als ich das Haus verlasse, ist das Geschrei der Fußballspieler verstummt und die ersten Takte der »schönen blauen Donau« schallen mir entgegen. Der Eismann ist wieder da. Er kommt jetzt täglich, parkt seinen alten Volkswagenbus vor meinem Haus und läßt das Tonband laufen. Es sind immer wieder dieselben dünn geklimperten Takte der »schönen blauen Donau«, die in dieser baum- und schattenlosen Straße geradezu absurd klingen. Der Mann muß wohl noch aus der österreich-ungarischen Monarchie stammen und eine Vorliebe für Wiener Walzer haben. Mich macht die Melodie immer traurig. Sie klingt nach den Leierkästen meiner Berliner Kindheit, und ich hatte nie einen Leierkasten hören können, ohne in Tränen auszubrechen. Nicht so die israelischen Kinder. Auf sie wirkt die Musik wie die Flöte des Rattenfängers von Hameln. Sie kommen in Scharen herbei und stehen, den Tönen lauschend und an ihren Eisstangen lutschend, um den vielversprechenden Wagen herum.
Mein Auto steht in der Sonne, und seine Innentemperatur ist gerade richtig, um Brot darin zu backen.
»Was ist«, frage ich mich drohend, »möchtest du lieber frieren?« Aber da ich mir im Moment alles vorstellen kann, alles, nur nicht frieren, bleibt meine Frage unbeantwortet.
Ich fahre schnell, damit die Zugluft den Wagen kühlt, nähere mich einem Taxi, das sich hartnäckig in der Mitte des Fahrdammes hält, hupe. Der Fahrer streckt einen braunen, schwarz behaarten Arm zum Fenster hinaus und legt in einer nachdrücklichen Gebärde die Spitzen von Daumen, Zeige- und Mittelfinger zusammen. Zum Glück biegt das Taxi, nicht ohne mir ein letztes warnendes Zeichen gegeben zu haben, an der Ampel links ab, und ich fahre geradeaus weiter, die Gazastraße hinauf.
Die Gazastraße war schon vor drei Jahrzehnten die Hauptverkehrsader des Viertels Rechavia, und sie ist es, obgleich für diesen Zweck jetzt viel zu schmal, bis zum heutigen Tage geblieben. Es ist keine repräsentative, dem adretten Rechavia angemessene Straße. Die niedrigen, vierschrötigen Häuser stehen in verkümmerten kleinen Gärten, deren vorherrschende Farbe ein verstaubtes Grün ist. Die engen, dunklen Kramläden bieten ein heilloses Durcheinander an Waren, die besser schmecken, als sie aussehen. Und so wie mit den Waren ist es mit den Ladenbesitzern: In ihrer wenig gepflegten Verpackung steckt ein liebenswerter Kern. Es sind vor allem Juden osteuropäischer Länder, ältere, jiddisch sprechende Leute, die den Hut nicht vom Kopf nehmen und selten das Hemd wechseln. Aber ich mag diese Menschen, in deren resignierten Blicken und schlaff herabhängenden Schultern sich immer noch das Stigma der Diaspora offenbart. Sie sind mir unbekannt und doch nicht fremd. So wie sie stelle ich mir meinen Urgroßvater vor, einen armen, frommen Bäcker, der aus einem polnischen Städtchen kam und sein Leben damit verbrachte, die Thora zu lesen, den Talmud zu studieren und Brot zu backen. Er hinterließ zehn Kinder und eine schmale Chronik, die mit den rührenden Worten beginnt: »Es ist Pflicht und Schuldigkeit eines jeden Menschen, über sein Leben, Thun und Wandel einige Notizen zu vermerken; denn jeder einzelne Mensch, der tadellos seinen von Gott vorgeschriebenen Weg wandelt, hat das Recht, die Worte unserer Weisen auf sich zu beziehen: ›Für mich wahrscheinlich ist die Welt erschaffen.‹«
Ich bin stolz auf meinen Urgroßvater, diesen schlichten, unverfälschten Mann, der nie etwas anderes hatte sein wollen als ein guter Jude. Aber mit dieser Einstellung stehe ich hier ziemlich allein, denn genau dieser Ghettotyp ist es, der in der gebildeten Schicht von jeher Schamgefühle hervorgerufen hat: ob in ihren früheren Heimatländern, in denen sie, die Assimilierten, nicht mit Juden »dieser Art« identifiziert werden wollten, oder in Israel, wo man vergessen möchte, daß sich der Großteil des jüdischen Volkes gerade aus jenen Menschen entwickelt hat. »Was«, fragen sie mich, »hat unsere starke, selbstsichere Jugend noch mit diesen Fossilien einer fernen Vergangenheit zu tun?« Sie wollen nicht wahrhaben, daß die aktive Stärke dieser Jugend aus der passiven Kraft ihrer Vorväter geboren wurde. Und ich fürchte, in dieser Verleugnung von allem, was gewesen, und der Glorifizierung von allem, was geworden ist, liegt eine Gefahr.
Ecke Gazastraße und Redak Redak parke ich das Auto und steige aus. Hier, in dieser Umgebung bin ich zu Hause, kenne jede Straße, jedes Haus, jeden Laden. Im nahen Umkreis wohnen alle meine deutsch-jüdischen Freunde, mein Arzt und Zahnarzt, mein Friseur, mein Schuster, mein Installateur. Hier ist meine kleine Wäscherei, in der mich der Inhaber mit »Schalom u wracha« – Frieden und Segen – begrüßt; mein Schneider, Herr Ben Lulu, der mir die Röcke kürzer und die Hosen länger macht; mein Schlächter Chaim, bei dem ich ein Kilo Leber für meine Katze und ein halbes Pfund Hackfleisch für mich kaufe; mein winziger bulgarischer Blumenladen, in dem ich mich mit den Besitzern in ihrer Muttersprache unterhalte und Erinnerungen über Sofia austausche. Hier in diesem Viertel Rechavia habe ich ein Stück Heimat gefunden
Ich habe mich oft gefragt, was aus mir geworden wäre, wären Michaels Briefe nicht in meine Hände gelangt oder hätte ich sie weitere Jahre in dem fest verschnürten Karton auf dem Schrank gelassen aus Angst, die Wunden der Vergangenheit wieder aufzureißen. Ich habe Michael, meinen Bruder (Halbbruder, müßte ich sagen, aber das Wort widersteht mir im Zusammenhang mit ihm), kaum gekannt. Er war zehn Jahre älter als ich, hatte wegen meines Vaters, den er ablehnte, nur ein Jahr mit uns unter demselben Dach gelebt und 1938 Deutschland verlassen. Ich habe ihn nie wiedergesehen, denn er fiel zwei Wochen vor Kriegsende, wenige Kilometer vor der deutschen Grenze, als Soldat der Französischen Freien Armee. Geblieben war die Erinnerung, eine Erinnerung, die, obgleich sie sich auf einen kurzen Zeitabschnitt beschränkte, auf kleine Begebenheiten und optische Eindrücke, nie an Intensität verloren hat. Ich muß ihn wohl sehr geliebt haben, diesen großen, geheimnisvollen Bruder, der eine Siamkatze hatte und schöne, exotische Freundinnen, der sich unter lauter Jazzmusik zum Abitur vorbereitete, Tango tanzte wie kein anderer, Auto fuhr wie ein Rennfahrer und hingegeben in der Sonne lag, die Augen geschlossen, einen Grashalm zwischen den Lippen. Er war so schön gewesen, zärtlich, heiter, wild; vielleicht war es das, was ihn mir unvergeßlich gemacht hat. Wenn er mit mir im Huckepack durch den Garten galoppiert war, wenn er mich auf sein Bett gezogen und geküßt oder hochgehoben, an seine Brust gedrückt und mit mir getanzt hatte, dann war das Glück voll gewesen. Lucrezia Borgia hatte er mich genannt und auf meine Frage, was das denn sei, gelacht und erklärt, das sei eben ich.
»Lucrezia Borgia«, hatte er gesagt, »wärest du nicht meine Schwester, ich würde mich in dich verlieben.«
So etwas vergißt man nicht.
Und dann war er tot. Jedenfalls hieß es so in der Mitteilung seines Kommandanten, stand es in einem Brief von Ibi, las ich es in den Augen meiner Mutter. Trotzdem war es für mich kein richtiger Tod, es war vielmehr eine Fortsetzung seiner Abwesenheit. Die, die durch Zeit und Raum von uns getrennt sterben, sterben einen unkörperlichen Tod, der schwer erfaßbar ist. Wir lieben sie so, wie wir sie in Erinnerung behalten haben, nicht so, wie sie geworden sind; und wenn sie sterben, stirbt ein Mensch, den wir nicht mehr kennen. Wir trauern im Leeren, und die Endgültigkeit entzieht sich uns. So war es mit Michael gewesen. Er starb, als ich seine Briefe las, achtzehn Jahre nach seinem Tod. Denn da erst lernte ich den Mann, der er geworden war, das Leben, das er gelebt hatte, kennen. Mit meiner Erinnerung ließ es sich nicht mehr vereinbaren. Er, der das leichte, verspielte Leben so liebte und jeder Verlockung nachgab, hatte auf alles Leichte, Verspielte, Verlockende verzichtet, um mit einer Kompromißlosigkeit ohnegleichen für eine Überzeugung zu leiden, zu kämpfen und zu sterben.
»Ich wäre der größte Gesinnungslump«, schrieb er an die angebetete Mutter, »würde ich den Vorteil eines arischen Vaters für mich ausnutzen. In Zeiten wie diesen gibt es keine Halbjuden. Es gibt Arier und es gibt Juden und zu denen gehöre ich.«
Die Worte hatten sich in mir festgesetzt, hatten mich wachgerüttelt, mir ein Leben gezeigt, das bewußt gelebt worden war, ob in der Not der Emigration und dem Grauen des Krieges, ob in den Tagen der Angst und Verzweiflung oder in den Stunden des Glücks und der Hoffnung, in der unerschütterlichen Liebe zu der jüdischen Mutter.
Ja, ich frage mich, was aus mir geworden wäre, wären diese Briefe nicht in meine Hände gelangt, hätten sie nicht diese wilde Sehnsucht in mir geweckt, da zu gehen, wo er gegangen ist, das zu sehen, was er gesehen hat, die zu lieben, die er geliebt hat. Hätte ich den Weg nach Israel auch allein gefunden? Vielleicht später, irgendwann einmal, ich weiß es nicht. Tatsache ist, daß ich zu jener Zeit nichts über Israel gewußt habe. Verdrängung, Interesselosigkeit, auch das kann ich nicht sagen. Ibis Adresse kopierte ich so, wie sie Michael Anfang der vierziger Jahre auf seine Umschläge geschrieben hatte. Daß Ibi inzwischen Mann und Wohnung gewechselt, hatte ich nicht ahnen können, daß aber aus Palästina Israel geworden war, hätte ich wissen müssen. Ich habe es offenbar nicht gewußt. Wie auch immer, der Brief, den ich umgehend an Ibi schrieb, kam an, denn sie, der Liebling Jerusalems, war selbst den Postboten bekannt. Eine Woche später erhielt ich die Antwort: »Komm so schnell Du kannst, bleib so lange Du willst, ich erwarte Dich!«
Rechavia, in das ich Michael gefolgt bin, ist auch für ihn ein Stück Heimat gewesen, hier, bei Ibi, die damals noch mit ihrem ersten Mann und drei kleinen Söhnen in der Gazastraße wohnte, verbrachte er während des Wüstenfeldzuges seine Urlaube. Er hat Ibi geliebt, das geht aus seinen Briefen an sie hervor. Doch Ibi behauptet: »Er hat es sich nur eingebildet, weil ich eine Freundin seiner Mutter war und ein Überbleibsel aus der alten Berliner Zeit. Geliebt aber hat er im Grunde nur sie.«
Er hat sie geliebt, seine Mutter, die Frau, die ihn im entscheidenden Moment verkannt, ihn einen Don Quichote, einen verschrobenen Idealisten, einen Fanatiker genannt hat, die Frau, die alles hatte sein wollen, alles, nur keine Jüdin.
»Du wirst Deinem Judentum nicht entkommen«, hatte er ihr geschrieben, »was immer Du auch tust.«
Sie war ihm nicht entkommen, obwohl sie keinen Versuch, keine Anstrengung gescheut hat.
»Ich ersticke in dieser jüdischen Enge«, hatte sie, achtzehnjährig, ihrem Tagebuch anvertraut, »ich kann das alles nicht mehr ertragen – diesen Geruch nach Hühnersuppe, diese Gespräche über Textilien, diesen wohlbeleibten, wohlhabenden Tölpel, mit dem man mich verheiraten will. Ich brauche mehr!«
Sie war klein, dicklich und geschmacklos angezogen. Sie hatte eine schmale Lücke zwischen den Vorderzähnen und kastanienrote Locken, die sich nicht zu einer Frisur zähmen ließen. Und dennoch hat sie uns alle fasziniert: Männer, Frauen, die eigenen Kinder. Vielleicht waren es ihre Augen, viel zu schön, als daß sie sich beschreiben ließen, ihre entwaffnende Natürlichkeit und Vitalität, die Großzügigkeit, mit der sie sich denen, die sie liebte, gab?
Sie kannte keine Tabus, und das »mehr«, das sie brauchte, fand sie sehr schnell in einem christlichen Poeten, der das glatte Gegenteil von wohlbeleibt und wohlhabend war. Er öffnete ihr das Tor zur weiten Welt abendländischer Kunst und Kultur. Sie heiratete ihn heimlich ein halbes Jahr später und tat damit das Unverzeihlichste, was sich ein jüdisches Mädchen gutbürgerlicher Kreise zuschulden kommen lassen konnte. Ihre Eltern, herzgebrochen, aber unerbittlich, verboten ihr und ihrem »Goi« das Haus.
Das Verbot wurde mit Michaels Geburt prompt wieder aufgehoben. Welche jüdischen Großeltern könnten einem wie auch immer gearteten Enkel widerstehen! Der winzige, unschuldige Mischling riß die Großmutter zu Tränen der Freude und Reue hin, den Großvater aber zum Kauf eines Hauses, in dem die kleine Familie unter dem Motto: »Ende gut, alles gut« von nun an sorglos leben sollte. Aber da hatten sich die armen Großeltern getäuscht. Es war kein geruhsames Ende, sondern der Auftakt zu einem turbulenten Leben.
Vielleicht lag es an dem Poeten, der sich als Egozentriker und Schürzenjäger entpuppte, vielleicht an der Ehe, die sich als schlecht erwies, vielleicht an unserer Mutter, deren Reaktion darauf wieder ganz anders ausfiel, als man es von einer jüdischen Tochter gutbürgerlicher Kreise erwartet hätte. Für sie bedeutete Leben: lieben und Männer, Kinder.
»Man muß von jedem Mann, den man wirklich liebt, ein Kind haben«, erklärte sie in aller Offenheit, und diesem verhängnisvollen Grundsatz blieb sie treu.
Dem ersten »Goi« folgte ein zweiter, und wenn sie den auch nicht genug liebte, um ihn zu heiraten, so doch wenigstens genug, um ein Kind von ihm zu bekommen; dem zweiten folgte ein dritter, und hier stellten sich, wenn auch unter umgekehrten Vorzeichen dieselben Schwierigkeiten ein wie beim ersten. Denn mein Vater, ein Mann mit zahlreichen Vorzügen, dem einen Nachteil aber, dem der Schwäche, war ein folgsamer Sohn; und seine Familie, deren Stammbaum eine stattliche Reihe preußischer Junker aufwies, war das, was man antisemitisch nennt. »Eine Jüdin«, erklärten sie, »kommt uns nicht ins Haus«, und dieses Verbot schien weitaus mehr Gewicht zu haben als das von den jüdischen Eltern proklamierte: »Ein Goi kommt uns nicht ins Haus.«
Meine Mutter, die nach Urteil verschiedener Ärzte nicht mehr schwanger werden konnte, betete um ein Kind. Sie tat das, wie sie mir später einmal erzählte, auf einer Italienreise in schönen und zu diesem Zwecke geeigneten Kirchen. Das Wunder fand statt, nicht aber die Hochzeit. Ich muß ein unrepräsentatives Baby gewesen sein, denn es dauerte fast zwei Jahre, bis sie es wagte, mich in dem Haus derer vorzuführen, die sie zu erobern hoffte. Und wenn es auch diesmal keine Tränen der Freude und Reue gab, so gab es doch wenigstens preußisches Ehrgefühl und die Einwilligung in eine Heirat.
Wir haben es gut gemacht, Michael und ich, wir waren die Pfeiler einer Brücke, die sich in seinem Fall über die Intoleranz des Judentums, in meinem über die des Christentums hinwegspannte. Wir haben unserer Mutter den Weg geebnet. Daß die Brücke einige Jahre später zusammenkrachte und der Weg in den Abgrund führte, daß unsere Mutter endgültig ins Christentum flüchtete und sich ihr Sohn zum Judentum bekannte, nennt man wohl Ironie des Schicksals.
In einem letzten Brief, kurz vor ihrem Tod, ist sie dann mit dem Satz: »Ich bin eben doch eine richtige Jüdin« zu sich zurückgekehrt. Aber das hat ihr Sohn nicht mehr erfahren. Eine Granate hatte ihn zerrissen, den schönen Michael, den einzigen in unserer Familie, der nicht gekniffen, sondern sich mit Haut und Haar für die gerechte Sache eingesetzt hat.
Ich gehe fast täglich an jenem Haus vorbei, in dem er ein paar Wochen seines kurzen Lebens verbracht hat. Es ist ein unauffälliges, zweistöckiges Haus, in dem sich unten eine Apotheke befindet. Vor dreißig Jahren, als die Gärten noch grün und in den Straßen wahrscheinlich mehr Esel als Autos zu sehen waren, wird das Haus zu einer der stattlichen Villen Rechavias gezählt haben. Ibi bewohnte mit ihrer Familie die obere Etage.
»In dem Moment, in dem er unsere Wohnung betrat«, hatte sie mir erzählt, »war er wieder der verwöhnte Junge aus Berlin-Grunewald. Alles mußte so sein wie früher. Der Tisch hübsch gedeckt, mit weißer Decke und Silber und gutem Porzellan, das Badewasser heiß, die Bettwäsche gebügelt. Das Mädchen mußte ihm die Uniform ausbürsten und die Schuhe putzen und ich mein bestes Kleid anziehen; dann setzte er sein kleines, dunkelblaues Käppi auf, und wir gingen aus. Alle Leute haben sich auf der Straße nach ihm umgedreht. Er hatte etwas so Leuchtendes, etwas so Nobles ... es läßt sich einfach nicht beschreiben.«
Manchmal versuche ich mir auszumalen, wie es damals war. Der lebendige, leuchtende Michael in Uniform; Ibi, mit rabenschwarzem Haar und glattem, jungem Gesicht; das noch unschuldige Jerusalem, eingebettet in Stein und kahle Hügel.
»Ach, das war noch eine schöne Zeit«, schwärmt man heute, »wir waren jung, und es gab keine Unterschiede. Wir hatten nur ein paar Habseligkeiten gerettet und verdienten uns das bißchen, was man zum Leben brauchte, als Kellner, Busfahrer oder Bauarbeiter. Was brauchten wir schon! Ein Stück Brot, ein paar Früchte und Eier, einen Rock oder eine Hose, etwas Petroleum, um im Winter die Öfen zu heizen. Ach ja, wir waren glücklich und zufrieden. Wir lebten und wir waren in unserem Land. Was konnte man mehr verlangen!«
Jetzt ist man nicht mehr jung, überlege ich, während ich wie so oft ziellos durch die Straßen wandere, jetzt gibt es viele Unterschiede. Jetzt sind neue Möbel skandinavischen oder spanischen Stils dazugekommen, Waschmaschinen und Fernsehapparate, Autos und Zentralheizung, Parties und Auslandsreisen, Snobismus und Arroganz. Aus Kellnern und Busfahrern sind hohe Regierungsbeamte geworden, Anwälte, Universitätsprofessoren, Ärzte. Viele davon sind deutsche Juden, Jecken, wie sie hier spöttisch genannt werden, und fast alle von ihnen wohnen in Rechavia. Es ist ein schönes, und wie es sich für Jecken ziemt, gepflegtes Viertel, ein Miniatur-Grunewald Jerusalemer Prägung. Die Häuser, zwei bis vier Stockwerke hoch, haben einen villenartigen, wenn auch nicht europäischen Charakter. Die kleineren sind in strenger Würfelform gebaut und noch aus echtem, grobgehauenem Stein. Die größeren, später dazugekommenen, sehen schon nicht mehr so solide aus. Sie haben große Fenster, Balkone und Terrassen, und den Stein hat man sparsam in dünne Platten geschnitten. Doch der Stolz Rechavias sind nicht so sehr die Häuser wie die kleinen Gärten, in denen neben europäischen Blumen tropische Pflanzen wachsen, und die Vielfalt an Bäumen, Sträuchern und Hecken, die mit ihrem schattenspendenden dunklen Grün in jedem wahren deutschen Juden Erinnerungen an eine vergangene wald- und wiesenreiche Landschaft wecken.
Es ist gut, so zu gehen, leicht benommen von der Hitze, der Brillanz des Lichtes, den strahlenden Farben, dem schweren, süßen Duft einer Pflanze, der einen plötzlich überfällt. Zu dieser Stunde, ehe die Sonne untergeht, die Männer in ihren Autos von der Arbeit kommen und die Frauen das Fernsehen anschalten, ist es noch still in Rechavia. Ich teile die Straße mit spielenden Kindern, streunenden Katzen und ein paar alten Jecken, die wahrscheinlich zum Abendeinkauf oder zu einem nachbarlichen Kaffeebesuch gehen. Ich mag diese alten Menschen, die sich, da sie zu spät ins Land kamen, nie ganz akklimatisiert haben. Die Männer scheinen noch immer ihre Anzüge aus den dreißiger Jahren zu tragen und, als einzige Konzession an das hiesige Klima, einen offenen Hemdkragen. Die Frauen, die sich weder von der Hitze noch der schweren Arbeit der ersten mageren Jahre erholen können, haben unförmig angeschwollene Beine und müde, tiefgefurchte Gesichter. Doch ihre Augen sind gut und lebensklug, und ihr Lächeln ist von jener ungezwungenen Freundlichkeit, die einem sofort das Herz öffnet.
In zehn, spätestens fünfzehn Jahren wird es sie nicht mehr geben, diese alte, liebenswerte Generation, der Europa, seine Landschaft und Städte, seine Kultur und Tradition, sein Klima und Lebensrhythmus vertrauter sind als das Land, das sie jetzt Heimat nennen. Ihre Enkel, deren Sprache sie kaum verstehen, werden übernehmen. Der Geist Europas, eines Europas der Jahrhundertwende, wird mehr und mehr verschwinden und mit ihm die Vielfalt der Sprachen, Gebräuche und Erinnerungsstücke, in denen sie leben. Ein paar Dinge werden bleiben, ein schmackhaftes Gericht, das sie ihren Kindern, ein Lied, das sie ihren Enkeln beigebracht haben, ein schönes Service, ein alter Fächer, eine wertvolle Buchausgabe.
»Hübsch, nicht wahr?« wird man sagen. »Das haben meine Groß- oder Urgroßeltern damals mit ins Land gebracht.«
Und das »damals« wird bereits Geschichte sein.
Ich fahre Richtung Ost-Jerusalem. Immer wenn mich die Unruhe packt und sich die ersten Anzeichen einer Depression bemerkbar machen, fliehe ich – entweder nach Jericho oder in die Altstadt. Es ist die Flucht vor mir selber, die mich aus der Enge der alltäglichen Atmosphäre heraus in unbekannte und ablenkungsreiche Regionen treibt. Dabei kann ich nicht behaupten, daß mir die Altstadt unbekannt ist, denn ich kenne jedes Viertel – das mohammedanische, das christliche und das von den Arabern zerstörte, von den Israelis wieder aufgebaute jüdische –, kenne fast jede Gasse, jeden Laden, jede »Heilige Stätte«, kenne all das, aber nur von außen. Das Innenleben dieser Stadt und seiner Bewohner, das, was sich hinter dicken Mauern und in verborgenen Patios abspielt, hat sich mir nie enthüllt. So bleibt ein Geheimnis, ein Gefühl des Unergründlichen, das meine Phantasie anregt. Ich parke das Auto außerhalb der Altstadt, verscheuche einen kleinen Araberjungen, der mit seinem dreckigen Lappen meine saubere Windschutzscheibe zu putzen versucht, und gehe auf die Stadtmauer zu. Wie immer fällt mir ihre Schönheit auf, die jetzt, in dem Licht des beginnenden Abends, Stein für Stein zum Ausdruck kommt.
Was wäre Jerusalem ohne seine Altstadt?
Der Gedanke verursacht mir Unbehagen. Einen Moment lang sehe ich wieder die geteilte Stadt, die häßliche graue Mauer, den Stacheldraht, die von Geschossen durchlöcherten, verlassenen Häuser, den verwahrlosten Streifen des Niemandslandes. Ich bin oft, die Warnungen meiner Freunde mißachtend, an der Grenze entlanggegangen, bin auf das Dach des französischen Hospitals gestiegen und habe hinübergespäht in jenes so nahe und doch unerreichbare Land, das mir geheimnisvoll erschien wie die Städte in den Märchenbüchern meiner Kindheit. Ich sah einen Teil der Stadtmauer, die goldene Kuppel des Felsendoms, den Ölberg mit seinen dunklen Baumgruppen; sah Kirchtürme und Minarette, arabische Häuser und Straßen, die sich durch die Hügel schlängelten. Ich sah den winzigen Autos nach und dachte: »Wohin fahren sie, woher kommen sie? Was für Menschen sitzen darin? Worüber sprechen sie, was fühlen sie, wie leben sie?«
Es war eine mit Sehnsucht durchsetzte Faszination für das Unbekannte, die ich auch empfand, wenn ich mich in fremden Fotoalben durch ein Stück Leben blätterte und mir die Geschichte der Menschen, die ich nie gesehen hatte und nie sehen würde, vorzustellen versuchte. Auch Ost-Jerusalem würde ich immer nur von einem der Aussichtspunkte sehen, einer märchenhaften Kulisse gleich, die ich mit den Requisiten meiner Vorstellung ausstatten mußte. So glaubte ich, so glaubten wir alle. Die Altstadt war eine Art Legende geworden, selbst für die, die sie gut gekannt hatten.
Ich gehe durch das Jaffator, vorbei an einer Gruppe zerlumpter Lastträger, drei hochbeladenen Eseln und zwei jordanischen Polizisten mit dunkelhäutigen Gesichtern und keckem Schnurrbart. Kleine Jungen bieten mir, ohne rechte Überzeugung, Kreuze aus Olivenholz, Davidsterne aus Metall und orientalische Ketten aus Kunststoff an. Aber sie kennen mich schon, und ein Kopfschütteln genügt, sie zu vertreiben.
Der Platz, von dem es rechts ins armenische Viertel geht, links ins griechische und geradeaus in die bunten Gassen des Bazars, ist immer noch voller Menschen. Ich steuere auf mein kleines arabisches Café zu, wo man dem Davidsturm gegenüber auf einem schmalen Vorbau sitzen und etwas trinken kann. Ein paar Hocker sind besetzt – von Touristen, wie man sofort an ihrer Aufmachung erkennt. Einer, ein bärtiger Tarzantyp, läßt sich von meinem bevorzugten Schuhputzer spitze, orangefarbene Stiefel putzen.
»Schalom!« ruft mein Schuhputzer, schwenkt die Bürste und wirft dann einen bedauernden Blick auf meine nackten Zehen.
»Hallo«, antworte ich, denn der israelische Gruß will mir in dieser Umgebung nicht über die Lippen.
Ich setze mich in die hinterste Ecke, und als ich aufblicke, steht der Sohn des Cafébesitzers, ein junger, betont europäisch gekleideter Mann, vor mir.
»Hi«, sagt er mit jenem mühsamen Lächeln, das sich erst durch Schichten männlichen Ernstes und arabischer Würde hindurcharbeiten muß, »how are you?«
»So, so«, sage ich.
»Es ist heiß heute.«
»Das kann man wohl sagen.«
Jetzt, da ihm das Lächeln gelungen ist, kann er sich nicht mehr davon trennen. Er blickt in die Ferne, lächelt und fragt: »Möchten Sie etwas trinken?«
»Ja, bitte, einen Tee mit Pfefferminz.«
Der junge Mann entfernt sich. Er kennt mich schon seit Jahren, genau gesagt, seit Juli 1967. Er kennt mich mit meinem geschiedenen Mann Udo, er kennt mich mit Serge, er kennt mich alleine, Briefe schreibend und kettenrauchend; er kennt mich stumm und verdrossen, still vergnügt, euphorisch verliebt, hoffnungslos niedergeschlagen. Er kennt in einem kleinen, aber bezeichnenden Querschnitt eine entscheidende Phase meines Lebens. Die entscheidendste vielleicht, die, in der es mir endlich gelang, mich von all den Bindungen zu befreien, die ich aus Gründen der Bequemlichkeit, Angst und Unentschlossenheit über viele böse Jahre aufrechterhalten hatte, die, in der ich ein für allemal die Tür hinter mir zuschlug und dem Teufelskreis meiner Münchener Existenz entfloh.
Der junge Mann bringt mir ein Glas Tee, in dem ein paar Pfefferminzblätter schwimmen.
»Sie sind traurig«, bemerkt er, während er das Glas auf den Tisch stellt.
Ich überlege, ob er das in der Hoffnung auf ein Gespräch sagt oder weil er mein Gesicht schon zu gut kennt.
»Woher wollen Sie das wissen?«
»Das sehe ich«, sagt er und bietet mir eine Zigarette an. »Ihr Freund ist nicht in Jerusalem?«
»Nein«, sage ich, sowohl als Antwort auf seine Frage wie auf das Angebot seiner Zigarette.
»Wie schade ... so ein schöner Abend, zu schön, um allein zu sein ...«
Ich schaue ihn stumm an, und er versteht, nickt mir ernst zu und geht.
»Ja, schade«, denke ich, »schade um einen so schönen Abend, ein so verführerisches Licht, eine so große Liebe.«
Ich trinke einen Schluck Tee. Er ist süß und heiß und treibt mir die Tränen in die Augen. Vielleicht sind es aber auch die Gedanken, die einmal losgelassen, nicht mehr aufzuhalten sind: »Serge, mein Gott, Serge, ich weiß nicht, ob wir es noch schaffen werden. Du sagst, jetzt sind wir fast am Ziel. Ziel, was ist das? Schlußstrich? Ende? ›... Erreicht’ sein Ziel mit Müh und Not und war am nächsten Tage tot ...‹, so kommt mir das vor. Es war zuviel, weißt du, einfach zuviel. Ich habe keine Kraft mehr, nur noch Angst.«
Damals, als noch kein Ziel in Sicht war, hatte ich die Kraft. Hier, von diesem kleinen Café aus, hatte ich ihm in dem Gefühl, nichts und niemand mehr zu fürchten, geschrieben: »Du bist das einzige, was für mich zählt, Du bist meine Heimat, und das Bett in dem ich mit Dir schlafe, ist mein Zuhause. Mehr brauche ich nicht.« Das war kurz nach dem Bruch mit Deutschland gewesen. Wäre mir der Bruch auch ohne Serge gelungen, ohne diese Liebe, deren Schutzpatron der »große jüdische Gott« persönlich zu sein schien? Mag sein, daß es mir gelungen wäre, irgendwann, aber gewiß nicht so schnell, so kompromißlos, so überzeugt, den einzig wahren Weg zu gehen, egal wohin er führte. Jeder Schritt, mit dem ich mich von meinem früheren Leben entfernte, war ein richtiger Schritt, auch wenn er mich nicht weiter brachte als bis zum nächsten Augenblick. Denn selbst der nächste Augenblick schien mir kostbarer als die gesamten zwanzig Jahre, die ich hinter mir gelassen hatte. Nein, ich habe nie nach dem Ziel oder Ende des Weges gefragt, habe es gar nicht kennen wollen. Jede große Leidenschaft ist zu einem Ende verdammt, und jedes Ende ist grausam: ob es zu früh und damit unerwünscht kommt oder planmäßig als sogenanntes »happy end« oder im Anschluß an das »happy end« und damit zu spät.
Ich habe ein Leben lang in Leidenschaften oder, wenn es die nicht gab, in Apathie gelebt. Immer auf Abbruch, zwischen Tür und Angel, zwischen kommenden und gehenden Menschen, zwischen Ungewißheit und Ruhelosigkeit. Es gab keine Beständigkeit, keine Zukunft, keine Stabilisierung von Beziehungen und Gefühlen. Jeder Anfang trug bereits den Keim des Endes in sich. So hatte ich es unfreiwillig in meiner Kindheit gelernt, dabei habe ich es später freiwillig belassen. Mit Serge, als ich ihm damals begegnete, gab es zwangsläufig nur einen Anfang, denn das, was man den »gemeinsamen Weg« nennt, gingen wir bereits mit anderen Partnern. Was uns blieb, war eine kurze, atemlose Affäre, ohne Komplikationen, ohne seelisches Engagement, ohne dramatische Folgen. Wir glaubten Übung genug zu haben, sie kontrollieren zu können. Doch bereits am Ende der ersten Woche merkten wir, daß wir die Kontrolle verloren hatten und das Opfer einer hemmungslosen Leidenschaft geworden waren. »Entweder«, sagte ich mir, »ist es der Fingerzeig Gottes oder ein Strohfeuer. Man muß Ruhe bewahren und abwarten.« Am Ende der dritten Woche, zwei Tage bevor er zu seiner Frau nach Paris und ich zu meinem Mann nach München flog, fuhren wir durch die judäische Wüste zu dem verlassenen mohammedanischen Kloster Nebi Musa. Nie werde ich die Schönheit dieses Tages vergessen, die Nähe des Himmels, die wogenden Formen der kahlen Berge, das Singen des Windes im Innenhof des Klosters. Hier war Ewigkeit, Sinn, Anfang und Ende. Und ich hatte gedacht: »Vielleicht war unsere Begegnung wirklich ein Fingerzeig Gottes, denn alles ist in ihr enthalten. Aber haben wir auch die Größe, alles aus ihr zu machen? Oder wird es die übliche Geschichte mit einem schmerzhaften oder banalen Ende? Nein, lieber daran zugrunde gehen, aber nicht das!«
»Das beste wäre«, hatte ich damals zu Serge gesagt, »wir würden gemeinsam in der judäischen Wüste Selbstmord begehen. Ich halte das für das einzige uns angemessene Ende.«
»Sag mir wann«, hatte er erwidert, »und ich bin bereit.«
»Ich meine es.«
»Ich auch, mon amour.«
Wir hatten oft darüber gesprochen, und ich bin nie dahintergekommen, weder bei ihm noch bei mir, bis zu welchem Grad wir es wirklich ernst gemeint haben. Auf jeden Fall hatten wir alles genau geplant: den Ort, die Stunde, sogar die Anzahl der Tabletten. Nur das mit den großen, schwarzen Vögeln hatten wir noch nicht geklärt. Serge meinte, eine Decke würde nicht genügen, sie von unseren Leichen abzuhalten, und mein Einwand, es wäre doch ganz egal, von wem wir gefressen würden, überzeugte ihn nicht. Er hatte vor allem Angst um seine Augen.
Wir sind in diesem Punkt nie zu einer Übereinstimmung gekommen, denn mit zunehmender Hoffnung trat der Selbstmord in der judäischen Wüste immer mehr in den Hintergrund. Wir waren prosaisch geworden und wollten lieber miteinander leben als sterben. »Schade«, denke ich.
Erschöpfte, schwitzende Touristen und jüdische Hausfrauen mit prall gefüllten Einkaufstaschen, verwilderte Hippies mit nackter Brust und mild lächelnde Nonnen, israelische Soldaten mit Maschinenpistole und prächtig aufgemachte Popen, Araber unter leuchtend weißer Kefieh4 und bleiche Chassidim mit hüpfenden Paies5, Horden schmutziger Kinder und schwarz verschleierte Araberinnen – all das eilt und schlendert, stößt und drängt sich durch die schmalen Gassen des Bazars. Vor den Läden, die geschmacklosen Schmuck, gräßliche Kitschandenken, bunte Teppiche, Schafpelze und für Touristen zurechtgeschneiderte Kleidungsstücke arabischen Kolorits anbieten, stehen junge, aufdringliche Burschen, die nach immer neuen Opfern Ausschau halten.
»Good evening, Lady!« rufen sie, unverschämt und unterwürfig zugleich. »Come in, please, hi, Lady, see what I have ... hallo, Mister, how are you, Sir, have a look at my shop ...«
»Shalom, Miss ...« – das gilt jetzt mir –, »wait a minute, I show you something ...«
Ein junger, magerer Mann springt mir in den Weg und schwenkt einen grellfarbigen Wandteppich aus Nylonfaser vor meinen Augen hin und her. Ich starre einen Moment lang gereizt auf ein verschneites Bergidyll und stoße es dann mit der Schulter beiseite. Zur Strafe werde ich gleich darauf von einer fetten Araberfrau angerempelt, die mit unwahrscheinlicher Grazie einen Korb voll bunter Früchte auf dem Kopf balanciert.
Ihr folgt ein Junge, der unter Rutenhieben zwei schwarze, an den Hörnern zusammengebundene Ziegen vor sich hertreibt. Während ich mich mitleidig nach den armen Tieren umdrehe, spüre ich, wie sich etwas Hartes in meine Seite bohrt. Erschrocken schaue ich hin, aber zum Glück ist es nur der Griff einer Maschinenpistole.
»Verzeihung«, sagt der junge, sommersprossige Soldat.
»Macht gar nichts«, sage ich und weiche gerade noch einem blonden Geschöpf aus, das in hautengen Shorts, ein großes Kreuz zwischen den Brüsten, unbekümmert einhergewippt kommt. Zwei ältere Araber, die auf der Schwelle eines Ladens sitzen, schauen ihr wie einer entschwindenden Fata Morgana düster nach. Ein Chassid, der mit nach innen gekehrtem Blick und vorgebeugtem Oberkörper gegen einen imaginären Sturm anzukämpfen scheint, hastet an ihr vorüber. Jetzt versuche ich so zu gehen wie der Chassid, mit eiligen, zielstrebigen Schritten, nichts sehend, nichts hörend und in Gedanken den vierten Bußpsalm deklamierend: »Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen beständigen Geist ...«
Aber natürlich gelingt mir das nicht, und so trete ich an einen Stand, um mir Zigaretten zu kaufen und eine Limonade zu trinken. Ein Radio, auf volle Lautstärke gestellt, spielt arabische Musik. Ein Junge sitzt auf einem Hocker und bohrt in der Nase. Als er den Finger aus dem Nasenloch zieht, um mich zu bedienen, ist mir der Durst vergangen. An der Ecke, an der ein Fleischer mit einer Auswahl blutiger Schafköpfe, fettgepolsterter Hammelhintern und blasser Hoden aufwartet, biege ich links ab und bereite mich auf einen neuen Schock, den der Hühnerschlächterei, vor. Sie ist nur ein paar Meter entfernt, und zu meinem Entsetzen höre ich bereits das verzweifelte Gegacker. Den Kopf gesenkt, die Hände über den Ohren, beginne ich zu rennen und lande mitten in einer christlichen Touristengruppe. Feuchte, kleinnasige, blaßäugige Gesichter schauen mich verblüfft an, und ich versuche mich mit einem »sorry« aus dem Knäuel zu befreien. Inzwischen schreit ein Huhn, schreit in langgezogenen, gequälten Tönen wie ein Mensch in Todesangst. Und als es mir endlich gelungen ist, die christliche Herde zu durchbrechen, stehe ich dem Huhn direkt gegenüber. Es liegt mit zerzaustem Gefieder, zusammengebundenen Beinen und weit aufgerissenem Schnabel in einer Waagschale, während seine in enge Käfige gesperrte Leidensgenossen stumm und entsetzt zu ihm hinüberspähen.
»Hühner sind dumm und häßlich, und ich habe überhaupt keine Beziehung zu ihnen«, sage ich mir, aber es hilft nichts. Ich kneife einen Moment lang die Augen zusammen und stelle mir die Käfige voller Touristen vor. Die Vorstellung ist überaus erfreulich, aber helfen tut sie auch nicht. Während ich weitergehe, die letzte Zigarette aus einem Päckchen ziehe und sie anzünde, verfolgt mich das schreiende Huhn.
Ich bin zweifellos in keiner guten Verfassung, und die Altstadt ist heute nicht dazu angetan, meine Stimmung zu heben. Der Rummel geht mir mehr denn je auf die Nerven. Das Ursprüngliche scheint mir verloren.
Ich war unter den ersten, die sich in die Altstadt stürzten, als ihre Tore etwa zwei Wochen nach dem Sechs-Tage-Krieg geöffnet wurden. Eingekeilt in Hunderte von Menschen, die über der Freude, sie zum erstenmal oder endlich wieder zu sehen, jede Gefahr vergaßen, wurde ich durch die Gassen geschleust. Viel sah ich nicht in dem höllischen Gedränge, aber das, was ich sah – die alten, miteinander verwachsenen Häuserfronten, eine mittelalterliche Pitabäckerei, ein schön geschwungener Torbogen –, erfüllte mich mit unbeschreiblichem Entzücken. In Ost-Jerusalem, der ersten orientalischen Stadt, die ich sah, entdeckte ich eine Märchenwelt, fremd- und eigenartig wie die dunklen, in Tücher gehüllten Gesichter der Araber, die stumm und ausdruckslos über den Strom fröhlicher Juden hinwegblickten.