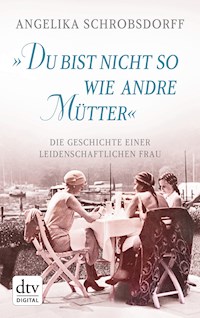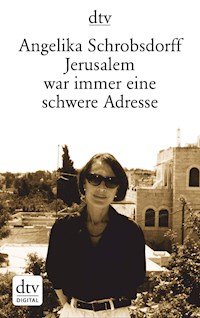
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Ein sehr persönliches, menschliches Zeugnis für Versöhnung und Toleranz. »Ich erinere mich genau, wann die Unruhen anfingen, denn am selben Tag ging mein Telefon kaputt...« Die »Unruhen«, das ist der passive Widerstand, die Rebellion, der Aufstand der Palästinenser, die Intifada. Angelika Schrobsdorff begegnet ihr hautnah, denn ihre Wohnung liegt auf der Grünen Grenze unweit der Altstadt von Jerusalem. Hier lebt sie mit jüdischen und arabischen Nachbarn zusammen. Ihre genaue Beobachtungsgabe, ihre Ehrlichkeit und ihre sanfte Ironie geben diesem Bericht über einen scheinbar aussichtslosen Konflikt zwischen zweier Völker seine befreiende Wirkung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 615
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Angelika Schrobsdorff
Jerusalem war immer eine schwere Adresse
Meinen Freunden zu beiden Seiten der Grünen Grenze
Ich erinnere mich genau, wann die Unruhen anfingen, denn am selben Tag ging mein Telefon kaputt, die Druckpumpe meiner beiden Öfen setzte aus, und es goß in Strömen. Ich saß also in einer großen, kalten, wenn auch schönen Wohnung, das Wasser begann unter der Tür, die zum Patio führt, durchzurinnen, und ich hatte nicht einmal die Möglichkeit, Avi anzurufen, den einzigen, der mit Situationen dieser Art im Handumdrehen fertig wird. Avi hat meine Wohnung renoviert. Es dauerte sechs Wochen, und in dieser Zeit wurde der Grundstein zu unserer Freundschaft gelegt. Sie wuchs mit jeder Wand, die er hochzog, wurde mit jedem Stein, jeder Kachel zementiert und leuchtete schließlich aus all den Spots, die er in großen Mengen an Decken und Wänden angebracht hatte. Als die Hauptarbeit getan war, verlangte ich den Haustürschlüssel nicht zurück. Es gab noch dieses und jenes zu reparieren, und ich sagte ihm, er könne kommen, wann er wolle. Es war ein Zeichen meines uneingeschränkten Vertrauens, und er verstand es, steckte den Schlüssel, den er mir hingehalten hatte, wieder ein, sagte: »Ich bin immer für dich da, wenn du mich brauchst« und ging.
Avi ist Araber – heute sagt man bereits Palästinenser –, und eigentlich heißt er Ali. Den Namen Avi hatte er sich für die Israelis zugelegt, so wie viele Palästinenser, die für sie arbeiten. Meine Zugehfrau heißt zum Beispiel Intisar und nennt sich Euphemia. Ihre Freundinnen, die bei meinen Freunden putzen, heißen oder nennen sich Maria und Anna und, wenn sie mondän werden, Margot oder Rita. Sie kommen alle aus Bethlehem und sind christliche Araberinnen. Die moslemischen Araber, die die niedersten Arbeiten verrichten und mit Israelis oder Touristen keinen Umgang haben – und das ist die große Mehrheit –, bleiben bei ihren ursprünglichen Namen. Die sind in vielen Fällen unaussprechbar, und vielleicht ist das einer der Gründe, warum sich die anderen neue Namen zulegen. Ganz bin ich nie hinter das Geheimnis gekommen, denn es gibt Dinge, nach denen man nicht fragt. Der Takt verbietet es einem, oder die Scham, oder Sprachschwierigkeiten. Auf diese Weise beschränken sich die Themen auf ein Minimum, und das hat mich oft sehr nervös gemacht. Bis die Barriere der diversen Tabus durchbrochen war, dauerte es Wochen, und bis dahin war man schon so auf der Hut, daß es wiederum Wochen dauerte, bis man sich zu so gewagten Sätzen wie etwa: »Sag mal, Avi, oder George, oder Euphemia, was hältst du eigentlich von dem Mazaf?« durchrang. »Mazaf« ist ein hebräisches Wort. Es bedeutet Situation oder Zustand – meistens böser –, und jeder hierzulande versteht sofort, was damit gemeint ist. Bei Avi hat es viereinhalb Monate gedauert, bis ich ihm diese Frage stellte. Und möglicherweise hätte ich sie ihm nie gestellt, wenn nicht die Unruhen ausgebrochen wären. Damals, am Anfang, nannte man sie noch Unruhen, heute nennt man sie Rebellion, und wenn man überhaupt kein Blatt mehr vor den Mund nimmt, Aufstand.
Natürlich habe ich Avi nicht gleich am Anfang der Unruhen, das heißt am Tag, an dem mein Telefon kaputtging und die Druckpumpe aussetzte, mit dieser Frage überfallen. Unruhen gab es ja schon immer, und man hat, wenn überhaupt, nur im Freundeskreis darüber gesprochen, und auch dann nur beiläufig. Also habe ich Avi, als ich ihn schließlich vom Telefon meiner Nachbarn aus anrief und zu meiner freudigen Überraschung auch erreichte, nur gefragt, ob es normal sei, daß die Druckpumpe ausgesetzt hätte. Auch in solchen Fragen bin ich vorsichtig, denn ich habe ihn schon mindestens fünfzigmal in ähnlichen Notfällen angerufen und geniere mich, ihn geradeheraus zu bitten, zu mir zu kommen und die Sache zu reparieren. Ich möchte unter keinen Umständen den Eindruck erwecken, unsere Freundschaft auszunutzen, und da er kein Geld mehr von mir nimmt – jedenfalls nicht für kleinere Reparaturen –, kann es leicht danach aussehen. Natürlich hat er den Code sofort entschlüsselt und erklärt, er sei in einer halben Stunde bei mir. Ich war so erleichtert, daß ich meinem Nachbarn, Mr. Shwarz, der geduckt und mit gespannter Aufmerksamkeit vor seinem Computer saß, den Mazaf mit der Druckpumpe erzählte.
Brian Shwarz ist Schriftsteller, Übersetzer und Literaturkritiker, ein runder, kurzbärtiger, sehr verworrener und scheuer Amerikaner mit Kipa. Gott sei Dank ist die Kipa gehäkelt und zweifarbig, was bedeutet, daß er nicht sehr fromm ist. Die sehr Frommen tragen schwarze Käppchen aus Seide oder Samt und längere, ungepflegte Bärte. Mit ihnen hätte ich nur dann ein Haus teilen können, wenn ich selber schleunigst fromm geworden wäre – was mir nicht liegt. Mr. Shwarz ist es egal, ob ich am Schabbat ins Auto steige oder ob mein Freund, Philip, in seinen manischen Phasen Tangokassetten in voller Lautstärke abspielen läßt. Er selber bläst jeden Abend das Saxophon. Zur Zeit übt er die ›Rhapsody in Blue‹.
»Schlimm«, sagte mein Nachbar mit zerstreuter Höflichkeit, »wenn man bei solchem Wetter keine Heizung hat. Aber wenigstens haben Sie Türen.«
Die Shwarz’ – es sind im ganzen sechs, er, seine Frau und vier Kinder – haben nur eine Behelfstür, auf die anderen warten sie seit Anfang September. Und nicht nur auf die. Sie hatten den Fehler gemacht, an die Fassade des alten Hauses einen zweistöckigen Würfel anzubauen und damit ihre Schönheit zu verhunzen. Am Anfang war ich darüber so verzweifelt gewesen, daß ich den Shwarzens alle Plagen dieser Welt an den Hals gewünscht habe. Aber jetzt sind sie, auch ohne die, gestraft genug, und ich habe, dank des viereckigen Furunkels, der fast bis zu meinen Fenstern hinaufgewachsen ist, eine Terrasse gewonnen. Nicht, daß ich Wert darauf gelegt hätte! Ich habe bereits einen Patio und eine zweihundert Quadratmeter große Dachterrasse, und wenn ich die, zusammen mit dem Dach der Shwarz’, bepflanzen und bewässern würde, käme ich zu nichts anderem mehr.
Wie gesagt, ich habe meinen Nachbarn verziehen, denn inzwischen hat ihre Verzweiflung die meine überrundet. Noch fast ein Jahr nach Baubeginn hausen sie zu sechst in einem wüsten sand- und mörtelbedeckten Durcheinander, und das einzige, was merkwürdigerweise noch funktioniert, ist ihr Telefon, das Saxophon und der Computer. Auf dem stand in grünen, flimmernden Buchstaben ein Text, der mit dem Satz begann: »After the Six Days War …«
Weiter kam ich nicht, denn Mr. Shwarz’ Blick war meinem gefolgt, und ich, an seiner Stelle, wäre verdrossen gewesen, wenn jemand unaufgefordert meinen Text gelesen hätte. Ich habe also nie erfahren, was nach dem Sechs-Tage-Krieg geschah.
Jetzt hätte ich eigentlich gehen können, aber die Unordnung und klamme Kälte in der Wohnung hielt mich zurück. Wenn man Ärger hat, soll man zu jemand gehen, der noch mehr Ärger hat als man selber. Das richtet einen wieder auf. Mein Nachbar mißverstand mein Zögern.
»Wenn Sie noch einen Anruf machen wollen«, sagte er, »können Sie das gern tun.«
Ich wußte, daß ich ihm, wie jedem Menschen, der an der Schreibmaschine oder gar vor einem Computer sitzt, furchtbar auf die Nerven ging, aber da er mich nun schon mal dazu aufgefordert hatte, nahm ich sein Angebot an.
»Danke schön«, sagte ich, »vielleicht noch einen …«, und wählte Philips Nummer.
Sein verdammter Anrufbeantworter sagte: »Hi, hier spricht Philip. Rein zufällig haben Sie die richtige Nummer erreicht …«
Auf dem Tisch, an dem Mr. Shwarz seinen Computer fixierte, lag die ›Jerusalem Post‹ mit der Schlagzeile: »Jugendlicher bei Zwischenfall in Gaza getötet: Ein junger Palästinenser wurde gestern von den IDF (Israel Defence Force) erschossen und mindestens vierundzwanzig weitere verletzt, als im Gaza-Streifen die schwersten Unruhen der letzten Monate ausbrachen.«
Ich las und lauschte, bis das Sprech-Signal erklang. Erst dann legte ich wortlos den Hörer auf. Wenn es um mein Leben ginge, könnte ich vielleicht mit diesen Maschinen sprechen, aber um das ging es ja nicht.
Ich warf noch einen Blick auf die Zeitung: »Unter den Verwundeten waren auch zwei Mädchen, elf und dreizehn Jahre alt. Die meisten Verwundeten wurden in die Beine geschossen.«
»Nochmals vielen Dank«, sagte ich zu Brian Shwarz.
»Das ist doch selbstverständlich. Und wenn Sie irgendwann telefonieren müssen, können Sie jederzeit zu uns kommen.«
Sehr leichtsinnig, so etwas zu sagen!
Als ich die Behelfstür öffnete, stand Mrs. Shwarz draußen und kämpfte mit dem Regenschirm. Sie ist von Beruf Weberin, eine sehr schmale, blasse, erschöpfte Frau, der das Leben als solches über den Kopf wächst. Der grüne Schirm hatte sich bei dem Sturm von unten nach oben gekehrt und sah aus wie eine exotische Wasserblume. Miriam Shwarz war vollkommen durchnäßt. Twinkle, der kleine, honigfarbene Hund, sprang mit schlammtriefenden Pfoten freudig an mir hoch.
»Den Schirm kann man wegwerfen«, sagte Miriam mit ihrer leisen, müden Stimme, »Twinkle, laß das.«
Der Hund dachte gar nicht daran, das zu lassen, und ich schrie ihn kurz an. Er legte den Kopf zur Seite und schaute mit einem Auge zu mir auf. Offenbar hatte er noch nie so ein Organ gehört. Alle sechs Shwarz’, selbst die vierjährige Tochter, sprachen mit kaum hörbaren Stimmen und bewegten sich lautlos. Sie waren ein Geschenk Gottes.
»Mein Telefon ist kaputt«, sagte ich und versuchte, ihr im Kampf mit dem Schirm beizustehen.
»Es ist immer etwas kaputt«, flüsterte sie, »und meistens ist es schon kaputt, bevor es fertig ist.«
»Meine Druckpumpe ist auch kaputt.«
Sie schüttelte den Kopf und steckte den Schirm in den Sandhaufen, der sich seit genau acht Monaten neben der Behelfstür der Shwarz’ befand, »es geht wirklich zu weit.«
»Ja«, sagte ich, »und das Schlimmste ist, daß man sich so schwer an kaputte Sachen gewöhnt.«
Sie lächelte zustimmend, seufzte »Schalom« und bat den Hund, ins Haus zu treten.
Als Avi kam, war es bereits so kalt in meiner Wohnung, daß ich im Mantel in meinem kleinsten Zimmer – das ist das Schlafzimmer – vor einem elektrischen Öfchen saß. Meine zwei Kater hatten sich auf dem Bett zu einer grauen und einer schwarzen Pelzkugel zusammengerollt, und daran erkannte ich, daß ihnen genauso ungemütlich war wie mir.
Avi trug eine Strickmütze, die er bis über Brauen und Ohren gezogen hatte, und sein Gesicht war so bewölkt wie der Himmel. »Marchaba1«, sagte er, »wie geht’s dir?«
Ich sagte, es ginge mir wie der Druckpumpe kurz vor dem Aussetzen.
Er lief mit Riesenschritten den Gang hinunter und ich hinter ihm her. Auch wenn wir in der Stadt eine Besorgung machten oder in Hebron spazierengingen, lief ich hinter ihm her. Avi ist mindestens eins neunzig groß, und seine Beine sind länger als Rumpf, Hals und Kopf zusammen. Er ist gerade und schmal gewachsen wie der Stamm einer Fichte und hat nur eine ganz dünne Schicht Fleisch auf den Knochen.
»Du fühlst dich schlecht, nicht wahr?« fragte ich, als ich ihn in der Küche eingeholt hatte.
»Nein, es geht mir sehr gut.«
Er nahm den Kellerschlüssel vom Haken und verschwand.
Avi rauchte damals noch drei Päckchen Zigaretten am Tag, trank zahllose Gläser starken Tees, aß in Schüben und dann nur die unverdaulichsten Sachen. Seit einigen Wochen litt er unter heftigen Bauchkrämpfen, rannte vom Schmerz getrieben zu verschiedenen israelischen und arabischen Ärzten und erhielt von denen jedesmal ein neues Medikament. Das zeigte er mir und erklärte, es helfe nicht die Spur. Daraufhin hielt ich ihm Vorträge über die Notwendigkeit, ein Medikament längere Zeit regelmäßig einzunehmen und nicht wie er einen Tag lang fünf verschiedene Medikamente auf einmal, belehrte ihn über die Nützlichkeit einer Diät, die Unfähigkeit der Ärzte als solche und die Schädlichkeit der Medikamente an sich. Er bekräftigte meine Unlogik mit eifrigem Kopfnicken und ließ mich abschließend wissen, er litte im Grunde genommen nur unter Blähungen, und die entwickelten sich aus seiner Nervosität, und die wiederum sich aus seiner Arbeit, die in diesem Land undurchführbar sei. Keiner seiner Arbeiter oder Lieferanten hielte sich an Zeiten und Versprechen. Und wenn das ein in diesem Land geborener, aufgewachsener und erzogener Araber und nicht eine von Pünktlichkeit und Gewissenhaftigkeit verseuchte Europäerin sagt, dann muß was dran sein.
Ich kochte Tee, und als Avi erschien, goß ich ihm schnell eine Tasse ein.
»Die Pumpe geht wieder«, sagte er.
Ein Genie, dieser Mann, und wäre ich zwanzig Jahre jünger und er bereit gewesen, mich als zweite Frau zu nehmen, ich hätte ihn geheiratet. Im Grunde habe ich mir immer einen Mann gewünscht, bei dem man sich, was das tägliche Leben betrifft, sicher fühlt. Alles andere ist nebensächlich und sowieso nicht zu reparieren: nicht der Zerfall des Körpers, nicht das Schrumpfen der Seele, nicht die Niedertracht der Menschen, nicht die Zerstörung der Welt.
Ich zündete die Öfen an, dann setzten wir uns ins Wohnzimmer und tranken Tee.
»Du brauchst eine neue Pumpe«, sagte Avi, »ich besorge eine. Das Rohr ist auch kaputt.«
»Welches Rohr?«
»Das vom Dach zum Boden. Es hat viele Löcher.«
»Aha.«
Egal welches Rohr. Er wußte schon, wovon er sprach.
Er nahm zwei Zigaretten aus dem Päckchen, steckte sich eine zwischen die Lippen und hielt mir die andere hin wie eine eben gepflückte Blume. Das war eine arabische Sitte und ließ auf gute Manieren schließen.
Ich erkundigte mich nach seiner Frau Jaissa, nach den zwei kleinen Söhnen und fünf Töchtern.
Es ging ihnen »sehr, sehr gut«, behauptete Avi.
Ich erkundigte mich nach seiner Mutter.
»Sie ist gestern wieder gestorben«, sagte er, »und dann mußte ich sie zum Arzt bringen.«
Avis Mutter, eine robuste und pfiffige Bauersfrau, starb oft und gerne, denn damit gelang es ihr immer noch, die ganze Familie – es waren fünfundzwanzig, die unter einem Dache zusammenlebten – um ihr Bett zu versammeln und, wenn auch nicht mehr zu erschüttern, so doch wenigstens eine mit Ungeduld gemischte Aufmerksamkeit zu erringen.
»Und was hat der Arzt mit ihr gemacht?« fragte ich.
»Er hat sie untersucht und gesagt, sie sei gesund. Sie hat schrecklich geschimpft und gesagt, er sei ein Betrüger und gar kein Arzt.«
Avi lachte. Er hatte viel Ähnlichkeit mit meinem schwarzen Kater Dino, der für einen Kater ein zu schmales Gesicht, eine zu große Nase und zu kleine Augen hat. Aber für einen Mann mit Katzenähnlichkeit waren diese Proportionen gerade richtig und Avis Züge die eines gut-, wenn auch an diesem düsteren Tag krank aussehenden Mannes.
»Du hast wieder Schmerzen«, sagte ich, die arabische Höflichkeit mit einem Frontalangriff durchbrechend.
»Ja«, gab er endlich zu, »schlimme Schmerzen. Es sind die Zigaretten. Morgen rauche ich nicht mehr, nie wieder, keine Zigarette.«
»Diese Drohung habe ich schon von vielen gehört, und, Gott behüte, sie haben dann auch noch versucht, sie wahr zu machen! Ein starker Raucher, der sich das Rauchen abgewöhnen will, ist eine Gefahr für seine Umwelt.«
»Du wirst sehen. Wenn ich das nächste Mal komme, rauche ich nicht mehr.«
Es war, wie er sagte, und für mich der schlagende Beweis, daß es nichts gab, was Avi nicht spielend bewältigen konnte.
Als er gegangen war, nahm ich ohne die geringste Hoffnung den Hörer vom Telefon und wurde von einem normalen Tuten aus der Fassung gebracht. In Israel wird viel von Wundern gesprochen, und wenn überhaupt nichts mehr geht und der Mazaf – welcher auch immer – unlösbar ist, wartet man darauf. Manchmal hat es auch den Anschein, als fände eins statt, aber es ist immer nur von kurzer Dauer. So auch das Wunder mit dem Telefon. Bei der zweiten Nummer, die ich versuchsweise wählte, hatte ich ein wahres Kriegsgetöse im Ohr – Knallen, Prasseln, Pfeifen, Zischen. Ich war beinahe froh, als es abrupt verstummte und der Apparat mausetot war.
Ich schaute auf meine Armbanduhr, die, obgleich sie nur 35 Schekel gekostet hatte, sogar das Datum produzieren konnte. Es war der 9. Dezember. Ich prägte ihn mir ein, weil man bei der Störungsstelle, die man, wenn überhaupt, erst nach Tagen erreicht, genau sagen muß, was wann passiert war.
Ich weiß nicht mehr, ob es Philip oder Rick war, der mich über die Lage aufgeklärt hat, und ich weiß auch nicht mehr, ob es am 9. oder 10. Dezember war. Ich nehme an, es war der 10., da ich am 9. bestimmt nur über Telefon, Druckpumpe und durchlöchertes Rohr gesprochen habe und Philip oder Rick oder beide genügend Anstand hatten, sich darauf einzustellen. Immerhin tue ich das auch, wenn bei ihnen etwas kaputtgeht oder durchbrennt oder ausläuft oder in Flammen aufgeht. Irgendwas ist immer los, und das liegt weniger an ihnen als am Mittleren Osten, der besonders im Winter viel Unterhaltung bietet.
Es ist auch egal, wer mich aufgeklärt hat: Philip oder Rick. Philip ist ein englischer Jude aus London, Rick ein amerikanischer aus New York. Beide kommen aus gutbürgerlich-wohlhabendem Haus, sind ebenso intelligent wie neurotisch und lesen ungeheure Mengen an in- und ausländischen Zeitungen, manche davon täglich und von A bis Z. Rick hauptsächlich aus beruflichen Gründen, denn er ist letztes Jahr aus freiem Willen Journalist geworden; Philip, weil ihn der blinde, tollwütige Wahnsinn der Menschheit im allgemeinen und der in Israel im besonderen interessiert und er sich damit außerdem erfolgreich ums Schreiben drücken kann. Seit August 1987 droht er damit. Zuerst war es ein Roman über AIDS, dann ein Theaterstück über seine Mutter. Ein Thema ergab sich sozusagen aus dem anderen. Philip ist homosexuell, was seine intensive Beschäftigung mit der Krankheit erklärt, und er hatte eine dominante, seiner Beschreibung nach unerträgliche Mutter, der er seine Homosexualität verdanken zu müssen glaubt. Was Rick anbelangt, so hat er ein Faible für ältere Frauen, die es im Leben zu etwas gebracht haben, sei es materiell oder intellektuell, am liebsten beides. Davon hat er eine große Auslese, und ob die Hintergründe dieses Faibles nun mehr pragmatischer oder bewundernder Natur sind, konnte ich bis zum heutigen Tage nicht feststellen. Philips Vergangenheit ist reich an manisch-depressiven, psychoanalytischen und Sex-Erfahrungen. Ricks Vergangenheit ist etwas komplexer. Zwar ist das Familienmuster ein ähnliches – dominante Mutter, weichlicher Vater, trübe Kindheit, in der er, der frühreif Übergescheite, vor Verwandten und Freunden glänzen mußte –, aber er ist fleißiger und ambitiöser als Philip. In Harvard, wo er im letzten Semester klassische Philologie studierte und außerdem in psychoanalytischer Behandlung war, überkam ihn plötzlich der Ekel vor Familie, Kommilitonen, Studium, Analyse und Amerika überhaupt so heftig, daß er als Austauschstudent auf einen Monat nach Deutschland fuhr und sieben Jahre später immer noch da war. Er schlug sich in München mit Gelegenheitsarbeiten durch, schluckte große Mengen an Alkohol, Schlaftabletten und Aufputschmitteln, lernte akzentlos deutsch sprechen, sammelte Bücher und verbrachte die Nächte in Bars und Kneipen. Als er merkte, daß ihm diese Lebensform auch nicht auf Dauer entsprach, wanderte er mit einer beachtlichen Bibliothek nach Israel aus. Dort, nach zwei mageren Jahren, in denen er sich weder Alkohol noch Tabletten, weder Kneipen noch Analyse leisten konnte, fing er sich und begann, mit Hilfe einiger deutschsprachiger Freunde, seine Karriere als Journalist. Der Abscheu vor seiner amerikanischen Vergangenheit ging so weit, daß er sich sogar an seiner Muttersprache rächte. Er schreibt, spricht, denkt und träumt deutsch.
So weit meine zwei jungen Freunde, die mich mit einem Übermaß an Abwechslung und Informationen versorgen. Abwechslung hatte ich zwar schon mehr als genug, aber an Informationen hat es mir von jeher gemangelt. Meine Aversion gegen Zeitungen schien unüberwindlich, und ich weiß nicht, worauf das zurückzuführen war: auf ihre Unhandlichkeit, die einem verbat, sie im Bett zu lesen – und ich lese nur im Bett –, oder ihre suggestive Berichterstattung, die einem verbat, eigene Gedanken zu einem Thema zu produzieren. Wie dem auch sei, ich habe meine Informationen jahrelang aus den englischen Nachrichten des jordanischen Rundfunksenders bezogen, und die waren außerordentlich spannend. Der Sprecher hatte außer »der zionistischen Aggression« ein Sätzlein, das er dank seiner Häufigkeit bestimmt noch im Koma sagen konnte, jede Silbe falsch betont, und es war mir überlassen geblieben, das entsprechende Wort und anschließend den Sinn eines ganzen Satzes zu entziffern. Es war wie ein Rätselraten gewesen. Davon abgesehen hatten einem die Nachrichten sehr viel Raum für eigene Gedanken gelassen.
Erst als ich in den Besitz eines Farbfernsehers kam, habe ich begonnen, mir am Freitag regelmäßig die Wochenendausgabe der ›Jerusalem Post‹ zu kaufen, denn in der befindet sich das Fernsehprogramm. Manchmal habe ich mich gezwungen, die Schlagzeilen zu lesen, aber meistens habe ich die Zeitung, so wie sie war, als Unterlage für die Freßnäpfchen meiner Katzen benutzt. Das Fernsehprogramm dagegen habe ich eifrig studiert, denn unter all den endlosen Schnulzen-, Krimi- und Lustspielserien, aus denen man lernen konnte, um was es im Leben wirklich geht, fand ich manchmal Perlen wie etwa einen guten englischen Film oder ein schlechtes amerikanisches Melo- oder Psychodrama – ein Genre, für das ich sehr empfänglich bin. Und außerdem boten sich mir jetzt endlich die jordanischen Nachrichten in voller Farbenpracht. »Seine Majestät der König …«, begannen sie feierlich, und dann sah und hörte man, was Seine lächelnde Majestät nun wieder alles getrieben hatte. Er reiste sehr viel, und wenn er das nicht tat, empfing er Staatsbesuche – hauptsächlich aus den arabischen Ländern. Auf diesen Empfängen ging es zu wie in ›Tausendundeiner Nacht‹. Fabelhafte Märchengestalten, in wundervollen Gewändern und Kopfbedeckungen, saßen an den Wänden entlang in plüschigen Sesseln neben Tischchen mit künstlichen Blumenarrangements, schritten auf roten Teppichen vom oder zum Flugzeug, schüttelten sich die Hände, küßten sich die Wangen – und all das zu den Klängen eines Wiener Walzers. Ich kannte inzwischen die Repräsentanten des »Haschemitischen Königshauses« wie gute Bekannte: den »Generalstabschef«, »Kronprinz Hassan«, die verschiedenen Minister und Würdenträger des Islam und selbstverständlich die schöne Königin Nur, deren goldenes, jedesmal anders frisiertes Haar ich aufrichtig bewunderte.
Meine Freunde, muß ich gestehen, waren etwas verstört – sowohl über meine Informationsquelle als über meinen Geschmack; aber dann brach ja, Gott sei Dank, die neue Ära an.
Rick trat in mein Leben, und Philip kehrte nach einjähriger Abwesenheit aus Amerika nach Jerusalem zurück. Ich kaufte eine Wohnung – eine Kreuzung zwischen Kathedrale und Karawanserei – und ließ mich dort zu einem geruhsamen Lebensabend nieder. So standen die Dinge am 10. Dezember, und sie standen, bis auf das Telefon, die Druckpumpe und das Rohr, nicht schlecht.
Nehmen wir also an, meine Aufklärung fand am 11. Dezember statt. Da funktionierte mein Telefon nämlich eine dreiviertel Stunde, und Philip rief als erster an. Er ist, so wie ich, Frühaufsteher, und seine Anrufe beginnen ab sieben Uhr. Damals begannen sie noch mit relativen Harmlosigkeiten, zum Beispiel, was er am Abend oder in der Nacht zuvor erlebt hatte. Philip erlebte viele sonderbare Geschichten, die einerseits auf seinen Lebenswandel, mehr noch auf Israel zurückzuführen waren. Ich kann beschwören, daß es das interessanteste, irrwitzigste Land der Welt ist, auf das alle jüdischen Dramen der Bibel und alle israelischen Satiren Kishons zutreffen.
An jenem Morgen erzählte mir Philip nun eine lange Geschichte von einer frommen Familie, die in der Eingangshalle eines gepflegten Jerusalemer Wohnhauses eine Kuh untergebracht und sich auf die erbitterten Proteste der Bewohner mit der Begründung verteidigt hatte: eine Kuh sei ein Haustier und nützlicher als Hund oder Katze. Erst als die Polizei kam, wurde die Kuh samt Heu und Fladen aus dem Foyer entfernt.
An diesem Punkt angekommen, brach Philip in irres Gelächter aus, und als er wieder sprechen konnte, las er mir übergangslos die Schlagzeilen in der ›Jerusalem Post‹ vor. »Noch zwei Tote bei gewälttätigen Ausschreitungen: Zwei junge Palästinenser wurden gestern erschossen, als die Unruhen in der West-Bank und im Gaza-Streifen zunahmen. In Nablus erschoß ein Soldat einen palästinensischen Jugendlichen, in Khan Yunis in Gaza wurde ein Elfjähriger in den Kopf geschossen.«
»Was sagst du dazu?« fragte er.
»Zum Kotzen.«
Er sagte: »Jetzt sind es schon drei Tote und mindestens dreißig Verwundete. Alles Halbwüchsige und Kinder. So weit sind die Israelis noch nie gegangen. Eine Schande! Was sagst du dazu?«
»Ich sagte schon: zum Kotzen.«
»Solche Unruhen hat es noch nie gegeben. Es würde mich nicht wundern, wenn das weitergeht und noch schlimmer wird. Die Araber haben jetzt endlich die Schnauze voll.«
»Das haben sie seit zwanzig Jahren.«
»Vierzig.«
»Gut, vierzig. Aber sie sind nicht organisiert. Was können ein paar Halbwüchsige mit Steinen gegen ausgebildete Soldaten mit Waffen ausrichten? Gar nichts.«
»Nein, wahrscheinlich nicht … Weißt du, daß es jetzt in dem Delikatessengeschäft in der Maimonstraße frisches Basilikum gibt?«
»Was soll ich damit?«
»Huhn mit frischem Basilikum ist köstlich. Ich glaube, ich mache eins. Sehr viel Basilikum, Weißwein, etwas Sahne, natürlich erst am Schluß …«
»Wann machst du eins … heute?«
»Ahaaa, jetzt interessiert dich die Sache schon mehr, was?«
»Ja.«
»Soll ich noch jemand dazu einladen, vielleicht …«
»Philip, lad ein, wen du willst, ich muß jetzt Tee trinken.«
Wenn man die Gespräche mit Philip nicht unter einem einleuchtenden Vorwand wie Tee trinken oder Zähne putzen oder was eben gerade nahelag, abbrach, dann konnten sie Stunden dauern, und nichts strengt mich mehr an als telefonieren. Ich halte es, wenn man nichts Dringendes zu sagen, fragen oder bestellen hat, für eine der unergiebigsten Beschäftigungen. Aber mit dieser Einstellung stehe ich in Israel mutterseelenallein da. Das Telefonieren ist hierzulande eine Sucht, und jeder, auch wenn er allein in einem Zweizimmerappartement wohnt, besitzt mehrere Apparate. Man muß sie immer griffbereit haben, denn sonst könnte man einen Anruf verpassen. Es gibt da die allerneuesten Modelle, die man sich, kaum daß sie auf den Markt kommen, unbedingt kaufen muß. Zum Beispiel diese lächerlichen kleinen Dinger, die nur aus einem Hörer mit draufgesetzten Zahlenviereckchen bestehen. Wenn man da keine Elfenfinger hat, vertippt man sich andauernd, und falsche oder keine Verbindungen kann man auch, ohne sich zu vertippen, mit ganz normalen Telefonen herstellen. Sie sind sozusagen die Regel.
Kaum hatte ich also meine neue Wohnung bezogen, schenkte mir Evchen, meine Mutter-Freundin, einen dieser untauglichen Spielzeugapparate – rot noch dazu. Ich glaube, es war ein symbolisches Geschenk, eine Art Nabelschnur, durch die wir Tag und Nacht in Verbindung blieben. Nur daß die Verbindungen täglich schlechter wurden und bald darauf in den Zeitungen eine Warnung erschien: das Telefonnetz sei stark überlastet – Kunststück –, die Bürger von Jerusalem täten sich einen Gefallen, wenn sie auf die alten Apparate zurückgriffen – meine Worte! – und in Privathäusern nur so viele anschlössen, wie unbedingt notwendig wären.
Es hört hier niemand auf Warnungen.
Als mich Rick zehn Minuten nach Philip anrief, war in der Leitung, wenn auch noch entfernt, wieder das Kriegsgetöse. Rick war zunächst zu aufgeregt, um es zur Kenntnis zu nehmen. Er sprach sofort und nur vom Mazaf. Es war erstaunlich, wie er sich in kürzester Zeit den Riecher, die Hektik und Sensationslust der Journalisten angeeignet hatte. Er würde es weit bringen.
»Das gibt eine Katastrophe«, nuschelte er – er nuschelt leider immer, und wenn er aufgeregt ist, besonders stark –, »ein zweiter Libanon!«
»Freu dich, Fritzchen, freu dich, Fritzchen, morgen gibt’s Selleriesalat …«, murmelte ich.
»Dieses Telefon! Was sagst du?«
»Du solltest was darüber schreiben.«
»Nein, Wiebke …« – eine seiner älteren, arrivierten Damen – »hat mir gesagt, die Deutschen hätten überhaupt kein Interesse mehr an Israel. Sie selber wollte eine Reportage über die palästinensischen Flüchtlingslager hier machen und hat mich angerufen und gefragt, ob man die nicht mit den deutschen Konzentrationslagern vergleichen könne.« Er wieherte kurz und freudlos auf. »Ich hab’ gesagt: Nein, das könne man nicht, es fehle noch an systematischem Vernichtungsgeist. Die Flüchtlinge in den Lagern würden weder ausgehungert noch gefoltert, noch auf diese oder jene Art umgebracht, noch vergast. Dann wäre es unmöglich, eine Reportage darüber in deutschen Zeitungen unterzubringen, hat sie gesagt.«
»Schade, nicht wahr? Aber gib die Hoffnung nicht auf, was nicht ist, kann noch werden.«
»Du meinst, ich soll auf gut Glück über den Mazaf schreiben?« Er witterte Morgenluft. Sein letzter Artikel über die äthiopischen Juden, die vor zwei Jahren in elendem Zustand nach Israel gekommen und dort schwer einzugliedern gewesen waren, war ihm nicht von der Hand gegangen. Vielleicht darum, weil die Äthiopier bereits ein alter Hut waren, was man von den gerade entdeckten Palästinensern nicht behaupten konnte.
»Schreib man, schreib«, sagte ich.
Das Geräusch in der Leitung war angeschwollen. Es knackte und sauste.
»Hör mal, was ist eigentlich mit deinem Telefon los?« rief er.
»Das würde ich auch gerne wissen.«
»Soll ich mal die Störungsstelle anrufen?«
»Wenn du die nächsten Tage nichts zu tun hast, bitte schön, sehr gerne.«
»Gut, ich versuch’s gleich mal … was machst du …«
Aus. Eine kompakte Stille.
Na ja, auch nicht so schlimm. Diese Anrufe machten einen noch nervöser als ein kaputtes Telefon.
Ich setzte mich hinter die Schreibmaschine, um an dem Buch über meine Mutter zu arbeiten. Eine überwältigende Unlust kroch in mir hoch. Alle schrieben plötzlich über ihre Mutter. War das nun eine Mode oder ein kollektives Bedürfnis? Ich begann, darüber nachzudenken, und wurde immer müder. Schließlich streckte ich mich neben den Katern vor dem Ofen aus. Sie öffneten die Augen und sahen mich mit starrem Erstaunen an. »Hello, sweethearts«, sagte ich, »ist hübsch, mit Frauchen hier zu liegen, nicht wahr?« Paulus, der graue, stand angewidert auf und stakste davon. Dino, der schwarze, der überaus gescheit ist und ebenso redselig, fing eine Unterhaltung mit mir an. Ich gab nur halbherzige Antworten. Das Gespräch mit Rick hatte mich irritiert. Immer diese Übertreibungen. Kein Wunder, daß ich keine Zeitungen lesen konnte. Ein zweiter Libanon! Als ob es, so wie es war, nicht schon böse genug aussah!
Ein Unglück kommt nie allein. An solchen Sprüchen ist immer etwas Wahres dran. Es kommt tatsächlich in Serien, und wenn man glaubt, man könne es aufhalten oder ihm entwischen, irrt man sich. Selbst im Bett, bei heruntergelassenen Jalousien und bis zu den Ohren hochgezogener Decke, kann man ihm nicht entwischen. Es kommt einem schlicht ins Haus.
Bei mir kam es mitten in meinem Nachmittagsschlaf in Gestalt von Stanley. Stanley ist Professor der Literatur, pensioniert und nach dem ersten Herzinfarkt. Er hat sich trotzdem gut gehalten. Man sieht ihm weder sein Alter noch den Infarkt an. Er sieht heute sogar besser aus als vor fünfzig Jahren – wie ich an einem Foto feststellen konnte –, denn er ist einer von den fahlen, leicht schwabbeligen Menschen, die sich aus dem amphibienartigen Zustand ihrer Jugend langsam zu einem männlichen oder weiblichen Wesen strukturieren. Wenn Stanley nicht gerade in Kniehosen, Socken und Sandalen herumläuft und sich nicht aus Versehen das spärliche Haar kupferrot, sondern nur dezent braun färbt, macht er einen angenehmen, sensiblen und liebenswert weltfremden Eindruck. Steckt man allerdings mitten in der Pechsträhne und im Nachmittagsschlaf, ist seine Weltfremdheit mehr enervierend als liebenswert.
»Was ist los, Stanley?« fragte ich darum auch ziemlich barsch und war nicht bereit, mich zu dieser gotterbärmlichsten aller Stunden zu einem freundschaftlichen Plausch niederzulassen.
Er trat buchstäblich von einem Fuß auf den anderen und sah mich dabei von unten herauf mit tief gekränktem Blick an. Mir kam der Gedanke, daß er vielleicht aufs Klo müsse, denn das mußte Stanley oft und jäh. Möglicherweise war er auf einem Spaziergang von diesem Drang überrascht worden und hatte in mir und meinem Klo die einzige Rettung gesehen.
»Komm rein, Stanley«, sagte ich milder, »du siehst ja ganz erschöpft aus. Ist etwas nicht in Ordnung?«
»Dein Telefon ist kaputt«, sagte er, »darum bin ich hergelaufen.«
»Um mir das zu sagen?«
Bei israelischen Freunden wußte man nie, sie waren zu allem fähig.
»Nein … nein …«
Wir hatten inzwischen den sehr langen Gang, der in ein Kloster zu führen schien, dann aber in der Küche endete, zurückgelegt und standen in der Wohnhalle. Stanley sah sich um, als suche er etwas, das er bei mir vergessen oder das ich ihm gestohlen hatte.
»Weißt du, wo Ibrahim ist?« fragte er.
Den also suchte er und glaubte, ihn endlich, endlich in flagranti bei mir zu ertappen. Wirklich, der Mann ging zu weit! Manische Eifersucht ist in jedem Fall und in jedem Alter unerträglich, aber bei einem Menschen über siebzig ist sie obszön.
»Nein, ich weiß nicht, wo Ibrahim ist, und wenn Ibrahim meine einzige Sorge wäre, dann wäre ich ein sorgenfreier Mensch.«
»Ich dachte nur …«
Er dachte nur – und war mit diesem Gedanken nicht allein –, daß ich mit Ibrahim eine Affäre hatte. Aber leider, denn vielleicht hätte mir das sehr gut getan, lag mir nichts ferner als das.
»Was dachtest du, Stanley … um Gottes willen, steh doch nicht so rum! Setz dich und sag mir, was los ist, sofern etwas los sein sollte.«
»Es ist etwas Schreckliches passiert!«
Drei Tote, dreißig Verletzte, ein kaputtes Telefon, eine auf dem letzten Loch pfeifende Druckpumpe, ein durchlöchertes Rohr, Avis Bauchkrämpfe, Ricks apokalyptische Prognosen und was jetzt noch?
»Ibrahim hat mit einem sechzehnjährigen Mädchen geschlafen.«
»Stanley, ich bitte dich! Du weißt inzwischen genau, daß Ibrahim mit allem schläft, was zwei Beine hat und zwischen zwölf und achtzig ist.«
Das war ausgesprochen taktlos, aber nichts ging mir mehr auf die Nerven als Eifersucht. Merkwürdigerweise schien ihm meine Entgleisung gar nicht aufgefallen zu sein. Er war in irgendwelche heftigen inneren Vorgänge verstrickt, und ich begann, um sein Herz zu fürchten.
»Stanley«, sagte ich beschwichtigend, »Ibrahim ist ein charmanter, reizender, sehr hübscher Junge, aber du mußt dich jetzt endlich damit abfinden, daß …«
»Darum geht es doch gar nicht«, sagte er plötzlich mit einem Anflug von Energie, »das Mädchen ist dem Gesetz nach minderjährig, und ihr Vater hat Ibrahim bei der Polizei angezeigt.«
Ich spürte ein leichtes Übelkeitsgefühl, aber das spürt man eben, wenn man um drei Uhr mittags, statt im Bett zu liegen, mit bösen Eröffnungen konfrontiert wird.
»Kannst du mir die Geschichte bitte mal von Anfang an erzählen«, sagte ich, »was ist das für ein Mädchen? Wie kommt Ibrahim zu ihr? Woher wußte der Vater, daß Ibrahim mit ihr geschlafen hat, und woher weißt du das alles?«
»Ibrahim hat sie bei mir kennengelernt, da war sie noch ein Kind, jedenfalls sah sie so aus … sieht immer noch so aus. Das ist ja das Schlimme. Manche sehen mit sechzehn aus wie zwanzig, aber sie sieht aus wie zwölf. Darum habe ich mir ja auch gar nichts dabei gedacht, verstehst du? Wenn man so unentwickelt …«
»Ich verstehe, Stanley, also weiter.«
»Sie wohnt nebenan mit ihren Eltern, amerikanische Juden, gräßliche Leute, das heißt, die Mutter kenne ich gar nicht, und der Vater war eigentlich immer sehr freundlich, wenn wir uns zufällig auf der Straße begegneten. Er wußte, daß seine Tochter manchmal wegen der Katzen zu mir kommt. Sie mag Katzen, und einmal hat sie mir ein Junges gebracht, aber ich konnte es nicht nehmen, weil meine fünf alten Katzen keine neue dulden. Du weißt ja, wie eifersüchtig Katzen sind – und besonders meine einäugige …«
»Ja, ich weiß, ich weiß, so ist das mit den Katzen.«
»Also, um ehrlich zu sein, das Mädchen hat mir nicht gefallen. Sie hat immer versucht, sich bei mir einzuschmeicheln, und zwar auf eine ganz durchtriebene und gleichzeitig infantile Art. Ibrahim hat sie auch nicht gefallen. Er hat nicht mal mit ihr geflirtet, und du kennst ihn ja, er flirtet mit jeder und jedem. Einmal im Supermarkt hat er mit einer jungen Frau …«
»Ist das Mädchen wenigstens hübsch?«
»Hübsch? Nein. Und dann eben ganz unentwickelt.«
Mir fiel auf, daß wir immer noch standen und Stanleys Blässe ins Grünliche übergegangen war.
»Hier«, sagte ich und klopfte auf die Sitzfläche eines Sessels. Er setzte sich, schaute mit verlorenem Blick ins Leere und sagte: »Ich weiß nicht, was jetzt aus Ibrahim werden soll. Er steht kurz vor dem Examen, und du hast ihm diese gute Arbeit in dem Restaurant verschafft. Alles hat wunderbar geklappt. Er fühlt sich in dem Zimmer bei der alten Frau Wishnovsky wohl, hat angefangen, Hebräisch zu lernen und sich für Filme zu interessieren … ist endlich aufgewacht. Du weißt ja, wie er war. Nichts war aus ihm herauszuholen, an nichts hat er sich beteiligt. Und in den letzten Wochen hat er sogar ein Buch gelesen, das ich ihm gegeben habe, kein schweres natürlich … was war es bloß …«
»Stanley«, rief ich mit derselben Stimme, mit der ich Twinkle, den kleinen, honigblonden Hund der Shwarz’, gelegentlich zur Räson gebracht hatte, »ich weiß jetzt immer noch nicht, wie diese ganze Sache aufgeflogen ist. Wann hat es der Vater entdeckt? Erst heute?«
»Ja, heute, aber er muß schon vorher was geahnt haben. Es ist eine kuriose Geschichte, ich glaube, ich weiß jetzt, wie sie gelaufen ist. Hör zu: Um zehn Uhr sehe ich plötzlich Ibrahim vor meinem Haus auf der Straße. Ich wundere mich, daß er da rumsteht und nicht hereinkommt, denke mir dann aber, daß er sich nicht traut, weil ich am Vormittag arbeite und ihm gesagt habe, er solle nicht zwischen neun und ein Uhr zu mir kommen. Dann ist mir eingefallen, daß ich eigentlich die Gelegenheit ausnutzen und mit ihm zum Supermarkt gehen könnte. Ich darf nämlich nichts Schweres tragen. Also habe ich aus dem Fenster gerufen und ihn gefragt, ob er mich zum Supermarkt begleiten würde. Er schien mir ein bißchen verlegen, nein, irritiert, aber das ist er ja oft. Er hat gesagt, gut, er würde mitkommen. Ich mußte noch die Katzen füttern und mich anziehen … es hat etwa eine Viertelstunde gedauert. Als ich aus dem Haus kam, war er weg.
Ich habe mindestens zehn Minuten gewartet und mich gefragt, ob ich Halluzinationen gehabt habe. Oben auf dem Balkon standen diese fürchterlichen Buben von meinem irakischen Nachbarn, du weißt, der, der mich immer tyrannisiert. Ich bin ganz sicher, daß sie alles gesehen und dem Vater des Mädchens berichtet haben.«
»Dann müssen die Jungens entweder hellsichtig sein, oder Ibrahim hat das Mädchen mitten auf der Straße …«
»Er hat sich mit ihr an der Ecke verabredet, oder vielleicht hat er da auch nur auf gut Glück auf sie gewartet. Er denkt doch nie nach, kombiniert nicht, tut, was ihm gerade einfällt, und ist dann erstaunt und verärgert, daß man ihm auf die Sprünge gekommen ist. Das Mädchen wird innerhalb der fünfzehn Minuten, die ich noch beschäftigt war, gekommen sein, und sie sind weggerannt und auf sein Zimmer gegangen. Die Buben haben das vom Balkon aus beobachtet und den Vater benachrichtigt. Vielleicht hat der sie sogar dazu beauftragt – diese Ungeheuer sind doch die geborenen Denunzianten!«
»Ein Kriminalroman von George Simenon ist nichts dagegen. Glaubst du nicht, daß du ein bißchen zu viel frei erfunden hast? Die Sache kann doch auch ganz harmlos gewesen sein.«
»Das Mädchen hat Tagebuch geführt, und der Vater hat es gefunden. Darin steht schwarz auf weiß, daß sie zweimal mit Ibrahim Sex gehabt hat.«
»Nur zweimal? Dann hast du vielleicht recht, und sie hat ihm wirklich nicht gefallen.«
»Im Grunde macht sich Ibrahim nicht viel aus Sex. Das einzige, woran ihm liegt, ist das Verführen und Erobern … entschuldige bitte.«
Er stand auf und ging ins Badezimmer.
Das stimmte. Am Verführen und Erobern lag Ibrahim viel. Er hatte es bei mir versucht, er hatte es bei zwei meiner Freundinnen versucht. Er versuchte es wahllos bei jeder mit schmachtendem Blick, mädchenhaftem Lächeln und einem lasziven Vorschieben des Beckens. Es war eine höchst merkwürdige Mischung aus Scheu und Unverschämtheit.
Ich hatte mich oft gefragt, was aus ihm geworden wäre, wenn er in seinem Milieu geblieben und nicht achtzehnjährig von seinem arabischen Vorarbeiter und Freund an einen amerikanisch-jüdischen Professor verkuppelt worden wäre. Das war vor dreieinhalb Jahren gewesen, als Stanley sich in einem Sanatorium von seinem Infarkt erholte und Ibrahim, in Shorts, mit nacktem, braunem Oberkörper und zartem Gesicht, auf einem Bau arbeitete. Gewiß, er stach von seinen Landsleuten ab und war in seinem Dorf eine vielbewunderte Ausnahme: dunkelblond, sanft, fast feminin, der einzige, der studierte und sehr gut Englisch sprach. Nein, er wäre bestimmt nicht in seinem Dorf, aber er wäre in seinem Kulturkreis geblieben.
Stanley kam ins Zimmer zurück. Er sah erbarmungswürdig aus.
»Einen Tee?« fragte ich.
»Gerne … und hast du vielleicht einen von diesen guten Kräckern, die ich bei dir immer esse.«
»Ja, aber bitte erzähl erst zu Ende. Durch wen hast du das alles erfahren? Durch das Mädchen?«
»Gott bewahre! Die steht jetzt unter Kuratel. Ihr Vater hat mir alles erzählt. Er hat mich angerufen und gebrüllt wie ein Prolet. Es war furchtbar unangenehm. Weißt du, was dieser Sadist gemacht hat? Als seine Tochter nach Hause kam, hat er sie gepackt, ist mit ihr ins Hadassah2 gefahren und hat sie untersuchen lassen.«
Wir starrten uns beide entgeistert an.
»Auf was?« fragte ich schließlich.
»Auf Samen! Nun stell dir das vor! Wie kann ein Vater seinem Kind so etwas Entwürdigendes antun?«
»Ich verstehe gar nicht, warum er es getan hat. Nur um sie zu entwürdigen?«
»Nein, um mit dem Beweis, daß seine Tochter Sex mit einem Araber gehabt hat, zur Polizei zu gehen.«
»Kann man am Samen feststellen, daß der Mann Araber war?«
»Angelika, du stellst manchmal wirklich komische Fragen!«
»Wieso? Du hast ausdrücklich gesagt ›mit einem Araber‹, und das ist doch auch der springende Punkt. Hätte sie mit einem guten jüdischen Jungen geschlafen, wäre ihr Vater ja nicht zur Polizei gegangen und hätte ihn angezeigt, oder? Also handelt es sich hier gar nicht um ein moralisches Vergehen, sondern um eine rassistische Schweinerei. Auf was lautete die Anzeige? Vergewaltigung?«
»Das habe ich auch gefürchtet, aber Gott sei Lob und Dank hat er das nicht hingekriegt. Seine Tochter hat erklärt, sie habe freiwillig Sex mit Ibrahim gehabt.«
»Gutes Kind, dann kann ihr Vater Ibrahim nur wegen Rassenschande angezeigt haben.«
»Wegen was?«
»Das ist ein rein deutsches Wort. Ich kann es leider nicht übersetzen. Stanley, vielleicht hat dieser Kerl nur gedroht und ist gar nicht zur Polizei gegangen. Im Grunde macht er sich doch lächerlich damit.«
»Nicht bei der Polizei. Und nicht, wenn Sex, Araber und minderjährige jüdische Mädchen im Spiel sind. Weißt du, was er mir am Telefon gesagt hat? Er hat gesagt, daß dieser Araber unschädlich gemacht werden müsse und er nicht eher ruhen würde, als bis das geschehen sei.«
Ich stand auf und ging in die Küche, um Tee zu kochen. Das Wort »unschädlich machen« hatte mich in der Magengrube getroffen. Ewig diese Wiederholungen, diese sich durch alle Staaten und Generationen fortsetzende Terminologie des Hasses. Stanley war in die Küche gekommen. Ich drückte ihm das Paket mit den Kräckern in die Hand, und er begann sofort, an einem herumzuknabbern und Krümel zu sprühen.
»Ich habe bei der alten Frau Wishnovsky eine Nachricht für Ibrahim hinterlassen, er soll sofort zu dir kommen. Sie sagt, sie hat ihn den ganzen Tag nicht gesehen, weil sie beim Arzt war und dann einen Shivabesuch3 gemacht hat. Was soll nun bloß werden? Er kann nirgends mehr hin, nicht zu mir, nicht in sein Zimmer … und dann auch noch der Mazaf, wo jeder Araber von vornherein verdächtig ist.«
»Ja, er hat sich wirklich den besten Zeitpunkt für diese Eselei ausgesucht.«
»Es tut mir so leid, daß ich dich in diese Geschichte verwickelt habe; aber wenn nicht dich, wen dann?«
Ich sah ihn stumm an.
Er lächelte mit geöffneten, nach außen gestülpten Lippen: »Du hast doch nun mal diese perverse Leidenschaft für die armen, verfolgten, diskriminierten Minoritäten«, sagte er, »Juden, Palästinenser, Homosexuelle, herrenlose Katzen …«
An die Phase mit den herrenlosen Katzen werde ich nicht gerne erinnert. Sie dauerte drei Jahre und war eine meiner schlimmsten. Daß sie mich nicht den Verstand gekostet hat, verdanke ich in erster Linie meinen Freunden, die oft mit Rat, Tat, Trost und übermenschlichem Verständnis eingesprungen sind. In Jerusalem gibt es etwa so viele Katzen wie Menschen, und würde nicht hin und wieder eine »Aktion« stattfinden – sie besteht aus Ölsardinen, der billigsten Sorte natürlich, mit Gift gewürzt –, dann würden sie die Stadt bereits übernommen haben. Sie vermehren sich, wie ich feststellen durfte, mit ungeheuerlicher Geschwindigkeit. Ich hatte damals ein kleines Haus mit kleinem Garten in einem der katzenreichsten Viertel Jerusalems gemietet. Ich liebe Katzen und entdecke selbst in den scheußlichsten einen liebenswerten oder eleganten Zug. Und außerdem entdecke ich in jeder die arme, verfolgte, diskriminierte Kreatur. Also machte ich es mir zur Aufgabe, ihnen ein sorgloses, vor Hunger, Kälte und Not geschütztes Dasein zu bescheren. Es fing mit einer Mutterkatze und deren vier entzückenden Jungen an und wuchs sich zu einer zwanzigköpfigen, gar nicht mehr entzückenden Meute aus.
Die israelischen Katzen haben vieles von ihren zweibeinigen Mitbürgern angenommen oder gelernt, zum Beispiel das starke Organ, die Chuzpe und die Entschlossenheit, sich nicht nach allgemeingültigen Vorschriften zu richten. Sie wurden nicht das, was ich anfangs in ihnen entdeckt zu haben glaubte: Leidensgenossen. Sie wurden zu einer Okkupation. Sie siedelten, kämpften und kopulierten in meinem Garten, drangen durch den kleinsten Spalt in mein Haus, schliefen auf meinem Bett, krochen in meine Kochtöpfe, gebaren in meinen Korbsessel, fauchten, kreischten, röhrten und fraßen, bis ihnen das Fressen aus den Ohren kam, und selbst dann fraßen sie weiter. Sie hatten mich im Handumdrehen zu dem gemacht, was sie hätten sein sollen: zu einer armen, verfolgten, diskriminierten Kreatur, und sie hatten nicht das geringste Mitleid mit mir.
Ich fuhr bei sintflutartigem Regen oder vierzig Grad Hitze auf den Markt, kaufte dort zwanzig Kilo Hühnerköpfe – die billigste und gesündeste Katzennahrung –, schleppte sie zum Auto, schleppte sie vom Auto nach Hause, teilte sie in Portionen auf – zwanzig rohe Hühnerköpfe pro Plastikbeutel –, fror sie ein, taute sie auf und warf sie den Monstern morgens um sieben und nachmittags um halb fünf zum Fraß hin. Ich verteilte kleine Hackfleischbällchen mit Antibabypillen, die meistens die Kater, und Antibiotika, die meistens die Gesunden fraßen, aß selber kaum noch, da der Frigidaire mit mich ekelnden Hühnerköpfen vollgestopft war, baute Winterhäuser, bereitete Wochenbetten, rettete vor Aktionen, schlief bei Sturm und Kälte mit geöffnetem Fenster, damit die Katzen ein- und ausgehen konnten, putzte pausenlos den penetranten Katergestank aus den Zimmern, verkrachte mich mit meinen Nachbarn, die diesen Wahnsinn nicht mehr ertragen konnten, überforderte meinen Veterinär, der in schnellem Wechsel heilte und einschläferte, und meine Freunde, die die Katzenprobleme und -dramen unaufhörlich mit anhören und miterleben mußten. Die Katzen hatten den Himmel auf Erden, ich die Hölle.
Es war in diesem Zusammenhang, daß ich Ibrahim kennen- und schätzenlernte. Stanley, der um mein seelisches Gleichgewicht fürchtete und, wichtiger noch, auf eine gute Einnahmequelle für Ibrahim hoffte, brachte ihn mir eines Tages an. Ich stand kurz vor dem Nervenzusammenbruch, außerdem vor einer Reise nach Europa, die ich der Katzen wegen monatelang verschoben hatte. Ibrahim, erklärte Stanley, sei genau das, was ich brauche. Ibrahim saß mir in einer sehr engen, weißen Hose, mit gespreizten Beinen gegenüber und lächelte süß. Er hatte ein feines, anziehendes Gesicht, mit tiefliegenden, braunen Augen, einer schmalen, gebogenen Nase und weichen, vollen Lippen. Außer »hello« hatte er noch kein Wort von sich gegeben, und in Momenten, in denen er sich unbeobachtet glaubte, machte er einen fahrigen und ungeduldigen Eindruck. Ich versuchte, ein Gespräch mit ihm in Gang zu bringen, aber das scheiterte an seiner undurchdringlichen, wenn auch höflichen Einsilbigkeit.
Stanley, der Zweifel in mir aufsteigen sah, sagte, Ibrahim sei etwas scheu, und Ibrahim fixierte einen bestimmten Punkt zwischen seinen gespreizten Beinen, sah dann auf und lächelte süß. Ich hatte bereits meine Flugkarte in der Tasche und kaum eine Möglichkeit, so schnell einen anderen Katzensitter aufzutreiben. »Wenn ich zurückkomme, sind alle Katzen tot«, dachte ich in heller Verzweiflung, und dann mit finsterer Entschlossenheit: »Nun gut, da kann man eben nichts machen.«
Drei Tage vor meiner Abreise bat ich Ibrahim, zu mir zu kommen – alleine. Ich wollte ihm genau sagen und zeigen, was während meiner Abwesenheit mit den Katzen zu geschehen hätte, und hoffte, den Ansatz eines menschlichen Kontakts herzustellen. Er kam frisch und duftend wie ein Frühlingsmorgen, setzte sich in derselben Haltung auf denselben Stuhl mir gegenüber und lächelte innig. Bevor ich zu den praktischen Anweisungen überging, begann ich mit einer schlichtgehaltenen Beschreibung meiner neurotischen Katzenbeziehung. Sie reicht bis in die Zeit des Holocaust zurück, aber so weit ging ich dann doch nicht. Ich erwähnte lediglich, daß ich mir der Anomalität dieser Beziehung bewußt sei, aber unfähig, sie unter Kontrolle zu bringen. Darauf stellte Ibrahim die sehr logische Frage, ob ich verheiratet sei und Kinder hätte. Ich sagte, ich hätte einen Mann und einen Sohn in Europa. Jetzt wurde sein Gesicht ernst und seine Worte eindringlich: Ich sei, erklärte er, eine außerordentlich attraktive Frau. »Und?« fragte ich. Und eine so außerordentlich attraktive Frau dürfe und könne nicht ohne Liebe leben. Ich dachte mir, das müsse sofort und ein für allemal geregelt werden, und nannte ihm mein Alter. Bei einer Frau wie mir spiele das Alter überhaupt keine Rolle, beteuerte er und ließ seinen Kennerblick an mir auf- und niedergleiten. Jetzt fuhr ich mein schwerstes Geschütz auf und sagte ruhig und überzeugend, daß mich die Liebe ankotze und ich gehofft hätte, einen Freund in ihm zu finden. Aber leider sei er so wie alle anderen Männer, die in der Frau nur ein Fickobjekt sähen, und darüber sei ich tief enttäuscht. Er war erschüttert – wahrscheinlich mehr von meiner drastischen Ausdrucksweise als von meiner enttäuschten Hoffnung – und sagte plötzlich mit ganz normaler Stimme und Mimik: Nein, er sei nicht so wie andere Männer, er respektiere mich und würde es mir beweisen.
Er hat es mir bewiesen, und auch wenn er einige Male rückfällig wurde, so waren es reflexbedingte Rückfälle mit Respekt.
Er wurde mir eine zuverlässige Stütze – versorgte mich, das heißt meine Katzen, mit Hühnerköpfen, wickelte tote Kätzchen in Zeitungspapier und trug sie – ich will nicht wissen, wohin, malte die häßlichen Resopaltische in meiner Behausung rot an und reparierte Kleinigkeiten, ohne die dafür notwendige Geschicklichkeit und Überzeugung. Als ich einmal krank im Bett lag, wollte er mich nicht alleine lassen und erklärte, er würde im anderen Zimmer schlafen und für mich sorgen wie für seine Mutter. Ich fragte ihn, ob er so gut für seine Mutter sorge, und er lachte und sagte, nein, aber sie für ihn.
Es war mir in Wochen zähester Kleinarbeit gelungen, die Barriere zu durchbrechen und eine ihm neue menschliche Beziehung aufzubauen, in der sich Mann und Frau als Freunde begegneten. Ich beobachtete mit Genugtuung, wie er mit jedem Mal freier, heiterer und artikulierter wurde, mir seine Anschauungen, Träume und Nöte anvertraute, mir interessiert zuhörte, wenn ich über meine Ansichten und Erfahrungen sprach. Er ließ mich nie im Stich, und ich nahm ihn immer gegen Freunde in Schutz, die ihn einen korrumpierten kleinen Gigolo und Halunken nannten. Ich sagte: So wie man in den Wald hineinruft, so schallt es wieder heraus, und wenn man einen achtzehnjährigen, diskriminierten Jungen korrumpiert, dann dürfe man sich nicht wundern, daß er korrupt ist. Er hätte das Recht, uns alle zu belügen, zu betrügen und zu bestehlen. Punkt.
In meinem Fall – und ich bilde mir sehr viel darauf ein – hat er es nicht getan.
Ibrahim, gutgelaunt und gut gekleidet, erschien kurz nach vier. Die Sonne war bereits untergegangen, und Stanley hatte sich auf mein Bett gelegt und schlief.
»Was hat sich Stanley denn nun wieder ausgedacht?« fragte Ibrahim lachend. »Ich komme nach Hause und finde diese dringende Nachricht und hatte Angst, dir ist was passiert, und bin sofort losgerannt.«
»Ich wecke gleich mal Stanley«, sagte ich, »er schläft.«
»Es ist doch nichts passiert, oder?«
Er sah mich an. Die Diskrepanz zwischen seinem frischen, offenen Gesicht und dem sich in Mißtrauen verschließenden war erschreckend. Er alterte innerhalb von Sekunden um Jahre.
Ich hatte ein flaues Gefühl in Kopf und Beinen und nicht die Absicht, ihn über die böse Situation, in der er sich befand, aufzuklären. Das war Stanleys Aufgabe.
»Doch, es ist etwas passiert, aber das soll dir Stanley sagen. Komm, zieh die Jacke aus und setz dich.«
Ich drehte mich um und ging ins Schlafzimmer. Stanley lag, wie ein Baby, auf dem Rücken. Er hatte die Brille abgenommen, und ohne die sah er hilflos aus.
»Stanley«, rief ich leise, »wach auf, Ibrahim ist hier.«
Er fuhr abrupt hoch, blieb dann aber geduckt sitzen.
»Hast du ihm gesagt …«
»Nein, das überlasse ich dir.«
»Ich komme gleich.«
Ibrahim hatte weder die Jacke ausgezogen noch sich gesetzt. Er stand am Fenster und schaute hinaus. Ich stellte mich neben ihn. Es hatte aufgehört zu regnen, und der Himmel war klar und dunkelblau. Der Mond, rund und golden wie eine Münze, kroch hinter den Hügeln hervor.
»Mein Gott, ist das ein schönes Land«, sagte ich.
»Kannst du mir nicht sagen, was passiert ist?«
»Stanley …«
»Ich will, daß du es mir sagst … bitte!«
»Na schön … du hast mit einem minderjährigen Mädchen – einer Amerikanerin – geschlafen, und der Vater von dem Mädchen hat es herausbekommen und gedroht, dich bei der Polizei anzuzeigen.«
Er starrte mich an, den Mund etwas geöffnet, die Augen zusammengekniffen. »Stimmt es, daß du mit dem Mädchen geschlafen hast, oder hat sie sich das zusammenphantasiert?«
»Nein, es stimmt. Aber wie hat ihr Vater das herausbekommen?«
»Sie hat’s in ihr Tagebuch geschrieben.«
»In was?«
»Tagebuch … da schreibt man alles mögliche hinein – was man erlebt, was man denkt, was man tut.«
»Warum hat sie denn das gemacht?«
»Wahrscheinlich, weil es ein wichtiges Ereignis in ihrem Leben war und sie kindisch und unvorsichtig ist. Wußtest du, daß sie sechzehn ist und darum noch minderjährig?«
»Nein. Bei uns heiraten die Mädchen schon mit vierzehn.«
»Hast du sie verführt, hast du sie gedrängt, mit dir zu schlafen?«
»Nein, sie wollte.«
Stanley schlafwandelte ins Zimmer. In jeder Hand hielt er einen Schuh. Er war noch nicht ganz da.
»Hallo, Ibrahim, hast du den Schraubenzieher mitgebracht?«
»Nein, ich habe ihn vergessen.«
»Aber ich habe dich doch in der Nachricht darum gebeten. Ich brauche ihn!«
Ibrahim warf mir einen händeringenden Blick zu.
»Willst du Tee oder Kaffee, Stanley?« fragte ich.
»Lieber Tee … und wenn du irgendwas zu essen hast – ich habe plötzlich großen Hunger.«
»Ich kann dir ein Stück Käse geben und Tomaten. Ich fürchte, mehr habe ich nicht.«
»Danke schön, das reicht. Es ist nur dieser plötzliche Hunger …«
Ich ging in die Küche. »Essen, trinken, Klo, schlafen«, dachte ich dumpf, »und vergessen, immer mehr vergessen, vergessen, sich die Schuhe anzuziehen … Nun gut, liebes Kind, das wird dir auch blühen.«
Als ich mit dem Tablett ins Zimmer zurückkam, verkündete Stanley: »Angelika, wir haben einen Vorsprung vor der Polizei. Das Mädchen …«
»Hat das Mädchen eigentlich keinen Namen?« unterbrach ich ihn.
»Bonni«, sagte Ibrahim.
»Das Mädchen«, sagte Stanley, »weiß nicht, wie Ibrahim mit Nachnamen heißt, und mit Vornamen nennt sie ihn Charlie.«
»Charlie? Warum Charlie? Ach so …«
Die berühmte Namensänderung.
»Clyde wäre besser gewesen«, sagte ich, »mein Gott, bin ich müde!«
»Ich will nicht, daß es dir wegen mir schlechtgeht«, sagte Ibrahim.
»Das hättest du dir vorher überlegen müssen«, brummte ich, und gleich hinterher: »Du hast keine Schuld an der ganzen Geschichte.«
»Natürlich hat er Schuld«, rief Stanley, »oder willst du vielleicht wieder behaupten, wir – wir alle – hätten Schuld daran.«
»Ja, das will ich. Oder kannst du mir noch einen einzigen Fall nennen, in dem ein normaler junger Mann bei der Polizei angezeigt wurde, weil er mit einem normalen jungen und überaus bereitwilligen Mädchen ins Bett gegangen ist?«
Stanley schwieg, und Ibrahim schaute erst mich, dann ihn, dann wieder mich an.
»Warst du der erste?« fragte ich streng.
»Ich weiß nicht.«
»Warum weißt du das nicht? Das muß man doch wissen!«
»Nicht immer.«
»Wir müssen es aber wissen! Wenn es, hasweh halila4, zu einem Verhör kommt, spielt es eine entscheidende Rolle, ob das Mädchen eine minderjährige Jungfrau oder eine unjungfräuliche Minderjährige war. Also wenn du mich fragst«, sagte ich zu Stanley, »war er nicht der erste.«
»Das glaube ich auch«, sagte Stanley, »ein unberührtes Mädchen hat nicht so ohne weiteres Sex mit einem Mann, den sie kaum kennt.«
Woher wollte ausgerechnet er das wissen!
»Ich gehe jetzt zu Bonnis Eltern und spreche mit ihnen«, sagte Ibrahim entschlossen, »ich habe nichts Schlechtes getan.«
»Vielleicht ist das eine gute Idee«, meinte Stanley.
»Das ist eine Scheißidee«, rief ich, »er kann dann auch direkt zur Polizei gehen, oder glaubst du, die empfangen ihn mit Kaffee und Kuchen.«
»Dann rufe ich bei ihnen an«, erklärte Ibrahim.
Er war schon am Telefon und begann die Nummer zu wählen.
»Woher weiß er die Nummer?« fragte mich Stanley, »und warum geht dein Telefon plötzlich?«
»Stanley, ich kann dir keine der beiden Fragen beantworten.«
»Guten Abend«, sagte Ibrahim am Apparat, »hier ist Charlie, ich würde gerne …«
Ich hörte den schrillen Schrei einer Frau, dem eine Salve zischender Worte folgte. Dann knackte es in der Leitung. Ibrahim stand, den Hörer in der Hand, verwirrt da.
»Eine Furie«, stellte Stanley fest, »man muß mit dem Mann reden. Bitte, wähle die Nummer noch einmal.«
Offenbar hatte man einen zweiten Anruf erwartet, denn nach dem ersten Klingelzeichen meldete sich der Vater.
»Hier spricht Professor Robinson«, sagte Stanley mit kultivierter Stimme und einem ebenso gewinnenden wie überflüssigen Lächeln, »ich habe mir die Sache durch den Kopf gehen lassen und finde, wir sollten uns in Ruhe darüber unterhalten … Wie bitte? … Einen Moment … Ich kenne den jungen Mann seit Jahren, er ist mir damals, als ich den Herzinfarkt hatte und auf Hilfe angewiesen war, wärmstens empfohlen worden …«
»Eine ausgesprochen warme Empfehlung«, sagte ich zu mir selber und sah zu Ibrahim hinüber. Der stand da und wickelte eine Locke um den Finger. In seinem Gesicht war der betretene Ausdruck eines Schülers, der wegen schlechten Betragens mit seinem Vater vor den Schuldirektor zitiert worden war.
Stanley hatte aufgehört zu sprechen. Er lauschte mit leicht geöffnetem Mund, auch dann noch, als kein Laut mehr aus dem Hörer kam. Schließlich legte er auf. »Nichts zu machen«, sagte er, »mit so was werden wir nicht fertig. Er hat gesagt, er sei bereits auf der Polizei gewesen und die Sache nähme jetzt ihren rechtmäßigen Gang. Wir brauchen einen Anwalt. Kennst du einen, Angelika?«
»Ja, den schärfsten und unfreundlichsten von ganz Jerusalem. Wenn ich den jetzt anrufe, wird er mich entweder anschreien oder anschweigen, und eins ist so peinlich wie das andere. Na schön, versuchen wir’s.«
Zu meiner größten Erleichterung war der Anwalt in verbindlicher Stimmung. Vielleicht hatte er gerade gut gegessen – er aß sehr gerne – oder ein neues wertvolles Bild gekauft – er sammelte Bilder – oder ein Paar hübsche Mädchenbeine gesehen … was weiß ich! Auf jeden Fall schrie er nicht, noch schwieg er.
»Also, die Geschichte ist so«, sagte ich, »ich kenne einen jungen Mann …«
Er lachte.
»Der ist Araber.«
»Was heißt hier Araber? Ist er aus Saudi-Arabien oder Ägypten oder …«
»Er ist von hier.«
»Hier? Ist er ein sogenannter israelischer Araber oder ein Groß-Israel-Araber aus Judäa und Samaria?«
»Ich bitte Sie, so kommen wir nicht weiter.«
»Genau. Also bitte etwas präziser. Wenn der Mann aus den besetzten Gebieten kommt, und die beginnen einen Meter hinter deinem Haus …«
»Das stimmt nicht! Mein Haus ist noch innerhalb der Grünen Grenze.«
»Darüber können wir ein anderes Mal diskutieren. Also wenn er aus den besetzten Gebieten kommt, ist er ein Palästinenser. Weiter.«
»Er hat mit einem sechzehnjährigen Mädchen geschlafen.«
»Das ist sein gutes Recht. Möchte ich auch mal.«
»Eine amerikanische Jüdin. Und deren Vater hat ihn bei der Polizei angezeigt.«
»Dann sieh zu, daß der junge Mann der Polizei nicht in die Hände fällt. Es könnte ihn einen Schädelbruch und einige Jahre Gefängnis kosten. Sex mit einer Minderjährigen ist gleich Vergewaltigung, auch wenn sie ihn vergewaltigt hat. Und wenn ein Palästinenser eine minderjährige Jüdin vergewaltigt, dann gnade ihm Allah.«
»Sehr beruhigend.«
»Ich bin kein Psychiater, sondern Anwalt. Ich kenne die Gesetze dieses Landes, den Rassismus unseres auserwählten Volkes im allgemeinen und den der Polizei im besonderen. Der junge Mann muß verschwinden, so schnell und so weit wie möglich. Ich gebe dir die Nummer eines Anwalts, der sich mit solchen Fällen befaßt. Er arbeitet mit arabischen – israelisch-arabischen – Anwälten zusammen. Beruf dich auf mich. Also, schreib dir die Nummer auf …«
»Was hat er gesagt?« fragte Stanley und kaute sichtbar an einem Brocken Käse.
Ibrahim sah mich gespannt an. Ich lächelte ihm zu – jedenfalls sollte es ein Lächeln sein.
»Mein Bekannter ist kein Strafverteidiger«, sagte ich, »aber er hat mir die Nummer von einem gegeben, der in solchen Fällen Bescheid weiß. Du kannst ihn jederzeit anrufen … Himmel, habe ich Durst. Ibrahim, kannst du mir ein Glas ganz kaltes Wasser bringen?«
Froh, etwas für mich tun zu können, trabte er in die Küche. »Die Geschichte sieht miserabel aus«, flüsterte ich, »Ibrahim muß verschwinden. Heute nacht schläft er bei mir. Ich fahr’ dich gleich nach Hause, damit du den Anwalt anrufen kannst.«
»Wird dir das nicht alles zuviel?« fragte Stanley mit einem neuen Anflug närrischer Eifersucht. »Ibrahim könnte auch bei meinem Freund Arnold schlafen.«
»Arnold! Du hast mir doch erzählt, daß der unter Depressionen und einer kranken Blase leidet und gegen das eine Lithium schluckt und gegen das andere zwei Kilo Sonnenblumenkerne pro Tag kaut. Willst du, daß sich Ibrahim umbringt?«
Stanley sah mich mit tiefem Vorwurf an.
»Das Wasser ist immer noch nicht richtig kalt«, rief Ibrahim.
»Macht nichts«, rief ich zurück, »dafür sind’s jetzt meine Füße.«