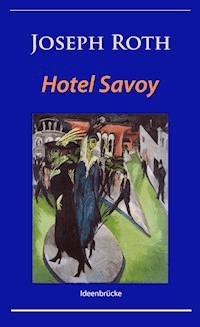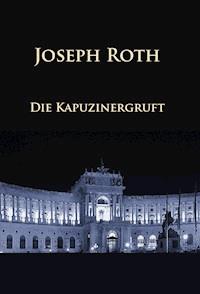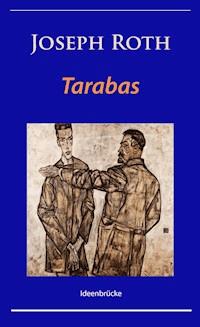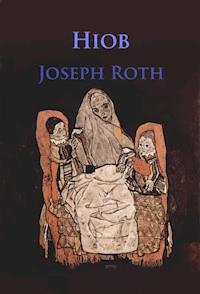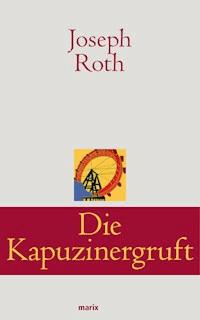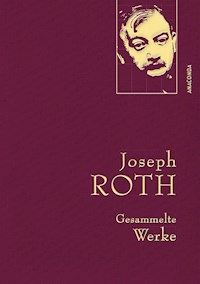1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Joseph Roths "Die Legende vom heiligen Trinker und andere Erzählungen" präsentiert eine faszinierende Sammlung von Erzählungen, die in einem subtilen, oft melancholischen Ton verfasst sind. Roth, ein Meister der frühen Moderne, erkundet Themen wie Verzweiflung, Transzendenz und das Streben nach Menschlichkeit in einer Welt des Wandels. Die titelgebende Erzählung entfaltet die Geschichte eines obdachlosen Trinkers, dessen unerwartete Begegnung mit einem mysteriösen Fremden sein Schicksal verändert und dabei grundlegende Fragen zu Glauben und Erlösung aufwirft. In einem lyrischen Stil, der oft mit eindringlichen Bildern und einer tiefen psychologischen Einsicht angereichert ist, schafft Roth eine Atmosphäre, die den Leser in die Seelenlandschaften seiner Protagonisten hineinzieht. Joseph Roth (1894-1939) war ein bedeutender österreichischer Schriftsteller jüdischer Herkunft, der in den turbulenten Zeiten zwischen den beiden Weltkriegen lebte. Seine eigene Biographie, die von Exil, Verlust und dem Aufeinandertreffen mit der europäischen Identität geprägt war, beeinflusste sein literarisches Schaffen maßgeblich. Roths Werk reflektiert die Haltungen und Schicksale seiner Zeitgenossen, und seine persönlichen Erfahrungen, insbesondere die seiner emigrierten Heimat, verleihen seinen Erzählungen eine tiefere emotionale Resonanz. "Die Legende vom heiligen Trinker und andere Erzählungen" ist nicht nur eine literarische Entdeckung, sondern auch eine Einladung, über das menschliche Dasein nachzudenken. Leser, die an der Komplexität menschlicher Emotionen und den Herausforderungen der Existenz interessiert sind, werden von Roths feinsinnigen Beobachtungen und seiner Fähigkeit, das Poetische im Alltäglichen zu erfassen, gefesselt sein. Dieses Buch ist ein Muss für alle, die die tiefgründige und oft melancholische Welt eines der größten Erzähler des 20. Jahrhunderts erkunden möchten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Die Legende vom heiligen Trinker und andere Erzählungen
Inhaltsverzeichnis
Die Geschichte einer Liebe
Die Aprilnacht, in der ich ankam, war wolkenschwer und regenschwanger. Die silbernen Schattenrisse der Stadt strebten aus losem Nebel zart, kühn, fast singend gegen den Himmel. Fein und dünngelenkig kletterte ein gotisches Türmchen in die Wolken. Die dottergelbe Scheibe der erleuchteten Rathausuhr hing, wie an einem unsichtbaren Seil, in der Luft. Um den Bahnhof roch es süß und trunken nach Steinkohle, Jasmin und atmenden Wiesen.
Die einzige Droschke der Stadt wartete, gleichgültig und bestaubt, vor dem Bahnhof. Die Stadt mußte klein sein. Sie besaß gewiß eine Kirche, ein Rathaus, einen Brunnen, einen Bürgermeister, eine Droschke. Das Pferd war braun, breithufig, trug rötliche Zottelmanschetten über den Fußgelenken und hatte keine Scheuklappen. Seine Augen glotzten groß und wohlwollend auf den Platz. Wenn es wieherte, neigte es den Kopf seitwärts, wie ein Mensch, der sich zum Niesen anschickt.
Ich stieg in die Droschke und überholte auf der Landstraße alle wackelnden Hutschachteln und schwankenden Koffer mit den daran hängenden Menschen. Ich hörte, was die Leute einander sagten, und fühlte die Armut ihrer Schicksale, die Kleinheit ihres Erlebens, die Enge und Gewichtlosigkeit ihrer Schmerzen. Über die Felder zu beiden Seiten der Straße ergoß sich Nebel, wie geschmolzenes Blei, und täuschte Meer und Grenzenlosigkeit vor. Deshalb waren die Hutschachteln, die Menschen, die Reden, die Droschke so gering und lächerlich. Ich glaubte wirklich an das Meer zu beiden Seiten und wunderte mich über seine Stille. Es ist vielleicht gestorben, dachte ich. Der Schornstein einer Fabrik, der plötzlich neben einem weißen Häuserwinkel aufstieg, beängstigend trotz seiner Schlankheit, sah aus wie ein erloschener Leuchtturm.
Zufällige Menschen lagerten am Wegrand: Vorhuten der Stadt. Sie waren zutraulich und aufrichtig, ich konnte sehen, was in ihnen vorging: Eine Mutter wusch ihr Kind in einem Faßeimer. Das Gefäß trug einen blanken und grausamen Blechgürtel, und das Kind schrie. – Ein Mann saß in seinem Bett und ließ sich von einem Jungen einen Stiefel ausziehn. Der Junge hatte ein rotes, angestrengt-aufgedunsenes Gesicht, und der Stiefel war schmutzig. – Eine alte Frau kehrte mit einem Besen auf den Dielen der Stube herum, und ich ahnte ihre nächste Tätigkeit: sie würde jetzt das blaurote Tischtuch zusammenraffen, zum Fenster oder zur Tür gehen und die Speisereste in den kleinen Garten schütten.
Ich hatte Mitleid mit dem Kind im Faßeimer, dem stiefelziehenden Jungen, den Speiseresten. Alte Frauen, die in der Nacht aufräumen, müssen schlecht sein. Meine Großmutter, die wie ein Hund aussah, kehrte immer in der Nacht mit dem Besen auf den Dielen umher. Ich war sehr klein, haßte die Großmutter und den Besen und liebte Papierschnitzel, Zigarrenstummel und allerlei Abfälle. Ich rettete alles, was auf dem Fußboden lag, vor dem Besen der Großmutter in meine Taschen. Ich liebte besonders Strohhalme. Von allen Dingen waren sie am meisten lebendig. Manchmal, wenn es regnete, sah ich zum Fenster hinaus. Auf den Wellen einer der unzähligen Regenbächlein schwamm, tänzelte, drehte sich kokett und unbekümmert ein Strohhälmchen und ahnte nichts von dem Kanalschacht, dem es zutrieb, in dem es verschwinden würde. Ich rannte auf die Straße, der Regen war schwer und wütend, er peitschte mich, aber ich lief, den Strohhalm retten, und erreichte ihn knapp vor dem Kanalgitter.
Viele Leute sah ich in der Nacht. In dieser Stadt gingen die Menschen vielleicht so spät schlafen, oder war es der April und die Erwartung, die in der Luft lag, daß alles Lebende wach bleiben mußte? Alle, die mir entgegenkamen, hatten irgendeine Bedeutung. Sie trugen Schicksale, waren selbst Schicksale; sie waren glücklich oder unglücklich, keineswegs gleichgültig und zufällig; oder sie waren zumindest betrunken. In kleinen Städten sind nachts keine zufälligen Menschen auf der Straße. Nur Liebhaber, oder Straßenmädchen, oder Nachtwächter, oder Wahnsinnige, oder Dichter. Die Zufälligen und Gleichgültigen sind sicher zu Hause.
In der Mitte des Marktplatzes stand der Gründer der Stadt, ein steinerner Bischof, als gäbe er acht. So mittendrin ist er und so wichtig. Ich glaube, die Leute hielten ihn für tot und erledigt. Sie gingen an ihm vorbei und grüßten nicht; sie hätten sich nicht gescheut, Geheimstes in seiner Nähe zu sagen oder auch ein Verbrechen zu begehen. Wozu hielten sie ihn überhaupt noch?
Mir tat der Bischof leid, der sich gewiß so geplagt hatte, als er die Stadt gründete. Er trug einen verkniffenen Zug um den Mund und sah ganz so aus wie jemand, der die Undankbarkeit der Welt kennengelernt hat. Ich versprach ihm in jener Nacht, fleißig in der Geschichte über ihn nachzulesen. Aber ich kam nie dazu. Denn auch in dieser kleinen Stadt hatten die lebenden Menschen Geschichten, die mir in den Weg liefen, mich umstellten und einspannten. Und übrigens war es Frühling, und ich mag in solcher Jahreszeit keine Bischöfe und keine Gründer.
Ich wußte schon am nächsten Morgen ein paar Geschichten.
Ich wußte, daß der Briefträger erst seit einigen Tagen hinke und keineswegs von Geburt lahm sei. Er trank selten, zweimal im Jahr: an seinem Geburtstag, das war der fünfzehnte April, und am Todestag seines Sohnes, der in der großen Stadt durch Selbstmord geendet hatte. Der Rausch war nachhaltig, und der Briefträger taumelte drei Tage zwischen den Mauern des Städtchens herum, ehe er nüchtern wurde. An diesen drei Tagen bekamen die Leute dieser Stadt keinen Brief. Der Verkehr mit der Außenwelt stockte.
Vor einer Woche, am fünfzehnten April, war der Briefträger in seinem Rausch gestürzt und hatte sich ein Bein verrenkt. Davon kam sein Hinken.
Das war nicht die einzige Geschichte.
In dem Hotel, in dem ich schlief, roch es nach Naphthalin, Moschus und alten Kränzen. Der große Speisesaal hinter dem Schankladen war niedrig, die Decke gewölbt, und die Wände trugen viereckige braunhölzerne Pflästerchen mit Sprüchen. Anna, das Mädchen, stützte den rechten Arm auf das Fensterbrett und gab acht, daß die Krüge nicht leer wurden. Sie wurden nie leer. Denn die Leute tranken hier sehr viel Wein und klapperten mit den Krugdeckeln, wenn Anna nicht aufpaßte.
Anna war damals siebenundzwanzig Jahre alt und blond und glatt gekämmt. Sie sah immer so aus, als wäre sie vor einer Weile aus dem Wasser gestiegen. So straff und blank war ihr Gesicht und so frisch und streng und feuchtblond zogen sich ihre gestrählten Haarsträhnen aus der Stirne.
Sie hatte schlanke, kräftige, aber schüchterne Hände, von denen ich immer glaubte, daß sie sich schämen.
Anna stammte aus Böhmen und liebte den Ingenieur. Der Ingenieur war der Betriebsleiter jener Fabrik, in der Annas Vater arbeitete. Anna hatte ein Kind von dem Ingenieur.
Der Ingenieur hatte geheiratet und Anna Geld gegeben fürs Kind und für die Reise. So war Anna Kellnerin in dem kleinen Städtchen.
Ich trat einmal zufällig in Annas Zimmer und sah die Photographie ihres Kindes. Es war ein schönes Kind, es griff mit runden Fäusten in die Luft und trank die Welt mit großen Augen.
Anna war schweigsam und erzählte ihre Geschichte sehr kurz.
Ich mag Ingenieure dieser Art nicht und liebte Anna.
»Sie lieben ihn immer noch?« fragte ich Anna.
»Ja!« sagte sie. Sie sagte es so selbstverständlich und trocken, wie irgendeine geschäftliche Auskunft.
In dem Städtchen gab es ein Kinotheater. Der Besitzer war ein jüdischer Tuchwarenhändler. Er hatte ein Kino gegründet, weil er tüchtig und betriebsam war und es ihn schmerzte, daß er einen ganzen Sonntag nichts zu tun haben sollte. Er verkaufte daher an Wochentagen Tuchwaren und ließ Sonntag im Kino spielen.
Ins Kino ging ich mit Anna.
Im Städtchen gab es eine Bibliothek. Der junge Mann, der Besucher zu bedienen und, wenn niemand da war, Staub aufzuwischen hatte, war blaß, romantisch blaß und dünn, wie ein auferstandener Dichter, und hatte eine blond-gelbe Schopflohe, die von seinem Kopf gegen den Suffit flackerte. Er stand immer auf einer Doppelleiter, er spazierte mit der Doppelleiter hinter dem Ladentisch herum, er konnte es vortrefflich, besser als jeder Zimmermaler. Als hätte er überhaupt nur auf Doppelleitern gehen gelernt. Die Leihbibliothek hatte auch alte, gute Bücher, und ich ging mit Anna in die Leihbibliothek.
Anna freute sich sehr.
Manchmal wußte ich, daß Anna zärtlich sein könnte. Ich liebte die Frauen, deren Güte wie ein verschütteter Quell, unsichtbar, fruchtlos, aber unermüdlich, jedesmal gegen die Oberfläche anströmt und weil ein Ausweg nicht möglich, nach der Tiefe gedrängt, verborgene Schächte gräbt und gräbt, bis zum Versiegen. Ich liebte Anna. Ich konnte ihren Reichtum nicht lassen. Sie wußte nicht, wieviel ihr verlorenging, wenn sie so daherschritt, rückwärts lebend, jede andere Sehnsucht ausschaltete und nur die nach Vergangenem trug und pflegte.
Ich habe noch nicht vom Park erzählt, in dem die Liebe dieser Stadt blühte. Der Goldregen wucherte leichtsinnig und liederlich zwischen Linden und Kastanien. Die Bänke standen nicht in den Alleen, sondern mitten auf den Beeten. Ich dachte, diese Bänke hätte der Bischof, als sie noch ganz jung waren, in die Erde gepflanzt und sie wuchsen immer jedes Jahr um ein Stückchen in die Breite. Die Füße hatten sicherlich schon Wurzel gefaßt im lockeren Boden.
Am Sonntag, nach dem Kino, ging ich mit Anna in den Park.
Einmal sahen wir, wie zwei sich küßten, und Anna lachte.
»Es ist nicht gut, Anna«, sagte ich, »über die Liebe zu lachen. Ich mag Menschen nicht, die so lügen können.«
Da hörte Anna zu lachen auf.
Als wir nach Haus kamen, erwies es sich, daß der Wirt Anna gesucht hatte, denn es war ein Gast gekommen. Er hatte einen knarrenden, neuen Lederkoffer mit vielen grünen und roten Heftpflästerchen. Er war schwarzgelockt und glutäugig, und er konnte gewiß Mandoline spielen und Mädchen verführen. Hätte ich in seine Brieftasche einen Blick tun können, so hätte ich eine ganze Sammlung bunter Schleifen und blonder Haare und rosa Liebesbriefe gesehn. Aber ich kam nicht dazu und wußte es auch so.
Er trank Bier in der Wirtsstube. Das Bier paßte nicht zu seinem Gesicht, er hätte Wein trinken müssen. Er ließ sich von Anna bedienen und war sehr höflich. Er sprach lauter Schnörkel. Seine Worte sehen aus, wie seine Unterschrift wahrscheinlich, dachte ich.
In dieser Nacht bemerkte ich, daß mein Licht fehlte. Ich machte die Tür auf und ging zu Anna in die Stube. Anna war im Hemd und weinte. Sie blieb auf ihrem Bett sitzen und erschrak nicht, als ich kam, sondern weinte ruhig und mit Ausdauer weiter.
Dann sagte sie: »Er sieht genauso aus!«
Der neue Gast sah genauso aus, wie Annas Ingenieur.
»Es ist so schrecklich!« sagte Anna.
Seit damals liebten wir uns und verbargen es nicht voreinander. Anna konnte sehr zärtlich sein und eifersüchtig auch. Aber ich kümmerte mich nicht um die Frauen. Die Frauen dieser Stadt gefielen mir gar nicht.
Nur, wenn ich sah, wie sie an goldumrahmten Frühlingsabenden über die Felder wanderten, ein Paar ums andere, rührten sie mich. Sie waren dazu da, die Welt zu erneuern. Sie wuchsen, liebten und gebaren. Im Frühling begannen sie ihr mütterliches Werk und vollendeten es im Laufe der Jahre. Ich sah, wie sie, berauscht und mit Appetit auf Rausch, harmlos und beflissen, Gottes Gebot zu erfüllen, wie Maikäfer in die Wälder ausschwärmten.
Spät in der Nacht noch standen sie in den dunklen Hausfluren, klebten sie an den Lippen und Schnurrbärten der Männer, kicherten und waren dankbar bis zur Demut für jedes gute Wort, das man ihnen in den Schoß warf. Schön waren die Nächte, in denen die Grillen und die Mädchen unermüdlich zirpten.
Und die Regentage auch.
Die Mädchen standen in den Fenstern und lasen in Büchern aus der Leihbücherei und aßen Butterbrot. Ein Regenschirm schwankte durch die Gasse und überdachte den zierlichen dünnen Notariatsschreiber. Er sah aus, wie eine aufrecht gehende Heuschrecke.
Strohhalme tänzelten, wirbelten, drehten sich kokett und schwammen ahnungslos dem Verderben der Kanalgitter zu. Ich lief nicht mehr, sie aufzuhalten. Immer dachte ich, daß ich es doch tun müßte. Der Regen, die Harmlosigkeit des Strohhalms, das Kanalgitter und ich gehörten zusammen. Vielleicht war auch noch der Notariatsschreiber dabei. Der Regentag war grau schraffiert, der Strohhalm ertrank, das Kanalgitter verschluckte ihn, der Notariatsschreiber stocherte, schirmüberdacht, durch die Gasse. Und ich hätte eigentlich laufen müssen, den Strohhalm retten. Jedes in der Welt hatte seine Aufgabe.
Sehr früh am Morgen stand ich täglich auf. Anna schlief noch, und der Wirt und der zweite Gast. Die Stiefel der Hausbewohner standen, noch nicht gereinigt, ein Stück Gestern, vor den Türen. Im Hof pendelte der Pudel, gähnte und suchte nach vergessenen Knochen unter der Hoteldroschke, die, unbespannt, mit einer zwecklosen Deichsel, vor dem Schuppen wartete, wie ein ausgegrabenes Gefährt. Jakob, der Kutscher, schnarchte im Schuppenbau, brünstig und stark; er schnarchte einen Hymnus auf Natur und Gesundheit. Es war gar nicht lächerlich, sein Schnarchen. Es klang selbstverständlich und machtvoll; ein Naturlaut, ein verhülltes Donnerrollen, ein Hirschröhren. Um fünf Uhr erhob sich ferne, und wie aus übersinnlichen Welten heranschwellend, das klagende Tuten der Dampfmühle und weckte Jakob, den Kutscher. Er mußte in den Kleidern geschlafen haben, denn er kam, gleichzeitig mit dem letzten verzitterten Oberton der Mühlensirene, in seiner großkarierten Ärmelweste, in Hosen und bestiefelt, barhaupt, mit einem zerknitterten Pergamentgesicht, sprudelte aus trichtergeformtem Munde Wasser auf seine gekrümmten Handflächen und rieb sich Stirn und Augen. Dann ging er quer über den Hof ins Haus, schwer und mühevoll, als müßte er jedes Bein, wie einen Baum mit Wurzeln, aus der Erde ziehn.
An der ersten Straßenbiegung klinkte Käthe ihr Fenster auf und sah hinunter in die Stadt. Ich grüßte Käthe immer. Ich hatte noch nie mit ihr gesprochen, ich hatte gar nichts mit ihr zu sprechen, ich grüßte sie nur, weil sie aus dem Fenster sah und weil die Welt so früh am Morgen noch nicht konventionell war, sondern einfach, wie in den ersten Tagen ihrer Kindheit, ein paar Jahre nach der Erschaffung, als noch im ganzen zwanzig Menschen sie belebten und alle zwanzig freundlich und gut miteinander waren. Später, wenn ich heimkehrte, war's Mittag bereits, die Welt um alle Jahrtausende älter und ich grüßte nicht mehr, weil es sich nicht schickte, in einer so fortgeschrittenen Welt ein Mädchen zu grüßen, mit dem man noch nie gesprochen.
Durch den Park knirschte ein rundbäuchiger Spritzwagen, Rasen und Beete berieselnd. Eine Amsel sprang mit Gassenbubengebärden neben dem Wagen her und schlug mit dem linken Flügel gegen die zerstäubenden Wassertropfen. Unsichtbar lärmte irgendwo oben ein ganzes, in die Ferien geschicktes Lerchenpensionat. Rund um die Bänke, die in der Mitte der Beete standen, war das Gras ein wenig müde und hergenommen von der nächtlichen Liebe der Menschen. Und mir entgegen schritt der lange Eisenbahnassistent durch den Park in den Dienst.
Den Eisenbahnassistenten haßte ich. Er war sommersprossig, unglaublich lang und gerade. Ich dachte, sooft ich ihn sah, an einen Brief an den Eisenbahnminister. Ich wollte vorschlagen, den häßlichen Eisenbahnassistenten als Telegraphenstange unterwegs irgendwo, zwischen zwei kleinen Stationen, zu verwenden. Nie hätte mir der Eisenbahnminister diesen Dienst erwiesen.
Ich wußte nicht, warum ich den Beamten so haßte. Er war außergewöhnlich groß gewachsen, aber ich hasse ja nicht grundsätzlich das Außergewöhnliche. Mir schien, daß der Eisenbahnassistent mit Absicht so hoch hinaufgeschossen sei, und das reizte mich auf. Mir schien, als hätte er seit seiner Jugend nichts anderes getan, als wachsen und Sommersprossen sammeln. Und außerdem hatte er rötliche Haare.
Auch trug er immer seine Uniform und eine rote Kappe. Er machte langsame und kleine Schritte, obwohl er mit seinen langen Beinen ganz gut rasch hätte gehen können. Aber er ging langsam und wuchs, wuchs, wuchs.
Ich weiß noch heute sehr wenig über den Eisenbahnbeamten. Aber ich hätte damals schon schwören können, daß er viele versteckte Gemeinheiten begangen habe.
Solch ein Eisenbahnassistent konnte zum Beispiel einen Zug, in dem sein persönlicher Feind saß, zu einem Zusammenstoß bringen und die Schuld geschickt auf den Zugführer schieben. Es war eigentlich sehr gefährlich, mit der Eisenbahn zu fahren.
Solch ein Eisenbahnassistent, dachte ich, ist niemals imstande, einer Frau wegen auf seine rote Kappe zu verzichten. Wenn er liebte, so legte er bestimmt die Kappe mit der Öffnung nach oben sorgsam auf einen Stuhl. Er vergaß nicht, die Hose im Bug zusammenzufalten und verstand gewiß nicht die Lust, einer Frau dankbar zu sein. Er konnte auch Frauen durch eine List überrumpeln. Und eifersüchtig war er auch.
Sooft ich ihn sah, dachte ich über einen Brief an alle Frauen der Welt: Frauen! Hütet euch vor dem Eisenbahnassistenten!
Anna mochte den Eisenbahnassistenten auch nicht. Anna fragte: »Warum hasse ich ihn?«
Ich wußte nicht, wie ich Anna antworten sollte, und erzählte ihr die Geschichte von Abel, meinem Freund, und der Frau seines Lebens.
Abel, mein Freund, sehnte sich nach New York. Abel war Maler, Karikaturist. Er hatte bereits karikiert, als er noch nicht einen Bleistift halten konnte. Er achtete die Schönheit gering und liebte Krüppelei und Verzerrtheit. Er konnte keinen geraden Strich zustande bringen.
Abel achtete die Frauen gering. Männer lieben in einer Frau die Vollkommenheit, die sie zu sehen sich einbilden. Abel aber leugnete die Vollkommenheit.
Er selbst war häßlich, so daß ihn die Frauen liebhatten. Frauen vermuten Vollkommenheit oder Größe hinter männlicher Häßlichkeit.
Einmal gelang es ihm, nach New York zu fahren. Auf dem Schiff sah er zum erstenmal in seinem Leben eine schöne Frau.
Als er im Hafen landete, verschwand ihm die schöne Frau aus den Augen. Da kehrte er mit dem nächsten Schiff nach Europa zurück.
Anna konnte den Zusammenhang zwischen Abel, meinem Freund, und dem langen Eisenbahnassistenten nicht begreifen.
»Warum erzählst du mir von Abel?« fragte sie.
»Anna«, sagte ich, »alle Geschichten hängen zusammen. Weil sie einander ähnlich sind oder weil jede das Entgegengesetzte beweist. Zwischen dem langen Eisenbahnassistenten und meinem Freund Abel ist ein Unterschied. Ein sehr banaler Unterschied: Abel, mein Freund, geht zugrunde, aber der Eisenbahnassistent wird leben und Stationsvorstand werden. Abel, mein Freund, hat eine Sehnsucht. Nie wird der Eisenbahnassistent eine andere Sehnsucht haben, als die, Stationsvorsteher zu werden. Abel, mein Freund, lief aus New York fort, weil er die Frau seines Lebens aus den Augen verloren hatte. Nie wird der Eisenbahnassistent einer Frau wegen aus New York fortlaufen.«
Ich war überzeugt, daß Anna nun den Zusammenhang verstehe. Anna aber umarmte mich und fragte: »Würdest du meinetwegen aus New York weglaufen?«
In dieser Nacht liebte ich Anna sehr, weil ich wußte, daß ich ihretwegen nie aus New York weglaufen würde. Ich fürchtete, es ihr zu sagen, und liebte sie dafür. Ich war feige und führte mich sehr männlich auf. Anna verstand mich aber und weinte. Jetzt sehe ich aus wie der Ingenieur, dachte ich. Am Morgen schlief Anna, als ich fortging. Sie fühlte, daß ich aufgestanden war, und suchte, schlafend noch, mit schwachen Armen in der Leere herum.
Es regnete, deshalb ging ich ins Kaffeehaus.
Der Kellner trug einen zerknitterten Frack und eine schwere Juchtenledertasche an der rechten Hüfte. Er hieß Ignatz, und jeder nannte ihn so. Er hatte keinen andern Namen. Nur ich sagte: Herr Ober!
Ignatz hatte Tag und Nacht Dienst. Er schlief auf zwei Stühlen im Kaffeehaus, und davon kam der zerknitterte Frack. Die Geldtasche schnallte er niemals ab. Er war an beiden Seiten etwas plattgedrückt, wie ein Fisch. Seine Arme hingen, wie bekleidete Rückenflossen, schlaff hinunter. Und außerdem hatte er große, graugrüne Fischaugen und kalte, feuchte Hände. Er wischte sie immer an der Ledertasche ab.
Ich mochte Ignatz nicht, denn er wollte kein Kellner sein. Er las alle Zeitungen und sprach mit den Gästen von Politik. Er wollte lieber Politiker sein.
Aber er blieb doch Kellner und war unzufrieden.
Er sah immer so aus, als gäbe er den Gästen die Schuld an seiner verpfuschten Karriere.
Er nahm Trinkgelder und dankte sehr kühl.
Einmal kam ich mit Anna ins Kaffeehaus und Ignatz sagte: »Wie geht es, Fräulein Anna?« und wischte sich die rechte Hand an der Ledertasche ab, um Anna mit einer trockenen Hand zu begrüßen. »Wie geht's Ihnen, Ignatz?« fragte Anna und gab ihm die Hand.
Weil Ignatz die Hand zu lange behielt, sagte ich: »Herr Ober!« Da grüßte Ignatz und ging.
Im Kaffeehaus hing ein großer Wandkalender.
Jeden Morgen um acht Uhr kam der Postdirektor, ein alter Herr mit weißem Backenbart. Der Postdirektor ging sehr aufrecht und hatte überlange Hosen an und Sporen an den Stiefelabsätzen, vielleicht, um den Hosenrand zu schonen. Er hatte gewiß bei der Artillerie gedient.
Der Postdirektor hatte so unwahrscheinlich tiefblaue, gute Augen, daß ich glaubte, er hätte sie bei einem Optiker eigens für sich machen lassen. Auch sein Backenbart war so märchenhaft weiß. Der Postdirektor puderte seinen Backenbart vielleicht, jeden Morgen, oder vor dem Schlafengehen.
Jeden Morgen riß der Herr Postdirektor einen Zettel vom Wandkalender im Kaffeehaus ab. Ignatz hätte das ganze Jahr den ersten Januar sein lassen. Aber der Postdirektor achtete darauf, daß jeder Tag seinen Namen und seine Nummer habe.
Ich liebte den Postdirektor.
Der Park, in dem die Liebe blühte, lag nicht in der Mitte, sondern am Ende der Stadt. Er lief hinaus in die Wiesenwege.
Am Ausgang war ein Gasthaus, in dem ich Nachtmahl aß.
Gegenüber war die Postdirektion.
Die Post war ein neues Gebäude, in einem schneeweißen Kalkgewande; es trug ein Wappen an der Stirn und am doppelflügeligen grünen Haustor ein rundes Posthorn. Die Post war das einzige Haus mit zwei Stockwerken in dem Städtchen.
Im zweiten Stockwerk wohnte der Herr Postdirektor.