
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Landor-Miriell-Serie
- Sprache: Deutsch
In einer Bibliothek entdeckt der junge Königssohn Landor ein altes Buch, das seine Abenteuerlust weckt. Mithilfe dieses Buchs begeht er einen Weg, welcher ihn in eine Welt voller Magie führt. Dort lernt er, dass das Leben nicht in Schwarz und Weiß eingeteilt werden kann, obwohl ihn sein strenger Vater so erzogen hat. Schnell stellt Landor fest, dass die magische Welt durch die finstere Kraft des Feuers bedroht wird. Zusammen mit seinen neuen Freunden muss Landor knifflige Rätsel lösen und gegen furchterregende Kreaturen kämpfen, um den finsteren Kräften zu trotzen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 480
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Missgunst und Hass werden durch Liebe gebannt, ob Drache oder Schmetterling, ich reich dir die Hand.
Für meinen Sohn Felian
Inhaltsverzeichnis
KAPITEL 1: Die drei Geschlechter
KAPITEL 2: Aufbruch in ein neues Abenteuer
KAPITEL 3: Der irreführende Wald
KAPITEL 4: Die Begegnung mit einem Geist
KAPITEL 5: Die drei Kreise des Waldes
KAPITEL 6: Die Gier des Drachenkönigs
KAPITEL 7: Der Beginn des Zerfalls
KAPITEL 8: Die Blume der ersten Erinnerung
KAPITEL 9: Der Sog eines düsteren Reichs
KAPITEL 10: Die Spinnenschwestern Saphira und Samara
KAPITEL 11: Der See des Spinnenkönigreichs
KAPITEL 12: Der Ursprung des Nebels
KAPITEL 13: Auf in Richtung Drachenberge
KAPITEL 14: Das Reich der Erzdrachen
KAPITEL 15: Gestatten, Reziell mein Name
KAPITEL 16: Ein weissagender Traum
KAPITEL 17: Die Militärstadt Satar
KAPITEL 18: Eine unerwartete Fügung
KAPITEL 1
Die drei Geschlechter
In einem längst vergessenen und von Legenden umranktem Land trägt der Wind eine Geschichte in seinen Flügeln. Ob der Ort existiert, existiert hat oder überhaupt existieren wird, kann nicht gesagt werden. Jene Geschichte ist so stark in Vergessenheit geraten, dass wir ebenso nicht mehr wissen, ob sie vor, nach oder während unserer Zeit stattgefunden hat. In dieser Erzählung lebten drei Geschlechter. Das Geschlecht der Menschen, der Schmetterlinge und der Drachen. Es war ein voneinander abgegrenztes Leben – ein Leben, welches frei von Verflechtungen der Geschlechter war. Durch Geschichten, welche sich die Menschen, Schmetterlinge und Drachen in ihrem Kreis erzählten. Durch Gerüchte, welche im Verlauf der Zeit keimten. Und durch Mythen, die im Laufe der Jahre entstanden, fruchtete der Gedanke, dass die anderen Geschlechter existierten, auch wenn man von ihrer Gegenwart nichts zu spüren vermochte.
Die Drachen lebten in einer wolkenhohen Berglandschaft, die durch vulkanische Aktivität gezeichnet war. Diese Landschaft war kahl und trist. Romantische Bergflüsse, bunt blühende Blumen und farbenfrohe Wiesen suchte man vergebens. In den riesigen Bergen waren viele tief gehende Höhlen, welche den Drachen ein Zuhause boten. Über die Jahre hinweg gruben sich die Drachen von Höhle zu Höhle, um somit ein vollständig vernetztes Tunnelsystem zu erschaffen. Dieses Tunnelsystem ermöglichte es den Drachen, dass sie sich unterirdisch zwischen einigen Höhlen hin und her bewegen konnten. Aufgrund ihrer Größe waren die Tunnel entsprechend riesig. Von ihrer Schwanzspitze bis zum Kopf wurden sie annähernd acht Meter lang und bei angelegten Flügeln knapp fünf Meter breit. Im Stand erreichten diese Wesen eine Höhe von vier Metern. Die Vielfalt der Tiere und Pflanzen kam der kargen Berglandschaft gleich. Angriffslustige Bergbären, welche nur den Appetit der Drachen fürchten mussten, trugen ihren Teil zum Erhalt der geringen Tierpopulation bei. Eisige Winde und tiefschwarze Nächte waren alltäglich. Nur an ganz wenigen Tagen schaffte es die Sonne Wärme in das Leben der Drachen zu bringen, wenngleich sie diese wenigen Tage in ihrem Reich unter den Bergen ausharrten. Temperaturen im mittleren zweistelligen Bereich waren am Fuß der Berge typisch. Je höher die Berge ragten, desto kühler und verschneiter wurde das Wetter. Das störte die Drachen jedoch wenig, da sie aufgrund ihrer starken, ledrigen Haut kälteunempfindlich waren. Zudem waren die Tunnel sowie die Höhlen durch Feuerstellen erwärmt, welche die Drachen durch die Fähigkeit des Feuerspeiens jederzeit entfachen konnten. Die Drachen waren grundsätzlich ein hitziges, männliches Volk. Viele kleine Unstimmigkeiten uferten schnell in kräftemessenden Kämpfen aus. Gefühlskälte, Missgunst und Hass vergifteten ihre Herzen von Generation zu Generation. So war es auch nicht verwunderlich, dass das Leben der Drachen untereinander einer Tyrannei gleichkam. Beherrscht und regiert von dem Ersten ihrer Art, dem Drachenkönig, mussten sie sich an Regeln halten, die er festgelegt hatte. Um seinen Untertanen die Gesetze begreiflich zu machen, lehrte er den anderen Drachen eine Sprache, welche so klingt, als würden Menschen permanent rückwärts sprechen. Neben den Gesetzen bestimmte er ebenfalls allein über das Leben und den Tod. Der Tod war mit dem Leben der Drachen beispiellos verknüpft. So musste ihr König einen Drachen verschlingen, damit neues Leben in die Welt der Drachen geboren werden konnte. Nachdem der Drachenkönig einen seiner Art verschlungen hatte, würgte er einige Tage später zwei Eier aus seinem Magen hinauf und spuckte sie aus seinem riesigen Maul. Aus diesen Eiern schlüpften jedes Mal zwei Drachenbabys. Diese Fortpflanzung erfolgte einmal im Jahr. Bedingt durch das natürliche Sterben der Drachen und durch tödliche Konflikte untereinander, war die Anzahl der lebenden Drachen sehr gering. Über die Jahre hinweg lebten nie mehr als 100 Drachen in den Drachenbergen. Keiner kam der Stärke und Größe des Drachenkönigs gleich, sodass er seit Beginn der Zeit auch niemanden fürchten musste, der ihm seinen Thron streitig machte. Auch das Alter vermochte das Oberhaupt der Drachen nicht schwächer oder gar gebrechlicher zu machen. Aus diesem Grund fruchtete im Reich der Drachen der Mythos, dass ihr König mit der Gabe der Unsterblichkeit gesegnet wurde.
Das Geschlecht der Schmetterlinge lebte hingegen in einem nahezu unendlich groß wirkenden Wald. Ein Wald, der im Dickicht seiner Bäume weite Wiesen freigab, auf denen die friedliebenden Wesen spielend den ganzen Tag verbringen oder dösen konnten. Ein Wald, der immergrün und durch die farbenfrohesten Blumen geschmückt war. Ein Wald, der nicht nur den Schmetterlingen Obdach bot, sondern auch Raupen, Käfern, Spinnen, Rehen und vielen anderen Tieren, die in harmonischem Einklang lebten. Außergewöhnlich war, dass männliche Geschöpfe nicht existierten. Es war ein Volk, das lediglich aus weiblichen Wesen bestand und obwohl es keine männlichen gab, konnten sie sich trotzdem vermehren. Durch die unendliche Liebe zur Natur gebaren die Schmetterlinge ihren Nachwuchs aus reinstem Herzen und sicherten sich somit ihren Fortbestand über die Jahre hinweg. Die Schmetterlinge waren ein genügsames Volk. Sie brauchten nicht viel im Leben außer Essen und Trinken. Essen boten ihnen die verschiedensten Blumen und Bäume mit ihren zuckersüß schmeckenden Pollen sowie Früchten. Trinken bezogen sie aus den himmelblauen Bächen, die zahlreich und endlos durch ihren Wald mit glasklarem, kühlem Wasser flossen. Neben dem Geräusch der Bäche sangen Vögel liebreizende Lieder. Grillen zirpten zum Abend eine Symphonie der Entspannung. Frösche quakten im Takt. Glühwürmchen erhellten die Nacht in den buntesten Farben und die Schmetterlinge tanzten voller Glückseligkeit im Mondschein zu der Musik. Man hörte, wie sie in ihrem Wald oftmals melodisch hallende Klänge von sich gaben. Aber es war keine Musik, die sie spielten, sondern es war deren Art miteinander zu sprechen. Dieses märchenhafte Land war ein Ruheort, in dem es keinerlei Hass, Hierarchie oder Neid gab. Es war ein Land, in welchem dieses zahme und behutsame Volk den ganzen Tag mit Spielen, Schlafen und Faulenzen verbringen konnte. Durch diese ganzheitlich vorherrschende Harmonie bedurfte es auch keinerlei Gesetze, an denen diese Geschöpfe ihr Handeln ausrichten mussten. Sie waren gänzlich freie Wesen. Diese perfekten Bedingungen ließen die Blumen, die Tiere und letztendlich auch die Schmetterlinge sonderlich groß wachsen. Ja, sie waren von der Größe dem Geschlecht der Menschheit sogar gleich. In dem märchenhaften Wald lebten nie mehr als 300 solcher Geschöpfe und folglich waren sie nur sehr selten zu erblicken. Die meisten von ihnen lebten im inneren Kern des Waldes, der so dicht war, dass die Sonnenstrahlen nur im seltenen Fall das Dickicht der Bäume durchdringen konnten. Durch den dichten Baumwuchs war es außerdem unmöglich, querfeldein das Zentrum zu erreichen. Doch entstanden im Laufe der Zeit zahlreiche Wege. Einige von ihnen verliefen direkt in den Wald hinein, andere glichen eher einem Labyrinth und führten zum Eingang des Waldes zurück. Es wurde erzählt, dass ein Wesen den Kern des Waldes nur erreichen kann, wenn man den Weg mit einer reinen Absicht begeht. So schützte und schottete der Wald sein Herz vor der Außenwelt ab und behütete somit auch die Schmetterlinge vor Außenstehenden, die mit bösen Absichten in den Wald eindringen wollten. Je näher man dem Kern des Waldes dabei kam, desto nebelhafter wurde das Licht, welches durch die dichten Bäume nur ganz schwach durchscheinen konnte. Außerhalb des Waldes hielten sich ab und zu auch Schmetterlinge auf. Doch so friedliebend wie sie waren, so scheu waren diese seltenen Geschöpfe auch. Ihre feinen Fühler ließen sie andere Wesen schon aus vielen Metern wahrnehmen. Dann beobachteten die Schmetterlinge diese Wesen so lange, bis sie sich sicher waren, dass diese ein sanftes Herz haben. So war es mit den Raupen, den Hasen, den Vögeln, den Füchsen, den Schlangen und auch mit allen anderen Wesen, denen sie begegneten. Die Schmetterlinge machten dabei keine Unterschiede, sie beurteilten nie nach dem Aussehen, sondern immer nach den inneren Werten.
Das Geschlecht der Menschen war zu Beginn dieser Geschichte ein Volk, das noch nicht sehr weit entwickelt war. Weder lebten diese inmitten eines Waldes noch in einem unterirdischen Tunnelsystem unter einem Berg. Sie waren eher ein wanderndes Volk, immer auf der eintönigen Suche nach Nahrung und Wasser. Im Laufe der Zeit stießen die Menschen auf sehr wasserreiche Flüsse, große Seen oder gar auf das Meer. Dies veranlasste sie dazu, sich an solchen Orten niederzulassen. Das Wasser versorgte nicht nur die Menschen, sondern auch eine reichhaltige Tierwelt und ließ viele verschiedene Bäume und Sträucher, die süße Früchte und Beeren trugen, sprießen. Genügend Wasser, die Jagd auf die frei lebenden Tiere und das Sammeln dieser Früchte und Beeren, bildete eine nachhaltige Grundlage für die Siedlung der Menschen. So kam es, dass um die Gewässer herum kleine Dörfer entstanden, in denen die Menschen ihr Zuhause gefunden hatten. Mit dem Ansiedeln der Menschen an bestimmten Orten, wurden sie von Tag zu Tag gesellschaftlicher. Es entstand eine Dorfgemeinschaft – eine Dorfgemeinschaft, in der man sich gegenseitig half und freundlich zueinander war. Es wurde gemeinsam am Lagerfeuer zu Abend gegessen, sich gegenseitig beim Bau der Hütten geholfen und es kam nie zu Streit unter den Dorfbewohnern. Doch im Gegensatz zu den Schmetterlingen und Drachen bestand das Menschengeschlecht aus Frauen und Männern. Dadurch konnten diese sich schneller fortpflanzten und die Anzahl der Dorfbewohner stieg stetig. Da das Nahrungs- und Wasserangebot jedoch nur begrenzt war und in den Dörfern mit der Zeit immer mehr Menschen lebten, mussten Erwachsene bei einer bestimmten Anzahl an Dorfbewohnern das Dorf verlassen und sich einen neuen Platz in der Welt suchen. So kam es, dass das Geschlecht der Menschen in verschiedenen Regionen angesiedelt war. Auch wenn die Menschen noch nicht weit fortgeschritten waren, stellten sie ein doch eher intelligentes Geschlecht dar. Sie entwickelten sich im Laufe der Zeit schnell weiter. So wurden in kurzer Zeit aus provisorischen Unterkünften im Dorf wetterfeste Hütten aus Holz. Es wurden zudem Waffen entwickelt, welche die Jagd auf Tiere erleichterten. Schlussendlich lernte man das Feuer zu bändigen, um es als Licht- und Wärmequelle zu nutzen. Während die Drachen und die Schmetterlinge mit ihrem Dasein zufrieden waren und in ihrem Tun, ihren Gewohnheiten und Ritualen gleichblieben, nutzten die Menschen ihre Intelligenz, um zu einer aufstrebenden Rasse aufzusteigen. Es dauerte nicht lange, dann lebten sie von der Landwirtschaft und dem Handel zwischen den großen menschlichen Hafenstädten, die sich aus den ersten beschaulichen Dörfern gebildet hatten. Dabei ragten zwei große Hafenstädte, welche alle anderen in deren Pracht übertrafen, besonders hervor – Satar und Höhn. In diesen Städten lebten jeweils über 200.000 Menschen, was im Vergleich zu den anderen großen Hafenstädten fast das Zehnfache darstellte.
Gezeichnet von einer breit gefächerten Schullandschaft war Höhn das Zentrum der menschlichen Bildung. Deshalb war es auch nicht verwunderlich, dass Höhn die klügsten Denker des menschlichen Geschlechts hervorbrachte. Dieser Umstand wurde insofern untermauert, als Höhn die einzigen beiden Hochschulen im Reich der Menschen besaß. Jeder Mensch, der eine geistige Laufbahn einschlagen wollte, musste folglich nach Höhn reisen und sich dort niederlassen. Ein Leben in Höhn stellte indes keine Verschlechterung in einem Leben dar. Ganz im Gegenteil – es war eine persönliche Bereicherung. Viele Menschen wollten nach Höhn ziehen, da die Stadt eine beispielhafte Kultur bot und die Lebensqualität sehr hoch war. So entwarfen gelehrte Architekten viele malerische Gebäude, die der Stadt eine besonders romantische Ausstrahlung verliehen. Außerdem ließen sie hunderte Brücken über den Fluss und seine Ausläufer bauen, der quer durch die gesamte Stadt floss. Diesem Umstand geschuldet nannte man Höhn auch die Stadt der hundert Brücken. Obwohl das ursprüngliche Dorf, aus dem sich Höhn entwickelt hatte, zufällig an diesem Fluss gegründet wurde, war die Stadt als solche gezielt um den Fluss und seine Ausläufer herum errichtet worden. So konnte der Fluss alle wichtigen Knotenpunkte der Stadt mit Wasser versorgen. Außerdem konnte man den Fluss zusätzlich nutzen, um innerhalb Höhns von Ort zu Ort mit kleinen Paddel- oder Tretbooten zu gelangen. Die Bildungslandschaft, die Kultur, die Lebensqualität sowie der allgemeine Fortschritt wirkten sehr anziehend auf die Menschen. Im Vergleich zu Satar erreichte Höhn deshalb sehr schnell den Grenzwert von 200.000 Einwohnern. Durch die hohe Einwohnerzahl waren die Lebensqualität sowie der anhaltende gesellschaftliche und wirtschaftliche Fortschritt stark gefährdet. Deshalb durften sich die Menschen in Höhn nur noch niederlassen, wenn sie in einer der beiden Hochschulen einen Studienplatz erhielten oder wenn sie in Höhn einer Arbeit nachgingen. Demgegenüber musste Höhn verlassen werden, wenn man seinen gesellschaftlichen Beitrag nicht mehr leisten konnte. Arbeit oder gehen, so lautete das indirekte Stadtmotto. Was auf den ersten Blick ziemlich hart oder gar grausam klang, fruchtete aber in einer funktionierenden Gesellschaft.
Im Gegensatz dazu war Satar eine Stadt, die sich dem militärischen Drill verschrieben hatte. Hier wurden die Menschen zu Soldaten ausgebildet. Die Soldaten wurden im Umgang mit dem Pferd, mit schweren Geschützen und im Einzelkampf trainiert. Im Vergleich zu Höhn legten die Menschen hier kaum Wert auf Bildung außerhalb des militärischen Bereichs. Das führte einerseits zwar dazu, dass die Satarner den Menschen aus Höhn geistig sehr unterlegen waren, andererseits hatte es aber auch zur Folge, dass es kaum ein Mensch aus Höhn sportlich gesehen mit einem Satarner aufnehmen konnte. Dies bedeutete natürlich auch, dass die Höhner den Satarnern im Umgang mit dem Schwert nicht gewachsen waren. Vom Stadtbild war Satar eher schnörkellos gehalten. Es war wichtig, dass die Straßen den Pferden und den Kriegsmaschinen genügend Platz boten und dass die Wege ohne Umschweife zu wichtigen Knotenpunkten in der Stadt führten. Wichtige Knotenpunkte waren beispielsweise die Ausbildungslager der Rekruten, die Waffenschmieden, die Pferdeställe und das Gerichtsgebäude. So schlicht wie die Straßen und Gehwege der Stadt gehalten waren, so uninspiriert wirkte das komplette Stadtbild. Eher in einem allumgreifenden Grau, als in Farbenpracht hatte man Satar in Erinnerung, wenn man es einmal gesehen hatte. Einzig allein das Schloss des Königs stach mit seinem wunderschönen Hofgarten aus dem monotonen Grau der Stadt heraus. Dort erblühten die buntesten Blumen und ein türkisblauer See inmitten des Hofgartens hatte dort sein Zuhause gefunden.
Neben den großen Hafenstädten, in welchen die Menschen lebten, war das Land von seinen weiten Feldern, auf denen die Menschen Ackerbau betrieben, geprägt. Dort nutzte die Menschheit Maschinen, welche in Höhn entworfen und in Satar gebaut wurden, um die Arbeit in den ländlichen Regionen zu erleichtern. Das Menschengeschlecht ging im Laufe seines Fortschrittes immer sorgfältiger mit seiner Umwelt um. So wurden für Holz, welches sie rodeten, stets neue Bäume gepflanzt, Müll wurde nicht in die Gewässer geworfen und Tiere wurden gezüchtet anstatt gejagt. Noch gab es zu Beginn des menschlichen Geschlechts keine Hierarchien. Kein Bauer unterstand einem Herrn und kein König regierte das Land. Doch im Zuge des Fortschrittes, der sich in Satar und Höhn bemerkbar machte, sowie der Ausbreitung des menschlichen Geschlechts brauchte es Menschen, die das Land zu regieren vermochten. Im Laufe der weiteren Zeit wurden die ersten Könige gewählt. In Höhn wurde der schlauste Mann, der zu dieser Zeit lebte, zum Herrscher des Volks ernannt. In Satar war es der stärkste, der die große Hafenstadt und angrenzende Dörfer sowie Städte regieren durfte.
KAPITEL 2
Aufbruch in ein neues Abenteuer
„Landor! Sei ruhig!“, rief es in der Bibliothek Höhns. Landor, ein junger Mann aus Satar, welcher dazu neigte, laut zu reden, wenn er in seinen Gedanken vertieft war, hob sichtlich fragend seinen Kopf und wunderte sich, woher diese schroffen Worte denn kamen. Allzu viel Aufmerksamkeit schenkte er dieser Aufforderung jedoch nicht, viel zu spannend war das Buch, welches er las. „Die Geschichte des unendlichen Waldes“, so lautete der Titel dieses Werkes.
Es erzählt von einem alten Mann, der weit östlich von Höhn in einer abgeschiedenen Hütte lebte. Er lebte abseits, da er die Gesellschaft anderer Menschen nicht mochte. Er wollte lieber allein sein. Um sich in dieser abgeschiedenen Gegend zu ernähren, musste er jagen gehen oder Beeren pflücken. Da dieser alte Mann aber nichts von Beeren hielt, musste er den Wald aufsuchen, um dort das Wild zu jagen. Der Greis wunderte sich stets, dass er den Wald nie so verließ, wie er in diesen hineingegangen war. Eines Tages nahm er dann eine Karte und einen Kompass mit und orientierte sich daran. Obwohl er sich nun sicher war, dass er den gleichen Weg hinein wie hinaus nahm, sah der Weg des Waldes beim Verlassen dennoch anders aus. Er konnte es sich nie erklären und schob es auf sein Alter.
„Vermutlich funktioniert mein Gehirn nicht mehr so gut“, dachte sich der alte Mann.
Im Verlauf der vielen einsamen Tage sah er abends ein Rehkitz. Der alte Mann nahm daraufhin seinen Pfeil und spannte mit diesem seinen Bogen. Er wollte es erschießen, um so an Nahrung für die nächsten Tage zu kommen. Also nahm er das Rehkitz in das Visier und schoss den Pfeil Richtung Oberkörper.
„Das wird ein Volltreffer!“, freute sich der Greis innerlich jubelnd.
Doch urplötzlich spürte er einen starken Windstoß, der so stark war, dass der Pfeil kurz vor dem Rehkitz auf den Boden fiel. Erschrocken blickte das kleine Reh zu seinem Jäger und verschwand im Dickicht des Waldes. Der alte Mann konnte es sich nicht erklären.
„Woher um Himmels willen kam bloß dieser Wind? Vorher war es so windstill, dass nicht ein Blatt in den Bäumen wehte! Woher nur?“, fragte sich der alte Mann mit leiser, verwunderter Stimme.
Als das Rehkitz verschwand und der Greis seinen Blick noch in Richtung des Ortes richtete, an dem er dieses kleine Reh erlegen wollte, erblickte er flüchtig eine Gestalt. Diese Gestalt schien wie ein Vogel in der Luft zu schweben. Er blieb noch eine Weile stehen und fragte sich, ob es real war, was er gesehen hatte.
„Falls mir meine Augen hier keinen Streich gespielt haben, hätte dieser große Vogel solch einen Windstoß zustande bringen können“, reimte sich der alte Mann nachdenklich zusammen.
An diesem Abend hatte der Greis kein Glück. Er verließ den Wald und abermals ragten die Bäume an anderen Orten heraus. Auch die Bäume als solche hatten wieder eine andere Form und der Weg war viel schmaler geworden. Der alte Mann sah diesen mysteriösen Vogel nie wieder und es dauerte viele weitere Jahre, bis er den Wald und diesen einen besonderen Abend verstanden haben sollte.
Erst nachdem der Greis das Empfinden des Waldes teilen konnte, offenbarte sich ihm sein wahres Gesicht. So wie der alte Mann nun in den Wald hineinging, kam er auch wieder heraus. Dieselben Bäume, Steine, Bäche – einfach alles war gleich. Über die Jahre hinweg fühlte sich der alte Mann immer heimischer im Wald und sah diesen als seinen Freund an. Noch nie im Leben konnte er von jemandem behaupten, dass er sein Freund war. Ständig war er allein im Leben, sodass das Band der Freundschaft sehr stark wurde. Eines Tages ging der alte Mann, der inzwischen einer blassen Hülle glich, die zu Staub verfallen drohte, ein letztes Mal in den Wald hinein. Was dort mit ihm passierte, kann nicht gewissenhaft gesagt werden, aber er wird wohl, aufgrund seines hohen Alters, sein Ende in den Armen seines besten Freundes gefunden haben.
Es vergingen einige Jahre und die Hafenstadt Höhn breitete sich immer weiter aus. Die Stadtgrenze verschob sich Stück für Stück näher an die Hütte des Greises, wobei die Hütte weiterhin mehrere Fußmärsche entfernt war. Eines Tages erkundete ein junger Forscher diese Gegend. Er sollte herausfinden, ob die Stadtgrenze weiter Richtung Osten ausgedehnt hätte werden können. So musste dieser junge Mann auskundschaften, wie es um den Bestand der Wildtiere aussah, ob sich der Boden für Ackerbau lohnte und ob ausreichend Wasser vorhanden war. Zum Abschluss seiner Untersuchungen kam er zu dem Entschluss, dass sich diese Gegend nicht eignete, um die Stadt in Richtung Osten weiter wachsen zu lassen.
Kurz bevor er wieder nach Höhn aufbrechen wollte, damit er seine Erkenntnisse dem König überbringen konnte, erblickte er in weiter Ferne eine marode Hütte. Die Neugier packte den jungen Forscher und er ritt zielgerichtet auf sie zu, da sie ihn auf irgendeine magische Art anzuziehen schien. Nahezu eine Stunde brauchte er, um die Hütte zu erreichen. Vermutlich dachte der junge Mann nicht, dass der Ritt so lange dauern würde, immerhin konnte er sie mit bloßen Augen sehen. Wie konnte sich der junge Gelehrte denn nur so irren? Dort angekommen brach zu seinem weiteren Unverständnis langsam die Dämmerung ein.
„Wie kann das sein, dass es zu dieser Uhrzeit dämmert? Eigentlich dämmert es erst in vier Stunden! Was stimmt an diesem Ort denn nicht?“, dachte der junge Mann sichtlich verwirrt.
Da mittlerweile die Dämmerung von der Nacht abgelöst wurde, nutzte er die Hütte, um dort zu übernachten. So musste er wenigstens nicht bei Nacht zurück nach Höhn reiten. In der Hütte war es stockfinster. Er sah rein gar nichts. Einen Meter nach dem Betreten der Hütte spürte er einen Schleier im Gesicht und erschrak fürchterlich. Ängstlich trat er zurück und wartete eine Zeit lang, bis sich seine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten. Nachdem er nun im Dunkeln wenigstens die Konturen innerhalb der Hütte wahrnehmen konnte, merkte er, dass er eine riesige Spinnwebe im Gesicht hatte. Angewidert entfernte er diese hastig. Daraufhin näherte er sich einem Raum, welcher einem Schlafbereich am nächsten kam. Dort entdeckte er in einer Schreibtischschublade eine Kerze und Streichhölzer. Endlich konnte er sich Licht machen und die Dunkelheit mit der Kerze erhellen. Nachdem er wieder sehen konnte, packte ihn erneut die Neugier. Er wollte die Hütte durchsuchen, fand aber nichts Spannendes. Als er sich in das Bett legen wollte, entdeckte er jedoch im Nachttisch eine Art Tagebuch. Es war das Tagebuch des alten Mannes, der einst im Wald das Rehkitz erlegen wollte. Warum er das Buch las, wusste er zu Beginn selbst nicht. Vielleicht war es die Neugier, wie der alte Mann gelebt hatte. Vielleicht war es aber auch einfach nur die Hoffnung, dass das Tagebuch so langweilig sei, dass er rasch müde werden würde, um somit besser einschlafen zu können. Doch schnell bemerkte er, dass das Buch alles andere als langweilig war. Ganz im Gegenteil – er verbiss sich in dieses Tagebuch und las es bis zur Morgendämmerung.
Er war so fasziniert von diesem Buch, dass er selber eins über seine ungewöhnliche Erkundung schreiben sollte. In diesem Buch schilderte er nicht nur die Geschichten des alten Mannes, die ihn so fesselten, sondern ebenfalls den Weg zur Hütte, in welcher sich die Zeit nicht an die Regeln der Menschen zu halten schien.
Viele lasen dieses Buch jedoch nicht und in den heimischen Bücherregalen der Menschen hatte es nie einen Platz gefunden. Landor war seit vielen Jahren einer der wenigen, der dieses Buch überhaupt ausgeliehen hatte und das auch nur zufällig, da dieses Werk in keiner Liste der Bibliothek verzeichnet war. Lediglich durch einen Zufall war er auf dieses Buch gestoßen, denn eigentlich musste Landor eine Arbeit über alte, ausgestorbene Sprachen der Menschen schreiben. Neben dem Buch, welches er sich dazu zugrunde legen wollte, sah er die verstaubte Geschichte des jungen Forschers, auf dessen Buchrücken der Titel „Die Geschichte des unendlichen Waldes“ zu lesen war. Während er nach seinem Fachbuch gegriffen hatte, hatte Landor nebenbei den Titel gelesen, aber sich nichts dabei gedacht. Anschließend befand er sich bereits auf dem Weg zu seinem Tisch, an welchem er das Fachbuch durchforsten wollte. Erst in diesem Moment nahm er den anderen Buchtitel richtig wahr. Je näher er seinem Tisch kam, desto mehr packte ihn seine Neugier. Am Tisch angekommen nahm er auf dem Stuhl Platz, doch war die Neugierde mittlerweile so groß, dass er gleich wieder aufstand, um sich das Buch des jungen Forschers zu holen. Ehe er sich versah, saß er wieder an seinem Tisch und las das Buch, während sein Fachbuch von ihm links liegen gelassen wurde.
Landor machte sich nun Gedanken über diesen mysteriösen Ort. „Wäre es nicht ein spannendes Abenteuer, diese Hütte zu suchen?“, fragte er sich grübelnd.
Er war im Zwiespalt. Einerseits wollte er jetzt die Hütte suchen, um zu schauen, ob in dieser Erzählung ein Fünkchen Wahrheit steckt, andererseits musste er sich in der Hochschule beweisen und durfte dort eigentlich nicht fehlen.
Die starken Männer Satars waren sicherlich keine dummen Männer, aber ihre körperliche Veranlagung übertraf bei Weitem ihre geistigen Fähigkeiten. Deshalb war Landor als gebürtiger Sartaner eine Seltenheit in den Hochschulen Höhns. Er wollte den Studierenden in Höhn zeigen, dass auch Sartaner den Verstand dazu haben, eine solche Bildungseinrichtung zu besuchen – immerhin hatte Landor auch den Aufnahmetest dafür bestanden. In diesem Test bewies er, dass er mathematisch, sprachlich sowie im Allgemeinwissen mit den anderen in der Hochschule Schritt halten konnte. Noch dazu kam, dass Landor der Sohn des Königs von Satar war. So floss in seinen Adern das Blut des stärksten Menschen seiner Zeit. Sein Vater hieß es damals nicht gut, als Landor nach Höhn aufbrach, um dort die Hochschule zu besuchen. Er wollte, dass Landor in seine Fußstapfen tritt. Er wollte, dass Landor ganz typisch für Satar eine militärische Ausbildung durchläuft und sich im Krieg beweist. Landor wollte dies aber nicht und obwohl sein Vater ihm klarmachte, dass er alle königlichen Sonderrechte verlieren würde, brach Landor nach Höhn auf, damit er dort zu dem Mann reifen konnte, zu welchem er selbst werden wollte.
Stark mit sich in einem inneren Konflikt, holte er zehn Bücher über die alten, ausgestorbenen Sprachen der Menschen und verfasste innerhalb von zwei Tagen seine Arbeit über dieses Thema. Auch wenn er die Arbeit schnell schrieb, gab er sich dennoch viel Mühe. Während des Schreibens überlegte er abwägend: „Wenn ich meine ganzen Prüfungsleistungen, die ich in der Hochschule ausarbeiten und schreiben muss, vorziehe, kann ich meine Hochschulferien vorverlegen und nach der Hütte sowie dem Wald suchen!“
Nachdem er seine Arbeit bei dem entsprechenden Lehrer eingereicht hatte, musste er noch fünf weitere Abschlussarbeiten in anderen Fächern schreiben. Diese musste Landor bei vier verschiedenen Lehrern abgeben. Er fragte alle einzeln, ob er die Arbeit vorziehen dürfe, da er ein Forschungsprojekt beginnen wolle. Die Lehrer wiesen Landor jedoch allesamt darauf hin, dass der Unterrichtsstoff noch nicht vollständig vermittelt worden sei. Dies störte den jungen Satarner aber nicht. Er beschloss mit den Lehrern, dass er die Abschlussarbeiten innerhalb der nächsten Woche schreiben dürfe. So gaben die Lehrer ihm die fehlenden Inhalte der fünf Unterrichtsfächer zum Lernen mit auf den Weg und Landor ging sofort in die Bibliothek, um die Unterrichtsinhalte auszuarbeiten sowie sich selbst anzueignen. Sicherlich war der Umstand, dass Landor der Sohn des Königs von Satar war, hilfreich dabei, dass die Lehrer ihn die Abschlussarbeiten vorziehen ließen. Nichtsdestotrotz arbeitete der Königssohn in den folgenden Wochen sehr hart. Er schlief wenig und aß auch kaum etwas. Schlussendlich schrieb er seine Abschlussarbeiten und, ohne dass er seine Noten wissen wollte, machte er sich auf in seine kleine Wohnung.
Dort packte er einen kleinen Jutebeutel, den er als Rucksack nutzte, und machte sich gemäß den Beschreibungen im Buch voller Tatendrang auf den Weg, um die Hütte zu finden.
Zu Beginn seiner Reise hatte Landor viel Glück. Das Wetter war heiter und die Sonne strahlte eine angenehme Wärme aus. Wohin er genau gehen sollte, wusste Landor nicht, da er nur die Beschreibung aus dem alten Buch hatte. Wie genau diese war, konnte er nicht wissen. So nahm Landor seinen Kompass aus seiner Hosentasche und lief erst einmal, ohne groß zu überlegen, nach Osten. Am ersten Tag lief er ohne Rast von der Morgendämmerung bis zur Abenddämmerung. Viel zu neugierig war er auf die Hütte. So gespannt, dass diese Neugierde das Gefühl von Hunger und Durst verdrängte. Außerdem machte ihm das lange Laufen nichts aus, immerhin war er einer der Söhne Satars, die auch für ihre ausdauernde Sportlichkeit bekannt waren. Zu Beginn der Abenddämmerung suchte er auf den großen Feldern, die er den ganzen Tag durchquerte, einen kleinen angrenzenden Bach. Dort angekommen, legte er seinen Jutebeutel und auch das zusammengerollte Zelt, welches er über seinem Beutel am Rücken trug, ab. Frei von dieser Last ging er auf das angrenzende Feld zurück und rollte drei Heuballen in die Nähe seines kleinen Lagers. Diese stellte er zu einem offenen Dreieck auf, in dessen Mitte er sein Zelt aufbaute. Dadurch hatte er ein Gefühl von Sicherheit geschaffen, wie er es aus seinen eigenen vier Wänden aus Höhn kannte. Anschließend nahm er etwas Stroh aus den drei Heuballen und nutzte dieses, um zusammen mit einigen Ästen, die er bei dem Tagesmarsch einsammelte, Feuer zu entfachen. Aus seinem Jutebeutel nahm er ein Stück Brot, welches er aß, und eine Schüssel, um Wasser aus dem kleinen Bach zu holen, welches er trank. Nach dem kleinen Abendbrot legte er sich in sein Zelt. Eine Unterlage, auf der er schlafen konnte, hatte er nicht mitgenommen, da er nicht zu viel tragen wollte. Deshalb baute er das Zelt einfach auf einer Stelle auf, wo der Boden recht weich war. Das Feuer war nach seinem Abendbrot schon fast wieder ausgegangen, um noch etwas Licht zu spenden, ließ er es einfach über Nacht ausglimmen. Aus Wandern, Zelt aufbauen und Abendbrot essen bestanden seine nächsten drei Tage. Am vierten Tag bemerkte Landor, wie aus den weiten Feldern wilde Wiesen wurden. Es sah immer mehr danach aus, als ob in dieser Gegend keine Menschen lebten. Er sah immer mehr Wildtiere, Insekten und vereinzelt auch Bereiche, die an kleine Wälder erinnerten. Freilich war es nicht der Wald, den Landor suchte. Viel zu klein und überschaubar waren diese und von einer Hütte gab es keinerlei Spur. Sein Enthusiasmus, die Hütte und den Wald zu finden, stieg am vierten Tag. Durch die Veränderung der Landschaft kam ihm der Gedanke, dass das der Ort sein musste, den der junge Forscher auskundschaften sollte, um herauszufinden, ob die Gegend für eine Erweiterung der Stadt Höhn geeignet sei. Es vergingen weitere zwei Tage. Die Gegend, welche er nun durchquerte, wurde immer naturbelassener. Aus den wilden Wiesen wurden die buntesten Blühwiesen und die Tierlandschaft wurde immer vielfältiger. Er durchquerte auch Waldabschnitte, die immer größer wurden. Am sechsten Tag neigte sich Landors Nahrungsvorrat dem Ende zu. Glücklicherweise konnte er seinen Jutebeutel voll mit Beeren füllen, die in einem Waldstück wuchsen, welches er passierte. Das Wetter war am sechsten Tag nicht mehr sonnig, ein rauer Wind und vereinzelter Regen lösten die Sonne und den blauen Himmel ab. Aber auch das machte Landor als Sohn Satars nichts aus. Unbeirrt ging er seinen Weg gen Osten weiter. Nach Dauerregen bis zum neunten Tag, als Landor die ersten Zweifel kamen, bemerkte er etwas Sonderbares.
Nein, es war nicht die Hütte oder der mysteriöse Wald, es war ein Wetterphänomen, welches Landor noch nie beobachtet hatte. Gerade passierte er einen kleinen Waldabschnitt. Dieser war so dicht bewachsen, dass Landor den Himmel nicht sehen konnte. Jedoch konnte er am Tag genug sehen, um diesen Waldabschnitt zu durchqueren. Es regnete noch sehr stark. Dies merkte Landor anhand der Wassermengen, die durch das Dickicht des Waldes vom Himmel niederschlugen. Beim Verlassen des Waldes musste Landor anschließend einen Weg begehen, der steil nach oben führte. Seine Aussicht war dadurch so stark begrenzt, dass er nicht weit sehen konnte. Je weiter er den Weg nach oben ging, desto heller wurde der Horizont. Er ging immer weiter und bemerkte, am Höhepunkt des Weges, dass in weiter Ferne die Sonne schien. Mit seinem Blick auf die Sonne gerichtet, bemerkte Landor beinahe nicht, dass es nach dem Höhepunkt des Weges steil einen senkrechten Berghang abwärts ging. Beinahe stürzte er, doch konnte er sein Gleichgewicht in letzter Sekunde halten. Es stellte sich nun die Frage, wie er diese Felswand herunterkam. Er blickte nach rechts sowie nach links und bemerkte, dass der Wald zu dem Berghang eine Art Sicherheitsabstand hielt. Die Bäume standen geradlinig in einer Reihe 100 Meter weit von diesem entfernt. Leider brachte ihn diese Erkenntnis nicht wirklich weiter. Er hatte auch keine Ausrüstung dabei, um an dieser steinigen Felswand herunterzuklettern. Völlig durchnässt und ratlos setzte er sich an den Vorsprung und wollte die sonnige Aussicht genießen, die auf ihn zu warten schien. Dabei merkte er, dass seine Knie und Beine, welche er im Freien baumeln ließ, trocken waren. Er streckte seine Arme aus und merkte, dass auch diese trocken waren. „Wieso sind urplötzlich meine Arme und Beine trocken? Klar, dort vorne scheint die Sonne, aber meine Arme und Beine müssen doch trotzdem nass sein?“, murmelte Landor vor sich hin.
Landor überlegte sich, ob es im Wald einen Abzweig gibt, der ihn vielleicht auf einen Weg Richtung des sonnigen Landes unterhalb des Felsvorsprunges führen könnte. Er stellte sich demnach wieder hin und ging ein Stück in Richtung des Waldes. Seine Arme und Beine wurden wieder nass. Fragend blickte er in den Himmel und bemerkte, dass der Regen exakt am Rand des Felsvorsprunges aufhörte. Anstatt in den Wald hineinzugehen, erkundete er nun den Weg zu seiner Linken und Rechten, den der Wald als Sicherheitsabstand hielt. Dabei stellte er fest, dass der Beginn des Felshangs nicht nur das Ende des Regens war, sondern auch, dass die Regenwolke hier in einer merkwürdigen Linienform, entsprechend dem Felshang, endete. Es wirkte, als wäre der Berghang eine natürliche oder magische Grenze, welche die Wolken einfach nicht überwinden konnten. Landor tendierte zu Letzterem, denn wieso sonst waren seine Arme und Beine augenblicklich luftgetrocknet, als er am Felsvorsprung saß?
Voller Euphorie redete Landor vor sich hin: „Das muss die Magie sein, von der der junge Forscher in seinem Buch schrieb. Diese magische Wand, die den Regen abblockt, ist vielleicht genau die Magie, welche den Verlauf der Zeit in seiner Geschichte beschleunigt hatte!“
Mit dieser Annahme war Landor so motiviert, dass er versuchte den steilen Abhang herabzuklettern, sogar wenn dieser ungefähr 50 Meter hoch war und er sich ausschließlich auf sein körperliches Geschick verlassen konnte. Zunächst griff Landor aus der Bauchlage heraus über den Abhang und fasste mit seiner rechten Hand die Felsen an. Damit wollte er überprüfen, ob auch diese trocken waren. Und so wie sein Arm beim Greifen nach der senkrecht verlaufenden Felswand plötzlich wieder trocken wurde, war auch die Felswand trocken. Nun fasste er sich seinen ganzen Mut und begann damit den steilen Abhang hinunterzuklettern. Während er mit dem Hinunterklettern begann, dachte er sich, dass er in zehn Minuten unten heil angekommen sein müsste. Doch bereits nach den ersten 20 Metern waren die zehn Minuten verstrichen. Zu diesem Zeitpunkt hörte Landor den Schrei eines Vogels am Himmel, welchem er, trotz aller Gefahr des Herunterfallens, neugierig Aufmerksamkeit schenkte. So hielt er sich mit jeder Hand extrem an einem Stein fest und schaute nach rechts, um zu sehen, was es für ein Vogel war. Plötzlich juckte es an seiner linken Hand, woraufhin er seinen Kopf hektisch zu ihr drehte und voller Schreck eine Spinne sah, die über seine Hand in Richtung seiner Schulter zu krabbeln schien. Vor lauter Aufregung ließ er mit seiner linken Hand den Stein los und wedelte wie verrückt mit dieser, um die Spinne loszuwerden. Dadurch kam es aber dazu, dass er sein Gleichgewicht zu verlieren drohte. Es sah so aus, als würde Landor gleich in die Tiefe stürzen. In letzter Sekunde aber konnte er sich mit der rechten Hand aufgrund seiner enormen Stärke wieder an die Felswand heranziehen und schnell mit der anderen Hand erneut Halt an einem Stein finden. Nachdem Landor den Schreck überwunden hatte, wollte er weiter hinunterklettern. Da brach der Stein ab, an den er sich soeben mit der rechten Hand an die Felswand ziehen konnte, um den Sturz in seinen sicheren Tod zu verhindern. Während des Abbrechens ging Landor der Gedanke durch den Kopf, dass der Stein vermutlich locker geworden war, weil er sich kurz zuvor an die Felswand gezogen hatte. Anders als bei dem Zwischenfall mit der Spinne, konnte Landor sein Gleichgewicht nicht wiedergewinnen. Er konnte sich nicht mehr halten. Landor flog die restlichen 30 Meter in die Tiefe. Noch während seines Sturzes verlor er sein Bewusstsein und alles vor seinen Augen wurde schwarz. Kein Ast bremste Landors Sturz, kein See linderte den Schmerz des Aufpralls und kein Wind ließ ihn wie eine Feder zu Boden gleiten. Es sah so aus, als wäre es das Ende der Geschichte Landors, doch öffnete er nur ein paar Minuten nach dem Sturz die Augen. Völlig unversehrt! „Ein Wunder!“, schrie Landor voller Freude in den türkisblauen Himmel.
Landor überlebte den Sturz gegen jedwede Logik der Physik. Als er mit den Händen seinen Körper aufrichten wollte, bemerkte er, wie diese den Boden nach unten drückten. Er spürte, dass der Untergrund von der Härte und Nachgiebigkeit einem Luftballon glich oder einer Hüpfburg, welche es zu den Feiern seines Geburtstages gab, als er noch ein Kind war. Wie sollte Landor sich nun aufrichten und vor allem, wie sollte er seinen Weg weiter gehen? Ein Marsch auf einem Weg, bei dem man bis zu den Knien einsackt, würde die Reise um einiges verlängern. Allmählich richtete sich Landor auf, ging behutsam zwei Schritte und bemerkte, dass der Boden nur an der Stelle luftballonweich war, auf die er gestürzt war. Schon einen Meter weiter war der Boden wieder so hart, dass er den Sturz nicht hätte überleben können. Landor sah sich jetzt bestätigt, dass er auf der richtigen Spur war. „Immerhin hatte der Wald in der Geschichte des alten Mannes auch das Rehkitz vor dem tödlichen Schuss seines Jägers gerettet. Vielleicht hat die Magie, die den Wald umgibt, auch mich gerettet“, vermutete Landor.
Nachdem Landor wieder Fuß auf festem Boden gefasst hatte, machte er sich sogleich weiter in Richtung Osten. Als er den Schock des Sturzes allmählich überwunden hatte, bemerkte er die Einzigartigkeit der Natur und Tierwelt an diesem Ort. Ein Bach, dem Landor nun folgte, war so klar, dass er den noch so kleinsten Stein am Grunde des Wasserlaufs sehen konnte. Er ließ es sich nicht nehmen, eine kleine Rast einzulegen und nutzte die Gelegenheit, um einen Schluck aus dem Bach zu trinken. Landor schmeckte bereits beim ersten Schluck die Reinheit und das Natürliche in diesem Wasser, welche er in dieser Form aus Höhn, Satar oder anderen Städten der Menschen nicht kannte. Nachdem er das Wasser getrunken hatte, fühlte er sich stärker und konzentrierter. Während er einen zweiten Schluck trinken wollte, in der Hoffnung, er würde sich noch stärker fühlen, sah er kleine flauschige Kaninchen und Füchse gemeinsam am Bach spielen und trinken. In Höhn war sowas nie zu sehen. Dort waren die Füchse Jäger und die Kaninchen die Gejagten. Es wirkte alles viel harmonischer als in Höhn oder in den anderen menschlichen Hafenstädten. Es war ein warmes Gefühl, welches Landor umarmte.
Gestärkt von dem Wasser, das seine Kraftreserven wieder auffüllte, brach er wieder auf und lief sorglos in den Abend hinein. Es war wie immer. Landor suchte sich eine ruhige Ecke, baute sein Zelt auf, aß ein paar Beeren und trank etwas Wasser aus seiner Trinkflasche, welche er bei der Rast zuvor am Bach aufgefüllt hatte. Anschließend ging er in das Zelt und wollte schlafen. Seine Augenlider wurden immer schwerer. Sie gingen zu und dann wieder kurz auf. Die Abstände wurden immer länger und schon bald sollten die Augen nicht mehr aufgehen, sondern geschlossen bleiben. Schlussendlich blieben die Augen der Müdigkeit geschuldet zu, doch ein unerklärliches Verlangen brachte ihn dazu, seine Augen noch einmal kurz zu öffnen. „Habe ich da gerade ein Licht in der Finsternis da draußen gesehen?“, fragte sich Landor verschlafen mit leiser Stimme.
„Nein, das ist unmöglich!“, beantwortete er sich kurzerhand seine Frage selbst.
Die Ungewissheit, ob er beim letzten Blinzeln ein Licht gesehen hatte, oder eben nicht, ließ ihn einfach nicht zur Ruhe kommen. Einerseits war er so müde, dass er schlichtweg schlafen wollte, andererseits ließ ihn die Ungewissheit einfach nicht einschlafen. Völlig übermüdet öffnete er schließlich seine Augen und sah ein schwaches Licht durch die Nahtstellen seines Lederzeltes. „Ob da draußen jemand ist?“, fragte sich Landor, während sein Herz immer schneller zu schlagen schien.
Etwas ängstlich öffnete Landor sein Zelt und hielt zögerlich Ausschau nach dem Licht. In weiter Ferne konnte er es sehen. Es war aber eigentlich so schwach, dass es nicht bis in das Zelt hätte hineinleuchten können. Landor überlegte nun, ob er augenblicklich seine Sachen packen und das Licht aufsuchen sollte, oder erst im Schutz des Tages. „Was ist, wenn das Licht morgen weg ist? Was ist, wenn es mir etwas zeigen will?“, grübelte Landor.
Nach kurzem Überlegen unterlag er seiner Neugier und packte seine Sachen. Mit dem Rucksack und dem Zelt auf den Schultern machte er sich nun auf den Weg zu dem mysteriösen Licht. Auf dem Weg dorthin bemerkte Landor eine beispiellose Stille. Keine Tiere machten Laute, keine Bäche gaben Geräusche von sich und keine Blätter spielten Lieder im Wind. Je näher er dem Licht kam, desto deutlicher wurden die Konturen, aus dem es strahlte. „Kann es wirklich die Hütte sein, aus der das Licht scheint?“, erhoffte sich Landor, während er der Lichtquelle immer näherkam.
Keine zehn Minuten Fußmarsch und Landor merkte plötzlich, dass der Morgen anfing zu dämmern. Wie in der Geschichte des jungen Forschers war Zeit und Raum nicht so, wie es Landor kannte. Schließlich hätte es noch viele weitere Stunden Nacht sein müssen. Jetzt war sich Landor sicher, dass er auf der richtigen Spur war und im Moment dieser Erkenntnis entdeckte er die nun sichtbare Hütte, in deren Hintergrund sich ein großer, sattgrüner Wald wie aus dem Nichts auftat. „Volltreffer!“, dachte Landor innerlich sehr stolz auf sich und hatte die Hütte dabei fest im Visier.
In der Hütte angekommen, musste Landor sich zunächst ausruhen, denn obwohl er das morgendliche Zwitschern der Vögel aus dem naheliegenden Wald hörte, was mit der Morgendämmerung einherging, hatte Landor in der Nacht schließlich noch kein Auge zumachen können. So legte er sich, ohne die Hütte zunächst zu untersuchen, in das dort noch brauchbare Bett und schlief ein paar Stunden. Als er aus seinem Schlaf aufwachte, machte er sich mit der Hütte vertraut. Es war alles genauso, wie es der junge Forscher in seinem Buch beschrieben hatte. Landor erfreute sich dieser Erkenntnis enorm, da er sich inzwischen endgültig sicher war, dass es sich um die richtige Hütte und folglich auch um den richtigen Wald handelte. Es war die Zeit gekommen. Die Suche nach dem mysteriösen Wesen in diesem zauberhaften Wald sollte für Landor nun beginnen.
KAPITEL 3
Der irreführende Wald
Landor legte nun wie in alter Gewohnheit seinen Rucksack sowie sein Zelt an. Er wollte gerade die Türklinke öffnen, da wurde ihm klar, dass er sowohl sein Zelt als auch seinen Rucksack in der Hütte lassen konnte. Schließlich wollte er in den Wald hineingehen und auch wieder zur Hütte zurückkehren, um ebenfalls zu überprüfen, ob sich der Wald so veränderte, wie es der alte Mann in seinem Tagebuch festgehalten hatte. Ohne seine Ausrüstung öffnete Landor sodann die Tür und lief in Richtung des Waldes. Dort angelangt fiel ihm auf, dass der Wald, welcher so viel Magie versprach, lediglich Gewöhnliches ausstrahlte. „Hier und da ein paar Insekten, ein kleiner Wanderpfad, sattgrüne Laubbäume – eben nichts Magisches!“, dachte Landor ein wenig enttäuscht und stöhnte dabei leicht in den Wald hinein.
Stundenlang lief er auf der Suche nach dem mysteriösen Wesen im Wald umher und hatte dabei nichts gefunden. Langsam wurde es dunkler. Landor musste also wieder zurück zur Hütte. Um sich nicht zu verlaufen, hatte er mit seinem Messer an einigen Bäumen Pfeilrichtungen hineingekratzt, die ihm zum Ausgang des Waldes führen sollten. Er folgte seiner selbst gelegten Spur Richtung Ausgang, doch nach einigen Minuten bemerkte Landor, wie ihm der Wald einen irreführenden Streich spielte. Ihm fiel auf, dass die Bäume, in welche er die Pfeilrichtungen gekratzt hatte, ihn nicht zum Ausgang führten, sondern ihn im Kreis laufen ließen. Während Landor sich dessen bewusst wurde, war es bereits stockfinster, sodass ihm nichts anderes übrigblieb, als im kalten Wald auf einer weichen Bodenstelle zu übernachten.
Im Moment seines Aufwachens war die Sonne bereits erneut aufgegangen. Wider Erwarten konnte er sehr gut schlafen, offensichtlich schien ihm das Nächtigen auf dem weichen Waldboden nichts auszumachen. Das morgendliche Gefühl nach Hunger und Durst ignorierend wollte Landor jetzt im Hellen den Weg zurück zur Hütte finden. Doch auch das Tageslicht war ihm kein Freund. Einmal lief er im Kreis, ein anderes Mal ließen ihn die Bäume in einem Dreieck laufen und manchmal bewegte er sich in einem Rechteck. Egal wie er lief, Landor kam immer wieder an der Stelle heraus, an der er abends zuvor geschlafen hatte. Allmählich konnte er nur noch an Wasser denken. Nach eineinhalb Tagen ohne Trinken, war Landor sehr durstig. „Wie soll ich denn hier etwas Trinkbares finden, wenn mich der Wald ständig zu dem Ausgangspunkt meiner Suche zurückführt?“, fragte sich Landor entmutigt.
Er versuchte noch zweimal den Ausgang zu finden, aber vergebens. Letztendlich musste Landor die Nacht wieder im Wald verbringen. Die Nacht war unruhig und Landor träumte ständig von dem klaren Bach, aus welchen er große Schlucke nehmen konnte, um seinen Durst zu stillen. Während dieser Träume wachte er einige Male auf und tat sich stets sehr schwer wieder einzuschlafen. Kurz vor Einbruch des Tages konnte Landor nicht wieder in den Schlaf finden und richtete sich daraufhin auf, um anschließend seinen ganzen Körper zu strecken. Damit versuchte er die Verspannungen aus seinem Körper zu bringen, die in der zweiten Nacht durch den unnachgiebigen Waldboden in seinen Körper gefahren waren. Verzweifelt und ohne Antriebskraft stand Landor vor dem Baum mit dem letzten eingeritzten Pfeil. Er starrte ihn an und Minuten verflogen, bis ihm klar wurde, dass er dringend Wasser benötigte. Alles um ihn herum verschwamm, Landor konnte mit seinen Augen kaum noch Dinge wahrnehmen. Erschöpft setzte er sich auf den Waldboden und lehnte sich mit seinem Rücken an einen Baum. Ihn verließ nun die Kraft und er wollte sich nur noch seiner Müdigkeit hingeben, wohlwissend, dass er aus diesem Schlaf nie wieder erwachen würde. Als er so vor sich hindöste, nahm Landor mit der Zeit einen melodischen Klang war. Anfangs konnte er nicht zuordnen, um welchen Klang es sich hierbei handelte, doch je näher er dem Schlaf kam, desto deutlicher wurde dieser. Nach circa einer halben Stunde wurde er so laut, dass Landor das Gefühl hatte, neben ihm würde eine junge Frau eine Melodie in sein Ohr summen. Es war kein unangenehmes Summen. Ganz im Gegenteil – es war liebreizend und sehr fröhlich. Landor bündelte seine letzten Kraftreserven und wollte nun den Ursprung des Summens aufsuchen. Daraufhin hielt er den Atem an und bewegte sich keinen Millimeter. Dadurch konnte er die Melodie klarer hören und vernahm die Richtung, aus welcher sie zu kommen schien. Zunächst führte ihn die Melodie in Richtung der Bäume, welche Landor markiert hatte. Mit der Zeit hatte es den Anschein, dass sie ihn zum Ausgang des Waldes geleiten wollte. Doch wusste Landor, dass der Weg bis an die Waldgrenze zu lang war, um auf Wasser zu verzichten. Ob die Melodie Landor zu der Waldgrenze führen wollte, blieb ungewiss, da Landors Schritte immer schwerer wurden und er nach kurzer Zeit kraftlos zu Boden stürzte. Er fiel dabei mit seinem Bauch auf eine Wiese und konnte seinen Sturz gerade noch so mit seinen Händen abfedern. Erschöpft blieb Landor liegen. Ein letztes Mal in seinem Leben wollte Landor den blauen Himmel anschauen, den er aus seinen Kindheitstagen kannte. Er wollte mit einer schönen Erinnerung einschlafen, auch wenn der Himmel durch die vielen Bäume kaum sichtbar war. Nun drehte Landor sich auf den Rücken, damit er den Himmel sehen konnte, welcher schüchtern durch die Blätter der Bäume blickte. Er schloss die Augen und gab sich in Frieden seiner Erinnerung hin. Plötzlich wurde aus dem sanften Summen, welches ihn vermutlich aus dem Wald führen wollte, ein greller Schrei. Landor erschrak fürchterlich und vergaß für einen Moment, dass er am Verdursten war. Als er sich umdrehen wollte, um nach der Quelle des Schreis zu schauen, sah er zu seiner rechten Seite eine Lichtung. Ein kreisrunder Bereich, ungefähr 25 Meter im Durchmesser, in dessen Mitte ein Baum mit sonderbar aussehenden Früchten herausstach. Die Waldlichtung wurde von der Sonne hell erleuchtet und vermittelte einen frühlingshaften Eindruck. „Wo kommen denn urplötzlich dieser Baum und diese Lichtung her? Das war gerade eben noch nicht da! Bilde ich mir das alles jetzt nur ein?“, sprach Landor mit schwacher Stimme vor sich hin.
Seine Neugierde übertraf schließlich den Drang einfach aufzugeben und auf ewig einzuschlafen. Abermals rappelte sich Landor auf und schleppte sich zu der Waldlichtung. Wie von einer unsichtbaren Macht angezogen, lief er direkt auf den Baum zu und pflückte eine seiner zahlreichen Früchte. Die Frucht war himmelblau und hatte die Form eines Hühnereis. Bei genauerem Betrachten fiel Landor auf, dass die himmelblaue Schale mit sehr feinen, dunkelblau leuchtenden Linien verziert war. Jede Frucht hatte ein anderes Muster, keine einzige war gleich. Die Linien bildeten seltsame Formen, die Landor vorher noch nie gesehen hatte. Von der Größe passte diese eiförmige Frucht perfekt in seine Hand. Es fühlte sich so an, als hätte die Frucht eine dünne Schale, welche an einen Apfel erinnerte, weshalb Landor diese auch nicht schälte. Ohne großartig weiter darüber nachzudenken, biss Landor in die Frucht. Er bemerkte, dass diese im Inneren mit Wasser gefüllt war! Blitzartig trank er den Fruchtsaft aus und verschluckte sich so stark an dem Samen, der im Inneren der Frucht im Wasser schwamm, dass Landor keine Luft mehr bekam. Er versuchte krampfhaft den Samen in seinem Hals herauszuwürgen, was ihm glücklicherweise letztendlich auch gelang. Völlig erstaunt darüber pflückte Landor in Windeseile 17 Stück und stillte damit seinen unendlichen Durst.
Als er das Wasser der Früchte ausgetrunken hatte, kam ihm der Gedanke, dass er die Schalen noch essen konnte. Somit wäre es ihm möglich gewesen seinen Hunger zu stillen, welcher spürbar wurde, nachdem er seinen Durst gelöscht hatte. Langsam zerkaute er daraufhin die Schalen und schluckte sie vorsichtig hinunter, damit er sich allmählich an deren Geschmack heranzutasten vermochte. Ähnlich einer Kokosnuss kam ihm der Geschmack vor, doch fühlte es sich eher so an, als würde er ein Stück Karotte durchbeißen. Es war ein komisches Gefühl, da er durch den Geschmack der Frucht eine andere Beschaffenheit erwartet hatte.
Nachdem Landor seinen enormen Durst sowie seinen Hunger stillen konnte, legte er sich in einen schattigen Bereich des Baums. Dort erholte er sich von den Strapazen der letzten Stunden, in denen er gedacht hatte, dass er seinem Tod sehr nahe war. Als Landor seinen langen Schlaf beendet hatte, stellte er sich die Frage, wie es weitergehen sollte. Mittlerweile wollte er das Geschöpf, welches der alte Mann in seinem Tagebuch beschrieben hatte, gar nicht mehr so dringend finden. Er wollte nur noch aus dem Wald hinaus und zurück nach Höhn. Der junge Satarner sehnte sich nach seiner Wohnung, nach seinem Bett und nach der Nähe der Menschen, die in Höhn lebten. Landor bekam es mit der Angst zu tun. Er hatte Angst, dass er sich mit seinem Abenteuer übernommen hatte und den Wald nie wieder verlassen würde. Während all dieser Gedanken bemerkte er, wie ihm eine Träne über die linke Wange floss. In diesem Moment erinnerte er sich an seinen Vater, der ihm, als sein Haustier starb, einst gesagt hatte: „Konzentriere dich auf deine Gefühle, pack sie fest in deine Hand und wirf sie dann so weit wie möglich von dir weg! Die Männer aus Satar kennen keine Tränen!“ Seitdem hatte der Königssohn nicht eine Träne vergossen, selbst wenn der Schmerz noch so groß war. Mit den Worten seines Vaters im Hinterkopf nahm Landor seine Ängste und verscharrte diese nun in der tiefsten Stelle seines Verstandes. So begrub Landor mit seinen Ängsten auch die Hoffnung, das mysteriöse Wesen zu finden. Da die letzten Tage so anstrengend waren, dass sie fast in seinen Tod mündeten, wollte sich Landor für eine längere Zeit in der Lichtung erholen. Erst im Anschluss daran wollte er weiter den Ausgang des Waldes suchen.
Um sich bei der kleinen Lichtung besser ausruhen zu können, wollte Landor sich ein Bett bauen. Dazu ging er in den Wald und sammelte ganz viele kleine Äste. Während der Suche ging Landor aber nie weit von der Lichtung weg, nur so weit, dass er sie stets im Auge behalten konnte. Er befürchtete, dass sie ansonsten so schnell und auf zauberhafte Weise verschwinden würde, wie sie aufgetaucht war. Zunächst warf er die gefundenen Äste bei dem Baum in der Mitte der Lichtung ziellos hin. Neben den Ästen sammelte Landor auch sehr viele Blätter, die er ebenfalls bei dem Baum ablegte. Anschließend steckte Landor die Äste aneinandergereiht in Form eines Rechtecks in die Erde. So, dass die eingesteckten Äste die Größe eines Einzelbettes ergaben. In dieses Rechteck legte er nun die Blätter und drückte diese mit seinen Händen platt. Jetzt hatte Landor zumindest ein halbwegs vernünftiges Bett, das ihm in der Nacht eine bessere Schlafgelegenheit bieten würde als die Waldböden in den Nächten zuvor. Damit er in der Nacht nicht so sehr frieren muss, suchte Landor ebenfalls nach Steinen. Mit diesen Steinen baute er sich eine Feuerstelle, durch deren Feuer er in der Nacht Wärme gespendet bekommen würde. Die Steine zu sammeln, dauerte deutlich länger, da es nicht so viele davon in der Umgebung der Lichtung gab. Bevor es dunkel wurde, hatte er sich aber neben dem Bett auch eine Feuerstelle bauen können. Er machte ein großes Feuer, das tief in die Nacht hinein lodern sollte. Am nächsten Morgen bemerkte Landor, dass die sonderbar aussehenden Früchte, welche er vom Baum gepflückt und gegessen hatte, allesamt nachgewachsen waren. Nun hatte Landor ein Bett, endlos viel Wasser aus den Früchten des Baums und auch Nahrung, da er die Schalen der Früchte stets mitaß. Außerdem fielen in der Lichtung wärmende Sonnenstrahlen ein, die Landor das Gefühl gaben, als würde jeder einzelne Tag der erste Tag des Sommers sein. War Landor zu warm, so konnte er sich einfach in den Schatten des Baums legen. Abgesehen von anderen Menschen hatte Landor alles, was er brauchte, um glücklich zu sein. So verbrachte Landor viele Tage mit Faulenzen und vergaß mit der Zeit die Sorgen in seinem Leben. Kein Studium, keine Probleme mit seinem Vater und keine Angst mehr, dass er den Ausgang des Waldes nie wiederfinden würde. Doch so wie am Anfang alles einen gewissen Reiz hat und Freude bereitet, konnte Landor allmählich den Geschmack der Schalen nicht mehr ertragen. Seine Gedanken drehten sich von Tag zu Tag mehr um eine deftige Portion Fleisch. Ein schöner Hirschbraten, wie ihn seine Mutter in Satar als Kind immer zubereitet hatte. An etwas anderes konnte er bald nicht mehr denken. Eines Tages war es so weit. Landor suchte einen langen und breiten Ast, um aus diesem eine Waffe zu fertigen. Relativ schnell fand er einen Ast, der dafür in Größe und Stärke geeignet schien. Aus diesem Ast schnitzte er sich mit seinem Messer den ganzen Tag einen Speer, mit dem er Tiere jagen konnte, um seinem Drang nach einem leckeren Braten nachzugehen. Jedoch wollte Landor noch immer nicht aus der Sichtweite der Lichtung, da er weiterhin befürchtete, dass diese verschwinden könnte, wenn er sie einmal aus den Augen lassen würde. So kam es, dass Landor bis an den Rand der Lichtung ging und so lange wartete, bis er ein Tier sah, welches er mit seinem selbst geschnitzten Speer erlegen konnte. Landor bewegte sich stundenlang nicht von der Stelle und atmete ganz ruhig. Er wollte den Tieren nicht auffallen, sondern, dass die Tiere ihn für einen Teil der Waldlandschaft hielten. Wenn das gelänge, würden sie sich ihm nähern, wodurch er sie leichter erlegen könnte. So waren jedenfalls Landors Erfahrungen aus dem Jagen mit seinem Vater. Kurz bevor Landor aufgeben und sich eine Frucht des Baums holen wollte, um Durst sowie Hunger zu stillen, sah er einen ausgewachsenen Hasen in seiner Nähe. Landors Gelegenheit war nah. Er musste nur noch warten, bis der Hase ihm den Rücken zudrehte. Anschließend würde Landor den Speer werfen, ohne dass es der Hase hätte sehen und davonrennen können. Als der Hase sich endlich drehte und mit dem Rücken zu Landor stand, sprang Landor ruckartig auf und wollte den Speer werfen. Doch er war zu laut. Der Hase vernahm sein Aufstehen und ergriff reflexartig die Flucht. „Zum Glück hat das mein Vater nicht gesehen, er hätte mich zugleich gemaßregelt. Ich höre ihn schon reden, wie ich denn nur so blöd sein und bei der Jagd so viel Krach machen kann. Nächstes Mal muss ich es besser machen!“, sprach Landor zu sich selbst etwas enttäuscht vor sich hin.
Landor schenkte dieser vergebenen Chance keine lange Trauer und ging nach seinem missglückten Jagdversuch zu dem Baum in der Mitte der Lichtung und machte sich ein großes Lagerfeuer. Er aß vor dem Feuer noch ein paar Früchte des Baums. Da die Früchte aber zu einem Großteil aus Wasser bestanden und nur ein kleiner Teil essbar war, konnte Landor zwar seinen Durst stillen, doch sein Hungergefühl sollte nur für kurze Zeit gestillt sein. Nach ein paar gemütlichen Stunden am Lagerfeuer ging Landor in sein selbstgebautes Bett und bemerkte bereits beim Schlafengehen, dass sein Hungergefühl wiederkam. Am nächsten Morgen war das Gefühl des Hungers noch größer. Es war so groß, dass Landor gleich wieder an den Rand der Lichtung ging und dort, dieses Mal im Stehen, dem Wild auflauerte. So wäre er gleich in der Wurfposition und würde keine Geräusche beim Aufstehen wie tags zuvor machen. Bereits nach 30 Minuten sah er eine Echse. Es war keine große Echse, aber mit 25 cm Länge würde sie eine leckere Zwischenmahlzeit darstellen. Landor wartete, bis die Echse still stand und warf dann seinen Speer. „Volltreffer!“, schrie Landor jubelnd in den Wald hinein.
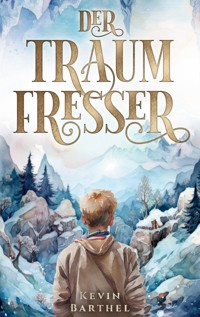













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)














