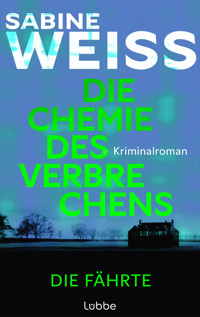12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Vom schwarzen Schaf der Familie zum weltberühmten Schriftsteller - ein packender Roman über eine Leuchtturmbauer-Dynastie und die frühen Jahre Robert Louis Stevensons, Autor von DIE SCHATZINSEL und DR. JEKYLL UND MR. HYDE
Schottland, 1868. Der fast 18-jährige Robert Louis Stevenson träumt von einem Leben als Schriftsteller. Eine Zeitlang lässt sein Vater ihn gewähren, doch als Robert sein Studium vernachlässigt und sich unstandesgemäß verliebt, muss er Edinburgh verlassen. Wenig später nimmt sein Vater ihn mit auf eine Inspektionsreise zu den Leuchttürmen, für deren Konstruktion die Männer der Familie berühmt sind: wahnwitzigen Bauten inmitten der schottischen See. Zum ersten Mal sieht Robert auch den Dubh Artach, den sein Vater gerade auf einem Riff im Atlantik errichtet - und riskiert auf der kleinen, sturmumtosten Felseninsel sein Leben. Er weiß: Bricht er mit der Tradition, wird er seine Familie verlieren. Aber kann er so wirklich leben?
Ein beeindruckender Roman über eine heute wenig bekannte Lebensphase des weltberühmten Schriftstellers
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 586
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumZitatVorbemerkungProlog123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536EpilogNachwort und DankDie Leuchtturm-StevensonsGlossarÜber dieses Buch
Vom schwarzen Schaf der Familie zum weltberühmten Schriftsteller – ein packender Roman über eine Leuchtturmbauer-Dynastie und die frühen Jahre Robert Louis Stevensons, Autor von DIE SCHATZINSEL und DR. JEKYLL UND MR. HYDE Schottland, 1868. Der fast 18-jährige Robert Louis Stevenson träumt von einem Leben als Schriftsteller. Eine Zeitlang lässt sein Vater ihn gewähren, doch als Robert sein Studium vernachlässigt und sich unstandesgemäß verliebt, muss er Edinburgh verlassen. Wenig später nimmt sein Vater ihn mit auf eine Inspektionsreise zu den Leuchttürmen, für deren Konstruktion die Männer der Familie berühmt sind: wahnwitzigen Bauten inmitten der schottischen See. Zum ersten Mal sieht Robert auch den Dubh Artach, den sein Vater gerade auf einem Riff im Atlantik errichtet – und riskiert auf der kleinen, sturmumtosten Felseninsel sein Leben. Er weiß: Bricht er mit der Tradition, wird er seine Familie verlieren. Aber kann er so wirklich leben? Ein beeindruckender Roman über eine heute wenig bekannte Lebensphase des weltberühmten Schriftstellers.
ÜBER DIE AUTORIN
Sabine Weiß, Jahrgang 1968, arbeitete nach ihrem Germanistik- und Geschichtsstudium als Journalistin. Seit 2007 veröffentlicht sie erfolgreich Historische Romane, seit 2016 zusätzlich Krimis um Kommissarin Liv Lammers und ihr Team. Mit deren Fall DÜSTERES WATT gelang ihr 2022 der lang verdiente Sprung auf die Bestsellerliste. Wenn Sabine Weiß nicht auf Recherchereise für ihre Bücher ist, lebt sie mit ihrem Mann und ihrem Sohn bei Hamburg.
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Originalausgabe
Copyright © 2024 byBastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln
Vervielfältigungen dieses Werkes für dasText- und Data-Mining bleiben vorbehalten.
Lektorat: Dr. Stefanie Heinen
Umschlaggestaltung: Massimo Peter-Bille
Vorsatzkarte: Markus Weber, Guter Punkt München
Einband-/Umschlagmotiv: © shutterstock: jumpingsack | Mari Kova | vectortatu
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7517-5610-5
luebbe.de
lesejury.de
Es gibt wohl kaum einen Leuchtturm von der Isle of Man bis nach North Berwick, den nicht einer meines Blutes geschaffen hätte. Der Bell Rock steht als Monument meines Großvaters und Skerryvore für meinen Onkel Alan. Und wenn die Lichter abends entlang der Küste von Schottland hervorkommen, dann denke ich voller Stolz, dass es das Genie meines Vaters ist, das sie heller brennen lässt.
Robert Louis Stevenson (1850–1894)
Vorbemerkung
Robert Louis Stevenson änderte mit achtzehn Jahren die Schreibweise seines zweiten Vornamens – vom schottischen Lewis, nach seinem Großvater mütterlicherseits, zur französischen Version, die jedoch nie französisch ausgesprochen wurde. Der Einfachheit halber verwende ich für ihn von Anfang an diese Version. Der Grund für die Änderung liegt weitgehend im Dunkeln. Eine Theorie besagt, dass sein Vater nicht wollte, dass sein Sohn genauso geschrieben wird wie einer seiner ärgsten moralischen und politischen Widersacher. Allerdings wirken einige Quellen, als sei die »Louis«-Version auch schon früher, u. a. von RLS’ Mutter, verwendet worden.
In diesem Roman wird an einer Stelle rassistische Sprache reproduziert. Dies entspricht in keiner Weise der persönlichen Haltung der Autorin oder des Verlags, sondern dem damals verbreiteten Sprachgebrauch.
Prolog
Edinburgh, 1857
Finsternis. Flappernde, klappernde Finsternis. Schwarz wie Ruß. Dunkelgrau gleich dem Gestein tödlicher Riffe, denen sein Papa den Schrecken nimmt. Seehundbraun wie die Leichentücher, die in den Geistergeschichten seiner Amme viel zu oft auftauchen. Die Angst lässt ihn erstarren. Heiß und kalt zugleich ist ihm. Wenn seine Eltern doch bei ihm wären! Er wagt weder, einen Laut von sich zu geben, noch zu atmen. Doch in seinem Hals krabbelt es wie in einer spinnenverseuchten Seeräuberhöhle. Weit aufgerissen seine Lider, das Herz in gestrecktem Galopp. Plötzlich blitzen im Dunkel Dämonenaugen auf, schauriges Getöse dröhnt in seinen Ohren. Nun hält er es nicht mehr aus. Sein Schrei zerreißt die Nacht: »Cummy! Sie kommen!«
Jemand umfängt ihn, neigt sich an sein Ohr. »Da ist niemand, Lou«, versucht seine Amme ihn mit sanfter Stimme zu beruhigen. Erst jetzt fällt ihm wieder ein, dass er, eng eingerollt in Decken, auf ihrem Schoß sitzt und sie gemeinsam aus dem Fenster schauen. Wie hat er das vergessen können? Es muss das Fieber sein, das ihn so dösig macht.
»Wir müssen uns nicht fürchten. Der Herr schickt uns heute Sturm. Siehe, es wird ein Wetter des Herrn mit Grimm kommen; ein schreckliches Ungewitter wird den Gottlosen auf den Kopf fallen.« Lou hört das Bibelwort in Cummys klarem Vorleseton kaum noch, denn prompt reißt der erste Huster seine Brust auf. Dass er gesprochen hat, war der Dammbruch. Weitere folgen, und bald sticht der Husten wie mit tausend Dolchen zwischen seine Rippen. Er muss ein böses Kind sein, dass Gott ihn so leiden lässt, das ist ihm trotz seiner erst sechs Jahre klar, egal was Cummy sagt. Der Hustenkrampf schüttelt ihn, bis sein Kopf zu platzen droht, seine Augen hervortreten und ihm Blut den Hals hochkriecht.
Seine Amme rückt das Senfpflaster auf seiner Brust zurecht und streicht ihm über den Rücken. Wie lieb sie ist und wie geduldig! Er ist froh, dass er sie hat. Trotz allem.
»Atme ruhig, Lou, dann lässt der Anfall auch wieder nach. Schau mal, dort hinten, dein Spielzeug. Wollen wir morgen mit dem Papiertheater spielen? Wir können auch mit den Zinnsoldaten die Schlacht von Waterloo nachstellen – das magst du doch so gern. Und wenn es dir besser geht, kann Bob dich noch einmal besuchen.«
Nichts möchte er lieber, als dass sein Cousin wieder bei ihm wohnt. Sein Blick fällt auf die Landkarten von Nosingtonia und Encyclopaedia, die sie gemalt haben. Aber er kann keine Sekunde länger über die Spiele nachdenken. Er bekommt keine Luft! Vor lauter Husten schnürt sich seine Kehle zu. Sein Leib schmerzt von der Kopfhaut bis zu den Zehenspitzen. Und draußen, vor ihrem Haus in der Heriot Row, toben noch immer die Dämonen. Er kann hören, wie sie an den Fenstern rütteln und ihn holen wollen.
»Ruhig jetzt. Wenn es dir noch schlechter geht, müssen wir den Doktor mit den Blutegeln kommen lassen. Du erinnerst dich doch sicher noch ans letzte Mal«, mahnt Cummy.
Lou heult bei der Erinnerung an die pechschwarzen, schneckengleichen Tiere auf seinen Fußrücken und das viele Blut auf seiner Haut auf. Anschließend hatte der Arzt die Wunden mit einem glühenden Eisen ausbrennen müssen. So schlimme Schmerzen! Das will er nicht – nie wieder! Panisch versucht er, Angst und Hustenreiz im Zaum zu halten. »Papa! Mama! Ich will zu ihnen!«, bricht es aus ihm heraus, obgleich er doch so gern tapfer sein möchte.
»Deine Eltern sind beschäftigt. Der Herr wacht über dich. Und ich wache über dich.«
Eine Ahnung ergreift von ihm Besitz. »Spielen sie Karten?«, fragt Lou, als nach einer Weile der Hustenanfall verebbt. Er hat Blutgeschmack zwischen den Lippen. Seine Stimme ist dünn. Allein der Gedanke vervielfacht seine Ängste noch. Kartenspiele sind Teufelswerk und führen direkt in die Hölle. Lou sieht seine Eltern im Höllenfeuer unendliche Qualen leiden.
Cummy versucht, ihm etwas von ihrer Medizin einzuflößen, dem starken, bitteren Kaffee. »Deine arme Mutter liegt krank im Bett, das weißt du doch, Lou. Und dein Herr Vater arbeitet noch.«
»Warum ist Papa nicht bei mir?« Jetzt weint Lou vor Angst und Schmerz.
»Dein Vater ist ein fleißiger Mann. Na, na, du darfst nicht immer nur an dich denken! Gott straft Selbstsucht mit harter Hand. Sei stolz, dass dein Vater der Gemeinschaft einen Dienst erweist und zum Wohle aller tätig ist.«
»Möge Gott der Herr ihn noch lange verschonen.« Heftig nickt Lou. Er dankt dem Allmächtigen im Stillen dafür, dass der Hustenanfall endlich aufzuhören scheint. Auf seiner Brust lastet ein Druck, als würde einer der Grabsteine von Greyfriars darauf liegen. Gewaltig groß und schwer sind diese Steine. Und doch haben Grabräuber sie bewegt und die Leichen aus ihren Ruhestätten gezerrt, das erzählt Cummy jedes Mal, wenn sie dort oder auf anderen Friedhöfen spazieren gehen, und sie senkt dann schaurig ihre Stimme, sodass ihm eiskalt vor Furcht wird. Lou schluckt mühsam. Furcht ist gut. Man muss über das Böse Bescheid wissen, damit man es erkennt, wenn es einem begegnet. Damit kennt seine Amme sich aus. Sie beschützt ihn und weist ihm den Weg, genau wie seine lieben Eltern.
Wieder blickt Lou durch das Fenster, das von seinem Atem milchig schimmert, auf die Straße und den gegenüberliegenden Park hinaus. Noch immer blitzen dort im Geäst drohend die Dämonenaugen. Seine Zähne klappern, als er fragt: »Siehst du diese funkelnden Augen auch, Cummy?«
Beruhigend streicht sie ihm über den Rücken. »Du meinst die Lichter? Das sind doch nur die Gaslampen in den Fenstern der anderen Häuser, Lou. Was meinst du – sitzen in der Queen Street ebenfalls kranke Kinder mit ihren Ammen und warten sehnsüchtig auf den Lampenanzünder oder die Morgendämmerung?«
In diesem Augenblick kriecht auf dem Gehweg eine warme Lichtschnur auf sie zu. »Leerie«, wispert er erleichtert. Seine Brust weitet sich, als das Licht die Finsternis erhellt, und er atmet etwas freier.
»Sieh nur, wie schön! Gedenke dankbar deiner Vorväter, denn dein Urgroßvater war es, der für die Beleuchtung Edinburghs gesorgt und so die Stadt sicherer gemacht hat. Wir müssen ihn immer in unsere Gebete einschließen.«
So andächtig, wie sie sonst nur in der Kirk beisammensitzen, sehen sie zu, wie Leerie seine Leiter an den Laternenpfahl lehnt und die Gaslaternen vor ihrem Haus entzündet. Der Anblick ist Lou ein Trost. Er lässt sich gegen seine Amme sinken. Seine Lider flattern, so schwer sind sie auf einmal. Kaum bekommt er noch mit, wie Cummy ihn aufhebt und zu seinem Bett trägt.
Lou schreit gellend. Da sind sie! Die Dämonenreiter – sie sind gekommen, ihn zu holen! Er schlägt um sich, will sich befreien, doch er ist bereits gefesselt. Ein Gewicht presst den Atem aus seinem Körper. Jemand sitzt auf seiner Brust. Höllenheiß! Berührungen. Eine Stimme, vertraut. Hilfe! Papa, Mama! So helft mir!
Tatsächlich: Jemand ist da, will ihn befreien. Ist das Cummy? Er starrt sie an. Lou erkennt seine Amme und erkennt sie doch nicht. Ihr Gesicht wirkt wie eine teuflische Fratze, voller unheimlicher Schatten. Der Raum um ihn herum scheint zu schrumpfen, ihn zu erdrücken. Husten und Atemnot schütteln ihn erneut. Nur einen gibt es, der ihm helfen kann.
***
Die Glaslinsen oder Prismen in den Leuchttürmen sollen jeden Tag gereinigt werden. Zunächst sollen sie mit einer Feder oder einem weichen Pinsel vom Staub befreit werden, dann werden sie poliert mit weichem Gamsleder, das ledig ist von allem, was das Glas beschädigen könnte. Wenn das Glas fettig wird …
»Papa!«
Tom schreckt hoch, als er das Kreischen seines Sohnes vernimmt. Cummy, wie auch er Alison Cunningham, die Amme seines einzigen Sohns, nennt, hat ihm versichert, dass es Lou besser gehe und er nun schlafen würde. Das scheint jedoch nicht der Fall zu sein. Ohnehin hat der Sturm Tom abgelenkt. Er hat bereits eine ausführliche Notiz in seinem Journal vorgenommen, denn noch am Nachmittag hat nichts diesen Wetterumschwung angekündigt – eine Tatsache, die er als persönlichen Affront betrachtet. Niemand kennt das Wetter besser als er.
Ein weiterer Schrei durchschneidet die Nacht. Eilig verstaut Tom die neue Fassung der Instruktionen für Leuchtturmwärter, die er und sein Bruder David gerade formulieren, in einer Mappe. Beide haben sie so viel Arbeit, dass er sich regelmäßig Akten mit nach Hause bringt. Alles muss schriftlich festgelegt werden, damit es reibungslos funktioniert, das weiß er inzwischen. Doch heute wird er damit nicht fertig werden. Offenbar hat Lou wieder einen seiner fiebrigen Albträume, bei denen er wie von Sinnen ist. Hoffentlich wird es ihm gelingen, seinen Sohn daraus zu befreien. Eilig kommt er auf die Füße.
»Was ist mit unserem liebsten Smout?« Maggie klammert sich in ihrem Nachtgewand an den Türpfosten, als würde sie gleich ohnmächtig. Sie ist eine blonde Schönheit, scheint ihrem Sohn aber leider ihre schwächliche Konstitution vererbt zu haben. Heftige Sorge um Robert Louis, den sie liebevoll »Smout« nennen – eigentlich ein einjähriger Lachs, aber bei den Schotten eine beliebte Bezeichnung für ein kleines Wesen –, verzerrt ihre Züge. Von tiefer Angst um seine beiden Liebsten erfüllt, umarmt Tom sie und trägt sie zurück ins Bett. Bitte, Herr, verschone uns noch ein wenig!
»Nur ein schlechter Traum, ich kümmere mich um Baron Breitnase«, versichert er ihr. »Du musst dich ausruhen. Alles wird gut werden, Liebling. Gott wird für uns sorgen.«
Er liebt es, Lou Spitznamen zu geben, was Maggie üblicherweise aufheitert. Heute jedoch nicht. Tom bettet seine Gattin auf die Laken, als Lou erneut aufheult – ein Geräusch, das ihm das Herz zerreißt und das seiner Frau ebenso, das sieht er ihr an. Hastig küsst er Maggie auf die Stirn und eilt nach oben.
Lou glüht vom Fieber. Hemd und Haare kleben feucht an seiner Haut, die Decke hat sich um seinen Körper geschlungen und schnürt ihn ein. Cummy versucht, das Kind aus dem Stoffwust zu befreien, aber Lou tobt wie von Sinnen. Mehrfach entschuldigt sie sich, dass Tom gestört wurde.
»Ich weiß, dass du dein Möglichstes getan hast, Cummy«, versichert er ihr abgelenkt, reißt die Decke ab und nimmt seinen um sich schlagenden und schreienden Sohn auf den Arm. Lou wiegt fast nichts, seine spitzen Knie und Ellbogen stechen in Toms Fleisch. Behutsam schaukelt Tom seinen Sohn und redet auf ihn ein, um ihn abzulenken. Was soll er nur sagen? »Du glaubst gar nicht, was mir der Kutscher heute Abend erzählte …«, beginnt er.
Gleichzeitig beruhigt er sich mit diesem Geplapper selbst. Tom ist kein Mann, der leichtfertig seine Gefühle zeigt. Ein Gentleman wahrt stets die Fassung und beweist Gleichmut, so hat er es gelernt, und so handhabt er es. Zudem ist er von einem tiefen Gottvertrauen erfüllt. Wenn Gott eine Entscheidung trifft, muss er diese klaglos hinnehmen – selbst wenn der Herr entscheiden sollte, Lou zu sich zu holen.
Sein Gemüt verdüstert sich. Oft genug ist Tom dem Tod begegnet. Von seinen neun Geschwistern weilen nur noch fünf auf der Erde. Seine Mutter ist im Himmelreich, und seinen Vater nahm Gott kurz vor Lous Geburt zu sich.
»… und dann hat der Kutscher doch tatsächlich gesagt …«, fährt Tom mit fester Stimme fort. Die Klagelaute verebben langsam.
Eine Eisenklammer scheint sich um sein Herz gelegt zu haben. Während er die belanglosen Dialoge mit Kutschern oder Seeleuten rekapituliert, die Lou wieder zu Sinnen zu bringen scheinen, flattern seine Gedanken in schierer Panik durcheinander. Sein Sohn, Robert Louis Stevenson, soll dereinst sein Erbe antreten. Er soll die Familie der Stevensons, die Dynastie der Leuchtturmbauer und Ingenieure, zu einer weiteren Blüte führen, soll seinem Leben einen Sinn geben, sein Werk abrunden.
Toms Blick verschwimmt, als die Arme seines Sohnes seinen Hals umklammern und der Junge seine glühende Stirn in seine Halsbeuge bettet. Lou ist klein und zart, ein Hänfling, und von Geburt an kränklich. Der Gedanke, dass die Frucht seiner Lenden, dieses kostbare Wesen, das ihn und Maggie schon so oft zum Staunen und Lachen gebracht hat, sterben könnte, verstört ihn zutiefst. Ihm schießt durch den Kopf, wie Lou, als er kaum einen Stift führen konnte, einmal einen Mann malte und fragte: »Soll ich auch seine Seele malen?«
Ein verzweifeltes Keuchen steigt in ihm auf. Oh, das unbefleckte Gottvertrauen eines Kindes! Tom spürt, dass Lou dem Tode nahe ist. Wieder einmal. O Herr, verschone unseren Lou!
1
Edinburgh, Anfang Mai 1868
Um ihn herum Meer. Kein Land, so weit das Auge reicht, einzig das blaue Samtband des Horizonts. Züngelnde, glucksende Wellen. Gurgelnde Strömungen. Sprühende Gischt, die Regenbogen in den Himmel malt. Er steht auf einem kleinen Felsen im Nichts. Rutschig und feucht ist der Untergrund, von Muscheln und Seepocken gezeichnet. Ein paar Quadratmeter Gestein nur, mit wenigen Schritten zu ermessen. Eine Böe durchzaust sein Haar. Der Geruch von Rauch und schmelzendem Eisen mischt sich in den Algendunst des Meeres. Orangerote Flammen züngeln ins Blau.
Er hört das Hämmern von Eisen auf Eisen, von Metall auf Stein oder Holz. Nun befreit er sich aus dem Bann dieser Eindrücke, zwingt sich in rationalere Gedankengänge zurück. Nur für wenige Stunden ragt dieses Riff aus dem Meeresspiegel. Die meiste Zeit tanzen über ihm die Wellenkämme, überqueren ihn Fischschwärme. Bald ist es wieder so weit, der Pegel steigt. Bald raubt das Meer ihm den Grund, auf dem seine Füße Halt finden. Dennoch hat er keine Angst, ebenso wenig wie die Arbeiter um ihn herum. Es ist ein klarer Tag mit diamantenfunkelnden Meeresspitzen, und nichts weist auf das Herannahen eines Sturms hin. Sie können sich unbesorgt auf ihr Geschäft konzentrieren.
Auf dem beengten Stein tummeln sich zweiunddreißig Männer und werkeln. Ein Jeder ist ein Meister seines Fachs. Die zwei Schmiedeöfen spucken Flammen, die Ambosse singen unter den rhythmischen Schlägen. Sie schärfen die Spitzhacken, Meißel und Brecheisen, die an dem Granit rasend schnell stumpf werden. Alle Gesichter schimmern zufrieden über das, was sie schon jetzt erreicht haben. So wie auch sein Herz beim Anblick der Baustelle vor Stolz zu jubilieren beginnt.
Das Fundament des Leuchtturms ist gelegt. Ein makelloses Rund wurde in den Stein gekerbt, ein perfekter Ring von Steinen eingepasst, jeder so exakt an den anderen und an den Felsgrund geschmiegt, dass kein Wassertropfen die Ritzen durchdringen wird. Eine technische Meisterleistung, denn jeder tonnenschwere Stein wird nach seinen Berechnungen an Land zurechtgehauen und nummeriert, mit dem Schiff zu diesem Riff geschippert und mithilfe von Seilwinden von dem schwankenden Boot auf den Felsen gewuchtet – ein ums andere Mal ein lebensgefährliches Unterfangen. Zuletzt wird er von den Arbeitern im Schwalbenschwanz-System verlegt und gegebenenfalls im Feinschliff angepasst. Ein gigantisches Puzzle, damit die Bausteine nicht zum Spielball der Wellen werden. Überhaupt ist der Bau dieses Leuchtturms ein Kampf auf Leben und Tod. Es ist ein Bauwerk, das die meisten für unmöglich halten. Und das dank seiner Berechnungen und der Kunstfertigkeit seiner Männer dennoch gelingen wird. Gelingen muss. Sonst ist sein Ruf ruiniert. Sonst ist es um ihn und die Seinen geschehen.
Aus dem Augenwinkel bemerkt er eine Bewegung. Was ist denn mit der Smeaton, dem Schiff, das sie auf den Felsen brachte und auch wieder an Land bringen soll? Die einmastige Sloop ist von ihrem Liegeplatz abgedriftet und treibt nun, anscheinend führerlos, von ihnen weg. Sie muss sich von der Mooring abgerissen haben.
Sprachlos beobachtet er sie, wie vom Schlag getroffen, unvermittelt hin- und hergerissen zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Die Smeaton muss zurückkehren, denn wenn die Flut zunimmt, werden sie sonst jämmerlich ersaufen. Todesangst ergreift von ihm Besitz. Er will seine Männer warnen – und beißt sich doch auf die Zunge. Wenn sie in Panik geraten, können sie ihr Leben durch unüberlegte Rettungsversuche erst recht gefährden.
Das Hämmern verklingt tröpfelnd. Der erste Arbeiter hat bemerkt, dass die Smeaton weit abgedriftet ist, und die anderen nehmen nun sein Erstarren wahr. In dieser kleinen Gemeinschaft und in dieser lebensfeindlichen Umwelt nimmt jeder die kleinste Nuance wahr. Sie alle sind menschliche Seismografen. Blass werden sie, ihre Augen sind schreckgeweitet. Und doch sagt keiner auch nur ein Wort. Ihre Blicke flackern in die Runde, halten sich hilfesuchend an seinem fest.
Bleischwer legt sich die Verantwortung auf seine Schultern. Jeden Arbeiter hat er handverlesen. Er kennt jede Lebensgeschichte, viele Familien, die meisten ihrer Hoffnungen und Nöte. Aber er kann nichts tun, außer Zuversicht zu zeigen und im Stillen zu beten. Zu rufen wäre vergebens, denn die Besatzung der Smeaton weiß, wie es um sie steht. Es muss ein gravierendes technisches Problem geben, das sie davon abhält, zu ihnen zu kommen.
Als wäre nichts geschehen, arbeitet er weiter. Seine Männer folgen seinem Beispiel, in stillem Entsetzen. Eine erste Welle nässt seinen Fuß, bald umspielen weitere seine Beine. Der Meeresspiegel steigt schnell. Eisige Kälte kriecht mit jedem Tropfen tiefer in seinen Körper. Er unterdrückt ein Beben. Als die Arbeit unmöglich wird, verstauen die Männer das Werkzeug. Ruhig, wie unter einem Bann. Nur an ihren flatternden Händen und den sich in stummen Gebeten öffnenden Mündern sieht er, wie es um sie steht. Ebenso wortlos scharen sie sich um die Anlegestelle für die beiden kleineren Boote, die üblicherweise zum Transport des Proviants verwendet und die nun langsam vom Meer eingekesselt werden. Bange, aufgewühlte Blicke huschen hin und her. Diese Boote werden niemals für sie alle reichen. Wer wird sich retten können, wer muss sterben?
Die Smeaton ist inzwischen weit abgeschlagen, zu weit. Doch nichts geschieht. Keiner kämpft um seinen Platz in einem der Rettungsboote, keiner stößt seinen Nächsten ins Wasser, um selbst zu überleben. Die melancholische Feierlichkeit seiner Leidensgenossen beeindruckt ihn tief. Er will seinen Männern befehlen, allen Ballast von den Booten zu schaffen, doch die panische Angst verschlägt ihm die Stimme. Wird auch er hier und jetzt sterben?
Verstört und schweißnass schreckte Louis hoch. Er brauchte seinen Puls nicht zu fühlen, er wusste auch so, dass er viel zu schnell war. Keuchend sog er die Luft ein, versuchte, seinen Atem in einen ruhigeren Fluss zu bringen. Allzu lange war er gestern in die Notizen seines Großvaters eingetaucht, statt zu erledigen, was ihm aufgetragen worden war. Staubtrockene Fleißarbeit war nichts für ihn, und das hatte er nun davon. Schon als Kind hatte er ständig geträumt, und vor allem die Albträume waren ihm bis heute geblieben. Er erinnerte sich noch genau, wie dankbar er als Kind jeden Morgen gewesen war, wenn das Licht die Dunkelheit vertrieben hatte; stets hatte er das Gefühl gehabt, noch einmal verschont worden zu sein. Manchmal ging es ihm heute noch so. Neulich hatte er geträumt, er liege auf dem Sektionstisch der Chirurgenfakultät, lebendig, aber erstarrt, sodass alle ihn für tot hielten und unbesorgt das Messer ansetzten – ein mageres Lernobjekt.
Louis schälte sich aus dem Bett. Auf seinem Schreibtisch lagen Unmengen aufgeschlagener Bücher, Briefpapiere, aufgerissene Umschläge, die Mappe, die er so schmählich ignoriert hatte. Die Standuhr schlug. Er hatte verschlafen. Auch das noch! Warum hatten ihn weder Cummy noch das Dienstmädchen geweckt? Nun hatte sein Vater einen Grund mehr, ihm eine Strafpredigt zu halten. Und das war das Letzte, was er wollte, liebte und bewunderte er Tom doch sehr.
Schnell sprang er aus dem Bett, schob die Samtvorhänge an den hohen Fenstern beiseite und warf einen prüfenden Blick hinaus. Graue Wolken kratzten über die Bäume der Queen Street Gardens, was nichts bedeuten musste. Oft genug präsentierte einem der launische schottische Wettergott alle Jahreszeiten an einem Tag, manchmal sogar in einer Stunde. Er wusch sich flüchtig, ignorierte die anderen Annehmlichkeiten des modern ausgestatteten Bades. Sicherheitshalber zog er das Flanellhemd unter, das seine Kinderkrankenschwester ihm bereitgelegt hatte; in der Universität pfiff der Wind durch die altehrwürdigen Räume. Er schlüpfte in Hemd, Hose und sein Lieblingsjackett – Samt mit Borten –, steckte seine Lektüre in die eine Tasche und das Notizbuch in die andere und eilte ins Treppenhaus.
Durch das ovale Oberlicht erhellte zitronenfarbenes Licht die mit Orientteppichen bedeckten Steinstufen, brachte Silberleuchter und die Tafel mit dem Wappen der Stevensons zum Strahlen. Ab in den Speisesaal, in dem es nach frischem Tee und Brötchen duftete! Ein heimeliges Ambiente mit Stuckdecken, etlichen Gemälden und Schränkchen in Nischen, auf denen Gaslampen und Kristallvasen thronten, und einem großen Kamin. Seine Mutter saß noch vor dem Porzellangeschirr und besprach mit der Köchin die nötigen Einkäufe für das nächste Dinner. In ihrem schlichten Seidenkleid mit den eng anliegenden, in Rüschenvolant mündenden Ärmeln und mit den streng hochgesteckten Haaren wirkte Maggie schmal – eine Folge der Diphterie-Erkrankung, die sie zur Jahreswende an den Rand des Todes gebracht hatte. Sofort umsprangen ihn ihre Hunde, zwei wuselige, zottelige Skye Terrier. Er herzte besonders Coolin, den er seit seiner Kindheit liebte.
Bei seinem Anblick sprang Maggie auf. »Smout, du siehst ja furchtbar aus! Hast du schlecht geschlafen?«
Auch wenn ihm klar war, dass die Anrede für einen jungen Mann von beinahe achtzehn Jahren unangemessen war, genoss er den liebevollen Ton, zumindest solange seine Mutter ihn nicht in der Öffentlichkeit anschlug. Maggie war mit ihren neununddreißig Jahren noch immer ansehnlich, ihre Haltung graziös, die Züge ebenmäßig. Er ließ zu, dass sie seine Stirn berührte.
»Kein Fieber, was für eine Erleichterung! Dein Vater fühlt sich ebenfalls kränklich. Natürlich ist Tom trotzdem ins Büro gegangen.« Sie runzelte die Stirn. »Allerdings erst, nachdem er einige Zeit auf dich gewartet hat.«
»Ich hoffe, er war nicht allzu wütend. Ein Albtraum hielt mich gefangen.«
»Du Armer! Ich habe immer gehofft, dass sich dieses Leiden deiner Kindheit einmal legen würde.« Maggie seufzte gottergeben. »Aber was sollen wir damit hadern! Gott hat es so eingerichtet, und deine Fantasie wird schon einen Sinn haben. Sie sucht sich einen Weg, und ich bin sicher, dass sie dir in deiner zukünftigen Profession dienlich sein wird. Ingenieure müssen einfallsreich sein, das weißt du. Du brauchst ein ordentliches Frühstück, dann wird es dir besser gehen.«
Sie schickte die Köchin weg, und noch ehe er The Scotsman aufgeblättert hatte, brachte das Dienstmädchen ein Tablett mit Toast, Speck, Ei, Kartoffelscones und Haferkeksen. Nach den Einzelheiten seines Albtraums fragte Maggie nicht, denn unangenehme Dinge galt es ihrer Meinung nach zu ignorieren. Seine Mutter hatte das Talent, ihre Aufmerksamkeit auf die schönen Dinge des Lebens zu richten. Vermutlich eine Fähigkeit, die sie in ihrer Kindheit erworben hatte, denn ihr Vater war ein Geistlicher der alten Schule gewesen und chronisch brummig. Dennoch schien sie etwas zu bedrücken.
Louis ließ die Zeitung sinken und berührte ihre Hand. »Was schlägt dir aufs Gemüt, liebste Mama? Sorgst du dich so sehr um Vater?«
Ein zerknirschter Blick. »Tom war ungehalten. Er hat erwartet, dass du ihm spätestens heute Morgen die kopierten Briefe, den Bericht und die Zeichnungen gibst, die er dir aufgetragen hat.«
Das schlechte Gewissen durchzuckte ihn, aber Louis ließ sich nichts anmerken. Er wollte das Beisammensein mit seiner Mutter nicht mehr als nötig durch die Auseinandersetzungen mit seinem Vater überschatten. Seine Eltern waren von sehr unterschiedlichem Temperament, und er genoss die unbefangenere Leichtigkeit und den Optimismus seiner Mutter. »Ich werde Vater sogleich aufsuchen. Hoffentlich schaffe ich es noch vor meinem Kurs.«
»Dein Studium geht vor.« Maggie straffte sich. Sie sah aus dem Fenster und lächelte. »Tom hat bereits seine Aufzeichnungen mit den Messungen seiner Wetterstation abgeglichen. Es verspricht ein schöner Tag zu werden.«
Die Haltung seines Vaters zu seinem Studium war weniger eindeutig als die seiner Mutter. Tom hielt die Ausbildung bei D & T Stevenson, Ingenieure für wichtiger als das Geschwätz an der Universität. Im täglichen Geschäft lerne man die Praxis, das Universitätsexamen brauche man lediglich, um die Ausbildung zu vervollkommnen und einen angesehenen Abschluss vorweisen zu können, betonte er oft. Deshalb hatte Louis mit Beginn seines Studiums auch Tätigkeiten im Ingenieurbüro übernehmen müssen. So hatte es bereits sein Großvater mit seinen Söhnen gehandhabt, und der Erfolg schien ihm recht zu geben. Louis haderte jedoch mit diesem Vorgehen. Die langweiligen Rechenaufgaben oder Kopierarbeiten schob er möglichst lang vor sich her. Er ließ sich allzu bereitwillig ablenken, schrieb weiter an seinen Gedichten oder Geschichten – wovon sein Vater nichts wissen durfte – oder schmökerte in einem Roman. Wenn er sich schon mit der Baukunst beschäftigte, dann las er in aufregenderen Berichten wie den Erinnerungen seines Großvaters an den Bau des Bell Rock Leuchtturms, bei dem er und seine Männer beinahe Opfer der See geworden wären. Erneut stand Louis das Bild der auf dem Riff eingeschlossenen Männer so lebhaft vor Augen, als sei er selbst dabei gewesen.
Ehe er seine Mutter auf die Geschehnisse ansprechen konnte, erhob sich Maggie und rückte den Strauß Narzissen, den Tom ihr gestern geschenkt hatte, zurecht. »Du entschuldigst mich? Ich muss noch für das Dinner und unseren Aufenthalt in Swanston planen. Du weißt schon: Stoff für die Vorhänge kaufen und so weiter. Frauenkram eben.« Sie lachte.
Nun warf auch Louis seine Serviette auf den Teller. Angesichts dessen, was er heute noch alles bewältigen musste, hielt ihn nichts mehr auf seinem Sitz. Keine Zeit für die übliche Morgenpfeife. Er musste sich dringend etwas einfallen lassen, um seinen Vater hinzuhalten, denn dessen Gefühle schlugen leicht um, und seinen Zorn konnte Louis kaum ertragen. Cummy reichte ihm an der Tür seinen Mantel und einen Regenschirm. Mit Mitte vierzig hätte sie längst eine eigene Familie und erwachsene Kinder haben sollen, stattdessen war Cummy aus Verbundenheit zu ihm und seinen Eltern bei ihnen geblieben. Ihre Augen lagen tief in dem blassen Gesicht, dem durch die hellen Augenbrauen die Konturen fehlten. Die kastanienbraunen Haare hatte sie straff zurückgebunden, und auch ihr Kleid war, ihrem Stand und ihrem Glauben entsprechend, schlicht. Dennoch war sie für Louis wie eine zweite Mutter, eine Gefährtin, auf die er vertrauen konnte. Gleichzeitig sehnte er sich danach, sich auch aus ihrer liebevollen Umklammerung befreien zu können. Würde er denn immer Kind bleiben?
»Das ist sehr nett, Cummy, aber ich hätte meine Ausgehsachen wohl selbst gefunden«, sagte er, als Cummy ihm auch Hut und Handschuhe hinhielt. Sogleich bereute er, diesen scharfen Ton angeschlagen zu haben, schließlich hatte seine Amme ihn geduldiger als ein Engel während all der Krankheiten seiner Kindheit gepflegt. Und das waren viele gewesen – ein Wunder, dass er überhaupt überlebt hatte.
Die Krankenschwester blieb gleichmütig, gleichmütiger zumindest als seine Mutter, die schon bei leichten Spannungen dünnhäutig reagierte und bei Streitereien schnell hysterisch wurde. »Na, na, Sie dürfen nicht leichtsinnig werden, Master Lou. Ich weiß, Sie fühlen sich im Moment gut, und das Wetter scheint angenehm. Aber bei Ihrer zarten Konstitution …« Sie wartete darauf, dass er Hut und Handschuhe anlegte. »Sie wissen genau, dass ich diejenige sein werde, die Sie pflegt, wenn Ihr Lungenleiden Sie wieder aufs Lager wirft, Master Lou. Sie sollten dankbar sein, dass der Herr Sie so lange verschont hat, und nicht leichtfertig mit Ihrem Leben spielen. Und, wo ich schon dabei bin«, ein verschmitztes Lächeln huschte über ihre müden Züge, »achten Sie darauf, den Versuchungen des universitären Lebens aus dem Weg zu gehen. Der Teufel hat überall seine Fallstricke ausgelegt, und man erzählt sich, dass an der Universität auch die Papisten ihr Unwesen treiben.«
Louis hätte am liebsten entnervt aufgestöhnt, beherrschte sich aber und schlüpfte in die Handschuhe. »Danke für die Mahnung, Cummy. Ich werde mich wunschgemäß von den Katholiken fernhalten.« Er setzte den Hut schief und grinste, bemüht, seinen Ton zu entschärfen. »Heute gibt es nur Gesang und Theater – und Glücksspiel, natürlich.«
Obgleich sie wissen musste, dass er es nicht ernst meinte, erschauderte sie sichtlich. »Lassen Sie das nicht Ihre lieben Eltern hören. Damit macht man keine Scherze, Master Lou.«
Als Louis auf die Heriot Row trat, brach ein Sonnenstrahl durch die Wolken und ließ das Treiben auf den breiten Straßen der Neustadt in schönstem Licht erstrahlen. Die Fassaden der eleganten Steinhäuser warfen die Sonne zurück, die lackierten Türen, frisch polierten Fenster und Messingklopfer strahlten um die Wette. Hier in New Town konnte man leicht vergessen, woher Auld Reekie, die Alte Verräucherte, wie Edinburgh in liebevollem Verdruss genannt wurde, ihren Spitznamen hatte.
Auch die Menschen hatten sich herausgeputzt: eine Parade von Reifröcken, dreiteiligen Anzügen, Lackschuhen und Zylindern, Dienstmädchen in reinweißen Hauben und Schürzen, Diener in dezenten Anzügen. Kutschen klapperten vorbei, Kaufleute trieben ihre Zuggespanne den Hügel hinauf.
Louis zog den Hut vor vorbeispazierenden Nachbarn und warf auch den fliegenden Händlern vor den Queen Street Gardens einen Gruß zu. Seine Laune hob sich, und er atmete leichter, als er die Straße überquerte und an dem privaten Park, für den nur Anwohner den Schlüssel hatten, entlang hügelaufwärts ging. Zu allen Seiten der Straßenfluchten tat sich Edinburghs Panorama auf. Durch die Hügellage und das nahe Meer bot die Stadt immer neue Ausblicke, die Louis zum Weiterlaufen und Entdecken reizten: die grünen Klippen der Salisbury Crags und Pentland Hills, der blaue Spiegel des Meeres, das Straßengewirr der entlegeneren Stadtviertel. Nichts machte seinen Kopf und sein Herz freier, als draufloszuspazieren und Menschen zu beobachten. Höchstens, an der Waverley Station zu stehen und davon zu träumen, kurzerhand in einen Zug zu steigen und in den Süden zu fliehen.
Als ihn ein Junge in einem Hundewagen passierte, der fröhlich vor sich hin sang, war Louis kurz versucht, das Notizbuch zu zücken und seinen Eindruck in Worte zu fassen. War der Junge wirklich fröhlich, war er unbeschwert oder aufgekratzt? Und wie könnte er das Aussehen des Gespanns beschreiben, ohne abgegriffene Formulierungen zu benutzen? Unwillig riss er sich von dem Anblick los, die Zeit drängte. Viel zu schnell hatte er die George Street erreicht, wo sich zur Rechten das Büro des Vaters befand. Ein Blick auf die Taschenuhr zeigte ihm, dass die Zeit bis zum ersten Universitätskurs knapp war. Er würde das unangenehme Gespräch mit seinem Vater verschieben müssen.
Louis kreuzte die Princes Street, eine Vergnügungsschneise mit brausendem Verkehr. Vor ihm schob sich auf ihrem Vulkanfelsen die Burg in den Himmel, links von ihm steuerte die Princes Street dem Calton Hill mit seinen im antiken Stil gehaltenen Monumenten und dem Nelson-Gedenkturm entgegen, und dort, in der Ferne, ragte Arthur’s Seat auf, erstarrte Lava mit grüner Haube. Louis liebte diese Aussicht. Er passierte die Senke mit dem weitläufigen Garten und marschierte den künstlich geschaffenen Hang The Mound empor, der beim Bau der New Town geschaffen worden war und Alt- und Neustadt verband. Ein Dudelsackspieler aus dem Hochland nutzte die besondere Akustik zwischen den antik wirkenden Säulen der Schottischen Nationalgalerie und der Königlich Schottischen Akademie und hatte mit seiner mitreißenden Melodie bereits viele Zuhörer angelockt.
Hügelauf wanderte Louis zur Altstadt. Die Anstrengung machte ihn kurzatmig. Es war noch nicht lange her, dass ihn sein Lungenleiden zuletzt aufs Bett geworfen hatte, aber Louis war entschlossen, sich von seiner körperlichen Fragilität nicht einschränken zu lassen. Er verschnaufte kurz, marschierte aber weiter, als er ein Studentengrüppchen herannahen sah, vor dem er sich keine Blöße geben wollte. Statt der breiten Straße weiter zu folgen, steuerte er den Lady Stair’s Close an, einen der schmalen Gänge, durch den er die Neustadt verließ und in die Altstadt mit ihren Wynds und Closes, ihren düsteren Winkeln und Abgründen eintrat. Es war finster und roch nach Urin, und als Louis eine abgerissene Gestalt entgegenkam, schlug sein Herz schneller.
Nur ein verwahrloster Zeitungsverkäufer, stellte er erleichtert fest; betrunken, aber harmlos. Die Kurse an der Universität erfüllten ihn mit gemischten Gefühlen, aber die Freiheit, durch sein Studium durch die Stadt streifen und sich den Tag selbst einteilen zu können, genoss er. Es gab Verpflichtungen genug, denen er nachkommen musste: die Mahlzeiten mit seinen Eltern, die Pfeife nach dem Abendessen mit seinem Vater, das gemeinsame Nachtgebet, die sonntäglichen Kirchbesuche.
Er trat auf den Lawnmarket hinaus und blickte ins Gassengewirr von Old Town. Die Häuser schluckten mit ihrer gewaltigen Höhe den Großteil des Lichts. Krumm und schief waren die meisten, weil man in den überfüllten Vierteln notdürftig Stockwerk um Stockwerk angebaut hatte. Sie lehnten sich aneinander, als würden sie andernfalls umstürzen. Nur schmale Streifen Himmel schienen zwischen ihnen auf.
Louis ging an der Tolbooth Kirk vorbei, über die George-IV.-Bridge bis zur imposanten Advocates Library, dann hinunter in die Cowgate, wo ihn der Anblick der vielen bitterarmen Iren, die hier lebten, den Schritt beschleunigen ließ. Fahle Kindergesichter an den Fenstern, freundlos und gleichgültig. Keifende Betrunkene zu jeder Tageszeit, bettelnde Frauen, dreckstarrende Männer. Dazu die vielen Pfandleiher, deren Waren an gescheiterte Leben mahnten. Er hätte einen leichteren, kürzeren Weg nehmen können, aber ihn faszinierte diese fremde Welt, und die Momente, in denen er in sie eintauchen konnte, verursachten ihm ein Prickeln. Edinburgh war mit knapp vierhunderttausend Einwohnern nicht nur die zweitgrößte Stadt Großbritanniens, sie war mehrere Städte zugleich.
Bald tauchte an der South Bridge das Universitätsgebäude vor ihm auf. Louis atmete tief durch, gab sich einen Ruck und durchschritt sodann das hohe Tor seiner Alma Mater. Er konnte sich glücklich schätzen, dass er in dieser Hochburg der Aufklärung und Gelehrsamkeit, dem Athen des Nordens, studieren durfte. Dennoch erfüllte ihn der Besuch der Universität mit Unbehagen und dem unbestimmten Gefühl, nicht zu genügen. Seine Schullaufbahn war eine Abfolge von Krankheitsausfällen, wechselnden Schulen und Privatlehrern sowie Bildungsreisen mit seinen Eltern gewesen. Er hatte England und Frankreich, Italien und Deutschland bereist – doch die korrekte Rechtschreibung beherrschte er in keiner Sprache, und seine mathematischen Fähigkeiten ließen zum Verdruss seines Vaters noch immer zu wünschen übrig. Während der kurzen Zeit, in der er gern zur Schule gegangen war, hatte er an einer Schülerzeitschrift gearbeitet. Allerdings hatte es nur eine Ausgabe gegeben, und alle Artikel waren von ihm gewesen.
Die Glocke rief zum Kursbeginn. Studenten strömten über das Geviert des Innenhofs den Räumen entgegen, und er schloss sich seinen aufgeregt plappernden Kommilitonen an.
»Stevenson, alter Freund und Leidensgenosse! Die Ringe unter deinen Augen lassen mich erahnen, dass du dich die ganze Nacht hingebungsvoll der Prüfungsvorbereitung gewidmet hast«, riss sein Freund James Walter Ferrier ihn mit samtiger Stimme aus den Gedanken. Ferrier war einer seiner ältesten Freunde. Extrem gutaussehend wirkte er in seinem Anzug, und dank der Weste mit Korallenknöpfen ungemein lässig. Ferrier gab sich stets den Anschein, er habe es nicht nötig zu studieren – wie alter Adel, der von seinen Besitztümern lebte. Sein Vater war ein bedeutender Philosophieprofessor an der St Andrews University und durchaus wohlhabend. Vielleicht hing Ferriers Lässigkeit aber auch damit zusammen, dass er von klein auf mit philosophischen Theorien gefüttert worden war und daher über den Dingen stand.
Louis hatte gerade ebenfalls eine Erkenntnis durchzuckt, allerdings keine angenehme: Wie hatte er vergessen können, dass Professor Tait, der Naturphilosophie unterrichtete, eine Wissensabfrage angekündigt hatte?
Ehe er Ferriers Mutmaßung bestätigen konnte, um nicht blöd dazustehen, hatte Maconochie, der neben ihnen ging, ihn bereits durchschaut. »Du hast es verpennt?«
»Nonsens. Wie könnte ich?«, versuchte Louis, seine Überrumpelung zu überspielen. »Ich habe mich in den letzten Tagen mit nichts als Naturphilosophie beschäftigt.« Ganz gelogen war das nicht. Er hatte sich auch damit beschäftigt. In gewisser Weise zumindest.
»Genau wie ich, Kumpel. Wie es sich für einen Studenten dieser altehrwürdigen Kathedrale des Wissens gehört.« An Ferriers amüsiert gekräuselten Lippen erkannte Louis die Ironie.
Ein wenig getröstet ließ Louis sich in den Raum schieben. Vielleicht würde er sich auch dieses Mal mit seinem Allgemeinwissen durchmogeln können. Als Schüler der Edinburgh Academy hatte er Naturgeschichte geliebt, weshalb er sich beispielsweise mit Vögeln ausgezeichnet auskannte. Allerdings standen die Chancen schlecht, dass Tait sie hierzu befragen würde, denn dieser hatte sie zuletzt mit Themen wie Thermodynamik oder Gravitation traktiert, die Louis’ Aufmerksamkeit zuverlässig abschweifen ließen.
Die ersten Bänke waren wie stets von Musterstudenten und ehrgeizigen Landwirtssöhnen besetzt, die typisch für Edinburgh waren, wo die Studenten anders als an englischen Universitäten nicht aus einem elitären Zirkel Bessergestellter stammten. Louis schob sich auf seinen Stammplatz in der letzten Bank, Ferrier und Maconochie nahmen neben ihm Platz. Auch hier füllte sich die Reihe so, dass sich auf der abgewetzten, speckigen Schreibplatte schließlich Ellbogen an Ellbogen drängte.
Professor Tait betrat den Raum, ein drahtiger Gentleman, den Louis üblicherweise mit einem Gespräch über Golf – Taits große Leidenschaft – vom drögen Unterricht abhalten konnte. Dieses Mal ließ Tait sich jedoch nicht ablenken. Die Prüfung bestand aus einer Abfrage von Begriffen, und Louis bemerkte zu seinem Entsetzen schnell, dass kaum einer davon ihm etwas sagte, also entschied er sich, die Aufgabe umzuwidmen und besonders absurde Definitionen zu liefern. Wenn er schon scheiterte, wollte er wenigstens Spaß haben. Das Risiko, dass sein Vater, der mit Tait befreundet war, von den albernen Antworten erfuhr, musste er in Kauf nehmen.
Als der Kurs beendet war und die Studenten hinausstürmten, meinte Maconochie offenbar, sie mit seinem Wissen beeindrucken zu müssen, denn er ratterte seine Lösungen heraus. »Und der nördliche Polarkreis …«
»… ist eine imaginäre Linie, die sich um den Globus zieht, um die Polarbären in ihren Grenzen zu halten«, vervollständigte Louis im Brustton der Überzeugung den Satz.
Maconochie packte ihn am Arm und starrte ihn fassungslos an. »Das hast du nicht wirklich geschrieben?«
»Doch, natürlich.« Louis blieb todernst.
Kopfschüttelnd ging der Student davon, während Ferrier nur mühsam das Lachen unterdrücken konnte.
Ferrier legte den Arm um Louis’ Schulter. »Komm, wir gehen zu Brash’s und trinken ein Glas. Das haben wir uns verdient!«
Louis dachte an die wenigen Münzen, die er noch in der Tasche hatte, und zögerte, doch Ferrier setzte schon hinzu: »Ich lade dich ein. Nächstes Mal bist du wieder dran.«
2
Bei dem Wein- und Spirituosenhändler in der Clerk Street ging es wie immer in der Mittagszeit hoch her. Ferrier und er tranken einen Claret und philosophierten über das Studium, die Kommilitonen und das Leben an sich.
»Gräm dich nicht, sollte dein Abschneiden im Test nach universitären Maßstäben zu wünschen übrig lassen. Wie heißt es so schön bei Hume: ›Die Freiheit ist die Vervollkommnung bürgerlicher Gesellschaft.‹«
Louis musste grinsen. »Und ich habe mir die Freiheit genommen, Taits Fragen nach meinem Ermessen auszulegen.« Ferrier liebte es, ihn mit den philosophischen Theorien zu überwältigen, die bei ihm zu Hause Tischgespräch waren. »Dass du David Hume aufführst! Der Gute mag ein bedeutender Philosoph sein – unbestritten. Aber sein Stil ist unerträglich. Unlesbar in meinen Augen! Was nützen mir die klarsten Erkenntnisse, wenn ich bei der Lektüre eindöse? Montaigne hingegen …«
Schließlich riss Louis sich von seinem Freund und der anregenden Atmosphäre los. Er musste das Gespräch mit seinem Vater hinter sich bringen und dann endlich die aufgetragene Arbeit erledigen; zur Not würde er den Mathekurs von Professor Kelland sausen lassen. Es würde ihm nicht sonderlich schwerfallen.
Er bog in die George Street ein, vorbei an dem Bettler, der jeden Tag an dieser Ecke die Hände aufhielt. Die bloßen, wunden Füße, der trotz vergleichsweise jungen Alters zahnlose Mund und der fadenscheinige Anzug rührten Louis jedes Mal, wenn er ihn sah. Nachdenklich näherte er sich dem Eingang von Nummer 84, wo wie so oft gestandene Kapitäne, Seeleute und Handwerker warteten, die um Arbeit nachsuchen wollten. Ein Leuchtturm am Fenster und die Flagge mit dem Wappen und dem Motto In Salutem Omnium – Für die Sicherheit aller – verkündeten weithin, wer hier, im Herzen Edinburghs, residierte: das Hauptquartier des Northern Lighthouse Board. Hier wurden die Leuchttürme für ganz Schottland geplant und betreut, und da der zunehmende Handelsverkehr und die Unbilden des Wetters weitere Seezeichen nötig machten, ging der Kommission die Arbeit nicht aus. Zugleich befand sich in dem schlichten Steinhaus das Ingenieurbüro seines Vaters und seines Onkels, die beide für das Northern Lighthouse Board tätig waren. Louis musterte die Männer. Ihre wettergegerbten Gesichter versprachen interessante Lebensgeschichten, doch für Plaudereien hatte er heute keine Muße.
Im Inneren herrschte geschäftige Ruhe. Überall hingen und standen Bauzeichnungen, Modelle von Leuchttürmen oder Hafenmauern und Akten, Akten, Akten. Die Mitarbeiter nickten Louis ehrerbietig zu. Er ging seinem Onkel David aus dem Weg – einem Vorbild an Pflichtbewusstsein und Akkuratesse, wie ihm immer wieder vorgehalten wurde – und schlug auch einen Bogen um den Arbeitstisch, an dem seine Cousins saßen und eifrig Unterlagen kopierten. David Alan – Davie genannt – und Charles Alexander waren fünf und vier Jahre jünger als er, Streber, die noch nie in ihrem Leben angeeckt waren.
Louis schalt sich für den missgünstigen Gedanken. Als Kind hatte er gern mit ihnen gespielt und war oft in ihrem Elternhaus gewesen. Jetzt zog er die Schultern hoch und hüstelte nervös. Hoffentlich bekamen sie nicht mit, wie sein Vater ihn zusammenstauchte! Ihre Anwesenheit und die Umgebung schüchterten ihn ein. Während seine Vorfahren mütterlicherseits Landbesitzer von Pilrig gewesen waren – sein Großvater Pfarrer –, hatten seine Vorfahren väterlicherseits viel für die marine Seefahrt geleistet, hatten Bahnbrechendes erfunden und waren daher weltweit gefragt. Von Farmern, Mälzern, Eisenwarenhändlern und Schiffsbesitzern abstammend, hatten sie sich hochgearbeitet. Inzwischen tauschten sich die Stevenson-Ingenieure mit anderen Experten intensiv aus, allein die Korrespondenz mit den Brüdern Augustin und Léonor Fresnel füllte ganze Aktenmappen. Louis’ Onkel Alan hatte sie in Frankreich getroffen und mit ihnen gemeinsam die Linsen der schottischen Leuchttürme verbessert. Später hatte vor allem sein Vater die Entwicklung vorangetrieben. Auf der ganzen Welt war Thomas Stevenson heute für das von ihm entwickelte Holophotale System berühmt, bei dem kein Licht am Rande des Reflektors verloren ging – der beste Leuchtturm nützte schließlich nichts, wenn man seinen Schein nicht sah. Sein Vater wurde nicht müde, davon zu sprechen, und Louis konnte diese Besessenheit verstehen, aber nicht nachfühlen. Sogar in Ländern wie Indien oder Japan war das technische Knowhow der Stevensons gefragt.
Er straffte sich, klopfte an die Tür, wartete auf das »Herein« und öffnete. Sein Vater hatte die Züge eines antiken Philosophen – allerdings ohne dessen ausgeglichenes Temperament. Thomas Stevenson war wie immer korrekt gekleidet mit einem etwas altmodischen schwarzen Gehrock, heller hochgeschlossener Weste und gestärktem blütenweißen Hemd. Markante Gesichtszüge mit einem Grübchen im Kinn, das die Strenge abmilderte. Backenbart und spärlicher Haarwuchs um die Stirn, dafür umso buschiger um die Ohren. Hochgewachsen und kräftig war er, dem Anschein nach ein Mann, der es mit jedem Sturm aufnehmen konnte. Doch Louis wusste es besser.
Zu Louis’ Überraschung machte sein Vater eine einladende, erfreute Geste. »Du kommst wie gerufen! Erinnerst du dich an Mr Warden, den kunstfertigen Schmied aus der Nähe von Swanston? Er ist meinem Wunsch nachgekommen, bei uns um Arbeit nachzusuchen. Allerdings hat er seine Tochter mitgebracht.« Tom zupfte an seinen Manschettenknöpfen. Unüberhörbar, für wie überflüssig er die Begleitung hielt.
Am Rande des Raums erhob sich eine junge Frau von ihrem Stuhl und strich ihren Rock glatt, und Louis spürte, wie sein Herz bei ihrem Anblick einen Sprung tat. Seit sein Vater im letzten Jahr das Cottage in Swanston, einem Vorort Edinburghs am Fuße der Pentland Hills gepachtet hatte, hatten sie viele Wochenenden und Urlaube dort verbracht. Das Klima dort war im Gegensatz zu der kohleofengeschwängerten Feuchtigkeit der Stadt heilsam. Etliche Male hatte er Jeannie auf dem Land beim Wäschewaschen gesehen, und seit sie ihn einmal lesend an einer Flusslichtung angetroffen und in ein Gespräch über Literatur verwickelt hatte, hatte er nach ihr Ausschau gehalten. Zu seiner Überraschung war sie nicht nur eine eifrige Leserin, sondern wusste auch begeistert über das Gelesene zu debattieren. Mit ihren sechzehn Jahren hatte sie ein natürliches, frisches Aussehen, das jetzt, im eleganten Umfeld der Großstadt allerdings etwas bäuerlich wirkte. Die langen blonden Haare hatte sie geflochten unter einer Haube versteckt, die Wangen und Lippen waren rosarot. In der fremden Umgebung schien sie sich nicht wohlzufühlen.
Er wandte sich an den Schmied, einen bulligen Mann mit den weichen Zügen eines Kleinkindes, der sich in seinen in die Jahre gekommenen Sonntagsstaat gezwängt hatte und über den Schultern ein Plaid mit Tartanmuster trug – neben seinem breiten Akzent die einzige Erinnerung daran, dass die Familie erst im letzten Jahr von der Hochlandinsel Skye hierhergezogen war. »Natürlich erinnere ich mich an Mr Warden. Jeannie.« Louis nickte auch ihr förmlich lächelnd zu. »Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Anreise.«
»Ach, ist eine Menge Gesocks auf den Straßen unterwegs … also, wenn Sie mich fragen. Aber meine Jeannie hat darauf bestanden, mich zu begleiten und zu den Stätten von John Knox zu pilgern. Das konnte ich ihr nicht verwehren, obwohl es aus meiner Sicht nicht ungefährlich für ein Mädchen ist, allein in unserer Hauptstadt herumzulaufen.«
»Dennoch ein lobenswerter Wunsch, unseren wichtigsten Theologen und Kirchengründer zu würdigen. Louis, begleite Miss Jeannie, und gib auf sie acht, bis wir hier fertig sind, sagen wir in …«, Tom zückte seine Taschenuhr, »drei Stunden. Wir müssen mit meinem Bruder und einem der Vorarbeiter neue Möglichkeiten für den Umbau der Apparaturen besprechen. Die Umstellung von Öl auf Paraffin stellt uns vor technisch ungeahnte Aufgaben, auch dafür können wir kundige Schmiede gebrauchen.«
Louis nickte, als wüsste er, wovon sein Vater sprach. Er musste sich unbedingt in das Thema einarbeiten, um zukünftig angemessen reagieren zu können. Sollte er einwenden, dass er an der Universität erwartet wurde? Das sollte seinem Vater eigentlich bekannt sein. Andererseits würde er natürlich viel lieber mit dieser reizenden Literaturbegeisterten durch die Stadt streifen.
Die Augenbrauen des Vaters formten einen Keil. »Die studentischen Lektionen musst du nachholen. Und die Kopien und Zeichnungen wirst du mir später vorlegen«, sagte er, als habe er Louis’ Gedanken gelesen.
Eine laue Brise wehte in das Zimmer. Tom machte sich eine Notiz und öffnete die Tür, bereits ein wenig ungeduldig. Louis unterdrückte ein Lächeln. Auch bei seinem Vater schlug sich der calvinistische Arbeitsethos in Getriebenheit und zugleich in einer Schriftbesessenheit nieder, nur dass diese anders ausgeprägt war als bei Louis. Neben der wahnwitzigen Menge an Rechenschaftsberichten und Korrespondenz, die das Ingenieurbüro bewältigen musste, füllte sein Vater Buch um Buch mit Wetter- und Wellenbeobachtungen.
»Dass du gut auf meine Jeannie aufpasst, Junge!«, gab Mr Warden Louis mit auf den Weg.
»Das werde ich, Sir.«
Die beiden jungen Leute verließen das Büro. Jeannie war ebenso rotwangig wie er, und Louis fragte sich, ob sie vielleicht sogar gehofft hatte, Zeit mit ihm verbringen zu dürfen. Bei ihrer letzten Begegnung an einem lauen Apriltag am Bach war er versucht gewesen, sie zu küssen, und hatte den Eindruck gehabt, dass sie es sich ebenso wünschte wie er.
Louis öffnete ihr die Tür und bahnte ihr den Weg durch die Wartenden. »Du hast mich gerettet!«, brach es aus ihm heraus, sobald sie einige Schritte zwischen sich und das Büro gebracht hatten. Vor Erleichterung musste er lachen.
»Wie das? Ich fürchtete schon, dass du mir gram bist, weil ich dich von deinen Studien abhalte.« Scheu sah sie ihn an, und er glaubte erneut, Zuneigung in ihrem Blick zu lesen. Was romantische Neigungen anging, war er ein Frischling. Sicher hatte er beobachtet, dass manche Frauen ihn wohlgefällig – oder zumindest amüsiert – musterten und dabei tuschelten. Männer hingegen nahmen ihn meist nicht für voll oder schienen ihn albern zu finden, was mit seinem Aussehen zusammenhängen musste: hochgewachsen und knochig, mit schmalen Händen, langen Fingern und großen, weit auseinanderstehenden dunklen Augen. »Schwächling« oder »weibisch« waren Zuschreibungen, die ihm manche seiner bäurischen Kommilitonen verehrt hatten.
Jeannies fragender Blick rief ihn in die Gegenwart zurück. Wie reizend sie aussah! Ein so offenes Gesicht, wissbegierig und ohne Arg! Sollte er sein Fehlverhalten gestehen und sich damit in schlechtes Licht rücken? Oder gar zugeben, dass er heute gut auf die Universität verzichten konnte? Sie spazierten auf die Princes Street zu. Die Sonne schien ihre Kraft verdoppelt zu haben, und Louis war danach, ein Lied zu singen, so froh war er auf einmal. »Ich fürchtete ein Donnerwetter meines Vaters, weil ich die Kopien, von denen er sprach, noch nicht fertiggestellt habe. Stattdessen habe ich mich gestern Abend in den Notizen meines Großvaters über den Bau des Bell Rock festgelesen. So tief bin ich eingetaucht, dass mich die Geschehnisse bis in den Schlaf verfolgt haben.«
»Dann werde ich dir auch etwas gestehen.« Sie lächelte. »Viel mehr als John Knox interessieren mich die Buchhandlungen der Stadt. Es soll so viele geben, mit Hunderten Büchern!«
»In der Tat. Du wirst staunen! Auf dem Weg können wir an den Erinnerungsorten für Killjoy –«
»Louis!«
Er musste über ihre Empörung lachen. »Was denn? ›Freudentöter‹ hat man Knox wegen seiner Strenge schon zu Lebzeiten genannt! Dabei haben die Damen den alten Knaben umschwärmt! Also gut: Wir können an den Stätten unseres ehrenwerten Kirchengründers vorbeigehen, an unserer Kathedrale und seinen Wohnsitzen, unter anderem in der High Street.«
Aber Jeannie interessierte anderes mehr. Sie zupfte an ihrem Ärmel, unter dem sich zarte Handgelenke abzeichneten, und kam auf den Beginn ihres Gesprächs zurück. »Was ist der Bell Rock? Ein Kirchturm?«
»Du weißt nicht, was der Bell Rock ist?« Unglauben und Schalk lagen in seiner Stimme.
Jeannie schoss die Röte auf die Wangen, und sie machte auf dem Absatz kehrt. Den Kopf vorgeschoben, stiefelte sie davon.
Louis lief ihr nach. »Halt, warte! Bleib stehen! Was ist los?« Sie ging weiter, den Blick aufs Pflaster gesenkt. »Was ich auch getan habe, ich entschuldige mich!«, rief er. »Auch wenn ich mir keiner Schuld bewusst bin.«
Endlich verharrte sie. »Du machst dich über mich lustig. Nur weil ich vom Land komme und mich nicht so gut auskenne«, brach es aus ihr heraus. »Dabei dachte ich, du wärst anders.«
»Das bin ich auch. Ich bin anders. Ganz bestimmt. Schön, dass du es erkannt hast.« Louis konnte das Lächeln nicht aufhalten, zwang sich aber schnell wieder zum Ernst. »Ich wollte mich nicht über dich lustig machen. Es ist nur so: Der Bell Rock ist für meine Familie und für alle, die mit Leuchttürmen zu tun haben, wie … wie eines der Weltwunder.«
»Du hast meine Frage noch nicht beantwortet!«
Er holte tief Luft. »Der Bell Rock ist ein Leuchtturm, den mein Großvater Robert auf dem Riff Inchcape errichtet hat. Dieses befindet sich etwa zwölf Meilen weit im Meer und die meiste Zeit unter Wasser. Es gilt als das gefährlichste Riff an der schottischen Ostküste und hat unzählige Leben gekostet, denn es liegt in der Einfahrt der Meeresarme von Forth und Tay, also auf wichtigen Handelsrouten. Jedes Jahr hat es im Schnitt sechs Schiffe in die Tiefe gerissen.«
»Zwölf Meilen? Das ist von hier nach Swanston und wieder zurück. Etwas weiter, wenn ich’s recht bedenke.« Sie schob die Unterlippe vor, was so reizend war, dass er sie am liebsten sofort geküsst hätte. »Das ist unmöglich. So weit draußen kann man keinen hohen Turm errichten. Schon gar nicht auf einem Felsen, der ständig im Meer untergeht. Du machst dir noch immer einen Spaß mit mir.«
»Die Leute haben damals gesagt, dass der Bau unmöglich ist. Niemand wollte den Leuchtturm finanzieren. Ohne den verheerenden Sturm von 1799, der in drei Tagen vor der schottischen Küste siebzig Schiffe zerstörte – darunter das Kriegsschiff HMS York, das auf einen der Felsen des Riffs getrieben und mit der kompletten Besatzung vernichtet wurde –, hätte das Parlament nicht genügend Geld für den Bau zur Verfügung gestellt. Niemand glaubte daran, dass es gelingen könnte. Aber mein Großvater hat ihnen das Gegenteil bewiesen.«
»Er allein?« Langsam ging sie weiter, die Augen in ungläubigem Interesse auf ihn gerichtet. Louis musste sie zurückreißen, weil ein Bierkutscher in voller Fahrt um die Ecke gebogen kam. Sie sog vor Schreck scharf die Luft ein. »Edinburgh mag ja prächtig sein. Aber dieser Verkehr – furchtbar!«, brach es aus ihr heraus.
Louis sah sich um. Die Princes Street war für Edinburgher Verhältnisse nicht einmal besonders voll. Er steuerte das Scott-Monument an, weil er wusste, dass sie ein Faible für die Romane Sir Walter Scotts hatte. Auch er kannte die Werke des schottischen Nationaldichters gut. Das Denkmal erinnerte an eine abgebrochene, verschnörkelte Kirchturmspitze, nur dass sich in den Nischen keine Heiligen, sondern die Figuren von achtundsechzig berühmten schottischen Dichtern und Persönlichkeiten aus den Romanen des Schriftstellers befanden.
»Genau genommen war mein Großvater ein Untergebener des Ingenieurs Rennie«, erklärte er. »Robert Stevenson war damals noch ein junger Ingenieur, und die Kommissionsmitglieder des Northern Lighthouse Board trauten ihm die Aufgabe nicht zu – obgleich er ihnen ausgezeichnete Entwürfe geliefert hatte. Also bekam Rennie den Zuschlag. Der hat sich wegen weiterer Projekte – vielleicht auch wegen seiner Seekrankheit – jedoch nur zweimal auf der Baustelle sehen lassen. Mein Großvater und seine Männer waren es, die den Bell Rock errichtet haben. Und dabei sind sie beinahe gestorben. Von einem dieser Momente habe ich heute Nacht geträumt.«
Während sie weiterschlenderten, erzählte Louis ihr seinen Traum. Er führte sie zu Andrew Elliots Buchhandlung und Druckerei in der östlichen Princes Street, die, wie er wusste, ein Exemplar des Buches feilhielt, das sein Großvater über den Bau verfasst hatte. Jeannie schien es kaum zu wagen, das Geschäft zu betreten. Staunend sahen sie sich um. Als sie ihre Neugier einigermaßen befriedigt hatte, sprach Louis den Buchhändler auf das Buch seines Großvaters an. Dieser erkannt ihn von seinen früheren Besuchen und reichte ihm das armdicke, schwere Buch – ein Entgegenkommen, das darin begründet lag, dass Tom Stevenson ihm ein guter Kunde war.
Louis legte das Buch vorsichtig auf einen Tisch. Es war nicht der kunstvolle Text, sondern die präzisen, detailgenauen Zeichnungen und die dahinterstehende Leistung, die ihm Ehrfurcht einflößten. Schon als Kind hatte er mit seinem Vater darin geblättert und dessen Berichte gehört, denn seinen Großvater hatte er leider nicht mehr kennengelernt.
»Vier Jahre hat es gedauert, den Bell-Rock-Leuchtturm zu errichten, knapp vierzehn Jahre hat mein Großvater gebraucht, bis dieses Buch fertig war. Als es endlich veröffentlicht wurde, rühmte man ihn als ›Robinson Crusoe des Ingenieurswesens‹.«
Jeannies Blick war an einem Querschnitt des Leuchtturms hängen geblieben. Auf dem Bild sah man, wie die Arbeiter die Steine mithilfe von auf den Stockwerken befestigten Kränen emporschafften. »Ich sehe keine Glocke. Warum heißt er ›Bell Rock‹?«
Louis stand halb hinter ihr und sah ihr über die Schulter. Er genoss ihren leicht blumigen Duft und den Anblick der feinen Härchen auf ihrer Wange. Was für ein Glück, nicht in einem Büro oder Vorlesungssaal sitzen zu müssen! Der Buchhändler beobachtete sie argwöhnisch.
»Das erzähle ich dir gleich.« Louis warf einen letzten Blick auf das Gemälde, das der berühmte Maler Joseph M. W. Turner im Auftrag seines Großvaters gemalt hatte. Es zeigte in typischer Turner-Manier den weißen Leuchtturm inmitten der aufschäumenden See. Schiffe kämpften sich beängstigend nah am Riff durch den Sturm. Treibgut verriet, dass der Sturm erste Opfer gefordert hatte. Er klappte das Buch zu und reichte es dankend zurück.
Sie verließen die Buchhandlung und passierten die Waverley Station, an der die Bauarbeiter lärmten. Auf der North Bridge vernebelten ihnen die Rauchwolken der Eisenbahnen die Sicht. Louis störte es nicht. Vor seinem inneren Auge zogen ohnehin Bilder von Orkanen, Schiffbrüchen und Strandräubern vorbei – Geschichten, mit denen er aufgewachsen war. »Es geht die Sage, dass der Abt von Arbroath eine Glocke auf dem Riff befestigt hat, die bei Sturm und Wellen die Seefahrer vor der Gefahr warnen sollte«, kam er auf ihre Frage zurück. »Ein Pirat soll die Glocke gestohlen haben – doch die Strafe folgte auf dem Fuß: Ihm selbst und seiner Mannschaft wurde das Inchcape-Riff zum Verhängnis, denn er erlitt Schiffbruch.«
»Gott hat den Glockendieb also gerecht gestraft. Und wie wurden dein Großvater und seine Leute gerettet?«
»Sie hatten Glück im Unglück. Unerwartet kam das Proviantschiff vorbei und nahm die Männer auf.«
Als sie die Altstadt erreichten, spürte Louis, wie Jeannie beim Anblick der dunklen Ecken und Winkel, der Durchgänge und schmalen Treppen, der abgerissenen Gestalten, der Huren und halbseidenen Herumlungerer den Blick senkte und schneller voranschritt. Unrat und Auswurf auf dem Gehweg beschmutzten den Rand ihrer Schuhe, und immer wieder mussten sie tiefen Pfützen, Kloakegräben oder Schlaglöchern ausweichen. Schließlich schlug er Jeannie zuliebe einen respektableren Weg über die Hauptstraßen ein. Dort rumpelten unzählige Kutschen und Pferdefuhrwerke, schrien fliegende Händler und dröhnten die Dudelsäcke oder Gesänge der Straßenmusikanten. Er zeigte ihr die Kathedrale mit dem Grab von John Knox sowie dessen nahegelegenes Wohnhaus.
Nach der dritten Buchhandlung flackerte Jeannies Blick über das Gewühl auf den Straßen. »Dass du es hier aushältst! Mir ist die Stadt viel zu laut, viel zu voll und viel zu schmutzig.«
»Du tust Edinburgh Unrecht. Soll ich dir einen meiner Lieblingsorte zeigen?«
Jeannie wirkte unentschlossen. »Nur wenn es nicht zu lange dauert. Ich darf meinen Vater nicht warten lassen.«
Louis sah auf die Uhr. »Ich würde mit dir auf den Arthur’s Seat wandern, aber das dauert etwa eine Dreiviertelstunde. Von dort aus hat man einen großartigen Blick über die Stadt und Edinburghs wilde Seite – man kann sogar Vogeleier sammeln, wenn man das Klettern nicht scheut.« Er wies auf den markanten Hausberg, eine smaragdgrün umhüllte und zugleich schroffe Klippe.
»Du wirkst nicht, als könntest du klettern und ein Vogelei von dem anderen unterscheiden!« Sanfter Spott schwang in ihrem Ausruf mit.
»Nicht? Du wirst dich noch wundern!« Sofort marschierte Louis los. Die Royal Mile mit ihren herrschaftlichen, aber bereits etwas heruntergekommenen Stadtpalästen flog an ihnen vorbei. Den königlichen Palast von Holyrood stellte er ihr im Schnelldurchgang vor; das geschichtsträchtige Gemäuer wurde ohnehin gerade renoviert. Kurz darauf begannen sie den Aufstieg. Als die Bebauung lichter wurde und schließlich ganz abbrach, schien Jeannie wieder freier zu atmen. Louis hingegen spürte, wie ihn die Steigung anstrengte. Um die Erschöpfung zu überspielen, machte er an einer Weggabelung Halt.
»Ich vermisse die heideduftenden Berge des Hochlands. Wenn ich an die wilden Cuillin Hills auf Skye denke, wird mir das Herz schwer«, sagte Jeannie wehmütig.
»Nun tust du auch noch den Bergen Edinburghs Unrecht! Immerhin wurde die Stadt wie Rom auf sieben Hügeln gebaut.« Louis erläuterte ihr das Stadtpanorama, fragte dann aber: »Warum seid ihr umgezogen?«
»Mein Vater brauchte eine bessere Arbeit, um meine Geschwister und mich durchzubringen. Und da er vor einigen Jahren bereits bei den Stevensons im Lohn stand …«
»Beim Bau des Leuchtturms Eilean Bàn, nehme ich an.« Sein Vater hatte ihn alle Leuchttürme der Stevensons auswendig lernen lassen.
Sie nickte. »Daher hat er Kontakt zu deinem Vater aufgenommen. Dass wir in Swanston gelandet sind, war Zufall.« Ihr schienen erst jetzt seine ausgebeulten Jackentaschen aufzufallen. »Warum trägst du gleich zwei Bücher mit dir herum?«
»Bücher kann man nie genug haben. Das eine ist zum Lesen und das andere zum Schreiben.« Louis ging weiter; er fürchtete ihre Reaktion. Würde sie sich über ihn lustig machen?
»Du schreibst?«