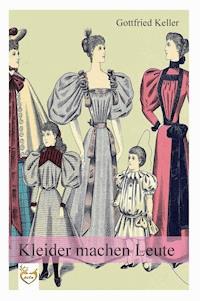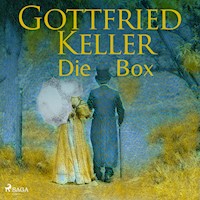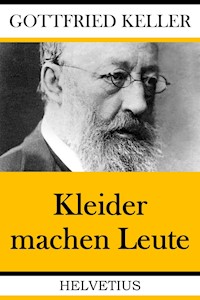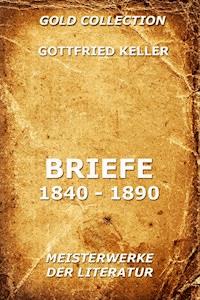Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Klassiker bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Neue Deutsche Rechtschreibung Die Leute von Seldwyla ist ein zweiteiliger Novellenzyklus des Schweizer Dichters Gottfried Keller. Erster Band - Pankraz, der Schmoller - Romeo und Julia auf dem Dorfe - Frau Regel Amrain und ihr Jüngster - Die drei gerechten Kammacher - Spiegel, das Kätzchen. Ein Märchen Zweiter Band - Kleider machen Leute - Der Schmied seines Glückes - Die mißbrauchten Liebesbriefe - Dietegen - Das verlorne Lachen Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 928
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gottfried Keller
Die Leute von Seldwyla
Novellen
Gottfried Keller
Die Leute von Seldwyla
Novellen
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] 2. Auflage, ISBN 978-3-962812-96-6
null-papier.de/neu
Inhaltsverzeichnis
Erster Band
Pankraz, der Schmoller
Romeo und Julia auf dem Dorfe
Frau Regel Amrain und ihr Jüngster
Die drei gerechten Kammmacher
Spiegel, das Kätzchen – Ein Märchen
Zweiter Band
Kleider machen Leute
Der Schmied seines Glückes
Die missbrauchten Liebesbriefe
Dietegen
Das verlorene Lachen
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Klassiker bei Null Papier
Alice im Wunderland
Anna Karenina
Der Graf von Monte Christo
Die Schatzinsel
Ivanhoe
Oliver Twist oder Der Weg eines Fürsorgezöglings
Robinson Crusoe
Das Gotteslehen
Meisternovellen
Eine Weihnachtsgeschichte
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Erster Band
Seldwyla bedeutet nach der älteren Sprache einen wonnigen und sonnigen Ort, und so ist auch in der Tat die kleine Stadt dieses Namens gelegen irgendwo in der Schweiz. Sie steckt noch in den gleichen alten Ringmauern und Türmen wie vor dreihundert Jahren und ist also immer das gleiche Nest; die ursprüngliche tiefe Absicht dieser Anlage wird durch den Umstand erhärtet, dass die Gründer der Stadt dieselbe eine gute halbe Stunde von einem schiffbaren Flusse angepflanzt, zum deutlichen Zeichen, dass nichts daraus werden solle. Aber schön ist sie gelegen, mitten in grünen Bergen, die nach der Mittagseite zu offen sind, sodass wohl die Sonne hereinkam, aber kein raues Lüftchen. Deswegen gedeiht auch ein ziemlich guter Wein rings um die alte Stadtmauer, während höher hinauf an den Bergen unabsehbare Waldungen sich hinziehen, welche das Vermögen der Stadt ausmachen; denn dies ist das Wahrzeichen und sonderbare Schicksal derselben, dass die Gemeinde reich ist und die Bürgerschaft arm, und zwar so, dass kein Mensch zu Seldwyla etwas hat und niemand weiß, wovon sie seit Jahrhunderten eigentlich leben. Und sie leben sehr lustig und guter Dinge, halten die Gemütlichkeit für ihre besondere Kunst, und wenn sie irgendwo hinkommen, wo man anderes Holz brennt, so kritisieren sie zuerst die dortige Gemütlichkeit und meinen, ihnen tue es doch niemand zuvor in dieser Hantierung.
Der Kern und der Glanz des Volkes besteht aus den jungen Leuten von etwa zwanzig bis fünf-, sechsunddreißig Jahren, und diese sind es, welche den Ton angeben, die Stange halten und die Herrlichkeit von Seldwyla darstellen. Denn während dieses Alters üben sie das Geschäft, das Handwerk, den Vorteil oder was sie sonst gelernt haben, das heißt sie lassen, solange es geht, fremde Leute für sich arbeiten und benutzen ihre Profession zur Betreibung eines trefflichen Schuldenverkehrs, der eben die Grundlage der Macht, Herrlichkeit und Gemütlichkeit der Herren von Seldwyl bildet und mit einer ausgezeichneten Gegenseitigkeit und Verständnisinnigkeit gewahrt wird; aber wohlgemerkt, nur unter dieser Aristokratie der Jugend. Denn sowie einer die Grenze der besagten blühenden Jahre erreicht, wo die Männer anderer Städtlein etwa anfangen, erst recht in sich zu gehen und zu erstarken, so ist er in Seldwyla fertig; er muss fallen lassen und hält sich, wenn er ein ganz gewöhnlicher Seldwyler ist, ferner am Orte auf als ein Entkräfteter und aus dem Paradies des Kredites Verstoßener, oder wenn noch etwas in ihm steckt, das noch nicht verbraucht ist, so geht er in fremde Kriegsdienste und lernt dort für einen fremden Tyrannen, was er für sich selbst zu üben verschmäht hat, sich einzuknöpfen und steif aufrecht zu halten. Diese kehren als tüchtige Kriegsmänner nach einer Reihe von Jahren zurück und gehören dann zu den besten Exerziermeistern der Schweiz, welche die junge Mannschaft zu erziehen wissen, dass es eine Lust ist. Andere ziehen noch anderwärts auf Abenteuer aus gegen das vierzigste Jahr hin, und in den verschiedensten Weltteilen kann man Seldwyler treffen, die sich alle dadurch auszeichnen, dass sie sehr geschickt Fische zu essen verstehen, in Australien, in Kalifornien, in Texas wie in Paris oder Konstantinopel.
Was aber zurückbleibt und am Orte alt wird, das lernt dann nachträglich arbeiten, und zwar jene krabbelige Arbeit von tausend kleinen Dingen, die man eigentlich nicht gelernt, für den täglichen Kreuzer, und die alternden verarmten Seldwyler mit ihren Weibern und Kindern sind die emsigsten Leutchen von der Welt, nachdem sie das erlernte Handwerk aufgegeben, und es ist rührend anzusehen, wie tätig sie dahinter her sind, sich die Mittelchen zu einem guten Stückchen Fleisch von ehedem zu erwerben. Holz haben alle Bürger die Fülle, und die Gemeinde verkauft jährlich noch einen guten Teil, woraus die große Armut unterstützt und genährt wird, und so steht das alte Städtchen in unveränderlichem Kreislauf der Dinge bis heute. Aber immer sind sie im ganzen zufrieden und munter, und wenn je ein Schatten ihre Seele trübt, wenn etwa eine allzu hartnäckige Geldklemme über der Stadt weilt, so vertreiben sie sich die Zeit und ermuntern sich durch ihre große politische Beweglichkeit, welche ein weiterer Charakterzug der Seldwyler ist. Sie sind nämlich leidenschaftliche Parteileute, Verfassungsrevisoren und Antragsteller, und wenn sie eine recht verrückte Motion ausgeheckt haben und durch ihr Großratsmitglied stellen lassen oder wenn der Ruf nach Verfassungsänderung in Seldwyla ausgeht, so weiß man im Lande, dass im Augenblicke dort kein Geld zirkuliert. Dabei lieben sie die Abwechselung der Meinungen und Grundsätze und sind stets den Tag darauf, nachdem eine Regierung gewählt ist, in der Opposition gegen dieselbe. Ist es ein radikales Regiment, so scharen sie sich, um es zu ärgern, um den konservativen frömmlichen Stadtpfarrer, den sie noch gestern gehänselt, und machen ihm den Hof, indem sie sich mit verstellter Begeisterung in seine Kirche drängen, seine Predigten preisen und mit großem Geräusch seine gedruckten Traktätchen und Berichte der Baseler Missionsgesellschaft umherbieten, natürlich ohne ihm einen Pfennig beizusteuern. Ist aber ein Regiment am Ruder, welches nur halbwegs konservativ aussieht, stracks drängen sie sich um die Schullehrer der Stadt, und der Pfarrer hat genug an den Glaser zu zahlen für eingeworfene Scheiben. Besteht hingegen die Regierung aus liberalen Juristen, die viel auf die Form halten, und aus häklichen Geldmännern, so laufen sie flugs dem nächstwohnenden Sozialisten zu und ärgern die Regierung, indem sie denselben in den Rat wählen mit dem Feldgeschrei: Es sei nun genug des politischen Formenwesens und die materiellen Interessen seien es, welche allein das Volk noch kümmern könnten. Heute wollen sie das Veto haben und sogar die unmittelbarste Selbstregierung mit permanenter Volksversammlung, wozu freilich die Seldwyler am meisten Zeit hätten, morgen stellen sie sich übermüdet und blasiert in öffentlichen Dingen und lassen ein halbes Dutzend alte Stillständer, die vor dreißig Jahren falliert und sich seither stillschweigend rehabilitiert haben, die Wahlen besorgen; alsdann sehen sie behaglich hinter den Wirtshausfenstern hervor die Stillständer in die Kirche schleichen und lachen sich in die Faust, wie jener Knabe, welcher sagte: Es geschieht meinem Vater schon recht, wenn ich mir die Hände verfriere, warum kauft er mir keine Handschuhe! Gestern schwärmten sie allein für das eidgenössische Bundesleben und waren höchlich empört, dass man Anno achtundvierzig nicht gänzliche Einheit hergestellt habe; heute sind sie ganz versessen auf die Kantonalsouveränetät und haben nicht mehr in den Nationalrat gewählt.
Wenn aber eine ihrer Aufregungen und Motionen der Landesmehrheit störend und unbequem wird, so schickt ihnen die Regierung gewöhnlich als Beruhigungsmittel eine Untersuchungskommission auf den Hals, welche die Verwaltung des Seldwyler Gemeindegutes regulieren soll; dann haben sie vollauf mit sich selbst zu tun, und die Gefahr ist abgeleitet.
Alles dies macht ihnen großen Spaß, der nur überboten wird, wenn sie allherbstlich ihren jungen Wein trinken, den gärenden Most, den sie Sauser nennen; wenn er gut ist, so ist man des Lebens nicht sicher unter ihnen, und sie machen einen Höllenlärm; die ganze Stadt duftet nach jungem Wein, und die Seldwyler taugen dann auch gar nichts. Je weniger aber ein Seldwyler zu Hause was taugt, um so besser hält er sich sonderbarerweise, wenn er ausrückt, und ob sie einzeln oder in Kompanie ausziehen, wie zum Beispiel in früheren Kriegen, so haben sie sich doch immer gut gehalten. Auch als Spekulant und Geschäftsmann hat schon mancher sich rüstig umgetan, wenn er nur erst aus dem warmen sonnigen Tale herauskam, wo er nicht gedieh.
In einer so lustigen und seltsamen Stadt kann es an allerhand seltsamen Geschichten und Lebensläufen nicht fehlen, da Müßiggang aller Laster Anfang ist. Doch nicht solche Geschichten, wie sie in dem beschriebenen Charakter von Seldwyla liegen, will ich eigentlich in diesem Büchlein erzählen, sondern einige sonderbare Abfällsel, die so zwischendurch passierten, gewissermaßen ausnahmsweise, und doch auch gerade nur zu Seldwyla vor sich gehen konnten.
Pankraz, der Schmoller
Auf einem stillen Seitenplätzchen, nahe an der Stadtmauer, lebte die Witwe eines Seldwylers, der schon lange fertig geworden und unter dem Boden lag. Dieser war keiner von den schlimmsten gewesen, vielmehr fühlte er eine so starke Sehnsucht, ein ordentlicher und fester Mann zu sein, dass ihn der herrschende Ton, dem er als junger Mensch nicht entgehen konnte, angriff, und als seine Glanzzeit vorübergegangen und er der Sitte gemäß abtreten musste von dem Schauplatze der Taten, da erschien ihm alles wie ein wüster Traum und wie ein Betrug um das Leben, und er bekam davon die Auszehrung und starb unverweilt.
Er hinterließ seiner Witwe ein kleines baufälliges Häuschen, einen Kartoffelacker vor dem Tore und zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Mit dem Spinnrocken verdiente sie Milch und Butter, um die Kartoffeln zu kochen, die sie pflanzte, und ein kleiner Witwengehalt, den der Armenpfleger jährlich auszahlte, nachdem er ihn jedes Mal einige Wochen über den Termin hinaus in seinem Geschäfte benutzt, reichte gerade zu dem Kleiderbedarf und einigen anderen kleinen Ausgaben hin. Dieses Geld wurde immer mit Schmerzen erwartet, indem die ärmlichen Gewänder der Kinder gerade um jene verlängerten Wochen zu früh gänzlich schadhaft waren und der Buttertopf überall seinen Grund durchblicken ließ. Dieses Durchblicken des grünen Topfbodens war eine so regelmäßige jährliche Erscheinung, wie irgendeine am Himmel, und verwandelte ebenso regelmäßig eine Zeit lang die kühle, kümmerlich-stille Zufriedenheit der Familie in eine wirkliche Unzufriedenheit. Die Kinder plagten die Mutter um besseres und reichlicheres Essen; denn sie hielten sie in ihrem Unverstande für mächtig genug dazu, weil sie ihr ein und alles, ihr einziger Schutz und ihre einzige Oberbehörde war. Die Mutter war unzufrieden, dass die Kinder nicht entweder mehr Verstand oder mehr zu essen oder beides zusammen erhielten.
Besagte Kinder aber zeigten verschiedene Eigenschaften. Der Sohn war ein unansehnlicher Knabe von vierzehn Jahren, mit grauen Augen und ernsthaften Gesichtszügen, welcher des Morgens lang im Bette lag, dann ein wenig in einem zerrissenen Geschichts- und Geografiebuche las und alle Abend, sommers wie winters, auf den Berg lief, um dem Sonnenuntergang beizuwohnen, welches die einzige glänzende und pomphafte Begebenheit war, welche sich für ihn zutrug. Sie schien für ihn etwa das zu sein, was für die Kaufleute der Mittag auf der Börse; wenigstens kam er mit ebenso abwechselnder Stimmung von diesem Vorgang zurück, und wenn es recht rotes und gelbes Gewölk gegeben, welches gleich großen Schlachteeren in Blut und Feuer gestanden und majestätisch manövriert hatte, so war er eigentlich vergnügt zu nennen.
Dann und wann, jedoch nur selten, beschrieb er ein Blatt Papier mit seltsamen Listen und Zahlen, welches er dann zu einem kleinen Bündel legte, das durch ein Endchen alte Goldtresse zusammengehalten wurde. In diesem Bündelchen stak hauptsächlich ein kleines Heft, aus einem zusammengefalteten Bogen Goldpapier gefertigt, dessen weiße Rückseiten mit allerlei Linien, Figuren und aufgereihten Punkten, dazwischen Rauchwolken und fliegende Bomben, gefüllt und beschrieben waren. Dies Büchlein betrachtete er oft mit großer Befriedigung und brachte neue Zeichnungen darin an, meistens um die Zeit, wenn das Kartoffelfeld in voller Blüte stand. Er lag dann im blühenden Kraut unter dem blauen Himmel, und wenn er eine weiße beschriebene Seite betrachtet hatte, so schaute er dreimal so lange in das gegenüberstehende glänzende Goldblatt, in welchem sich die Sonne brach. Im übrigen war es ein eigensinniger und zum Schmollen geneigter Junge, welcher nie lachte und auf Gottes lieber Welt nichts tat oder lernte.
Seine Schwester war zwölf Jahre alt und ein bildschönes Kind mit langem und dickem braunem Haar, großen braunen Augen und der allerweißesten Hautfarbe. Dies Mädchen war sanft und still, ließ sich vieles gefallen und murrte weit seltener als sein Bruder. Es besaß eine helle Stimme und sang gleich einer Nachtigall; doch obgleich es mit alle diesem freundlicher und lieblicher war als der Knabe, so gab die Mutter doch diesem scheinbar den Vorzug und begünstigte ihn in seinem Wesen, weil sie Erbarmen mit ihm hatte, da er nichts lernen und es ihm wahrscheinlicherweise einmal recht schlecht ergehen konnte, während nach ihrer Ansicht das Mädchen nicht viel brauchte und schon deshalb unterkommen würde.
Dieses musste daher unaufhörlich spinnen, damit das Söhnlein desto mehr zu essen bekäme und recht mit Muße sein einstiges Unheil erwarten könne. Der Junge nahm dies ohne weiteres an und gebärdete sich wie ein kleiner Indianer, der die Weiber arbeiten lässt, und auch seine Schwester empfand hievon keinen Verdruss und glaubte, das müsse so sein.
Die einzige Entschädigung und Rache nahm sie sich durch eine allerdings arge Unzukömmlichkeit, welche sie sich beim Essen mit List oder Gewalt immer wieder erlaubte. Die Mutter kochte nämlich jeden Mittag einen dicken Kartoffelbrei, über welchen sie eine fette Milch oder eine Brühe von schöner brauner Butter goss. Diesen Kartoffelbrei aßen sie alle zusammen aus der Schüssel mit ihren Blechlöffeln, indem jeder vor sich eine Vertiefung in das feste Kartoffelgebirge hineingrub. Das Söhnlein, welches bei aller Seltsamkeit in Essangelegenheiten einen strengen Sinn für militärische Regelmäßigkeit beurkundete und streng darauf hielt, dass jeder nicht mehr noch weniger nahm, als was ihm zukomme, sah stets darauf, dass die Milch oder die gelbe Butter, welche am Rande der Schüssel umherfloss, gleichmäßig in die abgeteilten Gruben laufe; das Schwesterchen hingegen, welches viel harmloser war, suchte, sobald ihre Quellen versiegt waren, durch allerhand künstliche Stollen und Abzugsgräben die wohlschmeckenden Bächlein auf ihre Seite zu leiten, und wie sehr sich auch der Bruder dem widersetzte und ebenso künstliche Dämme aufbaute und überall verstopfte, wo sich ein verdächtiges Loch zeigen wollte, so wusste sie doch immer wieder eine geheime Ader des Breies zu eröffnen oder langte kurzweg in offenem Friedensbruch mit ihrem Löffel und mit lachenden Augen in des Bruders gefüllte Grube. Alsdann warf er den Löffel weg, lamentierte und schmollte, bis die gute Mutter die Schüssel zur Seite neigte und ihre eigene Brühe voll in das Labyrinth der Kanäle und Dämme ihrer Kinder strömen ließ.
So lebte die kleine Familie einen Tag wie den andern, und indem dies immer so blieb, während doch die Kinder sich auswuchsen, ohne dass sich eine günstige Gelegenheit zeigte, die Welt zu erfassen und irgend etwas zu werden, fühlten sich alle immer unbehaglicher und kümmerlicher in ihrem Zusammensein. Pankraz, der Sohn, tat und lernte fortwährend nichts als eine sehr ausgebildete und künstliche Art zu schmollen, mit welcher er seine Mutter, seine Schwester und sich selbst quälte. Es ward dies eine ordentliche und interessante Beschäftigung für ihn, bei welcher er die müßigen Seelenkräfte fleißig übte im Erfinden von hundert kleinen häuslichen Trauerspielen, die er veranlasste und in welchen er behände und meisterlich den steten Unrechtleider zu spielen wusste. Estherchen, die Schwester, wurde dadurch zu reichlichem Weinen gebracht, durch welches aber die Sonne ihrer Heiterkeit schnell wieder hervorstrahlte. Diese Oberflächlichkeit ärgerte und kränkte dann den Pankraz so, dass er immer längere Zeiträume hindurch schmollte und aus selbstgeschaffenem Ärger selbst heimlich weinte.
Doch nahm er bei dieser Lebensart merklich zu an Gesundheit und Kräften, und als er diese in seinen Gliedern anwachsen fühlte, erweiterte er seinen Wirkungskreis und strich mit einer tüchtigen Baumwurzel oder einem Besenstiel in der Hand durch Feld und Wald, um zu sehen, wie er irgendwo ein tüchtiges Unrecht auftreiben und erleiden könne. Sobald sich ein solches zur Not dargestellt und entwickelt, prügelte er unverweilt seine Widersacher auf das jämmerlichste durch, und er erwarb sich und bewies in dieser seltsamen Tätigkeit eine solche Gewandtheit, Energie und feine Taktik, sowohl im Ausspüren und Aufbringen des Feindes als im Kampfe, dass er sowohl einzelne ihm an Stärke weit überlegene Jünglinge als ganze Trupps derselben entweder besiegte oder wenigstens einen ungestraften Rückzug ausführte.
War er von einem solchen wohlgelungenen Abenteuer zurückgekommen, so schmeckte ihm das Essen doppelt gut, und die Seinigen erfreuten sich dann einer heiteren Stimmung. Eines Tages aber war es ihm doch begegnet, dass er, statt welche auszuteilen, beträchtliche Schläge selbst geerntet hatte, und als er voll Scham, Verdruss und Wut nach Hause kam, hatte Estherchen, welche den ganzen Tag gesponnen, dem Gelüste nicht widerstehen können und sich noch einmal über das für Pankraz aufgehobene Essen hergemacht und davon einen Teil gegessen, und zwar, wie es ihm vorkam, den besten. Traurig und wehmütig, mit kaum verhaltenen Tränen in den Augen, besah er das unansehnliche, kalt gewordene Restchen, während die schlimme Schwester, welche schon wieder am Spinnrädchen saß, unmäßig lachte.
Das war zu viel, und nun musste etwas Gründliches geschehen. Ohne zu essen, ging Pankraz hungrig in seine Kammer, und als ihn am Morgen seine Mutter wecken wollte, dass er doch zum Frühstück käme, war er verschwunden und nirgends zu finden. Der Tag verging, ohne dass er kam, und ebenso der zweite und dritte Tag. Die Mutter und Estherchen gerieten in große Angst und Not; sie sahen wohl, dass er vorsätzlich davongegangen, indem er seine Habseligkeiten mitgenommen. Sie weinten und klagten unaufhörlich, wenn alle Bemühungen fruchtlos blieben, eine Spur von ihm zu entdecken, und als nach Verlauf eines halben Jahrs Pankrazius verschwunden war und blieb, ergaben sie sich mit trauriger Seele in ihr Schicksal, das ihnen nun doppelt einsam und arm erschien.
Wie lang wird nicht eine Woche, ja nur ein Tag, wenn man nicht weiß, wo diejenigen, die man liebt, jetzt stehn und gehn, wenn eine solche Stille darüber durch die Welt herrscht, dass allnirgends auch nur der leiseste Hauch von ihrem Namen ergeht, und man weiß doch, sie sind da und atmen irgendwo.
So erging es der Mutter und dem Estherlein fünf Jahre, zehn Jahre und fünfzehn Jahre, einen Tag wie den andern, und sie wussten nicht, ob ihr Pankrazius tot oder lebendig sei. Das war ein langes und gründliches Schmollen, und Estherchen, welches eine schöne Jungfrau geworden, wurde darüber zu einer hübschen und feinen alten Jungfer, welche nicht nur aus Kindestreue bei der alternden Mutter blieb, sondern ebensowohl aus Neugierde, um ja in dem Augenblicke da zu sein, wo der Bruder sich endlich zeigen würde, und zu sehen, wie die Sache eigentlich verlaufe. Denn sie war guter Dinge und glaubte fest, dass er eines Tages wiederkäme und dass es dann etwas Rechtes auszulachen gäbe. Übrigens fiel es ihr nicht schwer, ledig zu bleiben, da sie klug war und wohl sah, wie bei den Seldwylern nicht viel dahintersteckte an dauerhaftem Lebensglücke und sie dagegen mit ihrer Mutter unveränderlich in einem kleinen Wohlständchen lebte, ruhig und ohne Sorgen; denn sie hatten ja einen tüchtigen Esser weniger und brauchten für sich fast gar nichts.
Da war es einst ein heller schöner Sommernachmittag, mitten in der Woche, wo man so an gar nichts denkt und die Leute in den kleinen Städten fleißig arbeiten. Der Glanz von Seldwyla befand sich sämtlich mit dem Sonnenschein auf den übergrünten Kegelbahnen vor dem Tore oder auch in kühlen Schenkstuben in der Stadt. Die Falliten und Alten aber hämmerten, näheten, schusterten, klebten, schnitzelten und bastelten gar emsig darauflos, um den langen Tag zu benutzen und einen vergnügten Abend zu erwerben, den sie nunmehr zu würdigen verstanden. Auf dem kleinen Platze, wo die Witwe wohnte, war nichts als die stille Sommersonne auf dem begrasten Pflaster zu sehen; an den offenen Fenstern aber arbeiteten ringsum die alten Leute und spielten die Kinder. Hinter einem blühenden Rosmaringärtchen auf einem Brette saß die Witwe und spann und ihr gegenüber Estherchen und nähete. Es waren schon einige Stunden seit dem Essen verflossen, und noch hatte niemand eine Zwiesprache gehalten von der ganzen Nachbarschaft. Da fand der Schuhmacher wahrscheinlich, dass es Zeit sei, eine kleine Erholungspause zu eröffnen, und nieste so laut und mutwillig: hupschi! dass alle Fenster zitterten und der Buchbinder gegenüber, der eigentlich kein Buchbinder war, sondern nur so aus dem Stegreif allerhand Pappkästchen zusammenleimte und an der Türe ein verwittertes Glaskästchen hängen hatte, in welchem eine Stange Siegellack an der Sonne krumm wurde, dieser Buchbinder rief: »Zur Gesundheit!« und alle Nachbarsleute lachten. Einer nach dem andern steckte den Kopf durch das Fenster, einige traten sogar vor die Türe und gaben sich Prisen, und so war das Zeichen gegeben zu einer kleinen Nachmittagsunterhaltung und zu einem fröhlichen Gelächter während des Vesperkaffees, der schon aus allen Häusern duftete und zichorierte. Diese hatten endlich gelernt, sich aus wenigem einen Spaß zu machen. Da kam in dies Vergnügen herein ein fremder Leiermann mit einem schön polierten Orgelkasten, was in der Schweiz eine ziemliche Seltenheit ist, da sie keine eingeborene Leiermänner besitzt. Er spielte ein sehnsüchtiges Lied von der Ferne und ihren Dingen, welches die Leute über die Maßen schön dünkte und besonders der Witwe Tränen entlockte, da sie ihres Pankräzchens gedachte, das nun schon viele Jahre verschwunden war. Der Schuhmacher gab dem Manne einen Kreuzer, er zog ab, und das Plätzchen wurde wieder still. Aber nicht lange nachher kam ein anderer Herumtreiber mit einem großen fremden Vogel in einem Käfig, den er unaufhörlich zwischen dem Gitter durch mit einem Stäbchen anstach und erklärte, sodass der traurige Vogel keine Ruhe hatte. Es war ein Adler aus Amerika; und die fernen blauesten Länder, über denen er in seiner Freiheit geschwebt, kamen der Witwe in den Sinn und machten sie um so trauriger, als sie gar nicht wusste, was das für Länder wären noch wo ihr Söhnchen sei. Um den Vogel zu sehen, hatten die Nachbaren auf das Plätzchen hinaustreten müssen, und als er nun fort war, bildeten sie eine Gruppe, steckten die Nasen in die Luft und lauerten auf noch mehr Merkwürdigkeiten, da sie nun doch die Lust ankam, den übrigen Tag zu vertrödeln.
Diese Lust wurde denn auch erfüllt, und es dauerte nicht lange, bis das allergrößte Spektakel sich mit großem Lärm näherte unter dem Zulauf aller Kinder des Städtchens. Denn ein mächtiges Kamel schwankte auf den Platz, von mehreren Affen bewohnt; ein großer Bär wurde an seinem Nasenringe herbeigeführt; zwei oder drei Männer waren dabei, kurz ein ganzer Bärentanz führte sich auf, und der Bär tanzte und machte seine possierlichen Künste, indem er von Zeit zu Zeit unwirsch brummte, dass die friedlichen Leute sich fürchteten und in scheuer Entfernung dem wilden Wesen zuschauten. Estherchen lachte und freute sich unbändig über den Bären, wie er so zierlich umherwatschelte mit seinem Stecken, über das Kamel mit seinem selbstvergnügten Gesicht und über die Affen. Die Mutter dagegen musste fortwährend weinen; denn der böse Bär erbarmte sie, und sie musste wiederum ihres verschollenen Sohnes gedenken.
Als endlich auch dieser Aufzug wieder verschwunden und es wieder still geworden, indem die aufgeregten Nachbaren sich mit seinem Gefolge ebenfalls aus dem Staube gemacht, um da oder dort zu einem Abendschöppchen unterzukommen, sagte Estherchen: »Mir ist es nun zumute, als ob der Pankraz ganz gewiss heute noch kommen würde, da schon so viele unerwartete Dinge geschehen und solche Kamele, Affen und Bären dagewesen sind!« Die Mutter ward böse darüber, dass sie den armen Pankraz mit diesen Bestien sozusagen zusammenzählte und auslachte, und hieß sie schweigen, nicht innewerdend, dass sie ja selbst das gleiche getan in ihren Gedanken. Dann sagte sie seufzend: »Ich werde es nicht erleben, dass er wiederkommt!«
Indem sie dies sagte, begab sich die größte Merkwürdigkeit dieses Tages, und ein offener Reisewagen mit einem Extrapostillion fuhr mit Macht auf das stille Plätzchen, das von der Abendsonne noch halb bestreift war. In dem Wagen saß ein Mann, der eine Mütze trug, wie die französischen Offiziere sie tragen, und ebenso trug er einen Schnurr- und Kinnbart und ein gänzlich gebräuntes und ausgedörrtes Gesicht zur Schau, das überdies einige Spuren von Kugeln und Säbelhieben zeigte. Auch war er in einen Burnus gehüllt, alles dies, wie es französische Militärs aus Afrika mitzubringen pflegen, und die Füße stemmte er gegen eine kolossale Löwenhaut, welche auf dem Boden des Wagens lag; auf dem Rücksitze vor ihm lag ein Säbel und eine halblange arabische Pfeife neben andern fremdartigen Gegenständen.
Dieser Mann sperrte ungeachtet des ernsten Gesichtes, das er machte, die Augen weit auf und suchte mit denselben rings auf dem Platze ein Haus, wie einer, der aus einem schweren Traume erwacht. Beinahe taumelnd sprang er aus dem Wagen, der von ungefähr auf der Mitte des Plätzchens stillhielt; doch ergriff er die Löwenhaut und seinen Säbel und ging sogleich sicheren Schrittes in das Häuschen der Witwe, als ob er erst vor einer Stunde aus demselben gegangen wäre. Die Mutter und Estherchen sahen dies voll Verwunderung und Neugierde und horchten auf, ob der Fremde die Treppe heraufkäme; denn obgleich sie kaum noch von Pankrazius gesprochen, hatten sie in diesem Augenblick keine Ahnung, dass er es sein könnte, und ihre Gedanken waren von der überraschten Neugierde himmelweit von ihm weggeführt. Doch urplötzlich erkannten sie ihn an der Art, wie er die obersten Stufen übersprang und über den kurzen Flur weg fast gleichzeitig die Klinke der Stubentür ergriff, nachdem er wie der Blitz vorher den lose steckenden Stubenschlüssel fester ins Schloss gestoßen, was sonst immer die Art des Verschwundenen gewesen, der in seinem Müßiggange eine seltsame Ordnungsliebe bewährt hatte. Sie schrien laut auf und standen festgebannt vor ihren Stühlen, mit offenem Munde nach der aufgehenden Türe sehend. Unter dieser stand der fremde Pankrazius mit dem dürren und harten Ernste eines fremden Kriegsmannes, nur zuckte es ihm seltsam um die Augen, indessen die Mutter erzitterte bei seinem Anblick und sich nicht zu helfen wusste und selbst Estherchen zum ersten Mal gänzlich verblüfft war und sich nicht zu regen wagte. Doch alles dies dauerte nur einen Augenblick; der Herr Oberst, denn nichts Geringeres war der verlorene Sohn, nahm mit der Höflichkeit und Achtung, welche ihn die wilde Not des Lebens gelehrt, sogleich die Mütze ab, was er nie getan, wenn er früher in die Stube getreten; eine unaussprechliche Freundlichkeit, wenigstens wie es den Frauen vorkam, die ihn nie freundlich gesehen noch also denken konnten, verbreitete sich über das gefurchte und doch noch nicht alte Soldatengesicht und ließ schneeweiße Zähne sehen, als er auf sie zueilte und beide mit ausbrechendem Herzensweh in die Arme schloss.
Hatte die Mutter erst vor dem martialischen und vermeintlich immer noch bösen Sohne sonderbar gezittert, so zitterte sie jetzt erst recht in scheuer Seligkeit, da sie sich in den Armen dieses wiedergekehrten Sohnes fühlte, dessen achtungsvolles Mützenabnehmen und dessen aufleuchtende, nie gesehene Anmut, wie sie nur die Rührung und die Reue gibt, sie schon wie mit einem Zauberschlage berührt hatten. Denn noch ehe das Bürschchen sieben Jahre alt gewesen, hatte es schon angefangen, sich ihren Liebkosungen zu entziehen, und seither hatte Pankraz in bitterer Sprödigkeit und Verstockung sich gehütet, seine Mutter auch nur mit der Hand zu berühren, abgesehen davon, dass er unzählige Male schmollend zu Bett gegangen war, ohne Gutenacht zu sagen. Daher bedünkte es sie nun ein unbegreiflicher und wundersamer Augenblick, in welchem ein ganzes Leben lag, als sie jetzt nach wohl dreißig Jahren sozusagen zum ersten Mal sich von dem Sohne umfangen sah. Aber auch Estherchen bedünkte dieses veränderte Wesen so ernsthaft und wichtig, dass sie, die den Schmollenden tausendmal ausgelacht hatte, jetzt nicht im mindesten den bekehrten Freundlichen anzulachen vermochte, sondern mit klaren Tränen in den Augen nach ihrem Sesselchen ging und den Bruder unverwandt anblickte.
Pankraz war der erste, der sich nach mehreren Minuten wieder zusammennahm und als ein guter Soldat einen Übergang und Ausweg dadurch bewerkstelligte, dass er sein Gepäck heraufbeförderte. Die Mutter wollte mit Estherchen helfen; aber er führte sie äußerst holdselig zu ihrem Sitze zurück und duldete nur, dass Estherchen zum Wagen herunterkam und sich mit einigen leichten Sachen belud. Den weitern Verlauf führte indessen Estherchen herbei, welche bald ihren guten Humor wiedergewann und nicht länger unterlassen konnte, die Löwenhaut an dem langen gewaltigen Schwanze zu packen und auf dem Boden herumzuziehen, indem sie sich krank lachen wollte und einmal über das andere rief: »Was ist dies nur für ein Pelz? Was ist dies für ein Ungeheuer?«
»Dies ist«, sagte Pankraz, seinen Fuß auf das Fell stoßend, »vor drei Monaten noch ein lebendiger Löwe gewesen, den ich getötet habe. Dieser Bursche war mein Lehrer und Bekehrer und hat mir zwölf Stunden lang so eindringlich gepredigt, dass ich armer Kerl endlich von allem Schmollen und Bössein für immer geheilt wurde. Zum Andenken soll seine Haut nicht mehr aus meiner Hand kommen. Das war eine schöne Geschichte!« setzte er mit einem Seufzer hinzu.
In der Voraussicht, dass seine Leutchen, im Fall er sie noch lebendig anträfe, jedenfalls nicht viel Kostbares im Hause hätten, hatte er in der letzten größeren Stadt, wo er durchgereist, einen Korb guten Weines eingekauft sowie einen Korb mit verschiedenen guten Speisen, damit in Seldwyla kein Gelaufe entstehen sollte und er in aller Stille mit der Mutter und der Schwester ein Abendbrot einnehmen konnte. So brauchte die Mutter nur den Tisch zu decken, und Pankraz trug auf: einige gebratene Hühner, eine herrliche Sülzpastete und ein Paket feiner kleiner Kuchen; ja noch mehr! Auf dem Wege hatte er bedacht, wie dunkel einst das armselige Tranlämpchen gebrannt und wie oft er sich über die kümmerliche Beleuchtung geärgert, wobei er kaum seine müßigen Siebensachen handhaben gekonnt, ungeachtet die Mutter, die doch ältere Augen hatte, ihm immer das Lämpchen vor die Nase geschoben, wiederum zum großen Ergötzen Estherchens, die bei jeder Gelegenheit ihm die Leuchte wieder wegzupraktizieren verstanden. Ach, einmal hatte er sie zornig weinend ausgelöscht, und als die Mutter sie bekümmert wieder angezündet, blies sie Estherchen lachend wieder aus, worauf er zerrissenen Herzens ins Bett gerannt. Dies und noch anderes war ihm auf dem Wege eingefallen, und indem er schmerzlich und bang kaum erleben mochte, ob er die Verlassenen wiedersehen würde, hatte er auch noch einige Wachskerzen eingekauft und zündete jetzo zwei derselben an, sodass die Frauensleute sich nicht zu lassen wussten vor Verwunderung ob all der Herrlichkeit.
Dergestalt ging es wie auf einer kleinen Hochzeit in dem Häuschen der Witwe, nur viel stiller, und Pankraz benutzte das helle Licht der Kerzen, die gealterten Gesichter seiner Mutter und Schwester zu sehen, und dies Sehen rührte ihn stärker als alle Gefahren, denen er ins Gesicht geschaut. Er verfiel in ein tiefes trauriges Sinnen über die menschliche Art und das menschliche Leben und wie gerade unsere kleineren Eigenschaften, eine freundliche oder herbe Gemütsart, nicht nur unser Schicksal und Glück machen, sondern auch dasjenige der uns Umgebenden und uns zu diesen in ein strenges Schuldverhältnis zu bringen vermögen, ohne dass wir wissen, wie es zugegangen, da wir uns ja unser Gemüt nicht selbst gegeben. In diesen Betrachtungen ward er jedoch gestört durch die Nachbaren, welche jetzt ihre Neugierde nicht länger unterdrücken konnten und einer nach dem andern in die Stube drangen, um das Wundertier zu sehen, da sich schon in der ganzen Stadt das Gerücht verbreitet hatte, der verschollene Pankrazius sei erschienen, und zwar als ein französischer General in einem vierspännigen Wagen.
Dies war nun ein höchst verwickelter Fall für die in ihren Vergnügungslokalen versammelten Seldwyler, sowohl für die Jungen als wie für die Alten, und sie kratzten sich verdutzt hinter den Ohren. Denn dies war gänzlich wider die Ordnung und wider den Strich zu Seldwyl, dass da einer wie vom Himmel geschneit als ein gemachter Mann und General herkommen sollte gerade in dem Alter, wo man zu Seldwyl sonst fertig war. Was wollte der denn nun beginnen? Wollte er wirklich am Orte bleiben, ohne ein Herabgekommener zu sein die übrige Zeit seines Lebens hindurch, besonders wenn er etwa alt würde? Und wie hatte er es angefangen? Was zum Teufel hatte der unbeachtete und unscheinbare junge Mensch betrieben die lange Jugend hindurch, ohne sich aufzubrauchen? Das war die Frage, die alle Gemüter bewegte, und sie fanden durchaus keinen Schlüssel, das Rätsel zu lösen, weil ihre Menschen- oder Seelenkunde zu klein war, um zu wissen, dass gerade die herbe und bittere Gemütsart, welche ihm und seinen Angehörigen so bittere Schmerzen bereitet, sein Wesen im übrigen wohl konserviert, wie der scharfe Essig ein Stück Schöpsenfleisch, und ihm über das gefährliche Seldwyler Glanzalter hinweggeholfen hatte. Um die Frage zu lösen, stellte man überhaupt die Wahrheit des Ereignisses in Frage und bestritt dessen Möglichkeit, und um diese Auffassung zu bestätigen, wurden verschiedene alte Falliten nach dem Plätzchen abgesandt, sodass Pankraz, dessen schon versammelte Nachbaren ohnehin diesem Stande angehörten, sich von einer ganzen Versammlung neugieriger und gemütlicher Falliten umgeben sah, wie ein alter Heros in der Unterwelt von den herbeieilenden Schatten.
Er zündete nun seine türkische Pfeife an und erfüllte das Zimmer mit dem fremden Wohlgeruch des morgenländischen Tabaks; die Schatten oder Falliten witterten immer neugieriger in den blauen Duftwolken umher, und Estherchen und die Mutter bestaunten unaufhörlich die Leutseligkeit und Geschicklichkeit des Pankraz, mit welcher er die Leute unterhielt, und zuletzt die freundliche, aber sichere Gewandtheit, mit welcher er die Versammlung endlich entließ, als es ihm Zeit dazu schien.
Da aber die Freuden, welche auf dem Familienglück und auf frohen Ereignissen unter Blutsverwandten beruhen, auch nach den längsten Leiden die Beteiligten plötzlich immer jung und munter machen, statt sie zu erschöpfen, wie die Aufregungen der weiteren Welt es tun, so verspürte die alte Mutter noch nicht die geringste Müdigkeit und Schlaflust, so wenig als ihre Kinder, und von dem guten Weine erwärmt, den sie mit Zufriedenheit genossen, verlangte sie endlich mit ihrer noch viel ungeduldigeren Tochter etwas Näheres von Pankrazens Schicksal zu wissen.
»Ausführlich«, erwiderte dieser, »kann ich jetzt meine trübselige Geschichte nicht mehr beginnen, und es findet sich wohl die Zeit, wo ich euch nach und nach meine Erlebnisse im einzelnen vorsagen werde. Für heute will ich euch aber nur einige Umrisse angeben, soviel als nötig ist, um auf den Schluss zu kommen, nämlich auf meine Wiederkehr und die Art, wie diese veranlasst wurde, da sie eigentlich das rechte Seitenstück bildet zu meiner ehemaligen Flucht und aus dem gleichen Grundtone geht. Als ich damals auf so schnöde Weise entwich, war ich von einem unvertilgbaren Groll und Weh erfüllt; doch nicht gegen euch, sondern gegen mich selbst, gegen diese Gegend hier, diese unnütze Stadt, gegen meine ganze Jugend. Dies ist mir seither erst deutlich geworden. Wenn ich hauptsächlich immer des Essens wegen bös wurde und schmollte, so war der geheime Grund hievon das nagende Gefühl, dass ich mein Essen nicht verdiente, weil ich nichts lernte und nichts tat, ja weil mich gar nichts reizte zu irgendeiner Beschäftigung und also keine Hoffnung war, dass es je anders würde; denn alles, was ich andere tun sah, kam mir erbärmlich und albern vor; selbst euer ewiges Spinnen war mir unerträglich und machte mir Kopfweh, obgleich es mich Müßigen erhielt. So rannte ich davon in einer Nacht in der bittersten Herzensqual und lief bis zum Morgen, wohl sieben Stunden weit von hier. Wie die Sonne aufging, sah ich Leute, die auf einer großen Wiese Heu machten; ohne ein Wort zu sagen oder zu fragen, legte ich mein Bündel an den Rand, ergriff einen Rechen oder eine Heugabel und arbeitete wie ein Besessener mit den Leuten und mit der größten Geschicklichkeit; denn ich hatte mir während meines Herumlungerns hier alle Handgriffe und Übungen derjenigen, welche arbeiteten, wohl gemerkt, sogar öfter dabei gedacht, wie sie dies und jenes ungeschickt in die Hand nähmen und wie man eigentlich die Hände ganz anders müsste fliegen lassen, wenn man erst einmal ein Arbeiter heißen wolle.
Die Leute sahen mir erstaunt zu, und niemand hinderte mich an meiner Arbeit; als sie das Morgenbrot aßen, wurde ich dazu eingeladen; dieses hatte ich bezweckt und so arbeitete ich weiter, bis das Mittagessen kam, welches ich ebenfalls mit großem Appetit verzehrte. Doch nun erstaunten die Bauersleute noch viel mehr und sandten mir ein verdutztes Gelächter nach, als ich, anstatt die Heugabel wieder zu ergreifen, plötzlich den Mund wischte, mein Bündelchen wieder aufgriff und, ohne ein Wort weiter zu verlieren, meines Weges weiterzog. In einem dichten kühlen Buchenwäldchen legte ich mich hin und schlief bis zur Abenddämmerung; dann sprang ich auf, ging aus dem Wäldchen hervor und guckte am Himmel hin und her, an welchem die Sterne hervorzutreten begannen. Die Stellung der Sterne gehörte auch zu den wenigen Dingen, die ich während meines Müßigganges gemerkt, und da ich darin eine große Ordnung und Pünktlichkeit gefunden, so hatte sie mir immer wohlgefallen, und zwar um so mehr, als diese glänzenden Geschöpfe solche Pünktlichkeit nicht um Tagelohn und um eine Portion Kartoffelsuppe zu üben schienen, sondern damit nur taten, was sie nicht lassen konnten, wie zu ihrem Vergnügen, und dabei wohl bestanden. Da ich nun durch das allmähliche Auswendiglernen unsres Geografiebuches, so einfach dieses war, auch auf dem Erdboden Bescheid wusste, so verstand ich meine Richtung wohl zu nehmen und beschloss in diesem Augenblick, nordwärts durch ganz Deutschland zu laufen, bis ich das Meer erreichte. Also lief ich die Nacht hindurch wieder acht gute Stunden und kam mit der Morgensonne an eine wilde und entlegene Stelle am Rhein, wo eben vor meinen Augen ein mit Kornsäcken beladenes Schiff an einer Untiefe aufstieß, indessen doch das Wasser über einen Teil der Ladung wegströmte. Da sich nur drei Männer bei dem Schiffe befanden und weit und breit in dieser Frühe und in dieser Wildnis niemand zu ersehen war, so kam ich sehr willkommen, als ich sogleich Hand anlegte und den Schiffern die schwere Ladung ans Ufer bringen und das Fahrzeug wieder flottmachen half. Was von dem Korne nass geworden, schütteten wir auf Bretter, die wir an die Sonne legten, und wandten es fleißig um, und zuletzt beluden wir das Schiff wieder. Doch nahm dies alles den größten Teil des Tages weg, und ich fand dabei Gelegenheit, mit den Schiffsleuten unterschiedliche tüchtige Mahlzeiten zu teilen; ja, als wir fertig waren, gaben sie mir sogar noch etwas Geld und setzten mich auf mein Verlangen an das andere Ufer über mittelst des kleinen Kähnchens, das sie hinter dem großen Kahne angebunden hatten.
Drüben befand ich mich in einem großen Bergwald und schlief sofort, bis es Nacht wurde, worauf ich mich abermals auf die Füße machte und bis zum Tagesanbruch lief. Mit wenig Worten zu sagen: auf diese nämliche Art gelangte ich in wenig mehr als zwei Monaten nach Hamburg, indem ich, ohne je viel mit den Leuten zu sprechen, überall des Tages zugriff, wo sich eine Arbeit zeigte, und davonging, sobald ich gesättigt war, um die Nacht hindurch wiederum zu wandern. Meine Art überraschte die Leute immer, sodass ich niemals einen Widerspruch fand, und bis sie sich etwa widerhaarig oder neugierig zeigen wollten, war ich schon wieder weg. Da ich zugleich die Städte vermied und meinen Arbeitsverkehr immer im freien Felde, auf Bergen und in Wäldern betrieb, wo nur ursprüngliche und einfache Menschen waren, so reisete ich wirklich wie zu der Zeit der Patriarchen. Ich sah nie eine Spur von dem Regiment der Staaten, über deren Boden ich hinlief, und mein einziges Denken war, über eben diesen Boden wegzukommen, ohne zu betteln oder für meine nötige Leibesnahrung jemandem verpflichtet sein zu müssen, im übrigen aber zu tun, was ich wollte, und insbesondere zu ruhen, wenn es mir gefiel, und zu wandern, wenn es mir beliebte. Später habe ich freilich auch gelernt, mich an eine feste außer mir liegende Ordnung und an eine regelmäßige Ausdauer zu halten, und wie ich erst urplötzlich arbeiten gelernt, lernte ich auch dies sogleich ohne weitere Anstrengung, sobald ich nur einmal eine erkleckliche Notwendigkeit einsah.
Übrigens bekam mir dies Leben in der freien Luft, bei der steten Abwechslung von schwerer Arbeit, tüchtigem Essen und sorgloser Ruhe vortrefflich, und meine Glieder wurden so geübt, dass ich als ein kräftiger und rühriger Kerl in der großen Handelsstadt Hamburg anlangte, wo ich alsbald dem Wasser zulief und mich unter die Seeleute mischte, welche sich da umtrieben und mit dem Befrachten ihrer Schiffe beschäftigt waren. Da ich überall zugriff und ohne albernes Gaffen doch aufmerksam war, ohne ein Wort dabei zu sprechen noch je den Mund zu verziehen, so duldeten die einsilbigen derben Gesellen mich bald unter sich, und ich brachte eine Woche unter ihnen zu, worauf sie mich auf einem englischen Kauffahrer einschmuggelten, dessen Kapitän mich aufnahm unter der Bedingung, dass ich ihm in seinem Privatgeschäfte helfe, das er während seiner Fahrten betrieb. Dieses bestand nämlich im Zusammensetzen und Herstellen von allerhand Feuerwaffen und Pistolen aus alten abgenutzten Bestandteilen, die er in großer Menge zusammenkaufte, wenn er in der Alten Welt vor Anker ging. Es waren seltsame und fabelhafte Todeswerkzeuge, die er so mit schrecklicher Leidenschaft zusammenfügte und dann bei Gelegenheit an wilden Küsten gegen wertvolle Friedensprodukte und sanfte Naturgegenstände austauschte. Ich hielt mich still zu der Arbeit, übte mich ein und war bald über und über mit Öl, Schmirgel und Feilenstaub beschmiert als ein wilder Büchsenmacher, und wenn ein solches Pistolengeschütz notdürftig zusammenhielt, so wurde es mit einem starken Knall probiert; doch nie zum zweiten Mal, dieses wurde dem rothäutigen oder schwarzen Käufer überlassen auf den entlegenen Eilanden. Diesmal fuhr er aber nur nach Neuyork und von da nach England zurück, wo ich, der Büchsenmacherei nun genugsam kundig, mich von ihm entfernte und sogleich in ein Regiment anwerben ließ, das nach Ostindien abgehen sollte.
In Neuyork hatte ich zwar den Fuß an das Land gesetzt und auf einige Stunden dies amerikanische Leben besehen, welches mir eigentlich nun recht hätte zusagen müssen, da hier jeder tat, was er wollte, und sich gänzlich nach Bedürfnis und Laune rührte, von einer Beschäftigung zur anderen abspringend, wie es ihm eben besser schien, ohne sich irgendeiner Arbeit zu schämen oder die eine für edler zu halten als die andere. Doch weiß ich nicht, wie es kam, dass ich mich schleunig wieder auf unser Schiff sputete und so, statt in der Neuen Welt zu bleiben, in den ältesten, träumerischen Teil unsrer Welt geriet, in das uralte heiße Indien, und zwar in einem roten Rocke, als ein stiller englischer Soldat. Und ich kann nicht sagen, dass mir das neue Leben missfiel, das schon auf dem großen Linienschiffe begann, auf welchem das Regiment sich befand. Schon der Umstand, dass wir alle, so viel wir waren, mit der größten Pünktlichkeit und Abgemessenheit ernährt wurden, indem jeder seine Ration so sicher bekam, wie die Sterne am Himmel gehen, keiner mehr noch minder als der andere und ohne dass einer den andern beeinträchtigen konnte, behagte mir außerordentlich und umso mehr, als keiner dafür zu danken brauchte und alles nur unserm bloßen wohlgeordneten Dasein gebührte. Wenn wir Rekruten auch schon auf dem Schiffe eingeschult wurden und täglich exerzieren mussten, so gefiel mir doch diese Beschäftigung über die Maßen, da wir nicht das Bajonett herumschwenken mussten, um etwa mit Gewandtheit eine Kartoffel daran zu spießen, sondern es war lediglich eine reine Übung, welche mit dem Essen zunächst gar nicht zusammenhing, und man brauchte nichts als pünktlich und aufmerksam beim einen und dem andern zu sein und sich um weiter nichts zu kümmern. Schon am zweiten Tage unserer Fahrt sah ich einen Soldaten prügeln, der wider einen Vorgesetzten gemurrt, nachdem er schon verschiedene Unregelmäßigkeiten begangen. Sogleich nahm ich mir vor, dass dies mir nie widerfahren solle, und nun kam mir mein Schmollwesen sehr gut zustatten, indem es mir eine vortreffliche lautlose Pünktlichkeit und Aufmerksamkeit erleichterte und es mir fortwährend möglich machte, mir in keiner Weise etwas zu vergeben.
So wurde ich ein ganz ordentlicher und brauchbarer Soldat; es machte mir Freude, alles recht zu begreifen und so zu tun, wie es als mustergültig vorgeschrieben war, und da es mir gelang, so fühlte ich mich endlich ziemlich zufrieden, ohne jedoch mehr Worte zu verlieren als bisher. Nur selten wurde ich beinahe ein wenig lustig und beging etwa einen närrischen halben Spaß, was mir vollends den Anstrich eines Soldaten gab, wie er sein soll, und zugleich verhinderte, dass man mich nicht leiden konnte, und so war kaum ein Jahr vergangen in dem heißen, seltsamen Lande, als ich anfing vorzurücken und zuletzt ein ansehnlicher Unteroffizier wurde. Nach einem Verlauf von Jahren war ich ein großes Tier in meiner Art, war meistenteils in den Bureaus des Regimentskommandeurs beschäftigt und hatte mich als ein guter Verwalter herausgestellt, indem ich die notwendigen Künste, die Schreibereien und Rechnereien, aus dem Gange der Dinge mir augenblicklich aneignete ohne weiteres Kopfzerbrechen. Es ging mir jetzt alles nach der Schnur, und ich schien mir selbst zufrieden zu sein, da ich ohne Mühe und Sorgen dasein konnte unter dem warmen blauen Himmel; denn was ich zu verrichten hatte, geschah wie von selbst, und ich fühlte keinen Unterschied, ob ich in Geschäften oder müßig umherging. Das Essen war mir jetzt nichts Wichtiges mehr, und ich beachtete kaum, wann und was ich aß. Zweimal während dieser Zeit hatte ich Nachricht an euch abgesandt nebst einigen ersparten Geldmitteln; allein beide Schiffe gingen sonderbarerweise mit Mann und Maus zugrunde, und ich gab die Sache auf, ärgerlich darüber, und nahm mir vor, sobald als tunlich selber heimzukehren und meine erworbene Arbeitsfähigkeit und feste Lebensart in der Heimat zu verwenden. Denn ich gedachte damit etwas Besseres nach Seldwyla zu bringen, als wenn ich eine Million dahin brächte, und malte mir schon aus, wie ich die Haselanten und Fischesser da anfahren wollte, wenn sie mir über den Weg liefen.
Doch damit hatte es noch gute Wege, und ich sollte erst noch solche Dinge erfahren und so in meinem Wesen verändert und aufgerüttelt werden, dass mir die Lust verging, andere Leute anfahren zu wollen. Der Kommandeur hatte mich gänzlich zu seinem Faktotum gemacht, und ich musste fast die ganze Zeit bei ihm zubringen. Es war ein seltsamer Mann von etwa fünfzig Jahren, dessen Gattin in Irland lebte auf einem alten Turm, da sie womöglich noch wunderlicher sein musste als er; solange sie zusammengelebt, hatten sie sich fortwährend angeknurrt wie zwei wilde Katzen, und sie litten beide an der fixen Idee, dass sie sich gegenseitig ineinander getäuscht hätten, obwohl niemand besser füreinander geschaffen war. Auch waren sie gesund und munter und lebten behaglich in dieser Einbildung, ohne welche keines mehr hätte die Zeit verbringen können, und wenn sie weit auseinander waren, so sorgte eines für das andere mit rührender Aufmerksamkeit. Die einzige Tochter, die sie hatten und die Lydia heißt, lebte dagegen meistenteils bei dem Vater und war ihm ergeben und zugetan, da der Unterschied des Geschlechtes selbst zwischen Vater und Tochter diese mehr zärtliches Mitleid für den Vater empfinden ließ als für die Mutter, obgleich diese ebenso wenig oder so viel taugen mochte als jener in dem vermeintlich unglücklichen Verhältnis.
Der Kommandeur hatte eine reizvolle luftige Wohnung bezogen, die außerhalb der Stadt in einem ganz mit Palmen, Zypressen, Sykomoren und anderen Bäumen angefüllten Tale lag. Unter diesen Bäumen, rings um das leichte weiße Haus herum, waren Gärten angelegt, in denen teils jederzeit frisches Gemüse, teils eine Menge Blumen gezogen wurden, welche zwar hier in allen Ecken wild wuchsen, die aber der Alte liebte beisammen zu haben in nächster Nähe und in möglichster Menge, sodass in dem grünen Schatten der Bäume es ordentlich leuchtete von großen purpurroten und weißen Blumen. Wenn es nun im Dienste nichts mehr zu tun gab, so musste ich als ein militärischer zuverlässiger Vertrauensmann diese Gärten in Ordnung halten oder, um darüber nicht etwa zu verweichlichen, mit dem Oberst auf die Jagd gehen, und ich wurde darüber zu einem gewandten Jäger; denn gleich hinter dem Tale begann eine wilde unfruchtbare Landschaft, welche zuletzt gänzlich in eine Gebirgswildnis verlief, die nicht nur Schwärme und Scharen unschuldigeren Gewildes, sondern auch von Zeit zu Zeit reißende Tiere, besonders große Tiger, beherbergte. Wenn ein solcher sich spüren ließ, so gab es einen großen Auszug gegen ihn, und ich lernte bei diesen Gelegenheiten die Gefahr lange kennen, ehe ich in das Gefecht mit Menschen kam. War aber weiter gar nichts zu tun, so musste ich mit dem alten Herrn Schach spielen und dadurch seine Tochter Lydia ersetzen, welche, da sie gar keinen Sinn und kein Geschick dazu besaß und ganz kindisch spielte, ihm zuwenig Vergnügen verschaffte. Ich hingegen hatte mich bald so weit eingeübt, dass ich ihm einigermaßen die Stange halten konnte, ohne ihn des öfteren Sieges zu berauben, und wenn mein Kopf nicht durch andere Dinge verwirrt worden wäre, so würde ich dem grimmigen Alten bald überlegen geworden sein.
Dergestalt war ich nun das merkwürdigste Institut von der Welt; ich ging unter diesen Palmen einher gravitätisch und wortlos in meiner Scharlachuniform, ein leichtes Schilfstöckchen in der Hand und über dem Kopfe ein weißes Tuch zum Schutze gegen die heiße Sonne. Ich war Soldat, Verwaltungsmann, Gärtner, Jäger, Hausfreund und Zeitvertreiber, und zwar ein ganz sonderbarer, da ich nie ein Wort sprach; denn obgleich ich jetzt nicht mehr schmollte und leidlich zufrieden war, so hatte ich mir das Schweigen doch so angewöhnt, dass meine Zunge durch nichts zu bewegen war als etwa durch ein Kommandowort oder einen Fluch gegen unordentliche Soldaten. Doch diente gerade diese Weise dem Kommandeur, ich blieb so an die fünf Jahre bei ihm einen Tag wie den andern und konnte, wenn ich freie Zeit hatte, im übrigen tun, was mir beliebte. Diese Zeit benutzte ich dazu, das Dutzend Bücher, so der alte Herr besaß, immer wieder durchzulesen und aus denselben, da sie alle dickleibig waren, ein sonderbares Stück von der Welt kennenzulernen. Ich war so ein eifriger und stiller Leser, der sich eine Weisheit ausbildete, von der er nicht recht wusste, ob sie in der Welt galt oder nicht galt, wie ich bald erfahren sollte; denn obschon ich bereits vieles gesehen und erfahren, so war dies doch nur gewissermaßen strichweise, und das meiste, was es gab, lag zur Seite des Striches, den ich passiert.
Mein Kommandeur wurde endlich zum Gouverneur des ganzen Landstriches ernannt, wo wir bisher gestanden; er wünschte mich in seiner Nähe zu behalten und veranlasste meine Versetzung aus dem Regiment, welches wieder nach England zurückging, in dasjenige, welches dafür ankam, und so fand sich wieder Gelegenheit, dass ich als Militärperson sowohl wie in allen übrigen Eigenschaften um ihn sein konnte, was mir ganz recht war; denn so blieb ich ein auf mich selbst gestellter Mensch, der keinen andern Herrn als seine Fahne über sich hatte.
Um die gleiche Zeit kam auch die Tochter aus dem alten irländischen Turme an, um von nun an bei ihrem Vater, dem Gouverneur, zu leben. Es war ein wohlgestaltetes Frauenzimmer von großer Schönheit; doch war sie nicht nur eine Schönheit, sondern auch eine Person, die in ihren eigenen feinen Schuhen stand und ging und sogleich den Eindruck machte, dass es für den, der sich etwa in sie verliebte, nicht leicht hinter jedem Hag einen Ersatz oder einen Trost für diese gäbe, eben weil es eine ganze und selbstständige Person schien, die so nicht zum zweiten Male vorkomme. Und zwar schien diese edle Selbstständigkeit gepaart mit der einfachsten Kindlichkeit und Güte des Charakters und mit jener Lauterkeit und Rückhaltlosigkeit in dieser Güte, welche, wenn sie so mit Entschiedenheit und Bestimmtheit verbunden ist, eine wahre Überlegenheit verleiht und dem, was im Grunde nur ein unbefangenes ursprüngliches Gemütswesen ist, den Schein einer weihevollen und genialen Meisterschaft gibt. Indessen war sie sehr gebildet in allen schönen Dingen, da sie nach Art solcher Geschöpfe die Kindheit und bisherige Jugend damit zugebracht, alles zu lernen, was irgend wohl ansteht, und sie kannte sogar fast alle neueren Sprachen, ohne dass man jedoch viel davon bemerkte, sodass unwissende Männer ihr gegenüber nicht leicht in jene schreckliche Verlegenheit gerieten, weniger zu verstehen als ein müßiges Ziergewächs von Jungfräulein. Überhaupt schien ein gesunder und wohldurchgebildeter Sinn in ihr sich mehr dadurch zu zeigen, dass sie die vorkommenden kleineren oder größeren Dinge, Vorfälle oder Gegenstände durchaus zutreffend beurteilte und behandelte, und dabei waren ihre Gedanken und Worte so einfach lieblich und bestimmt wie der Ton ihrer Stimme und die Bewegungen ihres Körpers. Und über alles dies war sie, wie gesagt, so kindlich, so wenig durchtrieben, dass sie nicht imstande war, eine überlegte Partie Schach spielen zu lernen, und dennoch mit der fröhlichsten Geduld am Brette saß, um sich von ihrem Vater unaufhörlich überrumpeln zu lassen. So ward es einem sogleich heimatlich und wohl zumute in ihrer Nähe; man dachte unverweilt, diese wäre der wahre Jakob unter den Weibern und keine Bessere gäbe es in der Welt. Ihre schönen blonden Locken und die dunkelblauen Augen, die fast immer ernst und frei in die Welt sahen, taten freilich auch das ihrige dazu, ja um so mehr, als ihre Schönheit, sosehr sie auffiel, von echt weiblicher Bescheidenheit und Sittsamkeit durchdrungen war und dabei gänzlich den Eindruck von etwas Einzigem und Persönlichem machte; es war eben kurz und abermals gesagt: eine Person. Das heißt, ich sage: es schien so, oder eigentlich, weiß Gott, ob es am Ende doch so war und es nur an mir lag, dass es ein solcher trügerischer Schein schien, kurz –«
Pankrazius vergaß hier weiterzureden und verfiel in ein schwermütiges Nachdenken, wozu er ein ziemlich unkriegerisches und beinahe einfältiges Gesicht machte. Die beiden Wachslichter waren über die Hälfte heruntergebrannt, die Mutter und die Schwester hatten die Köpfe gesenkt und nickten, schon nichts mehr sehend noch hörend, schlaftrunken mit ihren Köpfen, denn schon seit Pankrazius die Schilderung seiner vermutlichen Geliebten begonnen, hatten sie angefangen schläfrig zu werden, ließen ihn jetzt gänzlich im Stich und schliefen wirklich ein. Zum Glück für unsere Neugierde bemerkte der Oberst dies nicht, hatte überhaupt vergessen, vor wem er erzählte, und fuhr, ohne die niedergeschlagenen Augen zu erheben, fort, vor den schlafenden Frauen zu erzählen, wie einer, der etwas lange Verschwiegenes endlich mitzuteilen sich nicht mehr enthalten kann.
»Ich hatte«, sagte er, »bis zu dieser Zeit noch kein Weib näher angesehen und verstand oder wusste von ihnen ungefähr soviel wie ein Nashorn vom Zitherspiel. Nicht dass ich solche etwa nicht von jeher gern gesehen hätte, wenn ich unbemerkt und ohne Aufwand von Mühe nach ihnen schielen konnte; doch war es mir äußerst zuwider, mit irgendeiner mich in den geringsten Wortwechsel einzulassen, da es mir von jeher schien, als ob es sämtlichen Weibern gar nicht um eine vernunftgemäße, klare und richtige Sache zu tun wäre, dass es ihnen unmöglich sei, nur sechs Worte lang in guter Ordnung bei der Stange zu bleiben, sondern dass sie einzig darauf ausgingen, wenn sie in diesem Augenblicke etwas Zweckmäßiges und Gutes gesagt haben, gleich darauf eine große Albernheit oder Verdrehtheit einzuwerfen, was sie dann als ihre weibliche Anmut und Beweglichkeit ausgäben, im Grunde aber eine Unredlichkeit sei, und um so abscheulicher, als sie halb und halb von bewusster Absicht begleitet sei, um hinter diesem Durcheinander allen schlechten Instinkten und Querköpfigkeiten desto bequemer zu frönen. Deshalb schmollte und grollte ich von vornherein mit allem Weibervolk und würdigte keines eines offenkundigen Blickes. In Indien, als ich mehr zufrieden war und keinen Groll fürder hegte, gab es zwar viele Frauensleute, sowohl indischen Geblütes als auch eine Menge englischer, da viele Kaufleute, Offiziere und Soldaten ihre Familie bei sich hatten. Doch diese Indierinnen, die schön waren wie die Blumen und gut wie Zucker aussahen und sprachen, waren eben nichts weiter als dies und rührten mich nicht im mindesten, da Schönheit und Güte ohne Salz und Wehrbarkeit mir langweilig vorkamen, und es war mir peinlich zu denken, wie eine solche Frau, wenn sie mein wäre, sich auf keine Weise gegen meine etwanigen schlimmen Launen zu wehren vermöchte. Die europäischen Weiber dagegen, die ich sah, welche größtenteils aus Großbritannien herstammten, schienen schon eher wehrhaft zu sein, jedoch waren sie weniger gut, und selbst wenn sie es waren, so betrieben sie die Güte und Ehrbarkeit wie ein abscheulich nüchternes und hausbackenes Handwerk, und selbst die edle Weiblichkeit, auf die sich diese selbstbewussten respektablen Weibchen soviel zu gut taten, handhabten sie eher als Würzkrämer denn als Weiber. Hier wird ein Quentchen ausgewogen und dort ein Quentchen sorglich in die löschpapierne Düte der Philisterhaftigkeit gewickelt. Überdies war mir immer, als ob durch das Innerste aller dieser abendländischen Schönen und Unschönen ein tiefer Zug von Gemeinheit zöge, die Krankheit unserer Zeit, welche sie zwar nur von unserm Geschlechte, von uns Herren Europäern, überkommen konnten, aber die gerade bei den anderen wieder zu einem neuen verdoppelten Übel wird. Denn es sind üble Zeiten, wo die Geschlechter ihre Krankheiten austauschen und eines dem andern seine angeborenen Schwachheiten mitteilt. Dies waren so meine unwissenden hypochondrischen Gedanken über die Weiber, welche meinem Verhalten gegen sie zugrunde lagen und mit welchen ich meiner Wege ging, ohne mich um eine zu bekümmern.
Als nun die schöne Lydia bei uns anlangte und ich mich täglich in ihrer Nähe befand, erhielt meine ganze Weisheit einen Stoß und fiel zusammen. Es war mir gleich von Grund aus wohl zumute, wenn sie zugegen war, und ich wusste nicht, was ich hieraus machen sollte. Höchlich verwundert war ich, weder Groll noch Verachtung gegen diese zu empfinden, weder Geringschätzung noch jene Lust, doch verstohlen nach ihr hinzuschielen; vielmehr freute ich mich ganz unbefangen über ihr Dasein und sah sie ohne Unbescheidenheit, aber frei und offen an, wenn ich in ihrer Nähe zu tun hatte. Dies fiel mir um so leichter, als ich in meiner Stellung als armer Soldat kein Wort an sie zu richten brauchte, ohne gefragt zu werden, und also kein anderes Benehmen zu beobachten hatte als dasjenige eines sich aufrecht haltenden ernsthaften Unteroffiziers. Auch war mir das Schweigen, besonders gegenüber den Weibern, so zur anderen Natur geworden durch das langjährige Kopfhängen, dass ich beim besten Willen jetzt nicht hätte eine Ausnahme machen können, auch wenn es sich geschickt hätte. Dennoch fühlte ich ein großes und ungewöhnliches Wohlwollen für diese Person, war in meinem Herzen sehr gut auf sie zu sprechen, und ihr zu Gefallen veränderte ich meine schlechten Ansichten von den Frauen und dachte mir, es müsste doch nicht so übel mit ihnen stehen, wenigstens sollten sie um dieser einen willen von nun an mehr Gnade finden bei mir. Ich war sehr froh, wenn Lydia zugegen war oder wenn ich Veranlassung fand, mich dahin zu verfügen, wo sie eben war; doch tat ich deswegen nicht einen Schritt mehr, als im natürlichen Gange der Dinge lag; nicht einmal blickte oder ging ich, wenn ich mich im gleichen Raume mit ihr befand, ohne einen bestimmten vernünftigen Grund nach ihr hin und fühlte überhaupt eine solche Ruhe in mir wie das kühle Meerwasser, wenn kein Wind sich regt und die Sonne obenhin darauf scheint.
Dies verhielt sich so ungefähr ein halbes Jahr, ein Jahr oder auch etwas darüber, ich weiß es nicht mehr genau; denn die ganze Zeitrechnung von damals ist mir verlorengegangen, der ganze Zeitraum schwebt mir nur noch wie ein schwüler, von Träumen durchzogener Sommertag vor. Während dieses Anfanges nun, dessen längere oder kürzere Dauer ich nicht mehr weiß, ging so alles gut und ruhig vonstatten. Die Dame, obgleich sie mich öfter sehen musste, hatte nicht besonders viel mit mir zu verkehren oder zu sprechen, wenn sie es aber tat, so war sie außerordentlich freundlich und tat es nie ohne mit einem kindlichen harmlosen Lachen ihres schönen Gesichtes, was ich dann dankbarst damit erwiderte, dass ich ein um so ehrbareres Gesicht machte und den Mund nicht verzog, indem ich sagte: ›Sehr wohl, mein Fräulein!‹ oder auch unbefangen widersprach, wenn sie sich irrte, was indes selten geschah. War sie aber nicht zugegen oder ich allein, so dachte ich wohl vielfältig an sie, aber nicht im mindesten wie ein Verliebter, sondern wie ein guter Freund oder Verwandter, welcher aufrichtig um sie bekümmert war, ihr alles Wohlergehen wünschte und allerlei gute Dinge für sie ausdachte. Kaum ging eine leise Veränderung dadurch mit mir vor, wenn ich mich recht entsinne, dass ich gegenüber dem Gouverneur ein wenig mehr auf mich hielt, ein wenig mehr den Soldaten hervorkehrte, der nichts als seine Pflicht kennt, und in meinen übrigen Dienstleistungen mehr den Schein der Unabhängigkeit wahrte, wie ich denn auch in keinerlei Lohnverhältnis zu ihm stand und, nachdem die eigentliche Arbeit auf seinem Bureau getan, wofür ich besoldet war, alles übrige als ein guter Vertrauter mitmachte und nur, da es die Gelegenheit mit sich brachte, etwa mit ihm aß und trank. Und so war ich, wie schon gesagt, vollkommen ruhig und zufrieden, was sich freilich auf meine besondere Weise ausnehmen mochte.