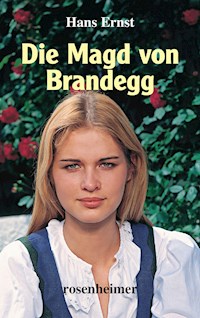
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rosenheimer Verlagshaus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Sohn eines reichen Gutsherrn hat Bernhard von Falk harte Arbeit und Entbehrungen nie kennen gelernt. Nach dem plötzlichen Tod des Vaters übernimmt er den stattlichen Brandegghof und muss feststellen, dass das Anwesen völlig überschuldet ist. Lina Fanderl, die letzte Magd des Brandegghofes, nimmt das Schicksal des Gutes und sein eigenes in ihre Hände und führt ihn Schritt für Schritt hin zu einem Leben, das vor allem Pflicht und Arbeit kennt. Klaglos nimmt sie Demütigungen auf sich und bringt viele Opfer, denn Bernhard ist ihre große Liebe. Bescheiden, aber willensstark geht sie ihren Weg im steten Bemühen, Bernhard zu echten Werten zu führen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
LESEPROBE ZU
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Rosenheimer Verlagshaus erschienenen Originalausgabe 2003
© 2017 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheim
www.rosenheimer.com
Titelbild: Michael Wolf, München
Bearbeitung, Lektorat und Satz: Pro libris Verlagsdienstleistungen, Villingen-Schwenningen
eISBN 978-3-475-54737-9 (epub)
Worum geht es im Buch?
Hans Ernst
Die Magd von Brandegg
Als Sohn eines reichen Gutsherrn hat Bernhard von Falk harte Arbeit und Entbehrungen nie kennen gelernt. Nach dem plötzlichen Tod des Vaters übernimmt er den stattlichen Brandegghof und muss feststellen, dass das Anwesen völlig überschuldet ist. Lina Fanderl, die letzte Magd des Brandegghofes, nimmt das Schicksal des Gutes und sein eigenes in ihre Hände und führt ihn Schritt für Schritt hin zu einem Leben, das vor allem Pflicht und Arbeit kennt. Klaglos nimmt sie Demütigungen auf sich und bringt viele Opfer, denn Bernhard ist ihre große Liebe. Bescheiden, aber willensstark geht sie ihren Weg im steten Bemühen, Bernhard zu echten Werten zu führen.
1
Der Winter lag streng über der Landschaft. Schneebedeckt ragten die Berggipfel in den stahlblauen Himmel, und die tief verschneiten Fichtenwälder schmiegten sich an die Hänge.
Das Dorf Brugg schien von der Schneelast erdrückt zu werden, und nur weil sich aus den Schornsteinen der Rauch so geschäftig in den klaren Winterhimmel schlängelte, konnte man annehmen, dass hinter den kleinen Fenstern der Häuser vielleicht sogar ein fröhliches, zumindest aber ein behagliches Leben in den warmen Stuben herrschte, mit Bratäpfelduft und dem leise knisternden Feuer der Buchenscheite.
Auf alle Fälle überstanden die Menschen in Brugg den Winter auf ihre Weise. Es machte ihnen gar nichts aus, wenn sie einmal acht Tage von der Welt völlig abgeschnitten waren, weil der Postomnibus aus Burghofen nicht durchkam. Die Bauern wurden erst dann nervös und ängstlich, wenn in der »Krone« und dann auch beim »Rösslwirt« das Bier ausging, weil auch das Bierauto sein Ziel nicht mehr erreichte. Wohl oder übel mussten sie dann mit Schaufeln ausrücken, den Rest besorgte der Schneepflug.
Ähnlich erging es den Leuten auf dem Gut Brandegg, das etwa achthundert Meter über dem Dorf lag. Da oben gab es noch viel mehr Schnee. Dort waren sie über Weihnachten noch eingeschneit, bis man den tiefen Hohlweg ausgeschaufelt hatte.Erst am Neujahrstag konnten die Leute zur Kirche herunterkommen, und am Heiligdreikönigstag ritt der Herr von Falk auf seinem Falben ins Dorf hinunter, um in der »Krone« mit Pfarrer Hiebler und dem Organisten Schöller einen Skat zu klopfen.
»Fast vierzehn Tage waren wir da oben wie begraben«, erzählte er, »und wenn uns wirklich die Schneemassen erdrückt hätten, wären wir samt und sonders ohne geistlichen Zuspruch gestorben.«
Der Pfarrer hob sein schmales Asketengesicht. »Sie leben aber, mein lieber Herr von Falk.«
»Jawohl! Und ich gedenke sogar noch recht lange zu leben. Auf meine Weise.«
»Auf eine glückliche Weise, Herr von Falk?«
Bruno von Falk richtete seine hellen, scharfen Augen auf sein Gegenüber. »Ja, Herr Pfarrer, auf eine glückliche Weise, seien Sie ganz unbesorgt. Ich weiß Ihre Frage zu deuten, und ich weiß auch, dass manche Leute die Nase rümpfen über die Weise, wie der Alte von Brandegg lebt. Als ob das jemanden etwas anginge! Das muss ich mit mir allein ausmachen. Und dazu habe ich noch Zeit, Herr Pfarrer. Viel Zeit sogar noch. Ich bin erst sechzig, und ich fühle mich noch sehr rüstig. Mit achtzig vielleicht oder mit neunzig kann es sein, dass der Falk besinnlicher wird oder braver, wie man so sagt.«
»Ich wünsche Ihnen von Herzen ein so hohes Alter. Bei guter Gesundheit natürlich.«
»Das sowieso«, nickte der Brandegger eifrig. »Bis jetzt fehlt mir noch gar nichts. Bei mir funktioniert das Herz noch verlässlich, der Magen hat noch nie rebelliert, und die Nieren arbeiten wie zwei Maschinenkolben in einer guten Ölwanne. Ich kann meine drei Flaschen Wein trinken und bleibe dabei stocknüchtern. Und ich singe, Herr Pfarrer, weil mich das Leben freut. Ich bin ein lebenslustiger Witwer. Und darüber zerreißen sich gewisse Leute das Maul, als ob es jemanden etwas anginge, was ich treibe.«
»Vielleicht hätten Sie doch noch einmal heiraten sollen«, meinte der Organist.
Bruno von Falk mischte ein neues Spiel, legte aber die Karten weg, als das Essen gebracht wurde. Für ihn eine Schweinshaxe mit Kraut, so groß, dass drei davon satt geworden wären, für den Herrn Pfarrer eine gebackene Leber und für den Organisten zwei Paar Wiener.
Wäre der Pfarrer nicht mit beim Tisch gesessen, der Brandegger hätte die Frage des Organisten wahrscheinlich anders beantwortet. So aber sagte er nur, und das war durchaus ehrlich gemeint: »Warum sollte ich nochmals heiraten? Eine zweite Amalie von Falk gibt es nicht. Und dann – ich habe ja einen erwachsenen Sohn. Meinen Sie, dass der recht begeistert wäre, wenn ich ihm mit seinen dreißig Jahren noch eine Stiefmutter vor die Nase setzte?«
»Sonst pflegen Sie allerdings auf Ihren Sohn weniger Rücksicht zu nehmen«, sagte der Pfarrer.
»Was heißt hier Rücksicht nehmen? Er lebt sein Leben in der Stadt und ich das meine heraußen. Soll ich vielleicht schon mit sechzig in den Austrag gehen?«
»Niemand weiß, wie viel noch vor ihm liegt. Gar mancher meint sich noch im Lebensmai und steht plötzlich vor dem Tor zur Ewigkeit«, sagte der Pfarrer.
Der Brandegger nickte eifrig und wie im Spott. »Ja, ja, das sind die Fälle, in denen es dann heißt: Nach Gottes unerforschlichem Ratschluss ...«
»Oder: Gott dem Herrn hat es gefallen ...«, ergänzte der Organist. Aber bei ihm war es kein Spott. Er war tief gläubig und hasste den Brandegger in solchen Augenblicken, wenn er so frivol von den Dingen sprach, die zwischen Himmel und Erde geschahen, jedem unbegreiflich und doch unerbittlich, rätselhaftes Geschehen, zu dem nur Gott allein den Schlüssel besaß.
Dann spielten sie wieder. Für den Brandegger war es ein Spiel ohne jeden Reiz. Hier gab es keine großen Einsätze, man konnte nichts gewinnen. Sie spielten einen »Bettlerskat«, wie der Brandegger es nannte, der in seinem Leben immer ein verwegener Spieler gewesen war.
Immerhin half ihm das auch über die Stunden der Langeweile hinweg, und dass er sich überhaupt herbeiließ, mit dem Organisten zu spielen, gab dem Herrn von Falk einen gewissen Nimbus von Leutseligkeit und ließ vergessen, dass sein Großvater noch sechsspännig durch die Landschaft gefahren war und mit der Peitsche aus reinem Standesdünkel auf die Leute eingeschlagen hatte, die am Wegrand standen. Jawohl, seine Ahnen hatten sich noch recht toll und in herrischem Hochmut gebärdet.
Dagegen war Bruno von Falk ein wahres Unschuldslamm.
Die Falks stammten eigentlich aus Holland, waren ein altes flämisches Kaufmannsgeschlecht und hießen ursprünglich van Falgen. Einer von ihnen hatte sich vor gut zweihundert Jahren oben auf dem Berg ansässig gemacht, und weil den einfachen Menschen dieses Gebirgstales der Name »van Falgen« etwas fremd in den Ohren klang, machten sie einfach einen »Herrn von Falk« daraus.
Bauern waren sie nie gewesen, immer Herren. Bruno von Falk war jetzt der Fünfte in seiner Geschlechterreihe, und Bernhard, sein Sohn, würde einmal der sechste Herr von Falk auf Brandegg sein.
Wenn Gott es wollte.
Gegen zehn Uhr begann der Pfarrer ein paar Mal zu gähnen, was so viel hieß wie: zwei Spiele noch, dann ist für heute Schluss.
Nein, hier konnte man keine Nächte durchmachen, nicht weitertrinken bis über Mitternacht hinaus. Die Bauern mussten früh aufstehen, und was über die Zeit sitzen blieb, das war kein geeigneter Umgang für den Brandegger, der immerhin der »Herr« war in dieser Gegend und sich zu solch Gesindel dann doch nicht herabbegeben durfte.
Es schlug halb elf Uhr, als er langsam auf seinem Falben den Berg hinaufritt. Es schneite wieder ein bisschen, ganz dünn und aus einem hohen Himmel, auf dem man zuweilen ganz matt einen Stern blinzeln sah.
Ja, dieser Winter hatte es in sich und dehnte sich mit aller Strenge noch über den ganzen Januar hin. Die Menschen duckten sich unter ihm, aber sie gingen trotzdem ihrer Arbeit nach. Die Gutsleute von Brandegg zum Beispiel waren schon beim Morgenrot im Bergwald und schlugen Bäume, wie sie es die ganzen Jahre getan hatten. Und mancher fragte sich, ob denn die Bäume des Herrn von Falk nie weniger würden. Manche wussten, dass sie weniger wurden, und schlugen bedrückten Herzens die Axt in den Stamm, weil sie das Verhängnis kommen sahen, dass der Herr einmal dastehen würde ganz ohne Baum. O ja, man konnte den Wald schon wieder aufforsten,aber bis er wieder groß genug war, um Nutzen abzuwerfen, das würde hundert Jahre dauern.
Aber das alles musste ja der Herr von Falk besser wissen. Sie waren nur seine Knechte und hatten in den Wald zu gehen, wenn er es anordnete. Der Atem gefror ihnen vor dem Mund, und um die Mittagszeit machten sie ein Feuer, dessen blauer Rauch ganz sanft über die Kronen stieg.
Bruno von Falk hätte es wissen und sich Gedanken darüber machen müssen. Aber es war nicht seine Art, über Dinge nachzudenken, die ihm Sorgen bereiten konnten. Und wenn er um diese Zeit unruhig wurde, so hing dies nur damit zusammen, dass der Winter ihn so lange auf Brandegg festhielt. Er wurde launisch und brauste bei jeder Gelegenheit auf. Die Unruhe machte sein Blut rebellisch. Und eines Tages rief er seinen Kutscher Martin Fanderl zu sich und erklärte ihm, dass sie am Nachmittag nach Burghofen fahren würden.
Martin Fanderl war schon vierzig Jahre auf dem Gut und wusste noch um die Zeiten, da er den Vater des jetzigen Herrn vierspännig nach Burghofen gefahren hatte. Er war ein kleiner, zaundürrer Mann, dem die graue Bartbürste so traurig in die Mundwinkel hing, als sei sein ganzes Dasein nur mehr ewige Verdrossenheit, seit ihm vor fünf Jahren die Frau gestorben war. In Wirklichkeit aber hatte er ein sonniges Gemüt, hing mit aller Liebe an seiner Tochter Karolina, Lina genannt, und war verschwiegen wie ein Grab. Gerade diese Eigenschaften schätzte Bruno von Falk an ihm am meisten.
Es gab so manches, was verschwiegen sein wollte. Keine dunklen Geschäfte etwa, nein, aber die Stunden, nach denen der Brandegger zuweilen gierig griffund in denen der rüstige Sechziger drängender und begehrlicher war als so mancher Jüngling.
Der Fanderl genoss so etwas wie eine Vertrauensstelle auf dem Gut, er war nicht nur Kutscher, sondern auch Gärtner und Hausmeister des Herrenhauses, in dem er gerade jetzt im Winter viel Arbeit hatte, weil er neben dem offenen Feuer in der Diele noch sechzehn Öfen zu schüren hatte, damit das Wasser nirgends einfrieren konnte. Er bewohnte mit Lina das kleine Gartenhäuschen am Ende des Ulmenparkes und hatte gerade seinen Mittagsschlaf gehalten, als der Brandegger ihn rufen ließ.
Er zog danach gleich die Schlittenkutsche aus der Remise, ließ sich von der Haushälterin Barbara ein paar wollene Decken geben und sah nach, ob die Kerzenstummel in den Laternen noch ausreichen würden, falls man in die Nacht hineinkäme. Daran zweifelte er übrigens nicht, denn wie er seinen Herrn kannte, hatte den wieder einmal der unruhige Geist gepackt, und da war man noch nie vor Mitternacht heimgekommen. Anschließend ging er in den Stall und gab dem Rossbuben den Auftrag, die beiden Goldfüchse anzuspannen.
Dann ging er zurück in das Gärtnerhäusl, wo Lina in der Küche noch mit dem Abspülen des Geschirrs beschäftigt war.
Lina Fanderl war gerade zwanzig Jahre alt geworden. Sie hatte ein hartes, verschlossenes Gesicht und war keinesfalls der Typ, der Männern auf den ersten Blick hin schon gefallen konnte. Der Mund war üppig und voll, die Backenknochen traten deutlich hervor, die Brauen waren dicht und wuchsen über der Nasenwurzel fast zusammen. Das Schönste an ihr waren die Augen, große dunkelbraune Augen mitlangen Wimpern. Seit die Mutter tot war, führte sie dem Vater den Haushalt, der aber so klein war, dass sie halbtags auch noch auf dem Gut mithelfen konnte. Ihr Wesen war von ruhigem Gleichmaß, die Arbeit ging ihr flink von der Hand, sie packte alles freudig an und empfand keine Arbeit als Last.
Als der Vater eintrat, hob sie den Kopf mit den dunklen Zöpfen, die sie über der Stirn zu einer Krone geschlungen hatte. »Was hat er denn gewollt?«, fragte sie.
»Richt mir meine Filzstiefel her, Linerl. Der Herr will wieder einmal nach Burghofen.«
»Bei dem Schnee?«
»Das macht nichts. Der Weg ist frei, und die Pferde müssen sowieso endlich wieder einmal aus dem Stall.«
Lina nahm die Holzleisten aus den Stiefeln und fuhr mit einer Bürste über die Schäfte. »Wird es spät werden, Vater?«
Martin Fanderl schlüpfte in die Stiefel und zog sich den schweren Mantel an, der innen mit Schafpelz gefüttert war. »Das kann man bei ihm nie sagen.« Er zog eine der Kommodenschubladen auf, nahm aus einer Zigarrenschachtel fünf Zwanzigmarkscheine und steckte sie in die Brieftasche. »Du brauchst auf keinen Fall aufzubleiben, wenn wir bis neun Uhr nicht zurück sind.«
Lina reichte ihm die hohe schwarze Pelzmütze. »Ich stelle dir den Kaffee ins Ofenrohr, Vater.«
»Ja, vergiss es nicht. Er wird mir gut tun, wenn ich ausgefroren heimkomme.« Er griff nach seinen Fäustlingen, die mit einer langen Schnur zusammengebunden waren – und hängte sie um den Hals. So konnte er wenigstens keinen davon verlieren. »Schürnoch einmal gut nach, bevor du ins Bett gehst, Lina. Und – b’hüt dich Gott.«
»B’hüt dich Gott, Vater. Hast du alles? Tabak und Pfeife?«
»Ich hab alles, ja.« Er griff in die Taschen und merkte, dass er doch nicht alles hatte. Zündhölzer fehlten ihm noch. Er nahm sie vom Ofensims und ging.
Lina sah ihm vom Fenster aus nach und dachte: ›Er wird eigentlich schon recht alt, der Vater, in letzter Zeit.‹ Die Schultern neigten sich schon stark nach vorne, sein Schritt war nicht mehr ausgreifend, sondern klein und trippelnd.
Auf einmal blieb er stehen, als besinne er sich auf etwas. Hatte er noch etwas vergessen?
Er kam zurück, ging wortlos auf seine Tochter zu und nahm sie, was er ganz selten tat, in seine Arme.
Lina schmiegte sich an ihn, sie fühlte seine Bartstoppeln auf der Wange und war glücklich über seine etwas unbeholfene Zärtlichkeit.
»Mein liebes Kindl«, sagte er, »was soll ich dir denn mitbringen?«
Das Mädchen schaute ihn erstaunt an. In seinen Augen war ein ganz merkwürdiges Glänzen. Der Vater war in letzter Zeit überhaupt manchmal wunderlich.
»Du brauchst mir nichts mitzubringen, Vater!«
»Doch, doch. Du hast kürzlich gesagt, dass du das Kettchen von deinem Anhänger verloren hast.«
»Ja, aber kein allzu teures.«
Seine Hände umschlossen ihr Gesicht. Ganz nahe zog er es an das seine heran, schaute ihr lange in die Augen und zärtelte mit seinen Lippen über ihre Stirn hin.
»O mein Kindl«, lächelte er in einer leisen Glückseligkeit, »du weißt gar nicht, wie gern ich dich habe.«
»Doch, Vater, ich weiß es schon. Darum hänge ich doch auch so an dir und tue alles, um es dir auf deine alten Tage recht schön zu machen.«
»Ja, das weiß ich. Und – ich danke dir auch sehr für alles. Du bist immer ein recht folgsames und braves Dirndl gewesen.« Er ließ sie los und richtete seine Pelzmütze, die etwas verrutscht war. »Und gelt, Linerl – wenn ich länger ausbleibe, lass mir den Jäger nicht herein, wenn du allein bist.«
»Du brauchst keine Angst zu haben, Vater. Übrigens, er weiß doch gar nicht, dass ich allein bin.«
»Sag das nicht. Der hat seine scharfen Bussardaugen überall. Deine Mutter, Gott hab sie selig, hat schon immer gesagt, dass er falsche Augen hat.«
»Du musst dir keine unnötigen Sorgen machen, Vater. Dem Schartner-Sepp habe ich noch nie Hoffnungen gemacht. Er sagt zwar, dass er mich gern hat, aber wenn er es sagt, bleibt alles ganz kalt in mir.«
»Dann ist’s schon recht, Kindl. Und jetzt muss ich gehen, sonst wird er ungeduldig, der Herr.«
Er umfasste sie nochmals mit seinem schweren, gütigen Blick, so als habe er sich für lange Zeit von ihr zu trennen. Dann ging er.
Die Goldfüchse, nach der langen Stallhaft recht übermütig, scharrten bereits ungeduldig mit den Hufen, und kaum saß der Fanderl auf dem Bock, schossen sie in scharfem Trab die ausgeschaufelte Wegschleife zum Herrenhaus hinüber, wo Bruno von Falk schon auf der breiten Freitreppe wartete. In hohen Schaftstiefeln, einer kurzen, pelzgefütterten Joppe mit weißem Lammkragen, die schwarze Persianermützeein wenig schief auf dem grauen Schädel und ein längliches, in braunes Packpapier verschnürtes Paket unterm Arm, so stand er breitbeinig da, mit einem missmutigen Ausdruck im Gesicht. »Glaubst du denn, dass ich mir beim langen Warten die Füß erfrieren will? Geschlagene zehn Minuten stehe ich jetzt da – aber der Herr Fanderl, der lässt sich natürlich Zeit.«
Martin Fanderl gab keine Antwort, er schlug seinem Herrn die Decken um die Knie, bestieg den Bock wieder, und mit hellem Schellengeläut schossen die Goldfüchse auf die Straße hinaus.
Die Fahrt ging am Pfarrdorf Brugg vorbei und führte eine ganze Weile durch tief verschneite Wälder. Der Himmel war nicht mehr so klar wie an den vergangenen Tagen. Dünne Schleierwolken zogen unter der Sonne hin, und manchmal ging ein Windstoß über die verschneiten Wipfel.
Weit zurückgelehnt saß Bruno von Falk im Schlitten und ließ sich den Fahrtwind ums Gesicht blasen. Manchmal schloss er dabei die Augen, und es mochte sein, dass er an die vergangenen Zeiten dachte, als er noch ein kleiner Bub war und mit seinem Vater nach Burghofen fahren durfte. Vierspännig und mit noch lauterem Schellengeläute, das man auf drei Kilometer hin hören konnte. Auch damals saß schon der Fanderl auf dem Bock, ganz jung noch, schulterschmal und kerzengerade. Heute war sein Rücken gekrümmt. Er sah wie ein Berg aus, auf dem die Last von Jahren lag.
Aber heute wie damals empfand Bruno von Falk das Berauschende so einer Fahrt durch den verschneiten Winterwald.
Er empfand ein angenehmes Prickeln, weil er aus der verschneiten Einsamkeit seines Gutes endlichwieder einmal zu einem Ausflug ins Leben aufgebrochen war.
Nach etwa einer halben Stunde lichtete sich der Wald, und eine weite silberne Fläche breitete sich vor ihnen aus. Das war der zugefrorene Gildensee. Am andern Ufer lag im hellen Sonnenschein das Städtchen Burghofen mit den beiden Münstertürmen und der alles überragenden Burg auf dem Hügel. In dieser Burg waren das Landratsamt, die Forstbehörde und das Finanzamt untergebracht. Im südlichen Teil, wo sich der schlanke Turm einer Kirche erhob, lag ein Benediktinerkloster.
Um den See herum wären es noch genau sechs Kilometer gewesen. Aber sie sahen die verlockende Schlittenspur, die über den See ging, und Martin Fanderl lenkte die Goldfüchse ebenfalls ohne Bedenken auf das Eis.
Wie hell die Hufe hier klangen! Manchmal schrie eine der Schlittenkufen misstönend auf, aber dann glitt das Gefährt wieder lautlos auf der Spiegelfläche dahin.
In den Gassen von Burghofen lag kaum noch Schnee, und die Kufen jaulten erbärmlich, ehe das Gespann in den Hof der Schlossbrauerei einfuhr, wo man seit alters her einzustellen pflegte.
Bruno von Falk sprang vom Schlitten und streckte sich. Dann griff er nach der Pappschachtel. Von der Uhrzeit, zu der man wieder heimfahren wollte, wurde nicht gesprochen. Vor dem Abend kam es sowieso nicht in Frage, und dann würde Bruno von Falk seinen Kutscher wie immer im Bierstüberl des Burgbräus treffen.
»Also, vertreib dir die Zeit gut«, sagte der Herr von Falk und stelzte davon. Seine Stiefel knarrten aufdem Pflaster des Bräuhofes, als ob sie noch nicht bezahlt wären. Bevor er durch das Tor ging, schlug er den weißen Lammfellkragen nieder, sah einmal kurz nach links und rechts und überquerte die Straße.
Martin Fanderl brachte nun die beiden Goldfüchse in den Stall, wobei ihm der Hausknecht des Bräuhofes behilflich war.
Die beiden kannten sich auch schon bald dreißig Jahre. Felix war ein grau gewordener Hausknecht, zu dessen Wohnung, die über dem Rossstall lag, eine Treppe von außen hinaufführte.
Als sie gemeinsam die Pferde ausgeschirrt hatten, saßen sie eine Weile nebeneinander auf der Haferkiste. Der Felix zog seine Schnupftabaksdose heraus, klopfte sich eine Prise auf den Handrücken und reichte sie dann dem Martin hinüber. Dabei lachte er pfiffig.
»Jetzt können wir ja schnupfen, solange wir Lust haben, weil wir keine Frauen mehr haben, die darüber schimpfen.«
»Mir wär’s lieber, sie wäre noch da, meine Marianne, und täte manchmal schimpfen«, antwortete Martin Fanderl mit einem Anflug von Wehmut.
»Ja, da hast du auch wieder Recht. Ohne Frau bist du ein Depp. Du hast es ja noch besser als ich, weil du deine Tochter hast. Aber ich bin ganz allein.« Er schob die Ladung Schmalzler in die Nasenlöcher und philosophierte weiter. »›Felixl‹, hat sie oft gesagt, die Meinige, ›du wärst ein manierliches Mannsbild, wenn du bloß nicht schnupfen tätest. Du verschnupfst noch deinen ganzen Verstand, und mittendrin trifft dich der Hirnschlag.‹ Und was war? Der Hirnschlag hat vor zwei Jahren sie getroffen, und ich lebe immer noch auf der buckligen Welt!«
Der Fanderl seufzte, aber der Felix redete schon weiter. »Keine hat die Salzburger Nockerln so gut backen können wie sie.«
»Und die Meinige erst!«, schwärmte der Fanderl. »Einen Rostbraten hat die mir hingestellt, den hast du mit der Zunge zerdrücken können! Ja, ja! Meine Marianne! So eine wie sie gibt es nimmer.«
»Sag das nicht. Es gibt doch so viele ledige Frauen, dass ich manchmal sogar daran denke, ob ich nicht noch einmal heirate.«
»Das fehlte dir noch bei deinem Alter!«
»Na ja, manchmal fühle ich mich noch so jung, dass ich meine, ich müsste Bäume ausreißen.«
»Ja, und am andern Tag plagt dich wieder das Zipperlein«, lachte der Fanderl. »Wenn man einmal auf den Siebziger hinrutscht, schaut man das Leben mit anderen Augen an.«
»Olala! Bis zum Siebziger haben wir zwei schon noch ein paar Jährl hin. Und so wie wir beieinander sind, können wir leicht neunzig werden.«
»Ich weiß nicht, ich weiß nicht«, orakelte der Fanderl. »Manchmal habe ich so Ahnungen, als wenn es bei mir nimmer allzu lange dauern könnte.«
Der Felix schaute ihn betroffen an. »Geh, hör auf mit deinen Ahnungen! Wenn ich das schon hör’! Wir sind zwei alte, übrig gebliebene Kutscher und müssen schon noch dableiben, weil man uns braucht.«
Der Fanderl schüttelte langsam seinen grauen Schädel. »Es geht auch ohne uns zwei! Bloß so lange möcht ich noch leben, bis ich meine Lina in guten Händen weiß, bei einem braven, fleißigen Mann. Dann kann ich beruhigt meine Augen zumachen.«
»Das kannst du noch leicht erwarten. Ich hab sie zwar schon eine Ewigkeit nimmer gesehen, deine Lina, aber sie muss doch schon das Alter zum Heiraten haben.«
»Zwanzig wird sie im Mai.«
»Schau an, wie die Zeit vergeht! Ich meine, es war erst gestern, als ich ihr beim Kramer drüben ein Zuckerl gekauft habe. Damals war sie fünf Jahre alt. Was ist, alter Spezl, gehst ein bissl mit hinauf in meine Wohnung? Ich habe warm eingeheizt.«
Der Fanderl rutschte von der Haferkiste. »Nein, ich habe noch ein paar Wege zu machen.«
»Gehst du auch zur Wally?«
»Kann sein, auf ein paar Stamperln.«
»Aber am Abend treffen wir uns dann auf alle Fälle im Bierstüberl, oder?«
»Ja, das auf alle Fälle. Es sei denn, dass mein Herr heute früher als sonst heimfahren will.«
»Das glaubst ja selber nicht«, Felix lachte und riet seinem Freund, den dicken Pelzmantel dazulassen, weil ja draußen die Sonne doch recht warm scheine.
Das tat Martin Fanderl auch. Die Fäustlinge hängte er ebenfalls über die leere Box. Dann brach er auf. »Sollte ich bis sechs Uhr noch nicht da sein, dann schütt ihnen vor«, sprach er noch über die Achsel zurück und streifte dabei die zwei Goldfüchse mit einem zärtlichen Blick. Einer davon wieherte hellauf, und der andere schlug übermütig mit der Hinterhand gegen die Planke.
Auf dem Stadtplatz lag mild die Nachmittagssonne. Aus den Dachrinnen träufelte das Schneewasser, und in der Seifensiederei Harzeder hingen im oberen Stockwerk schon ein paar Überbetten zum Fenster heraus, obwohl dies nach altem Brauch noch viel zu früh war, weil man kein Bettzeug ins Freie bringen soll, wenn die Monate ein »r« in ihrem Namen haben.
Burghofen war eigentlich ein Kurort, in dem Moorbäder verabreicht wurden. Um diese Zeit waren aber noch keine Gäste da. Das Kurhaus war geschlossen, die Wege des Kurparks waren verschneit und wenig begangen. Die Bretter der Bänke waren abgeschraubt, und nur die kahlen, grauen Betonsockel standen unter den schneeglitzernden Bäumen. Auf dem Teich aber – Martin Fanderl traute seinen Augen kaum –, auf dem Teich war bereits eine Rinne eisfrei, und in dem schwarzen Wasser zogen majestätisch drei Schwäne dahin.
Schnuppernd hob Martin Fanderl die Nase in die Luft. Fächelte der Wind nicht wärmer über den laublosen Kronen der Buchen? Brach die Kälte nun endlich? Tatsächlich, der Wind wehte von Süden her, ein feuchter, warmer Wind unter einer sanft verschleierten Sonne.
›Es ist nicht mehr zu früh‹, sagte sich Martin Fanderl und dachte dabei an den klein gewordenen Holzhaufen unter den Fenstern des Häusels daheim. So viel Holz wie heuer hatten sie nur selten gebraucht. Zwei Klafter standen ihm zu als Lohn. Zwei Ster davon hatte er immer verkaufen können. In diesem Winter aber hatten sie fast alles selber aufgebraucht.
Vom Kurpark kam er auf den Hauptplatz, stand eine lange Weile vor einer Litfasssäule und las mit Staunen, was in so einem Städtchen alles los war zur Faschingszeit. Schützenball im Kurhaussaal und tags darauf schon wieder ein Sportlerball im Burgkeller. Das liebe Leben schwamm in Fröhlichkeit, und seine arme Lina saß daheim wie in der Verbannung. Und während er langsam weitertrippelte, überlegte er, ob er es nicht bewerkstelligen könne, einmal mit Lina zu so einem Ball zu fahren. Der Herr würde bestimmtnichts dagegen haben, wenn er einen von den Goldfüchsen bei Dunkelwerden aus dem Stall nahm, vor den kleinen Pendelschlitten spannte und mit Lina zu einer Faschingsgaudi fuhr.
Umständlich zog er seine Brille mit dem Nickelrand aus dem Futteral und las genau, wann der Sportlerball im Burgkeller stattfinden solle. Am Samstag, dem fünfzehnten Februar. Heute war Montag. Wenn er heute den Stoff für ein Ballkleid kaufte, konnte es die Enzinger-Nanndl bis zum Samstag noch zusammenschneidern.
Wenig später stand er bereits im Kaufhaus Anton und verlangte Stoff für ein Ballkleid. Das Mädchen, das ihn bediente, maß die Leute nach dem Äußeren, und diesem kleinen, grauhaarigen Mann, der in seinem derben Lodenzeug mit den Filzstiefeln wie ein Schafhirte oder ein Torfstecher aussah, konnte man ruhig ein billiges »Fähnchen« hinlegen.
Martin Fanderl verstand etwas von Loden oder von wollenen Pferdedecken, aber nichts von Stoffen für ein Ballkleid. Seine rauen Finger griffen in das leichte Gewebe.
»Ist das nicht ein bissl dünn?«, fragte er.
Das Mädchen sah ihren »Schafhirten« unter langen Wimpern heraus belustigt an.
»Dünn?«, fragte sie. »Das ist Geschmackssache. Wir haben auch anderes. Aber vielleicht nehmen Sie gleich ein fertiges Kleid? Man müsste nur die Größe und das Alter der Dame wissen.«
Der alte Kutscher strich seinen Bart aus den Mundwinkeln. »Meine Tochter ist keine Dame.«
»Ach so, für Ihre Tochter gehört es. Wie groß ist sie denn?«
»Ungefähr wie du.«
Das Mädchen zog einen Schmollmund, weil sie wieder einmal geduzt wurde. Aber ländliche Kunden taten das öfter, und sie machte nun gute Miene zum bösen Spiel, weil der Chef des Hauses, Julius Anton, herankam. Er kannte den Fanderl seit vielen Jahren und streckte ihm wie einem guten Freund die Hand entgegen.
»Ja, wen seh ich denn da? Der Fanderl ist wieder einmal in der Stadt! Was soll es denn sein?«
Bevor Martin antworten konnte, sprudelte bereits das Mädchen heraus, was der Kunde wünsche.
»Na, da kann man schon helfen. Berta, probieren Sie doch ein paar Sachen an.«
Er zwinkerte mit dem linken Auge, und Fräulein Berta verstand ihn sofort. Irgendein alter Ladenhüter konnte hier an den Mann gebracht werden. Sie führte ein paar Kleider vor. Das dritte, mit Blumen gemustert, gefiel dem Fanderl. Besonders der Preis gefiel ihm. Nur fünfundzwanzig Mark. Aber die rothaarige Verkäuferin schwatzte ihm auch noch einen Büstenhalter auf, der allein schon fünf Mark kostete. Weil aber der Herr Anton sagte, dass man das Ding unbedingt zu dem Kleid brauche, fügte er sich drein.
»Dann pack halt alles ein.«
Weil er wirklich schon ein alter Kunde war im Hause Anton, wurden ihm noch ein Paar dünne Strümpfe geschenkt. Die junge Frau packte ihm alles in einen Karton mit einem kleinen, hölzernen Griff an der Packschnur, so dass er ihn bequem tragen konnte. Es wurde ihm sogar die Tür geöffnet, und Herr Anton begleitete ihn bis dorthin.
»Beehr mich nur wieder, Fanderl. Bist du allein in der Stadt heute?«
»Nein, der Herr ist dabei.«
»Das habe ich mir schon gedacht. Also dann, recht viel Vergnügen am Samstag. Kann sein, dass ich auch hinkomme.«
Von da aus ging der Martin in das Goldwarengeschäft Reindl am unteren Markt und erstand um fünf Mark ein schmales Silberkettchen. Man kannte den Fanderl-Martin eigentlich überall, auch hier war er schon öfter gewesen, nicht um für sich große Einkäufe zu machen. Aber zur Zeit, als die gnädige Frau noch lebte, gab es hin und wieder ein Schmuckstück zu reparieren oder eine der vielen Uhren, die auf Brandegg die Stunden schlugen.
Auf alle Fälle begrüßte Frau Philomena Reindl ihn mit der Herzlichkeit einsam gewordener Frauen, die sich immer freuen, wenn sie einen Bekannten aus längst vergangenen Tagen sehen. Vielleicht erinnerte er sich noch, dass sie vor dreißig Jahren noch kein Silber in ihrem Haar hatte und schön gewesen war.
Ihren Mann hatte Frau Philomena längst verloren, aber ihn nicht vergessen. An ihrer hoch geschlossenen Bluse trug sie eine goldgefasste, ziemlich große Brosche mit einem Bild, das Herrn Reindl in seinen besten Jahren zeigte, mit einem aufgezwirbelten Schnurrbart und in der Mitte gescheiteltem Haar.
Damit Frau Reindl auf keine falschen Gedanken käme, sagte Fanderl, dass er das Kettchen für seine Tochter Lina kaufe, mit der er am Samstag auf den Ball gehen möchte.
»Ach ja«, lächelte Frau Philomena, »das Fräulein Tochter! Sie muss ja schon mächtig groß geworden sein?«
»Ja, groß und schön.«
»Kein Wunder, bei so einem Vater. – Übrigens war auch der Herr von Falk nach langer Zeit heutewieder einmal hier.« Sie beugte sich vertraulich über die Theke. »Er sitzt wohl wieder einmal arg in der Klemme, der gute Herr von Falk?«
Der Fanderl bekam sofort einen abweisenden Gesichtsausdruck. »Wie soll denn ich das wissen?«
»Ach, tun Sie doch nicht so, Fanderl. Sie sind doch sein Faktotum, und man sagt, dass Sie sein uneingeschränktes Vertrauen haben.«
»Das wäre ein Grund mehr, nichts zu wissen«, antwortete der Fanderl. Er wurde erst dann interessierter an dem Gespräch, als Frau Philomena ein riesengroßes, mit feinstem Leder überzogenes Etui aus der Vitrine nahm und den Deckel öffnete. Da erst weiteten sich seine Augen, und dann wurden sie sehr traurig.
»Aber das ist doch – unser silbernes Tafelbesteck!«
»Ja, das ist es. Und gerade das hat er mir heute zum Kauf angeboten für zweitausend Mark. Wissen Sie, Fanderl, mir tut so etwas immer Leid bis in die Seele hinein. Das ist eine der herrlichsten Silberschmiedearbeiten, die ich jemals gesehen habe. Sehen Sie sich bloß diese Ziselierung an! Dem Monogramm nach muss es zur Aussteuer der gnädigen Frau von Falk gehört haben. Gott habe sie selig. Ich habe ihm angesehen, dass er sich schweren Herzens von dem Besteck trennte. Viel schwerer als sonst von einem Schmuckstück, das er mir hin und wieder einmal verkauft hat. Aber das Finanzamt, sagte er, setzte ihm wieder einmal das Messer an die Brust.«
Der Fanderl schwieg, und sein Blick wurde immer trauriger. Nach einer Weile sagte er: »Nur gut, dass es die gnädige Frau nicht mehr erleben braucht.«
Frau Philomena nickte tiefsinnig.
»Sie würde sich im Grabe umdrehen, wenn sie es wüsste.« Ein tiefer Seufzer. »Man kann wohl sagen, dass sie sein guter Geist war. Nach ihrem Tod hatte er keinen richtigen Halt mehr, begann zu saufen und zu spielen und lebte sein wildes Leben. Ich kann mir bloß nicht denken, für wen er das teure Armband gekauft hat. Ein goldenes Armband für zweihundert Mark. Sie wissen es nicht zufällig?«
»Nein, ich weiß gar nichts. Was kostet mein Kettchen?«
»Vier achtzig.« Frau Philomena wickelte es in Seidenpapier und gab dem Fanderl auf zwanzig Mark heraus. »Ja, ja«, kam sie nochmals auf ihre vorherige Feststellung zurück, »ohne seine Frau verlor er den Halt. Das ist vielleicht verständlich, aber es wäre schlimm bestellt auf der Welt, wenn dies zur Regel würde. Sehen Sie, mein lieber Fanderl – als mein Seliger mich allein gelassen hatte, da habe ich mir gesagt: ›Philomena‹, habe ich mir gesagt, ›nur stark bleiben in allen Anfechtungen des Lebens.‹ Ich hätte oftmals wieder heiraten können. ›Aber nein‹, habe ich mir gesagt, ›was du einmal mit deinem Herzen umschlossen hast, dem soll ewige Treue bewahrt werden.‹«
Der »Selige« schien das zu würdigen. Seine Augen blickten verständnisvoll aus der goldverzierten Brosche, auf der die Spitzen seines Bartes so unternehmungslustig in die Höhe standen.
»Ja, dann auf Wiedersehn«, sagte der Fanderl und ging. Das Glockenspiel über der Eingangstür läutete wieder so harmonisch, dass man meinte, es müsse sich im nächsten Augenblick ein grünendes Almfeld mit Enzian und Almrosen vor dem Auge auftun.
Vor Martin Fanderl lag nun der untere Marktplatz, auf dem noch am Vormittag die Bauern aus dernächsten Umgebung ihre Erzeugnisse feilgeboten hatten. Im Rinnstein lag noch ein vergessener Weißkrautkopf, und dort, wo der Würstelstand gewesen war, saß ein rot-weiß-gefleckter Kater und blinzelte in die etwas wässrige Sonne, die schräg über dem Kirchtürmchen der Benediktinerabtei stand.
Langsam trottete der Martin über das bucklige Kopfsteinpflaster hinauf in den oberen Stadtteil mit den vielen schönen Häusern. Manchmal blieb er stehen und schüttelte den Kopf. »Das schöne Silberzeug! Nein, nein, ein Kreuz und ein Elend ist es ...«
In letzter Zeit ging beim Herrn von Falk aber auch alles schief. Er hatte in nichts mehr eine glückliche Hand. Und trotzdem ließ er sich nie etwas anmerken. Kein Sturm konnte ihn niederbeugen. Er blieb in allen Lagen der Herr von Brandegg, der den Kopf so unnachahmlich zu tragen wusste und höchstens einmal mit dem Zeigefinger unter den Hemdkragen griff und am Hals entlangfuhr, wenn ihn etwas stark erregte.
Aber war es nicht immer so gewesen, wenn »Matthäi am Letzten« zu sein schien? Plötzlich hatte der Brandegger dann wieder Geld gehabt, hatte die Leute bezahlt, Kunstdünger gekauft und Steuern bezahlt und war überhaupt von einem Schwung beseelt, der alles mitriss.
Darum war es wohl Unsinn, wenn sich der Kutscher Martin Fanderl Gedanken darüber machte.
Sie wollen wissen, wie es weitergeht?Dann laden Sie sich noch heute das komplette E-Book herunter!
Besuchen Sie uns im Internet:www.rosenheimer.com





























