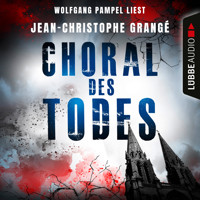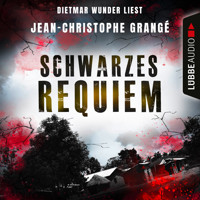10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tropen
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Meister der französischen Spannung: so episch und böse wie nie! Berlin 1939: Während die Welt dem Grauen des Zweiten Weltkrieges entgegenblickt, treffen sich die schönen Damen der Nazi-Elite zum Champagner im Adlon. Sie scheinen unantastbar. Bis an der Spree eine brutal zugerichtete Frauenleiche gefunden wird. Sie war eine von ihnen, und die Spur des Täters reicht bis in die obersten Führungskreise des Regimes. Jean-Christophe Grangé mit seinem ersten historischen Berlin-Thriller: eine erbarmungslose Jagd in den finstersten Abgründen der menschlichen Existenz. Simon Kraus ist ein brillanter Psychoanalytiker und Traumforscher. Und er ist ein gerissener Gigolo: Erst verführt er seine Klientinnen, allesamt Ehefrauen hochrangiger Nazi-Funktionäre, dann erpresst er sie für sein Stillschweigen. Ein lukratives Geschäft. Doch eines Tages sucht ihn der SS-Offizier Franz Beewen auf: Eine von Kraus' Klientinnen wurde grausam ermordet. Sie gehörte zum Wilhelmklub, einem illustren Zirkel reicher Nazi-Frauen, der jeden Tag im Hotel Adlon zusammenkommt. Während Simon Kraus im Adlon unauffällig seine Kontakte spielen lässt, werden weitere Frauenleichen entdeckt. Unversehens gerät Kraus immer tiefer in die Ermittlungen der Gestapo gegen den brutalen Mörder – und mit ihm die Psychiaterin Minna von Hassel, die mit ganz eigenen Dämonen ringt. Gemeinsam müssen sie erkennen, dass das Böse bei Weitem nicht nur dort lauert, wo man es vermutet. »Ein Hochfest des Grauens, aber auch ein Plädoyer für die Menschlichkeit.« Rhein-Neckar Zeitung »Grangés großer Coup.« RTL »Eine wahre Meisterleistung.« Le Figaro Magazine »Ein Thriller mit hohem Suchtfaktor.« 20 minutes »Ein Wendepunkt in der Karriere des Autors, ein Donnerschlag.« Libération
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 866
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Jean-Christophe Grangé
Die marmornen Träume
Thriller
Aus dem Französischen von Ina Böhme
Tropen
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Die Arbeit der Übersetzerin am vorliegenden Roman wurde vom Deutschen Übersetzerfonds gefördert.
Tropen
www.tropen.de
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Les Promises«
© 2021 by Editions Albin Michel, Paris
Für die deutsche Ausgabe
© 2023, 2024 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Cover: Zero-Media.net, München
unter Verwendung zweier Abbildungen von © Christie’s Images/Bridgeman Images (Photo) und © noppadon_sangpeam/istockphoto (Marmorstruktur)
Gesetzt von C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen
Gedruckt und gebunden von Nørhaven A/S, Viborg, DK
ISBN 978-3-608-50253-4
E-Book ISBN 978-3-608-11994-7
Für Megumi
I
Die Träumenden
1
»Alles spielt sich auf dem Land ab. Sie kommt an einem Wintermorgen.«
»Kennen Sie die Gegend?«
»Nein. Ich lebe schon immer in Berlin und verlasse die Stadt nur sehr ungern.«
»Beschreiben Sie mir das Mädchen.«
»Sie trägt die Uniform vom Bund Deutscher Mädel: schwarzes Halstuch, langer Rock, Reichsadler-Abzeichen. Ich sehe sie durch den Nebel kommen. Sie sagt: ›Hitler schickt mich.‹«
»So rundheraus, ja?«
»Ja. Hitler scheint ein Verwandter oder Vertrauter zu sein, ich weiß nicht genau. Es ist absurd. Jedes Detail in meinem Traum hat etwas Seltsames, Unerklärliches.«
»Das haben Träume so an sich, oder?«
Simon Kraus schenkte ihr ein komplizenhaftes Lächeln. Die Frau erwiderte es nicht. Sie war schön, vornehm, sehr gut gekleidet. Wie all die anderen.
»Bitte, fahren Sie fort.«
»Sie tritt noch ein Stück näher, und ich kann ihr Gesicht besser erkennen. Ihr Teint ist sehr blass, die Haut pockennarbig. Ihre Haare sind blond … ein unangenehmes Gelb. Ich kann gar nicht hinsehen.«
»Was meinen Sie mit unangenehm?«
»Sie sind … urinfarben. In meinem Traum denke ich: Das Mädchen hat pissgelbes Haar. Mir wird speiübel davon.«
Simon machte sich grundsätzlich keine Notizen. Ein Mikrofon, unter dem Schreibtisch versteckt, nahm jede Sitzung auf. Stattdessen kritzelte er gern heimlich Porträts seiner Patientinnen.
Sie war neu. Für ihn, den Amateurzeichner, eine Herausforderung. Hohe, eckige Augenbrauen (falsche allerdings, die echten waren ausgezupft), kleiner Kussmund, freche Nase, große, schlanke Hände … Konzentrier dich.
»Während sie spricht, bemerke ich ein paar Details. Erstens hält sie eine Schaufel in der Hand. Dann steht da eine Schubkarre neben ihr. Womöglich hat sie die mitgebracht, keine Ahnung …«
Er kritzelte noch immer, das Heftchen leicht angewinkelt, damit sie sein Werk nicht sehen konnte. Er war solche Geschichten gewohnt. Die Patientinnen kamen in seine Praxis, um sich mitzuteilen, ihre Probleme, ihre Neurosen zu schildern – und vor allem ihre Träume.
Simon Kraus war eigentlich Psychiater, gewiss einer der besten seiner Generation, nannte sich aber lieber einen Psychoanalytiker. Obwohl der Begriff inzwischen als gefährlich galt, war es weitaus rentabler, den weiblichen Ängsten Gehör zu schenken.
»Hören Sie mir zu, Herr Doktor?«
Sie sah ihn unverwandt an, die grauen Augen lebhaft, aber stumpf, verwaschen, wie Kieselsteine auf dem Grund eines Flusses. Bestimmt die Müdigkeit. Im August 1939 bekam niemand in Berlin genug erholsamen Schlaf.
»Ich höre Ihnen zu, Frau …«
Er warf einen Blick auf seinen Zettel.
»… Feldmann.«
Sie musterte einen Augenblick die Umgebung. Um die Praxis für seine Patientinnen (denn er empfing nur Frauen) möglichst beruhigend zu gestalten, hatte Simon alles selbst entworfen. Altweiß gestrichene Wände, ein »Elefantensessel« aus braunem Leder, als Couch eine Chaiselongue, ein dicker Kandinsky-Wollteppich, der einen wie auf Wolken gehen ließ, ein verglaster Bücherschrank, in dem er seine Nachschlagewerke sorgfältig verstaut hatte, und vor allem sein berühmter Art-déco-Schreibtisch mit den Unterschränken, hinter dem er sich, vor fremdem Blick geschützt, die Schuhe auszuziehen pflegte.
»In der Schubkarre liegt ein Aschehaufen. Das Morgenlicht lässt ihn wie einen fahlen Fleck erscheinen, ähnlich dem Gesicht des Mädchens … Und obwohl es so neblig ist, wirkt alles wie ausgetrocknet: die Asche, der reifbedeckte Boden, die Haut von dem Gör … Sogar ihre Stimme. Als ob sie das Ergebnis eines rostigen Mechanismus wäre.«
Simon hatte sein Porträt fast vollendet. Gar nicht so übel. Er hob den Blick.
»Noch mal zurück zu der Schaufel. Was macht das Mädchen mit diesem … Werkzeug?«
»Sie gibt es mir und befiehlt mir zu graben.«
Hinter dieser Szene steckte nichts weiter als die stinknormale Angst, die bereits alle Berliner gepackt hatte. Seit der Machtergreifung der Nationalsozialisten natürlich, aber auch schon vorher, während der Weimarer Republik.
Was den Psychiater interessierte, war die Einflussnahme der Diktatur auf das Unbewusste. Die NSDAP gab sich nicht damit zufrieden, das wache Gehirn zu kontrollieren, sondern schlich sich in Gestalt blanken Entsetzens auch in die Welt der Träume.
»Und was machen Sie?«
»Ich grabe. Komischerweise begreife ich erst gar nicht, dass ich mein eigenes Grab schaufele.«
»Und dann?«
»Als das Loch tief genug ist, wird mir alles klar. Das Gör will mir eine Kugel ins Genick jagen und den Inhalt ihrer Schubkarre über meine Leiche kippen. Es ist gar keine Asche, sondern gebrannter Kalk. Genau in dem Moment lacht das Mädchen auf, zückt ihre Pistole und sagt: ›Der Vorteil von Calciumoxid ist, dass es kein Metall angreift. Sie tragen doch Schmuck, oder? Bestimmt haben Sie Goldzähne?‹ Ich will flüchten, aber meine Beine sind so steif wie der Stiel der Schaufel.«
Simon legte sein Heft beiseite. Nun galt es, die neue Patientin zu begleiten, sie aus ihrem Loch rauszuholen – und das sollte kein Wortspiel sein.
»Wir wissen doch beide, dass das nur ein Traum war, Frau Feldmann.«
Sie schien ihn nicht zu hören. Sie rang nach Luft.
»Das Mädchen will mich erschießen, und ich stehe in der Grube und … grabe einfach weiter, wie zum Zeichen, dass ich noch nicht fertig bin, dass ich noch ein paar Sekunden Lebenszeit brauche, um meine Arbeit zu beenden … Es ist furchtbar … Ich …«
Sie hielt inne und holte ein kleines Schnupftuch aus ihrer Tasche hervor. Sie tupfte sich die Augen, schniefte. Simon ließ sie wieder zu Atem kommen.
»Plötzlich«, fuhr sie fort, »lasse ich die Schaufel los und versuche, aus der Grube zu klettern. Da explodiert mein Körper.«
»Wie meinen Sie das?«
»Meine Wirbelsäule bricht entzwei. Ich höre es laut krachen und lande mit dem Gesicht auf dem Boden. Es fühlt sich an, als bewegten sich meine beiden Körperhälften unabhängig voneinander, wie ein halbierter Regenwurm. Ich schaue auf und sehe, dass sie ihre Luger auf mich richtet (ich kenne die Waffe, mein Mann hat auch so eine). Sie kneift ein Auge zu, um besser zielen zu können. Das offene Auge ist auch gelb.«
Unter ihr Schluchzen mischte sich ein Kichern.
»Pissgelb!«
Jedes Detail eines Traums konnte wichtig, signifikant sein.
»Was geht Ihnen da durch den Kopf?«
»Meine Goldzähne.«
Sie unterdrückte einen Schrei, sank in sich zusammen und schluchzte. Simon stellte fest, dass sie ein Kostüm trug, das er im Kaufhaus des Westens gesehen hatte. Die Vorzeichen standen günstig. Beim nächsten Mal würde er sie nach ihrem Mann fragen, nach dessen Karriere, seinen Ansichten, seinem exakten Einkommen …
»Sind Sie Jüdin, Frau Feldmann?«
Wie vom Schlag getroffen, richtete sie sich wieder auf.
»Na … im Leben nicht!«
»Kommunistin?«
»Mitnichten! Mein Mann leitet die Reichswerke Hermann Göring!«
Als Ausdruck des Erstaunens, gepaart mit einem Hauch von Bewunderung, runzelte er die Stirn. In Wahrheit besaß er diese Information bereits – die Freundin, die ihm Frau Feldmann empfohlen hatte, war nicht müde geworden zu betonen, dass ihr Mann einen beachtlichen Teil des deutschen Stahls in der Hand hatte.
Simon schenkte ihr sein gewogenstes Lächeln.
»Nun gut, Frau Feldmann, seien Sie unbesorgt. Ihr Traum ist bloß Ausdruck einer dumpfen Angst, die, sagen wir, der momentanen Lage geschuldet ist.«
»Was soll das heißen?«
Das heißt, dass wir alle mit ’ner Luger an der Schläfe draufgehen, hätte er beinahe erwidert, setzte aber seine besondere intra-muros-Miene auf: Alles, was in dieser Praxis gesagt würde, sollte den Raum nicht verlassen.
»Ihr Geist ist großem Druck ausgesetzt, Frau Feldmann. Die merkwürdigen Szenarien befreien ihn nachts von seinen Ängsten.«
»Ich bin wahrscheinlich eine schlechte Deutsche.«
»Ganz im Gegenteil. Solche Träume zeigen, dass Sie trotz allem ein glückliches Leben in Berlin führen wollen. Noch mal: Sie reinigen sich von Ihrer Furcht. Schlaf ist Ruhe. Und Träume sind die Ruhephase der Seele, ihre Erholung, wenn Sie so wollen. Machen Sie sich keine Gedanken.«
Derweil dachte er: Du wirst schon noch deinen Lohn bekommen. Er konzentrierte sich auf ihre ausgezupften Brauen. Er konnte solche Eitelkeiten nicht leiden. Die Striche über den gerupften Haarbogen hatten etwas Obszönes und zugleich Gekünsteltes. Simon mochte natürliche Schönheiten. In diesem Sinne war er urdeutsch und den Nazis, die nur sportliche, vor Gesundheit strotzende Mädchen mit Zöpfen mochten, gar nicht so unähnlich.
»Verzeihung … Was haben Sie gesagt?«, fragte er und richtete sich wieder auf.
»Ich wollte wissen, ob die Stunde zu Ende ist.«
Er warf einen Blick auf seine Armbanduhr.
»Das ist sie.«
Hastig schlüpfte er in seine Schuhe, kassierte sein Geld und begleitete die Frau zur Tür. Nach ein paar aufmunternden Worten – sie sähen einander nächste Woche wieder – ließ er die Gattin des Leiters der Reichswerke Hermann Göring auf dem Treppenabsatz zurück. Wie eine Kugel schoss ihm ein Bild durch den Kopf: eine Zange, die Frau Feldmanns Goldzähne zog.
Simon fuhr sich mit der Hand übers Gesicht und kehrte zu seinem Schreibtisch zurück. Er kramte in seiner Tasche und holte den kleinen Schlüssel hervor, den er, durch ein Kettchen mit seiner Weste verbunden, wie eine Taschenuhr stets bei sich trug.
Vorsichtig (und wie immer entzückt) öffnete er die Tür des Schreibtisch-Unterschranks. Die Tür zu seinem geheimen Reich.
2
Der schmale, fensterlose und rundum vertäfelte Raum maß nicht mehr als fünf Quadratmeter. Von einer mattgläsernen Hängelampe erleuchtet, erinnerte er an eine riesige Zigarrenbüchse oder an einen Fahrstuhl.
Auf einem runden Tischchen thronte ein Grammophon, das er vor jeder Therapiestunde neu aufzog. In den Wandregalen ringsum archivierte Simon seine Aufzeichnungen. Hunderte besprochene Platten, die sämtliche Geheimnisse seiner Kundschaft bargen. Jahrelanges Zuhören, Zuwenden, Erpressen …
Er griff nach der neuen Acetatscheibe und schob sie in eine Papierhülle, die er mit Patientinnennamen, Tag und Uhrzeit der Therapiestunde beschriftete. Dann räumte er die Schallplatte an ihren korrekten Platz und trat etwas zurück, um seine Schätze zu bewundern: drei hohe Wände dichtgedrängter, gutsortierter Träume.
Träume waren Simons Leidenschaft. Er hatte seine Doktorarbeit über einen biologischen Zugang zum Schlaf geschrieben und war dann in die Psychoanalyse eingestiegen. Er hatte alle Bücher zum Thema gelesen – damals hatten die Nazis sie noch nicht verbrannt. Später, 1934, war er nach Paris gereist, um die Koryphäen der Traumforschung zu treffen.
Simon war fasziniert von der Komplexität der Träume, ihrem Einfallsreichtum, ihrer Gestaltungsmacht. Davon, was einem dieses Wirrwarr über einen selbst und die Welt erzählte. Er hatte seine eigene Theorie: Von Zensur und Ängsten befreit, konnte das Gehirn die Welt nachts so wahrnehmen, wie sie wirklich war, und erstaunliche Klarheit schaffen. Insofern waren Träume hellseherisch: Sie durchdrangen den dünnen Schutzschild der Träumenden und sahen immer das Schlimmste kommen.
Vielleicht würde Ilse Feldmann mit einer Kugel im Genick in einem selbst geschaufelten Grab enden. Wer wusste das schon?
In den ersten Jahren des Nationalsozialismus hatte Kraus sich getraut, einige wissenschaftliche Artikel zum Thema zu veröffentlichen. Damals war er sogar Mitglied des Göring-Instituts gewesen, eines Schlupfwinkels für Psychiater, die weder Juden noch Freudianer waren. Dann hatte er sich zurückgezogen, sich angesichts der braunen Welle bedeckt gehalten. Inzwischen behandelte er nur noch ängstliche Frauen, deren Träume starke Aversionen gegen Hitler, also fehlende Vaterlandsliebe, erkennen ließen.
Die Ironie der Geschichte: Das Reich bemühte sich stets, herauszufinden, was seinen Bürgern durch den Kopf ging, und deren Psyche zu beeinflussen, doch die Geheimnisse der Frauen – und indirekt oft auch ihrer Männer – bewahrte Simon, hier, in seiner Praxis unweit der Staatsbibliothek. Hahaha! Noch etwas, was Hitler nicht kriegen würde!
Mit den Jahren hatte er seine Theorie weiterentwickelt. Für Freud hatten Träume einen sexuellen Hintergrund. Kraus war anderer Meinung. Der geniale Analytiker Otto Gross, der obdachlos geworden war und sich 1920 zu Tode gehungert hatte, hatte einst gesagt: »Wenn Freud überall nur Sex sieht, vögelt er einfach nicht genug!«
Träume waren politisch. Sie handelten von zwischenmenschlichen Beziehungen, von Macht und Unterdrückung. In den meisten von Simons eigenen Träumen ging es genau darum: um frühere Demütigungen (weiß Gott, wie viele es gegeben hatte!), bis zum Überdruss wiederholt in Gestalt von absurden symbolischen Geschichten. Indem er die alten Kränkungen noch einmal durchlebte, litt er jede Nacht Höllenqualen, aber das war der Preis für sein seelisches Gleichgewicht.
Die Wunde musste gesäubert werden. Die Beleidigungen, die ihn noch immer erstickten, im Schlaf ausgespuckt werden.
Im Grunde war Simon nichts weiter als ein Revanchist. Er konnte noch so brillant, so leidenschaftlich, ja so aufopferungsvoll gegenüber seinen Patientinnen und als Traumforscher sein, es änderte nichts daran, dass er ein zynischer, verbitterter Mensch war, der anderen übel mitspielte.
Der Beweis? Während er mit seinem Arzthonorar ein mehr als angenehmes Leben führte und fröhlich vom Nazi-System profitierte – denn er residierte in einer luxuriösen Wohnung, die einer jüdischen Familie gehört hatte –, erpresste er seine Patientinnen.
Apropos: Da fiel ihm sein Termin um siebzehn Uhr mit Greta Fielitz ein. Nur nicht zu spät kommen.
Pünktlichkeit ist des Erpressers erste Anstandsregel.
3
Simon war schön. Sehr schön sogar.
Aber er war klein. Furchtbar klein.
Mit vorgerecktem Kinn und auf Zehenspitzen maß er mit gutem Willen einen Meter siebzig, wollte aber lieber nicht wissen, wie arg er schummelte. Er hatte vergessen, genauer gesagt absichtlich aus dem Gedächtnis gestrichen, wann er zuletzt an der Messlatte gestanden hatte.
Seine geringe Größe hatte ihm eine andere Stärke zuteilwerden lassen, nämlich seinen Willen. Seine Schulkameraden waren in die Höhe geschossen, während sein Körper dahingehend keinerlei Anstalten gemacht hatte. Da hatte er gespürt, wie er auf andere Weise stärker geworden war, als habe sich in seinem Inneren eine explosive Energie entwickelt.
Es war zu dantesken, vom Gespött über sein Handicap provozierten Schlägereien gekommen. Einmal hatte er auf einer Schultoilette mit niedrigen Trennwänden eine ordentliche Tracht Prügel bezogen. Er erinnerte sich aber noch an das Freiheitsgefühl, an den Windhauch, der durch die Betonflure strich, das Knirschen seines Nasenknorpels, als er gegen die Holztür prallte … Er war froh gewesen, dass er sich durchgebissen hatte, dass er den Weg hatte abschätzen können, den er gehen musste, um sich zu behaupten.
Simon war ein kleiner Mann, aber ein großer Geist. Ihn anzugreifen, war bald gefährlich geworden. Aus Furcht vor seiner Intelligenz hatten sie aufgehört, ihm die Visage zu polieren. Er hatte ein paar Fausthiebe eingesteckt, ja, aber dafür hatte er den Übeltätern Spitznamen aufgebrummt, die ihnen für immer anhaften sollten. Blaue Flecken verblassten, Sticheleien nicht.
Seine Lage verschärfte sich durch einen weiteren Makel: Er war arm. Was eine andere Form von klein war. Aber auch ein zusätzlicher Grund, hoch hinauszuwollen. Er dachte oft an diesen einen Schauspieler, der alle zum Lachen brachte und selbst in Armut aufgewachsen war, Charlie Chaplin. Simon ahmte ihn im Spiegel nach (er hatte wie Chaplin einen tänzelnden Gang) und sagte sich, während er mit seinem Spazierstock hantierte, dass auch er eines Tages ganz oben stehen würde.
Im Studium war er immer der Beste gewesen, ohne sich übermäßig anzustrengen, ohne mehr als nötig zu büffeln. Jahrelang hatte er deshalb als Genie gegolten. Was ihn aus seiner Sicht allerdings nach wie vor hauptsächlich kennzeichnete, war sein verflixt geringer Wuchs. »Du sollst der werden, der du bist«, hatte Nietzsche geschrieben. Der musste größer sein als Simon, denn wenn man ständig mit Plateausohlen unterwegs war und an jeder Straßenbahnhaltestelle eine Schulter ins Gesicht gerammt bekam, war man eher der, der man wurde … ungeachtet seiner Größe.
Simon Kraus war 1934 zum Studium nach Frankreich gegangen und 1936 nach Berlin zurückgekehrt. Er hatte den Reichstagsbrand im Februar 1933 erlebt, Hitlers Wahlerfolg einen Monat später, kurz darauf die Bücherverbrennung, den Röhm-Putsch 34 und die Reichskristallnacht im November 38. Das einzige Ereignis, das er sich hatte entgehen lassen, waren die Olympischen Spiele gewesen. Diesen ganzen Dünnschiss hatte er vollkommen gleichgültig aufgenommen. Selbst heute noch, da der Krieg auf dem nächsten Kalenderblatt stand, scherte er sich einen Teufel darum. Er würde die Sintflut schon überleben.
Ein Ereignis fasste die Person Simon Kraus treffend zusammen: Als er eines Nachmittags im April 33 in der Bibliothek arbeitete, gab es auf den Gängen plötzlich Radau. Türenschlagen, Stiefelgescharre, erstickte Schreie: »Sie werfen die Juden raus!« Und ihm ging nur ein einziger Gedanke durch den Kopf: Solange sie nicht über die Kleinen herfallen …
Das war es also, was diese Art von Behinderung aus einem machte: ein Scheusal. Ein kleines zwar, aber dennoch ein Scheusal.
Na schön. Simon beschloss, seinen Kleiderschrank zu öffnen. Er legte großen Wert darauf, in Greta Fielitz’ Gegenwart vorteilhaft gekleidet zu sein. Hm, hm, hm … Er musterte die Mantelkollektion zu seiner Linken: ein brauner Alpaka mit Pikeekragen, ein schwarzer Mantel aus gekrempelter Wolle mit doppeltem Knopfverschluss, ein Trenchcoat aus Gabardine … Alles zu warm. Er ging zu den Anzügen über: alle Säume abgesteppt, Wolle, Flanell, Leinen … Die Rede war natürlich von Dreiteilern mit körperbetonten Westen und hochtaillierten Hosen – aber nicht zu hoch, sonst sahen sie aus wie Latzhosen.
Sie waren viel raffinierter geschnitten als die Durchschnittshosen: Er besaß noch französische Modelle, die er talentierten Schneidern überließ, allesamt Juden, immer schwieriger auffindbar.
Er entschied sich schließlich für Tweedweste, Oxfordhemd mit Knopfkragen, Bundfaltenhose, Derbys, und fertig war die Laube. Beschämendes Detail: Seine Schuhe waren manipuliert, sie hatten Keilabsätze. Simon, der längst begriffen hatte, dass Selbstironie das beste Mittel war, um Spötteleien unter Kontrolle zu halten, hatte sich als Assistenzarzt an der Charité diesen Witz ausgedacht: »Was ist der Unterschied zwischen Joseph Goebbels und Simon Kraus? Goebbels hat einen Klumpfuß. Simon hat zwei.«
Er betrachtete sich noch einmal im Schrankspiegel und bemerkte dabei, dass die Schattierungen seiner Jacke – Moos, Rinde, schottisches Heidekraut – an die Nazi-Uniform erinnerten. Sehr gut, er würde nicht auffallen.
Er warf einen Blick auf die Armbanduhr und stellte fest, dass er gut in der Zeit war. Er ging durch den Flur zurück in die Küche, um sich Kaffee zu kochen.
Die über sechzig Quadratmeter große Wohnung beherbergte sowohl die Praxis als auch seine privaten Räumlichkeiten. Da ein Zimmer als Büro und eines als Wartezimmer fungierte, beschränkte sich die eigene Unterkunft auf Küche, Bad und ein großes Schlafzimmer. Völlig ausreichend.
Wie seine Anzüge pflegte Simon auch seine Möbel. Für das Wartezimmer hatte er einen Lyratisch aus Palisander, zwei braune Ledersessel und eine quadratische, mattgläserne Deckenleuchte beschaffen können. Das Herzstück des Schlafzimmers war sein immerhin von Jean Lurçat signierter Paravent …
Wie konnte er sich diesen Luxus leisten? Ganz einfach: Leni Lorenz, eine seiner Patientinnen, war mit einem Bankier verheiratet, der sich auf die »Arisierung« Berlins verlegt hatte. Ein lächerlicher Begriff, um die offensichtliche Enteignung der Juden und die Konfiszierung ihres Eigentums zu bezeichnen, das Hans Lorenz den »guten Deutschen« zu Spottpreisen wieder zu kaufen empfahl.
Auf jene Weise hatte Simon diese Wohnung beziehen können, ohne auch nur Miete zu bezahlen. Danach hatte Leni ihn zu den Hallen begleitet, in denen die Nazis die Beute ihrer Raubzüge lagerten, und wie ein junges, frisch zusammengezogenes Paar hatten sie eingekauft. Sie hatten es geschafft, hinter dem Lurçat-Paravent, den Simon ausgesucht hatte, miteinander zu schlafen. Ein süßes Andenken.
Das Halbweltartige seiner Situation hätte dem Psychiater peinlich sein können (Leni hielt sich ihn wie ein Bourgeois seine Liebchen), doch es kümmerte ihn nicht. Im Gegenteil. Er war Gigolo mit Leib und Seele. Sein gesamtes Studium hatte er durch sein Engagement als mondäner Tänzer finanziert – und bei Sympathie gerne mehr.
Vor dem Gehen konnte er nicht widerstehen, sich im Flurspiegel ein letztes Mal zu beäugen. Ja, er sah wirklich gut aus. Hohe Stirn unter dem nach hinten gestrichenen kastanienbraunen Haar. Selbiges war pomadig, wenn man so wollte, aber ungebändigt pomadig, irgendwie wild-gezähmt. Mitunter baumelte ihm sogar eine Strähne in die Stirn, wie ein Geistesblitz, der ihm aus dem Kopf geschossen kam.
Die Brauen setzten einen düsteren Akzent. Man garniere ihn mit einem dunkelblauen Blick, den die kultivierten Augenringe noch betonten, sowie mit einigen Pinselstrichen, die eine gerade Nase und sinnliche Lippen zeichneten, und schon hatte man einen verdammten Herzensbrecher.
Mit großer Sorgfalt wählte Simon seinen Hut. Der Kleiderschrank war seine Schatzkammer, die Hutsammlung sein Meisterwerk. Er besaß eine Reihe Trilbys aus Filz mit schmaler, hinten aufgeschlagener Krempe. Ein paar Homburgs mit ihrer berühmten Delle in der Platte. Er mochte sie, weil ihre halbsteife Krone ihn etwas größer wirken ließ. Doch heute schnappte er sich einen Fedora, fälschlicherweise auch »Borsalino« genannt, einen Filzhut aus Kaninchenhaar. Er bog die Krempe nach oben und warf sich einen verruchten Blick zu.
Mit einer kurzen, kräftigen Handbewegung fegte er sich die Fusseln von den Schultern, und: andiamo!
4
Simon Kraus war kein waschechter Preuße. Er stammte aus der Gegend um München. Dennoch hatte er sich immer als Berliner gefühlt. Jeden Tag, wenn er die Praxis verließ und durch »sein« Berlin schlenderte, spürte er mit jeder Nervenfaser den Reiz dieser Stadt und ihre besondere Atmosphäre.
Er hatte in Paris gelebt, sich in London aufgehalten, und was die architektonische Schönheit oder die räumliche Harmonie anbelangte, hielt Berlin diesen Vergleichen nicht stand. Aber es gab da etwas anderes … Die beklemmende, farblose, rußige Stadt setzte eine außergewöhnliche Energie frei. Man munkelte, sie sei auf Gelände erbaut worden, das Alkaligeruch verströmte, giftige Dämpfe, die die Gemüter erhitzten. In Anbetracht der vergangenen zwanzig Jahre konnte man diesem Gerücht nur Glauben schenken.
Seit dem Ende des Weltkriegs hatte Berlin alle möglichen Exzesse und Extreme erlebt. Staatsstreiche, Revolutionen und Anschläge auf der politischen Seite, Armut, flüchtiges Glück und Ausschweifungen auf der sozialen. Inzwischen hatte der Gleichschritt der Nazis die Wogen geglättet, doch das Großstadtgetriebe war nicht ruhiger geworden.
Simon nahm die Alte Potsdamer Straße Richtung Nordosten und erreichte den Potsdamer Platz. Immer wieder der gleiche Schock: ein großes Fenster zum Himmel, zerschnitten von U-Bahn-Schienen und ihren Stromtrassen, durchpflügt von Automobilen und Pferden … Die Gebäude rings um den Platz sahen aus wie Berge, die einen stählernen See überragten. In der Mitte stellte eine Art schwarzer Obelisk einige Uhren und die erste Ampel der Stadt zur Schau. Im Hintergrund wirkte das Vaterland mit seiner Kuppel wie eine unechte italienische Basilika. Das Haus beherbergte eine Spielbank, ein Kino und Gaststätten, in denen die Gäste wie Kinder behandelt wurden: Zwischen den Tischen schlängelten sich elektrische Modelleisenbahnen und -flugzeuge.
An diesem sonnigen Tag erbebte Simon beim Anblick der Menschenmenge – ein Meer aus schwarzen Anzügen, leichten Kleidchen (seiner persönlichen Schwäche) und den guten alten Schupos mit ihren lackierten Schirmmützen. Genüsslich tauchte er in die Umgebungsgeräusche ein: das Klappern der Hufe, das Heulen der Straßenbahnen, die über das Pflaster schepperten, das Dröhnen der Automobile …
Wie gewöhnlich gönnte er sich einen kurzen Augenblick, um das Columbushaus zu bewundern, einen neunstöckigen Monumentalbau aus Glas und Stahl, der gerade erst fertig geworden war und einen Kontrast zu den alten Bauwerken bildete. Weiß der Kuckuck, warum er davon träumte, seine Praxis in dieses Gebäude zu verlegen. Simon war modern, er wollte seine Patientinnen in einem futuristischen Glaskubus empfangen und gab die Hoffnung nicht auf, dass ein paar jüdische Kaufleute ausquartiert würden, damit er kostenlos einziehen konnte.
Am anderen Ende des Platzes, wo es ruhiger war, sog er die milde Luft ein. In jenem Spätsommer musste man nur ein paar Schritte im Schutze der hundertjährigen Bäume über die breiten Bürgersteige tun, und schon wusste man, dass etwas Größeres existierte als die Nazi-Unterdrückung oder ein drohender Krieg. Ein sanfter, warmer Windhauch, leises Blätterrascheln, die herrlich funkelnde Sonne … Und diese zarten Schatten, die auf dem Asphalt Walzer tanzten.
Er begegnete Bettlern mit Verdienstkreuzen aus dem Krieg (es gab noch welche, Relikte des letzten Konflikts) und einem dicken Mann in bayerischer Tracht: Lederhose und Hut mit Flederwisch. Simon grinste. Solche Gestalten bewiesen einmal mehr, dass Freud recht hatte. Die deutsche Kultur war rückwärtsgewandt, ein Pfadfindertraum, in dem alle in kurzen Hosen über die Berge hüpften.
Er bog in die schöne, breite Wilhelmstraße ein (das Lineare musste man allerdings mögen) und spürte, wie die Atmosphäre sich verdüsterte. Während er sich auf dem quirligen Potsdamer Platz fast in einer gewöhnlichen Stadt wähnte, gemahnte diese Gegend mit ihren Ministerien, ihren Amtsgebäuden und den zahlreichen Hauptquartieren daran, dass mit der amtierenden Regierung nicht zu spaßen war.
Das von der Prinz-Albrecht-Straße und der Anhalter Straße begrenzte Viertel war ein wahrer Ort des Schreckens, wo sich die bedrohlichsten Reichsmächte bündelten. Säulen und Banner stellten allenthalben SS-Runen, Adler und diese verdammten Hakenkreuze zur Schau, die ihm zum Halse heraushingen.
Seine Laune sank. Hier konnte man nicht träumen. Die bittere Realität holte einen ein. Der Krieg war nur noch eine Frage der Zeit. Der Hitler-Stalin-Pakt hatte die letzte Kette gesprengt, die den Einmarsch nach Polen bislang verhindert hatte. Die Zeitungen – allesamt ver- oder aufgekauft, je nachdem – konnten noch so viel behaupten, Hitler wolle den Krieg um jeden Preis verhindern, niemand fiel darauf herein. Er hatte sich erst Österreich und dann das Sudetenland unter den Nagel gerissen, warum sollte er auf halbem Weg stehen bleiben?
Simon durchquerte das Viertel mit hochgezogenen Schultern und zusammengekniffenen Pobacken. Auf Höhe der Prinz-Albrecht-Straße 8 wechselte er sogar die Straßenseite. Es war die Adresse der Gestapo.
Auf dem Wilhelmplatz konnte er endlich wieder durchatmen. Hier war alles anders. Nicht zu vergleichen mit dem Tumult auf dem Potsdamer Platz oder dem bedrückenden Wilhelmstraßenviertel: viel Grün, viel Himmel und viel Platz, umrahmt von großen, nüchternen, friedlich wirkenden Gebäuden.
Die U-Bahn-Station Kaiserhof mit ihren beiden Laternen, dem schmiedeeisernen Gitterwerk und dem merkwürdigen Säulengang rings um den Eingang erinnerte an ein Mausoleum.
Hundert Meter weiter, Wilhelmplatz 3–5, thronte das gleichnamige Hotel, und ohne jeden Zweifel, mit den vier massiven Stockwerken, den unzähligen Fenstern, den verzierten Balkonen und der italienischen Dachterrasse erwies sich die Luxusherberge ihres Standes würdig.
Hier hatte Simon seine Verabredung mit Greta Fielitz.
5
Die Empfangshalle war der Außenfassade ebenbürtig. Sie ließ die Sonnenstrahlen großzügig durch hohe, senkrechte Fenster, regelrechte Lichtwächter, fallen. In der Mitte ragten zwischen Tischen und Podesten zwei riesige Grünpflanzen wie Herkulessäulen empor. Die Welt, die man hier betrat, war edel, mondän, vornehm.
Und hektisch.
Unter dem Kristallglanz ging es heiß her. Ordengeschmückte Portiers, karminrote Pagen und Ober im Frack kamen und gingen, während eine kleine Tagmusik die Sessel und Tischchen umfloss, zu der das Tassenklappern, das Gläserklirren und das Stimmengewirr den Takt schlugen.
Simon nahm die waltenden Kräfte ausführlich in Augenschein.
Die Vertreter der preußischen Alten Garde mit ihren Monokeln und ihrer Hochnäsigkeit. Die nervös und elektrisiert lächelnden Kaufleute in Schwarz (schon seit einer ganzen Weile liefen die Geschäfte in Deutschland wieder besser). Und natürlich die Nazis mit ihren durchfallbraunen Uniformen, deren Gürtel quietschten wie lederne Garrotten, die einem den Hals abschnürten.
Zum Glück gab es die Frauen.
Sie waren so geschmeidig wie ihre Männer steif, so heiter wie jene ernst, so anmutig wie jene plump. Die einen waren buchstäblich das Leben, die anderen dagegen der Tod.
Kraus ging durch die Lobby auf die Veranda, wo sich die Bar befand. Als er an einem der Tische Platz nahm, überkam ihn das Gefühl, in einem überheizten Terrarium mit einigen ziemlich grünen Nazi-Offizieren als Krokodile gelandet zu sein.
Durch das große Glasfenster konnte er das Auf und Ab der Passanten auf dem kaiserlichen Platz verfolgen. Mit etwas Glück würde er Greta Fielitz kommen sehen und durch das sonnenbeschienene Sommerkleid hindurch ihre Beine erkennen können.
Sein ganzes Leben widmete Simon solchen kurzen Augenblicken. Den intensiveren, stärkeren Momenten des Daseins. Die beste aller Drogen war die Begierde. Er bestellte einen Martini, griff nach seinem Zigarettenetui (extraschmal, gold- und silbergestreift, Marke Cartier: das Geschenk einer guten Freundin) und entnahm ihm eine Muratti.
Langsam stieß er den Rauch aus und betrachtete abermals die Uniformen um ihn herum. Wer um alles in der Welt wollte so schon herumlaufen? Vor allem bei der Hitze … Die Nazis hatten keinerlei Realitätssinn. Mit ihren Tressen, Medaillen und Goldverzierungen wirkten sie nicht seriöser als die Pagen oder die Kofferträger.
Er blickte nach oben und sah der Rauchschwade in der sonnenklaren Luft hinterher. Er konnte es immer noch nicht fassen. Wenn diejenigen, die sie alle in den Abgrund trieben, zumindest brillant und charismatisch wären … Ein erfolgloser Maler, ein Hinkebein, ein Drogensüchtiger, ein Hühnerzüchter … Hallo, Regierungsmannschaft. Und das waren nur die Anführer. Bevor sich die braune Pest wie aus einem umgekippten Tintenglas über Deutschland ausgebreitet hatte, hatte jemand gesagt: »Eines der grundlegenden Elemente der Nazi-Ideologie ist die Trunksucht.« In gewisser Weise nötigte einem die Machtübernahme Bewunderung ab. Wie hatte es ein Trupp von Zirkusclowns nur so weit bringen können?
Greta ließ auf sich warten. Noch einen Martini. Unter der Wärme des Glasdachs stieg ihm der Alkohol allmählich zu Kopf. War er etwas Besseres? Ganz bestimmt nicht. Simon hatte seinen Platz in dieser Angstgesellschaft gefunden: Er spielte den Schlaumeier, das Großmaul und verstand es zugleich, sich von den Frauen der Schurken beschützen zu lassen. Eine unsichere Stellung …
Wie lange konnte das noch so weitergehen?
Nicht mehr lange. Die Arbeit an sich machte Probleme. In diesen Zeiten war es so schon eher unvorteilhaft, Psychiater in Berlin zu sein, und Analytiker erst … Bei der Bücherverbrennung von 1933 waren sämtliche Werke von Freud hinübergegangen. Die Nazis hassten die Vorstellung, man könne das menschliche Bewusstsein öffnen wie einen Samtvorhang, um verborgene Geheimnisse auszugraben.
Was soll’s, dachte Simon und gönnte sich eine zweite Muratti, keine dunklen Gedanken. Nicht jetzt, da er bei herrlichstem Wetter seinen Martini schlürfte und eine der schönsten Frauen Berlins erwartete, in ihrer Tasche ein Umschlag voller Zaster.
Er leerte sein Glas in einem Zug und bestellte ein weiteres. Drei Martinis zum Kaffeekränzchen, das ist ganz schön viel, mein Lieber.
»Guten Tag, kleiner Mann!«
Vor ihm stand Greta Fielitz. Er war so tief in Gedanken versunken gewesen, dass er sie durch die Scheibe nicht bemerkt hatte. Schade. Wie erwartet trug sie ein einziges, an der Taille gegürtetes Kleidungsstück, dessen Material er auf den ersten Blick erkannte: Lystav, knitterfreies Leinen. Das Kleid war … azurblau. Eine Farbe, die zu ihrem Teint passte wie das Meer zur Sonne.
Hitler, der sich in alles einmischte und die Haute Couture für eine von unzähligen jüdischen Verschwörungen hielt, mahnte die deutschen Mädchen, Zöpfe und scheußliche traditionelle Kleider zu tragen. Dabei konnte er noch so sehr die Tschechei, Frankreich oder die Sowjetunion angreifen, gegen die Frauen würde er nicht ankommen. Eine Berlinerin würde niemals ein Dirndl anziehen.
»Bitte, setz dich«, gurrte er, stand auf und zog den Stuhl gegenüber zurück.
Mit seidigem Rascheln kam sie der Aufforderung nach. Sie war ungemein verführerisch. Und verführerisch, dachte er, war tausendmal besser als mit dem Führer am Tisch.
Das Wortspiel, die Macke der Psychoanalytiker.
6
Sobald sie Platz genommen hatte, öffnete sie ihre perlenbestickte Tasche, holte einen Umschlag heraus und schleuderte ihn auf den Tisch.
»Du bist so ein kleiner Scheißkerl.«
»Hör doch auf mit deinem ›klein‹.«
Sie schlug die Beine übereinander. Simon vernahm deutlich, wie unter dem blauen Kleid ihre Strümpfe aneinanderrieben, und spürte einen regelrechten Stich im Unterleib.
Finger für Finger streifte Greta ihre weißen Handschuhe ab und räumte ein:
»Ich verleihe dir den nächsthöheren Rang: Du bist ein großer Scheißkerl.«
»Schon besser. Was trinkst du?«
Behutsam nahm er ihre Hand. Im Hotel Kaiserhof vor aller Augen die Gattin eines sächsischen Aristokraten zu liebkosen, während auf dem Tisch ein Umschlag mit zweitausend Reichsmark lag, Folge der Erpressung ebenjener Gattin, war nicht kühn, sondern selbstmörderisch.
»Einen Martini«, erwiderte sie und überließ ihm ihre Hand. »Willst du nicht nachzählen?«
»Ich vertraue dir.«
»Ich sollte dich an meinen Mann verraten.«
Simon begnügte sich mit einem Lächeln. Anfangs war Greta mit Anzeichen einer (leichten) Depression zu ihm gekommen. Verstimmung, Schlaflosigkeit, Angstzustände … Wie üblich hatte er sie nach ihren Träumen gefragt.
Sie hatte sofort ausgepackt und von ihren wiederkehrenden Alpträumen erzählt.
Ihre Alpträume waren immer antinazistisch. Tagsüber spielte Greta tapfer die Rolle der guten deutschen Ehefrau, doch im Schutze des Schlafes brachen sich ihre Ängste Bahn und schufen unerträgliche Szenen, in denen die Nazis (sofern dies möglich war) noch schlechter wegkamen als in Wirklichkeit.
Die Träume gaben nichts her, womit die junge Frau hätte erpresst werden können. Bloß hatte sich Greta auch zu dem Bekenntnis hinreißen lassen, dass ihr Mann, ein preußischer, der Partei nahestehender Graf, Adolf Hitler von Herzen verachtete und ihn stets bei dem Spitznamen nannte, den Hindenburg ihm verpasst hatte: »böhmischer Gefreiter«.
Mit seinen Schallplatten unterm Arm hatte Simon ihr gedroht, die Gestapo zu kontaktieren. Greta steckte in der Zwickmühle. Entweder sie gestand ihrem Mann, dass sie einen Analytiker aufsuchte, oder sie zahlte, indem sie Geld aus dem Geheimfonds des Grafen stibitzte.
Sie hatte sich für Letzteres entschieden, und das schon vor sechs Monaten.
»Danke«, sagte er trocken.
Möglichst unbefangen steckte er den Umschlag ein. Die Ironie des Augenblicks: Er heimste die Früchte der Erpressung einer Nazi-Frau ein, umgeben ausgerechnet von dreckigen Nazi-Uniformen.
»Ich habe dir ja schon erklärt, dass das hier zur Therapie gehört«, fuhr er mit seiner sanftesten Stimme fort. »Diese Entschädigung ist der Schlüssel zu deiner Heilung. Sigmund Freud hat gesagt –«
»Schnauze! Du bist einfach ein fieser Erpresser.«
»Denk, was du willst«, erwiderte er gespielt beleidigt. »Es ist nur zu deinem Besten.«
»Das Geld gehört noch nicht mal mir, sondern meinem Mann.«
»Umso besser!«
»So ein Unsinn.«
Abermals beugte er sich vor und nahm ihre Hand.
»Greta, ich behandle doch deine Alpträume, oder?«
»Ja«, räumte sie ein und zog einen Schmollmund.
»Und woher kommen deine Alpträume?«
Sie hob den Kopf und blickte sich ängstlich um.
»Halt die Klappe.«
Er beugte sich noch weiter vor und hauchte:
»Sie kommen von der NSDAP, meine Liebe.«
»Schnauze, verdammt!«
»Und woher kommt der Zaster von deinem Mann?«
Sie schlug die Hände vors Gesicht und begann zu schluchzen. Genau das gleiche Schauspiel wie bei Frau Feldmann. Bei dem hohen Geräuschpegel auf der Terrasse blieb es zum Glück unbemerkt.
»In gewisser Weise bezahlt mich Hitler«, sagte er. »Er macht den Schaden wieder gut, den er deiner Seele zugefügt hat.«
Sie tupfte sich die Wimpern.
»Du immer mit deiner Scheißlogik.«
»Du bist kindisch«, sagte er und griff nach einer dritten Muratti. »Das Geld dient der Wissenschaft. Immer noch besser, als es in einem Krieg zu verbrennen, der jetzt schon das größte Fiasko des Jahrhunderts zu werden verspricht. Und Millionen Menschen das Leben kosten wird!«
Greta rutschte auf ihrem Stuhl zurück. Sie sah nun nicht mehr traurig, sondern geradezu neugierig aus.
»Ich frage mich, wie du eigentlich überlebst.«
»Tja, weil ich so klein bin. An mir regnet’s einfach immer vorbei.«
»Bald regnet’s Granaten.«
»Nur nicht so ungeduldig. Noch einen Martini?«
Sie nickte wie der Kuckuck einer Kuckucksuhr. Sie war äußerst gern kindisch und ihre Kindheit eigentlich noch gar nicht so lange her …
Er rief den Ober und gab eine neue Bestellung auf. Seine Gedanken schweiften in seltsame Richtungen.
»Wie geht’s deinem Mann?«, wollte er plötzlich wissen, als beharrte er darauf, sie zu provozieren.
»Er ist ganz aus dem Häuschen«, stieß sie aus. »Diese Polensache macht ihn fertig.«
Er nahm einen tüchtigen Schluck Martini und schmeckte das Kaffeearoma auf der Zunge. Dann stieg ihm die Galle hoch und verätzte ihm den Rachen.
»Endlich mal was, was ihn erregt.«
»Gib mir bitte eine Zigarette«, fauchte sie.
Simon reichte ihr sein Etui, und Greta bediente sich mit zittrigen Fingern.
»Warum kommst du nicht mehr in meine Praxis?«, fragte er, während er ihre Zigarette anzündete (auch sein Feuerzeug war vergoldet, ebenfalls ein Geschenk, von einer anderen Freundin).
»Deine Therapiestunden kosten mir zu viel.«
Immerhin hatte Greta Humor. Sie schlug erneut die Beine übereinander, und wieder war das Knistern ihrer Strümpfe zu hören. Diesmal war es, als würde in seinen Lenden etwas reißen. Der Alkohol verstärkte das Gefühl.
Die junge Frau war nicht mit Absicht verführerisch. Ihre sexuelle Anziehungskraft wirkte gleichsam ohne ihren Willen. Es war eine Frage der Proportionen ihrer Gliedmaßen und ihrer Statur, etwas Schweres, so natürlich wie die Erdanziehungskraft, das ihn in einen seltsamen Bann riss.
Der Nationalsozialismus, die zweitausend Mark, die Zeit und der Ort ihres Treffens waren auf einmal vergessen. Wenige Zentimeter von ihren Schenkeln entfernt, dachte Simon nur noch daran, in Greta zu versinken, sie zu spüren, zu herzen. Mein Gott, allein der Gedanke an ihre Beckenregion, an diese Babyhaut, in der er einst geschwelgt hatte, machte ihn verrückt.
»Komm doch wieder in meine Praxis«, sagte er entschieden.
»Um mit dir zu schlafen?«
»Egal. Es wird dir guttun.«
Er spürte, wie ihm schwindelig wurde – die Martinis vernebelten ihm die Sinne, und er vergaß beim Sprechen schon die Konsonanten.
»Wer bist du eigentlich?«
»Ein Arzt, der seinen Patienten die bestmögliche Behandlung bieten möchte.«
Ihm wurde klar, dass er noch nicht einmal scherzte.
»Ein Arzt und ein Erpresser.«
»Sagen wir so: Ich habe zwei Berufe. Oder besser, eine Arbeit und ein Hobby.«
»Ich frage mich, was von beidem dein Hobby ist …«
Er antwortete nicht. Unversehens war sein Blick zur Reichskanzlei am anderen Ende des Platzes geschweift. Jetzt gerade erschien ihm die Diktatur beinahe angenehm. Als eine Art gleichmäßiger Druck, wie beim Tiefseetauchen, wenn jede Sekunde kostbar und intensiv ist … In seinem Kopf geriet alles durcheinander. Meine Güte, diese Martinis …
»Hörst du mir überhaupt zu?«
»Was?«
»Dir ist wohl nicht klar, dass deine zynische Art, dein Getändel, dein billiges Lausbubengehabe und das alles nicht mehr gefragt ist?«
Sie streckte den Arm aus und griff ihm wie einem Kätzchen sanft in den Nacken.
»Wach auf, Simon, und zwar bevor deine Stärken zu deinen Schwächen werden. Im Konzentrationslager bist du nur ein kleiner Mann auf Kolbenhöhe. Und kriegst voll eins auf die Fresse.«
Simon erschauderte. Greta hatte recht: Seine ständige Klugscheißerei würde die dünne Eisschicht unter seinen Füßen zum Brechen bringen. Intelligenz war nicht mehr in Mode. Und was seinen berühmten Schutz anging … Den Schutz von Frauen, die er erpresste und mit denen er schlief, da hatte es schon bessere Immunitäten gegeben. Am Ende würden die Gehörnten der Sache auf die Spur kommen.
»Und wenn wir wieder ins Hotel Zara gehen, wie in den guten alten Zeiten?«
Greta lächelte.
»Tut mir leid, mein lieber Simon. Auch da bist du nicht mehr auf der Höhe der Zeit.«
Er stieß ein resigniertes »Ah« aus, das mehr nach einem Rülpser klang.
»Treffen wir uns lieber im Bayernhof«, sagte sie plötzlich heiter. »Ist lange her, dass ich den Kartoffelsalat dort gegessen habe.«
Sie hatte ihr Lächeln wiedererlangt, und er konnte es erneut bewundern. Ihr Puppengesicht verdrehte der vornehmen Gesellschaft Berlins den Kopf, und ihre Wangen sahen wie zwei kleine Glutstücke aus – wie jene, die sie hinter jedes Mannes Hosenschlitz entzündete.
»Dann der Bayernhof«, kapitulierte er. »Freitag um halb eins?«
»Halb eins, prima.«
Sie erhob sich mit einem weiteren himmlischen Rascheln.
»Und dann rede ich«, warnte sie. »Ein bisschen weniger Unsinn als sonst kann nicht schaden. Auf Wiedersehen.«
Simon sah ihr nach, ohne frustriert zu sein. Er sagte sich, dass er wirklich ein Intellektueller war. Schließlich wollte er, mehr noch als ihre Schenkel, die Vorstellung ihrer Schenkel liebkosen.
7
Auf dem Rückweg wurde er wieder etwas nüchterner. Doch er blieb beschwingt. Er spürte Gretas Umschlag in der Tasche, und seine Masche schien ihm todsicher. Er verdiente Geld, indem er die Frauen reden ließ, ehe er noch mehr Zaster machte, indem er ihnen Stillschweigen versprach. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold.
Um sich noch mehr auszunüchtern, blieb er vor einem Straßenhändler stehen und kaufte sich zwei dampfende Wiener Würstchen. Ein fleischfarbenes Berliner Vergnügen … Die Würstchen in der Hand ging er leichten Schrittes die Wilhelmstraße hinauf. So leichten Schrittes, dass er wie früher als Knabe die Rillen zwischen den Steinplatten auf dem Bürgersteig zu umgehen versuchte. Wenn du die Linie berührst, stirbst du …
Er überquerte wieder den Potsdamer Platz, wo er seinen Abfall in hohem Bogen in eine Mülltonne warf. Diesmal war ihm der tobende Platz unerträglich, verstopft mit Straßenbahnen, Doppeldeckerbussen, Automobilen und Karren, aber auch überschwemmt von einer Flut von Stoff- und Strohhüten, die einer Welle wabernder Punkte gleich auf und ab wogte – Pointillismus, im Stakkato produziert. Zack, zack, zack …
Simons Beschwingtheit ging allmählich in eine Migräne über. Irgendwo hinter den Gebäuden versank die Sonne, der Lärm zerfurchte ihm das Hirn wie Schlittschuhkufen eine Eisbahn.
Als er in die Alte Potsdamer Straße bog, packte ihn jäh eine dunkle Vorahnung. Greta hatte recht: Diese Seiltänzerei konnte so nicht weitergehen. Die Wirklichkeit würde ihn mit ihrer ganzen Wucht einholen, wie eine mit Volldampf auf ihn zurasende Kriegslokomotive.
In Sichtweite seiner Wohnung musste er beinahe losprusten vor Lachen. Er hätte eine Karriere als Medium einschlagen können … Vor seinem Haus spielte sich jenes Schauspiel ab, das jeder Deutsche am meisten auf der Welt fürchtete.
Neben dem Portalvorbau parkte ein prächtiger Mercedes. Ein Chauffeur in SS-Montur rauchte an das Fahrzeug gelehnt eine Zigarette. Wenige Schritte entfernt stand wie versteinert ein Koloss in schwarzer Uniform, auf dem Kopf eine funkelnde Schirmmütze, die Hacken fest in den Asphalt gepresst.
Hahaha! Der kleine Simon, an dem es immer vorbeiregnete. Hopp, hopp! Ab ins KZ, wie alle anderen auch!
Sein Interesse galt weder dem Wagen noch dem Chauffeur, sondern dem Koloss mit der Hakenkreuz-Armbinde. Das Bild war so perfekt, dass es eine Illustration aus den Propagandabüchern hätte sein können. Über der Jacke ein Schulterriemen. Reithose. Weiche, spiegelblank polierte Stiefel. Ein SS-Dolch an einem Kettchen. An der Brust das SA-Sportabzeichen. Und natürlich überall Adler – auf der Mütze, am Kragen, an der Gürtelschnalle …
»Dr. Simon Kraus?«
»Der bin ich«, sagte Simon, ohne den Blick von den beiden Runen abwenden zu können, die das SS-Zeichen an seinem Kragen bildeten.
»Hauptsturmführer Franz Beewen«, sagte der Koloss und schlug die Hacken zusammen.
Der Gruß war offensichtlich vor dem Spiegel eingeübt worden. Simon erwartete das übliche »Folgen Sie uns«, doch der Mann fügte mit beinahe versöhnlicher Stimme hinzu:
»Können wir uns in Ihrer Praxis unterhalten?«
Der Offizier streckte ihm eine ovale Medaille aus schwarzgetöntem Metall entgegen, in die ein Adler auf einem Hakenkreuz geprägt war. Darunter eine Zahl. Gestapo, was? In Anbetracht seiner Erscheinung war diese Dienstmarke wahrlich ein Pleonasmus.
»Kein Problem«, sagte Simon und vollführte seinerseits eine kleine Verbeugung, die gestisch mehr nach Charlie Chaplin als nach Hitler aussah.
Während sie die Stufen des Portalvorbaus emporstiegen, empfand Simon ungebührenden Stolz. Ein Haus aus Quadersteinen, ein schmiedeeisernes Portal … Das machte doch Eindruck.
Stumm gingen sie nach oben. Abermals war Simon stolz auf sein üppig ausgestattetes Zuhause, die Vornehmheit der Gemeinschaftsbereiche. Du Idiot, du siehst das alles wahrscheinlich zum letzten Mal.
Im dritten Stock schloss er seine Wohnungstür auf, während er nach seinem Gast schielte. Er fragte sich, ob selbiger wirklich so groß war, wie es den Anschein machte. Es war nicht schwer, neben Simon wie ein Titan zu wirken.
Sie blieben einen Augenblick im Flur stehen, einem kleinen, beigegestrichenen Raum mit entsprechend hellem Parkett aus Gabunholz. Einziger Zierrat waren eine Reihe Paul-Klee-Skizzen.
Der Hauptsturmführer betrachtete die Bilder einen Moment lang mit kritischem Blick. Simon nutzte die Zeit, um ihn erneut zu mustern. Er war nicht nur groß, sondern auch imposant. Er sah wie ein echter Arier aus, frisch aus dem Märklin-Baukasten: eiserne Gesichtszüge, starre Kinnlade, helle Augen, verächtlicher Mund … Mit einer solchen Visage konnte er einen durch bloßes Nicken ins Konzentrationslager schicken.
Doch der Siegfried hatte eine Schwäche. Offenkundig litt er unter Ptosis, einem Ausfall des Hebemuskels am oberen Lid, weshalb sein rechtes Auge halb geschlossen war. Wenn er einen ansah, schien es, als würde er mit seiner Luger auf einen zielen.
»Bitte, hier entlang.«
Sie betraten sein Büro. Der angewiderte Gesichtsausdruck des Offiziers beim Anblick des Art-déco-Mobiliars sprach Bände über seine, sagen wir, »kulturelle« Einstellung. Noch so einer, der am 10. Mai 1933 vor der Berliner Oper einen Haufen Bücher verbrannt haben musste.
»Was kann ich für Sie tun, Herr Hauptsturmführer?«, fragte Simon und setzte sich hinter seinen Schreibtisch.
Er hatte zwar nicht die Füße auf den Tisch gelegt, war nun aber von diesem Geist beseelt. Umgeben von seinen Büchern und Möbeln fühlte er sich nach dem ersten Schreck wieder stark, unverwundbar. Zumal ihm noch immer die Martinis in den Adern brannten und ihn fortwährend glauben machten, er besäße Superkräfte.
Der Mann in Schwarz antwortete nicht, er schaute sich um, musterte jedes Detail. Die Gestapo ließ sich Zeit.
Als er sich der Geheimtür zum Aufnahmeraum näherte, hustete Simon, um ihn abzulenken.
»Bitte, nehmen Sie doch Platz«, bat er mit Nachdruck.
Unter der Masse des Gestapo-Mitarbeiters quietschte das Leder vor Schmerzen.
»Kennen Sie Margarete Pohl?«
Simon Kraus spürte, wie etwas in seinem Inneren sich entspannte. Margarete war eine seiner ersten Patientinnen, eine chronisch Depressive, die ihn nach wie vor von Zeit zu Zeit aufsuchte. Eine zierliche Blonde mit flachem Hintern und kleinen, festen Brüsten, mit der er auch geschlafen hatte, aber das war über zwei Jahre her.
»Sie haben sicherlich viel zu tun, Herr Hauptsturmführer«, erwiderte er, wieder voller Tatendrang. »Und ich habe auch nicht so viel Zeit. Vielleicht überspringen wir die Fragen, deren Antworten Sie bereits kennen?«
Simon sah zweierlei in den anderthalb Augen des Offiziers. Erstens echte Fassungslosigkeit darüber, wie man so mit einem SS-Mann reden konnte. Zweitens eine Art Verständnisinnigkeit. Jemand musste ihn gewarnt haben: Simon Kraus war der persönliche Psychiater der Ehefrauen hochrangiger Persönlichkeiten. Und somit unantastbar.
Die Vorstellung, Schutz durch Frauen zu erfahren, musste einem Mann wie Franz Beewen erbärmlich vorkommen.
»Beantworten Sie meine Frage.«
»Sie ist meine Patientin, ja.«
»Seit wann?«
»Spontan würde ich sagen, Mai oder Juni 1937.«
»Kommt sie … regelmäßig in Ihre Praxis?«
»Nicht mehr. Sie ist in Remission. Zigarette?«
Franz Beewen schüttelte verneinend den Kopf. Er beobachtete Simon aufmerksam. Dessen Lässigkeit und Unbekümmertheit mussten ihm bemerkenswert erscheinen – vor allem in Zeiten wie diesen.
Aus der Tiefe seiner wassergrünen Iris blitzte sogar eine Art Genugtuung auf. Hinter dem Karnevalskostüm und den hirnverbrannten Auszeichnungen witterte Simon, der die Frauen, aber auch die Männer kannte, einen Kämpfer. Beewen wollte, dass man ihm Paroli bot.
Simon ahnte zudem, dass er es mit einem Meister zu tun hatte. Einem Führungsmitglied der Geheimen Staatspolizei. Warum schickte man ihm diese Kriegsmaschine? Was war so wichtig?
Als hätte der Gestapo-Mann seine Gedanken gelesen, klärte er ihn plötzlich auf:
»Margarete Pohl wurde ermordet.«
8
Beinahe wäre Simon Kraus vom Stuhl gefallen. Alle Welt wurde in Berlin ermordet. Das nannte sich »Politik«. Doch eine Frau wie Margarete Pohl konnte nicht in der Schusslinie stehen: zu hundert Prozent arisch, zu hundert Prozent dem Tausendjährigen Reich ergeben, mit einem SS-Gruppenführer verheiratet, der einst Waffenbruder von Göring gewesen war.
Auf einmal sah er die Blondine wieder vor sich, die, kaum größer als er, in Seidenunterwäsche auf dem Bett tanzend schallend lachte wie Anita Berber. Seine Augen füllten sich mit Tränen. Bösen, ätzenden Tränen, als hätte ihm jemand eine Salzlösung unter die Lider gespritzt.
»Ermordet?«, wiederholte er dümmlich. »Aber … wann?«
»Ich kann Ihnen keine Details nennen.«
Simon ließ von seiner Haltung des Unbekümmerten ab und stützte die Ellbogen auf die Tischplatte.
»Wissen Sie … Ich meine, weiß man schon, wer’s war?«
Zum ersten Mal setzte Franz Beewen ein Lächeln auf, ein Grinsen, das mehr einem Kugellager als einer menschlichen Regung gleichkam. Er hatte seine Mütze abgenommen. Sein blonder Haarschopf, kurz wie Rinderfell, lud zum Streicheln ein.
»Die Ermittlungen wurden gerade erst aufgenommen.«
Simon war stocknüchtern. Unter größter Mühe versuchte er, sich zu konzentrieren.
»Wie … wurde sie denn umgebracht?«
»Noch mal: Ich kann Ihnen dazu nichts sagen.«
Kurz dachte er an ein Ehedrama. Margarete war weder der Treue noch der Keuschheit zugetan, aber ihr Mann, ein vielbeschäftigter General, kümmerte sich nicht die Bohne um sie. Das Profil des gramerfüllten Hahnreis passte keineswegs auf ihn.
Ein neuer Liebhaber?
Beewen hatte die Beine übereinandergeschlagen und ließ amüsiert den Blick über Simons Praxis und die exquisite Einrichtung schweifen. Er schien sich daran zu erfreuen, bei dem kleinen Mann in den Derbys mit den blumenverzierten Spitzen eine 180-Grad-Wendung ausgelöst zu haben. Simon war für Psychogequatsche, entartete Kunst und nutzlose Bücher zuständig. Er dagegen für Tod, Gewalt und Macht. Für die wirkliche Welt. Die moderne Welt.
»Hat Margarete Pohl Sie regelmäßig aufgesucht?«
»Wie gesagt. Wir haben die Abstände zwischen unseren Sitzungen vergrößert. Zuletzt habe ich sie vor zwei Wochen gesehen.«
»Wie haben Sie sie behandelt?«
Simon hätte die ärztliche Schweigepflicht geltend machen können, doch er hätte damit riskiert, im Kellergeschoss der Prinz-Albrecht-Straße 8 zu landen. Lieber nicht.
»Durch Reden«, entgegnete er ausweichend. »Sie hat mir ihre Beschwerden genannt, und ich habe sie mit Ratschlägen versorgt.«
»Was hatte sie für Beschwerden?«
Simon griff nach der nächsten Muratti. Er zündete sie an, um ein paar Sekunden Bedenkzeit zu gewinnen.
»Sie litt unter Ängsten«, sagte er, nervös die Asche seiner Zigarette abklopfend.
»Was für Ängste?«
Na ja, jetzt hat sie eh nichts mehr zu befürchten …
»Sie hatte Angst vor dem NS-Staat.«
»So ein Quatsch.«
»Ja, nicht wahr? Das habe ich ihr auch immer wieder gesagt.«
Die Bemerkung war ihm herausgerutscht. Der große, in die schwarze Uniform eingeschnürte Körper versteifte sich plötzlich, als ob der darunterliegende Mechanismus klemmte.
»Hat sie über ihre Beziehung zu ihrem Mann gesprochen?«
»Natürlich.«
»Was hat sie gesagt?«
Simon hatte erneut einen Flashback. Im Schlafzimmer nebenan spielte Margarete auf dem Grammophon ihr Lieblingslied, »Heute Nacht oder nie«, und wirbelte barfuß übers Parkett.
»Sie litt unter seinem Verhalten. Er hatte nie Zeit für sie. Immer viel beschäftigt …«
»Etwas genauer, bitte. Was hatte sie für eine Krankheit?«
»Ihr Verlassenheitsgefühl hat sich in Appetitlosigkeit, Tremor, Ohnmachtsanfällen, Angstzuständen und so weiter geäußert.«
Der Gestapo-Mann bohrte seinen merkwürdigen Blick in Simons Augen. Die Asymmetrie seiner Lider verlieh ihm seltsamerweise eine erstaunliche, beinahe fantastische Ausstrahlung. Etwas Geheimnisvolles, Obskures, etwas von einem einäugigen Piraten.
»Hat sie einen Liebhaber erwähnt?«
Simon zuckte zusammen – eine Falle, vielleicht. Er hatte keinerlei Vorstellung vom Stand der Ermittlungen. Er wusste noch nicht einmal, wann Margarete getötet worden war.
»Nein, nie«, erwiderte er. Dann ergänzte er in verbindlichem Ton: »Das war nicht ihre Art.«
Der Nazi-Offizier nickte nur kurz. Man konnte unmöglich wissen, was er dachte. Dieser Typ hätte heute Morgen seine Mutter verlieren können, sein undurchdringlicher Blick, getragen von einer Kinnlade wie einem Amboss, wäre derselbe gewesen.
»Wissen Sie, womit sie ihre Tage verbracht hat?«
»Nein. Da fragen Sie wohl besser ihren Mann.«
Beewen beugte sich nach vorn und stützte sich mit den Ellbogen auf den Schreibtisch, wobei Leder und Holz knarzten. Die lasierte Platte war Simon noch nie so klein vorgekommen.
»Sie muss Ihnen doch von ihrem Alltag erzählt haben.«
Simon drückte seine Zigarette aus und stand auf, um das Fenster zu öffnen. Den Tabakgeruch vertreiben. Oder vielmehr: den Druck im Raum ablassen.
»Ich will keine Verstorbene schlechtmachen«, sagte er, Verlegenheit vortäuschend, »aber Margarete hat das müßige, uninteressante Leben der Ehefrau eines wohlhabenden Mannes geführt.«
»Das heißt?«
»Friseur, Einkäufe, Kosmetiker … Oft hat sie auch ihre Freundinnen zum Tee getroffen.«
»Ich habe da von einem Klub gehört …«
»Sie hat tatsächlich dem Wilhelmklub angehört. Einer Art Literatur- oder besser: Gesellschaftssalon. Die Mitglieder treffen jeden Nachmittag im Hotel Adlon zusammen.«
Beewen lehnte sich wieder in seinen Sessel zurück.
»Ist Ihnen Frau Pohl bei Ihren letzten Treffen nervös oder ängstlich vorgekommen?«
»Wie gesagt, darum ging es in unserer Therapie.«
»Stellen Sie sich nicht dumm. Hatten Sie den Eindruck, dass sie sich vor etwas Bestimmtem gefürchtet hat? Wurde sie bedroht?«
»Nicht, dass ich wüsste, aber …«
Das Verhör ging ihm allmählich auf die Nerven. Normalerweise war er derjenige, der die Fragen stellte.
»Vielleicht können Sie mir ein paar Details zu ihrem Tod nennen? Wenn ich weiß, was passiert ist, kann ich besser auf Sie eingehen …«
»Ich bin nicht befugt, auch nur die kleinsten Details preiszugeben.«
Der Hauptsturmführer hatte seine Arme um die übereinandergeschlagenen Beine geschlungen. Er hatte große, trockene Hände mit unzähligen Schnittwunden. Die Hände eines Bauern, aber auch eines SA-Mannes, der Schnauzen poliert, Arme gebrochen, Scheiben und andere Dinge in Reichweite zertrümmert haben musste, ehe die unselige Beförderung anstand: Gestapo.
Ferner war Simon aufgefallen, dass der Offizier keinen Akzent hatte. Simon hatte Jahre gebraucht, um seinen dämlichen bayerischen Akzent loszuwerden.
»Wenn ich das richtig verstanden habe«, griff der Gast das Wort wieder auf, »hat das Opfer Sie seit fast zwei Jahren regelmäßig aufgesucht. Sie hat Ihnen von ihren persönlichen Problemen, ihren Ängsten, ihren Vorbehalten oder sonst was erzählt. Wenn es in Berlin jemanden gibt, der etwas über ihr Privatleben weiß, dann sind Sie das.«
»Noch mal: Margarete litt unter … persistentem Unbehagen. Sie hat nie eine Bedrohung erwähnt oder eine Person, die sie für gefährlich hielt.«
»Denken Sie nach.«
Simon griff nach der nächsten Muratti und zündete sie mit erhobener Nase an, was sein angestrengtes Nachdenken zum Ausdruck bringen sollte. Auf der anderen Seite der Wand stand eine Reihe von Schallplatten von jedem Treffen mit Margarete seit Mai 1937.
»Es tut mir wirklich leid. Da war nichts.«
Die meisten von Frau Pohls »Problemen« verdienten kaum die Bezeichnung Neurose, und ihre melancholische Stimmung war nicht mehr als die Lebensangst einer vernachlässigten Ehefrau. Ihr einziger Feind war die Langeweile, die sie mit ihrer Kaufsucht, mit starken Cocktails ab vier Uhr nachmittags und, ja, mit einigen Liebhabern vertrieb, ihn inbegriffen, die sie mehr oder minder erfolgreich zerstreuten.
Simon kehrte zu seiner ersten, oder vielmehr seiner zweiten, Theorie zurück. Weil sie ständig wild herumtollte und in den Niederungen der Gesellschaft schlechten Umgang pflegte, hatte sie womöglich eine verhängnisvolle Begegnung gehabt.
»Hat sie jemals einen Marmormann erwähnt?«
»Wie bitte?«
»Einen Marmormann.«
»Was meinen Sie damit? Eine Statue?«
Franz Beewen schnaubte verdrossen. Zum ersten Mal unterwarf er sich einer menschlichen Regung. Plötzlich veränderte sich sein Gesicht, wurde weicher … lebendiger.
»Das ist unser einziger Anhaltspunkt«, räumte er ein. »Sie hat ihrem Mann gegenüber mehrmals einen Marmormann erwähnt. Offenbar hatte sie Angst vor ihm.«
»Mehr hat sie nicht gesagt?«
Beewen antwortete nicht. Er schien sein Gegenüber abzuschätzen. Sogar sein Piratenauge wirkte weniger erbarmungslos.
»Nein, sie hat sich immer hartnäckig geweigert, mehr zu erzählen«, ergänzte er. »Sie hat nur gesagt, dass sie Angst hat. Große Angst. Aber wovor genau, weiß keiner …«
Simon erwiderte nichts. Er hoffte, der Zerberus würde endlich verschwinden. Er wollte allein sein. Mit seinen Erinnerungen einen letzten Walzer tanzen. Einen alten Cognac schlürfen und zu den Liedern von Mischa Spoliansky an Margarete denken.
Beewen erhob sich spontan, als wäre er direkt mit Simons Gehirn verbunden. Der Psychiater glaubte nicht wirklich an seine telepathischen Kräfte, jedenfalls nicht in diesem Ausmaß. Es war vielmehr ein Beispiel für Synchronizität, wie Carl Gustav Jung es gefallen hätte.
Der Hauptsturmführer, offenbar leicht besänftigt, griff nach Simons Federhalter und notierte seinen Namen und seine Parteimitgliedsnummer auf einer Visitenkarte.
»Denken Sie nach, Herr Kraus. Überprüfen Sie Ihre Akten und rufen Sie mich an.«
Der Psychiater konnte nur noch nicken. Seine Lider brannten, was nicht nur dem Zigarettenrauch geschuldet war.
»Machen Sie sich keine Umstände. Ich kenne den Weg.«
Er sah zu, wie der imposante Schrank über die Schwelle trat und dabei den ganzen Raum zum Beben brachte. Solche Gestalten empfing er normalerweise nicht. In der Regel kamen nur feine Wolljacken, Pelzkragen und Seidenstrümpfe zu ihm.
Simon wartete, bis die Tür zuschnappte, und schloss dann das Fenster. Der Hüne stieg in seinen Mercedes – »verkeilte sich darin« wäre der passendere Ausdruck gewesen. Simon blickte dem Wagen nach und gestattete sich ein Lächeln. Wieder einmal war er einen Schritt voraus. Hatte einen Trumpf im Ärmel.
Der Marmormann, was? Natürlich kannte er ihn. Margarete hatte ihn mehrmals erwähnt. Franz Beewen konnte Berlin bei seiner Suche auf den Kopf stellen, er würde ihn niemals finden. Der einzige Ort, wo diese Steinfigur spukte, war Margaretes Kopf. Der Marmormann erschien ihr nur im Schlaf … Er war eine Art Golem, der in ihren Träumen vorkam.
Kraus wusste noch etwas, was vielleicht von Bedeutung war. Margarete Pohl war nicht die Einzige mit diesem Syndrom. Einige weitere Patientinnen wurden von diesem Alptraum geplagt. Simon hatte das Phänomen als häufig auftretendes Symbol für die Nazi-Herrschaft oder sogar für Adolf Hitler identifiziert. Aber weshalb eine Skulptur? Aus Marmor? Simon tendierte zu einem Bild oder einem Ort, den sich die großbürgerlichen Damen eingeprägt hatten und den sie in ihren Träumen wiederverwerteten.
Er bezweifelte, dass diese geistige Schöpfung in irgendeinem Zusammenhang mit der Ermordung der kleinen Pohl stand, aber es lohnte sich trotzdem, der Sache auf den Grund zu gehen.
Das war er seiner jungen Konkubine wohl schuldig. Die mit ihrem schrillen Stimmchen »Heute Nacht oder nie« gesungen hatte.
9
Franz Beewen verabscheute solche kleinen Scheißer. Simon Kraus war ein Parasit. Ein Gigolo. Ein entarteter Mediziner.
Ein hübsches Gesicht, gewiss, aber auf einem Marionettenkörper – und dieser Gnom saß auf dem hohen Ross? Hielt ihn für einen Tölpel? Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte er ihn umgebracht, dort, auf der Stelle, in seiner bürgerlichen, mit merkwürdigem Zeug vollgestopften Wohnung (man wähnte sich fast in der Ausstellung »Entartete Kunst«, wo er 1938 die Aufsicht übernommen hatte).
Nein, für solche Parasiten war kein Platz im Tausendjährigen Reich. Derartige verschrobene Zeitgenossen führten nur zu Ausschweifungen und zur Lasterhaftigkeit. Intellektuellen-Pack. Die Intellektuellen waren die Lepra der neuen Gesellschaften. Wenn man genauer darüber nachdachte, entstellten sie den Sinn des Lebens, hörten nicht mehr den dumpfen, natürlichen, lebenswichtigen Herzschlag der Erde …
Der Zwerg hatte ihm nicht alles gesagt – es war beispielsweise offensichtlich, dass er von dem Marmormann schon gehört hatte. Aber daran sollte es nicht scheitern, er würde wiederkommen. Er würde seine Fragen wiederholen, den Psychiater unter Druck setzen, ihn auspressen wie eine faule Frucht. Und, nicht zu vergessen, seine Praxis komplett auf links drehen, wenn er nicht da war.
Und wenn die sanfte Methode nichts hergab, würde er ihn zu Hackfleisch verarbeiten. Beewen hatte zwar Tressen bekommen, aber er war nicht aus der Übung.
»Fahren wir nach Brangbo, Herr Hauptsturmführer?«
Er sah seinen Fahrer nicht einmal an.
»Nach Brangbo, ja.«
Als er zum ersten Mal in seinem Mercedes-Benz 170 gesessen hatte, hatte er geradezu Spaß daran gehabt. Das Automobil war die eiserne, lederne Verkörperung seines Erfolgs, seines Aufstiegs, seiner Macht.
Inzwischen achtete er gar nicht mehr darauf. Man gewöhnt sich an alles, sogar an das Wahrwerden der eigenen Träume. Träume, die er mit zusammengebissenen Zähnen, geballten Fäusten und Wut im Bauch verwirklicht hatte.
Er war nur noch einen Schritt von seinem Ziel entfernt, doch nun hatten diese Ermittlungen ihn überrumpelt.
Dieser kleine, pomadige Mistkerl hatte vom Ausmaß der Katastrophe ja keine Ahnung. Margarete Pohl war nicht die Erste. Am Freitag, dem 4. August, war auf der Museumsinsel die Leiche von Susanne Bohnstengel, siebenundzwanzig Jahre alt, gefunden worden. Aufgeschlitzt. Übel zugerichtet. Ohne Schuhe.
Zunächst war die Kripo mit dem Fall betraut worden, doch als sie keine Ergebnisse geliefert hatte und dann eine weitere Leiche aufgetaucht war, waren die Bullen von der Mordkommission gefeuert und die Akte der Gestapo zugeschoben worden.
Und an ihm, Franz Beewen, hängengeblieben, der auf diesem Gebiet keinerlei Erfahrung hatte. Bei der Gestapo wurden die Verbrecher nicht gesucht, sondern aus dem Ärmel geschüttelt. Die Ermittlungsakte wurde gemütlich im Büro erstellt, ehe man den Täter fasste, der in erster Linie überrascht war, wenn er von seiner Schuld erfuhr.
Doch diesmal war alles anders. Durch Berlins Straßen spazierte ein echter Mörder, der die Ehefrauen von Persönlichkeiten aus den höchsten Nazi-Kreisen angriff, und ausgerechnet er war dafür zuständig, ihn zu fassen. Scheiße!
Die Fahrt nach Brangbo würde eine gute halbe Stunde dauern. Er versank in seinem Sitz und rekapitulierte sämtliche Ermittlungen.
Am 4. August war an der Nordspitze der Museumsinsel in Berlin-Mitte am Spreeufer also die Leiche einer jungen Frau entdeckt worden. Sie war Am Kupfergraben, gegenüber dem Bode-Museum, am Westufer des Flusses abgelegt worden.
Es war ein Leichtes gewesen, das Opfer zu identifizieren: Sie trug noch ihre Kleidung und ihre Tasche bei sich. Susanne Bohnstengel, geboren 1912 in Ansbach, Mittelfranken, Bayern, als Susanne Scheydt. Frau von Werner Bohnstengel, Lieferant von Einzelteilen für die Wehrmacht. Der NS-Regierung sehr nahestehend.
Max Wiener, Kriminalinspektor bei der Sicherheitspolizei und Ermittlungsleiter, war auf gewohnten Gleisen geblieben: Sie hatten auf der Suche nach Zeugen den Stadtteil durchkämmt, den Gefängniswärtern den Marsch geblasen (obwohl man dieser Tage leichter hinein- als herauskam), die Berliner Verbrecherwelt auf den Kopf gestellt …
Die Autopsie der jungen Frau hatte zur gleichen Zeit ergeben, dass sie grausam verstümmelt worden war. An ihrem Hals klaffte eine offene Wunde. Die Stichwaffe (Messer oder Dolch) hatte die Drosselvene und die äußere Halsschlagader sowie Gefäße in Kehlkopf und Schilddrüse durchtrennt.
An diesen Verletzungen, die starke Blutungen zur Folge hatten, war das Opfer gestorben. Doch es waren weitere Angriffe erfolgt. Eine Reihe von Wunden auf der linken Seite ließ annehmen, dass die Frau sich gewehrt und zu schützen versucht hatte, während der Mörder ihr die Arme über dem Kopf festhielt – die Verletzungen reichten bis in die Achselhöhle. Die Innenseiten sämtlicher Finger wiesen tiefe Schnittwunden auf. Manche Glieder hingen nur noch an einzelnen Fäden. Die Frau hatte die Klinge gepackt, die sie so übel zurichtete.
Der Mörder hatte sich auf den Bauch gestürzt. Ein großer, tiefer Einschnitt verlief von links unterhalb des Zwerchfells schräg hinunter bis zum Blinddarm. Zwei weniger tiefe, demselben Verlauf folgende Wunden belegten, dass der Mörder mehrere Versuche unternommen hatte, ehe es ihm gelang, die Stichwaffe bis zum Griff in den Bauch seines Opfers zu stoßen und ihn buchstäblich entzweizureißen.