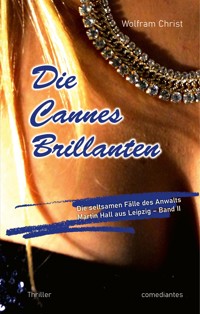Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: comediantes - Verlag für Lyrik und Belletristik des 21. Jahrhunderts
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Erinnern Sie sich an den Juwelenraub im Grünen Gewölbe in Dresden? Obwohl sich viele Fachleute damals sicher waren, eine solche Tollheit könne nur die Auftragsarbeit eines Sammlers gewesen sein, in dessen Tresor die unbezahlbaren Preziosen nun für immer verloren seien, tauchte ein Teil davon später wieder auf. Was war schiefgegangen? Die Antwort, die der Autor in diesem Kriminalroman liefert, ist so einfach wie verblüffend: Die Gangster hatten nicht mit Marina Casanova aus Köln gerechnet! Rückblende. Im Frühsommer 2020 gerät die junge Kunsthistorikerin in Italien zufällig in den Strudel jener Geschehnisse. Anders als in Deutschland vermutet, sind internationale Interessen im Spiel. Und selbst die 'Ndrangheta will ein Wörtchen bei der Sache mitreden. Marina erkennt schnell, dass sie eingreifen muss. Wie ihre Lieblingsromanheldin, Agatha Christies Miss Marple, braucht sie dafür aber keine Waffe. Charme und gesunder Menschenverstand genügen vollkommen. Und gute Freunde.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 305
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wolfram Christ
Die merkwürdigen Abenteuerder Marina Casanova aus Köln:Dresdener Preziosen
Kriminalroman
1. Auflage / Eibenstock
© 6.4.2024 www.comediantes.de
Lektorat: Juliane Renn, Larissa Carolin Böttcher, Uta Christ
e-book / EPUB
ISBN 978-3-946691-38-9
Mein ausdrücklicher Dankgilt den Kölschen Harlequins derKarnevalsgesellschaft Alt-Köllen vun 1883 e.V.
Liebe Harlequins,am Anfang stand eine Idee. Dann fand ich Euch.Mit Euch die schwierige Session 2022,das unglaubliche Feuer Eurer Darbietungen erleben,Euch mit meinen Fragen löchern undmich ein bisschen wie ein Teil von Euch fühlen zu dürfen,hat Marina Casanova wachgeküsst.Danke!
Harlequins e Levve lang!
Ein weiterer Dank geht an dieVG Wort,die mir mit ihrem Stipendium aus dem Programm
der Bundesrepublik Deutschlanddie Recherchen in Köln und Italien ermöglichte!
Anmerkung
Alle Ereignisse und Namen sind frei erfunden.Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Geschehnissen undlebenden Personen sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel
Titel
Orientierungsskizze I
Kapitel1
Erwartungen
Kapitel2
Marina
Kapitel3
Ansichtssachen
Kapitel4
Begegnungen
Kapitel5
Starhemberg
Kapitel6
Überraschungen
Kapitel7
Entscheidungen
Kapitel8
Kevin
Kapitel9
Adrienne
Kapitel 10
Wahrheiten
Kapitel 11
Absprachen
Kapitel 12
Aufbrüche
Kapitel 13
Spekulationen
Kapitel 14
Affairen
Kapitel 15
Mario
Kapitel 16
Nachrichten
Kapitel 17
Polizisten
Kapitel 18
Verräter
Kapitel 19
Gastspiele
Kapitel 20
Katastrophen
Kapitel 21
Nachwehen
Orientierungsskizze II
Kapitel 1 – Erwartungen
Es hätte nach Sommer riechen sollen. Stattdessen? Scharfe Reinigungsmittel, Metall, Schweiß, Frust. Der typische, klimatisierte Mief von Eisenbahnwaggons an heißen Frühsommertagen. Und im Kopf? Wut. Marina fröstelte. Das würde sich ändern. Sie würde es ändern. Genau jetzt, an diesem späten Sonntagvormittag, fing sie damit an. Ja, sie würde ihr Leben ändern. Komplett! Jedenfalls für eine Weile. Hoffentlich.
Langsam setzte sich der ICE in Bewegung. Er verließ die Halle. Draußen blieben Dom und Domplatte zurück. Mit Menschen darauf und der Philharmonie darunter. Museum Ludwig, Rheinufer. Dann verdarben stählerne Streben den Ausblick. Die schnellen Lichtwechsel auf der Brücke brannten in ihren Augen, schmerzten im Kopf. Sie wandte sich ab.
Marina Casanova wollte weg. Einfach nur weg. Wenigstens für ein paar Tage. Irgendwohin, wo sie ihren siebenundzwanzigsten Geburtstag ungestört feiern konnte. Irgendwohin, wo feiern noch, oder genauer gesagt, seit kurzem wieder, erlaubt war. Nach Italien. Von Deutschland hatte sie bis auf weiteres gestrichen die Nase voll.
In weitem Bogen schwenkte ihr Zug nach Süden, der Sonne entgegen. Köln winkte ihm ein letztes Lebewohl. Schiffsanlegestellen, Altstadtkneipen. Die Kranhäuser wirkten von hier aus eher wie Galgen, fand Marina. Prima geeignet, um sich dran aufzuhängen. Passend zu diesem beknackten Jahr 2020. Sollten die Eigentümer vielleicht als PR-Gag in ihr Marketingkonzept einbauen. Galgenhumor im wahrsten Sinne des Wortes. Marina verkniff sich ein Grinsen. Im nächsten Moment fragte sie sich, wozu eigentlich? Hätte unter der blöden Maske eh niemand gesehn.
Eintauchen ins Häusermeer von Köln-Deutz. Vorbei am geschwungenen Dach der Lanxess-Arena. Bis letztes Jahr steppte da drin regelmäßig der Bär. Letztes Jahr. Lang her. Ewig. Irgendwo dahinter lag ihre kleine Studentenbude. Am Gotenring. Ziemlich tote Ecke. Aber von da aus waren es nur ein paar Schritte bis zur Deutzer Freiheit mit ihrem bunten Gewimmel zwischen Kneipen, Dönerbuden und Zigarrenläden. Nicht, dass sie Zigarren geraucht hätte, aber irgendwie ging von solchen Orten etwas Anheimelndes aus. Ein Gefühl von Beständigkeit, das sich wohltuend vom Tempo der modernen Großstadt abhob.
Vor allem aber gab es an der Deutzer Freiheit ein Hinterhaus und darin die Pizzeria »Diana«. Wie die Göttin der Jagd. Allerdings hatte die Namensgebung profanere Gründe. Die Mama des Kochs hieß so. Die »Diana« war Marinas absolute Lieblingskneipe. Ein bisschen versteckt und urgemütlich. Ein guter Ort, sich ungestört mit Freunden zu treffen. Die jungen Wirtsleute, kölsche Italiener in dritter Generation, boten originelle Leckereien aus saisonalem Anbau und garantiert von regionalen Höfen. Und das zu Preisen, die sich selbst Studenten leisten konnten. Nicht zu vergessen hausgemachte Klassiker: Verschiedene Pesto-Soßen und … das Diana-Tiramisu! Das war jede Sünde wert.
Vorbei. Auch diese Pizzeria hatte wegen Corona schließen müssen. Klar, die durften noch außer Haus Verkauf auf Bestellung machen, aber was war das schon für ein Ersatz? Allein zu Hause konnte sie selber kochen. Alles, was Marinas bisherige Welt ausgemacht hatte, schien ausgelöscht. Verboten, verboten, verboten. Die kleinen Kinder durften bei schönem Wetter noch nicht mal auf den Spielplatz. Idiotisch. Die Menschheit verblödete vorm Fernseher oder in bescheuerten Fake-News-Foren im Netz und wurde darüber fett. Oder besoffen. Oder beides.
Marinas Leben fühlte sich an, als wäre es bereits vorüber, bevor es richtig beginnen konnte. Sie hätte Trauer empfinden sollen. Wenigstens etwas Wehmut. Stattdessen? Erleichterung. Erleichterung? Tatsächlich Erleichterung. Je länger die junge Frau nachdachte, desto mehr schien es ihr, nicht nur ein bisschen zu verreisen. Nein, es war als würde sie ihre alte Existenz abstreifen, damit ab morgen eine neue beginnen konnte. Jedenfalls hoffte sie inständig, dass es so käme. Irgendwie. Keine Ahnung. Sie wollte die vergangenen Wochen vergessen. Sie hatte lange genug geheult. Angestrengt starrte sie aus dem Fenster. Das Atmen fiel ihr schwer. Sie zupfte die vorschriftsmäßig übergestülpte Maske etwas tiefer, bis die Nase frei lag. Besser.
Nicht besser, denn der aufgestaute Ärger blieb. Vor allem der über den Einstellungsstopp im Museum, der sie nach endlich erfolgreichem Ende ihres Masterstudiums unerwartet zum Nichtstun verurteilte. Nicht mal ein kleines Praktikum war plötzlich mehr möglich. Und das, obwohl sie vom MAKK, dem Museum für Angewandte Kunst Köln, noch vor ein paar Monaten eine feste Zusage erhalten und sich deshalb mit ihrer Masterarbeit extra beeilt hatte. Tag und Nacht hatte sie geschuftet. Trotz der widrigen Umstände hielt sie jeden Termin ein.
Für die Katz! Das MAKK wurde wie alle anderen Museen im Land geschlossen. Die Leitung nutzte die Schließung zu Umbauarbeiten. Praktika oder gar Neueinstellungen standen bis auf weiteres nicht zur Debatte. Marina schloss die Augen. Keine Träne. Nein. Sie hatte genug geweint.
Zur gleichen Zeit an einem Ort, etliche tausend Kilometer südöstlich von Köln. Der Zeitzone wegen zeigte die Uhr allerdings bereits zwei Stunden später. Ein entspannter Sonntagnachmittag. Breite, mit kunstvollen Intarsien aus edlen Hölzern bedeckte Türflügel schwangen auf. Ein Mann eilte herein, blieb kurz stehen, verneigte sich und legte wortlos ein Schreiben auf das niedrige Tischchen. Der Raum duftete nach frischgebrühtem Tee, aufgeschnittenen Früchten und aromatischem Tabak. Ein anderer Mann, der an diesem Tisch zwischen zahllosen Kissen auf weichen Teppichen am Boden ausgestreckt lag, sog versonnen an seiner Wasserpfeife. Er blickte nur kurz zu dem Neuankömmling auf. Einen Augenblick schien er zu überlegen, ob er den Brief lesen sollte. Er entschied sich anders.
»Ist es soweit?« fragte er.
»Ja, Sir. Sie passieren in diesen Minuten die italienische Grenze.« Der andere nickte. Schweigen. Nach einer Weile richtete er sich auf und betrachtete das vor ihm liegende Papier.
»Wie bald müssen wir aufbrechen?«
»Das hat Zeit, Sir. Unsere Partner wollen sichergehen, dass die Abwicklung kein Aufsehen erregt. Sie fürchten, möglicherweise unter Beobachtung zu stehen.«
»Verstehe.«
»Zudem haben die Leute genügend Neider, die nur auf eine Gelegenheit warten, sie ans Messer zu liefern.«
»Heißt?«
»Vielleicht in einem Monat.«
»So lange?« Er wirkte enttäuscht.
»Die Sache hat in Deutschland hohe Wellen geschlagen, Sir.«
»Haben wir trotzdem schon Grund, zu feiern?«
»Ja, Sir. Ich bin zuversichtlich, dass die größten Schwierigkeiten mit dieser Nachricht überwunden sind.« Erleichtert nahm der Mann am Boden einen tiefen Zug aus seiner Pfeife und lehnte sich zurück in die Kissen.
»Gut. Bereiten Sie alles vor. Am Montag wird mein Onkel unsere Pandemieverordnung bis auf weiteres außer Kraft setzen. Es scheint überstanden. Höchste Zeit. Ich wünsche ein rauschendes Fest mit allem, was Spaß macht. Sparen Sie nicht. Solche Momente muss man genießen.«
»Welchen Grund soll ich in der Einladung nennen? Das Ende des Lockdowns?«
»Natürlich, Dummkopf. Das andere geht niemanden etwas an. Wir feiern das Leben. Lassen Sie sich was einfallen!«
Immer noch zur gleichen Zeit auf der anderen Seite des Erdballes, in Downtown Santa Barbara. Den Zeigern der Uhr nach jedoch elf Stunden früher als am Persischen Golf und neun früher als in Köln. Die Morgendämmerung lag in weiter Ferne. Eine sternlose Nacht. In die Dunkelheit hinein glänzten lediglich einige Straßenlaternen der State Street und die Lichter am Eingang zum Arlington Theater. Abgesehen von den Lampen wirkte das Haus recht schmucklos. Es war im Stile alter Missionskirchen errichtet. Drinnen jedoch erwartete unverhofft Eintretende eine Überraschung, eine Art Zeitreise. Eine Reise in jene Epoche, da sich die kalifornische Pazifikküste in der Hand spanischer Caballeros befand. Der Saal bot nämlich die fast perfekte Illusion eines früheren mexikanischen Dorfes. Und das Publikum saß mittendrin auf der unvermeidlichen Plaza. Allerdings in äußerst bequemen, tiefblauen Sesseln unter einem schwarzen Nachthimmel. Und dieser hier hing selbstverständlich voller Sterne. Ringsum windschiefe, farbenfrohe Häuschen, hinter deren geöffneten Fenstern sich die Logen des ersten Ranges verbargen.
In einer der Logen dehnte sich Magdalena Leszczynska-Lancaster, umgeben von ihrer üblichen Entourage und einigen ausgewählten Gästen. Es war ein illustrer Haufen, der sich um diese späte beziehungsweise frühe Stunde im Arlington Theater versammelt hatte. Kein Wunder, handelte es sich beim eben zu Ende gegangenen Bühnenspektakel doch um eine nächtliche Privatvorstellung. Anderes ließen die strengen Corona-Regeln des Bundesstaates gar nicht zu. Und selbst die hätte an und für sich nicht stattfinden dürfen. Allein, es war eben nicht irgendwer, der hier die Strippen zog. Nein, es war Magdalena Leszczynska-Lancaster. Sie galt als eine der wichtigsten Kunstmäzene der Stadt. Natürlich entlohnte sie das Arlington-Ensemble großzügig für derartige illegale Genüsse. Es gab also mehr als einen Grund, dass die kalifornischen Behörden in ihrem Fall beide Augen zudrückten.
Apropos Augen. Magdalena Leszczynska-Lancaster schloss die ihren verzückt, als wolle sie das eben dargebotene Spiel genüsslich im Kopf Revue passieren lassen. Neben ihr hüstelte jemand. Sie öffnete die Lider einen Spalt. Ein Laut des Unwillens entfuhr ihr. Da der Mann jedoch hartnäckig weiter hüstelte, gab sie schließlich nach.
»William, wollen Sie schon nach Hause? Hat es Ihnen nicht gefallen?«
»Doch, schon, nur …«
»Nur was? Wenn es etwas Dienstliches ist, hat es dann nicht bis Montag Zeit? Kommen Sie, Sie Unhold, was kann es denn so Unvermeidliches geben, dass Sie ausgerechnet jetzt in mein Elysium einbrechen müssen?«
»Verzeihen Sie, königliche Hoheit!« Der Anwalt wirkte verlegen. Die Frau schüchterte ihn ein. Er wollte daher schnell sein Anliegen vorbringen, kam jedoch nicht zu Wort.
»William, wie oft soll ich Ihnen noch verbieten, mich so anzusprechen? Wir leben in einem freien Land. Ich heiße einfach Leszczynska-Lancaster. Merken Sie sich das!«
»Wie königliche … äh … Frau Leszc…«, er hüstelte erneut. »Es gibt Neuigkeiten aus Europa. Ich erhielt sie vor wenigen Minuten und ich glaube, dass …«
»Aus Europa? Lassen Sie hören!«
»Das Kleinod ist auf dem Weg.«
»Hört, hört. Und unser Mann vor Ort?«
»Hat Verbindungen geknüpft.«
»Verbindungen geknüpft? Ich erwarte keine Verbindungen, ich erwarte Ergebnisse. Sagen Sie ihm das.«
»Das werde ich.«
»Gibt es einen Zeitplan?«
»Noch nicht, aber ich schätze, dass die Aktion in den nächsten zwei, drei Wochen über die Bühne gehen wird.«
»Das will ich hoffen, William, das will ich hoffen. Apropos Bühne: Lassen Sie uns in die Künstlergarderobe gehen. Ich fand den Hamlet heute Abend grandios. Ich muss ihm unbedingt meine Aufwartung machen. Kommen Sie, meine Freunde.« Keinen Widerspruch duldend, rauschte Magdalena Leszczynska-Lancaster davon.
Ihr Anwalt blickte der Dame und dem Schwarm ihrer Günstlinge nach. Es wurde still. William Hammersmith stand ganz allein am Fenster der Loge und blickte über das Meer aus 2000 tiefblauen Sesseln. Eine surreale Situation. Er, der Mann, der gewöhnlich vor Gericht die Puppen nach seiner Pfeife tanzen ließ, allein in dieser überwältigenden Kulisse eines luxuriös bestuhlten mexikanischen Dorfes. Als Marionette an den Fäden einer blaublütigen Polin. Damit konnte er nicht umgehen. Wo kam der eisige Windhauch her? Wahrscheinlich vom Airconditioner über seinem Kopf.
Kapitel 2 – Marina
Sitzpose, Schultersteher, Wurf, Gassenwurf, Überwurf, Salto. Gedankenverloren ging Marina alle Tanzfiguren durch, die ihr einfielen. Draußen verschwanden die letzten Häuser der Stadt. Grüne Wiesen, Wälder, Felder. Marina schluckte. Nein, sie würde nicht heulen. Nicht mehr. Sie war ein Kölsches Mädsche, ein »Kölscher Harlequin«. »Harlequins e Levve lang!« lautete das Motto ihrer Tanzgruppe. Echte Harlequins beißen die Zähne zusammen und lachen, auch wenn mal was schmerzt. Einer für alle, alle für einen. »Du bes nit allein«, wie es im Karnevalslied so schön hieß. Das war wie bei den Musketieren. Sie konnten nur erfolgreich sein, wenn sich niemand hängen ließ, wenn man einander unter die Arme griff, wenn man sich auf den Partner, die Partnerin verlassen konnte. Einhundertprozentig! Das hatte sie deutlich zu spüren bekommen, als es mit dem Lockdown losging.
Sie hatten die Session 2019/2020 Gott sei Dank zu Ende bringen können. Auftakt am 11.11., da gab‘s noch keinen Virus. Höchstens als kurze Info in den Nachrichten. Nach Silvester die großen Volkssitzungen im Festzelt auf dem Neumarkt. Dieses komische Corona schien nach wie vor ziemlich weit weg, irgendwo in China. Dann im Februar Weiberfastnacht, Rosenmontagszug, Party in allen Kneipen und Dienstag um Mitternacht das Finale: Nubbelverbrennung mit der Prinzengarde draußen in Frechen. Eine schöne Tradition. An allen Dummheiten, die in den tollen Tagen passierten, war nur der Nubbel schuld. Fröhlich wurde sein Ende gefeiert, wohl wissend, dass er im kommenden Jahr zurückkehren würde. Quasi wie Phönix aus der Asche.
Zu der Zeit schwebte das Gespenst kommender Verbote schon über ihren Köpfen. Sie hatten es zu verdrängen versucht. »Et kütt wie et kütt.« hieß es. Und: »Et hätt noch immer jotjejange.« Also »Es kommt wie es kommt und es ist noch immer gut gegangen.« Kölsche Weisheiten, mit denen die Jecken sich Mut gemacht hatten.
Was dann aber kam, war schlimmer als die schlimmsten Befürchtungen: Sie durften nicht mehr in ihre Trainingshalle nach Köln-Ehrenfeld! Überhaupt nirgends durften sie mehr hin. Sie durften nicht zusammen trainieren, feiern, Spaß haben. Für einen Kölschen Harlequin die Höchststrafe!
Seit zehn Jahren gehörte Marina nun schon zu der fröhlichen Truppe. Genauso lange, wie es die Harlequins gab. Sie war dabei gewesen, damals, als der Vorstand beschloss, die »Karnevalsgesellschaft Alt-Köllen vun 1883 e.V.« müsse frecher, jünger und weiblicher werden. Gesagt getan.
Ihre Gruppe wuchs schnell. Und sie war anders als die bei anderen Vereinen üblichen Funkengarden. Das ging schon bei den Kostümen los. Harlequins trugen natürlich keine Uniformen. Kleider und Anzüge boten dem Auge ein Feuerwerk aus grün-weiß-roten Rautenmustern, wie man sie vom klassischen Harlequin der Commedia dell‘Arte kannte. Eine Renaissance der Renaissance gewissermaßen. Italienisches Lebensgefühl. Quirlig und bunt. Besonders wichtig: Es gab von Beginn an mehr Tanzpaare. Mädchen und Jungs wirbelten gemeinsam über die Bühne. Ein gutes Gleichgewicht stellte sich ein. Die Folge: Weniger Eifersüchteleien und weniger Konkurrenzdenken als bei anderen, bei denen es nur ein einziges Paar gab, den Tanzoffizier und die Marie. Die gab es bei den Kölschen Harlequins als »erstes Paar« und Vortänzer zwar auch, aber niemand hatte es nötig, sich in diese Solorolle »hochzuschlafen«, denn jede bekam irgendwann ihre Chance, sich mal von ihrem Partner werfen zu lassen oder auf seinen Schultern einen Sonderapplaus zu bekommen. Marina hatte in der Gruppe ihre besten Freundinnen und Freunde gefunden.
Ihr Tanzpartner Kevin zum Beispiel, genannt »Tarzan«, war zwar manchmal ein bisschen eitel, meist ziemlich albern, und er hielt sich für den größten Aufreißer aller Zeiten. Aber davon ganz abgesehen wusste sie, dass sie mit dem Kindskopf hätte Pferde stehlen können. Wenn es drauf ankam, war Tarzan für sie da. Wenn er sie in die Luft hob, sie mit einer Hand in die Höhe stemmte, fühlte sie sich sicher. Der Mann wusste, wie er sie halten musste. Er verstand jedes noch so kleine Signal, das sie ihm gab. Auf der Bühne verschmolzen sie regelrecht zu einer Einheit.
Dabei hatte sie zuerst Angst gehabt, so leichtbekleidet bei einem Fremden auf den Schultern zu sitzen, von ihm womöglich begrabscht zu werden. Ja, sie war sehr schüchtern gewesen. Aber das legte sich mit jeder Trainingseinheit ein bisschen mehr. Das, was sie hier auf den Bühnen des Kölner Karnevals trieben, das hatte nichts Anrüchiges. Das war Sport, Hochleistungssport. Da ging es um Perfektion, nicht um peinliche Hintergedanken. Das machte sie stark, gemeinsam. Wenn die Leute sie bewunderten, klatschten, jubelten, dann wussten sie, dass sie alles richtig gemacht hatten. Das war Marinas Leben. Bis Februar.
Plötzlich war Schluss gewesen. Mit allem. Von einem Tag auf den anderen. Sie sollten sich nicht mehr sehen dürfen, nicht mehr miteinander trainieren, gar nichts. Auch in die Uni durfte Marina nicht mehr. Zum Glück lief dort zuvor schon ziemlich viel digital. An ihrer Masterarbeit über »Modeschmuck und Kunsthandwerk im Zeitalter des Barock« schrieb sie sowieso meist zu Hause. Diese Umstellung zumindest funktionierte für die Studentin im Fach Kunstgeschichte an der Philosophischen Fakultät relativ reibungslos.
Weil das nicht nur an der Uni halbwegs klappte, sondern auch in vielen Schulen und bei manchem Arbeitgeber, kamen die jungen Leute auf die Idee, online miteinander zu trainieren. Einfach, um nicht aus der Übung zu kommen und den Kontakt nicht zu verlieren. Ergo, die Computerfreaks ihrer Truppe fanden Mittel und Wege, alle am Bildschirm zusammenzuschalten. Die Trainerin gab den Takt vor und fortan übte jeder daheim für sich und doch mit allen anderen gemeinsam. Was sich zwar etwas merkwürdig anfühlte und zu mancher familiären Krise führte. Vor allem, wenn die Wohnung klein war und die Mitbewohner oder Nachbarn eine niedrige Toleranzschwelle besaßen. Aber es ging. Irgendwie. Etliche blieben dann hinterher weiter am Bildschirm zusammen, um zu zocken. Computerspiele. Das war alles okay. Nicht wirklich befriedigend, aber okay. Wie sich nach und nach herausstellte, stieg bei vielen an solchen Abenden der Alkoholpegel. Aus Frust, Angst, später Trauer um liebe Angehörige, die es nicht geschafft hatten.
Es war eine trostlose Zeit gewesen. Nicht einmal eine ordentliche Abschlussfeier an der Uni hatte stattfinden dürfen. Und dann, als krönender Höhepunkt, die Absage des Museums. Klar hatte sie sich anderweitig umgehört, aber die Situation war nirgends besser. Alles, was mit Kunst und Kultur, Ausstellungen oder sonstigen öffentlichen Ereignissen zu tun hatte, war verboten. Nicht nur in Köln. Überall. Das Kulturland Deutschland hatte den Betrieb eingestellt. Seine Bewohner glichen den Mangel an Abwechslung mit gegenseitigen Beleidigungen und Beschimpfungen in ihren (a)sozialen Netzwerk-Blasen aus.
Marinas Vater hatte ihr angeboten, übergangsweise wieder daheim einzuziehen. Ihre Mutter meinte, im Supermarkt würden ungelernte Hilfskräfte gebraucht. Einen Moment hatte Marina tatsächlich über so eine Option nachgedacht. Aber der Moment dauerte nicht sonderlich lang. Einfach so hinschmeißen und ihre Träume aufgeben? Nein, soweit war sie noch nicht. Sie hatte ein bisschen was angespart und die BAföG Rückzahlung würde erst in ein paar Jahren fällig sein. Was sprach also dagegen, jetzt, wo in anderen Ländern das schlimmste überstanden schien und beispielsweise in Italien die ersten Museen wieder öffneten, nach Süden zu reisen, um sich im Mutterland der Kunst weiterzubilden, die Sonne zu genießen? Wer weiß? Es hieß ja, die Männer dort seien attraktiv und charmant. Am Koch ihrer Pizzeria »Diana« zum Beispiel hätte Marina wirklich wenig auszusetzen gehabt, wäre der nicht schon verheiratet gewesen. Nein, es sprach nichts dagegen, das ganze deutsche Jammertal für ein paar Wochen hinter sich zu lassen. Vielleicht würde die Situation hier bei ihrer Rückkehr auch wieder normaler sein. Kommt Zeit, kommt Rat. Marina lehnte sich in ihrem Sitz zurück. Das gleichmäßige Surren des ICE, die vorbeifliegenden Landschaften und ihre trüben Gedanken hatten sie müde gemacht.
In einem kleinen Kaff namens Pietrapaola, hoch oben in den kalabrischen Bergen, da, wo sich beim italienischen Stiefel der Fußspann befindet, so ungefähr jedenfalls, ruhte das Leben. Der Gottesdienst war vorüber, das Städtchen gönnte sich seine Auszeit. Die hochbetagte Donna Antonia nutzte die stille Stunde, um sich ihren zumindest in ihren Augen reichlich missratenen Sohn zur Brust zu nehmen. Ein Ritual, das sich jeden Sonntag ziemlich genau um die gleiche Zeit wiederholte. Familientradition gewissermaßen. Und wehe, der Bengel versäumte die Audienz bei seiner Mutter.
Wie immer herrschte in der stickigen, mit Erinnerungen vollgestopften Kammer unterm Dach Gewitterstimmung. Donna Antonia sah ihrem Sprössling ernst in die Augen.
»Söhnchen, willst du nicht endlich anfangen, Gutes zu tun? Bald wirst du 65 und du weißt, dass das für einen Mann in dieser Gegend ein fast schon biblisches Alter ist. Willst du nicht, dass deine Mutter stolz auf dich sein kann, bevor sie für immer ihre Augen schließt?«
»Aber Donna, ich tue Gutes, wo immer ich kann. Ich spende regelmäßig in der Kirche für die Armen, …«
»Papperlapapp. Du weißt genau, was ich meine. Es muss doch möglich sein, dass du dein Geld wenigstens einmal im Leben mit edlen und wahrhaft schönen Dingen verdienst.«
»Donna, da kann ich Sie beruhigen.« Don Alberto, der mächtigste Mann im Ort, zeigte ein überlegenes Lächeln. »Gerade planen wir ein wunderbares Geschäft. Dabei geht es tatsächlich um etwas Edles und sehr Schönes.«
»So? Dient die Sache auch einem guten Zweck?«
»Aber natürlich! Mama, Sie kennen mich. Ich werde einer hochgestellten Persönlichkeit helfen, ihr rechtmäßiges Erbe zurückzuerhalten. Eine großartige Geschichte.«
»Großartig? Soll ich dir was sagen, Alberto, gerade weil ich dich kenne, mache ich mir Sorgen. Du bist ein Angeber und Großmaul und Tunichtgut.«
»Aber Mama …«
»Nein, widersprich mir nicht. Nun gut, ich gebe die Hoffnung nicht auf, das habe ich deinem Vater selig versprochen. … Sag mir die Wahrheit, ist das auch ein ehrliches Geschäft, bei dem du ehrliches Geld verdienst?«
»Und ob! Die Person wird uns für unsere Dienste königlich entlohnen. Einen Vorschuss haben wir bereits.«
»Euro?«
»US-Dollar.«
»Hm. Gefährlich?«
»Keineswegs. Wir müssen lediglich ein paar kleinen Gaunern die Kehlen durchschneiden und ihnen ihre Beute abknöpfen. Fertig. Genau genommen übernehmen wir die Arbeit der Polizei, denn es handelt sich um wirklich dreiste Diebe, die keinen Respekt zeigen. Sie wissen, wie schwer sich unser sogenannter Rechtsstaat mit solchen Halunken tut.«
»Keine Erpressung? Mädchenhandel?«
»Nein.«
»Hat es was mit Drogen zu tun?«
»Donna, Sie wissen, dass ich das Drogengeschäft Ihrem Enkel, meinem Ältesten, dem Gino in Düsseldorf, überlassen habe.«
»Das ist ja das Schlimme. So habe ich mir die Lösung des Problems nicht vorgestellt. Aber gut. Gibst du deinen anderen beiden Söhnen, die hiergeblieben sind …«
»Sie meinen Luigi und Mario?«
»Die meine ich. Gibt es für sie in deinem neuen Projekt wenigstens auch anständige Arbeit?«
»Aber das versteht sich von selbst!«
»Näheres kannst du mir wohl nicht erzählen?«
»Diskretion.«
»Das ist wichtig, gewiss. … Apropos, meine Freundin Mathilda erzählte mir in der Kirche, es hätte heute Nacht eine Schießerei gegeben. Mit der Polizei. Unten in der Marina von Cariati. Nicht sehr diskret, wie mir scheint. Weißt du etwas davon?«
»Och das.« Don Alberto grinste. »Ich würde es nicht ›mit der Polizei‹ nennen. Die haben sich gegenseitig ein paar blutige Köpfe verpasst. War ‘ne Idee von Pasquale. Damit sie in den nächsten Wochen mit sich selber beschäftigt sind und ihre dreckigen Nasen nicht so tief in unsere Angelegenheiten stecken. Ein kleiner Denkzettel für die Bullen, mehr nicht.«
»Alberto, sprich nicht so ordinär!«
»Ja, Mama.« Der Don senkte schuldbewusst seinen Kopf.
»Ein Dummejungenstreich demnach. Ich hoffe, du hast da nicht mitgemacht?«
»Bewahre, wo denken Sie hin, Donna?« Er wurde rot, hüstelte verlegen und fügte schnell hinzu:
»Ich habe Ihnen doch gerade erzählt, dass ich …«
»Du sollst mich nicht anlügen!«
»Ja, Mama.«
»Gut. Schwamm drüber. Also die Sache, die du vorhast, das ist wirklich ein sauberes und sicheres Unternehmen?«
»Sie können mir vertrauen, Mama! Wir verhelfen der Gerechtigkeit zum Sieg. Die Bösen bekommen ihre Strafe, die Guten den Lohn.«
»Amen. Wenn‘s mal so wäre …«
»Es ist so!«
»Ich weiß was ich weiß. Du bist leider ein naiver Simpel und wirst es immer bleiben. Hoffentlich hauen sie dich nicht übers Ohr. Aber gut, meinen Segen hast du. Geh mit Gott und beeil dich, damit ich es noch erlebe.«
»Selbstverständlich, Donna.«
»Schön. Nun, ich denke, es ist an der Zeit für meinen Mittagsschlaf. Er wird mich erfrischen, bei dieser Hitze.«
»Soll ich Ihnen die Klimaanlage einstellen?«
»Wie oft muss ich dir sagen, du sollst mich mit diesem neumodischen Unfug in Frieden lassen! Willst du mich umbringen? Soll ich eine Lungenentzündung bekommen? Das könnte dir so passen! Verschwinde, Nichtsnutz. Und berichte mir, wie dein Projekt vorankommt.«
»Selbstverständlich, Donna.«
»Dass du mir nichts verschweigst!«
»Selbstverständlich.« Don Alberto erhob sich eilig. Er verkniff sich jede weitere Bemerkung, küsste seine Mutter auf die Wange und ging. Hätte die kalabrische Polizei dem Mann Wanzen ins Jackett geschmuggelt, sie hätte ihn beim Verlassen des Zimmers deutlich ein Stoßgebet grummeln hören:
»Herr im Himmel, nimm die Alte endlich zu dir. Ich halt‘s nicht mehr aus!« Unten, vor der Treppe angekommen, hielt er inne, reichte ein »Vater unser« nach und bat seiner unreinen Gedanken wegen um Vergebung. Dann brüllte er quer über den stillen Hof seines Hauses:
»Mario! Luigi! Pronto!«
Marinas Reise verlief vergleichsweise ereignisarm. Die Chancen auf nette Zugbekanntschaften standen denkbar schlecht. Die Apelle, daheim Urlaub zu machen, trugen Früchte. Spätestens am Abend in München leerte sich die ohnehin spärlich besetzte Bahn. Denn Schengen hin, Freizügigkeit her, ohne negativen PCR-Test ließen weder Österreich noch Italien jemanden ins Land. Und im Frühsommer 2020 war es nicht leicht, überhaupt tagesaktuelle Tests zu bekommen. Eigentlich sollte möglichst nur reisen, wer einen guten beruflichen Grund dafür vorweisen konnte. Marina sah sich für entsprechende Fragen der Grenzkontrolleure gewappnet. Stichwort Weiterbildung. Ein wissenschaftlicher Assistent der Unibibliothek war so nett gewesen, ihr einen Rechercheauftrag für Florenz zu beschaffen. Mit Stempel und Unterschrift. Nur für den Fall der Fälle. Der junge Mann war ein bisschen verliebt in die angehende Kunsthistorikerin.
Kurz und gut, die längste Zeit im Zug verbrachte Marina schlafend. Kein Wunder, angesichts der vielen mit Arbeit am Computer durchwachten Nächte in den vergangenen Wochen. Sie träumte davon, ein echter Harlequin zu sein, über eine kleine Wanderbühne irgendwo in der Toskana zu toben, Rad zu schlagen, sich mit anderen bunten Figuren fröhliche Wortgefechte zu liefern. Als sie am Montagmorgen kurz vorm Ziel erwachte, fiel ihr auf, dass ihr Traum einen logischen Fehler gehabt hatte. Der klassische Harlequin der Commedia dell‘Arte war männlich. Sein weibliches Pendant nannten die Italiener Colombine. Hatten sie in Köln bei der Namensgebung womöglich einen Fehler gemacht? Wobei: »Kölsche Colombines« hätte wirklich merkwürdig geklungen. Marina blieb keine Zeit, ihren Gedanken zu vertiefen. Der ICE lief in die weitläufige Halle des Florentiner Kopfbahnhofes ein.
Die Stadt der Künste empfing die junge Frau sehr profan. Zum einen war das nüchterne Bahnhofsgebäude im Bauhausstil nicht gerade geeignet, Neuankömmlingen einen freundlichen Empfang zu bereiten, zum anderen erwartete sie am Ende des Bahnsteiges eine erneute peinliche Überprüfung ihrer Test- und Personalunterlagen, inklusive Infrarot-Fiebermessung. Die hatten hier allen Ernstes eine Sperre gebaut, richtig aus festem Glas mit Türen an jedem Übergang zum Querbahnsteig, bewacht von strengem Personal. Verrückt. Sie erinnerte sich an Geschichten ihrer Urgroßmutter, dass es in Deutschland derartiges ebenfalls gegeben habe. Aber vor mehr als einhundert Jahren!
Das gleiche mühsame Prozedere und jede Menge Papierkram wenig später in ihrer Unterkunft. Zum Zwecke einer möglichen Nachverfolgung, falls das Virus wieder ausbräche. Sie ertrug es klaglos. Sie wusste, sie konnte sich glücklich schätzen, überhaupt jemanden gefunden zu haben, der bereit war, Fremde zu beherbergen. Ein Privatvermieter. Hostels oder ähnliche Gemeinschaftsunterkünfte waren zu diesem Zeitpunkt auch in Italien noch komplett tabu. Was für eine irre Zeit!
Als sie wenig später allein in ihrem düsteren Zimmerchen lag, fühlte sich Marina wie erschlagen. Von der Stadt hatte sie bis jetzt kaum Notiz nehmen können. Es war schwierig genug gewesen, sich in den engen Gassen zurechtzufinden. Mit ihrem kleinen Rollkoffer polternd über jahrhundertealte Steinplatten voller Risse und Löcher, eine kräftezehrende Angelegenheit. Die Hitze machte ihr zu schaffen. Überall staute sich die Luft. Das Atmen fiel schwer. Erst recht mit Maske. Dann die steile Treppe hoch in den dritten Stock.
Endlich oben angekommen, schleuderte sie die Maske zu Boden und warf sich aufs Bett. Das Fenster öffnete sie vorsichtshalber erst gar nicht. Es hätte nur schlimmer werden können. Die dicken Wände des alten Hauses mit seinen geschlossenen Fensterläden schienen ihr ein guter Schutz gegen die Glut draußen. Eine womöglich romantische Aussicht verpasste sie definitiv nicht, denn kaum zwei bis zweieinhalb Meter entfernt spendeten hohe graue Mauern aus grob behauenen Steinen zusätzlich Schatten. Ein mittelalterlicher Wohnturm. Ziemlich imposant, soweit sie das vorhin auf der Straße und nun durch die Ritzen der Läden von ihrem Lager aus beurteilen konnte. Immerhin. Und trotzdem. Dieses gedämpfte Licht drückte Marinas Stimmung weiter in den Keller.
Sie hätte schon wieder heulen können. Allmählich kamen ihr Zweifel, ob ihre Flucht aus Deutschland wirklich eine gute Idee gewesen war. Notfalls würde sie die Reise abkürzen und in zwei Tagen wieder heimfahren. Nach Hause, nach Köln, zu den anderen Harlequins. Wenig später schlief sie erneut tief und fest.
Kapitel 3 – Ansichtssachen
»Sottotenente Lippi, es mag ja sein, dass Sie als Angehöriger der Carabinieri gewisse militärische Ambitionen hegen und gern ein bisschen Krieg spielen. Ich kann auch Ihren jugendlichen Drang zu schnellen und radikalen Lösungen nachvollziehen. Aber solange Sie hier unter meinem Kommando stehen, unterstehen Sie auch dem Innenministerium und haben sich entsprechend zivil zu benehmen!« Commissario Falk Hofer von der Polizia di Stato, der Staatspolizei, verschränkte die Arme und musterte sein Gegenüber. Er schien sich zu fragen, ob die Botschaft beim Empfänger angekommen sei. Als Leiter der Abteilung II / Polizeiliche Ermittlungen der DIA-Außenstelle Cosenza koordinierte der Südtiroler alle Aktivitäten des italienischen Polizeiapparates im zentralen Hochland Kalabriens. Jedenfalls, sofern es den Kampf gegen die ’Ndrangheta betraf. Die DIA, also die Direzione Investigativa Antimafia, war Anfang der 90er Jahre als Zusammenschluss operativer Einheiten der Staatspolizei, der Carabinieri und der für Zoll und Steuerfragen zuständigen Guardia di Finanza gegründet worden. Und ebenso lange gab es zwischen den Mitarbeitern der drei verschiedenen Behörden gewisse Kompetenzrangeleien. Was einer effizienten Erfüllung ihrer Aufgabe natürlich im Wege stand.
Weswegen Hofer jetzt ganz genau wissen wollte, wie es zu den Ereignissen der vergangenen beiden Tage hatte kommen können. »Sottotenente Lippi, wenn Sie weiterhin beabsichtigen, wie ein begossener Pudel dazusitzen und zu schweigen, bringt uns das kein Stück weiter. Versuchen Sie wenigstens, mir zu erklären, was Sie geritten hat!«
Dem jungen Carabinieri-Sottotenente, was in etwa dem deutschen Leutnant entspricht, war die ganze Angelegenheit äußerst peinlich. Es war Antonio Lippi keineswegs darum gegangen, die Führungsrolle seines Chefs anzuzweifeln. Ganz im Gegenteil. Er bewunderte die ruhige und besonnene Art dieses erfahrenen Polizisten. Mit seinen leicht angegrauten Schläfen und den Lachfältchen, die im Laufe der Jahre immer tiefer wurden, strahlte der Mann etwas Väterliches aus. Selbst hier, im kahlen Büro des Chefs, auf dessen Schreibtisch sich Berge von Aktenordnern türmten, fühlte man sich nicht völlig verlassen, wenn der Mann einen aus seinen ziemlich blauen Augen ansah. Eher ein bisschen durchschaut. Die Enttäuschung, die momentan in diesen Augen lag, schmerzte Antonio Lippi darum umso mehr. Eigentlich hatte er nur beweisen wollen, dass er in der Lage war, selbständig die notwendigen Entscheidungen zu treffen, ohne jedes Mal den Vorgesetzten nerven zu müssen. Das war gründlich schief gegangen, und nun rang er nach den richtigen Worten.
»Commissario, es lag nicht in meiner Absicht, Sie in irgendeiner Weise zu kompromittieren. Wirklich nicht, das müssen Sie mir glauben. Sie waren übers Wochenende verreist. Und am Samstagmorgen bekam ich diesen Tipp vom blinden Richi, dass abends eine große Rauschgiftlieferung drüben an der Marina von Cariati ankommen würde.«
»Vom blinden Richi?« Hofer zog die Augenbrauen hoch.
»Ja, ich weiß, der Bursche ist nicht ganz … Egal. Diesmal klang aber alles logisch. Ich habe die Information geprüft. Es gab Anzeichen, dass tatsächlich etwas Ungewöhnliches vorbereitet wurde.«
»Kein Wunder.«
»Commissario, auf so eine Gelegenheit haben wir lange gewartet. Die Bande im Castello von Mandatoriccio hält sich für unantastbar. Und Cariati ist quasi deren Heimathafen. Sie wissen selbst, wie schwer es geworden ist, jemanden von denen auf frischer Tat zu erwischen. Seit die Padrones ihre internationalen Geschäfte über Zwischenhändler abwickeln und dafür ganz legal die Containerterminals der großen Überseehäfen nutzen, bekommen wir hier im Süden doch nur noch die Ergebnisse zu Gesicht: protzige Villen, luxuriöse Autos und ab und an mal eine teure Yacht. Ich wollte einfach schnell und entschlossen zuschlagen, ohne dafür Ihre kostbare Erholungszeit zu beanspruchen. Ich hoffte, Ihnen heute eine gute Ausbeute für die Presse und ein paar neue Delinquenten für den Staatsanwalt präsentieren zu können.«
»Hofften Sie? Ah ja.« Der Commissario dachte einen Moment nach. »Und dafür war es notwendig, zwei Fischkutter zu versenken, das Büro des Hafenmeisters in Schutt und Asche zu legen und die Hälfte ihrer Kollegen mit Schussverletzungen ins Hospital zu befördern? Mit Schussverletzungen wohlgemerkt, die sie sich im Eifer des Gefechts im Dunkeln gegenseitig zugefügt haben? Sie können von Glück reden, junger Mann, dass keiner ums Leben gekommen ist. Weder von uns, noch von den Fischern. Dass Ihr kleiner privater Bürgerkrieg drüben an der Ostküste ein Nachspiel und dienstrechtliche Konsequenzen haben wird, ist Ihnen hoffentlich klar? In einer halben Stunde muss ich dem Innenminister in der Video-Konferenz Rede und Antwort stehen. Er hat mich ausdrücklich zum Rapport befohlen. Befohlen, nicht gebeten, verstehen Sie? Der Mann ist auf 180. Nachvollziehbar. Können Sie mir sagen, wie ich ihm das Chaos erklären soll?«
»Wir wurden in eine Falle gelockt.«
»Na selbstverständlich wurden Sie das. Mit der Folge, dass Sie unsere ganze Abteilung zum Gespött der Leute gemacht haben und enorme Entschädigungssummen drohen. Welcher Gauner soll nach der Lachnummer noch Respekt vor uns haben?«
»Aber warum haben die Fischer bei der Schmierenkomödie mitgespielt? Die haben alles so arrangiert, dass ihre Boote nachher weg waren und wir wie die Deppen dastanden. Ich glaube nicht mal, dass die rostigen Kähne durch unsere Schuld untergegangen sind. Die paar Löcher hätten meiner Meinung nach nicht gereicht. Die haben nachgeholfen. Jede Wette. Wir wollten sie eigentlich nur einkreisen, damit keiner ausbüxt. Wir haben sie aufgefordert, uns an Bord zu lassen. Eine ganz normale Polizeikontrolle. Plötzlich fiel ein Schuss. Dann gab es die Explosion. Da sind einigen unserer Jungs die Nerven durchgegangen.
Klar wissen wir jetzt, dass es eine Propangasflasche war. Aber irgendwer muss die genau im passenden Moment gezündet haben. Vielleicht sogar der Hafenmeister selber? Nein, für mich steht es fest: Die Fischer hatten das so geplant, dass wir sie für Angreifer halten mussten. Ich nehme an, die sind gut dafür bezahlt worden. Deswegen konnten die im Gegensatz zu uns rechtzeitig in Deckung gehen. Von denen wurde kein einziger verletzt. Und jetzt wollen sie ihre maroden Schrotthaufen gegen nagelneue Boote eintauschen. Auf unsere Kosten. Wenn Sie mich fragen, Commissario, dann war das ein ganz faules, abgekartetes Spiel.«
»Können Sie‘s beweisen?«
»Nein.«
»Eben.«
»Noch nicht. Aber wenn wir die Spuren zurückverfolgen, kriegen wir sie dran. Es muss Spuren geben. Irgendeiner wird reden, wenn wir ihn nur genug ausquetschen. Das war ein Angriff auf die Autorität des Staates. Das können wir nicht auf sich beruhen lassen.«
»Mag sein.«
»Wir müssen einfach unsere Arbeit machen, gründlich ermitteln!«
»Müssen wir, Sottotenente, müssen wir. Aber nicht Sie. Sie werden vorerst vom Dienst suspendiert.«
»Aber …«
»Keine Widerrede!« Der Commissario machte eine Pause. Dann fügte er hinzu: »Damit Sie mir bis zur Klärung des Falls nicht vor lauter Langeweile auf dumme Gedanken kommen, machen Sie in der Zwischenzeit Verkehrskontrollen. Oben in den Bergen.«
»Nicht Ihr Ernst?«
»Doch. Quartieren Sie sich in Savelli ein.«
»Savelli? Aber das gehört doch gar nicht mehr zu unserer Provinz. Das ist schon Crotone. Dürfen wir das denn?«
»Natürlich ist das nicht mehr unsere Provinz, Sie Schlaukopf. Ich kläre das mit meinem DIA-Kollegen drüben persönlich. Ich muss Sie aus der Schusslinie bringen. Unsere Leute brauchen davon nichts zu wissen. Andererseits liegt der Ort nah genug an der von Ihnen verwüsteten Marina, um spitze Ohren machen zu können. Dem Innenminister wird es für den Moment reichen, dass Sie nicht mehr an Ihrem Schreibtisch sitzen. Kennt Sie in der Gegend jemand?«
»Nicht, dass ich wüsste.«
»Fein. Legen Sie sich einen neuen Namen zu. Sagen wir Vittorio Pazzi. Der Schnurrbart kommt ab. Haare kürzer. Viel kürzer, verstanden? Und ab sofort keine alberne Checker-Sonnenbrille mehr. Die Zeitungen sind voller Porträts von Ihnen mit diesem Ding auf der Nase. Inklusive hämischer Kommentare. Was für uns von Vorteil ist, denn ohne dürfte man Sie kaum wiedererkennen. Und so wichtig sind Sie gottlob nicht, als dass jemand dafür eine Gesichtserkennungssoftware bemühen würde. Ich besorge Ihnen den passenden Dienstausweis. Lassen Sie sich als einfachen Agente der Verkehrspolizei einkleiden. Einen höheren Dienstrang kann ich Ihnen für die nächste Zeit nicht anbieten. Ihr Dienstwagen bleibt hier. Sie bekommen ein Moped. Das sollte, nebenbei gesagt, hoffentlich Ihrem Ego einen kleinen Dämpfer geben und Sie lehren, Ihren Job künftig mit etwas mehr Demut auszuüben. Wenn jemand fragt, sagen Sie, Sie seien abkommandiert, weil es in den Bergen zuletzt zu viele Unfälle mit alten klapprigen Treckern und Pickups gab. Ich informiere die zuständigen Kollegen, dass sie einen Strafversetzten bekommen. Grund? Alkohol im Dienst. Vielleicht kleine Mauscheleien. Bestechlichkeit. Nur Andeutungen. Die müssen nicht alles wissen. Aber sie werden es weitererzählen, was Ihnen, mein Lieber, wiederum helfen wird, das Vertrauen der Leute zu erringen. Mit Alkohol und Korruption kennen die sich nämlich aus. Gibt ja sonst nichts da oben.