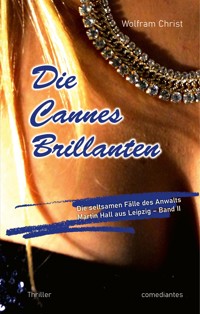Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: comediantes - Verlag für Lyrik und Belletristik des 21. Jahrhunderts
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieser Sammelband vereint achtzehn Geschichten, wie sie das Leben schreibt oder zumindest schreiben könnte. Ergänzt um einen vermeintlichen "Leserbrief", der für so ziemlich alles, was Ihnen in letzter Zeit merkwürdig erschien, eine plausible Erklärung bietet. Kurz und gut, das Ihnen vorliegende Buch enthält Heiteres und Trauriges, Hoffnungsvolles und Nachdenkliches. In jedem Fall aber bietet es neunzehnmal kurzweilige Unterhaltung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 485
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Du nicht hier
Kurzgeschichten und Erzählungen
von
Wolfram Christ
Die Entstehung dieses Werkes wurde durch ein Stipendiumder Kulturstiftung des Freistaates Sachsen ermöglicht.
Lektorat: Uta Christ und Thomas Lünser
e-book / EPUB
ISBN 978-3-946691-18-1
© 2020 www.comediantes.de
Titel
Vorwort
Erstaunliche Begegnungen
Geisterbahn
Der Nachtwächter
Sonnenblumengold
Santa Barbara
Schneesturm
Das Mädchen mit dem Wachslicht
Selbstmörderische Aktivitäten
Über den Wolken
Lifestyle Magazine
Der Graf
Claudine
Wenn das kein Grund zum Feiern ist
Sein großes Comeback
Überraschende Wenden
Wellenrausch
Roadmovie
Schattenmacher
Schrat, Schrat, Schrat
Altweibersommer
Du nicht hier
Verschwörungstheoretisches Nachwort
Weltuntergang? War schon.
Vorwort
Unverhofft kommt oft, sagt der Volksmund. Er hat recht. 2020 traf uns unerwartet und heftig eine Pandemie. Den einen mehr, den anderen weniger. Die eine eher gesundheitlich, die andere wirtschaftlich durch das sogenannte „Herunterfahren“ des öffentlichen Lebens.
Erstaunlich: Wir merkten plötzlich, wozu unser Land fähig ist, wozu wir gemeinsam fähig sind. Grippewellen oder Seuchen früherer Jahrzehnte und Jahrhunderte hinterließen tiefe Spuren der Vernichtung. Diesmal?
Dass nach einer verhältnismäßig kurzen Phase allgemeiner Solidarität umgehend die übliche Kakophonie wütender Beschuldigungen, Beschimpfungen und Beleidigungen sowohl von Befürwortern eines noch härteren Kurses als auch des kompletten Gegenteils inklusive wilder Verschwörungstheorien durchs Internet wie auch die reale Welt schwappte, beweist: Wir haben keine wirklichen Probleme! Die meisten jedenfalls.
Ja. Natürlich. Vielen Menschen brach ihre Existenzgrundlage weg. Einige verloren liebe Angehörige. Wieder andere, vor allem junge Mütter und ihre Kinder, kamen durch Schulschließungen und die daraus resultierende familiäre Situation an die Grenzen ihrer Belastbarkeit. Aber all dies passierte im Rahmen einer sozialen Absicherung, die es so auf der Welt wohl kein zweites Mal gibt und die auch in Deutschland nie zuvor möglich war.
Bestes Beispiel ist das Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, vorliegende Buch. Der Autor dieser Zeilen gehört zu jenen Künstlern und Freiberuflern, deren Broterwerb durch den Wegfall von Veranstaltungen, Buchmessen und ähnlichem einen Totalschaden erlitt. Als hauptberuflicher Theatermacher mit seiner kleinen aber feinen Truppe deutschlandweit unterwegs, unterbrach die Pandemie nicht nur die laufende Tournee, verhinderte Lesungen aus Büchern des gerade gegründeten comediantes Verlages und machte mithin die Arbeit vieler Monate zunichte, sie verhinderte auch die dringend notwendige Vorbereitung auf die kommende Saison, weil sich keiner der bisherigen Partner in Kleinkunstbühnen, Restaurants, Hotels oder Buchhandlungen in der Lage sah, über neue gemeinsame Planungen zu reden. Einige dieser Partner mussten in Folge der Einschränkungen sogar komplett schließen.
Ausgerechnet in dieser völlig aussichtlosen Lage nun lobte die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen ein kleines Stipendium für von Corona betroffene Freiberufler aus, das es Wolfram Christ erlaubte, sich einen langgehegten Wunsch zu erfüllen. Die vor Ihnen liegende Sammlung.
Das Programm der Stiftung nannte sich „Denkzeit“. Christ stellte sein persönliches „Denkzeit“-Projekt unter das Motto „(Mit-)Menschlichkeit“. Heraus kam „Du nicht hier“.
„Du nicht hier“ ist eine Auswahl der schönsten Kurzgeschichten, Erzählungen und Novellen, die der Autor in den vergangenen zwanzig Jahren verfasste. Ergänzt um drei Shortstorys, die in den Corona-Tagen exklusiv für diese Sammlung geschrieben wurden. Alle drehen sich um das weite Feld zwischenmenschlicher Beziehungen. Meist werden diese durch persönlich verursachte oder von außen auf die Protagonisten einstürzende Krisen auf harte Proben gestellt. Oft gibt es ein Happy End, manchmal enden sie tragisch. Ganz wie im richtigen Leben.
Neben den drei aktuellen Geschichten „Geisterbahn“, „Wellenrausch“ und „Du nicht hier“ wird der Liebhaber christscher Erzählungen einiges wiederfinden, das bereits in frühere Bände Aufnahme fand. Gründlich neu lektoriert, versteht sich. Der weitaus überwiegende Teil ist jedoch bislang unveröffentlichtes Material, das in vergangenen Jahren nach und nach entstand, dabei diverse Wandlungen erlebte und hier nun nach erneuter Überarbeitung endlich das Licht der Öffentlichkeit erblicken durfte.
Tauchen Sie bitte ein in das Universum der Irrungen und Wirrungen, der menschlichen Verfehlungen und skurrilen Verwicklungen. Am Ende, und auch das ist dem Leben abgeschaut, zählt nur eines: Die Liebe.
Erstaunliche Begegnungen
Geisterbahn
Soja wusste, was sie wollte. Normalerweise. Dummerweise war gerade absolut nichts normal. Auch das wusste die Frau; sie ärgerte sich, nichts daran ändern zu können. Deshalb hockte sie im Schatten der Eisbude. Der geschlossenen Eisbude. Missmutig spuckte sie in den Staub zwischen ihren Füßen. Der dunkle, feuchte Fleck hob sich deutlich ab. Es hatte seit Wochen nicht geregnet. Soja war das gleichgültig. Sollten doch alle übers Wetter klagen. Wenn jemand wirklich Grund zu klagen hatte, dann sie. Davon war sie überzeugt. Nicht wegen der Trockenheit. Nein. Die war eher gut, denn sonst hätte sie jetzt in einer Pfütze gehockt. Nein, das war es nicht. Ganz im Gegenteil.
Soja war sauer, weil man sie im Regen stehen ließ. Oder hocken. Im übertragenen Sinne. Sie scharrte mit den Füßen im Staub, um ihre Spucke zu verwischen. Irgendwie fand sie den Fleck jetzt doch eklig. Schließlich setzte sie sich und streckte die Beine aus. Mitten rein in den Dreck. War sowieso alles Wurst. Sie fühlte sich nutzlos und unendlich alleine. Die Eisbude durfte sie jetzt schon seit drei Wochen nicht mehr öffnen. Genau wie ihr Riesenrad. Ja, „ihr“ Riesenrad! Seit Dezember.
Kurz vor Weihnachten nämlich war Sojas Vater gestorben. Influenza. Virusgrippe. Sie gab seiner angeschlagenen Gesundheit den Rest. Es folgte ein trauriges Fest. Was er ihr hinterließ, war nicht viel.
Zum einen seinen Optimismus:
„Es kann für den Rummel eine Zukunft geben, wenn du die Sache nur richtig angehst! Menschen brauchen immer ein bisschen Spaß und Abwechslung. So lange du eine Vision hast, besteht Hoffnung!“ Sein Credo.
Zum anderen erbte sie das Riesenrad. Ihr alter Herr hatte es letzten Herbst, nach der Ostseetour und den guten Einnahmen des heißen Sommers, gerade erst generalüberholt. Wahrscheinlich hatte er sich schon dabei körperlich überanstrengt. Aber er war nun mal ein Sturkopf. Vorbei.
Die junge Frau nahm die Herausforderung an. Ändern konnte sie am Tod ihres Vaters ohnehin nichts. Eine Mutter gab es in ihrem Leben seit langem nicht mehr. Die war vor Jahren mit einem Messerwerfer vom Zirkus durchgebrannt und lebte jetzt irgendwo in Spanien. Abgehakt.
Soja hatte es aufgegeben, ihr nachzutrauern. Für sie waren der Rummel und die anderen Schausteller Mutter, Onkel, Tanten und Geschwister zugleich. Seit Kindesbeinen. Das reichte. Also schüttelte sie sich nach der Beerdigung kurz, krempelte die Ärmel hoch und beschloss, ihre Chance zu nutzen.
Die Sache ließ sich zuerst auch gut an. Soja hatte einige neue Ideen, wollte dem Riesenrad sein Kinderspielzeug-Image nehmen und es den Leuten als Vergnügen für frisch Verliebte oder Junggebliebene schmackhaft machen. Sie investierte in ein attraktives Kostüm, das ihre weiblichen Reize betonte. Ein Western-Outfit. Motto: Cowboy, auf meinem Riesenrad bist du der Held! Reite mit deiner Liebsten dem Sonnenuntergang entgegen und führe sie zu unbekannten Höhepunkten!
Sie ließ professionelle Fotos für diese Kampagne machen, betrieb intensive Werbung im Netz und druckte neue Flyer. Mit unzähligen persönlichen Telefonaten und hunderten E-Mails bewarb sie sich in vielen Städten und bei etlichen Veranstaltern. Der Elan des attraktiven Mädchens im Cow-Girl Kleid schien viele zu überzeugen.
Wie gesagt, das neue Jahr fing gut an. Sojas Kalender füllte sich rasch mit Terminen. Bis dieses dämliche neue Virus auftauchte. Die Angst der Leute vor Ansteckung entwickelte geradezu hysterische Züge und führte schließlich zum Veranstaltungsverbot für Volksfeste. Soja hatte dafür nicht das geringste Verständnis. Als ihr Vater an der Grippe starb, interessierte das kein Schwein. Und jetzt so ein Zinnober!
Das war drei Wochen her. Die Verbote kamen gerade in dem Moment, als sie ihr Rad zum ersten Mal auf einem schönen Frühlingsjahrmarkt aufgestellt hatte. Anreise, Aufbauhelfer, Standgebühr, jede Menge Kosten und dann: Alles umsonst! Träume geplatzt.
Seitdem war Sojas Wut tiefer Resignation gewichen. Sie akzeptierte die Argumente inzwischen. Sie sah die Bilder aus Italien und New York. Wem wollte sie zumuten, zu entscheiden, wer zu retten sei und wer verrecken durfte? Insofern nutzte dieses „Herunterfahren des öffentlichen Lebens“ sicher. Irgendwie. Nur, wer sah die Folgen für Leute wie sie? Im Prinzip konnte sich Soja den Strick nehmen. Ihre Verluste waren schon jetzt irreparabel hoch und ein Ende nicht in Sicht. Das Riesenrad abzubauen, hatte sie daher unterlassen. Sie musste sparen. Wohin hätte sie damit auch ziehen sollen? In ihr trostloses, leeres Winterquartier? Hier auf dem Platz stand es gut und solange die Stadt auf weitere Standgebühren verzichtete …
Die meisten anderen Schausteller waren nach Hause gefahren. Die hatten Familien und so Sachen. Nur die Geisterbahn blieb. Gleich schräg rüber von ihrer Eisbude und dem Riesenrad. Die Geisterbahn blieb deshalb, weil deren Besitzer pleite war. Er hatte auf eine gute Frühjahrssaison gesetzt, um offene Rechnungen bezahlen zu können. Die Soforthilfen der Regierung kamen für ihn zu spät. Jedenfalls glaubte er nicht an eine schnelle Lösung. Er war über Nacht verschwunden. Vielleicht hatte er sich umgebracht, vielleicht nur irgendwo vor seinen Gläubigern versteckt. Soja wusste es nicht. Er hatte ihr den Schlüssel vorbei gebracht und sie gebeten, ein wenig auf sein Fahrgeschäft acht zu geben. Er müsse kurz verreisen. Das war das Letzte, das sie von ihm gesehen oder gehört hatte. Damit fiel die Geisterbahn bis auf weiteres zusätzlich in ihren Verantwortungsbereich. Genau wie die Eisbude. Die Eisbude allerdings gehörte schon ewig zu Sojas kleinem Imperium. Die Eisbude am Riesenrad! Das war normalerweise eine Bombenkombination. Normalerweise.
„Mein Riesenrad.“ Wie schön das klang. Noch vor einem Monat. Jetzt? Ein großes nutzloses Stück Metall. Schön bunt aber nutzlos. Wie sie selbst. Soja lehnte sich an die Eisbudenwand, schloss die Augen und schob ihren Cowboyhut ins Gesicht. So lange die Sonne schien und die Temperaturen erträglich blieben, musste sie sich weniger Sorgen machen. Zum Beispiel, ob ihr Wohnwagen nachts nicht zu sehr auskühlte oder ob sein Dach dicht hielt. Eigentlich hatte sie gehofft, sich nach diesem Sommer endlich ein etwas besseres Gefährt leisten zu können. Die Kutsche hatte fast vierzig Jahre auf dem Buckel und schepperte bei jeder Fahrt, als würde sie gleich auseinanderfallen. Vaters Einnahmen waren stets ins Riesenrad geflossen. Das hatte immer Vorrang gehabt. Damit mussten sie Geld verdienen. Auf Komfort kam es nicht so an. Jetzt allerdings hatte Soja gehofft …
Vergebens. Alles futsch. Die Prognosen der Leute im Fernsehen wurden immer klarer: Dieser Sommer war im Arsch. Wahrscheinlich die ganze Saison. Soja hatte keine Ahnung, wie es weiter gehen sollte. Rücklagen? Fehlanzeige. Wovon, nach den Wintermonaten? Die laufenden Kosten waren hoch, die Einnahmen ein Komplettausfall. Totalschaden.
Ganz zu schweigen von der emotionalen Wüste, die sich einstellte. Soja war allein. Sich fest zu binden, hatte sie bisher tunlichst vermieden. Jemand, der nicht aus ihrem Metier stammte, hatte sicher wenig Verständnis für ihr unstetes Leben. Da wäre Beziehungsstress vorprogrammiert. Schausteller in ihrem Alter hingegen waren rar gesät. Die wenigen, denen sie begegnete, taugten in ihren Augen nicht viel oder waren schon in festen Händen.
Außerdem fühlte sie sich noch viel zu jung, um auf die kleinen amourösen Vergnügungen zu verzichten, die sich zuweilen in fremden Städten entwickelten. Angefangen vom harmlosen Flirt an der Eisbude bis hin zum heißen Quicky in der Mittagspause hinterm Wohnwagen. Ja, dahinter. Drinnen ging nicht. Das hätten alle mitgekriegt. Wegen der Schaukelei. Alles bestens, alles folgenlos, just for fun, denn am nächsten Tag ging es schon wieder weiter zur nächsten Stadt und vielleicht zum nächsten Abenteuer. Damit war es nun auch Essig. Manchmal glaubte das Mädchen, die Einsamkeit fräße ihre Seele auf. Ganz langsam. Häppchen für Häppchen. Müßig, darüber nachzudenken.
Soja saß im Schatten ihrer Eisbude und versuchte, zu schlafen. Was hätte sie tun sollen? Sie war mit ihrem Riesenrad den Ereignissen hilflos ausgeliefert. Immerhin schien es mit der Grundsicherung vom Jobcenter zu klappen. Jedenfalls hatten die gesagt, sie würden den Antrag zügig bearbeiten. Soja hoffte inständig, dass das stimmte und sie wenigstens die Miete fürs Winterquartier würde weiter bezahlen können. Wilder Aktionismus brachte momentan nichts. Obwohl sich Soja mit solchen Gedanken zu beruhigen versuchte, träumte sie wirres Zeug. Kein tiefer Schlaf.
Weswegen ein leises Geräusch reichte, sie zu wecken. Das Geräusch kam von der Geisterbahn. Waren das Stimmen? Jetzt am Vormittag? Auf einem geschlossenen Rummelplatz?
Soja rappelte sich hoch und spähte um die Ecke ihrer Eisbude. Tatsache. Drei Kinder. Zwei Jungs, ein Mädchen. Höchstens zehn oder elf Jahre alt. Sie machten sich am Eingang zu schaffen. Wahrscheinlich auf der Suche nach einem Abenteuer.
„Ihr kleinen Halunken!“ dachte Soja. „Eigentlich solltet ihr doch brav zu Hause sitzen und die Aufgaben erledigen, die euch die Lehrer geschickt haben. Na wartet!“
Die junge Frau musste einen ziemlich weiten Umweg schleichen, um unbemerkt an den Hintereingang der Bahn zu gelangen. Drinnen war es dunkel und Soja bewegte sich auf Zehenspitzen, damit die Dielen nicht zu sehr knarrten. Ein Blick nach vorn. Die Kinder waren noch da. Wie es aussah, hatte es einer der Jungs tatsächlich geschafft, das Vorhängeschloss zu knacken. Einen Augenblick später huschten die Drei ins Innere. Zwei Augenblicke später kreischten sie erschrocken los. Fast gleichzeitig waren die gespenstischen Lichter aufgeflammt und ein diabolisches Gelächter erscholl. Im Nu machten sie kehrt, zurück zum Ausgang. Zu spät! Breitbeinig und mit einem Colt in der Hand stand da eine knallharte Western-Lady und versperrte ihnen den Rückweg.
„Halt! Stehen geblieben, Hände hoch und keinen Mucks!“ Die Kinder erstarrten. Soja musste arg an sich halten, um nicht sofort laut loszuprusten. „Was habt ihr hier verloren?“ donnerte sie.
„Wir dachten … wir wollten …“, stammelten die drei.
„Ihr dachtet, ihr wolltet … So, so!“ Soja steckte die Spielzeugpistole weg und stemmte ihre Arme in die Hüften. „Ich denke, ihr habt Ausgangssperre oder so?“
„Na ja, nicht ganz“, meinte das Mädchen. Es schien sich als erstes vom Schreck zu erholen. „Es hieß nur, wir dürfen nicht auf den Spielplatz und nicht auf der Straße miteinander spielen.“
„Genau!“ hakte einer der Jungs ein. „Von ‚nicht in der Geisterbahn‘ hat niemand was gesagt.“
„Ja“, bestätigte das Mädchen. „Und weil die Geisterbahn geschlossen hat, ist auch niemand hier, von dem wir uns anstecken können.“
„Wir wussten ja nicht, dass Sie hier sind“, ergänzte der Dritte. Angesichts derart zwingend logischer Argumente konnte Soja nicht mehr anders. Sie musste lachen. Den Kindern fiel ein Stein vom Herzen.
„Na gut“, meinte sie schließlich. „Bleibt immer noch der Einbruch.“
„Rufen Sie jetzt die Polizei?“ Die Frage schien ernst gemeint. Soja überlegte.
„Nein“, meinte sie schließlich, „bis der Sheriff hier ist, das könnte zu lange dauern. Bei uns im Wilden Westen …“, sie stippte sich an den Hut, „klären wir solche Sachen selber. Wenn ihr mir versprecht, das nie wieder zu machen und nachher ganz schnell heimzugehen, verurteile ich euch zu einer vollen Runde durch die Geisterbahn.“ Drei paar Kinderaugen begannen zu glänzen.
„Echt jetzt?“
„Echt jetzt. Aber ihr müsst mir versprechen, mich nicht zu verpfeifen. Eigentlich darf ich niemanden reinlassen.“
„Ehrenwort!“ meinte das Mädchen. „Sie haben uns ja auch gar nicht reingelassen. Das haben wir ja selber gemacht.“
„Stimmt“, gab Soja zu. „Dann sind wir quitt. Aber bitte immer schön den Pfeilen nach laufen und nicht vom Weg abkommen! … Und anschließend verschwindet ihr auf nimmer Wiedersehn. Versprochen?“
„Versprochen!“ tönte es gleichzeitig aus drei glücklichen Kehlen. Soja trat ans Steuerpult und startete das Programm. Sie hatte oft genug zugesehen und wusste, wie die Technik funktionierte. Dass es auf dem Platz immer noch Strom gab, lag an ihrem Wohnwagen. Die Stadtverwaltung hatte netterweise ein Einsehen in ihre prekäre Lage gehabt und ihr den Saft nicht abgedreht. Dass die Geisterbahn am gleichen Kabel hing, daran hatte niemand gedacht. Dieses Versäumnis konnte die junge Frau nun nutzen, den Kindern eine kleine Freude zu bereiten.
„Besser so als ständig in der Stube hocken!“ dachte sie. Dass sie bei der Gelegenheit ihre Befugnisse überschritt, war ihr gleichgültig. Sie genoss einfach das Quietschen und Kichern der drei kleinen Einbrecher. Wie ihr solche Klänge in den vergangenen Wochen gefehlt hatten!
Nachdem die Bande weg war, untersuchte Soja das Vorhängeschloss. Das Teil war im Eimer. Die Jungs hatten es mit ihrem Dittrich nicht öffnen können und deshalb mit brachialer Gewalt aufgehebelt. Schöner Mist. Hätte sie den Nachwuchs-Ganoven vielleicht doch lieber den Hintern versohlen sollen? Ach was. Der Schreck, den sie ihnen eingejagt hatte, sollte reichen. Provisorisch hängte sie das Schloss wieder ein. Von weitem war kein Unterschied zu erkennen.
Soja ging einkaufen. Das Nötigste. Ein paar Kleinigkeiten. Obst, Brot, Müsli. Belustigt hatte sie die Debatten anderer Kunden über nicht vorhandenes Toilettenpapier verfolgt. Für sie kein Thema. Sie hatte sich vor Saisonstart einen kleinen Vorrat in ihrem Wohnwagen angelegt. Der reichte eine Weile. Trinkwasser bekam sie genau wie Strom über den zentralen Anschluss der Kommune. Sie wollte sich nach Ende der Krise unbedingt erkenntlich zeigen. Ob sie dann Geld nachzahlen konnte, stand in den Sternen. Aber die ganze Stadtverwaltung auf ihr Riesenrad einladen, das wäre möglich. Vielleicht noch ein Eis dazu für jeden … obwohl … wusste sie, wie viele Mitarbeiter es hier gab? Das konnte zum Fass ohne Boden werden. Vielleicht doch lieber nur Riesenrad.
Als sie zurückkehrte, traf sie auf dem Platz ein Rentnerpärchen. Händchenhaltend wie frisch verliebte Teenager. Der Blick der beiden Alten glitt sehnsuchtsvoll vom Riesenrad zur Geisterbahn. Soja grüßte freundlich. Als sie sahen, dass die junge Frau zum Wohnwagen ging und also offenbar zum Rummel gehörte, traten sie näher.
„Sagen Sie“, begann der Mann, „wissen Sie zufällig, wann es hier weiter geht?“ Soja zuckte mit den Schultern.
„Wahrscheinlich gar nicht. Wenn die Einschränkungen überhaupt noch in diesem Sommer aufgehoben werden, dann müssen wir weiterziehn. Der Frühlingsmarkt wäre sowieso längst vorbei.“ Die beiden Alten nickten.
„Schade“, meinte die Frau. „Wir wollten nicht gleich zum Eröffnungstag, wissen Sie, wegen dem Gedränge …“
„Wegen des Gedränges!“ korrigierte sie ihr Mann.
„Ja, ist ja gut, alter Besserwisser. … Also, des Gedränges wegen. Zufrieden?“ Die Beiden lachten sich an. Soja stimmte ein.
„Er ist wohl immer so?“ Die Frau nickte. Er senkte peinlich berührt den Kopf.
„Ich kann halt nicht aus meiner Haut. Ich war mein Leben lang Deutschlehrer. So was prägt.“
„Verstehe“, antwortete Soja, „und Rummel-Fan außerdem?“ Die Frau kuschelte sich in den Arm ihres Ehemannes. Sie gluckste und sah zu ihm auf. Er räusperte sich.
„Soll ich’s sagen?“
„Na, mach schon!“
„Also gut. Dieses Jahr ist es genau 65 Jahre her, dass wir uns ungefähr hier an dieser Stelle das erste Mal begegnet sind. Damals gab es auch schon ein Riesenrad und eine Geisterbahn.“
„Ja. In der Geisterbahn hat mich der Mistkerl geärgert!“ gickerte sie. „Am nächsten Tag hat er mich zur Entschuldigung aufs Riesenrad eingeladen. Vorher hat er mir mit dem Luftgewehr einen Strauß Papierrosen geschossen. Und als wir dann mit unserer Gondel ganz oben waren, haben wir uns das erste Mal geküsst.“
„Ein halbes Jahr später wurde geheiratet.“ Der Alte drückte seine Frau. „Tja, damals ging alles ein bisschen schneller. Wir haben uns nicht so lange geziert, wie ihr jungen Leute heute.“ Soja nickte. Ihr kam ein Gedanke.
„Sie wollten wohl zum Jubiläum …?“
„Ja. Das war eigentlich der Plan.“
„Riesenrad?“
„Ach nein. Uns wird jetzt immer so schnell schwindlig. Aber noch mal durch die Geisterbahn, das wäre schon lustig gewesen.“
„Hm“, meinte Soja, „Riesenrad wäre auch schwierig. Das sieht man von der Straße. Da darf ich nur alleine Inspektionsrunden drehen. Sonst würde ich Ärger mit dem Ordnungsamt kriegen. Aber die Geisterbahn könnte ich Ihnen schon anwerfen. Das kriegt keiner mit. Jedenfalls, wenn Sie mich hinterher nicht wegen Übertretung des Verbots anzeigen.“
„Das würden Sie machen?“
„Wenn Sie Lust haben?“
„Und ob wir Lust haben!“
Allmählich begann Soja, die Sache Spaß zu machen. Klar, sie musste aufpassen. Nicht, dass sie am Ende doch noch Platzverbot bekam. Aber solange sie ab und zu jemandem eine kleine Freude machen konnte, fühlte sie sich nicht mehr ganz so nutzlos. Leider verlief der Rest des Tages ziemlich ereignislos.
Als die Nacht hereinbrach, setzte sich Soja in eine Gondel, nahm die neue Fernbedienung zur Hand, die sie sich für Kontrollfahrten zugelegt hatte, und setzte ihr Riesenrad in Bewegung. Sie durfte das. Genauer gesagt war sie zu regelmäßigen Tests sogar verpflichtet. Wegen der Standsicherheit und so weiter.
Oben angekommen, stoppte sie. Die Höhe war zwar nicht so atemberaubend wie im London-Eye, aber dafür saß man hier in keiner abgeschlossenen Kabine, sondern schwebte frei wie ein Vogel an der frischen Luft. Soja liebte die Aussicht. Unter ihr die Eisbude, gegenüber die Geisterbahn, dahinter die Bundesstraße. In entgegengesetzter Richtung thronte hoch über der Altstadt eine Burg. Dazwischen das Gewirr enger Gassen, alter Häuser, ein Fluss und die Reste der Stadtmauer. Ein nettes Städtchen. Schade, dass niemand außer ihr diesen Blick genießen durfte.
Ihr Riesenrad vibrierte. Soja stutzte. Sie blickte über die Brüstung ihrer Gondel nach unten. Was war das denn? Zwei Männer. Sie turnten über die unteren Gondeln und hatten offenbar Spaß. Frechheit! Was hatten die hier verloren? Um diese Zeit? Was das für Typen waren, ließ sich nicht genau ausmachen. Nur, dass sie um das Riesenrad herum tobten, die Eisbude inspizierten, ihren Wohnwagen, …
Einen Augenblick überlegte Soja, ob es klüger sei, einfach oben zu bleiben und die Polizei zu rufen. Vielleicht waren es Diebe. Andererseits? Die junge Frau war kein Feigling. Auf dem Rummel durfte man kein Angsthase sein. Erst recht nicht als Frau. Außerdem: Warum immer gleich das Schlimmste denken? Vielleicht waren die Jungs harmlos? Ein bisschen Abwechslung auf den Abend konnte nicht schaden und im Notfall würde sie sich zu helfen wissen. Sie hatte vor ein paar Jahren einen Kurs im Kickboxen belegt. Damit ließ sich einiges anfangen. Hatte ihr schon gute Dienste geleistet.
Was tun? Vielleicht erschrecken. Wie heut Morgen bei den Kindern. Liefen die Kerle dann weg, war die Sache klar. Blieben sie …? Nun, das würde sich zeigen.
Soja schaltete auf volles Programm. Bunte Lichter flammten auf und erhellten den Platz, kreischend donnerte ein uralter Schlager aus den Lautsprecherboxen. Das Riesenrad begann, sich zu drehen. Schneller und schneller. Seine leeren Gondeln schaukelten gespenstisch. So plötzlich das Spektakel anfing, so abrupt endete es. Die beiden Männer, von nahem besehen waren sie höchstens Mitte zwanzig, erschraken zwar durchaus. Die Flucht ergriffen sie trotzdem nicht. Also keine Diebe, konstatierte Soja.
Erst musterten die Kerle das Western-Mädchen erstaunt, das vor ihnen aus der Gondel stieg, dann begannen sie, über den gelungenen Streich zu lachen. Ein ansteckendes Lachen. Wie sich herausstellte, waren die beiden Burschen Brüder. Sie lebten noch daheim, also in einem Haushalt.
„Demnach kann das Ordnungsamt nichts dagegen haben, dass wir hier zu Dritt beieinander stehen“, sagte Soja und erschrak im nächsten Moment über sich selbst. War schon verrückt, was einem in diesen Zeiten durch den Kopf ging. Abstandsregeln, Mund-Nasen-Schutz, … Als ob es ein Verbrechen war, mit netten Menschen zu reden, ihnen ein Lächeln zu schenken?
Die Jungs sahen die Sache zum Glück locker. Grinsend versicherten sie Soja, dass es in ihrer Stadt bislang keine Corona-Infizierungen gegeben habe und sie sich immer ordentlich die Hände wüschen. Wenn sie darauf bestünde, würden sie auch ihre frischen Schlüpfer zur Kontrolle vorlegen. Ein fröhliches Pärchen. Das tat gut. Einer der Brüder lief zum nahen Supermarkt und schaffte es tatsächlich noch vor Ladenschluss, einen Kasten Bier zu besorgen. Als Gegenleistung bot das Mädchen an, den Herren in der Geisterbahn das Gruseln zu lehren. Wenn sie heut schon zweimal jemandem Zutritt gewährt hatte, sollte es zum eigenen Vergnügen auch ein drittes Mal möglich sein. Verbotene Früchte schmeckten bekanntlich am besten. Die beiden Männer lehnten nicht ab.
Es wurde ein vergnüglicher Rundgang und Soja erinnerte sich, was ihr am Nachmittag die beiden Alten erzählt hatten. War schon ein guter Ort, jemanden kennenzulernen, so eine Geisterbahn.
Mitten im schönsten Herumgealber wurde es plötzlich dunkel im Labyrinth und die Spukgeräusche verstummten. Hatte die Stadt ihr nun doch den Saft abgedreht oder machte das Ordnungsamt ernst? Um diese Zeit? Sojas Sorgen kehrten zurück. Ihre Nerven lagen wegen des ganzen Theaters sowieso blank. Jetzt packte sie das nackte Grauen. Hatte jemand etwas mitgekriegt und sie angezeigt? Hatten die Kinder etwas ihren Eltern erzählt? Nicht, dass man sie wegen ihrer Verstöße von hier vertrieb? Sie wollte doch nur etwas Gutes tun! Ein klein wenig Freude bereiten! Es fehlte nicht viel und Soja hätte laut losgeheult.
Die beiden Brüder spürten sehr wohl die Veränderung, die sich bei ihrer neuen Freundin im Dunkel vollzog. Sie wussten nicht, wovor die Kleine Angst hatte, sie merkten nur, dass es so war. Um sie zu beruhigen, hakten sie Soja rechts und links unter, um sich gemeinsam durch die Finsternis ins Freie zu tasten. Das war schwieriger als gedacht. Keiner von ihnen hatte eine Taschenlampe dabei. Ihre Mobiltelefone steckten in den Jacken und die wiederum lagen vor der Tür beim Bierkasten.
Immer wieder schlugen ihnen Plastik-Knochen ins Gesicht oder sie verhedderten sich in künstlichen Spinnennetzen. Seit der Ventilator aus war, stand in der stickigen Anlage die Luft. Die Drei schwitzten und atmeten schwer. Soja schien es, als bewegten sie sich im Kreis. So groß war das Labyrinth doch gar nicht! Sie konnte nicht mehr. Vielleicht wollte ihr Unterbewusstsein auch einfach nicht wissen, was sie draußen erwartete. Soja hatte Angst. Sie brach regelrecht zusammen. Zum Glück hielten sie die beiden jungen Männer. Sie hockten sich zu ihr auf den Bretterboden und streichelten sie, nahmen sie in den Arm, küssten sie, redeten beruhigend auf sie ein. Soja genoss ihre Liebkosungen. Sie presste sich fest an die Jungs und erwiderte deren Küsse. So kam eines zum andern. Es war wie im Traum. Soja stöhnte unter den Berührungen von vier zärtlichen Händen. Die Furcht schwand und an ihre Stelle trat etwas anderes: Lust. Lust, allen Frust zu vergessen und für wenige Minuten oder Stunden einfach nur zu lieben und geliebt zu werden. Sie rissen sich ihre verschwitzten Klamotten vom Leib und bereiteten daraus ein Lager. Gut, gemütlich ging anders, aber mehr hätte keiner von ihnen jetzt gewollt.
Als die drei sehr viel später endlich den Ausgang der Geisterbahn erreichten, graute schon der Morgen. Zum Glück hatte niemand die Jacken mit den Telefonen geklaut. Bei näherer Besichtigung der elektrischen Anlage stellte sich heraus, dass nur die Hauptsicherung ausgefallen war. Weit und breit nichts von einem Denunzianten des Ordnungsamtes zu sehen. Der wäre wahrscheinlich auch eher rein gekommen, als draußen zu warten. Vor allem angesichts der seltsamen Geräusche, die mit Sicherheit dumpf durch die Geisterbahnwände gedrungen waren. Kein Grund zur Panik. Soja atmete auf. In diesem Moment spürte sie nichts als Glück und Dankbarkeit. Vielleicht mehr als jemals zuvor im Leben. Allen Unwägbarkeiten und Zukunftsängsten zum Trotz. Es bestand wohl doch ein Rest Hoffnung für die Menschheit. Und für sie selbst. Denn plötzlich hatte Soja das Gefühl, tatsächlich eine Vision für ihr Leben zu bekommen. Eine Vision, die alles verändern konnte und die ihr neue Kraft einflößte. Ganz so, wie ihr Vater immer gesagt hatte.
Sie verabschiedete sich von ihren Rettern. Nicht jedoch, ohne sie zu verpflichten, am Abend wieder vorbei zu schauen. Dann gern im Wohnwagen. Sie versprach, den Brüdern ein gutes Abendbrot zu bereiten. Eine Einladung, die diese ohne zu zögern annahmen.
Den Rest des Tages verbrachte Soja damit, über ihre Vision nachzudenken. Nämlich darüber, ob es denn möglich wäre, auch mit zwei netten Jungs gleichzeitig zusammen zu leben? Sobald diese verdammte Krise vorüber wäre, sollte sie das ausprobieren. Vielleicht könnte immer im Wechsel einer daheim bleiben, sich um das Winterquartier kümmern, später Kinder hüten. Der andere könnte sie begleiten und als „unentgeltlich mitarbeitender Ehemann“ helfen, genug Geld nach Hause zu bringen. Soja sah sich schon als Chefin eines florierenden kleinen Familienunternehmens. An hohen Feiertagen würden sie dann wieder zu dritt ins Bett steigen und Spaß haben. Das klang reizvoll. Das klang nach einem Plan! Toll. Wäre sie ohne Corona nie drauf gekommen. Sie würde die Brüder zum Abendbrot nach ihrer Meinung fragen.
Mit Widerspruch rechnete Soja allerdings nicht. Schon gar nicht, wenn sie ihnen anbot, von jedem von ihnen ein Kind zu bekommen. Mindestens. Die Frau wusste, was sie wollte.
Der Nachtwächter
Hommage à Paul Delvaux I - „Der Nachtwächter“
Mathilde ist glücklich. Sie arbeitet nicht. Nicht mehr. Nicht mehr, seit sie schwanger ist. Früher arbeitete Mathilde am Bahnhof. Da hieß sie noch Chantal. Warum gerade Chantal? Irgendein Typ hatte ihr gesagt, Frauen, die Chantal hießen, seien entweder Nutten oder aus Ostberlin. Was letztlich aufs Gleiche rauskäme. Mathilde stammt aus Ostberlin.
Der Mann erwachte in der Notaufnahme. Mathilde wurde freigesprochen. Er sei ihr besoffen vor die Füße getorkelt, gab sie zu Protokoll. Sie habe nicht ausweichen können. Die Abdrücke ihrer High Heels in seinem Gesicht und sein von der Polizei gemessener Alkoholpegel ließen keinen Zweifel an der Glaubwürdigkeit ihrer Version aufkommen. Seitdem nannte sie sich Chantal. Rein dienstlich, versteht sich. Jetzt erst recht!
Charles ist glücklich. Er arbeitet wieder. Er arbeitet als Nachtwächter bei einer Spedition am Bahnhof. Seit der Sache mit Mathilde haben sie ihn wieder eingestellt. Das heißt, erst haben sie ihm gekündigt. Dann … Nein, das wird zu kompliziert. Der Reihe nach.
Die Geschichte von Charles und Mathilde beginnt im letzten Frühjahr. Mitte Mai, genauer gesagt. Sie spielt in einer Stadt, groß genug, um Freiberuflerinnen wie Mathilde zu ertragen. Zu klein allerdings, dass die Frau bei ihrer Arbeit nicht für ein gewisses Aufsehen gesorgt hätte. Nicht, dass sie direkt eine Schönheit wäre. Das Leben hat Spuren in ihrem Gesicht hinterlassen. Aber diese Spuren passen zu ihr. Kein Püppchengesicht. Es ist „das gewisse Etwas“, wie die Leute sagen. Das macht sie interessant.
Das nutzte sie, als sie noch arbeitete. Wen sie ansprach, lächelnd, sympathisch, selbstsicher, ohne eine Spur von Scham, der konnte sich ihrem Charme kaum entziehen. Geschickt verwickelte Chantal potenzielle Kunden in ein Gespräch. Ihre Worte versponn sie zu verlockend glitzernden Satzfäden, aus denen sie eine Art Netz voller Wohlfühlgedanken webte. Daran blieben nachher manche Herren und einige Damen kleben. Chantal war eine geschickte Händlerin. Ihre Geschäfte liefen … sagen wir … den Möglichkeiten der kleinen Stadt angemessen … passabel.
Charles kannte Chantal seit vielen Jahren. Sie sahen sich oft. Beider Dienst begann ungefähr um die gleiche Zeit. Er war einer der wenigen Menschen in der Stadt, der wusste, dass sie in Wirklichkeit Mathilde hieß. Er durfte sie auch so nennen. Jedenfalls, wenn sonst niemand dabei war. Wenn auf dem Bahnhofsvorplatz nichts los war. Dann unterhielten sie sich manchmal. Wie Freunde, Arbeitskollegen. Charles hatte nie mit ihr geschlafen. Mathilde hatte ihn nie zu verführen versucht. Bis zu besagtem Freitagabend im Mai.
Es war ein kühler, regnerischer Nachmittag. Nach Wochen voller Sonne und frühsommerlicher Temperaturen schien der Winter ein letztes Mal seine Krallen auszufahren. Die meisten Leute saßen daheim am warmen Ofen und ließen es sich gut sein. Nur Mathilde und Charles drehten ihre Runden am Bahnhof. Er, weil sein Dienstplan es so vorschrieb. Sie, der Berufsehre wegen. Wäre ja noch schöner, sich von bisschen Kälte vertreiben zu lassen!
„Nicht viel los heute, was?“ erkundigte sich Charles. Eine rein rhetorische Frage. Nur um überhaupt etwas zu sagen.
„Hm“, antwortete Chantal, „bei dir aber auch nich.“
„Gott sei Dank.“
„Wann is eigentlich das letzte Mal was gewesen, in deiner Spedition?“
„Da warst du noch nicht in der Stadt. Ist bestimmt 15 Jahre her.“
„Und?“
„Hat einer versucht, das Tor aufzubrechen. Ich hab ihn auf frischer Tat ertappt. Seitdem wissen die Ganoven, dass sie an mir nicht vorbei kommen.“
„Hut ab. Sag mal, wie alt bist du eigentlich, mein Held? Ich rätsel schon, seit ich hier arbeite. Aber von dir erfährt man ja nüscht Privates. Den grauen Haaren nach und deinem wettergegerbten Gesicht, müsstest du eigentlich die Dinosaurier persönlich gekannt haben. Aber wenn man dich so hört und sieht, wie fit du bist, glaube ich, der Schein trügt.“
„Danke. Manchmal fühl ich mich ziemlich alt. Vor allem, wenn ich die Muckibudentypen seh, die neuerdings in unserem Security Service anheuern. Von der alten Garde, die den Laden aufgebaut hat, bin ich fast der Letzte.“
„Keine Ausflüchte, wie alt?“
„Ich werd demnächst 55.“
„Frau und Kinder?“
„Lange her. Würdest du mit jemandem zusammen bleiben wollen, der jede Nacht unterwegs ist?“
„Warum nich? Hätten wir den ganzen Tag für uns. Und die halbe Nacht hier draußen außerdem.“ Sie lachte. Er lachte.
„Stimmt allerdings. Geht dir ja nicht anders als mir.“ Dann wurde Charles nachdenklich. „Lange werde ich dir aber wohl nicht mehr Gesellschaft leisten. Weil so wenig passiert, wollen sie die Stelle kürzen. Es gibt seit letztem Monat eine PKW-Streife, besetzt mit zwei Jungspunden, die mehrere Objekte in der Stadt Nacht für Nacht stichprobenartig abfahren. Die Spedition verhandelt mit meinem Chef, ob die Jungs nicht meinen Job mit übernehmen können, um Kosten zu sparen.“
„Das tut mir leid.“
„Nicht zu ändern. Ist auch noch nicht amtlich. Die Versicherung stellt sich quer.“
„Die Versicherung? Logisch, is ein großes Gelände, oder? Reicht das nich bis runter zum Fluss? Jede Menge Platz, für Ganoven.“
„Stimmt. Und in den Hallen hast du mitunter ziemlich wertvolle Fracht. Einmal im Monat zum Beispiel kistenweise Uhren.“
„Aus der Schweiz?“
„Aus Deutschland, aus Glashütte. Nomos. Lange & Söhne. Echt Glashütte. Die kosten richtig Knete. Etliche zigtausend Euro das Stück. Nächsten Freitag, also heut in einer Woche, kommt wieder eine Lieferung. Die Kästchen liegen dann über Nacht in Spezialbehältern im Hauptgebäude. In einem großen Safe. Teure Uhren werden grundsätzlich übers Wochenende weitergeleitet, weil dann weniger los ist auf den Autobahnen. Dafür verwenden die auch keine LKW sondern gepanzerte Limousinen. Sicher und unauffällig. Als würde jemand zur Oma fahren. Zu Kaffee und Kuchen. Diesmal kommt außerdem ein Spezialauftrag dazu. Ein ganz großes Ding. Streng geheim, versteht sich.“
„Versteht sich.“
„Ich hab zufällig mitgekriegt, wie der Chef davon erzählte. Sagt dir ‚Grand Complication‘ was?“
„Nie gehört.“
„Die ‚Grand Complication‘ ist das Flaggschiff von Lange & Söhne. Von den Dingern wurden ganze sechs Exemplare gebaut. Kostenpunkt: je zwei Millionen!“
„Is nich wahr!“
„Doch. Dagegen schmeißt du jede Rolex weg. Diese Uhren sind natürlich ein gefundenes Fressen für den Geldadel in aller Welt. Die sechs Teile waren schon verkauft, da haben die Uhrmacher in Glashütte noch dran rumgeschraubt. Länger als ein Jahr dauerte die Herstellung. Kleine Kunstwerke. Jetzt sind sie endlich fertig. Der Clou: Die Spedition hat den Auftrag, alle sechs Exemplare ihren Käufern rund um den Globus persönlich zuzustellen. Möglichst ohne großes Aufsehen, ohne Polizeieskorte, so wie immer, damit niemand Verdacht schöpft. Ich sage nur Kaffee und Kuchen.“
„Das heißt, da drin liegen dann über Nacht zwei Millionen Euro?“
„Du hast mir nicht zugehört. Jede Uhr kostet zwei Millionen! Das macht zusammen zwölf! Deshalb will die Versicherung, dass hier nicht nur mit Kameras und Alarmanlagen gearbeitet wird. Es ist völlig unmöglich, alle Winkel komplett einzusehen. Gemeinsam suchen sie jetzt einen sinnvollen Kompromiss, haben sie gesagt. Was immer das heißen mag.“ Er zuckte mit den Schultern. „Na egal. Ich muss los. Bis nachher.“
„Bis gleich. Pass auf dich auf!“
Charles begab sich auf seine gewohnte Runde. Chantal stöckelte ein paar Mal fröstelnd auf und ab. Zwecklos. Weit und breit keine Menschenseele. Einzig ein älteres Ehepaar flanierte über den Platz hinunter zum Fluss. Zwei kleine Leutchen, Arm in Arm. Chantal sah ihnen wehmütig lächelnd hinterher. Beide waren festlich gekleidet. Ein runder Geburtstag oder eine goldene Hochzeit, vermutete sie.
Das Paar war aus dem Hotel auf der anderen Straßenseite gekommen. Ein gutes Haus. Konnte sich nicht jeder leisten. Durch die Fenster im Erdgeschoss schimmerten die Lichter edler Kristalllüster. Dort befand sich der Festsaal. Im Eingang stand ein Mann und rauchte. Musik und fröhliches Gelächter wehten herüber.
Die werden dem Trubel für ein paar Minuten entkommen wollen, dachte Chantal. Eigentlich beneidenswert, trotz ihres Alters. Die haben wenigstens jemanden, der für sie da ist, an den sie sich anlehnen können.
Chantal stellte sich schließlich in der Vorhalle des Bahnhofs unter. Hier zog es nicht so und um diese Zeit würde sie der Vorsteher nicht verscheuchen.
Charles kehrte zum Haupttor zurück. Er hatte die beiden Alten unterwegs getroffen. Die Straße zum Fluss führte über die Bahngleise direkt an der Verladerampe der Spedition vorbei. Dort befand sich ein neuralgischer Punkt von Charles‘ Revier. Das betreffende Tor schloss nicht richtig. Es hatte sich verzogen. Die Reparatur würde noch einige Tage in Anspruch nehmen. So lange wurden die schweren Riegel zusätzlich mit einer Petschaft versehen. Charles musste das rote Siegel auf jeder Runde gründlich mit seiner Taschenlampe kontrollieren.
Die beiden Leutchen waren stehen geblieben und hatten ihm zugesehen. Sie waren ins Gespräch gekommen. Das Paar feierte tatsächlich seine goldene Hochzeit. Die ganze große Verwandtschaft hatte sich eingefunden. Weil der Hauptteil der Festivität nun Gott sei Dank überstanden sei, wollten sie ein wenig frische Luft schnappen, bevor sie zu Bett gingen. Charles hatte artig gratuliert und eine gute Nacht gewünscht.
Zurück am Bahnhofsvorplatz hätte er es sich in seiner Pförtnerloge bequem machen können. Es gab einen kleinen Heizlüfter und einen Fernseher. Aber da hinein hätte er Chantal-Mathilde nicht mitnehmen dürfen. Dienstvorschrift. Und die Kleine allein in der Kälte stehen zu lassen, brachte er nicht fertig. Sie war sofort herüber gekommen, als sie ihn sah. Er merkte, dass sie jemanden zum Reden brauchte und ihm machte es Spaß, sich ausfragen zu lassen. Das verkürzte die Zeit.
„Und? Verbrecherjagd erfolgreich?“ Chantal kicherte.
„Fünf über den Jordan geschickt, zehn inhaftiert und geschätzte 2000 Geiseln befreit!“ grinste der Nachtwächter zur Antwort. „Bruce Willis ist ein Scheißdreck gegen mich!“
„Haste nich was vergessen?“
„Was denn?“
„Na, bei der Gelegenheit die halbe Stadt in die Luft zu jagen. Mit einem fröhlichen ‚Yippiajeh, Schweinbacke‘ auf den Lippen!“
„Ich dachte, das wär normal. Muss ich nicht extra erwähnen, oder?“
„Ah ja!“ Chantal fror inzwischen ziemlich heftig. Sie hatte sich nach den warmen Nächten der vergangenen Tage eindeutig zu dünn gekleidet. Charles überlegte, wie er ihr helfen könnte. Er bot ihr seinen Mantel. Sie lehnte dankend ab. Berufsehre. Trotzdem kuschelte sie sich ein bisschen an den Mann.
„Was machst du eigentlich, wenn du nicht mehr hier arbeitest? Gibt’s ‘nen anderen Job in der Firma?“
„Kaum. Nicht in meinem Alter. Wenn’s gut läuft, krieg ich ’ne kleine Abfindung.“
„Und was machste dann?“
„Wenn sie mich entlassen? Keine Ahnung. Vielleicht mach ich erstmal Urlaub. Vielleicht geb ich mir die Kugel.“ Er klopfte auf seinen Dienstrevolver. „Wird das Beste sein.“
„Spinnste?“
„Wieso nicht? Wenn ich nachts nicht mehr mit dir hier draußen palavern kann, sterbe ich sowieso vor lauter Langeweile.“ Es sollte lustig klingen. Mathilde spürte jedoch die Bitterkeit, die in seinen Worten mitschwang. Sie hätte ihn gern aufgemuntert. Nur wie? Ihr war ja selber nicht gerade nach fröhlichen Sprüchen, an so einem besch…eidenen Abend. Oder sollte sie vielleicht …?
„Du, sag mal, wann musste das nächste Mal los?“
„Frühestens in einer Stunde. Davor lohnt sich‘s nicht.“
„Kommst du so lange mit zu mir? Ich koch dir einen heißen Tee und wir haben bisschen Spaß mit Aufwärmen und so. Nur bis du wieder weg musst.“
„Mathilde, Hildchen, was soll der Quatsch? Du weißt so gut wie ich, dass ich im Dienst bin.“
„Na und? Erstens wohn ich gleich da drüben. Das is nich weiter weg von den Hallen als deine Pförtnerloge. Und zweitens hast du mir gerade erzählt, dass die demnächst sowieso nur noch alle paar Stunden vorbei schauen wollen. Also fangen wir einfach gleich damit an. Nachher bist du pünktlich wieder hier und drehst deine Runde. Wird dir gut tun, so‘n bisschen Abwechslung! Ich kenn ein paar Methoden …“
„Mathilde!“
„Ach komm, ich seh doch wie müde du bist. Wie frustriert, weil sie dich wegrationalisieren wollen. Ich bau dich wieder auf! Ich krieg das hin. Ich bin gut! Vertrau mir.“
„Hildchen, wenn dir kalt ist, dann geh einfach heim und wärm dich auf. Mach Schluss für heute. Dafür brauchst du mich nicht.“
„Und du?“
„Bei mir ist das was anderes. Ich hab Dienst. Ich arbeite.“
„Ach, und was, mein lieber Charly, meinst du wohl, was ich hier treibe? Spazieren gehen, weil die Luft so schön frisch is? Einfach so?“
„Hildchen.“
„Nix Hildchen. Ohne Freier geh ich nich nach Hause. Schon mal was von Arbeitsmoral und Berufsethos gehört? Ich arbeite im Dienstleistungssektor! Abkommandiert, den ehrenwerten Bürgern dieser schönen Stadt ihre tristen Stunden zu versüßen. Das is nich nur‘n Job, das is Berufung! Aber schön, frier ich mir eben den Arsch ab. Lieg ich morgen im Bett und sterbe an Lungenentzündung. Und danach komm ich als Geist zu dir. Als dein schlechtes Gewissen. Denn dann bist du dran schuld, dass ich in standhafter Erfüllung meiner Pflicht elendlich zugrunde gegangen bin. Nur weil sich der Herr zu fein war, einer armen kleinen Hure mal ein Schäferstündchen zu gönnen. Gefall ich dir gar nich?“
„Aber Hildchen, natürlich gefällst du mir. Sehr so gar. Ich hab dich gern.“
„Also?“
„Also was?“
„Kommst du jetzt mit oder lässt du mich erfrieren?“
„Hildchen, selbst wenn ich wollte, und du hast natürlich recht mit meinem Frust und so, aber …“
„Aber?“
„Ich hätte gar nicht genug Geld mit für dich. Also, wenn ich nachts arbeite, stecke ich nie Geld ein. Tut mir leid.“
„Du bist der größte Trottel, den ich kenne, Charly. Hab ich vergessen, zu erwähnen, dass heute mein Null-Euro-Flat-Rate-Tag is? Und für alle, die mitmachen, gibt’s ‘nen Tee als Zugabe gratis. Topp? Na los, komm schon, alter Esel. Mir is kalt.“
„Was ist mit dem Berufsethos?“ wagte der Widerstrebende einen letzten Versuch, dem Unvermeidlichen zu entgehen. „Ich mein, wenn du kein Geld nimmst …“
„Freier ist Freier. Sind lausige Zeiten und jetzt halt endlich die Klappe!“
Eine dreiviertel Stunde später stand der Nachtwächter wieder vor seinem Pförtnerhäuschen. Drüben im Hotel wurde es langsam ruhig. An den Fenstern huschten Schatten entlang. Wahrscheinlich Kellner, die den Saal aufräumten. Charles war seltsam zumute. Zum ersten Mal in seinem langen Berufsleben hatte er kurzzeitig seinen Posten verlassen. Das hätte ihm eigentlich Gewissensbisse bereiten sollen. Er sollte zerknirscht sein, niedergeschlagen.
Das ganze Gegenteil war der Fall! Der Mann fühlte sich fröhlich, leicht, zufrieden. Versöhnt mit sich und der Welt. Mit einem Küsschen an der Tür hatte Mathilde ihn hinaus in die Nacht entlassen. Es war wie ein Traum. Seit seiner Scheidung hatte er den Dienst nicht mehr so beschwingt angetreten. Auch wenn es heute natürlich nur die zweite Hälfte der Schicht war. Fröhlich pfeifend begab er sich auf seine gewohnte Runde.
Schon von weitem sah er, dass etwas nicht stimmte. Hinten an der Rampe. Am Tor klaffte ein Spalt. Ausgerechnet heute. Ausgerechnet jetzt. Charles begann zu rennen. Die Petschaft war erbrochen, das Gitter aufgeschoben. Am Boden Schleifspuren. Der Nachtwächter folgte ihnen. Sie führten von den Gleisen nach drinnen. Im Schatten der großen Halle, in der die Überseefrachten für den Zoll vorbereitet wurden, entdeckte Charles ein Bündel. Nein, zwei. Seine Taschenlampe schaffte Klarheit: Die beiden Alten, die goldene Hochzeit! Seine Schuld, seine Schuld, seine Schuld.
Die Polizei legte sich relativ früh fest. Ein Raubüberfall. Jemand hatte beide vor dem Tor erschlagen und sie dann auf das Firmengelände gezogen, um sie ungestört ausplündern zu können. Eine Befragung der Verwandten ergab, dass der Mann immer genug Bargeld bei sich trug. An diesem Abend wahrscheinlich über tausend Euro, weil er am nächsten Morgen im Hotel die Unterkunft für seine Gäste, Musik und Festschmaus zu bezahlen hatte. Er traute weder Banken noch dem Hotelsafe. Vermisst hatte die Jubilare niemand. Sie hatten sich vor ihrem Spaziergang förmlich von der Festgesellschaft verabschiedet und zur Nachtruhe abgemeldet.
In der Spedition schien ansonsten alles in Ordnung. Nichts deutete auf einen Einbruch hin. Es gab zwar ein paar Fußspuren in der Nähe des Hauptgebäudes, die denen an der Rampe ähnelten, aber das hatte nichts zu sagen. Hier liefen tagsüber so viele Leute rum. Auf den Überwachungskameras war auch nicht viel zu erkennen. Ein huschender Schatten. Mehr nicht. Zu dunkel. Die Alarmanlage löste wegen des defekten Schlosses nicht aus. Völlig abwegig der Gedanke, wie ausgerechnet der Nachtwächter den Mord hätte bemerken und verhindern sollen. Niemand machte Charles einen Vorwurf. Niemand.
Nur er selbst. Er glaubte, er hätte Schreie hören können. Das Quietschen des Tores. Schritte. Er hatte ein feines Gehör und wusste, welches Geräusch in sein Revier gehörte und welches nicht. Er hätte etwas hören müssen! Wenn … ja, wenn. Dieses „wenn“ machte ihn wahnsinnig. Vielleicht hätte er den Mörder auf frischer Tat ertappt. Vielleicht würden die beiden netten Menschen noch leben, hätte er sie rufen gehört. Vielleicht. Es war seine Schuld.
Deshalb gestand er dem Chef sein Fehlverhalten. Er bat nicht um Nachsicht oder Vergebung. Er wurde umstandslos gekündigt. Das Tor ließ die Spedition schnellstens reparieren, Zäune und Hallen mit zusätzlichen Alarmanlagen, Laternen und Kameras ausstatten. In der Pförtnerloge installierten sie eine neue vollautomatische Schaltzentrale, von der aus Polizei und Security über jede Unregelmäßigkeit umgehend informiert wurden. Zugriff zu den Sicherheitssystemen hatten nur die Kollegen der Security-Streife, die von Stund an die Überwachung übernahmen. Und natürlich die Geschäftsführung der Spedition.
Um Mathilde-Chantal machte Charles fortan einen großen Bogen. Überhaupt mied er das Areal am Bahnhof. Was hatte er dort verloren? Der Anblick hätte ihn nur noch trauriger gemacht. Und letztlich: Was wusste er schon von dem Mädchen, dass sich Chantal nannte? Was, wenn sie mit dem Räuber unter einer Decke steckte? Was, wenn sie ihn absichtlich weggelockt hatte? Aber selbst wenn nicht. Sie war zumindest mitschuldig. Hätte sie ihn nicht fortgelockt, wäre wahrscheinlich nichts passiert. So, wie all die 15 Jahre zuvor. Charles war verbittert. Er fraß seinen Kummer in sich hinein, hockte daheim vorm Fernseher und blies Trübsal. Zwei Tage, drei Tage, vier, fünf, sechs.
Am Freitag hielt er es nicht länger aus. Seit einer Woche war er jetzt außer Dienst. Genug Zeit zum Nachdenken. Er musste endlich zurück zum Bahnhof. Sich umsehn, wie die neuen Kollegen arbeiteten. Wie das funktionierte, ohne ihn. Mathilde? Mathilde. Vielleicht auch Mathilde.
Die Temperaturen waren im Laufe dieser Woche erheblich gestiegen. Vor dem Hotel standen Tische und Stühle. Charles setzte sich dorthin, bestellte ein leichtes Abendbrot, Kaffee. Kein Bier. Er wollte nüchtern bleiben. So saß er, als alle anderen längst gegangen waren. Bis die Kellner ihn baten, nun bitte drinnen Platz zu nehmen. Sie wollten die Stühle anketten. Charles zahlte.
Ein einziges Mal hatte er innerhalb der vergangenen drei Stunden die Streife auftauchen sehen. Zwei Jungs mit kahlen Schädeln und dicken Oberarmen. Sie hatten erst vor kurzem in der Firma angefangen. Sie checkten in der Pförtnerloge ihre Bildschirme, kurvten einmal mit dem Wagen ums Gelände und verschwanden. Das war so gegen halb neun. Jetzt ging es auf elf zu. Einmal in drei Stunden! Und das, wo doch heute die teuren Uhren im Haus lagerten. Waren die Leute so überzeugt, dass ihre Elektronik die Arbeit für sie erledigen würde?
Charles schlenderte den Weg zum Fluss hinab. Das Tor an der Rampe hatten sie nicht nur repariert, es war komplett neu. Auf einmal ging es. Interessant. Gleich zwei Kameras behielten die hell erleuchtete Zufahrt im Blick. Wie schön.
Unten am Ufer blieb Charles stehen. Er lauschte dem leisen Plätschern, beobachtete die Lichter der Stadt, wie sie auf den Wellen tanzten. Sehr zart, sehr lustvoll. Fast wie Mathilde.
Mathilde. Nein, die Frau traf keine Schuld. Bestimmt nicht. Er allein hatte alles verbockt. Sicher machte sie sich längst Gedanken, weil er so spurlos von der Bildfläche verschwunden war. Er sollte zu ihr gehen.
Der Streifenwagen seines ehemaligen Arbeitgebers rollte oben vorüber. Na endlich. Charles blickte zur Uhr. Halb zwölf. Um diese Zeit begann Chantals Schicht am Bahnhof. Jedenfalls, wenn sie nicht gerade daheim mit telefonisch vorbestellten Terminen zu tun hatte. Er beeilte sich.
Chantal war nicht da. Sie würde kommen. Er kannte sie. Und sei es nur ihrer sogenannten Berufsehre wegen. Charles suchte sich eine Bank. Nicht direkt auf dem Platz. Sie sollte ihn nicht gleich sehen. Zwischen Hotel und Bahnhof lag ein kleiner Park. Dort, unter einer alten Trauerweide, gab es ein kuschliges Eckchen, das die hellen Straßenlaternen nicht erreichten. Der Nachtwächter hatte oft beobachtet, wie junge Pärchen an dieser Stelle im Dunkel verschwanden. Jetzt nahm er hier Platz und wartete.
Gegen halb eins tauchte Chantal auf. Sie wirkte ziemlich mitgenommen. Wahrscheinlich hatte sie ein paar schwierige Kunden hinter sich, mutmaßte Charles. Vorstellen wollte er sich das lieber nicht. Schon gar nicht, seit er selbst in ihrem Liebesnest hatte einkehren dürfen. Oder müssen. Wie auch immer. Eine Weile beobachtete er sie schweigend. Dann räusperte er sich und rief nach ihr.
„Mathilde!“ Erschrocken fuhr sie herum. Der Ruf war ihm auf dem nächtlich leeren Platz eindeutig zu laut geraten.
„Wer … Charles?“ Sie sah nach rechts, nach links und erst als sicher schien, dass sie allein waren, kam sie in sein dunkles Versteck. „Sag mal spinnst du? Durch die ganze Stadt meinen Namen zu brüllen? Und was bildest du dir überhaupt ein, mir aufzulauern? Wo hast du gesteckt, die ganze Zeit? Weißt du, was ich mir für Sorgen mache? Ich bin ein seelisches Wrack, kann mich gar nich mehr auf meine Arbeit konzentrieren. Ich bin so fahrig, vergesslich und oberflächlich geworden in dieser einen Woche, dass ich Angst habe, alle meine Kunden zu verlieren. Ich dachte schon, du hättest Selbstmord gemacht, als ich von den beiden Toten und deiner Kündigung hörte. Die beiden Muckibudenheinis, die jetzt deinen Job machen, sind zwar Arschlöcher aber wenigstens gesprächig. Was man von dir nich sagen kann!“
„Du lässt mich ja nicht zu Wort kommen.“
„Werd nich spitzfindig! Wer hat mich denn die ganze Woche ohne Nachricht gelassen? Kerl, kannste dir nich vorstellen, dass es Menschen gibt, denen du was bedeutest? Aber was reg ich mich auf. Für dich bin ich wahrscheinlich nur ‘ne billige Nutte. Gerade gut genug zum Ficken. Muss man ja nich unbedingt Rücksicht drauf nehmen, wie sich die Frau fühlen tut. Hauptsache in Selbstmitleid versinken, was? Weißt du was? Du kannst mich mal!“ Wütend drehte sie sich um. Er sprang auf, hielt sie fest.
„Mathilde.“
„Lass mich los!“
„Mathilde, bitte. Hör mir zu. … Bitte entschuldige. Ich, ich wusste nicht, ob ich dir wirklich was bedeute. Ich hatte Angst, nach dieser Nacht, überhaupt einem Menschen zu begegnen. Ich fühle mich so verdammt schuldig.“
„Schuldig? Du? Wenn hier eine Schuldgefühle haben muss, dann bin ich das. Ich, ich, ich, du Trottel!“ Sie brach in Tränen aus. „Weißt du, wie oft ich mir in den letzten Tagen Vorwürfe gemacht habe? Ich war so egoistisch. Ich wollte dich … Na gut, ich wollte dir vor allem was Gutes tun, weil du so depri warst. Aber ich habe es verdammt nochmal genossen, mit dir zusammen zu sein. Weil du ’n Freund bist. ‘N echter Freund. Und bloß wegen so einem bisschen Glück, wegen so ‘ner scheiß halben Stunde glücklich sein, mussten vielleicht zwei Menschen sterben; und du verlierst deine Arbeit ohne Abfindung und bringst dich womöglich um. Weißt du, wie ich geheult hab? Ich hatte keinen Hunger mehr, konnte nich schlafen, wollte mich bei dir entschuldigen und hab dich nirgendwo gefunden!“ Bei jedem Wort trommelte sie mit ihren Fäusten gegen seine Brust. Ihre Tränen flossen ungehemmt. Er ließ sie trommeln und weinen, wühlte ein Taschentuch aus seinem Mantel und wischte ihr Gesicht trocken. Jedenfalls versuchte er es. Vergebene Liebesmüh. Sie konnte sich lange nicht beruhigen. Als ihr Weinkrampf endlich in ein ruhigeres Schluchzen überging, presste Charles sie an sich. Ganz leise stammelte er:
„Vergib mir!“ Sie schüttelte den Kopf.
„Du musst mir vergeben.“
„Schon geschehen.“ Er hob ihren Kopf und küsste sie. Mathilde blickte ihn erstaunt an.
„Aber du müsstest mich eigentlich hassen!“
„Quatsch. Ich hab es genauso genossen, mit dir zusammen zu sein. Ich bin einfach ein Idiot. Vielleicht bin ich zu lange Einzelgänger, als dass ich mir vorstellen kann, dass jemand mich vermissen könnte.“ Er schluckte. „Übrigens, ich habe über den Mord nachgedacht. Wahrscheinlich hätte ich sowieso nichts gehört. Die Einfahrt an der Rampe ist viel zu weit weg. Und so, wie die aussahen, hatten die Opfer vermutlich gar keine Zeit, zu schreien. Der Kerl muss schnell und präzise zugeschlagen haben.“
„Ach Charles.“
„Lass gut sein, Hildchen. Es ist wie es ist. Jetzt bin ich ja wieder bei dir.“ Er zog sie auf seine Bank. Sie lehnte sich an seine Schulter. So saßen sie, schwiegen und starrten auf den leeren Bahnhofsvorplatz.
Gegen zwei, Mathilde wollte ihn gerade bitten, sie nach Hause zu bringen, rauschte der Security-Wagen heran. Charles legte einen Finger an den Mund. Er wollte die Burschen nicht unnötig auf sich aufmerksam machen. Hätte möglicherweise albern gewirkt. Als ob er sie kontrollieren wolle. Durchaus möglich, dass sie ihn schon am Abend im Straßencafé des Hotels bemerkt hatten. Interessanterweise stieg diesmal nur einer aus, um zur Pförtnerloge zu gehen. Der andere wendete den Wagen und fuhr die Straße zur Rampe hinunter. Irgendwie wurde Charles das Gefühl nicht los, dass jetzt alles viel länger dauerte, als am Abend. Das Auto kam nicht zurück. Merkwürdig.
„Kannst du erkennen, was der macht?“ Mathilde schüttelte den Kopf.
„Keine Ahnung.“
„Ich kann schlecht hingehen und hallo sagen, oder?“
„Nee, du nich. Aber ich. Soll ich?“
„Hm, irgendwie stimmt da was nicht. Und dass der Typ mit dem Wagen nicht wiederkommt, irritiert mich auch.“
„Also soll ich?“
„Von mir aus. Aber sei vorsichtig. Du siehst, was das für bullige Kerle sind. Ich schleiche derweil dem Auto hinterher. Mal gucken, was der so lange treibt.“
„Okay. Wir sehen uns dann in einer Viertelstunde wieder hier auf dieser Bank?“
„Genau.“
Als Charles zur Rampe kam, glaubte er an ein Déjà-vu. Das Tor stand offen! Er schlich hinein. Das Auto parkte am Hauptgebäude. Machten die Kollegen ihre Kontrollgänge gründlicher als gedacht? Aber wieso ließen sie dann das Tor sperrangelweit offen? Warum ging der Typ nicht von vorn zu Fuß rein sondern fuhr mit dem Wagen vor?
Charles schlich zurück. Höchste Zeit, sonst würde ihm Mathilde wieder Vorwürfe machen. Dass er sie warten ließe oder so. Auf dem Platz war von Mathilde keine Spur zu entdecken. Weder am vereinbarten Treffpunkt noch an der Pförtnerloge. Sollte unerwartet ein Freier gekommen sein? Nein. Dann hätte sie ihm wenigstens eine Nachricht hinterlassen. Er blickte zur Pförtnerloge. Der junge Mann drinnen schien sich mit etwas auf dem Boden liegendem … Moment. Charles fuhr zusammen. Wäre es möglich …? Was, wenn Mathilde? Er glaubte zwar nicht daran, dass ein Mitarbeiter seines langjährigen Arbeitgebers sich an einer wehrlosen Frau vergehen würde, andererseits war Mathilde-Chantal aber auch keine normale Frau. Oder ob das zu Mathildes Plan gehörte? Nein, er durfte es nicht darauf ankommen lassen. Er musste nachsehen gehen.
So unbeteiligt, wie sich ein Spaziergänger nachts halb drei auf einem menschenleeren Platz geben kann, bummelte Charles zur Pförtnerloge hinüber. Der Knabe drinnen bemerkte ihn schon von weitem. Er kam aus dem Häuschen, Charles zu begrüßen.
„Ach nee, was ‘ne nette Überraschung. Der Herr Kollege. Kannste nicht schlafen oder willste gucken, ob ich alles richtig mache?“
„Hallo. Ersteres. Wenn man fast drei Jahrzehnte jede Nacht draußen war, fällt der Nachtschlaf schwer. Wie läuft’s denn so?“
„Prima, alles bestens. Schön, dass du mal vorbei schaust.“ Seine Augen straften die Worte Lügen. Charles fiel auf, dass der Mann hektisch den Platz nach weiteren ungebetenen Gästen absuchte.
„Ja, dachte halt so, machst mal einen Spaziergang und sagst hallo, falls ihr gerade hier seid.“
„Soso. Na schön, willste mit reinkommen? Dir die neue Technik ansehen?“
„Na das ist doch sicher nicht gestattet, oder?“
„Aber hallo, bei einem Kollegen? Noch dazu, wo du dein ganzes Leben hier gedient hast. Komm schon!“
Die scheißfreundlichen Töne, die der Mensch anschlug, machten Charles misstrauisch. Er hatte zwar seinen Dienstrevolver abgeben müssen, die ziemlich große, stabile Stabtaschenlampe trug er allerdings aus alter Gewohnheit nach wie vor stets in der Manteltasche. Um die schlossen sich jetzt seine Finger. Charles wusste, dass er dem Kerl rein kräftemäßig unterlegen war. Am Ende konnte für ihn nur das Überraschungsmoment den Ausschlag geben.
Der Junge hielt Charles die Tür auf. Charles lehnte dankend ab.
„Nach dir Kollege, du bist hier der Hausherr.“
„Ach was, Alter vor Schönheit.“
„Unter keinen Umständen. Ich weiß, was sich gehört.“ Bei diesen Worten trat Charles einen Schritt zurück. Er merkte, wie der andere nervös wurde und wollte unbedingt außer Reichweite seiner Fäuste bleiben. Der Junge knurrte zwar. Seine Hand zuckte kurz zur Dienstpistole, dann gab er missmutig nach und schritt voran. Aller Wahrscheinlichkeit nach war er überzeugt, mit dem Alten auch so fertig zu werden, wenn der erstmal in der Falle säße. Beim Eintritt gab er sich Mühe, die linke Seite mit der breiten Schreibtischplatte für Anmeldeformalitäten zu verdecken.
Charles lenkte folgerichtig seinen Blick genau zu dieser Platte und sah am Boden unter ihr, was er vermutet hatte. Ohne auch nur eine Sekunde zu zögern, zog er seine Taschenlampe dem Kerl über den Kopf. Es krachte wie brechende Knochen. Die Schädeldecke.
Dem alten Nachtwächter war es gerade völlig egal, wie unfair es sein mochte, jemanden von hinten niederzuschlagen. Mit Fairness hatte das hier nichts zu tun. Es ging ums nackte Überleben. Der Mann schoss herum, zückte den Revolver und blickte Charles mit glasigen Augen an. Dann brach er ohne ein Wort zusammen.
Charles zitterten zwar die Knie, doch wusste er, dass er jetzt keine Zeit hatte, Schwäche zu zeigen. Als erstes prüfte er, ob der Mann noch lebte, entwand dem Bewusstlosen die Waffe und durchsuchte ihn nach den in der Branche üblichen Kabelbindern, um ihn zu fesseln. Anschließend kümmerte er sich um die zusammengekrümmt am Boden liegende Mathilde. Der Mistkerl hatte sie mit ebensolchen Kabelbindern zu einem handlichen Päckchen verschnürt und unter den Schreibtisch geschoben. Es dauerte eine Weile, bis Charles ein Messer gefunden hatte, mit dem sich die Plastikbändchen lösen ließen. Mathildes Mund war mit festem Gaffa-Tape zugeklebt. Das abzuziehen musste dem Mädchen Schmerzen bereiten. Deswegen wollte er es sie selbst machen lassen, was ihm erneut Tadel einbrachte.
„Du hättest mir wirklich erst den Mund losmachen können, du Hirni! Ich wär fast erstickt!“
„Entschuldige. Ich wollte dir nicht weh tun.“
„Schönen Dank auch. Schwamm drüber. Gott sei Dank, dass du überhaupt gekommen bist. Ich hatte das Gefühl, der Typ meint’s ernst.“
„Was hast du denn rausgefunden? Ohne Not wird er dich nicht verschnürt haben, oder?“
„Da kannste Gift drauf nehmen. Wie ich rüber bin, hat der anscheinend gerade sämtliche Sicherungen gekappt.“
„Das geht doch gar nicht!“
„Oder den Alarm abgeschaltet oder was weiß denn ich. Jedenfalls glaub ich nich, dass der nur einfach so die Kontrollmonitore abgeschaltet hat.“
Mathilde hatte recht. Charles sah sich um. Sämtliche Sicherheitssysteme einschließlich des Alarmes, der das Gelände mit der Polizei verband, waren abgeschaltet. Irgendwie musste es der Kerl geschafft haben, die Stromkreise zu überbrücken. Jetzt fiel ihm auch ein, was er vorhin am Tor vermisst hatte: Den Alarm! Der hätte zweifellos sofort losgehen müssen, denn laut Dienstanweisung hatten Begehungen und Kontrollen durch die Security immer vom Haupteingang aus zu erfolgen. Die hinteren Tore blieben nachts geschlossen.
„Hm, dabei hast du ihn also ertappt und als er merkte, dass du was mitgekriegt hast, hat er dich gekidnappt.“
„So in etwa. Bloß wieso denn nur?“
„Tja, wieso? … Die Uhren!“
„Die zwölf Millionen Dollar Uhren?“
„Euro, meine Liebe, Euro. Das ist ein bisschen mehr.“
„Besserwisser. Und nun?“
„Ruf die Polizei an! Ich kümmer mich um das Tor, damit uns der andere nicht entwischt.“