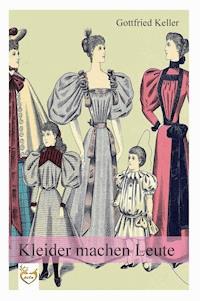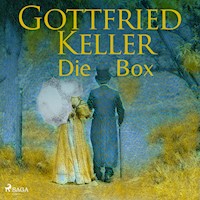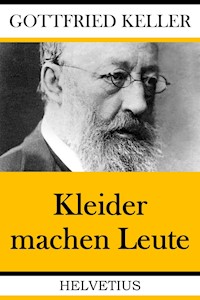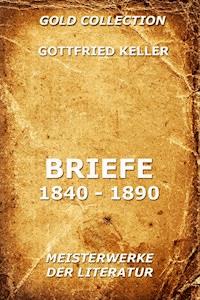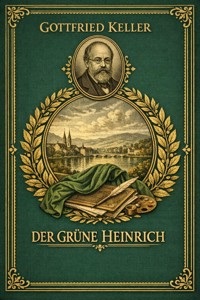Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Satire über das Schreiben von Liebesbriefen: Viggi hat die wohlhabende Gritli geheiratet und verdient sein Geld als Kaufmann, sieht sich jedoch immer mehr als talentierten Schriftsteller. Von einer Geschäftsreise schreibt er ihre glühende Liebesbriefe und erwartet ebenso wortgewaltige Antwortbriefe, was die pragmatische Frau jedoch überfordert. In ihrer Not hat sie eine Idee, wie der schüchterne Nachbar Wilhelm ihr unwissentlich helfen kann...-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 120
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gottfried Keller
Die missbrauchten Liebesbriefe
Saga
Die missbrauchten LiebesbriefeCoverbild / Illustration: Shutterstock Copyright © 1865, 2020 Gottfried Keller und SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788726555141
1. Ebook-Auflage, 2020
Format: EPUB 2.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit Zustimmung von SAGA Egmont gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk
– a part of Egmont www.egmont.com
Die missbrauchten Liebesbriefe.
Viktor Störteler, von den Seldwylern nur Viggi Störteler genannt, lebte in behaglichen und ordentlichen Umständen, da er ein einträgliches Speditions- und Warengeschäft betrieb und ein hübsches, gesundes und gutmütiges Weibchen besass. Dieses hatte ihm ausser der sehr angenehmen Person ein ziemliches Vermögen gebracht, welches Gritli von auswärts zugefallen war, und sie lebte zutulich und still bei ihrem Manne. Ihr Geld aber war ihm sehr förderlich zur Ausbreitung seiner Geschäfte, welchen er mit Fleiss und Umsicht oblag, dass sie trefflich gediehen. Hierbei schützte ihn eine Eigenschaft, welche, sonst nicht landesüblich, ihm einstweilen wohl zustatten kam. Er hatte seine Lehrzeit und einige Jahre darüber nämlich in einer grösseren Stadt bestanden und war dort Mitglied eines Vereines junger Comptoiristen gewesen, welcher sich wissenschaftliche und ästhetische Ausbildung zur Aufgabe gestellt hatte. Da die jungen Leute ganz sich selbst überlassen waren, so übernahmen sie sich und machten allerhand Dummheiten. Sie lasen die schwersten Bücher und führten eine verworrene Unterhaltung darüber; sie spielten auf ihrem Theater den Faust und den Wallenstein, den Hamlet, den Lear und den Nathan; sie machten schwierige Konzerte und lasen sich schreckbare Aufsätze vor, kurz, es gab nichts, an das sie sich nicht wagten.
Hiervon brachte Viggi Störteler die Liebe für Bildung und Belesenheit nach Seldwyla zurück; vermöge dieser Neigung aber fühlte er sich zu gut, die Sitten und Gebräuche seiner Mitbürger zu teilen; vielmehr schaffte er sich Bücher an, abonnierte in allen Leihbibliotheken und Lesezirkeln der Hauptstadt, hielt sich die „Gartenlaube“ und unterschrieb auf alles, was in Lieferungen erschien, da hier ein fortlaufendes, schön verteiltes Studium geboten wurde. Damit hielt er sich in seiner Häuslichkeit und zugleich seine Umstände vor Schaden bewahrt. Wenn er seine Tagesgeschäfte munter und vorsichtig durchgeführt, so zündete er seine Pfeife, an, verlängerte die Nase und setzte sich hinter seinen Lesestoff, in welchem er mit grosser Gewandtheit herumfuhr. Aber er ging noch weiter. Bald schrieb er verschiedene Abhandlungen, welche er seiner Gattin als „Essays“ bezeichnete, und er sagte öfter, er glaube, er sei seiner Anlage nach ein Essayist. Als jedoch seine Essays von den Zeitschriften, an welche er sie sandte, nicht abgedruckt wurden, begann er Novellen zu schreiben, die er unter dem Namen, „Kurt vom Walde“ nach allen möglichen Sonntagsblättchen instradierte. Hier ging es ihm besser, die Sachen erschienen wirklich feierlich unter dem herrlichen Schriftstellernamen in den verschiedensten Gegenden des Deutschen Reiches, und bald begann hier ein Roderich vom Tale, dort ein Hugo von der Insel und wieder dort ein Gänserich von der Wiese einen stechenden Schmerz zu empfinden über den neuen Eindringling. Auch konkurrierte er heimlich bei allen ausgeschriebenen Preissovellen und vermehrte hierdurch nicht wenig die angenehme Bewegtheit seines eingezogenen Lebens. Neuen Aufschwung gewann er stets auf seinen kürzeren oder längeren Geschäftsreisen, wo er dann in den Gasthöfen manchen Gesinnungsverwandten traf, mit dem sich ein gebildetes Wort sprechen liess; auch der Besuch der befreundeten Redaktionsstübchen in den verschiedenen Provinzen gewährte neben den Handelsgeschäften eine gebildete Erholung, obgleich diese hier und da eine Flasche Wein kostete.
Ein Haupterlebnis feierte er eines Tages an der abendlichen Wirtstafel in einer mittleren deutschen Stadt, an welcher nebst einigen alten Stammgästen des Ortes mehrere junge Reisende sassen. Die würdigen alten Herren mit weissen Haaren führten ein gemächliches Gespräch über allerlei Schreiberei, sprachen von Cervantes, von Rabelais, Sterne und Jean Paul, sowie von Goethe und Tieck und priesen den Reiz, welchen das Verfolgen der Kompositionsgeheimnisse und des Stiles gewähre, ohne dass die Freude an dem Vorgetragenen selbst beeinträchtigt werde. Sie stellten einlässliche Vergleichungen an und suchten den roten Faden, der durch all dergleichen hindurchgehe; bald lachten sie einträchtig über irgendeine Erinnerung, bald erfreuten sie sich mit ernstem Gesicht über eine neugefundene Schönheit, alles ohne Geräusch und Erhitzung, und endlich, nachdem der eine seinen Tee ausgetrunken, der andere sein Schöppchen geleert, klopften sie die langen Tonpfeifen aus und begaben sich auf etwas gichtischen Füssen zu ihrer Nachtruhe. Nur einer setzte sich unbeachtet in eine Ecke, um noch die Zeitung zu lesen und ein Glas Punsch zu trinken.
Nun aber entwickelte sich unter den jüngeren Gästen, welche bislang horchend dagesessen hatten, das Gespräch. Einer fing an mit einer spöttischen Bemerkung über die altväterische Unterhaltung dieser Alten, welche gewiss vor vierzig Jahren einmal die Schöngeister dieses Nestes gespielt hätten. Diese Bemerkung wurde lebhaft aufgenommen, und indem ein Wort das andere gab, entwickelte sich abermals ein Gespräch belletristischer Natur, aber von ganz anderer Art. Von den verjährten Gegenständen jener Alten wussten sie nicht viel zu berichten als das und jenes vergriffene Schlagwort aus schlechten Literargeschichten; dagegen entwickelte sich die ausgebreitetste und genaueste Kenntnis in den täglich auftauchenden Erscheinungen leichterer. Art und aller der Personen und Persönchen, welche sich auf den tausend grauen Blättern stündlich unter wunderbaren Namen herumtummeln. Es zeigte sich bald, dass dies nicht solche Ignoranten von alten Gerichtsräten und Privatgelehrten, sondern Leute vom Handwerk waren. Denn es dauerte nicht lange, so hörte man nur noch die Worte Honorar, Verleger, Clique, Koterie und was noch mehr den Zorn solchen Volkes reizt und seine Phantasie beschäftigt. Schon tönte und schwirrte es, als ob zwanzig Personen sprächen, die tückischen Äuglein blinkerten, und eine allgemeine glorreiche Erkennung konnte nicht länger ausbleiben. Da entlarvte sich dieser als Guido von Strahlheim, jener als Oskar Nordstern, ein dritter als Kunibert vom Meere. Da zögerte auch Viggi nicht länger, der bisher wenig gesprochen, und wusste es mit einiger Schüchternheit einzuleiten, dass er als Kurt vom Walde erkannt wurde. Er war von allen gekannt, sowie er ebenso alle kannte, denn diese Herren, welche ein gutes Buch jahrzehntelang ungelesen liessen, verschlangen alles, was von ihresgleichen kam, auf der Stelle, es in allen Kaffeebuden zusammensuchend, und zwar nicht aus Teilnahme; sondern aus einer sonderbaren Wachsamkeit.
„Sie sind Kurt vom Walde?“ hiess es dröhnend. „Ha! willkommen!“ Und nun wurden mehrere Flaschen eines unechten, wohlfeilen und sauren Weines bestellt, der billigste unter Siegel, der im Hause war, und es hob erst recht ein energisches Leben an. Nun galt es zu zeigen, dass man Haare auf den Zähnen habe! Alle Männer, die es zu irgendeinem Erfolge gebracht und in diesem Augenblicke Hunderte von Meilen entfernt vielleicht schon den Schlaf der Gerechten schliefen, wurden auf das gründlichste demoliert; jeder wollte die genauesten Nachrichten von ihrem Tun und Lassen haben, keine Schandtat gab es, die ihnen nicht zugeschrieben wurde, und der Refrain bei jedem war schliesslich ein trocken sein sollendes: „Er ist übrigens Jude!“ Worauf es im Chor ebenso trocken hiess: „Ja, er soll ein Jude sein!“
Viggi Störteler rieb sich entzückt die Hände und dachte: „Da bist du einmal vor die rechte Mühle gekommen! Ein Schriftsteller unter Schriftstellern! Ei! was das für geriebene Geister sind! Welches Verständnis und welch sittlicher Zorn!“
In dieser Nacht und bei diesem Schwefelwein ward nun, um der schlechten Welt vom Amte zu helfen und ein neues Morgenrot herbeizuführen, die förmliche und feierliche Stiftung einer „neuen Sturm- und Drangperiode“ beschlossen, und zwar mit planvoller Absicht und Ausführung, um diejenige Gärung künstlich zu erzeugen, aus welcher allein die Klassiker der neuen Zeit hervorgehen würden.
Als sie jedoch diese gewaltige Abrede getroffen, konnten sie nicht weiter, sondern senkten alsbald ihre Häupter und mussten das Lager suchen; denn diese Propheten ertrugen nicht einmal guten, geschweige denn schlechten Wein und büssten jede kleine Ausschreitung mit grosser Abschwächung und übelkeit.
Als sie abgezogen waren, fragte der alte Herr, welcher zurückgeblieben war und sich höchlich an dem Treiben ergötzt hatte, den Kellner, was das für Leute wären? „Zwei davon“, sagte dieser, „sind Geschäftsreisende, ein Herr Störteler und ein Herr Huberl; der dritte heisst Herr Stralauer, doch nur den vierten kenn’ ich näher, der nennt sich. Dr. Mewes und hat sich vergangenen Winter einige Wochen hier aufgehalten. Er gab im Tanzsaal beim Blauen Hecht, wo ich damals war, Vorlesungen über deutsche Literatur, welche er wörtlich abschrieb aus einem Buche. Dasselbe musste aus irgendeiner Bibliothek gestohlen worden sein, dem Einbande nach zu urteilen, und war ganz voll Eselsohren, Tinten- und Ölflecke. Ausser diesem Buchen besass er noch einen zerzausten Leitfaden zur französischen Konversation und ein Kartenspiel mit obszönen Bildern darin, wenn man es gegen das Licht hielt. Er pflegte jenes Buch im Bett auszuschreiben, um die Heizung zu sparen; da verschüttete er schliesslich das Tintenfass über Steppdecke und Leintuch, und als man ihm eine billige Entschädigung in die Rechnung setzte, drohte er, den Blauen Hecht in seinen Schriften und ,Feuilletons‘ in Verruf zu bringen. Da er sonst allerlei hässliche Gewohnheiten an sich hatte, wurde er endlich aus dem Hause getan. Er schreibt übrigens unter dem Namen Kunibert vom Meere allerhand süssliche und nachgeahmte Sachen.“
„Was Teufel!“ sagte der Alte, „Ihr wisst ja wie ein Mann vom Handwerk über diese Dinge zu reden, Meister Georg!“ Der Kellner errötete, stockte ein wenig und sagte dann: „Ich will nur gestehen, dass ich selbst anderthalb Jahre Schriftsteller gewesen bin!“ „Ei der Tausend!“ rief der Alte, „und was habt Ihr denn geschrieben?“ „Das weiss ich kaum gründlich zu berichten,“ fuhr jener fort, „ich war Aufwärter in einem Kaffeehaus, wo sich eine Anzahl Leute von der Gattung unserer heutigen Gäste beinahe den ganzen Tag aufhielt. Das lag herum, flanierte, räsonierte, durchstöberte die Zeitungen, ärgerte sich über fremdes Glück, freute sich über fremdes Unglück und lief gelegentlich nach Hause, um im grössten Leichtsinn schnell ein Dutzend Seiten zu schmieren; denn da man nichts gelernt hatte, so besass man auch keinen Begriff von irgendeiner Verantwortlichkeit. Ich wurde bald ein Vertrauter dieser Herren, ihr Leben schien mir meiner dienstbaren Stellung weit vorzuziehen, und ich wurde ebenfalls ein Schriftsteller. Auf meiner Schlafkammer verbarg ich einen Pack zerlesene Nummern von französischen Zeitungen, die ich in den verschiedenen Wirtschaften gesammelt, wo ich früher gedient hatte, ursprünglich, um mich darin ein wenig in die Sprache hineinzubuchstabieren, wie es einem jungen Kellner geziemt. Aus diesen verschollenen Blättern übersetzte ich einen Mischmasch von Geschichtchen und Geschwätz allerart, auch über Persönlichkeiten, die ich nicht im mindesten kannte. Aus Unkenntnis der deutschen Sprache behielt ich nicht nur öfter die französische Wort- und Satzstellung, sondern auch alle möglichen Gallizismen bei, und die Salbadereien, welche ich aus meinem eigenen Gehirne hinzufügte, schrieb ich dann ebenfalls in diesem Kauderwelsch, welches ich für echt schriftstellerisch hielt. Als ich ein Buch Papier auf solche Weise überschmiert hatte, anvertraute ich es als ein Originalwerk meinen Herren und Freunden, und siehe, sie nahmen es mit aller Aufmunterung entgegen und wussten es sogleich zum Druck zu befördern. Es ist etwas Eigentümliches um die schlechten Skribenten. Obgleich sie die unverträglichsten und gehässigsten Leute von der Welt sind, so haben sie doch eine unüberwindliche Neigung, sich zusammenzutun und ins Massenhafte zu vermehren, gewissermassen um so einen mechanischen Druck nach der oberen Schicht auszuüben. Mein Büchlein wurde sofort als das sehr zu beachtende Erstlingswerk eines geistreichen jungen Autors verkündet, welcher deutsche Schärfe des Urteils mit französischer Eleganz verbinde, was wohl von dessen mehrjährigem Aufenthalt in Paris herrühre. Ich war nämlich in der Tat ein halbes Jahr in dieser Stadt bei einem deutschen Gastwirt gewesen. Da unter dem übersetzten Zeuge mehrere pikante, aber vergessene Anekdoten waren, so zirkulierten diese, unter Anführung meines Buches, alsbald durch eine Menge von Blättern. Ich hatte nich auf dem Titel George d’Esan, welches eine Umkehrung meines ehrlichen Namens Georg Nase ist, genannt. Nun hiess es überall: George Desan in seinem interessanten Buche erzählt folgenden Zug von dem oder von jenem, und ich wurde dadurch so aufgeblasen und keck, dass ich auf der betretenen Bahn ohne weiteren Aufenthalt fortrannte wie eine abgeschossene Kanonenkugel.“
„Aber zum Teufel!“ sagte jetzt der Alte, „was hattet Ihr denn nur für Schreibestoff? Ihr konntet doch nicht immer von Eurem Pack alter Zeitungen zehren?“
„Nein! Ich hatte eben keinen Stoff als sozusagen das Schreiben selbst. Indem ich Tinte in die Feder nahm, schrieb ich über diese Tinte. Ich schrieb, Kaum dass ich mich zum Schriftsteller ernannt sah, über die Würde, die Pflichten, Rechte und Bedürfnisse des Schriftstellerstandes, über die Notwendigkeit seines Zusammenhaltens gegenüber den andern Ständen, ich schrieb über das Wort Schriftsteller selbst, unwissend, dass es ein echt deutsches und altes Wort ist, und trug auf dessen Abschaffung an, indem ich andere, wie ich meinte, viel geistreichere und richtigere Benennungen ausheckte und zur Erwägung vorschlug, wie z. B. Schriftner, Dinterich, Schriftmann, Buchner, Federkünstler, Buchmeister usf. Auch drang ich auf Vereinigung aller Schreibenden, um die Gewährleistung eines schönen und sichern Auskommens für jeden Teilnehmer zu erzielen, kurz, ich regte mit allen diesen Dummheiten einen erheblichen Staub auf und galt eine Zeitlang für einen Teufelskerl unter den übrigen Schmierpetern. Alles und jedes bezogen wir auf unsere Frage und kehrten immer wieder zu den ,Interessen‘ der Schriftstellerei zurück. Ich schrieb, obgleich ich der unbelesenste Gesell von der Welt war, ausschliesslich nur über Schriftsteller, ohne deren Charakter aus eigener Anschauung zu kennen, komponierte ,ein Stündchen bei X.‘, oder ,ein Besuch bei N.‘, oder ,eine Begegnung mit P.‘, oder ,einen Abend bei der Q.‘ und dergleichen mehr, was ich alles mit unsäglicher Naseweisheit; Frechheit und Kinderei ausstattete. Überdies betrieb ich eine rührige Industrie mit sogenannten ,Mitgeteilts‘ nach allen Ecken und Enden hin, indem ich allerlei Neuigkeitskram und Klatsch verbreitete. Wenn gerade nichts aus der Gegenwart vorhanden war, so übersetzte ich die Sesenheimer Idylle wohl zum zwanzigsten Male aus Goethes schöner Sprache in meinen gemeinen Jargon und sandte sie als neue Forschung in irgendein Winkelblättchen. Auch zog ich aus bekannten Autoren solche Stellen, über welche man in letzter Zeit wenig gesprochen hatte, wenigstens nicht meines Wissens, und liess sie mit einigen albernen Bemerkungen als Entdeckung herumgehen. Oder ich schrieb wohl aus einem eben herausgekommenen Bande einen Brief, ein Gedicht aus und setzte es als handschriftliche Mitteilung in Umlauf, und ich hatte immer die Genugtuung, das Ding munter durch die ganze Presse zirkulieren zu sehen. Insbesondere gewährte mir der Dichter Heine die fetteste Nahrung; ich gedieh an seinem Krankenbette förmlich wie die Rübe im Mistbeete.“
„Aber Ihr seid ja ein ausgemachter Halunke gewesen!“ rief der alte Herr mit Erstaunen, und Meister Georg versetzte: „Ich war kein Halunke, sondern eben ein armer Tropf, welcher seine Kellnergewohnheiten in eine Tätigkeit übertrug und in Verhältnisse, von denen er weder einen sittlichen noch einen unsittlichen, sondern gar keinen Begriff hatte. Überdies brachte mein Verfahren niemandem einen wirklichen Schaden.“