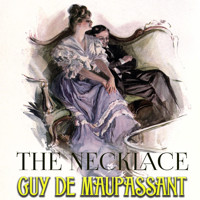0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Erotik
- Serie: Erotik bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
"Die Nichten der Frau Oberst" (Les cousines de la colonelle) ist seit Jahrzehnten nicht im Handel erschienen. Die Moralauffassungen vergangener Zeiten gestattete es nicht. Madame Briquart will ihre beiden jungen, hübschen Nichten verheiraten. Schnell wird ihr Salon zu einem Treffpunkt der Junggesellen von ganz Paris. Der (vermutete) Autor Guy de Maupassant schilderte die amourösen Abenteuer der bürgerlichen, französischen Mitte in einer bis dahin ungekannten Deutlichkeit, aber auch in einer schriftstellirischen Qualität, wie nur er es konnte. Null Papier Verlag
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 338
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Guy de Maupassant
Die Nichten der Frau Oberst
Guy de Maupassant
Die Nichten der Frau Oberst
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] 2. Auflage, ISBN 978-3-954186-85-3
null-papier.de/neu
Inhaltsverzeichnis
Autor
Erster Teil
I. Kapitel.
II. Kapitel.
III. Kapitel.
IV. Kapitel.
V. Kapitel.
VI. Kapitel.
VII. Kapitel.
VIII. Kapitel.
IX. Kapitel.
X. Kapitel.
XI. Kapitel.
Zweiter Teil
I. Kapitel.
II. Kapitel.
III. Kapitel.
IV. Kapitel.
V. Kapitel.
VI. Kapitel.
VII. Kapitel.
VIII. Kapitel.
IX. Kapitel.
X. Kapitel.
XI. Kapitel.
XII. Kapitel.
XIII. Kapitel.
XIV. Kapitel.
XV. Kapitel.
XVI. Kapitel.
XVII. Kapitel.
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Erotik bei Null Papier
Die 120 Tage von Sodom
Justine
Erotik Früher
Fanny Hill
Venus im Pelz
Juliette
Casanova – Geschichte meines Lebens
Gefährliche Liebschaften
Traumnovelle
Die Memoiren einer russischen Tänzerin
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Die Nichten der Frau Oberst
Ein Klassiker der erotischen Literatur. Mit Aktaufnahmen aus der Belle Époque.
»Die Nichten der Frau Oberst« (Les cousines de la colonelle) ist seit Jahrzehnten nicht im Handel erschienen. Die Moralauffassungen vergangener Zeiten gestattete es nicht.
Madame Briquart will ihre beiden jungen, hübschen Nichten verheiraten. Schnell wird ihr Salon zu einem Treffpunkt der Junggesellen von ganz Paris.
Der (vermutete) Autor Guy de Maupassant schilderte die amourösen Abenteuer der bürgerlichen, französischen Mitte in einer bis dahin ungekannten Deutlichkeit, aber auch in einer schriftstellirischen Qualität, wie nur er es konnte.
Der Busen des jungen Mädchens, den ihr leichtes Mieder schlecht verteidigte, hüpfte an seiner Brust. Er fühlte, wie dieses junge Fleisch instinktiv vor Liebe und Begehrlichkeit zitterte und bebte; er verlor den Kopf, tauchte seine fiebernden Hände in die halb gelösten Haare seiner Gefährtin, atmete den feinen Duft, der sich daraus erhob und ließ eine magnetische Hand über ihre brennenden Arme gleiten.
Autor
Maupassant wurde am 05. August 1850 im Schloss Miromesnil, in der Normandie im Norden Frankreichs geboren. Seine Eltern waren aus adligem, normannischen Geschlecht. Seine frühe Jugend verlief glücklich. Seine ersten Schwierigkeiten im Leben bekam er, als er während seiner Internatszeit ein Spottgedicht auf einen Erzieher verfasste und deswegen die Schule verlassen musste.
Mehrere Jahre verbrachte er als Beamter im Pariser Marineministerium. Während dieser Zeit entstanden seine ersten schriftstellerischen Arbeiten, zu der ihn sein Freund Flaubert ermuntert hatte. Schon in seiner ersten Erzählung von 1880 »Boule de suif« (Fettklößchen) erkennt man den Meister der Novelle. In mehr als 260 Arbeiten bewährte sich diese einmalige Kunst, die er in unermüdlicher Arbeit bis zu seinem frühen Tode vorantrieb (7. Juli 1893).
Maupassant liebte die künstlerische Analyse des Banalen. Seine Helden entstammen allen sozialen Schichten: Fischer und Bauern der Normandie, Provinzbürgertum, Pariser Beamtenwelt, Halbwelt und niedere Aristokratie. Und in allem erkennt er das immer gleiche Bild menschlicher Durchschnittlichkeit: ordinäre Erotik, Habsucht, Grausamkeit, in Banalität erstickende Illusion und vor allem Langeweile.
Gerade hier erweist sich das Besondere seiner Erzählkunst, indem er das Gewöhnliche auf ungewöhnliche Art pointiert. Überzeugt von der menschlichen Dummheit, Triebhaftigkeit und Einsamkeit, trifft er seine Urteile in einem knappen, scharfen Erzählstil. Seine Stoffe durchzieht eine eigentümliche Poesie der Sinnlichkeit, aber auch der Schwermut. Maupassants Werk stellt bis heute den nicht überbotenen Höhepunkt der gesamten französischen Novellenkunst dar.
Erster Teil
I. Kapitel.
Einer der feinen und eisigen Regenschauer, wie sie der Dezember oft im Rückhalt hat, fiel dicht auf die Stadt.
In der Rue d’Assas gab es wenig Passanten. Man hörte bis in die Häuser hinein das Plätschern des Wassers, das in die Rinnsteine flutete, und der Wind erschütterte diese Atmosphäre von Trübsal durch seine grollende und klagende Stimme.
Im kleinen Salon der Madame Briquart waren vier Personen vereinigt: zunächst sie selbst, die respektable Witwe eines Obersten jener schönen Kürassiere, die nun schon zur Legende geworden sind. Die Dame trug ihre sechzig Jahre ebenso rüstig, wie sie -- einem on dit1 zufolge -- zeit ihrer Ehe die Hosen angehabt hatte; denn der Oberst verstand es nicht, sich wo anders tapfer zu halten als an der Spitze seines Regimentes. Damit soll nicht gesagt sein, dass Madame Briquart wie ein Mannweib aussah. Weit entfernt davon, war sie vielmehr ein zartes Wesen von sanftem und mildem Ausdruck, gehörte aber zu jenen Frauen, in deren Augapfel man einen ruhigen und unerschütterlichen Willen liest.
In dem ihrigen fand man auch die Beimischung der Duldsamkeit, die den überlegenen Intelligenzen die Lebenserfahrung verleiht.
Neben ihr blätterte Julia, ihre junge Nichte, in einem Album, und Florentine, deren Schwester, arbeitete an einer Stickerei. Während sie einen Roman von Octave Feuillet anhörten, den ihnen ein Herr von etwa fünfzig Jahren, Vetter Georges, wie er genannt wurde, vorlas, folgten die drei Damen dem Laufe ihrer Gedanken, die an diesem Abend ein wenig melancholisch gefärbt waren.
Ein stärkerer Windstoß ließ das Haus beinahe erzittern.
Madame Briquart duckte sich, wohlig schauernd, in ihrem Fauteuil und gab sich einem Ausbruch des egoistischen Sensualismus hin, der das Wohlbefinden desto angenehmer genießt, wenn es durch einen lebhaften äußeren Gegensatz hervorgehoben wird.
Das gleiche Gefühl wurde auch von den Gästen ihres Salons empfunden, die es je nach ihrem individuellen Charakter in besonderer Färbung zum Ausdruck brachten.
Julia hob den Kopf und murmelte: »Was für ein schreckliches Wetter!«
Florentine senkte den ihren auf ihre Arbeit wie eine Lilie, die ihren duftigen Kelch der Gewalt des Windes beugt.
Georges unterbrach seine Lektüre, zunächst um Florentine mit größerer Aufmerksamkeit zu betrachten, sodann, um mit befriedigtem Lachen auszurufen: »Wahrhaftig, Tante, in Ihrem Salon ist jetzt besser sein als zum Beispiel am Rondeau in den Champs-Elysées!«
»Wohl wahr«, entgegnete die alte Dame; »ich glaube auch, dass unsere Freunde uns heute Abend im Stiche lassen und wir den Tee in sehr kleiner Gesellschaft einnehmen werden.«
»Man müsste auch -- gebet Ihr’s zu? -- ein wenig geisteskrank oder verliebt sein, was, wie man sagt, einander sehr ähnlich ist, um heute nach der Rue d’Assas zu kommen.«
»Ach! Verliebte!« sagte Julia, »die kommen nicht hierher!«
»Wirklich?« erwiderte Georges Vaudrez mit leichter Ironie. »Bist du dessen ganz sicher?«
»Ganz sicher. Du kannst, Vetter Georges, ohne Angst, unterbrochen zu werden, die Odyssee dieser Dame fortsetzen, die mir von der Manie, sich zu opfern, ergriffen scheint.«
Als sie diese Worte gesprochen hatte, wurde das Rollen eines Wagens, bespannt mit zwei Pferden, deren regelmäßiger Gang auf Rasse schließen ließ, hörbar und verstummte plötzlich vor dem Tore.
Die Eingangsglocke klang an.
»Gilt dieser unerschrockene Besuch uns?« fragte Madame Briquart.
Bevor man Zeit hatte, zu antworten, öffnete sich die Tür des Salons, und der alte Diener der Frau Oberst meldete den Vicomte Saski, dessen Namen die leichten Falten an den Schläfen des Vetters Georges tiefer furchte, während zweifellos der Einfluss des Wetters auf den Wangen Julias eine rosige Wolke hervorrief..
»Wie liebenswürdig von Ihnen, dass Sie dem Unwetter getrotzt haben, um uns zu besuchen!« sagte huldvoll Madame Briquart zu dem neuen Ankömmling und streckte ihm ihre weiße, runzelige Hand entgegen, über die der junge Mann nach einem in Frankreich zwar überlebten, aber in Russland und Polen noch charmanten Brauche sich neigte und einen respektvollen Kuss darauf drückte.
»Eine Spazierfahrt nach Kamtschatka würde mir ein Vergnügen sein, wenn ich Ihnen dort begegnen könnte«, entgegnete galant der Vicomte, dessen Lippen zwar zu der Dame des Hauses redeten, dessen Blicke aber über deren Kopf hinweg zur braunen Julia noch viel mehr sprachen.
»Sie sind ein Schmeichler, den man nicht hart schelten darf nach der heldenhaften Tat, dem Unwetter bis ans Ende der alten Vorstadt zu trotzen ohne anderen Anziehungspunkt als den, eine Tasse Tee bei Einsiedlern zu nehmen.«
Das Gespräch setzte sich noch eine kurze Weile in dieser Art fort, dann näherte sich der junge Mann unauffällig Julien, mit der er eine halblaute Unterhaltung begann.
Seitdem er in den Salon eingetreten war, war es wie ein Frost auf seine Gastgeber gefallen. Georges sprach überhaupt nichts mehr; Florentine hatte ihre Stickerei verlassen und blätterte ihrerseits schweigend in dem Buche, das Georges auf den Tisch gelegt hatte.
Madame Briquart warf einen mit einer leichten Boshaftigkeit versetzten Blick auf ihre Umgebung und erhob sich, was niemand bemerkte, weil Julia ein sehr eingehendes Interesse an der Unterhaltung mit Herrn Saski nahm und Florentine von Georges, der ihr mit dem Finger bleistiftunterstrichene Stellen im »Tagebuch einer Frau« zeigte, mit Beschlag belegt war.
Es schlug elf Uhr; Karoline, das Stubenmädchen, brachte den Tee, den die jungen Mädchen herumreichten, und es schlug Mitternacht, als der Hausbesorger konstatierte, dass der letzte Besucher seiner ruhigen Mieter sich entfernt hatte und dass er sich nun in aller Ruhe dem holden Schlafe hingeben könnte.
Einige Wochen waren vergangen; sie reihten sich wie Perlen an den Lebensfaden jeder der Bewohnerinnen des kleinen Haushaltes, den wir eben skizziert haben, brachten aber keine Änderung in ihre Existenz.
Dennoch lag eine Krise in der Luft: die Krise, die über das ganze Leben der Frauen entscheidet, kündigte sich für die beiden jungen Mädchen an.
Julia und Florentine waren die Töchter eines richtigen Vetters der Oberstin, die für diesen Freund von Kindheit an eine jener schwer zu charakterisierenden Neigungen hatte, die nicht Freundschaft und nicht Liebe sind.
Für alle Fälle aber vereinigen sie die davon Ergriffenen mit einem Bande, das von nichts zerrissen wird.
Von nichts? ... Ja, vom. Tode!
Der Tod nahm den armen Rektor nach zweijähriger Witwerschaft hinweg, ohne ihm Zeit zu lassen, etwas anderes zu tun, als seine beiden Töchterchen der Madame Briquart zu schicken und ihr zu schreiben:
»Ich sterbe: Nimm Du sie auf.«
Sie hatte sie aufgenommen, sie erzogen nach ihrer Art und sich dabei mitunter gefragt, welche Zukunft wohl die beiden lieblichen Geschöpfe erwarte, die sie liebte, als gehörten sie ihr an durch die engsten Bande, die der Mutterschaft.
»Jung, hübsch, ohne Vermögen«, sagte sie sich, »was für Gefahren! Wieviel Klippen und Leiden mögen sie wohl erwarten!«
Heute Mittag hatte die Oberstin ihre Kotelette kaum angerührt, und die halbe Flasche Rotwein, den sie, gewissermaßen als hygienische Maßnahme, zu jeder Mahlzeit zu trinken pflegte, war fast ganz voll geblieben.
Als der Kaffee serviert war und Karoline das Speisezimmer verlassen hatte, richtete Madame Briquart die Blicke auf Florentine und sagte recht plötzlich:
»Töchterchen, hast du vielleicht eine Abneigung dagegen, Frau zu werden?«
Das junge Mädchen erhob errötend ihre Augen und erwiderte lächelnd:
»Oh nein, Tantchen. Aber das hängt doch davon ab, mit wem ich mein Leben verbringen soll.«
»Ganz recht: mit einem, der dich anbetet.«
»Der sie anbetet? Es gibt also etwas Neues, Tante?« fragte Julia lachend, und zu ihrer Schwester gewendet, meinte sie: »Liebe, mach’ dich auf etwas Fürchterliches gefasst! Ein Antrag ist eingelangt. Tante, lass uns nicht sterben vor Ungeduld!«
»Gott behüte mich davor, meine lieben Kinder! Ich will euch auch ohne Umschweife erzählen, dass gestern Vetter Georges mit mir eine lange Unterredung hatte, in der er mir sein Herz entdeckte, das für Florentine von den glühendsten Gefühlen beseelt ist, und mich um ihre Hand bat. Diese Bitte konnte ich natürlich nur mit dem Versprechen beantworten, sie getreulich weiterzuleiten. Nun steht es bei dir, die Entscheidung zu treffen. Georges war der Neffe meines Mannes; ich kenne ihn seit fünfundvierzig Jahren, er hat ein hübsches Vermögen, ist persönlich nicht übel, hinlänglich intelligent, um sein Schiffchen zu steuern, und in jeder Lebenslage vollendeter Gentleman. Du bist jung, hübsch, aber zurzeit nicht reich und wirst es in Hinkunft noch weniger sein. Ich habe mein kleines Erbteil gegen eine Leibrente verkauft, um uns ein angenehmes Leben zu sichern, meine Pension erlischt mit meinem Tode, und die Stunde schlägt, ernsthaft an die Zukunft zu denken. Was denkst du über Georges’ Person?«
Florentine war ein wenig bleich geworden.
Mit zwanzig Jahren hat man andere Träume als solche, die von einem fünfundfünfzigjährigen Manne ausgehen.
Sie hatte Herrn Vaudrez, den sie seit ihrer Kindheit wie einen Verwandten betrachtete, obgleich er ein Fremder war, sehr gerne; niemals aber hatte ihr Herz in seiner Gegenwart unregelmäßiger geschlagen, und trotz seiner sehr ausgesprochenen Aufmerksamkeiten war ihr der Gedanke, seine Lebensgefährtin zu werden, niemals durch den Sinn gegangen.
Sie war ein sanftes junges Mädchen, unschuldig und sogar gänzlich unwissend in allem, was sich unter dem Wort Liebe verbirgt.
Wohl hatte sie in ihrer Lektüre mit halbem Blick hellere Aussichten gesehen als die, welche sich vor ihr abzeichneten; sie empfand aber weder Beängstigung noch Widerstreben bei dem Gedanken, ihre zarte und zierliche Hand in die des Georges Vaudrez zu legen.
»Mein Gott, Tante«, sagte sie nach einem Augenblick des Schweigens, »du kennst das Leben besser als ich; richte das meine so ein, wie du es für vorteilhaft hältst!«
»Das heißt: Ich bin nicht toll in Georges verliebt, aber er gefällt mir hinlänglich, dass ich, ungeachtet seiner fünfundfünfzig Jahre, die angenehme Position, die er mir bietet, annehmen kann.«
»Ich weiß nicht, ob das ganz genau das Richtige ist -- oder besser: ich werde glücklich sein, mich diesem Herrn Vaudrez angenehm zu erweisen.«
»Oho! Sehet die einmal an! Die ist gut!« rief Julia. »Einen heiraten, nur um ihm ein Vergnügen zu machen! So was hat die Welt noch nicht gesehen. Man kennt Heiraten aus Neigung und Heiraten aus Vernunft; aber die Heirat aus Gefälligkeit ist noch nicht dagewesen. Meine Hochachtung, Schwesterchen! Nur deinem Beispiel werde ich nicht folgen.«
»Du könntest es später einmal bedauern«, sagte die Tante. »Glücklicherweise handelt es sich aber nicht um dich, sondern um Florentine, und ich werde unverzüglich diesen wackeren Georges in den dritten Himmel erheben, indem ich ihm mitteile, dass sie ihn ermächtigt, ihr den Hof zu machen.«
Madame Briquart erhob sich und verließ das Speisezimmer. Die jungen Mädchen taten desgleichen und zogen sich jede auf ihr Zimmer zurück, um über die Ereignisse des Tages nachzudenken.
Eine Hochzeit im Hause, das ist schon eine große Affäre.
Die Ankündigung und der Ausblick auf sie verwirrte weniger Florentine als ihre Schwester. Nicht etwa, dass sie jene beneidet hätte, dafür liebte sie sie zu sehr. Sie hatte eine hohe Denkungsart und ein gutes Herz und war überdies der Schwester aufrichtig zugetan. Aber die Worte, die Madame Briquart gesprochen hatte, indem sie ein wenig den Schleier von ihrer Lage zog, die bisher keiner ihrer Gedanken auch nur gestreift hatte, erregten in ihr nun eine ganze Welt von Beunruhigungen.
»Ohne Vermögen!« sagte sie sich, »das heißt, dazu verurteilt sein, entweder eine alte Jungfer zu bleiben oder die Gattin, sei es eines liebestollen Greises, sei es eines Narren zu werden. Wer denn sonst in unserem schönen Lande Frankreich heiratet ein Mädchen ohne Mitgift?
Das ist heiter!
Aber trotzdem: Niemals werde ich mich dazu resignieren.
Alles in der Natur wiederholt bis zum Überdruss das Wort Liebe. Es steht in allen Büchern, von den Klassikern bis zu den Romantikern. Alles in mir schreit nach etwas Unbekanntem, nach einer Hingabe meines Wesens, die sicherlich jene Liebe ist. Und ich sollte darauf verzichten, ihre Gluten kennen zu lernen? Dafür ein ruhiges und langweiliges Dasein eintauschen, kleine Sorgen und regelmäßige Vergnügungen, die schon im voraus bekannt und im voraus langweilig geworden sind? Niemals! Niemals!«
Auf diese Versicherung, die in ihrem Kopf wie die Fanfare eines Hornes widerhallte, erwiderte eine tiefe Stimme:
»Und was weiter? Was wirst du tun, wenn du keinen jungen, schönen, reichen Gatten findest, der dich vergöttert?«
Das Schweigen allein antwortete auf diesen grollenden Akkord.
Florentine empfand nicht diese Beunruhigungen. Sie fasste sich bald und sah vor ihren Blicken sich die ganze Existenz einer Schlossdame aufrollen, was ihr sehr annehmbar erschien.
Georges bewohnte fast das ganze Jahr ein sehr hübsches Schloss in der Nähe von Paris; sie kannte es, da sie oft die Ferienzeit dort verbracht hatte.
Dort stellte sie sich im großen Saale thronend vor, indem sie ihre Gäste willkommen hieß.
Die Vormittage erschienen ihr ganz in Sonne gebadet, durchduftet von dem Geruch der Felder, den sie in vollen Zügen einatmete, während sie den zahlreichen Beschäftigungen oblag, die jeder Tag auf dem Lande mit sich bringt, und ihren Dienstleuten Befehle erteilte.
Der Mittag traf sie umgeben von ihrer Familie, dem Mittagessen präsidierend im Kreise der Kinder, die sich, Mama rufend, um sie scharten, und über dieses liebliche Bild neigte sich ein weißer Kopf, dessen Blicke aber von Liebe erfüllt waren: Georges.
Diese Zukunftsvision prägte sich ihrem Geiste so tief ein, fasste in ihrem Herzen so fest Wurzel, dass sie des Abends mit glücklicher Ergriffenheit ihre Hand in die Monsieur Vaudrez’ legte und das von ihm so innig ersehnte Jawort sprach.
Ohne irgend etwas übereilen zu wollen, war Madame Briquart der Ansicht, dass der Vollzug der Eheschließung nicht zu weit hinausgeschoben werden solle. Ihr Neffe widersprach ihr hierin ganz und gar nicht.
So gab es denn während sechs Wochen ein unaufhörliches Kommen und Gehen von Schneiderinnen und Modistinnen. Madame Briquart beschaffte alles mit größter Freigebigkeit.
»Ich gebe dir nichts als deine Ausstattung«, hatte sie ihrer jungen Nichte gesagt, »so will ich dir wenigstens eine hübsche geben.«
Die gute Dame hatte mit äußerster Sorgfalt kokette Hauskleider, feine Batistwäsche mit Seidenbändchen und all die anderen Kleinigkeiten ausgewählt, die alle zusammen ein Ganzes bilden, das den hübschen Rahmen der Liebesnächte darstellen soll.
»Aber Tante«, sagte Florentine zuweilen, »warum soviel Raffinement auf Dinge verwenden, die niemand sieht?«
Die alte Dame lächelte und sprach: »Lass mir doch das kleine Vergnügen!«
Madame Briquart kannte das menschliche Herz, wusste, dass es von Unlogik erfüllt ist, und war sich nicht im unklaren darüber, dass ihr Neffe, der sein Recht als Junggeselle reichlich genossen hatte, kein großer Sünder vor dem Herrn mehr war.
Er hatte die Mußestunden seiner Jugend, und sogar die späteren, in einer mehr genussfrohen als durchgeistigten Umgebung verbracht, wo ein übertriebenes Wohlleben an Stelle seelischer. Erregungen tritt, die bei den richtigen Venuspriestern fehlen oder selten sind. Madame Briquart wollte nicht, dass die Gedanken des Gatten durch Vergleiche verstimmt würden; sie erinnerte sich eines Paares, dessen Lebensweg mit den holdesten Liebesblumen bestreut zu sein, schien und das vierzehn Tage nach der Vereinigung die unglücklichste Ehe war, weil die junge Frau, missleitet von ihrer mehr sparsamen als klugen Mutter, am Hochzeitsabend ein Paar Strümpfe aus solider, ungebleichter Baumwolle und eine Nachtjacke aus der gleichen Schule hervorgekehrt hatte.
Darum sparte sie weder Sorgfalt noch Mühe.
Endlich brach der große Tag an.
Lieblich-schön unter dem Kranze aus Orangenblüten, gehüllt in die weiße Wolke des Brautschleiers, gelobte Florentine ihrem Gatten aufrichtig Liebe und Treue. Sie war ein wenig erregt, aber nicht erschreckt, als sie, nach einem kleinen Hochzeitsmahl im Freundeskreise, in den Wagen stieg, der das Paar nach dem Schlosse entführte, wo Georges, im Einverständnis mit Madame Briquart, die ersten Stunden ehelicher Vertraulichkeit zu verbringen beschlossen hatte.
Auch er liebte nicht diese Mode unserer Tage, die zartesten Eindrücke des Lebens nach allen vier Windrichtungen zu verstreuen und für das erste Liebeserblühen der jungen Frau die banalen Wände eines Hotelzimmers zu Zeugen zu nehmen.
Er zog das Echo der Wohnung vor, in der ihr Leben hinfließen sollte, in der ihre Kinder zur Welt kommen -- wenn es Gott gefiel, ihnen solche zu schenken --, in der auch in schlechten Zeiten, deren es für jedermann gibt, die guten Erinnerungen den Teil, der sich schwach werden fühlte, kräftigen konnten.
Gerücht <<<
II. Kapitel.
Der Wagen fuhr rasch dahin, und bald waren die Befestigungswerke von Paris im Nebel verschwunden.
Georges hatte eine Rand seiner Frau in die seine genommen und hielt sie eng umschlossen; von Zeit zu Zeit beugte sich sein Kopf auf die junge Stirne, die sich ihm bot und drückte darauf einen Kuss, der ohne Erröten oder Verlegenheit hingenommen wurde.
All das war sehr keusch, ja noch viel mehr als das. Um bei der Wahrheit zu bleiben, muss eingeräumt werden, dass der junge Gatte nicht sehr erbaut davon war.
Monsieur Vaudrez gehörte nicht zu den Sentimentalen. Vor allem sinnlich, hatte er, indem er Florentine heiratete, hauptsächlich die Auferstehung eines Gefühls angestrebt, das sich zu verschaffen ihm von Tag zu Tag schwieriger wurde.
Als ausgedienter Feinschmecker wollte er die Freuden, die in Zukunft die seinen sein sollten, schon im Vorgeschmack ganz auskosten.
Für ein Paar gute. Pferde ist’s nicht zu weit von Paris nach Montmorency; in der Umgebung dieses Ortes lag Les Charmettes, das Schloss des Herrn Vaudrez.
Bald war man angelangt.
Der junge Ehemann hatte um sein neuangetrautes Weib eine Leere angeordnet; sie begegnete auf ihrem Gang nur einem diskreten und umsichtigen Stubenmädchen mit einem abgefeimten Gesicht, dessen Züge eine tadellose Ernsthaftigkeit zur Schau trugen, dessen Augen aber viel mehr sprachen.
Das für Florentine bestimmte Zimmer war renoviert worden, und die zierlichste Einrichtung war dort vereinigt.
»Wie lieb du bist!« sagte die junge Frau mit Überzeugung, als sie nach einem sehr erlesenen Mahl sich auf ihrem Zimmer befand und dem Herrn, der seit ein paar Stunden ihr Gatte war, eine Tasse Tee bot.
»Ich? Nein, du bist’s, meine angebetete Liebste, du, die du mir die Sorge für dein Leben anvertraut hast. Ja, du! Ich hab’ es auch sehr eilig, von meiner geliebten Frau Besitz zu ergreifen.«
»Wie meinst du das? Bist du nicht schon jetzt mein Herr und Meister?«
»Nicht vollständig, Geliebte. Ich habe das Recht erworben, es zu werden. Das ist alles.«
»Nicht möglich!« sagte Georges Vaudrez zu sich selbst. »Sollte das liebe Kind ganz und gar unwissend sein? ... Sollte Madame Briquart die ausgezeichnete Gelegenheit, ihre Einbildung mit Dingen, die schon lange für sie verbotene Früchte geworden sind, zu beschäftigen, versäumt haben? Das ist ja unmöglich! Immerhin Vorsicht!«
»Also du glaubst, Herzchen, dass das, was sich heut morgen am Standesamt und in der Kirche zugetragen hat, die letzten Freuden der Liebe ausmacht?«
Die junge Frau errötete und senkte den Kopf.
»Ich weiß nicht«, flüsterte sie.
»Sie ist zum Anbeißen!« sagte sich Georges! »Welch ungeheures Glück, diese Unschuld zu entblättern!«
»Wahrhaftig nicht?« begann er wieder. »Dann also will ich dich’s lehren. Warum machst du dir’s aber nicht bequem; dieses Korsett muss dich doch genieren! Bedarfst du des Stubenmädchens, um es abzulegen?«
»Nein, nein!«
»Dann lassen wir sie also schlafen gehen und erledigen wir unsere kleinen Geschäfte ganz allein!«
Mariette wurde verabschiedet und Georges schob den Riegel vor die Zimmertür.
Florentine war schon in ihre Ankleidekammer eingetreten und pflichtschuldigst daran, den erhaltenen Rat zu befolgen.
Hinter einem Vorhang versteckt, sah ihr Georges zu, und all sein Blut erhitzte sich bei dem Anblick dieser Arme und dieser Schultern, die des Schleiers, der sie bedeckt hatte, entkleidet, sich in ihrer jugendlichen Pracht zeigten.
Als Florentine nichts mehr an hatte als das Hemd, tauchte er plötzlich aus seinem Schlupfwinkel auf und nahm sie in seine Arme.
»Ach, wie du mich erschreckt hast!« rief das junge Mädchen ganz verwirrt und über und über errötend.
Sie hatte wohl vor ihrem inneren Forum geahnt, dass das Leben der Frau irgend ein Geheimnis verberge; sie wusste aber nicht, worin dieses Unbekannte bestand, das ihre Tante einerseits und ihr Beichtvater anderseits ihr hingestellt hatten als künftige Pflicht, für deren Erfüllung ihr beide die größte Unterwerfung unter die Wünsche ihres Gatten gepredigt hatten.
Georges war sehr bleich. Er nahm sie in seine Arme und bedeckte mit Küssen ihre Lippen, ihre Schultern, ihren Busen, den sie seinen Blicken zu entziehen sich vergeblich mühte. Plötzlich glitten seine brennenden Finger den Körper der jungen Frau entlang. Mit vollen Händen ergriff er die graziösen Erhebungen, die den Abfall der Lenden beschließen, und krümmte sich vor Lust, während er seinen trockenen, glühenden Mund auf ihre roten Lippen drückte.
Dann setzte er seinen Spaziergang fort, und es gelang ihm, trotz der Anstrengungen der jungen Frau, den Besitz ihrer selbst zurückzugewinnen, ihre Schenkel und Knie zu betasten. Zwei Strumpfbänder aus weißer Seide hielten das feine Seidengeflecht, das ihre zierlichen Beine bedeckte. Er machte sie los und ließ auf den Teppich das dünne Gewebe gleiten, das noch den unteren Teil von Florentines zartem Körper verhüllt hatte. Gleich einem erschreckten Vögelchen stieß sie leise Schreckensrufe aus und entfloh bis ans Ende des Zimmers.
Georges betrachtete sie mit Bewunderung. Seine Augen leuchteten in allen Flammen der Begehrlichkeit, die auf ihrem höchsten Punkte angelangt ist.
»Florentine, mein Liebling«, sagte er, »hast du denn Angst vor mir, weil du so vor mir flüchtest? Bin ich nicht dein Gatte? Warum weigerst du mir’s, meine Frau zu sein?«
»Noch etwas? Ich versteh’ dich ja gar nicht!«
»Dann komm her, ich will dir erklären, worin der Unterschied zwischen einem jungen Mädchen und einer Frau besteht.«
»Ich trau’ mich nicht, so ...« erwiderte die junge Gattin, indem sie einen verzweifelten Blick auf ihre leichte Kleidung warf.
»Kind, wovon machst du Aufhebens? Von deiner summarischen Toilette? Ist sie nicht die reizendste von der Welt, da sie den Liebesfesten vorbehalten ist? Wart’, ich will dir Mut machen und gleichfalls alles, was das Feuer unserer zärtlichen Hingabe behindern kann, weit von mir werfen.«
Georges verband das Wort mit der Tat; rasch entledigte er sich seiner männlichen Kleidungsstücke und fand sich in gleichem Kostüm wie seine Frau bei ihr ein.
»Komm«, flüsterte er, und zog sie mit kosender Umarmung auf ein Ruhebett, »daher, ganz nah’ zu mir ... Ja, so ist’s recht! Nun will ich dir verständlich machen, was meine Liebe von der deinen verlangt; du liebst mich doch, du wirst mich doch lieben, meine angebetete kleine Frau? In der Heiligen Schrift, du hast’s oft gelesen, steht geschrieben, dass Mann und Weib nur ein Fleisch und Blut sind, wenn sie durch die Ehe verbunden sind.«
»Ja.«
»Nun siehst du: Was muss man tun, um dazu zu gelangen? Du musst deinen Gatten Besitz ergreifen lassen von den Schätzen, die dein Schoß umschließt, nicht dieser entzückende Hügel, den ich liebkose, sondern viel tiefer drinnen, im Grunde deines Wesens, dessen Eingang dort ist, wohin ich die Hand lege, wohin ich den Finger stecke.«
Georges hatte die junge Novize mit seinem linken Arm umfasst, er hielt sie halb zurückgelegt nahe bei während seine Rechte sich Erklärungen und packenden Demonstrationen hingab, deren Eindruck die Nerven Florentins zu empfinden begannen.
»Damit du ganz mein wirst, Schatz, ist’s nötig, dass ich in dich eindringe.«
»Aber wie?«
»Du bist also so unwissend, dass du nicht weißt, wie die männliche Körperbildung von der weiblichen abweicht?«
»Ja.«
»Nun greif’ da her und sieh!«
Georges enthüllte das Bohrwerkzeug, das Gott seinen männlichen Kreaturen zu gebrauchen gab, auf dass sie ihre Herrschaft ausüben. Erschreckt musste die junge Frau ihre niedlichen Fingerchen über das rebellische Fleisch ihres Gatten führen.
»Du bist das Ziel dieses artigen Pfeiles; er soll siegreich in dich eindringen, um deinen Schoß zu befruchten und ihn allen Genüssen der Liebe zu erschließen.
Nun weißt du’s. Willst du also meine Frau sein? Willst du das Versprechen erfüllen, das du mir heute morgen gabst?«
»Ja«, murmelte eine kaum hörbare Stimme.
»Du musst Courage haben, denn, siehst du, der erste Liebeskampf ist eine Schlacht. Das Tor des Paradieses ist versperrt, und ich muss den Eintritt erzwingen.«
Georges hörte Ihre Antwort nicht mehr; er nahm Florentine in seine Arme, zog sie in sein Zimmer und hob sie auf das große Bett, das ihrer wartete, um Zeuge ihres Glückes zu sein.
Hierauf warf er sich mit siegreichem Ungestüm erst neben sie und streckte seine zottigen Beine längs ihres glatten, weichen Leibes, um sich an dessen Berührung zu berauschen. Endlich stieg er über sie, und während er mit sehnigen Händen die Schenkel, die sich aus mangelnder Erfahrung oder aus Furcht gegeneinander pressten, auseinander drängte, sprach er zu sich selbst:
»Die Siegesstunde schlägt.«
Herr Vaudrez war noch im besten Alter und konnte in einem leichten Scharmützel noch glänzend seinen Mann stellen; hier aber handelte es sich um große Manöver, für die es vor allem darauf ankommt, ganz sattelfest zu sein: mit Schrecken musste er’s konstatieren.
Der Kampf, die Erklärungen, hatten eine gewisse Zeit in Anspruch genommen, und der erobernde Zustand des jungen Gatten veränderte sich in beunruhigender Weise. Die Nervenabspannung nahm überhand; es sollte ihm unmöglich werden, von der Festung, die sich ihm auf Gnade und Ungnade ergab, Besitz zu ergreifen.
»Ich Narr!« dachte er, »warum habe ich auch die stärkenden Tropfen ausgeschlagen, die mir Albert anbot.
›Du tust nicht recht daran‹, sagte mir dieser wackere Freund.
Zum Teufel, ja! Ich tat nicht recht daran; ein Glück, dass meine Frau unschuldig ist wie ein neugeborenes Kind; ich werde ihr einen Ersatz geben.«
Er setzte die Bewegung vor dem Heiligtum fort und fühlte plötzlich, wie das kleine, entzückende Knöspchen, dessen Erhabenheit sein unzuverlässiger Freund streichelte, sich erhob und geschwellt wurde. Erstickte Seufzer entflohen Florentins Lippen, und sie wand sich wie eine Schlange. Georges war kein Neuling; er überblickte die Sachlage; sie war zugleich schrecklich und reizend. Mit fester Hand ergriff er den Verbrecher und zwang ihn zu einem wohlüberlegten Hin und Her, das alsbald den Paroxysmus des Liebeskrampfes herbeiführte.
Die junge Frau stieß einen. Schrei ans.
Sie war noch Jungfrau und doch schon eine Wissende, denn sie hatte eben die ersten Gefühle der Liebe gekostet.
Georges ärgerte sich. Er wusste sich geschlagen. Traurig sah er seine Frau an, die auf dem Bette halb ohnmächtig lag, ihre Haltung war voll Hingebung für ihn. Philosophisch legte er sich neben sie, um zu warten, bis es Cupido gefiele, ihm beizustehen und ... schlief bis zum Morgen.
Was Florentine betraf, so ruhte sie, selbst ermattet von jenen ersten Zuckungen, friedlich aus, erwachte mit strahlendem Gesicht und erkühnte sich sogar, einen Kuss auf die Lippen ihres Gatten zu drücken.
Die Ehe erschien ihr keine so üble Sache mehr, und sie bewahrte von ihrer Brautnacht nur eine sehr süße Erinnerung.
Georges fühlte sich von seinem vergeblichen nächtlichen Angriff noch nicht hinlänglich wieder hergestellt, um eine neue Schlacht anzunehmen. So zog er vor, List zu gebrauchen, und erwiderte die Liebkosungen Florentins, die sich wie ein Kätzchen an ihn schmiegte, mit einer Wiederholung des kleinen nächtlichen Spieles. Sein Finger verlor sich in dem blonden Vlies der goldigen Scham der jungen Frau, verweilte am Schlüssel der Seligkeit und ließ ihn in seinem Schloss von rotem Sammet schwingen, dann drang er, nicht ohne ein wenig Anstrengung, in der Richtung nach dem Heiligtums vor und gab sich Rechenschaft über die Schwierigkeiten, die ihn für den Augenblick der Entscheidungsschlacht erwarteten, in der er, bei Strafe der Lächerlichkeit, siegen oder sterben musste.
Nicht mehr ganz unerfahren, gab sich Florentine diesmal völlig seinen Bemühungen hin und wurde belohnt durch einen Liebeserguss, der viel stärker und länger anhielt und viel genussreicher war, als der der letzten Nacht.
»Morgen«, sagte sich Georges, »werde ich meine Tropfen haben. Dann wollen wir’s schon fertig bringen!
Albert, dieses Tier, wird sich über mich lustig machen; das steht fest. Aber meinetwegen! Die Hauptsache ist, nicht auf dem Wege schwach zu werden.«
Albert war nicht in Paris. Erst am folgenden Tage sollte er dorthin zurückkommen..
Es wurde beschlossen, dass Jean Madame Briquart und Julia zu einem versprochenen Besuch abholen und bei dieser Gelegenheit die von Freund Albert erbetene Sendung mitbringen sollte.
III. Kapitel.
Gegen zwei Uhr kam Georges’ Wagen zurück und brachte Madame Briquart und Julia.
Die Zeit war ihnen sehr lang erschienen.
Im Geiste der beiden Frauen war eine ganze Welt von Neugierde erweckt: die Tante erinnerte sich, Julia erriet.
Eine wie die andere brannten sie darauf, zu erfahren, wie Florentine die Krise überstanden hatte. Die alte Tante kannte sehr wohl deren mögliche tragische Wendung, Julia hingegen stellte sich sie grässlich vor ohne den Enthusiasmus, der in Anbetracht von Georges’ Alter bei dem Feste unmöglich sich hatte einstellen können.
Sie waren ein wenig enttäuscht, als sie das Behagen bemerkten, mit dem die junge Frau sie empfing. Sie war rosig und lächelnd, nur ein etwas lebhafteres Rot verbreitete sich über ihre Züge, als sie das prüfende Auge der Tante auf sich ruhen fühlte. Georges sah aus wie immer, und der blaue Liebeszirkel ließ seine für gewöhnlich schon etwas tiefliegenden Augen nicht hohler erscheinen.
Die Feststellung dieser Einzelheit versenkte Madame Briquart in tiefe Reflexionen.
»Schau, schau!« sagte sie sich. »Sollte er noch rüstiger sein, als ich gedacht hatte?«
Vetter Georges war sehr angelegentlich um die Damen bemüht und schien darauf hinzuarbeiten, dass seine Frau nicht unter vier Augen mit seiner Schwägerin blieb. Aber es steht irgendwo geschrieben: »Weiberwille ist Gottes und des Teufels Wille.« Da gab es nun drei Weiber. Was sollte Georges beginnen? Es war unvermeidlich. Er sah sich mit Gewalt dazu gezwungen, über sich ergehen zu lassen, was er zu vermeiden gewünscht hatte, um der Lächerlichkeit zu entgehen. Er musste sich entfernen, um der Dienerschaft seine Weisungen bezüglich der Unterbringung der Gäste zu geben; denn Florentins Unerfahrenheit im Haushalt ließ nicht zu, dass sie sich damit befasste.
Madame Briquart machte sich’s zunutze, indem sie die Nichte in ihr Zimmer zog. Während Julia die tausend Einzelheiten von Florentins Ausstattung betrachtete, die in den Glasschränken des Ankleidezimmers verteilt waren, ließ die Tante diese neben sich auf einer Chaiselongue niedersitzen.
»Nun, meine arme Kleine«, sagte sie, indem sie ihr herzlich beide Hände drückte, »wie fühlst du dich in der Ehe?«
»Sehr wohl, Tante; Georges ist voll Aufmerksamkeit und Zärtlichkeit für mich.«
»Er? Ja, das glaub’ ich gern! Aber du, du, Liebling?«
»Ich? Ich fühle mich ganz glücklich, und ich sehe nicht ein, warum dies Glück nicht dauernd sein sollte?«
»Ich auch nicht. Aber sag’ mir: War er brutal gegen dich? Es gibt Augenblicke, weißt du, in denen der beste Mann aufhört, zartfühlend zu sein.«
»Er und brutal?! Gewiss nicht, er ist, wiederhol’ ich dir, voll Sorgfalt und Aufmerksamkeit.«
»Nun schön! Ich sehe, dass alles gut verlaufen ist, und dass du nicht viel gelitten hast. Georges hat wohl seinen Arzt gefragt« -- Madame Briquart war schon daran, zu sagen »seine Erfahrung«, aber sie dachte, dass es besser wäre, die soliden Schultern des Doktors heranzuziehen --, »er wird ihm eine Salbe gegeben haben, ein schmerzstillendes Wasser ...«
»Wozu das, Tante?«
Plötzlich blickte Madame Briquart ihre Nichte mit Erstaunen an.
»Aber, meine gute Kleine, um dir die Schmerzen zu ersparen, die für die Frau immer die erste Liebesschlacht begleiten. Der Schöpfer hat jeden Sieg zum Preis eines Kampfes gesetzt, und Blut muss fließen, sowohl für das erste Gefühl der Liebe, wie für das der Mutterwerdung.«
Madame Briquart hatte eine nicht geringe Vorliebe für Vorträge; sie wäre vielleicht noch lange in diesem Ton fortgefahren, wenn ihre Nichte sie nicht mit den Worten unterbrochen hätte:
»Aber Tante, ich verstehe nichts von all dem, das du mir da erzählst. Da wir Frauen unter uns sind« -- die Neuvermählte sprach dies »Frauen unter uns« mit einem Ernste aus, der die alte Dame lächeln machte --, »kann ich dir wohl sagen, dass ich in mir ein körperliches Gefühl hatte, das mich entzückte, und dass all dies das erste wie das zweite Mal ohne Kampf oder Blutvergießen abgegangen ist.«
»Ah bah! Aber dann ...«
Ein fürchterlicher Gedanke fuhr Madame Briquart durch den Sinn, aber sie wies ihn als unsinnig zurück. Nein! Dieses junge Mädchen hatte sie seit seiner Kindheit nicht verlassen, und die Naivität, mit der es seine Eindrücke schilderte, verbürgte die unberührte Reinheit.
Intuitiv überblickte sie die Sachlage und sagte sich: »Teufel! Sollte mein teurer Neffe weniger rüstig sein, als ich gedacht hatte?«
»Also, Liebling, hat dein Mann von seinen Gattenrechten noch nicht Gebrauch gemacht, weil er dich nicht verschüchtern wollte. So wird’s sein!«
»Aber ja, aber ja!«
»Dann versteh’ ich nichts mehr. Du spielst die Unwissende, du böses Kind, und bist doch verheiratet und sagst, dass mein Neffe sein Recht als Gatte gebraucht hat.«
»O ja! Schon von der ersten Nacht unserer Ehe an. Vier Tage später mussten wir sogar den Doktor kommen lassen, weil Georges mich zu rasch von der Jungfrau zum Weibe gemacht hatte. Ja, bin ich denn noch immer nicht Frau, liebe Tante?«
»Ich glaube nicht, Liebling. Du bist, wenn ich recht vermute, viel eher noch Jungfrau zu nennen.«
Die Tante zog die junge Frau zu sich, hielt sie halb zurückgelegt auf ihren Knien, ließ ihre Hand unter Florentins Röcke gleiten und berührte mit leichtem Finger den Kitzler, der sein kleines, rotes Köpfchen aufreckte. Dann versenkte sie sich mit zärtlicher Vorsicht zwischen die Schamlippen und versuchte, in die Scheide vorzudringen; aber eine starre Barrière widerstand ihren Bemühungen.
»Du tust mir weh, Tante«, sagte Florentine.
»Da siehst du, dass man leiden muss, um Frau zu werden; denn du wirst es nicht eher sein, als bis Georges durch heftige und wiederholte Stöße des männliches Gliedes, das er ohne Zweifel besitzt, dies Häutchen durchstoßen haben wird, das man Jungfernhäutchen nennt. Hernach wird er, unter Wonnen, die du noch nicht kennst, in dein tiefstes Innere sich eingraben und dich mit dem heißen Liebesstrom überfluten, den er in sich trägt und der deinen jungfräulichen Schoß befruchten wird.
Aber Blut muss fließen, und durch einige Augenblicke eines flüchtigen Schmerzes musst du die Freuden der Liebe und die der Mutterschaft erkaufen. Georges wird dich bisher haben schonen wollen.«
»Trotzdem, Tante, empfand ich ...«
»Das, was du jetzt gleich wieder empfinden wirst.«
Die alte Dame ließ ihren Finger beweglich über die Geschlechtsteile der jungen Frau spielen und rief aufs neue den entzückenden Reiz hervor, den Florentine für das Glück des Besessenwerdens gehalten hatte.
»Ach! Mein Gott! Das ist ja gerade so gut wie bei Georges!« murmelte sie. »Also dann kann ... kann ... eine Frau eine Freundin auch glücklich machen?«
Die Tante unterdrückte auf ihren Lippen ein rätselhaftes Lächeln und wies diskret nach der Tür des Ankleidezimmers, in welchem man nicht mehr das Kommen und Gehen Julias, die in den Schränken gestöbert hatte, vernahm.
Lebhaft wandte sich Florentine um, gab ihrer Tante einen langen Kuss und rief ihre Schwester, die sofort erschien, die Wangen sehr gerötet und mit animiertem Blick.
»Nun, Schwesterlein«, fragte sie Florentine, »findest du mein Leinenzeug hübsch? Macht dir’s keine Lust, auch zu heiraten?«
»Mich zu verheiraten? Das hängt davon ab, mit wem; aber geliebt zu werden und zu lieben -- die Lust dazu gesteh’ ich ein.«
»Die Reihe wird schon an dich kommen«, sprach Madame Briquart. »Und wer weiß? Ich kenne einen gewissen Vicomte, der mir ganz danach aussieht, als dächte er wie du.«
Julia errötete diesmal noch viel tiefer; aber man hörte Georges’ Stimme, der an die Tür seiner Frau klopfte und fragte, ob er eintreten dürfe.
»Nein, nein!« erhielt er zur Antwort, »wir kommen gleich!«
Georges strahlte vor Freude. Albert war in Paris, der Kutscher hatte die kostbaren Tropfen mitgebracht. Georges nahm sie nach Vorschrift und schluckte sie ebenso hinunter wie den kleinen, geistreichen, aber sehr spöttischen Brief, mit dem Albert seine Sendung zu begleiten sich bemüßigt geglaubt hatte.
Man speiste sehr fröhlich. Madame Briquart konnte sich einige boshafte Anspielungen, deren Spitze sich gegen Georges kehrte, nicht versagen. Er tat, als verstünde er sie nicht, sprach aber zu sich selber:
»Alte. Hexe!«
Im allgemeinen hatte er für seine Tante mehr Zuneigung als Ehrfurcht.
»Was kann sie nur meiner Frau gesagt haben? Meiner Frau! Nur Geduld, heut Abend werden wir ja sehen. Ich weiß nicht, ist das die Wirkung des trefflichen Chambertin, den wir trinken, oder fangen wirklich die Tropfen schon zu wirken an? Ich fühle so ein vielsagendes Zucken, sogar wenn ich die verehrlichen und verehrten Züge der Madame Briquart betrachte.«
Die Damen erwiesen dem Champagner reichlich Ehre. Herr Vaudrez weigerte sich entschieden, auch nur ein einziges Glas davon zu nehmen, und die Tante dachte:
»Sagen wir ihm noch nichts. Es ist augenscheinlich, dass er sich über die Lage Rechenschaft gibt und sich für die Schlacht vorbereitet.«
Es war beschlossen worden, dass die beiden Gäste einige Tage auf Les Charmettes verbringen sollten. Zu früher Abendstunde schützte die Tante ein wenig Ermüdung vor, zog sich auf ihr Zimmer zurück und bat Julia, ihr vorzulesen, wofür Georges ihr unendlich dankbar war.
»Mein kleiner Liebling«, sagte er zu seiner Frau, »willst du, dass wir dem Beispiel der Tante folgen und ins Schlafzimmer hinaufgehen? Ich bin etwas müde.«
»Sehr gerne.«
»Also gut. Geh’ du voraus, und, wenn du das Stubenmädchen verabschiedet hast, dann wird’ ich zu dir kommen.«
Georges begab sich auf sein Zimmer, entkleidete sich, setzte sich in seine Wanne; richtete auf sein Rückgrat, dann auf seinen ganzen Körper einen Strahl eiskalten Wassers und verlängerte die Douche auf dem Gliede, das zum Kampfe bestimmt war. Hernach frottierte er sich sorgfältig und befeuchtete Rücken, Lenden, Arme, Achselhöhlen mit einem Schwamm, der in ein Fluid getaucht war, dessen Wirkung nach dem kalten Wasser eine anregende sein musste. Darauf zog er den Hausanzug an, goss eine Tasse Tee mit Vanille hinab, in deren Duft sich der Geruch des Aphrodisiakums mischte, das man ihm gebracht hatte. Dann flog er, voll Kühnheit, nach dem Zimmer seiner Frau, das von dem seinen nur durch ihr Ankleidezimmer getrennt war.
Florentine, die in ihrem großen Himmelbett saß, war hinreißend hübsch inmitten der Flut von Spitzen und duftigem Batist, die sie umgab. Sie erwartete ihn, auf ihre Kissen gestützt, ein wenig beunruhigt vor der zweiten Brautnacht, die ihr, wie sie instinktiv fühlte, die große Erleuchtung bringen sollte.
Diesmal beging Georges nicht die Unvorsichtigkeit, sich bei der reizvollen Einleitung aufzuhalten. Während er das Ankleidezimmer durchmaß, hatte er sich der Dose mit Coldcream1