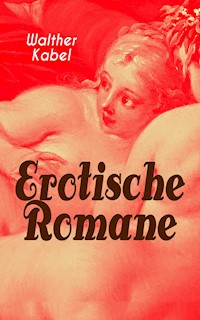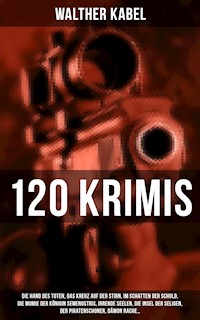Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In 'Die Perle der Königin', einem aufregenden Detektiv-Abenteuer von Walther Kabel, wird der Leser in die mysteriöse Welt von Verbrechen, Intrigen und Geheimnissen eingeführt. Der Roman ist in einem packenden und mitreißenden Stil geschrieben, der den Leser von der ersten bis zur letzten Seite fesselt. Kabel schafft es, eine spannende Handlung mit cleveren Wendungen und überraschenden Enthüllungen zu verweben, wodurch das Buch zu einem wahren Pageturner wird. Das Werk ist ein Meisterstück des Krimigenres und ein echtes Juwel der Detektivliteratur der frühen 20. Jahrhunderts.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 116
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Perle der Königin
(Detektiv-Abenteuer)
Books
Inhaltsverzeichnis
1. Kapitel
Der dicke Wirt des Exzelsior-Hotels in Bombay schnaufte kurzatmig den endlosen Korridor im zweiten Stock entlang und klopfte dann an die Tür von Nr. 64. Auf ein kurzes, recht energisch klingendes »Herein« öffnete er und trat näher.
»Bitte schließen Sie die Tür hinter sich«, sagte der Bewohner dieses Zimmers, ein hagerer, junger Mann mit bartlosem, sonngebräuntem und außerordentlich kühn geschnittenem Gesicht, der in einem Sessel saß und vor sich auf der Platte des Mitteltisches sauber in einer Reihe eine goldene Uhr mit Kette, zwei Ringe und eine Busennadel und etwa zehn Mark in englischem Gelde hingelegt hatte.
Wilhelm Segerl, der Besitzer des Exzelsior, drückte die Tür ins Schloß und verbeugte sich leicht.
»Sie haben mich zu sprechen gewünscht, Herr Manhard.«
»Ich habe Sie hier zu mir in mein Zimmer gebeten, weil diese Unterredung möglichst ohne Zeugen stattfinden sollte«, erklärte Felix Manhard gelassen.
Segerl, ein geborener Schweizer, schaute seinen Gast etwas mißtrauisch an. Und dann wanderten seine Augen prüfend zu der merkwürdigen kleinen Ausstellung hin, die der junge Deutsche da auf der Tischplatte ausgebreitet hatte.
Ein flüchtiges Lächeln zuckte um Manhards Lippen.
»Sie wundern sich wohl über diese Zurschaustellung meiner gesamten Habe, Herr Segerl. – Bitte, kommen Sie ganz dicht heran. Sie sollen mal diese Dinge hier abschätzen.«
Der Hotelier, der den übermütigen Spott dieses Gastes schon so manches Mal unangenehm empfunden hatte, setzte ein recht unnahbares Gesicht auf.
»Da wenden Sie sich wohl besser an jemand anders,« meinte er kurz. Im stillen aber grübelte er darüber nach, was diese ganze Szene nur zu bedeuten haben könnte.
»Unmöglich, Herr Segerl!« erwiderte Manhard liebenswürdig. »Nur Sie allein haben jetzt noch ein Interesse an diesen Wertsachen.«
Wilhelm Segerl ging ein Licht auf. Seine Miene veränderte sich plötzlich. Der höfliche, zurückhaltende Besitzer des Exzelsior verwandelte sich in den um sein Geld besorgten Geschäftsmann.
»Soll das vielleicht heißen, daß Sie … daß Sie …«
»… sehr richtig«, vollendete Manhard, »… daß ich nicht in der Lage bin, meine Wochenrechnung zu begleichen. – Hier ist sie. Ich schulde Ihnen runde zehn Pfund Sterling (200 Mark). Ihre Rechnungen zeichnen sich ja dadurch vorteilhaft aus, daß man zur Bezahlung nie Kleingeld braucht.«
Segerl ballte unwillkürlich die dicken Finger zur Faust. Aber im übrigen nahm er sich vor, durchaus höflich zu bleiben. Hoffte er doch, daß die Wertsachen des jungen Deutschen ihm noch einen kleinen Profit einbringen würden.
»Unter diesen Umständen muß ich mich freilich überzeugen, was diese Dinge wert sind«, meinte er und nahm die goldene Kapseluhr zur Hand, an der eine feingliedrige, lange Kavalierkette hing.
»Lassen Sie sich Zeit mit dem Abschätzen, Herr Segerl«, sagte der Deutsche gemütlich, indem er aus einer silbernen Zigarettendose die letzten drei Zigaretten herausnahm und das Etui dann neben die Busennadel legte. »So – hier, dieses Andenken habe ich noch vergessen. Außerdem steht Ihnen auch noch mein Koffer mit meinen soeben eingepackten zwei Anzügen und der ganzen Wäsche zur Verfügung.«
Segerl schaute etwas überrascht auf, aber nicht unangenehm überrascht. O nein! Seine Ahnung hatte ihn nicht betrogen. Hier war tatsächlich ein Geschäft zu machen. Diese Deutschen sind doch alle dumm und unpraktisch. Ein anderer wäre ihm sicher unter Zurücklassung des Gepäcks mit der Zeche durchgebrannt.
Inzwischen hatte Felix Manhard in leichtem Plauderton weitergesprochen.
»Ja, Herr Segerl, meine Hoffnung, hier als Redakteur oder Privatlehrer ein Unterkommen zu finden, hat mich eben arg betrogen. Zwei Wochenrechnungen konnte ich bezahlen. Jetzt bei der dritten hapert’s gewaltig. Ich bin vollständig abgebrannt, vollständig, bin aber auch ehrlich genug, Sie nicht betrügen zu wollen, wie Sie sehen. Die Not zwingt mich, andere, sogar jede beliebige Arbeit zu suchen, nur um mich satt essen zu können. Und in einer Stellung als Kohlenschipper oder Zeitungsausträger brauche ich diese bescheidenen Kostbarkeiten nicht mehr.«
Der Wirt war mit der Prüfung fertig. Er verstand sich auf dergleichen.
Mit einem Gesicht, das Wohlwollen und gütige Nachsicht ausdrücken sollte, erklärte er jetzt:
»Na, – weil Sie so ein halber Landsmann von mir sind, Herr Manhard, – ich bin ja Deutsch-Schweizer –, will ich den ganzen Kram hier für zehn Pfund gelten lassen und die Rechnung als quittiert unterschreiben.«
»Es sind alles liebe Andenken, von denen man sich ungern trennt«, meinte Felix Manhard, sich eine Zigarette anzündend. »Und – was hier im Zimmer noch mein Eigentum ist, packen Sie bitte ebenfalls in den Koffer.«
Felix Manhard griff nach seinem Panamahut, warf den Zigarettenrest in den Aschbecher und ging mit einem beinahe herablassenden: »Auf Wiedersehen, Herr Segerl« zur Tür hinaus.
Es war genau elf Uhr vormittags, und das Leben und Treiben in der wichtigen Hafenstadt befand sich so ziemlich auf dem Höhepunkt. Manhard wollte sich eben vorsichtig durch das Gewühl auf die andere Straßenseite hindurchschlängeln, als er angerufen wurde. Er drehte sich um und lüftete leicht den Hut.
»Guten Morgen, Miß Fartaday. – Gut, daß ich Ihnen noch begegne. Ich möchte Ihnen als Schriftsteller Felix Manhard lebewohl sagen.«
Die schlanke, hübsche Engländerin, ganz in Weiß gekleidet, musterte ihn vom Kopf bis zum Fuß.
»Sie sehen heute so anders aus als sonst«, meinte sie offensichtlich erstaunt. »Und – was heißt das: »als Schriftsteller Felix Manhard lebewohl sagen«? Ich verstehe Sie nicht.«
Ihre grauen Augen suchten forschend in seinem Gesicht.
»Nun – wahrscheinlich bin ich sehr bald Arbeiter am Hafen oder sonst etwas ganz ehrliches, aber für Sie nicht mehr standesgemäßes, Miß Fartaday. Der Schriftsteller verschwindet eben aus Geldmangel, und der neue Felix Manhard dürfte von Ihnen kaum noch beachtet werden.«
»Sie machen wieder einen Scherz wie so oft«, meinte sie gelangweilt. »Kommen Sie, begleiten Sie mich nach dem Sportplatz.«
»Bedaure. Ich scherze wirklich nicht. Erkundigen Sie sich bei Herrn Segerl. Der hat meine sämtlichen Sachen als Zahlung für die letzte Wochenrechnung einbehalten.«
Die junge Engländerin wurde rot. »Aber – aber gestern abend tranken Sie doch noch mit uns Sekt und aßen allein für Ihre Person zwei Dutzend Austern, und uns hatten Sie … hatten Sie …«
»… eingeladen, – stimmt! War mein Abschiedssouper. Ich liebe die Gegensätze. Heute werde ich vielleicht hungern. Dieser einfache Anzug und der Inhalt seiner Taschen bildet das Letzte, was ich besitze.«
Miß Fartadays Wangen brannten jetzt in heißer Glut. In diesem Augenblick, wo ihre sonst so blasierte Miene leichte Verlegenheit ausdrückte, sah sie sogar für Manhards Geschmack recht annehmbar aus.
»Sie … Sie sind der merkwürdigste Mensch, den ich je kennengelernt habe,« sagte sie, ihren weißseidenen Sonnenschirm auf der Schulter in Umdrehung versetzend. »Ist denn das alles wirklich wahr?«
Er nickte nur ernst.
Da wurde sie lebhaft. »Sie wissen, mein Vater ist Regierungsbeamter und besitzt eine sehr einflußreiche Stellung. Er ist Gouverneur des Roxara-Distriktes, zu dem auch die neuen Perlmuschelbänke gehören.«
»Oh«, unterbrach Manhard sie eifrig, »– des Roxara-Distriktes …?! Das wußte ich nicht.«
Sie ahnte nicht, warum gerade diese Gegend ihn so sehr interessierte, und nahm seinen Zwischenruf nur als Erstaunen über den wichtigen Posten ihres Vaters hin.
»Ja«, fuhr sie ebenso hastig fort, »und es kostet mich nur ein Wort, um Ihnen eine Anstellung zu verschaffen. Ich werde an meinen Vater telegraphieren – sofort. Und er wird Ihnen Vorschuß schicken.«
Der lange Deutsche mit dem auffallend energisch gemeißelten Kopf hatte, noch während sie sprach, seinen Entschluß gefaßt.
»Ich danke Ihnen, Miß Fartaday,« sagte er kurz. »Wir Deutschen helfen uns auch allein weiter.«
»Habe ich Sie verletzt? Das wollte ich nicht«, meinte sie verwirrt, und wieder errötete sie bis unter die aschblonden Stirnhaare.
Dabei blickte sie ihn mit Augen an, die ihm plötzlich das Geheimnis ihres neunzehnjährigen Herzens verrieten. Sie liebte ihn. Geahnt hatte er das schon seit ein paar Tagen.
Nun tat sie ihm leid. Sie hatte ja nur sein Bestes gewollt.
Und so sagte er denn herzlich:
»Verletzt haben Sie mich keineswegs, Miß Ethel, wirklich nicht. Das mag Ihnen genügen. – Und nun – nochmals: leben Sie wohl!«
Er lüftete den Hut und schlüpfte schnell zwischen zwei hochbepackten Lastwagen hindurch auf den jenseitigen Bürgersteig.
Ethel Fartaday wäre ihm am liebsten nachgeeilt. Dann aber preßte sie die Lippen fest aufeinander und schritt dem Eingang des Hotels zu. Sie würde ihn schon wiederfinden und feststellen, womit er sein Geld jetzt verdiente. Und – ging es ihm erst einmal ganz schlecht, so würde er trotz seines törichten Stolzes wohl zugänglicher werden. – –
Eine halbe Stunde später stand Felix Manhard in dem Laden eines chinesischen Trödlers am Hafen und kaufte sich einen blauen, billigen Seemannsanzug sowie einfache Wäsche und einen geflickten Rucksack ein. Eine weiche Mütze, ein buntes Halstuch und eine Nickeluhr vervollständigten die neue Ausrüstung. Alles, was er aus dem Leibe trug, gab er dem Chinesen in Zahlung. Nur die dicksohligen, braunen Schnürstiefel behielt er, ebenso eine feste Lederbrieftasche. Da der Händler noch eine Kleinigkeit bares Geld dazu verlangte, reichte er ihm eine 100-Pfundnote zum Wechseln, die er der Brieftasche entnahm. Der schlitzäugige Chinamann schaute ihn argwöhnisch an, noch mißtrauischer aber die Banknote. Doch sie stellte sich als völlig echt heraus. In wenigen Minuten hatte Manhard sich dann umgezogen und verließ den Laden, nachdem er das von dem Chinesen erhaltene Papiergeld bis auf einen kleinen Rest unbemerkt in der dicken Sohle seines einen Schuhes untergebracht hatte.
Nachmittags zwei Uhr ging der Küstendampfer, wie er wußte, nach Kalikut ab. Er bezahlte den billigsten Platz, aß wie die anderen Vorschiff-Passagiere seine eigenen, vorher eingekauften Speisen und spuckte genau so beim Rauchen seiner kurzen Pfeife auf Deck wie all die bunt zusammengewürfelten Gestalten um ihn her.
Zwei Tage später war er in Kalikut. Hier wechselte er das Schiff und benutzte einen uralten Raddampfer zur Überfahrt nach Roxara, einem Städtchen, das, hart an der Südwestküste Vorderindiens gelegen, seine Entstehung nur den dort vor einem halben Jahre neu entdeckten Perlmuschelbänken verdankte und trotz seines jugendlichen Alters von noch nicht ganz drei Monaten schon jetzt einige dreitausend Einwohner zählte, die sich aus Vertretern aller Nationen und Menschenrassen der ganzen Welt zusammensetzten, freilich nicht aus den besten Elementen. Perlenbänke bilden ja für Abenteurer genau dieselbe Anziehungskraft wie Goldfelder, vielleicht nur mit dem einen Unterschied, daß jene mehr die gescheiterten Existenzen des Seemannsberufes anlocken, da die Perlenfischerei eben ein nasses Geschäft darstellt.
Felix Manhard suchte sich sofort nach seinem Eintreffen in Roxara ein Unterkommen. Es war bereits dunkel gewesen, als der vorsintflutliche Raddampfer an der primitiven Hafenmole des Städtchens festgemacht hatte. Daher war der junge Deutsche froh, als er in einer einem dicken Chinesen namens Fung-Scho gehörigen Hafenkneipe eine Kammer mit einem Maisstrohsack als Bett erhielt. Vorausbezahlung war hier Bedingung. Manhard feilschte um den Logispreis wie der ärmste Hindu, der nach Roxara kam, um sich als Perlentaucher zu verdingen. Dann aß er in der Kneipe, einem stallähnlichen Raum mit langen, in die Erde gerammten Tischen, irgend ein Fischgericht, das gar nicht übel schmeckte, trank dazu ein Glas sogenannten »echt englischen Porters« und suchte nachher seine Kammer auf, wo er bis in den hellen Morgen hineinschlief. –
Der Zufall wollte es, daß Miß Ethel Fartaday an demselben Abend von dem von ihr beantragten Detektivinstitut Perkins u. Lawson, Bombay, den schriftlichen Bescheid erhielt, der Deutsche Felix Manhard sei in Bombay nicht aufzufinden und habe die Stadt sicher bereits verlassen.
Die junge Engländerin war bitter enttäuscht. Bombay langweilte sie plötzlich. Sie sehnte sich nach der Einsamkeit der alten Rajahburg (Rajah, indischer Fürst) dort unten im Süden zurück, die die englische Regierung neuerdings ihrem Vater als Wohnsitz angewiesen hatte, damit der Distriktsgouverneur den wichtigen Roxara-Perlbänken stets nahe sei, wo Handel und Wandel in kurzer Zeit einen so ungeahnten Aufschwung genommen hatten.
So telegraphierte sie denn noch an demselben Abend ihrem Vater, daß sie morgen Bombay verlassen werde. Ihre Gesellschaftsdame Miß Folson rang zwar verzweifelt die Hände, daß man sich nun wieder in die weiten, stillen Räume der unheimlichen indischen Fürstenburg vergraben solle. Aber alles Gerede half ihr nichts.
»Ethel – wäre der junge Deutsche noch hier, so würde nichts Sie nach Roxara zurücklocken können!« sagte sie schließlich spitz, um ihrem Schützling wenigstens einen kleinen Hieb zu versetzen.
»Vielleicht«, erwiderte Ethel Fartaday gelassen und packte mit Hilfe ihrer Zofe ihren Riesenkoffer weiter.
2. Kapitel
Felix Manhard fühlte sich am nächsten Morgen wieder völlig frisch. Die Fahrt auf den Küstendampfern, wo er auf dem bloßen Deck hatte nächtigen müssen, war auch für seinen an Strapazen gewöhnten Körper etwas anstrengend gewesen.
Nachdem er reichlich und gut gefrühstückt hatte, – Fung-Scho’s Küche war sicher das Beste an der ganzen Kneipe –, begab er sich zur Bucht hinab, an deren tiefstem Winkel das Städtchen lag.
Die Wasserfläche der Bucht war mit einer Unmenge von Fahrzeugen aller Art belebt, die sämtlich vor Anker lagen und von denen aus die Perlenfischerei mit Hilfe von farbigen Tauchern, – Hindus, Kanaken und Negern, betrieben wurde. Die gesuchten Perlmuscheln wuchsen auf den zum Teil aus Korallenbauten bestehenden Riffen am Boden der Bucht in einer durchschnittlichen Tiefe von fünf Meter. Was die Perlenbänke von Roxara so schnell berühmt gemacht hatte, war der ungeheure Reichtum an Muscheln, der den der nahen Küstenstriche der Insel Ceylon noch übertraf.
Manhard verfolgte mit lebhaftem Interesse das geschäftige Treiben auf den ihm zunächst liegenden Schiffen, sah die nackten Taucher mit ihrem Körbchen und dem hakenförmigen Messer in die Tiefe gleiten und nach regelmäßig drei Minuten mit dem muschelgefüllten Bastbehälter wieder auftauchen. Gesänge in allerlei Mundarten tönten über das in brennendem Sonnenglast daliegende Wasser hin, bisweilen auch ein lauter Jubelruf eines besonders glücklichen Perlenfischers. In der Luft aber schwebte eine Unmenge von Seevögeln, deren Geschrei oft zu einem häßlichen Getöse anschwoll, nämlich stets dann, wenn man von einem der Schiffe verbotenerweise die abgestorbenen, aus den Muscheln gelösten und nach Perlen bereits durchsuchten schleimigen Tiere über Bord schüttete, wodurch sofort hunderte von gierigen Möwen, Albatrossen und buntschillernden indischen Krähen herbeigelockt wurden, die sich kreischend um die leichte Beute stritten. –