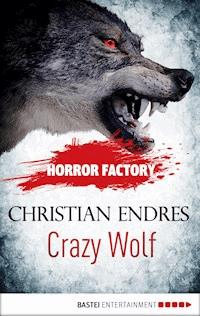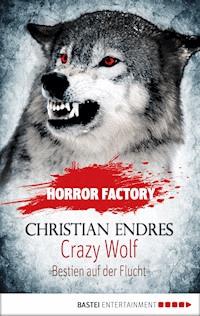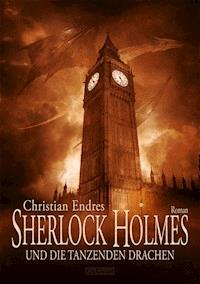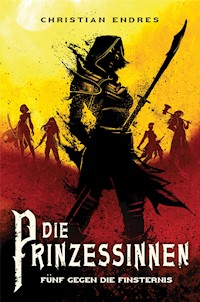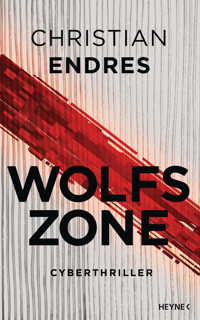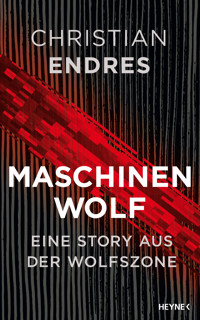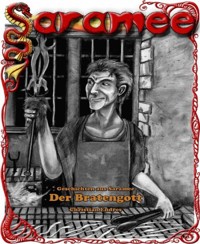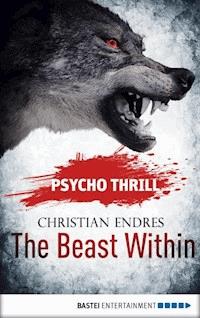12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Cross Cult
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Aus den Legenden … ins Blutbad Obwohl Narvila, Aiby, Cinn, Decanra und Mef einst in königliche Familien geboren wurden, leben sie heute fernab aller Schlösser oder Throne: Als waffenstarrende Söldnerinnen metzeln sie sich durch eine brutale Welt, weisen sie Ungeheuer wie Unmenschen in die Schranken. Doch die Prinzessinnen stellen sich nicht nur Vampiren, Kobolden sowie Würmern und Ratten aller Art. Als ein Serienmörder mit einer Vorliebe für Königstöchter gleich mehrere Reiche in Aufruhr versetzt, begeben sich Narvila und ihre Gefährtinnen auf eine riskante Jagd – die zu einem wahren Prinzessinnen-Blutbad führt und für die fünf Freundinnen alles verändern könnte …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 544
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
HOHEITLICHES GEMETZEL
NARVILA
EINST
NARVILA
EINST
NARVILA
EINST
NARVILA
EINST
NARVILA
EINST
NARVILA
EINST
NARVILA
EINST
NARVILA
EINST
NARVILA
EINST
NARVILA
KÜRZLICH
NARVILA
EINST
NARVILA
EINST
NARVILA
EINST
NARVILA
EINST
NARVILA
DANKSAGUNG
KURZGESCHICHTEN UND ANDERE KURIOSITÄTEN
MEHR HEFTIGE ABENTEUER
ESKORTE FÜR EINE TORTE
DIE PRINZESSINNEN UND DIE BÜCHERWÜRMER
BLAUES BLUT AUF LEINWAND
WARUM MAN PRINZESSINNEN NICHT AUF DEN GEIST GEHEN SOLLTE
DIE HOHE KUNST DES AUSSCHLACHTENS
VON AUFTRÄGEN UND VERTRÄGEN
MONSTER AUF DER MESSE
ALS PRINZESSIN BEKOMMT MAN NICHTS EINFACH SO GESCHENKT …
EIN SCHLITTEN VOLLER ÄRGER
AM HORIZONT
HOHEITLICHES GEMETZEL
NARVILA
Bloß noch ein paar Herzschläge im Licht des Vollmonds, dann werden die Prinzessinnen das Stadthaus mit dem Lebenssaft und dem Unleben ihrer Gegner dekorieren. Aber der Reihe nach.
Es ist noch gar nicht so lange her, dass Narvila ihr Dasein als Prinzessin von Besgios aufgegeben und sich just jenen vier Kriegerinnen angeschlossen hat, die sie damals vor einer Bande Entführer gerettet haben.
Wie Narvila selbst sind auch Aiby, Decanra, Mef und Cinn geborene Königstöchter, die nur schon länger einem blutigen Pfad fern aller Schlösser, Paläste, Throne und Privilegien folgen.
Sich als Söldnerinnen einen eigenen Weg bahnen.
Gegen alle Widerstände und Widerlinge.
Man könnte ganze Bücher füllen mit Narvilas Ausbildung und ihren ersten Abenteuern, in dieser Welt voller Gefahren und Gemetzel, Magie und Monster, Abschaum und Ausgeburten.
Einer Welt, in der die Dienste der waffenstarrenden Prinzessinnen von allerlei Menschen benötigt werden, nicht nur von den klassischen Jungfrauen und Maiden in Nöten.
Deren Rettung stellt zwar tatsächlich ihr Fachgebiet dar, doch helfen Narvila und ihre Freundinnen auch allen anderen, sofern man sie dafür anheuert, und bringen dabei jedes Ungeheuer und jeden Unhold zur Strecke.
Es ist ein hartes, ein raues Leben.
Wild, waghalsig, wüst, windig, wacker, wendungsreich, was-nich-noch-alles.
Das beste Leben, das Narvila sich vorstellen kann, und das einzige, das sie führen will.
Mit genau den Menschen, die sie in jeder Situation an ihrer Seite wissen möchte.
Selbst wenn ihre Truppe, wie üblich in schwarze Lederharnische und diverse andere Rüstungsteile gehüllt, heute Nacht das protzige Haus eines Vampirs stürmen wird.
Aber auf das Paar Fangzähne mehr kommt’s vermutlich nicht mehr an, schätzt Narvila.
Der wohlhabende Gewürzhändler Silgarno bezahlt die Prinzessinnen dafür, seine Tochter Catessju aus den – nun ja – Fängen eines betuchten Blutsaugers zu befreien.
Eines Vampirs, der in Kierganich, Hauptstadt des kleinen Königreichs Tulephwin, Narrenfreiheit genießt.
Bei Tag wäre dieses Unterfangen sicherlich leichter zu bewerkstelligen. Allerdings stehen der Vampir und seine Gefolgschaft unter dem Schutz einiger reicher, von Unsterblichkeit träumender Adeliger – die geschmierte Stadtwache schickt daher regelmäßig wohlmeinende Patrouillen an dem Haus in einem der nobleren Viertel Kierganichs vorbei.
Darum können Narvila, Aiby, Decanra, Cinn und Mef nicht tagsüber eindringen, was todsicher weniger vampirischen Widerstand bedeuten würde, und sind nachts hier.
Da kommen die Wächter zwar auch, jedoch seltener.
Trotzdem haben die Prinzessinnen zu dieser späten Stunde einen unerwarteten Vorteil.
Aus dem steinernen Gebäude erschallt nämlich laute Orchestermusik. Keine ruhigen Stücke, sondern dramatische Werke, die wie der raue Ozean oder eine rohe Schlacht krachen.
Während die Musik dröhnt und brandet, braucht Decanra mit dem Knacken des Türschlosses dummerweise länger als erwartet.
Die ehemalige Meuchlerin aus den Juwelenstädten jenseits der Sandwüste trägt fingerlose Handschuhe und einen Kapuzenumhang, der eine schwarze Mähne, tiefbraune Haut, einen Krummsäbel und viele Wurfmesser verhüllt.
»Hab’s gleich«, murmelt sie, ihre Dietriche zwirbelnd, mit ihrem Dolch hebelnd.
»Hast du grad schon gesagt.« Mef, von Küste, Ozean und Tropen gebräunt, hat ihre weizenfarbene Haarpracht heute Nacht mit einem Stirnband gebändigt, das Schwert bereits aus der Hülle auf ihrem Rücken gezogen. Ihre Handschuhe münden in großen Stulpen. Sie grinst, was die Narbe zwischen ihrem Mundwinkel und ihrem Ohr zucken lässt. »Soll ich mal? Ist zwar kein Keuschheitsgürtel, aber länger als du brauch ich auch nicht.«
»Halt die Klappe«, murrt Decanra, stochert und dreht.
»Sieht nicht so aus, als hättest du so was schon mal gemacht«, setzt Mef nach.
Decanra seufzt. »Dieses Schloss stammt von Meister Rohde aus Dretvik. Es gibt Schatzkammern, die schlechtere Schließmechanismen haben. Das dauert eben etwas.«
»Schließmuskeln?«, fragt Mef heiter.
»Mir reicht’s jetzt«, brummt Aiby. Die Anführerin ihrer Schar strotzt vor nach Hochlandart tätowierten Muskeln und Rundungen – Monster, Totenschädel und Runen, von den Fingerknöcheln bis zu den Fußgelenken. »Die verfickten Stadtwächter kommen auf ihrer nächsten Runde bald wieder vorbei. Lass mich mal.«
Widerwillig rückt Decanra von der Tür ab, stellt sich neben Narvila, packt ihren Dolch weg und zieht geräuschlos ihren gebogenen Säbel.
Aiby holt unterdessen beidhändig mit der großen Streitaxt aus, bis ihre verfilzten roten Zöpfe nur so hüpfen, und versenkt ihre Waffe in der Eingangstür der Vampir-Residenz.
Die laute Musik aus dem Haus übertönt den Krach einigermaßen.
»So geht’s natürlich auch«, sagt Narvila, die ihre Schwertlanze wie eine Standarte hält. Sie dreht den Kopf zur Seite, als bei Aibys folgenden Schlägen Holzsplitter gegen ihre helle Haut und ihren mit Harpyien-Krallenfurchen verzierten Brustpanzer aus Echsenschuppen fliegen.
»Ich hätt das Schloss aufbekommen«, grummelt Decanra.
»Der direkte Weg ist immer der beste«, knurrt Cinn. Zwei Dolche schimmern in den bandagierten Fäusten der kleinen, knochigen Nordländerin. Ihre stechend hellblauen Augen bleiben auf die Tür gerichtet, egal wie viele Holzstücke gegen ihr kurzes weißes Haar und ihr blasses Gesicht prallen.
»Ich hab mal einer Vampirin das Herz gebrochen«, sagt Mef indessen nostalgisch. »Erinnert ihr euch?«
»Das war vor meiner Zeit.« Narvila streicht über die längere Seite ihres braunen, ungleichmäßig geschnittenen Haares. »Aber du erwähnst es so oft, dass ich das Gefühl hab, dabei gewesen zu sein.«
Aibys Axt gräbt sich zu einem lauten Tusch in die Bohlen des Eingangsportals.
»Bei mir und der Vampirin?«, fragt Mef.
»Gnah«, antwortet Narvila.
Aiby schlägt ein letztes Mal zu.
Das war’s für die Tür.
»Vorwärts«, sagt die Hochländerin, spuckt Holzspäne aus und steigt als Erste durch, über die Trümmer ins Haus.
Sofort sind Narvila und die anderen ernst.
Ganz bei der Sache.
Voll konzentriert.
Zu allem bereit.
Und das ist auch gut so, denn trotz der lärmenden Musik hat man ihr Eindringen inzwischen bemerkt.
Sechs Männer, mit Kurzschwertern und Dolchen bewaffnet, rennen in die von Laternen erhellte Eingangshalle, direkt auf sie zu.
Narvila sieht junge wie alte Gesichter – manche Menschen, die sich Vampiren verpflichten, wollen durch den Kuss der Finsternis ihre Jugend auf ewig bewahren, andere dem ewig währenden Tod ein Schnippchen schlagen.
So oder so kommen die Prinzessinnen diesen Plänen heute Nacht garantiert in die Quere.
Die Musik, die im Haus noch ohrenbetäubender und durchdringender ist, untermalt ihren Zusammenprall mit den Bewaffneten auf theatralische Weise.
Aiby enthauptet den vordersten Vampir-Gefolgsmann, als würde der Kerl mit dem Schwert noch zur Tür gehören. Sein Kopf rollt davon, ein Staunen auf den faltigen braunen Zügen.
Decanra wehrt ein langes Messer mit ihrem Säbel ab, bewegt sich wie ein fließender Schatten und schlitzt ihrem hellhäutigen Gegner den Arm samt Pulsader auf.
Blut spritzt im Überfluss.
Mefs Schwert trifft derweil scheppernd auf die Klinge eines sehnigen, erfahrenen Glatzkopfes. Mef trennt dem Mann am Ende einer filigranen Fechtfigur die weiße Schwerthand ab.
Cinn wirbelt zwischen zwei Vampir-Freunden umher, trifft sie erst mit den Füßen und dann mit Stahl, was jeweils Blut fließen lässt. Am Boden gibt sie ihnen emotionslos den Rest.
Narvila, die noch nie zu musikalischer Begleitung gekämpft hat, pariert die lange Klinge eines fahlen Gecken, dreht sich und bewegt ihre Schwertlanze elegant, aber tödlich. Blut schießt aus einer geöffneten Halsschlagader, die in letzter Zeit vermutlich eh schon einiges durchgemacht hat.
Gurgelnd bricht der langhaarige Bursche zusammen.
Ohne ein Wort darüber verlieren zu müssen, bewegen sich die Prinzessinnen in Kampfformation auf die Quelle der tosenden Orchestermusik zu.
Narvila spürt sie in ihrem Körper.
Die Tiefen und Höhen.
Das Donnern und Knallen.
Als hätte das Haus ein pochendes Herz.
Einen fühlbaren Puls.
Sie folgen einem holzvertäfelten, lampenbeschienenen Flur mit Teppichläufern, von dem mehrere Zimmertüren abgehen.
Weitere Angriffe bleiben aus.
»Lauschen wohl alle gebannt dem Krach«, sagt Aiby – sie bevorzugt Lieder, die man selbst im größten Suff noch mitgrölen kann und für deren Begleitung ein Stampfen mit den Füßen unter einem Tavernentisch genügt.
Das Ziel der fünf ist die große Doppeltür am Ende des Ganges.
Die ist es immer, wie Narvila weiß, ob im Turm eines Zauberers, einem uralten Tempel oder eben einem protzigen Vampir-Haus mitten in der Stadt.
Auf der anderen Seite des Portals steigert sich das Wummern der Musik weiter.
»Soll ich diesmal …?«, fragt Decanra, doch da geht Aiby schon auf die Tür los, hackt wie von Sinnen aufs Holz ein.
»Wir sollten wirklich mal drüber reden, was neulich im Hochland passiert ist«, sagt Narvila, die sich seit ihrer Reise in Aibys Heimat ein paar Wochen zuvor ziemliche Sorgen um die Gemütslage ihrer Freundin macht. »Du darfst es nicht in dich reinfressen …«
»Grmpf«, quittiert Aiby zwischen zwei wütenden Hieben.
Diese Tür gibt noch schneller auf.
Narvila und ihre Gefährtinnen schwärmen in einen feudal ausgestatteten Salon mit Holzparkett, Kristallleuchtern, teuren Möbeln. Die zwei Dutzend Leute, die auf Sesseln, Stühlen und Sofas sitzen, haben ihnen den Rücken zugewandt. Nur die erschrockenen Musiker auf der anderen Seite des Raums können sie sehen – und hören beim Auftritt der blutbesudelten Prinzessinnen mit schiefem Kratzen und Tröten der Instrumente auf zu spielen.
Nun rucken die Köpfe des Publikums herum.
Aller Augen richten sich auf Narvila und die anderen.
Das ist sie inzwischen gewohnt.
Doch die Feindseligkeit in den Blicken hier hat’s in sich.
Ein älterer Mann in einer engen mitternachtsblauen Hose und einem Leinenhemd, mit samtig brauner Haut und einem kurzen silbergrauen Zopf erhebt sich aus einem Sessel, geht seufzend um diesen herum und tritt den Eindringlingen entgegen.
Seine Haltung, sein Blick, seine Bewegungen – Narvila ist sich ziemlich sicher, dass das Tenvariz sein muss.
Der Vampir, der es sich in Kierganich bequem gemacht und die Tochter des Gewürzhändlers entführt hat.
»Ich bedaure, meine Damen, doch dieses Konzert ist eine Privatveranstaltung.« Tenvariz’ Stimme wirkt ähnlich volltönend wie bis eben die Instrumente. »Außerdem wage ich zu bezweifeln, dass die Musik Euren Geschmack trifft. Dafür braucht man Feingeist, wenn Ihr versteht?«
Mit dieser Bemerkung erntet Tenvariz seitens seiner Gäste sogar Gekicher und Gelächter.
Narvila mustert die gut gekleideten, perfekt frisierten und geschminkten Leute. Die Musiker wirken verunsichert, aber die anderen Anwesenden geben sich angesichts der Tatsache, dass da gerade eine Handvoll Kriegerinnen die Tür eingeschlagen hat, recht gelassen.
Tenvariz sieht sie mit wissendem Blick an, als er fragt: »Eurem blutgetränkten Aussehen nach lohnt es sich nicht, mein Personal unten zu rufen, schätze ich?«
»Sie haben uns angegriffen«, sagt Narvila, die das Gefühl hat, sich rechtfertigen zu müssen.
»Wenn ich das richtig sehe, haben sie mein Haus beschützt. Ihr Leben dafür gelassen, Euch daran zu hindern, bis hierher vorzudringen. Sicher, das war ihre Aufgabe, dafür wurden sie bezahlt, doch haben sie es deshalb verdient, gnadenlos niedergemacht zu werden? Und wofür, frage ich Euch?«
Narvila weiß nicht, was sie antworten soll.
Mef schon. »Will der uns verarschen? Lasst uns den blutsaugenden Ficker einen Kopf kürzer machen, die Kleine schnappen und dann irgendwo hingehen, wo sie keinen Vampiren den Arsch lecken.«
»Aye«, macht Aiby grollend.
»Bin dabei«, knurrt Cinn.
»Seht ihr das Mädchen?«, fragt Decanra.
Narvilas Blick huscht durch den Salon. »Noch nicht.«
»Hier sind zu viele Rothaarige.« Mef reckt den Hals. »Hätt nie gedacht, dass ich das mal sage …«
»Wir suchen Catessju«, verkündet Aiby kurzerhand. »Wir sollen sie befreien und sicher zu ihrem Vater zurückbringen. Gebt sie uns, und wir verschwinden ohne weiteres Blutvergießen.«
Eine dralle junge Frau, deren Gesicht bisher hinter einem Fächer verborgen gewesen ist, erhebt sich von einem Sofa.
Narvila erkennt Silgarnos Tochter von dem Porträt wieder, das der Händler ihnen gezeigt hat.
»Ich bin aus freien Stücken hier«, erklärt Catessju hochnäsig. »Ich muss nicht befreit werden.« Sie wendet sich dem Vampir zu. »Es tut mir leid, dass meine Anwesenheit diese Monster zu uns geführt hat, Meister Tenvariz.«
Mef lacht ungläubig. »Jetzt sind wir die Monster?«
»Es sind Eure Mordwerkzeuge, von denen Blut tropft«, sagt Catessju angewidert. »Wir wollten einen friedlichen Abend mit schöner Musik und in guter Gesellschaft genießen.«
»Und etwas Bluttrinken, nehm ich an«, versetzt Decanra. »Euer Gastgeber ist das Monster. Das wisst Ihr genau.«
»Ich?« Tenvariz, eine Hand an der Brust, tut überrascht, zutiefst verletzt. »Warum? Weil diese Menschen aus eigenem Antrieb zu mir kommen, um etwas mit mir zu teilen?« Er schüttelt traurig das Haupt. »Was kann der Wolf dafür, wenn die Schafe sich zu ihm legen, weil sie selbst wie Wölfe sein wollen?«
Narvila kann sehen, dass Catessju und die anderen überzeugt von dem sind, was Tenvariz sagt.
Sie hat auf die harte Art gelernt, dass Zweifeln und Zaudern sehr leicht den Tod bedeuten können. Trotzdem kommt Narvila jetzt ins Grübeln. Sie erinnert sich an Gelegenheiten, bei denen die Prinzessinnen einen Auftrag nicht zu Ende gebracht, zähneknirschend auf ihre Belohnung verzichtet haben.
Um einer höheren Gerechtigkeit oder Moral zu dienen, das individuelle Glück von anderen nicht zu zerstören.
Das Richtige zu tun.
Aber ist dies hier auch so ein Fall?
Wenn ein manipulativer Vampir involviert ist?
»Lassen wir sie hier?«, fragt Narvila leise.
»Auf keinen Fall«, widerspricht Aiby prompt, laut und bestimmt. »Sie steht unter seinem Bann. Die Kleine weiß nicht, was sie will. Oder labert.«
»Ich darf ja wohl sehr bitten«, empört sich Catessju. »Wie könnt Ihr es wagen, für mich zu sprechen? Ihr plappert doch nur nach, was mein Vater sagt. Und das auch nur, damit Ihr Euren Sold erhaltet. Ekelhaft!«
Narvila, deren eigener Vater sie einmal mit Gewalt nach Besgios hat zurückbringen wollen, verzieht das Gesicht. Ihre nicht mehr ganz so zarte und gepflegte Haut spannt – das Blut des Gecken, den sie in der Eingangshalle getötet hat, trocknet bereits auf ihren Zügen.
So viel zum Thema Monster, was?
»Wie es scheint, haben wir ein Problem«, sagt Tenvariz, der das Theater mittlerweile wohl mehr genießt als das unterbrochene Konzert davor. »Ich sage es geradeheraus: Wir kuschen nicht vor Eurem Aufzug oder Eurer Gewaltbereitschaft.« Nun ist da etwas Schneidendes in seiner Stimme, seinem Blick, selbst seinem Lächeln. »Wir verteidigen das, was wir haben.«
Die Umstehenden nicken, ihre Mienen verdüstern sich. Und ob Männer oder Frauen, alt oder jung, dick oder dünn, weiß oder schwarz oder braun oder etwas anderes: Alle greifen unter ihre Sitzgelegenheiten, holen Dolche oder sogar Schwerter hervor.
Dergestalt bewaffnet erheben sie sich.
Schafe, die zu Wölfen werden …
Um gegen die Monster zu kämpfen?
Oder um für das Monster zu kämpfen?
Narvila kann es nicht mit Sicherheit sagen, und das bereitet ihr Sorgen. So große Zweifel hat sie lange nicht gespürt, seit sie aus dem Schloss in die Schlacht gezogen ist.
Tenvariz lächelt noch breiter, als würde er ihre Gedanken lesen – was ein Mythos ist, das können Vampire nicht.
Oder?
»Wie weit werdet Ihr gehen, meine Damen?«, fragt der Blutsauger und zeigt ihnen jetzt seine ausgefahrenen Fangzähne. »Wie viele wollt Ihr noch abschlachten, um eine Einzelne gegen ihren Willen aus unserer Mitte zu reißen? Aus dem Rudel?«
»Wohl eher der Herde«, sagt Cinn verächtlich.
Mef dreht ihr Schwert, bis es im Schein der Leuchter schimmert. »Wir gehen so weit, wie wir müssen, du untoter Ficker. Und weiter, wenn’s sein muss.«
Der Vampir gibt die Höflichkeiten nun auf. »Du wirst die Erste sein, von der ich trinke.« Kaum dass er das angekündigt hat, schnuppert Tenvariz lautstark. »Du gehörst zu ihr«, sagt er auf einmal verblüfft. »Sie hat dich nicht an sich gebunden, aber ihr Anspruch ist deutlich. Du gehörst der Blut-Prinzessin. Wyskrid von Barundien.«
Mef grinst. »Hab dir doch gesagt, dass ich mal was mit ’ner Vampir-Prinzessin hatte«, raunt sie Narvila übertrieben laut zu. »Meine Schönheit war wie ein Pflock für ihr Herz.«
Tenvariz starrt Mef an. »Schade. Dich darf ich leider nicht anrühren. Politik.« Er wedelt mit einer Hand und bleckt die Eckzähne. »Deine Freundinnen aber schon. Und darauf kannst du wetten: Ich werde dich dabei zusehen lassen, wie ich einer nach der anderen die Halsschlagader zerfetze und ein Bad nehme in einer Wanne voll mit ihrem heißen Blut, und dann …«
Etwas Glänzendes schießt an Narvilas Ohr vorbei.
Genau auf Tenvariz zu.
Der Arm des Vampirs schnappt so schnell hoch, dass Narvila der Bewegung kaum zu folgen vermag.
Tenvariz fischt das Wurfmesser, das auf sein unendlich langsam schlagendes Herz gezielt hat, mit der Rechten aus der Luft.
Er hält es vor sich und betrachtet es mit philosophischer Miene.
Narvila, Cinn, Mef und Aiby sehen diejenige an, die das Messer geworfen hat.
»Was?«, fragt Decanra. »Darf ich nicht auch mal die Geduld verlieren? Warum soll immer ich die verfickte Stimme der Vernunft sein?«
»Jetzt wär ein Tusch genau das Richtige«, meint Mef.
Aiby schnaubt.
Narvila grinst.
Selbst Cinn wirkt erheitert.
Tenvariz blickt sie kalt an. »Zeigt ihnen, wie stark wir sind«, sagt er dann.
Daraufhin stürzt sich seine Anhängerschaft auf die Prinzessinnen, Abscheu und Mordlust in den Augen.
Die Musiker kauern sich an die hintere Wand, verstecken sich hinter ihren Instrumenten.
Narvila umfasst den Griff ihrer Schwertlanze fester.
Was sind Tenvariz’ Gefolgsleute?
Menschen oder Monster?
»Sie haben die Finsternis gewählt«, sagt Aiby, die Narvilas Gedanken besser liest als jeder Vampir. »Halt dich nicht zurück. Sie tun’s sicher auch nicht.«
Ehe Narvila antworten kann, sind die Ersten bei ihnen.
Die zahlenmäßige Überlegenheit der feinen Abendgesellschaft ist an sich kein Problem. Aber diejenigen, die dem Vampir dienen, sind stärker als normale Menschen.
Narvila bemerkt es gleich beim ersten Zusammenprall mit einer fülligen Dame. Als sich zwei Herren aus Tenvariz’ Gefolge zu ihrem Tanz hinzugesellen, muss Narvila all ihr Können aufbieten.
Ihre Sorge, dass sie sich ob der Menschlichkeit ihrer Gegner zurückhalten könnte, schmilzt dahin.
Ein kurzer Seitenblick – ihre Gefährtinnen haben gleichfalls alle Hände voll zu tun.
Nichtsdestotrotz behaupten sich die Prinzessinnen.
Natürlich tun sie das.
Da greift Tenvariz ins Geschehen ein.
Narvila hat nicht gesehen, dass er sich ins Zentrum der Auseinandersetzung begeben hat.
Er bewegt sich wie eine Flüssigkeit.
Blut, vielleicht.
Der schlanke Vampir steht plötzlich vor Aiby und fegt sie trotz ihrer Statur mit einem Rückhandschlag zur Seite, woraufhin sie gegen eine Wand taumelt. Cinn springt zwischen Aiby und den Blutsauger, aber egal wie schnell die Nordländerin ihre Dolche zuschnappen lässt, Tenvariz weicht stets mühelos aus.
Und schickt Cinn am Ende mit einem Tritt aufs Parkett.
Nun zieht er selbst ein Schwert, eine alte Klinge, die ihrerseits wahrscheinlich schon viel Blut gesoffen hat.
Narvila ist mit einem Adeligen beschäftigt, der ein besseres Händchen für seinen protzigen Dolch als für sein penetrantes Duftwasser hat. Sie kann Cinn und Aiby nicht helfen.
Zum Glück kämpft sich Decanra wehenden Umhangs zu ihnen durch und baut sich vor Tenvariz auf. Der ist nicht beeindruckt vom Blut an ihrem Säbel oder ihren Hieben und Tritten, drängt sie mit seiner fremd anmutenden Schwertkunst zurück.
Endlich erwischt Narvila ihren Gegner, stößt sie ihre Lanze von unten durch sein Kinn und seinen Kopf.
Mit frischem Lebenssaft an der breiten Klinge ihrer Waffe eilt sie los, um Decanra zu unterstützen.
Doch selbst zu zweit können Narvila und Decanra den Vampir nicht in Bedrängnis bringen.
Das gelingt erst, als Mef dazukommt.
Tenvariz, der sich auf keinen Fall mit der Vampir-Prinzessin von Barundien anlegen will, wird durch Mefs Unantastbarkeit aus dem Konzept gebracht.
Narvila nutzt das Stocken in seinem Rhythmus und treibt ihm ohne Begleitmusik die Schwertlanze durch den Leib, bis sie hinten wieder rausschaut.
Für einen Moment halten alle im Salon inne.
Tenvariz erstarrt.
Sein Schwert fällt scheppernd zu Boden.
Und dann geschieht etwas mit dem Körper und dem Gesicht des Vampirs.
Die Zeit, immer da, immer bereit, immer zur Stelle, immer geduldig, holt sich zurück, was Tenvariz ihr durch seine Existenz in Unleben, Nacht, Schatten und Finsternis so lange vorenthalten hat.
All die Momente, nach denen ihr seit Langem verlangt.
Jeden Herzschlag, der ihr zusteht.
Der Beißer altert rapide vor Narvilas Augen.
Verschrumpelt und zerfällt.
Lidschlag um Lidschlag.
Eine Frau aus Tenvariz’ Gefolge kreischt. Ein Mann jammert, ein zweiter beginnt zu schluchzen. Eine Dame flucht wie ein Hafenarbeiter. Jemand fällt in Ohnmacht. Andere übergeben sich.
Narvila zieht ihre Lanze aus dem sich auflösenden Leib des Blutsäufers.
Der stürzt zu Boden, wo er noch schneller vergeht und am Ende wie durch einen Zauber endgültig zu Staub zerfällt.
Alle glotzen auf die Stelle.
Den Haufen.
Das, was von Tenvariz übrig geblieben ist.
»Ich richte Wyskrid Grüße aus«, sagt Mef genüsslich in die Fassungslosigkeit hinein.
Das löst den Bann.
Die Anhänger des Vampirs wollen den Prinzessinnen jetzt mehr denn je ans Leder.
Aufgebracht, ungestüm und bestürzt, wie sie sind, stellen sie freilich erst recht keine Gefahr mehr dar.
Als Narvila einen Typen in besten Jahren kaltmacht und hinter sich eine Bewegung spürt, fährt sie mit einer Figur herum, die ihren Angreifer in Hals oder Brust treffen soll, je nach Größe.
Doch plötzlich ist da Decanra, lenkt Narvilas Streich mit ihrem Säbel ab. Narvila taumelt und ist verwirrt.
Bis sie die Frau erkennt, die sie beinahe getötet hätte.
Catessju.
Die Tochter des Gewürzhändlers Silgarno, wegen der sie überhaupt hier sind.
Decanra entwaffnet Catessju, die mit zu Klauen gekrümmten Fingern nach Decanras Augen krallt. Narvilas Freundin verdreht Silgarnos widerspenstiger Erbin die Arme hinter dem Rücken und hält sie fest. Narvila schirmt Decanra ab, allerdings liegen alle Vampir-Freunde am Boden.
Leblos, oder fürs Leben gezeichnet.
Nachdenklich besieht sich Narvila die niedergestreckten Gestalten, das viele Blut, all das Elend, den ganzen Tod.
Das und den Haufen Staub, in dem zwei blutige Stiefelabdrücke prangen – die Überreste von Tenvariz’ Existenz sind im Raum verteilt worden, offensichtlich von Cinn.
Gut, dass Narvila bei solchen Gelegenheiten nicht mehr kotzen muss, wie noch am Anfang ihrer Söldnerinnenlaufbahn.
Sie blickt in die Augen einer tot auf dem Holzboden liegenden Frau, die jünger aussieht als Narvila selbst.
So was erwischt sie dann doch noch.
Sind diese Menschen wirklich Monster gewesen?
Oder haben sie in Wahrheit diesen Leuten ihren Willen aufgezwungen, wie es sonst die Monster tun, ob menschlich oder sonst was?
Ihre Freundinnen, die Narvila gut genug kennen, fühlen ihr Hadern.
Zumal sie mit ihrer Meinung eh nie hinter dem Berg halten.
Außer es geht um die Bergziegen-Prinzessin.
Aber das ist eine andere Geschichte.
Über die sie nicht reden, niemals, unter keinen Umständen.
»Schafe, die Wölfe sein wollen, können nicht in die Herde zurück«, sagt Decanra bitter.
»Aye«, sekundiert Aiby, während sie zu Decanra geht und Catessju die Hände mit dem Halstuch eines Toten zusammenbindet. Er braucht’s nicht mehr. »Sie würden immer Blut wollen. Falls der Beißer sie ganz verwandelt und nicht einfach leer gesaugt hätte. Sie wären also entweder eh gestorben oder selbst Bestien geworden.«
»Aber es wär ihre Entscheidung gewesen«, denkt Narvila laut. »Ihre Freiheit.«
Aiby schüttelt den Kopf. »Zählt nicht, wenn’s die Leben von anderen bedroht.«
»Ich hab einen Grafensohn erwischt«, teilt Cinn ihnen da emotionslos mit und streift ihre mit blutigem Staub panierte Sohle an einer Leiche ab.
»Wie kommst du darauf?«, fragt Narvila.
»Er hat’s mir zweimal gesagt. Als er mich bedroht hat. Und als er um sein Leben gebettelt hat.«
»Lasst mich gehen, ihr Schlampen!«, kreischt Catessju auf einmal und will Cinn ins Gesicht spucken.
Doch die Nordländerin reißt einen ihrer Dolche hoch, was ein Vampir nicht besser hingekriegt hätte, und fängt den Speichel im Flug ab. »Mach das noch mal, und ich scheiß auf die Belohnung.«
Silgarnos Tochter verstummt vorerst.
Die Prinzessinnen schleifen sie in den Flur und in die Eingangshalle.
»Ihr Monster«, sagt Catessju, sowie sie die verstümmelten Wächter sieht.
»Ach, halt die Klappe«, brummt Aiby. »Du hast dich einem Vampir angeschlossen. Wir …«
Weiter kommt sie nicht, da in diesem Augenblick drei Soldaten der Stadtwache durch die zerstörte Haustür treten.
Düstere Mienen aus Misstrauen.
Schimmernde Harnische, Helme und Hellebarden.
Einer von ihnen hat eine eigene Laterne dabei.
»Hilfe!«, kreischt Catessju sofort wie von Sinnen. »Helft mir! Diese Bestien haben alle anderen im Haus abgeschlachtet und wollen mich entführen! Helft mir, bitte!«
»Die Musiker haben wir am Leben gelassen«, korrigiert Mef. »Kann aber sein, dass sie nie wieder irgendwo auftreten.«
Aiby wirft ihr einen Blick zu. »Wir sind Söldnerinnen«, sagt sie sachlich. »Man hat uns damit beauftragt, diese Frau zu retten.« Sie fixiert den Wächter mit dem schwarzen Schnurrbart, der das Rangabzeichen eines Feldwebels trägt. »Vor einem Vampir. Aber das wisst Ihr ja sicher.«
Narvila erkennt, was Aiby versucht.
Es wird nach hinten losgehen, sollten die Wachsoldaten auf der Gehaltsliste der Vampir-versessenen Adeligen von Kierganich stehen.
Aber nun ja.
Es wäre nicht das erste Mal, dass sich die Prinzessinnen mit ein paar Wächtern oder Soldaten anlegen.
Und sicher auch nicht das letzte Mal.
Die Männer sehen alles andere denn erfreut aus.
Einer wirkt sogar, als müsste er gleich fürchterlich reihern, wie Narvila bemerkt.
Erfahrung ist etwas Schönes, aus der Distanz betrachtet.
»Keiner von uns trauert dem verschissenen Vampir nach«, sagt der Feldwebel schließlich. »Oder seinen verblödeten Anhängern. Aber wir können Euch nicht einfach gehen lassen. Ich hab Vorgesetzte, die dafür bezahlt werden, dass dieses Haus geschützt wird.«
»Dann müssen wir uns den Weg hier raus freikämpfen?«, fragt Aiby, noch immer ganz nüchtern.
Die Stadtwächter schauen sich die Leichen, die Blutlachen, den abgeschlagenen Kopf und die besudelten Söldnerinnen ganz genau an.
»Als wir hier angekommen sind, waren die Täter schon weg«, schnarrt der Feldwebel. »Verschwindet. Bevor ich es mir anders überlege.«
»Klar«, sagt Aiby, ihr Sarkasmus so zart wie ihre Axthiebe.
»Das könnt Ihr nicht tun!«, keift Catessju. »Diese Drecksschlampen haben meine Freunde eiskalt …!«
Decanra verpasst Silgarnos Tochter einen Handkantenschlag gegen den Hals, infolge dessen Catessju zusammensackt.
Aiby fängt sie auf, verrenkt sich etwas, stemmt die junge Frau hoch und trägt sie quer über den Schultern.
Die Wächter sind wie versteinert.
»Die Arme war völlig hysterisch, sie hätte sich selbst verletzen können«, erklärt Narvila glatt. »So ist es für sie sicherer. Wir bringen sie schnellstmöglich zu ihrem Vater. Dort wartet ein Heiler. Er wird sich um das arme Mädchen kümmern.«
»Das klingt … vernünftig«, sagt der Feldwebel, und auf sein Nicken hin lassen seine Männer sie durch.
Narvila und Cinn decken ihren Abgang, behalten die Soldaten aus Kierganich im Auge.
»Bei all dem Stress hätten wir auch am Tag reingekonnt«, seufzt Decanra und setzt ihre Kapuze auf.
Narvila wischt sich Vampir-Reste, Menschenblut und ihren eigenen Schweiß aus dem Gesicht. »Schade, dass unser Gasthaus keinen großen Badezuber hat. Das wär jetzt genau das Richtige.«
»Wir finden sicher ein Bordell mit einem«, sagt Mef fachkundig. »Oder wenigstens mit ein paar Badewannen.«
»Vergesst es«, schnauzt Aiby und verändert die Position des bewusstlosen Beißer-Liebchens auf ihrem Rücken. »Wir liefern diese Bekloppte ab, kassieren unseren Sold, und fertig. Ich hab keinen Bock, mich heute Nacht noch mit irgendwelchen Bordelltürstehern zu prügeln, weil du wieder Streit wegen einem Mädchen anzettelst.«
»Du gönnst einem aber auch gar nix«, beschwert sich Mef.
Trotz ihrer Last gelingt es Aiby, mit den tätowierten Schultern zu zucken.
»Aye. Die einen führen, die anderen folgen. So ist das eben. Und da das nun geklärt ist: Folgt mir …«
EINST
Bevor Narvila zu den Prinzessinnen stieß, vervollständigte Sacipha die Truppe: eine Zauberin mit langem, rabenschwarzem Haar und mondheller Haut – Mefs große Liebe, auf immer und ewig, bis in den Tod, und darüber hinaus. Sacipha brauchte so gut wie keine alten Artefakte, um auf die magischen Kräfte der Welt zugreifen zu können. Zu Kopf stieg ihr diese Macht nie. Alle betrachteten Sacipha als die Sanftmütigste der ursprünglichen Prinzessinnen-Besetzung, freundlich gegenüber Mensch wie Tier, manchmal sogar Unmensch wie Untier.
Doch selbst Sacipha konnte sich aufregen.
»Dieser König ist so ein Arschloch«, giftete Sacipha, während die Prinzessinnen durch einen grün-gold schattierten Wald marschierten, dessen Dimension zum kümmerlichen Königreich um ihn herum passte. Man nannte diese Gegend, in der es viele kleine Länder gab, nicht umsonst den Flickenteppich.
»Ist er«, bestätigte Cinn, die als Ziehtochter eines Jägers keine Schwierigkeiten hatte, ihre Gruppe auf einer für die meisten Leute unsichtbaren Fährte durch den Forst zu führen.
»Habt ihr schon mal etwas so Herzloses gehört?«, regte sich Sacipha weiter auf. »Als wär eine Prinzessin in einem Glassarg so was wie ein Schwert in einem Stein oder einem Amboss! Was für ein sackdämlicher Ficker. Ihr eigener Vater. Ich kann es immer noch nicht fassen.«
»Ich mag es, wenn du so leidenschaftlich bist«, sagte Mef, sah Sacipha grinsend von der Seite an.
»Nicht jetzt, Mef.« Die Zauberin presste die Lippen zusammen. »Sonst bin ich am Ende noch wütend auf dich, obwohl es König Zadkernius ist, den ich am liebsten grillen würde.«
»Würd ich zu gern sehen«, sagte Decanra.
»Aye«, machte Aiby.
Cinn knurrte zustimmend.
Was Sacipha und die anderen so aufregte, war Folgendes:
König Zadkernius machte sich keine Illusionen über die Bedeutung seines Reichs, das auf den meisten Landkarten bloß ein Fliegenschiss war, nicht mal eine ordentliche Beschriftung wert.
Deshalb hatte sich der König etwas überlegt.
Durch Krieg oder Reichtum würde er nicht mehr berühmt werden, nicht in die Ewigkeit eingehen. Aber vielleicht könnte er sich und seinen Namen ja in einem Märchen verewigen …?
Also hatte er einen Pakt mit einer Hexe geschlossen. Die versetzte König Zadkernius’ Tochter Mulfrenda in einen tiefen, tiefen Schlaf. Daraufhin legte man die Prinzessin in einen Glassarg, den man in diesen Wald brachte und hier ferner auf eine Lichtung mit einer Erhebung stellte, die kein seriöser Kartograf als Hügel bezeichnet hätte.
Aber Zadkernius ging noch weiter in seinem Versuch, die Grundlage für ein Märchen zu kreieren.
Der König bezahlte eine Bande räuberischer Kobolde dafür, ihr Lager auf der Lichtung aufzuschlagen und den Glassarg seiner Tochter zu bewachen.
Gleichzeitig ließ er in alle Himmelsrichtungen verkünden, dass der Prinz oder Held, der Mulfrenda aus den Klauen der Kobolde befreite und mit einem märchenhaften Kuss ins Leben zurückholte, die Hand seiner Tochter bekommen sollte.
Doch weder Zadkernius’ unbekanntes Königreich noch seine unbesungene Tochter lockten große Helden oder edle Prinzen an.
Die wenigen Möchtegernhelden, Aufschneider, Herumtreiber und siebten Bauernsöhne, die kamen und es versuchten, scheiterten kläglich an den Kobolden.
Mit Beginn des Sommers hatte Mulfrendas Stiefmutter genug und zwang ihren Gatten, ein paar seiner wenigen Soldaten in den Wald zu schicken, um die Sache zu beenden.
Keiner der Männer kehrte zum Schloss zurück.
Dann hörte ein Diener von den Prinzessinnen, die in einem Nachbarkönigreich just einen mittelprächtigen Riesen erschlagen hatten, und erneut ritten Zadkernius’ Boten los.
Und jetzt waren Sacipha und die anderen hier, schimpften über den König der Rabenväter und sollten die arme Mulfrenda retten.
»Vielleicht erinnert man sich ja für seine Blödheit an den König«, sagte Sacipha ungebrochen sauer.
»Eine gute Stiefmutter hat ebenfalls Seltenheitswert«, meinte Decanra, von einer Meistermörderin geliebt und großgezogen.
Wenig später erreichten sie die Lichtung mit der Erhebung, der sich die verbliebenen Soldaten in Zadkernius’ Diensten nicht nähern wollten, sollten, konnten – wie auch immer.
Cinn und Decanra schlichen los, die Lage jenseits der letzten Baumreihe auskundschaften.
»Fünfzehn Kobolde«, sagte Cinn bei ihrer Rückkehr.
»Vierzehn«, präzisierte Decanra mit blutigem Dolch. »Und ein paar Leichen und Waffen unserer Vorgänger.«
»Alles klar.« Aiby nickte, sah Sacipha an. »Fackel vor Wut nicht den ganzen Wald ab, in Ordnung? Pass auf sie auf, Mef.«
»Ich kann die Augen eh nie von ihr lassen …«
Der Kampf mit den Kobolden, die ungefähr Cinns Statur hatten, Äxte, Keulen und Hackbeile in den grünen Händen hielten, dauerte nicht lange.
Sacipha streckte allein vier Spitzohren durch magische blaue Blitze nieder.
Zauberei gepaart mit Zorn.
Mef blieb immer in ihrer Nähe, machte zwei Angreifer in Saciphas Rücken nieder.
Cinn schlitzte und schnetzelte.
Decanra warf ihre Messer und schwang ihren Säbel.
Aiby köpfte und zerteilte.
Als das gelbe Blut der Kobolde das Gras und das Moos der Lichtung tränkte, versammelten sich die Prinzessinnen auf dem Nichthügel, und um den dort stehenden Glassarg.
Vorsichtig hoben sie dessen schweren Deckel ab.
Mulfrenda regte sich nicht.
»Sie ist hübscher, als ich dachte«, bemerkte Mef. »Bisschen ausgezehrt allerdings …«
Sacipha und Aiby schnaubten wie eine Frau.
Danach schob Sacipha ihre Finger sanft in Mulfrendas Mund und öffnete ihn.
Mef legte den Kopf leicht schief. »Tu jetzt nichts, was ich nicht auch tun würde.«
Sacipha ignorierte sie und hielt ihre Rechte über Mulfrendas geöffnete Lippen, als würde sie in der Kehle der Königstochter an unsichtbaren Fäden eine Marionette bewegen. Saciphas Finger arbeiteten vorsichtig, und schließlich schwebte ein Stück Apfel aus Rachen und Mund der Prinzessin.
»Das Herz dieser Hexerei«, erklärte Sacipha ihren staunenden Gefährtinnen – und schleuderte das verfaulte Fruchtfleisch, ohne es jemals berühren zu müssen, wütend in die Büsche.
»Und jetzt fehlt nur noch der Kuss«, sagte Mef. »So läuft das doch, oder?«
Sacipha sah sie über den offenen Glassarg hinweg an. »Wenn du sie küsst, Liebste, werde ich mit Decanra durchbrennen.«
»Hey.« Decanra hob demonstrativ die Hände. »Haltet mich gefälligst da raus.«
»Mich auch«, sagte Aiby sofort.
Cinn grollte unwirsch.
Mef zwinkerte Sacipha zu. »Aber sie wacht nicht auf. Sicher, dass ich sie nicht wenigstens ganz leicht …? Nur die Spitze? Die Zungenspitze?«
Doch da richtete sich Mulfrenda ruckartig auf und gab einen Laut von sich, der halb Luftholen, halb erstickter Schrei war.
»Ganz ruhig.« Sacipha berührte Mulfrendas Schulter. »Ihr seid in Sicherheit, Hoheit. Alles wird wieder gut. Atmet einfach ganz normal. Ein. Aus. Ein. Aus. So ist’s richtig.«
»Wie lange?« König Zadkernius’ Tochter hustete. »Ich kann meine Beine nicht spüren.«
»Eine Nebenwirkung der Hexerei.« Sacipha tätschelte Mulfrendas Hand. »Das wird wieder.« Die Zauberin sah Aiby an. »Schaffst du es, sie durch den ganzen Wald zu tragen?«
»Aye. Ich kann von hier ja praktisch bis zum Waldrand spucken. Allerdings hab ich was anderes im Sinn.«
»Und zwar?«, fragte Decanra.
»Wir tragen Prinzessin Mulfrenda mitsamt dem Glassarg nach Hause«, legte Aiby ihren Plan dar. »Für einen Märchenklassiker wird’s nicht reichen, doch bestimmt für eine gute Geschichte in den Wirtshäusern und Herbergen des Flickenteppichs.«
»Was uns mit der Zeit den einen oder anderen Auftrag bringen mag«, folgte Decanra Aibys Gedanken.
»Aye. Ganz genau. Mef, Sacipha, ihr hebt das Ding vorn an. Decanra, du kommst mit mir nach hinten. Cinn, du gehst voraus und achtest auf alles, was den Kampflärm gehört hat und voreilig die falschen Schlüsse zieht, was die gedeckte Tafel angeht.«
Vorsichtig trugen sie den Glassarg und die Königstochter darin zu den Bäumen, wobei sie unter Cinns Anleitung, so gut es ging, den rutschigen gelben Blutpfützen sowie den Kadavern und Körperteilen der Kobolde auswichen.
»Ich glaube, ich muss mich übergeben«, sagte Mulfrenda, noch ehe sie den Rand der Lichtung erreichten, und beugte sich zwischen Decanra und Sacipha würgend aus ihrem Sarg.
Sie hielten an und warteten.
»Fast wie im Märchen«, kommentierte Mef grinsend.
NARVILA
Sie liefern Catessju bei ihrem Vater ab, der sich nicht über den Knebel seiner Tochter zu wundern scheint, und streichen ihren Sold in Form von barer Münze sowie eines Beutels Salz ein. Nach einer wortkargen Verabschiedung bewegen sich Narvila und die anderen wachsam durch Kierganich. In der Stadt sind neben den üblichen Nachtschwärmern und Halunken zu dieser Zeit verdächtig viele Soldaten unterwegs, findet Narvila.
Ob die nach ihnen suchen?
Wegen des Vampirs und seiner Leute?
»Verdrücken wir uns?«, fragt Narvila.
Aiby hat die Wächter auch bemerkt. »Falls sie uns suchen, kriegen wir am Stadttor erst recht Ärger. Wir gehen zurück zum Drachen und halten erst mal die Köpfe unten.«
Im Brüllenden Drachen haben sie ein Zimmer gemietet, von dem aus man den höchsten Turm des königlichen Schlosses vor dem Vollmond aufragen sehen kann.
Ungehindert erreichen sie das Gasthaus.
Im Zimmer gibt es eine Katzenwäsche, unter Zuhilfenahme einer Schüssel voll Wasser, das sich schnell rot färbt.
Danach hat Narvila die erste Wache, während ihre Gefährtinnen sich hinlegen und so schnell einschlafen, wie geübte Kriegerinnen das nun mal tun.
Auch wenn Narvila bei Cinn immer das Gefühl beschleicht, dass die Nordländerin jederzeit die Augen aufschlagen könnte, nie so tief schläft.
Am nächsten Morgen sagt Aiby ihnen, wie es weitergeht.
»Wir halten uns erst mal bedeckt. Gehen höchstens zu zweit raus. Ohne unsere Harnische. Und du lass deine Schwertlanze hier, Narvila. Falls die Stadtwächter doch nach fünf Söldnerinnen in Rüstung und voller Bewaffnung Ausschau halten sollten.«
Narvila gähnt und überlegt, ob Aiby schon vor ihrem Abenteuer, vor ihrer Rückkehr ins Hochland, so herrisch gewesen ist.
Sie spricht ihre Gedanken nicht aus.
Aber sie wünschte, sie würden noch mal über die Vorfälle reden, damit Aiby alles richtig verarbeiten kann.
Mef zieht direkt los, um Chaggedi zu umgarnen, eine kleine Bäckerin mit brauner Haut und grünen Augen, die sie vor ein paar Tagen erstmals hier im Viertel gesehen hat.
Cinn unternimmt ihrerseits einen Spaziergang mit einer neuen Bekanntschaft: Sie hat schnell den riesigen Hund des Gasthauses als Freund gewonnen, der jeden Menschen anknurrt, sogar seinen Besitzer – nur bei Cinn benimmt er sich wie ein Schoßhündchen.
Aiby setzt sich nach dem Frühstück an einen Tisch in der Mitte des Schankraums, um mit sechs Kaufleuten aus der Lagunenstadt Kiavdaot zu trinken.
Noch etwas, das sie seit ihren gemeinsamen Erlebnissen im Hochland neulich ausschweifender tut denn je.
Wieder schweigt Narvila dazu.
Sie selbst bleibt mit Decanra im Anschluss an Brot, Räucherwurst und Käse ebenfalls unten sitzen.
Die beiden zocken an einem Tisch mit Blick auf die Eingangstür sowie ein Fenster zur Straße Zy-Fuw – sie haben es satt, im Spiel mit den Holzplättchen ständig gegen Cinn zu verlieren, und wollen besser werden.
Nach einer Vielzahl Partien sind Aiby und ihre Trinkkumpane noch immer gut dabei, am Tisch wird es lauter.
Mef ist nach wie vor anderswo mit ihrer Honigschnecke aus der Bäckerei beschäftigt.
Cinn kehrt zurück und schlägt Decanra und Narvila abwechselnd im Zy-Fuw, den großen Hund zu ihren Füßen.
»Hier gibt’s Tentakel-Kronen-Ficker«, sagt Cinn irgendwann ruhig, derweil sie Narvila zum dritten Mal in Folge plattmacht. »Hab ihr Zeichen an mehreren Häusern und Mauern gesehen.«
Decanra nickt missmutig. »Wir haben ihnen damals einen Schlag versetzt, aber der Kult breitet sich trotzdem weiter aus.«
»Weil die Leute so dringend ein neues Zeitalter der Magie wollen?«, fragt Narvila skeptisch. Sie erinnert sich noch gut daran, wie sie es während ihrer Probezeit, ihrer Feuertaufe als Prinzessin, mit diesen fanatischen Anhängern finsterer Gottheiten aus einer anderen Welt zu tun bekommen hat. »Eine neue Ordnung?«
»Neue Ordnung am Arsch«, sagt Cinn und legt mit einer ihrer letzten Holztafeln eine Kreuzung, die Narvilas Schicksal besiegelt.
Decanra zuckt mit den Schultern. »Manche Leute wollen einfach nur irgendwo dazugehören. Die Ziele sind da gar nicht so wichtig. Es reicht schon, einmal die Woche zusammenzukommen und über alles ablästern zu können, was einem am Leben stinkt. Oder über die, die man für die eigene Misere verantwortlich macht. Mit anderen, die genauso frustriert und wütend sind. Gemeinsam fühlen sie sich im Recht. Und stark. Das genügt vielen.«
»Ich bin nie frustriert«, sagt Mef, als sie neben Cinn auf die Sitzbank rutscht. »Und die Frauen, mit denen ich mich treffe, auch nicht.« Sie linst unter den Tisch. »Wenn das Vieh mich beißt, schneid ich ihm den Schwanz ab.«
»Er beißt nur, wenn man ihm blöd kommt«, meint Cinn.
Mef grinst. Ihre Narbe tanzt. »Wann bin ich jemals irgendwem blöd gekommen?«
Cinn grunzt vielsagend.
Narvila sieht Mef an.
Seit ihrem Abenteuer in der Unterwelt, mit dem legendären Helden Prytos und der Göttin Vejalcii, wirkt Mef noch lebenslustiger.
Narvila ist sich allerdings ziemlich sicher, dass ihre Freundin sich und allen anderen etwas vormacht, um zu überspielen, was für ein Sturm in ihr tobt.
Seit sie glaubt, in der Unterwelt einen Blick auf ihre tote Geliebte Sacipha erhascht zu haben.
»Was?«, fragt Mef fröhlich, der Narvilas Blick nicht entgeht. »Du verlierst übrigens. Mal wieder.«
»Nichts«, sagt Narvila, denn das ist weder der Ort noch die Zeit, um mit Mef über Sacipha zu reden. Oder über Narvilas Versprechen, Mef dabei zu helfen, sie aus der Unterwelt zu befreien – sollte es das sein, was Mef versuchen, woran sie glauben will. »Und ich weiß, danke.«
Nach dem unvermeidlichen Ausgang der Partie sammelt Cinn die Zy-Fuw-Steine ein und verstaut sie in dem kleinen Beutel zum Zuziehen. »Ihr seid noch immer keine Herausforderung.«
»Vermisst du Kaer nur deshalb?«, neckt Mef die Nordländerin und spielt auf den Geschichtenerzähler in Prytos’ Begleitung an, der Cinn im Zy-Fuw ebenbürtig gewesen ist – und ihr auch sonst ganz gut gefallen hat, soweit man das bei Cinn sagen kann.
Cinn dreht den Kopf und sieht Mef schneidend an.
»Hetz bloß nicht deinen Wolf auf mich«, sagt Mef.
»Habt ihr irgendwelche Steckbriefe gesehen?«, fragt Narvila, um die Spannung zu vertreiben. »Oder was gehört? Wegen letzter Nacht, mein ich.«
»Nur den üblichen Tratsch«, antwortet Mef. »Kein Wort über ein paar verfickt gut aussehende Söldnerinnen, die Kierganich von seiner Vampir-Plage befreit haben.« Sie besinnt sich kurz. »Vielleicht sind ein paar Soldaten mehr unterwegs als sonst. Wir könnten heute oder morgen Abend also eigentlich mal ein bisschen auf die Kacke hauen. Silgarnos Kohle ausgeben.«
»Unser Blutgeld«, murmelt Narvila.
Nun starrt Cinn sie an. »Alles Geld, das wir verdienen, ist blutig.«
»Die Anhänger eines Vampirs sind nicht besser als irgendwelche Räuber oder Entführer«, sagt auch Decanra. »Oder weniger gefährlich. Sie haben sich gegen ihre Menschlichkeit entschieden. Und verdient, was sie bekommen haben.«
»Schon klar.« Narvila, noch immer nicht überzeugt, fährt mit dem Zeigefinger einen von vielen Krügen hinterlassenen, wie eingebrannten Abdruck auf dem Tisch nach. »Es ist nur …«
»Es gibt Ärger«, unterbricht Cinn sie und schiebt Mef mit sich von der Bank.
Narvila und Decanra folgen ihrem Beispiel, ohne zu zögern.
Zielstrebig gehen sie zu dem Tisch, an dem Aiby den ganzen Vormittag mit den Kaufleuten gebechert, gequatscht, gejohlt und gelacht hat.
Jetzt ist die Stimmung gekippt.
Narvilas Freundin und die Männer stehen sich auf zwei Seiten des Tisches gegenüber – Aiby und einer der Kerle in einem weiten Gewand schnauzen einander an, gestikulieren ungehalten.
Narvila, Cinn, Decanra und Mef beziehen neben Aiby Stellung.
Und auch wenn sie ihre großen Waffen und die meisten Rüstungsteile oben im Zimmer gelassen haben, verschiebt sich allein durch ihre Ausstrahlung das Ungleichgewicht.
Zumal der große Hund an Cinns Seite steht und die anderen Gäste anknurrt.
Darüber scheint sich der Wirt hinter dem Tresen seinem Gesichtsausdruck nach zu urteilen mehr aufzuregen als über den Streit in seinem Laden.
Narvila versucht unterdessen herauszufinden, worum es zwischen Aiby und ihren Trinkkumpanen plötzlich geht.
»Wiederhol ruhig noch mal, was du gesagt hast«, fordert Aiby den schmalgesichtigen, hellhäutigen Mann mit Bart auf, der sie wütend anfunkelt. »Oder traust du’s dich nur in Überzahl?«
»Ich hab keine Angst vor dir und deinen Freundinnen!«, speit der Mann nicht nur Aiby entgegen.
»Solltest du aber«, sagt Mef gut gelaunt.
»Toll, noch eine vorlaute Schlampe«, ätzt einer der anderen Kerle, der eher teigig als tatkräftig wirkt.
Mefs auf einmal sehr gemeines Grinsen lässt ihn verstummen.
»Also?«, schnappt Aiby, und wieder einmal bemerkt Narvila bei ihrer Freundin mehr Aggression als früher, als vor dem Hochland. »Wiederholst du Riesenficker jetzt, was du gerade gesagt hast?«
»Gern.« Auch der Bärtige lächelt gemein. »Ich sagte, dass Weiber von Pferden keine Ahnung haben und du am besten meinen Pferdeschwanz lutschst, statt hier so dein Maul zu wetzen.« Er sieht Narvila, Decanra, Cinn und Mef reihum an. »Das gilt für euch alle.«
»Nicht mal in meinen schlimmsten Albträumen«, sagt Mef sofort. »Selbst wenn du ihn mit einem kleinen Gnomen-Messer abschneidest und ein Jahr lang in ein Fass Wein legst. Würg.«
»Aye.« Aiby legt die rechte Faust in die linke Hand und lässt die tätowierten Fingerknöchel knacken. »Ich denk, wir haben genug gehört.«
Zur Antwort zieht die Hälfte der Männer ihre Dolche.
Cinn, Decanra und Narvila tun es ihnen gleich.
Mef schnappt sich einen Stuhl und prüft sein Gewicht in ihren Händen.
Aiby sieht aus, als wolle sie jeden Augenblick den Tisch zur Seite schleudern.
Der Hund neben Cinn knurrt.
Narvila weiß, dass sie gleich zwei Aufgaben hat:
Den Kerlen in den Arsch treten, klar.
Aber auch darauf achtgeben, dass Aiby niemanden umbringt.
Das sind die Pisser nicht wert.
»Sofort die Waffen weg!«, donnert da eine Männerstimme aus der geöffneten Tür zum Wirtshaus.
Ein halbes Dutzend Wachsoldaten kommt in den Drachen.
Grün-blaue Wappenröcke, Helme mit Nasenschutz und den herabstürzenden blutroten Falken von König Emlogiel auf der Brust.
»Hier in Kierganich sind die echt fix«, meint Mef. »Die tanzen ja schon an, bevor die Tavernenschlägerei richtig angefangen hat. Letzte Nacht sind sie später aufgekreuzt …«
»Mef«, mahnt Decanra.
Cinn wirft indes dem Wirt einen vernichtenden Blick zu.
Der hebt die Hände, wäscht sie in Unschuld. »Ich hab die nicht gerufen. Schaut mich also nicht so an. Und du«, wendet er sich an seinen untreuen Hund. »Komm gefälligst her. Hierher.«
Der Hund ignoriert demonstrativ den Befehl seines Herrn.
»Ich glaub nicht, dass die deswegen hier sind«, sagt Narvila.
Sie muss daran denken, was das letzte Mal passiert ist, als sie in einem Gasthaus von Soldaten einkassiert worden sind.
An den Kerker in Dretvik, der Hauptstadt Lirgodens.
Der von seinen bewaffneten Männern flankierte Hauptmann mustert die Söldnerinnen und die Kaufleute kritisch.
»Ihr da, verpisst Euch, sonst werdet Ihr festgenommen«, sagt er schließlich zu Aibys unfreundlich gewordenen Trinkgesellen. Er wartet, bis die Kerle grummelnd abgezogen und zur Tür raus sind – der Bärtige, der auf der Schwelle innehält und böse zurückblickt, wird von einem Soldaten rüde nach draußen geschubst. »Und Ihr«, richtet sich der Hauptmann mit der braunen Haut und den buschigen Augenbrauen daraufhin an Narvila und ihre Gefährtinnen. »Ihr kommt mit uns. Der König will Euch sehen.«
»Der König?«, wundert sich Aiby. »Wegen einem Vampir und ein paar reichen Arschlöchern mit zu viel Zeit und zu wenig Hirn?«
»Macht schon«, sagt der Hauptmann. »Seine Majestät wartet nicht gern. Aber holt vorher Eure Waffen. Ihr werdet sie wahrscheinlich brauchen.«
Für die Dauer mehrerer nicht vampirischer Herzschläge bewegt sich keine von ihnen.
»Aye«, sagt Aiby dann nur gedehnt und stapft als Erste auf die Treppe zu.
»Das wird bestimmt interessant«, sagt Mef oben.
Sowie Narvila ihre Schwertlanze hält, fühlt sie sich wohler. »Wenn wir unsere Waffen mitnehmen sollen, kann’s nicht darum gehen, uns einzusperren und zu bestrafen. Oder?«
»Gibt nur einen Weg, das rauszufinden«, sagt Aiby mit hörbarem Zungenschlag und wiegt ihre Axt in den Händen.
Wenig später eskortieren die berittenen Soldaten sie zum Schloss. Mef reitet einen gutmütigen Falben, Aiby einen großen, kräftigen Braunen, Cinn einen temperamentvollen Rappen, Decanra einen gelassenen Grauen und Narvila den Schimmel ihrer Mutter, den sie am Tag ihrer Flucht aus ihrem alten Leben mitgenommen hat.
Die Dimensionen des hübschen kleinen Schlösschens mit den runden Türmen, dem sie sich nähern, passen zum Königreich.
Narvila ist schon aufgefallen, dass sie seit zwei Wochen durch eine unübersichtliche Ansammlung winziger Königreiche reiten, viele davon noch kleiner als ihre Heimat Besgios, das sogenannte Waldkönigreich des Holzkönigs.
»Willkommen auf dem Flickenteppich«, hat Decanra ihr erklärt und den inoffiziellen Namen dieser Gegend genannt.
Hier in Kierganich, Hauptstadt des Flickenteppich-Königreichs Tulephwin, reiten die Prinzessinnen nun über die heruntergelassene Zugbrücke des Schlosses. Im Innenhof steigen sie ab und werden nach drinnen geführt. Dort erwarten sie Mauerwerk, Treppen, Wandbehänge, Teppiche, Kronleuchter, Wächter, Flügeltüren.
Das Übliche.
Ehe sie den Thronsaal betreten, müssen sie ihre Waffen abgeben.
»Wieso sollten wir sie dann überhaupt mitbringen?«, fragt Narvila.
»Das werdet Ihr gleich erfahren«, erwidert der Hauptmann.
Er sieht nicht so aus, als würde er eine jeden Moment zuschnappende Falle vorbereiten.
Vielleicht ist er aber auch bloß ein guter Schauspieler.
König Emlogiel von Tulephwin erweist sich als großer Mann mit schütterem schwarzen Haar unter der Krone und einem kunstvoll frisierten Backen- und Schnurrbart. Emlogiel sitzt auf einem hölzernen Thron, neben dem ein verwaister, etwas kleinerer Hochsitz steht. Der König, den roten Falken seiner Sippe auf der Brust, hält sich nicht mit Floskeln auf.
»Erhebt euch, erhebt euch, dafür haben wir keine Zeit«, sagt er mit einer recht angenehmen Stimme zu den aufs Knie gegangenen Söldnerinnen um Narvila. »Meiner Tochter Prinzessin Sveallic ist letzte Nacht etwas Schreckliches zugestoßen.«
Für einen Moment fürchtet Narvila, dass sie doch in eine Falle getappt sind, in Sicherheit gewiegt von Waffen, die sie letzten Endes haben abgeben müssen.
Dass Prinzessin Sveallic im Haus des Vampirs gewesen ist, womöglich unter falschem Namen und einer Perücke, und sie, ohne es zu ahnen, König Emlogiels Tochter getötet haben.
»Sie wurde verschleppt«, fügt Tulephwins Regent da jedoch an, und Narvila atmet tief durch. »Höchstwahrscheinlich entführt. Meine Männer können sie nicht finden.« Der König streicht sich über seinen Bart. »Aber um der Wahrheit die Ehre zu geben: Mein Hofzauberer ist nicht gerade ein Erzmagier, und meine Soldaten sind besser darin, Räuber- oder Kobold-Banden aufzuspüren. Und ich bin es meiner toten Frau schuldig, aus falschem Stolz nicht damit zu warten, fachkundige Unterstützung für die Suche nach meiner Tochter hinzuzuziehen.« Er sieht Narvila in die Augen. »Als ich heute Morgen von eurer nächtlichen Unternehmung hörte, erinnerte ich mich an euch. Fünf Söldnerinnen. Fünf Prinzessinnen. Die selbst alle einmal Thronerbinnen waren. Und nun Prinzessinnen retten.«
»Das ist unser Ding«, sagt Aiby unbesonnener, als sie es ohne die alkoholschwangeren Stunden im Gasthof tun würde.
Der König hebt eine üppig beringte Hand. »Vor ein paar Jahren habt ihr Prinzessin Mulfrenda gerettet, die Tochter meines nördlichen Nachbarn, König Zadkernius.«
»Der Glassarg«, sagt Decanra nach kurzem Überlegen.
»Der Glassarg«, bestätigt Emlogiel. »Ganz genau.«
Mefs verhärtete Miene bringt Narvila flugs darauf, dass es ein Abenteuer mit Sacipha gewesen sein dürfte.
Vor Saciphas Tod in der Verwüstung, dieser Einöde der Mutanten und Schimären oberhalb von Lirgoden und Valahmes, wegen deren Entstehung weiter nördlich Magie oftmals verboten ist.
Narvila kennt eine Menge Geschichten über die Jahre, da sie selbst noch nicht zu den Prinzessinnen gehört hat.
Von einem Glassarg weiß sie allerdings nichts.
Später wird sie Decanra oder Aiby danach fragen müssen.
Trotz der festen Bande zwischen ihnen kommt Narvila sich in so einem Moment unerfahren vor.
Sie weiß, dass diese Zweifel ihr Problem sind, und kein Versäumnis der anderen.
»Ihr wisst also sicher, wie man eine Prinzessin aus einer misslichen Lage rettet«, sagt König Emlogiel in der Zwischenzeit. »Es wird sich für euch lohnen, uns zu helfen. Bei meinen Ahnen. Beim Andenken an meine Frau. Beim Leben meiner Tochter. Sofern sie noch am Leben ist.«
»Wir werden tun, was wir können«, sagt Aiby mit kaum hörbarem Lallen.
Emlogiel nickt zufrieden. »Hauptmann Werzenim wird euch zeigen, was ihr sehen müsst. Findet meine Tochter!«, beschwört er sie zum Abschluss der Audienz noch einmal.
Damit winkt er sie fort und starrt etwas an, das allein er auf den Steinplatten vor seinem Thron sehen kann.
Womöglich den Geist seiner toten Frau, mutmaßt Narvila.
Sie verlassen den Thronsaal, erhalten ihre Waffen zurück und werden vom Hauptmann und ein paar seiner Untergebenen durch die Gänge des Schlosses geführt.
Bis hoch in die Gemächer der Prinzessin.
»Stört es Euch, dass wir Eure Arbeit machen sollen?«, fragt Mef die Männer des Königs auf einer steinernen Wendeltreppe.
Eisiges Schweigen antwortet ihr.
Ausgerechnet Cinn lacht, obwohl es wie ein Knurren klingt.
Sie folgen einem breiten Korridor, der auf eine mit Tierschnitzereien verzierte Tür zu führt. Hauptmann Werzenim gibt den zwei Wachen mit Hellebarden davor einen Wink, und sie machen ihnen auf, sodass der Offizier und die Prinzessinnen Sveallics Räumlichkeiten betreten können.
Auf den ersten Blick sieht alles ganz harmlos aus.
Die Landschaftsgemälde an den Wänden, der Spiegel über der hübschen Kommode, das große Himmelbett, die flauschigen Teppichläufer.
Dann bemerkt Narvila den abgetrennten Finger.
Er liegt in einer getrockneten Blutlache auf der weißen Bettdecke.
Blutstropfen am Boden führen außerdem bis zu einer offen stehenden Balkontür am anderen Ende des Zimmers.
Werzenim hüstelt. »Es ist der Finger der Prinzessin. Unser Hofzauberer – zumindest dafür sollten seine Fähigkeiten genügen – hat es bestätigt. Und so war es auch bei den anderen.«
»Welche anderen?«, fragt Narvila stirnrunzelnd.
»Den anderen Prinzessinnen, die entführt und ermordet wurden. Den anderen Königstöchtern. Um Missverständnisse zu vermeiden.«
Daraufhin erzählt Hauptmann Werzenim ihnen von dem Monster, das seit ein paar Wochen die Königreiche des Flickenteppichs unsicher macht.
EINST
Es war schon länger her, dass man sie als Aibhilyn gekannt hatte, Tochter von Ebalarg, Häuptling aller Häuptlinge des grünen Hochlands. Eine tödliche Rangelei unter jugendlichen Häuptlingskindern hatte zu Aibys Verbannung aus den Hügeln ihrer geliebten Heimat geführt. Seitdem hatte Aiby sich vielen bewaffneten Truppen und sogar Armeen angeschlossen, viele geschlagene Schlachten sowie erschlagene Monster mit einer weiteren Tätowierung auf ihrem Körper verewigt.
Nur ihre Schultern blieben, wie sie waren.
Gezeichnet von den schändlichen Hochland-Runen der ins Exil geschickten Verbannten.
Der Heimatlosen.
Nachdem sie sich mit dem Anführer ihrer letzten Truppe überworfen hatte, einem großen Helden und noch größeren Scheißkerl, war Aiby Leibwächterin der lieblichen Prinzessin Himalgen von Uressting geworden.
Es war reiner Zufall gewesen, dass Aiby die Schreie im Wald hörte, wo Himalgen und die Eskorte ihrer Kutsche von Ogern angegriffen wurden. Aiby stürzte sich brüllend auf die großen grauen Kreaturen mit den Hauern und Keulen. Ihre Axt erkaufte den letzten lebenden Rittern und Soldaten Zeit, sich neu zu formieren und mit Aibys Hilfe die Bestien zu vertreiben.
Bei ihrer Rückkehr ins Schloss bestand Himalgen darauf, dass Aiby ihre neue Leibwächterin wurde, und da König Difinekdur seiner Tochter keinen Wunsch abschlagen konnte, kam Aiby ziemlich unverhofft zu ihrem neuen Posten in Uressting.
Den Mitgliedern der Garde gefiel das nicht – Aiby musste ja nicht mal die vorgeschriebene Rüstung oder den hellblauen Umhang tragen, der sofort dreckig wurde, weshalb man ständig Ärger mit dem Hauptmann bekam.
Ein metallener Brustharnisch, den ein Schmied eigens an Aibys Maße anpasste, war ihr einziges Zugeständnis an die Rüstungsetikette im Schloss.
Aiby begleitete Himalgen, eine lebensfrohe junge Frau mit glänzender tiefbrauner Haut, schwarzen Locken und einem entzückenden Lächeln, den ganzen Tag.
Nachts schlief Aiby in einer Kammer zwischen Vorraum und Schlafzimmer der Prinzessin von Uressting.
Himalgen vertraute Aiby seit dem Ereignis im Wald bedingungslos, teilte auch viele ihrer Gedanken, Gefühle und Geheimnisse mit ihr.
Irgendwann verriet sie Aiby sogar, dass sie sich unsterblich in den gut aussehenden Dichter Lepgarian verliebt hatte, der die königliche Familie samt höfischer Gesellschaft im Schloss regelmäßig mit seinen Versen erfreute.
»Bitte, Aiby«, flehte Himalgen, als sie eines Frühlingstags gemeinsam durch den Schlossgarten flanierten, die Prinzessin mit geschultertem Sonnenschirm, ihre Leibwächterin mit geschulterter Axt. »Du musst mir bei Lepgarian helfen!«
»Ich versteh nichts von Gedichten, Hoheit«, sagte Aiby abwehrend, da sie zu ahnen glaubte, worauf das hinauslief. Sie vergnügte sich seit ein paar Wochen mit dem königlichen Falkner Ghoffrai und wusste, dass auch junge Prinzessinnen irgendwann Bedürfnisse verspürten, Triebe entwickelten. Dafür sorgten die Märchen, Geschichten, Lieder und Gedichte schon. »Ihr müsst ihm allein einen Brief schreiben, fürchte ich.«
»Das haben wir doch alles schon hinter uns!« Himalgen stöhnte vor Ungeduld. »Jetzt brauchen wir Zeit.«
»Zeit?«, machte Aiby betont begriffsstutzig.
»Zeit für uns. Für Zweisamkeit. Um uns noch besser kennenzulernen. Ach, Aiby! Ich habe das Gefühl, als würde Lepgarian die verborgensten Winkel meiner Träume und meines Herzens kennen! Aber bisher haben wir uns noch nie länger, als schicklich wäre, in die Augen gesehen. Oder uns gar berührt. Noch nie Händchen gehalten. Uns noch nie geküsst. Er hat mir noch nie eine Haarsträhne hinters Ohr gestrichen.«
»Eurem Vater würde das auch nicht gefallen«, wandte Aiby ein, obwohl sie es nicht gern sagte – aber am Ende bezahlte König Difinekdur sie, und nicht die verknallte Prinzessin.
»Ich weiß. Und doch muss ich mich endlich mit meinem Liebsten treffen! Er und ich. Nur wir zwei. Damit unsere Seelen ganz miteinander verschmelzen können.«
Aiby glaubte nicht, dass es am Ende so sehr um Seelen ging, behielt ihre Gedanken jedoch für sich.
»Hilfst du mir, meine teure Aiby?«, fragte die Prinzessin. »Bitte. Ich vertraue niemandem mehr als dir. Sei die Freundin, die ich in dir sehe.«
Aiby seufzte und sah zwei gelben Schmetterlingen zu, die sich in irgendeinem Liebestanz durch den sonnigen, duftenden Garten jagten. Sie schnaubte, fuhr sich über ihre Zöpfe, seufzte noch lauter, noch tiefer. »Aye. Ich helfe Euch, Hoheit.«
»Oh, Aiby!« Himalgen quietschte und klatschte in die zarten Hände. »Du bist die Beste!«
»Nicht so laut«, mahnte Aiby mit einem Lächeln – die nächsten Wächter waren nie weit, und ein Schloss hatte noch weit mehr Ohren, die man oft nicht lauschen sah.
Und so half Aiby der Prinzessin und ihrem Dichter in den kommenden Wochen immer öfter dabei, einander zu sehen.
Hierzu führte Aiby den anfangs arg nervösen Lepgarian und die nicht minder angespannte Himalgen durch selten benutzte Dienstbotengänge in einen verlassenen Flügel des Schlosses, wo sie den beiden heimlich ein Zimmer mit einem Tisch, zwei Sesseln und ja, bei den Hügeln, einem Bett hergerichtet hatte.
Wenn Himalgen und Lepgarian in diesem Gemach Zeit miteinander verbrachten, stand Aiby vor der Tür und wartete, ihrerseits nervös und angespannt, wobei sie mehr auf den Rest des Schlosses horchte denn auf das Geschehen hinter sich.
Das sollte ihnen allen zum Verhängnis werden.
Zunächst war Himalgen glücklich, blühte immer mehr auf, schien von innen heraus zu strahlen.
Aiby verschwieg ihre Zweifel und Sorgen daher selbst dann, als die Prinzessin sie nachts wispernd nach bestimmten Teilen des weiblichen und des männlichen Körpers fragte.
Daraufhin musste sich Aiby bei den von ihr ermöglichten heimlichen Treffen mehr anstrengen, nicht auf das Treiben hinter der Tür zu achten, das Kichern, Stöhnen, Klatschen und unterdrückte Schreien zu ignorieren. Hin und wieder trat sie mit dem Stiefelabsatz gegen die Tür, wenn es zu laut wurde.
»Können sich Menschen ändern?«, fragte Himalgen Aiby eines Morgens, auf ihrem Spaziergang im Schlossgarten.
Sie wirkte bedrückt, besorgt.
»Manche«, antwortete Aiby. »Die meisten allerdings nicht, oder nicht genug. Geht es um Euren Dichter?«
»Es ist nichts«, wiegelte Himalgen ab.
Die Wolke aus Besorgnis über ihrem Kopf blieb.
Aiby sah über sie hinweg, wollte der Prinzessin nicht zu nahe treten.
Vielleicht nahm sich Himalgen, das junge, unerfahrene Ding, alles etwas zu sehr zu Herzen.
Sie sprachen nicht mehr darüber.
Als Himalgen und Lepgarian das nächste Mal hinter verschlossener Tür zusammen waren, überhörte Aiby auch das ungestüme Poltern und die unterdrückten Schreie.
Bis sie verstummten.
Und jemand bitterlich schluchzte.
Aiby riss die Tür auf, und da saß Lepgarian auf dem Boden und benetzte das Gesicht der toten Himalgen mit seinen Tränen.
Aibys Stiefel traf ihm voll im Gesicht, und er ging rücklings zu Boden, blieb benommen liegen.
»Was hast du getan?«, fragte Aiby und tastete hektisch nach dem Puls der Prinzessin.
Aber da war kein Leben mehr.
»Nichts«, wimmerte Lepgarian, Rotz und Wasser heulend.
»Sag es mir«, verlangte Aiby und schloss die Finger so fest um den Griff ihrer Axt, dass sie schmerzten. »Sofort.«
Der Dichter blickte sie an, und Aiby sah seine Dämme brechen. »Ich habe Spielschulden«, sprudelte es aus Lepgarian heraus, als würde ihm die Beichte Erleichterung verschaffen. »Himalgen hat mir damit geholfen. Aber ich habe mich wieder reingeritten. Übler als je zuvor. Und diesmal wollte sie mir nichts mehr geben. Sonst würde ich es nie lernen, sagte sie. Doch diese Kerle werden mich umbringen! Aber das wollte Himalgen nicht einsehen. Ich war so wütend. Ihre Familie hat so viel Geld! Und da habe ich sie gewürgt. Ich weiß nicht, ob es Wut war, ob ich ihr Angst machen wollte oder ob ich selbst vor Furcht für einen Augenblick den Verstand verloren habe …«
»Deine schönen Worte werden dir jetzt nicht helfen«, knurrte Aiby – am liebsten hätte sie dem Versschmied den Kopf abgeschlagen. Doch sie brauchte seine Aussage noch, um diesen Schlamassel irgendwie zu erklären. »Und mir auch nicht.«
Sie starrte Himalgen an.
Vor Kurzem noch so lebensfroh.
Nun leblos und tot.
Auf einmal schallte ein schreckliches Heulen durchs Zimmer.
Wahrscheinlich das ganze Schloss.
Es war Lepgarian, der sein Leid in die Welt schrie.
»Halt die Fresse!«, zischte Aiby, woraufhin der Dichter bloß noch lauter wehklagte.
Er rezitierte sogar ein paar Zeilen über Liebe und Trauer.
Aiby trat erneut zu.
Lepgarian fiel mit dem Kopf auf ein Tischbein.
Es knackste, und er blieb mit unnatürlich abgeknicktem Nacken liegen.
Seine geröteten, feuchten Augen starrten ins Leere.
Nun lagen zwei reglose Körper zu Aibys Füßen.
Und draußen kündigten aufgebrachte Stimmen und stapfende Schritte ungebetene Zeugen, schwierige Fragen an.
Aiby strich sich mit der Hand über Zöpfe und Gesicht. »Riesenscheiße«, sagte sie, leise und müde, und an die Leiche der Prinzessin gewandt: »Es tut mir leid, Himalgen.«
Als sie das Liebesnest verließ, eilten drei Gardisten in voller Montur heran.
»Halt!«, rief einer von ihnen. Sein Name war Neotwung, und er hasste Aiby für all die Privilegien, die man ihr gewährte. »Was ist hier los? Wo ist die Prinzessin?«
»Dadrinnen«, erwiderte Aiby ruhig. Es brauchte all ihre Selbstbeherrschung, nicht kampfbereit die Axt zu heben. »Sie traf sich hier heimlich mit ihrem Geliebten. Er hat sie aus Gier umgebracht. Ich bin zu spät gekommen.«