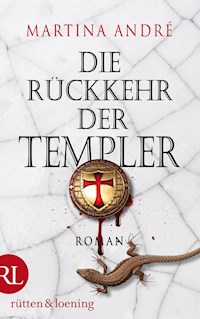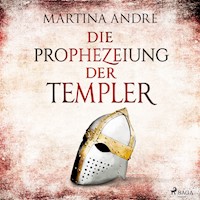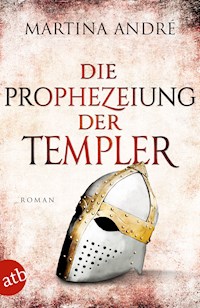
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Gero von Breydenbach
- Sprache: Deutsch
Die Jagd nach dem größten Geheimnis des Mittelalters.
Festung Waldenstein, 1316: Gero von Breydenbach richtet ein Turnier aus, um seine Ernennung zum Grafen zu feiern. Er und seine Frau Hannah erwarten ranghohe Gäste, ein bunter Jahrmarkt soll außerhalb der Burg stattfinden. Endlich könnte alles friedlich sein, doch Hannah quält die Angst davor, dass Gero seinen Templern bald schon wieder in einen Krieg folgen muss. Während die Feierlichkeiten in vollem Gang sind, sinnen die Erzfeinde der Templer in Franzien auf Rache – und sie haben eine rätselhafte Waffe, mit der Gero und seine Templer nie gerechnet hätten ...
Ein rasanter historischer Roman, der tief in die uralten Legenden der Templer eintaucht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1702
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über das Buch
Als Gero zum Grafen von Lichtenberg zu Waldenstein ernannt wird, will er zur Feier ein glanzvolles Turnier mit zahlreichen Gästen ausrichten. Auch seine Frau Hannah ist glücklich über die jüngsten Entwicklungen, und ihre gemeinsame Tochter Sophia kann behütet aufwachsen. Wäre da nicht die ständige Sorge, dass Gero und seinen Templern erneut ein Krieg bevorsteht. Als während des Turniers eine rätselhafte Frau auf der Burg eintrifft und sich als Händlerin ausgibt, ahnt niemand, dass es sich um eine Falle handelt – und dass Gero und seine Familie in Lebensgefahr sind.
Über Martina André
Martina André wurde 1961 in Bonn geboren. Der französisch klingende Nachname ist ein Pseudonym und stammt von ihrer Urgroßmutter, die hugenottische Wurzeln in die Familiengeschichte miteinbrachte. Martina André lebt heute mit ihrer Familie in der Nähe von Koblenz sowie in Edinburgh/Schottland, das ihr zur zweiten Heimat geworden ist.
Im Aufbau Taschenbuch sind die Romane um Gero von Breydenbach „Das Rätsel der Templer“, „Die Rückkehr der Templer“, „Das Geheimnis des Templers“, „Das Schicksal der Templer“ und „Das Erbe der Templer“ lieferbar.
Außerdem sind lieferbar „Die Gegenpäpstin“, „Schamanenfeuer. Das Geheimnis von Tunguska“, „Die Teufelshure“ und „Totentanz“.
Mehr Informationen zur Autorin unter www.martinaandre.com und https://www.facebook.com/Autorin.Martina.Andre/
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Martina André
Die Prophezeiung der Templer
Roman
Übersicht
Cover
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Widmung
Motto
PROLOG — Oktober 1156 Vizegrafschaft Razès / Templerburg Campagne-sur-Aude / Pech de Bugarach
KAPITEL 1: Januar 1316 Paris / Festung Bois de Vincennes — Im Auftrag des Königs
KAPITEL 2: April 1316 – drei Monate später – Herzogtum Lothringen / Burg Waldenstein — Schuldgefühle
KAPITEL 3: April 1316 Paris / Festung Bois de Vincennes — Die Rache des Inquisitors
KAPITEL 4: April 1316 Herzogtum Lothringen / Burg Waldenstein — Familienpflichten
KAPITEL 5: April 1316 Königreich Franzien / Paris / Festung Bois de Vincennes — Dämonentanz
KAPITEL 6: April 1316 Herzogtum Lothringen / Burg Waldenstein — Minnesang
KAPITEL 7: April 1316 Grafschaft Champagne / Bar-sur-Aube — Verlorener Vater
KAPITEL 8: April 1316 Herzogtum Lothringen / Burg Waldenstein — Blutsverwandte
KAPITEL 9: April 1316 Champagne / ehemalige Templerburg von Troyes — Jean de Paris
KAPITEL 10: April 1316 Herzogtum Lothringen / Burg Waldenstein — Treueschwur
KAPITEL 11: April 1316 Herzogtum Lothringen / Burg Waldenstein — Fragwürdige Liebschaften
KAPITEL 12: April 1316 Herzogtum Lothringen / Burg Waldenstein — Einsame Helden
KAPITEL 13: April 1316 Herzogtum Lothringen / Burg Waldenstein — Teufelsbrut
KAPITEL 14: April 1316 Herzogtum Lothringen / Burg Waldenstein — Tjost
KAPITEL 15: April 1316 Herzogtum Lothringen / Burg Waldenstein — Verhängnisvolle Freundschaften
KAPITEL 16: April 1316 Herzogtum Lothringen / Burg Waldenstein — Falsches Spiel
KAPITEL 17: April 1316 Herzogtum Lothringen / Burg Waldenstein — Unselige Bündnisse
KAPITEL 18: April 1316 Herzogtum Lothringen / Burg Waldenstein — Tod und Teufel
KAPITEL 19: April 1316 Herzogtum Lothringen / Burg Waldenstein — Eisenhut
KAPITEL 20: April 1316 Herzogtum Lothringen — Gens du Roi
KAPITEL 21: April 1316 Herzogtum Lothringen / Burg Waldenstein — Zwei Fronten
KAPITEL 22: April 1316 Bistum Metz / Grafschaft Bar — Blutende Herzen
KAPITEL 23: April 1316 Herzogtum Lothringen — Wahre Freunde
KAPITEL 24: April 1316 Grafschaft Bar / Saint-Mihiel — Pakt mit dem Teufel
KAPITEL 25: April 1316 Bistum Metz — Mehr Glück als Verstand
KAPITEL 26: April 1316 Grafschaft Bar / Saint-Mihiel — Liebe und Lügen
KAPITEL 27: April 1316 Grafschaft Bar — Die Rache der Templer
KAPITEL 28: April 1316 Carcassonne / Domaine Royal / Königreich Franzien — Maulwürfe
KAPITEL 29: April 1316 Grafschaft Champagne / Saint-Dizier — Vertrauter Feind
KAPITEL 30: April 1316 Grafschaft Auxerre / Zisterzienserabtei Pontigny — Alte Seilschaften
KAPITEL 31: April 1316 Herzogtum Lothringen / Burg Waldenstein — Blut und Wasser
KAPITEL 32: April 1316 Grafschaft Nevers / Donzy — Einer für alle
KAPITEL 33: April 1316 Herzogtum Lothringen / Burg Waldenstein — Familienbande
KAPITEL 34: April 1316 Grafschaft Nevers / Nevers — Bruderkuss
KAPITEL 35: April 1316 Grafschaft Nevers / Nevers — Fleury
KAPITEL 36: April 1316 Herzogtum Lothringen / Château de Carmac — Findelkind
KAPITEL 37: April 1316 Domain Royal / Zisterzienserabtei Noirlac — ›Tischlein deck dich‹
KAPITEL 38: April 1316 Herzogtum Lothringen / Bistum Metz — Geheime Allianzen
KAPITEL 39: April 1316 Grafschaft Bourbonnais / Vichy — Der verlorene Sohn
KAPITEL 40: April 1316 Herzogtum Lothringen / Bistum Metz — Bluthunde
KAPITEL 41: April 1316 Bistum Metz — Gute Beziehungen
KAPITEL 42: April 1316 Königreich Franzien / Domaine Royal / Carcassonne — Blonder Engel
KAPITEL 43: April 1316 Königreich Franzien / Domaine Royal / Toulouse — Verlorener Sohn
KAPITEL 44: Mai 1316 Herzogtum Lothringen / Reichsstadt Metz — La Familia
KAPITEL 45: Mai 1316 Königreich Franzien / Domaine Royal / Carcassonne — Irrlehren
KAPITEL 46: Mai 1316 Herzogtum Lothringen / Reichsstadt Metz — Krumme Geschäfte
KAPITEL 47: Mai 1316 Königreich Franzien / Domaine Royal / Carcassonne — Veteranen
KAPITEL 48: Mai 1316 Herzogtum Lothringen / Reichsstadt Metz — Feinde fürs Leben
KAPITEL 49: Mai 1316 Königreich Franzien / Domaine Royal / Carcassonne — Finstere Seelen
KAPITEL 50: Mai 1316 Herzogtum Lothringen / Burg Lichtenberg — Mit dem Herzen einer Löwin
KAPITEL 51: Mai 1316 Königreich Franzien / Domaine Royal / Carcassonne — Alte Rechnungen
KAPITEL 52: Mai 1316 Herzogtum Lothringen / Burg Lichtenberg — Kriegserklärung
KAPITEL 53: Mai 1316 Königreich Franzien / Domaine Royal / Carcassonne — »Die Prophezeiung der Templer«
EPILOG
Juni 1316 Herzogtum Lothringen / Burg Waldenstein »Tue jetzt, was du wünschen wirst, getan zu haben …«
NAMENSLISTE
NACHWORT UND DANKSAGUNG
RECHERCHEHINWEISE
Impressum
Wer von diesem Roman begeistert ist, liest auch ...
Für meinen Mann, er war und ist mir eine unentbehrliche Inspirationsquelle für meine Templer-Romane.
»Tue jetzt, was du wünschen wirst, getan zu haben, wenn du stirbst.«
Gérard de Sède: »Die Templer sind unter uns – oder ›Das Rätsel von Gisors‹«
PROLOG
Oktober 1156 Vizegrafschaft Razès / Templerburg Campagne-sur-Aude / Pech de Bugarach
Deutsche Bergleute
Eben hatte die tief stehende Nachmittagssonne das beschauliche Templerkastell von Campagne-sur-Aude in ein goldenes Licht getaucht, als unvermittelt ein Sturm aufkam, der Berge von schwarzen Wolken über den Himmel jagte. Im Nu braute sich ein Unwetter zusammen, das biblische Ausmaße befürchten ließ.
Davon unbeirrt kniete Bertrand de Blanchefort vor dem Altar der Ordenskapelle von Saint Marie und faltete die Hände.
Im sanften Kerzenschein schaute er zu einer lebensgroßen, bunt bemalten Statue der Muttergottes auf, die – an Seilen befestigt und ohne den kleinen Jesus in ihren Armen – hoch über ihm auf einer Mondsichel schwebte.
Ihr huldvolles Lächeln berührte seine Seele wie eine mildtätige Gabe und erfüllte ihn mit einer tiefen Liebe, die er nicht erst seit seiner Aufnahme in den Templerorden für die reinste aller Frauen empfand.
»Heilige Maria«, flehte er inbrünstig, »bitte für mich beim Vater im Himmel. Falls die deutschen Bergleute am Pech de Bugarach auf ein göttliches Geheimnis stoßen, das nicht für die Augen der Menschheit bestimmt ist, möge der Allmächtige uns und nicht diese Männer für die Kühnheit unseres Vorgehens bestrafen. Dafür verspreche ich, sechster Großmeister der Templer, alles in meiner Macht Stehende zu tun, um eine solche Entdeckung vor dem Zugriff unserer Feinde zu bewahren.«
Kaum hatte er den Satz beendet, zuckte ein Blitz, dessen greller Schein durch das achteckige Fenster direkt auf die Heilige Jungfrau fiel und ihr feines Gesicht taghell erleuchtete. Nur einen Augenblick später folgte ein Donnerschlag, der das gesamte Gebäude erzittern ließ.
Was Bertrand nicht nur daran erinnerte, welche Macht sich hinter einem solch lieblichen Antlitz verbergen konnte, sondern auch, dass das Haupt einer Frau der Grund dafür war, warum er an diesem Ort himmlischen Beistand erflehte.
Übergangslos wanderten seine Gedanken zu seinem Vorgänger André de Montbard, fünfter Großmeister der Templer und Bewahrer des CAPUT LVIII, einem Mysterium, das die Geschicke des Ordens bestimmt hatte wie kaum ein anderer Gegenstand seit seiner Gründung vor knapp vierzig Jahren.
»Wenn ich nicht mehr bin, musst du das Haupt behüten, wie die Reinheit deiner eigenen Seele«, waren Bruder Andrés mahnende Worte gewesen, als er Bertrand unter vier Augen auf seine zukünftigen Pflichten als nächsten Großmeister der Templer vorbereitet hatte. »Der Teufel in Gestalt gieriger Machthaber darf keinesfalls in den Besitz der Geheimnisse des Ordens gelangen«, hatte er ihn eindringlich beschworen. »Ansonsten könnte das nicht nur die Vernichtung der Templer bedeuten, sondern der gesamten Menschheit.«
Danach hatte Bruder André ihn mit einem unscheinbaren Kasten aus Metall konfrontiert, kaum größer als eine Bibel und sogleich einen gregorianischen Choral angestimmt. Woraufhin sich der flache Deckel des Kastens wie von Zauberhand öffnete und eine spiegelglatte Oberfläche zum Vorschein brachte.
Bertrand erinnerte sich noch gut an den Schrecken, der ihm in die Glieder gefahren war, als sich daraus ein leuchtend blaugrüner Nebel erhob, der sich zusehends in das Haupt einer wunderschönen schwarzhaarigen Frau verwandelte. Kaum war dieser Vorgang beendet, fixierte sie jede seiner Bewegungen mit den schräg stehenden Augen einer ägyptischen Katze. Hinzu kam, dass sie offenbar die Kontrolle über seine innere Stimme übernommen hatte und ihm lautlos die Hintergründe ihres Auftritts erklärte, wobei er jedes ihrer Worte verstand.
»Der CAPUT LVIII, wie seine Schöpfer dieses Wunderwerk nennen, vermittelt uns zukünftiges Wissen, das uns beim Aufbau unseres Ordens behilflich sein wird«, erklärte ihm Bruder André in einem Ton, als ob dieses einzigartige Objekt die reinste Selbstverständlichkeit wäre.
»Darüber hinaus vertraue ich dir ein weiteres Geheimnis an, das noch bedeutender ist, weil es den Ursprung des CAPUT begründet«, fuhr er mit der gleichen Leichtigkeit fort, die Bertrand beinahe noch mehr erstaunte als der leuchtende Kopf.
»Es handelt sich um ein einzigartiges Gestein, dem eine unvergleichliche göttliche Macht innewohnt. Die Steintafeln, die wir im Jahre des Herrn 1118 mit Hugues de Payens, Godefroy Bisol und den anderen Begründern des Ordens unter dem Tempelberg in Jerusalem in der Bundeslade gefunden haben, offenbarten uns ein unermessliches Mysterium, das sich in gewisser Weise auch hinter den Fähigkeiten dieses magischen Hauptes verbirgt. Das Material der Tafeln stammt vom Berg Horeb und hat Moses einst in die Lage versetzt, allein kraft seines Glaubens das Meer zu teilen und die nachfolgenden Ägypter zu vernichten«, fügte Bruder André mit bedeutungsvoller Miene hinzu. »Wie uns die Schöpfer des CAPUT verraten haben, liegt sein Ursprung in den unendlich weiten Himmelssphären. Vor unfassbar langer Zeit, als die Welt noch jung war, ist ein riesiger Felsbrocken auf die Erde gestürzt und hat nicht nur den Berg Horeb geschaffen, sondern weitere Bergeshöhen, denen allen ein ähnliches Aussehen gemein ist. Tief im Innern dieser Berge verbirgt sich der sogenannte ›Lapis ex celis‹, der ›Stein, der vom Himmel gefallen ist‹. Mithilfe dieses Gesteins erlangt der Mensch die Fähigkeit nicht nur die eigene Realität auf unnatürliche Weise zu verändern, sondern auch die seiner Mitmenschen und darüber hinaus. Eine Eigenschaft, die den Stein trotz seiner unzweifelhaften Möglichkeiten höchst gefährlich macht. Du musst es dir so vorstellen Bertrand: Von diesem ›Lapis ex celis‹ geht eine unsichtbare Strahlkraft aus, wie von einem Heiligenschein, die sich bei einer gewissen Annäherung mit deinem geistigen Auge verbindet. Alles was du dort siehst, überträgt sich unter dem Einfluss des Steins in deine äußere Wirklichkeit. Damit kannst du Großes erschaffen, wenn du deinen Geist eisern beherrscht. Aber das erreichen die wenigstens. In deinem Innern kreisen unzählige Gedanken, gute und böse, die dir womöglich nicht bewusst sind und sich ebenfalls mit der Kraft des Gesteins verbinden. Je nachdem wie abstrus deine verdrängten Vorstellungen sind, sorgen sie im Innern wie im Außen für ein unermessliches Chaos das der Beschreibung der Hölle gleichkommt. Deshalb ist es auch nur Eingeweihten des Ordens erlaubt die Höhle im Berg Horeb zu betreten. Weil der Abstand zum Stein und die Menge den Einfluss seiner Macht bestimmt. Was naturgemäß eine gewisse Erfahrung voraussetzt, wie weit man sich ihm nähern darf oder eben nicht. Es wird unter anderen deine Aufgabe sein, diese Gesetzmäßigkeiten möglichst rasch zu studieren.«
Bertrand hatte den Ausführungen seines Vorgängers bis hierher voller Spannung gelauscht. Wobei er nicht sicher war, ob er einer solchen Herausforderung gewachsen sein würde.
»Wenn du erst Großmeister bist, Bruder Bertrand, wirst du nicht nur Hüter dieser Geheimnisse sein, sondern – so Gott der Herr es erlaubt – weitere ergründen«, ermutigte ihn Bruder André, der offenbar seine Gedanken erraten hatte. »Deshalb wird deine erste Mission darin bestehen, im Auftrag des Hohen Rates diese magischen Orte, von denen ich sprach, zu suchen, zu finden und dafür zu sorgen, dass sie, wie die bereits entdeckten Mysterien, vor dem Zugriff unserer Feinde gesichert sind.«
»Und was fange ich mit dem Wunderstein an, wenn wir tatsächlich ein neues Vorkommen des ›Lapis ex celis‹ finden?«, wollte Bertrand wissen, weil er sich mehr von einer solchen Entdeckung erhoffte, als nur ihr Hüter zu sein. »Wenn Moses damit die Ägypter in die Flucht geschlagen hat, können wir dann nicht auch unsere Feinde mit diesem göttlichen Werkzeug besiegen?«
»Von einem solchen Vorhaben kann ich zurzeit nur dringend abraten«, hatte Montbard ihn gewarnt. »Bisher ist niemand von uns in der Lage, das Mysterium so perfekt zu beherrschen, wie es einst Moses gelungen ist. Mit den Tafeln, die wir in der Bundeslade gefunden haben, könnte man mühelos ganze Reiche auslöschen, wenn man es richtig anstellt. Um die unermesslichen Kräfte des Gesteins gefahrlos in sinnvolle Bahnen zu lenken, muss man unbedingt reinen Herzens und reinen Geistes ist. Aber so weit sind wir noch nicht. Bevor wir den Stein und seine Macht vollends für unsere Zwecke nutzen können, benötigen wir einiges mehr an Wissen über dessen genaue Wirkungsweise. Schon allein deshalb ist bei jeder weiteren Grabung höchste Vorsicht geboten. Andererseits ist dieses Werkzeug göttlicher Macht zu einflussreich, um es jedem dahergelaufenen Tölpel zu überlassen, der es zufällig findet, geschweige denn unseren mächtigen Feinden. Wann wir uns weiter vorwagen, wird zukünftig auch in deiner Hand liegen. Wobei ich noch eine weitere Warnung aussprechen muss: Es gibt da eine Prophezeiung des Hauptes, die einer fernen Zukunft entstammt. Sie besagt, dass jeder, der sich der Macht der Steine bedient, früher oder später den eigenen Untergang zu befürchten hat, wenn er anmaßend wird und die universellen Kräfte des ›Lapis ex celis‹ in die falschen Bahnen lenkt. Auch auf uns und unseren Orden könnte das zutreffen. Deshalb bitte ich dich, sei vorsichtig, bei allem was du entscheidest. Obwohl ich weiß, dass du diese Aufgabe besonnen angehen wirst. Das ist einer der Gründe, warum wir dich als meinen Nachfolger ausgewählt haben und niemand anderen.«
Vor fast fünf Monaten war Bruder André verstorben und – so hoffte Bertrand – in den Himmel aufgefahren. Obwohl der Orden ihn schmerzlich vermisste, hatte die Macht der Steine sein viel zu frühes Ableben nicht verhindern können. Eine Tatsache, die Bertrand irritierte. Denn offenbar hatte Bruder André durch das magische Haupt von seinem bevorstehenden Tod gewusst, aber nichts unternommen, um sein Leben mithilfe des Mysteriums zu verlängern.
Nach dem Begräbnis seines Vorgängers war Bertrand unverzüglich im Heiligen Land aufgebrochen und wenig später mit dem Schiff in Marseille angelandet. Nach einem kurzen Aufenthalt in der dortigen Kommandantur war er in Richtung Paris geritten, um sich beim Generalkapitel des Ordens zum neuen Großmeister ernennen zu lassen.
Bereits zuvor hatte er südlich von Carcassonne im Namen der Templer ein großes Stück Land erworben. Ein Gebiet, das auf Bruder Andrés überaus präzisen Karten verzeichnet war und zu den weiteren möglichen Fundorten des mysteriösen ›Lapis ex celis‹ zählte. Bei dem Gelände handelte es sich um eine felsige Ödnis, die kaum landwirtschaftlichen Gewinn versprach, und auch von möglichen Bodenschätzen war nichts bekannt. Bertrand empfand es als einen Wink des Himmels, dass er den Besitzer dieser rauen Gegend durch familiäre Verbindungen persönlich kannte. Somit waren er und der vorherige Eigentümer rasch handelseinig geworden. Das Terrain in den so genannten Corbièras, einer Bergkette südlich von Carcassonne, war von mehreren herausragenden Erhebungen gekennzeichnet. Die höchste, der Pech de Bugarach, sah dem Berg Horeb zum Verwechseln ähnlich. Was möglicherweise ein Hinweis darauf war, dass er die gleichen Besonderheiten aufwies wie sein Zwilling im Land der Ägypter.
Bis dahin war alles nach Bruder Andrés Plan verlaufen. Allein die Frage, ob ihm genug Zeit blieb, dessen Auftrag ordnungsmäßig auszuführen, beschäftigte Bertrand beinahe täglich. Seine ahnungslosen Mitbrüder im Heiligen Land drängten auf seine baldige Rückkehr, weil die dortigen Aufgaben ebenfalls keinerlei Aufschub duldeten. Von der Dringlichkeit seiner Mission in der Occitanie wussten dagegen nur Bertrand selbst und der Hohe Rat der Templer, eine kleine eingeschworene Gemeinschaft, die zur Elite des Ordens gehörte und dafür sorgte, dass ihm die notwendigen Gelder zur Erschließung des Geländes bewilligt wurden.
Offiziell hatte Bertrand verlauten lassen, dass er rund um den Pech de Bugarach nach Eisen und Silber schürfen ließ. Ein Ansinnen, das ihn wegen der schlechten Erfolgsaussichten nicht nur bei König und Klerus als Glücksritter brandmarkte. Was ihn aber nicht besonders störte. Besser man hielt ihn und seine Mitbrüder für verrückt, als dass man ihnen ein dunkles Geheimnis unterstellte.
Fürs Erste hatte Bertrand sein Lager im unbedeutenden Templerkastell von Campagne-sur-Aude aufgeschlagen, nur eine knappe Stunde Ritt vom Grabungsort entfernt. Es bot ihm die notwendige Abgeschiedenheit, um Tag und Nacht seine Pläne zu schmieden, mit denen er seine Mission möglichst schnell zum Erfolg führen wollte.
Dass er in Wahrheit das Tor zur Hölle suchte, hatte er nicht einmal jenen verraten, die er eigens für diesen Auftrag eingestellt hatte.
Inzwischen waren die angeheuerten Bergleute aus den deutschen Landen eingetroffen und schon seit mehr als einem Monat damit beschäftigt, einen ersten Stollen in den Felsen zu treiben, dessen äußere Struktur leider um einiges härter war als zunächst angenommen. Der im Inneren des Berges vermutete ›Lapis ex celis‹ war erfahrungsgemäß von weicherer Beschaffenheit. Aber ihn sollten die Hauer ohnehin nicht fördern, sondern nur den Weg dorthin freimachen. Zunächst sicherten sie den Stollen mit Eichenbalken und eisernen Streben, die extra vor Ort angefertigt wurden, damit der künstliche Hohlraum nicht unter der Last des Gebirges zusammenbrach.
Es würden wohl noch einige Wochen ins Land ziehen, bis Bertrand und seine Mitstreiter sicher sein konnten, ob sich der gesuchte Wunderstein tatsächlich unter dem Berg befand oder nicht.
Unvermittelt hüstelte jemand hinter ihm.
»Wer stört?« Ein wenig ungehalten wandte Bertrand seinen Blick vom Altar der Kapelle in die Richtung, aus der das Geräusch gekommen war.
»Ich bitte um Vergebung, Beau Seigneur.« Die von Ehrfurcht getragene Stimme eines blonden Jünglings wurde vom Rauschen des Gewitterregens übertönt, der dem Donner gefolgt war. »Es liegt mir fern, Beau Seigneur, Eure Gebete zu unterbrechen.«
Bertrand, der als Großmeister zugleich ranghöchster Befehlshaber der Templer war, entschuldigte sich im Geiste bei der Heiligen Jungfrau für die Unterbrechung und erhob sich mit einem leisen Seufzer aus seinem Betstuhl.
Der junge, hoch gewachsene Ordensbruder aus der Champagne, der mit gesenktem Blick auf ihn wartete, hatte erst vor Kurzem sein Gelübde als Tempelritter bei ihm abgelegt. Aus dem strohblonden, geschorenen Haupthaar perlte das Wasser und rann an der Schläfe entlang in den dichten, rotblonden Bart. Sein weißer Kapuzenumhang, die sogenannte Chlamys, die einem Regenguss üblicherweise mühelos standhielt, hing völlig durchnässt an ihm herab und bot ein Bild des Jammers. Das leuchtend rote Croix pattée der Templer auf der linken Schulter des Mantels war von der Nässe dunkel wie Blut. Trotz seines bedauernswerten Zustands glühten die hellen Augen des jungen Bruders vor Tatendrang.
Bertrand de Blanchefort war sich bewusst darüber, dass er für die meisten jungen Ritterbrüder nicht nur den machtvollen Großmeister verkörperte. In seinem fortgeschrittenen Alter von fast fünfzig Jahren ersetzte er ihnen nicht selten den Vater, den die allermeisten aufgrund von Siechtum und Krieg bereits in früher Jugend verloren hatten. Was bedeutete, sie riskierten ihr Leben nicht nur für ihren Glauben, sondern im Zweifel auch für ihn selbst.
Im Umkehrschluss empfand Bertrand eine große Verantwortung für die jüngeren Brüder im Orden, denen es in vielerlei Hinsicht an Erfahrung mangelte. Mit einem tadelnden Blick stemmte er die Hände in die Hüften und ging bedächtigen Schrittes auf den frisch initiierten Mönchskrieger zu.
»Sag, Bruder Aymon, was bringt dich dazu, so todesmutig durch diesen wütenden Sturm zu reiten und dabei deine Gesundheit aufs Spiel zu setzen? Der Blitz hätte dich und das Pferd treffen können.«
»Ich habe eine persönliche Eil-Botschaft von Kommandeur Wilhelm von Fliesteden an Euch zu überbringen. Ich komme geradewegs aus La Jacotte, Beau Seigneur«, antwortete der junge Ritter atemlos und ignorierte Bertrands Einwand. »Bruder Wilhelm wünscht, Euch unverzüglich im Dorf der deutschen Bergleute zu sehen. Wie es scheint, haben die Hauer gefunden, wonach Ihr sucht, Beau Seigneur. Heute Mittag ist im Hauptstollen der Durchbruch in eine bis dahin unbekannte Höhle gelungen. Nur … leider hat es dabei Tote und Verletzte gegeben. Bei den Deutschen herrscht aufgrund der jüngsten Geschehnisse helle Aufregung. Unsere Brüder haben die verletzten Männer in die Hütten gebracht und notdürftig versorgt. Die Toten wurden in der Kapelle des Lagers aufgebahrt. Seltsam, aber … die Haut der Leichen ist auf merkwürdige Weise verbrannt. Und bisher konnten nicht alle Vermissten gefunden werden, was daran liegt, dass niemand sich getraut, in die Höhle vorzudringen, um nach ihnen zu suchen. Das wird erst der Fall sein, wenn Ihr eine entsprechende Anordnung erteilt habt, Beau Seigneur. Bruder Wilhelm wartet deshalb dringend auf Eure Befehle, damit kein noch größeres Unheil geschieht, wie er sagte.«
Bertrand warf einen nachdenklichen Blick durch die offenstehende Spitzbogentür hinaus auf den Hof des Kastells, wo der Regen weiterhin in wahren Sturzbächen auf die quadratischen Pflastersteine prasselte. Dazu blitzte es hin und wieder, gefolgt von Donnerschlägen, bei denen jedes Mal die Fenster der Kapelle vibrierten.
»Danke, dass du so mutig warst und so rasch hierher geritten bist.« Bertrand nickte dem jungen Bruder anerkennend zu und murmelte, mehr zu sich selbst: »Ich hoffe nur, das Wetter ist kein schlechtes Omen oder gar ein Zeichen dafür, dass mit dem Vorstoß eine Macht entfesselt wurde, die sich am Ende nicht mehr beherrschen lässt.«
Sein durchnässtes Gegenüber warf ihm einen wissbegierigen Blick zu. »Was meint Ihr damit, Beau Seigneur?« Offenbar vergaß er, dass sein Großmeister ihm nicht die Erlaubnis zur Rede erteilt hatte.
»Vergiss es.« Bertrand zuckte mit seinen breiten Schultern. »Es war nicht für deine Ohren bestimmt.« Unvermittelt überkam ihn die Gewissheit, dass sein Vertrauter und Adjutant Wilhelm von Fliesteden, der das Unternehmen vor Ort überwachte, recht behielt und tatsächlich ein noch größeres Unglück geschah, wenn er den Fortgang der Geschehnisse zu lange sich selbst überließ. Wobei Bertrand hoffte, dass es nicht bereits zu spät war, um noch eingreifen zu können.
»Sag meinem Knappen, er soll mein schnellstes Pferd satteln. Und nein, er muss mich nicht begleiten – und du auch nicht. Lass dich in der Küche verpflegen. Meine Ordonnanz soll dir etwas Trockenes zum Anziehen bringen und dir ein Nachtlager zuweisen.«
»Aber Beau Seigneur«, protestierte der junge Bruder. »Ich habe den Auftrag, Euch zur Seite zu …«
»Schweig«, befahl Bertrand ihm barsch. »Ich reite allein.«
Den in der Ferne aufragenden Kamm des Pech de Bugarach fest im Blick, der ab und an von gleißenden Blitzen erhellt wurden, preschte Bertrand wenig später auf seinem schwarzen Araberhengst über die Hochebene von Corbièras. Auf seinem Ritt durch mehrere Bauerndörfer begegnete ihm keine Menschenseele – was bei diesem Wetter kein Wunder war. Das änderte sich auch nicht, als er nach einer guten halben Stunde im gestreckten Galopp das dicht bewaldete Tal von Bézu erreichte.
Der Regen hatte nachgelassen, aber das Wetterleuchten zuckte nach wie vor geisterhaft über dem eindrucksvollen Bergmassiv, als La Jacotte, das Dorf der Deutschen, hinter einem uralten Pinienwald auftauchte. Hin und wieder war das Rollen des Donners zu hören, der von den Felsen widerhallte wie eine Warnung vor unseligen Mächten.
Die Hütten aus Stein und Holz hatte Wilhelm von Fliesteden im Auftrag des Ordens eigens für die ausschließlich deutschen Arbeiter in Sichtweite des Berges erbauen lassen. Über Wochen hinweg hatte Bertrands deutscher Kampfgenosse und Bruder speziell für diese Aufgabe sechzig Bergleute unter dem Siegel absoluter Verschwiegenheit in der Nähe von Köln und im Osten der deutschen Lande rekrutiert. Offiziell sollten sie in drei Schichten nach Silber schürfen, wobei man sie über den Ort und den wahren Charakter ihres Auftrags bewusst im Unklaren gelassen hatte. Wenige Tage nach ihrer Ankunft hatten sie unter der strengen Aufsicht von Bruder Wilhelm am Fuß des Pech de Bugarach damit begonnen, einen ersten Stollen in den felsigen Untergrund zu treiben. Inzwischen waren sie einige hundert Fuß weit in den zunächst unverdächtigen Kalkstein vorgedrungen.
Bertrand hatte ihnen zuvor eine beachtliche Anzahlung auf den versprochenen Lohn zukommen lassen, der weitaus höher ausfiel als üblich. Was beides zugleich als Schweigegeld zu verstehen war. Selbst die Familien der Bergleute hatten nicht die leiseste Ahnung, wohin die Reise ihrer Väter, Söhne und Ehemänner gegangen war.
Die Deutschen hatte es nicht gestört, dass ihnen bei Strafe verboten war, mit den Einheimischen in der Umgegend des Berges zu reden, was naturgemäß schon an der unterschiedlichen Muttersprache gescheitert wäre. Doch Bertrand de Blanchefort und seine Vertrauten wollten kein Risiko eingehen, wenn es darum ging, geheim zu halten, was womöglich in den Tiefen des Pech de Bugarach auf sie lauerte. Zugleich herrschte ein Verbot für die Bewohner der Umgebung, das Dorf der Deutschen zu betreten.
Gemeinsam mit dem Herrn von Albedun, dessen Festung in Sichtweite stand, hatte Bertrand Wachmannschaften aufstellen lassen. Mit der nachvollziehbaren Begründung, dass der Orden bei seiner Suche nach edlen Metallen Räuber und Gesindel fernhalten wollte. Die gut einhundert Söldner, die Tag und Nacht rund um den Berg patrouillierten, unterstanden dem Befehl von Albeduns Bruder, der sie als Kommandeur die Templer der benachbarten Festung von Le Bézu befehligte.
Von den Einheimischen verirrte sich ohnehin kaum jemand in diese einsame Gegend, weil es schon vor dem Erwerb dieses Landstrichs durch die Templer Gerüchte gegeben hatte, der Berg und dessen unmittelbare Umgebung seien verflucht.
Bauern und Schäfer hatten immer wieder berichtet, sie hätten am Gipfel des Berges seltsam blaugrüne Lichter gesehen. Ihre Tiere, die dort geweidet hatten, waren angeblich elendig zugrunde gegangen. Kühe hatten keine Milch mehr gegeben. Ziegen und Schafe, die dem Berg zu nahegekommen waren, hatten Junge mit zwei Köpfen oder nur drei Beinen geboren. Etliche Hirten hatten über Schwindel und Unwohlsein geklagt und darüber, dass ihre Frauen nicht mehr schwanger wurden.
Diese Unkenrufe waren unter anderem der Grund, warum für Bertrand nur ausländische Arbeiter infrage gekommen waren, denen man tunlichst verschwiegen hatte, welch gruselige Legenden in der Umgegend ihres Einsatzgebietes kursierten.
Bertrand selbst hatte zumindest eine Ahnung, was der Grund für diese seltsamen Erscheinungen war. Augenscheinlich entsprachen Bruder Andrés Vermutungen der Wahrheit, was den Ort und seine Bedeutung betraf.
Als er das Dorf der Deutschen erreichte, übergab er seinen schweißnassen Hengst einem herbeieilenden Knappen, der zu einem benachbarten Kastell gehörte. Es beherbergte ein Pionier-Bataillon der Templer, dessen Brüder die vorübergehenden Behausungen für die deutschen Hauer und die dort stationierten Wachen errichtet hatten. Darüber hinaus waren sie für den Abtransport von Geröll und Abraum zuständig und halfen bei der Herstellung von Streben und Stützen.
Schon von Weitem sah Bertrand zahllose Menschen mit Fackeln, die aufgebracht und wild gestikulierend durcheinanderliefen. Beim Anblick der verzweifelten Männer, die sich auf dem Platz in der Dorfmitte versammelt hatten, überlegte er fieberhaft, wie er ihnen das Unglück erklären sollte. Er konnte ihnen ja schlecht die von ihm vermutete Wahrheit sagen.
Anstatt sich beim Erscheinen des Großmeisters zu beruhigen, wurde die Meute immer wütender und fuchtelte nun wie von Sinnen mit erhobenen Schaufeln und brennenden Fackeln herum. In ihren verschmutzten Gesichtern konnte Bertrand mühelos die nackte Angst erkennen, die sich zudem in ihre panisch dreinblickenden Augen eingebrannt hatte.
»Was ist geschehen, Bruder?«, rief er Wilhelm von Fliesteden entgegen, der im Laufschritt auf ihn zuhielt, umringt von einem Pulk aufgebrachter Bergleute, die sein rasches Weiterkommen verhinderten. Vergebens versuchte Bertrand, sich in diesem Heer aus tanzenden Lichtern und lamentierenden Männern einen ersten Überblick zu verschaffen.
Fliesteden war ein großer, hagerer Mann mit schütteren blonden Haaren und steingrauen Augen. Mit seiner Größe von fast sieben Fuß überragte er die aufgebrachten Menschen wie ein Leuchtturm die stürmische See. Ursprünglich stammte er aus den deutschen Landen, genau genommen aus der Nähe von Köln. Seine Aufnahme als Templer war im Haupthaus des Ordens auf dem Tempelberg in Jerusalem erfolgt. Anschließend hatte er mit Bertrand Seite an Seite im Heiligen Land gekämpft. Spätestens seit dieser Zeit war bekannt, dass man sich blindlings auf den deutschen Ordensritter verlassen konnte.
Bruder Wilhelm versuchte, auf Bertrands Frage nach den Vorkommnissen zu antworten, doch wegen der zahllosen Rufe in deutscher Sprache drangen nur unverständliche Wortfetzen zu ihm durch.
»Ruhe!«, brüllte Bertrand mit seiner gewaltigen Stimme, die ihm nicht nur bei Feldzügen zum Vorteil gereichte. Augenblicklich kehrte Stille ein; nur noch gelegentliches Husten oder Räuspern waren zu vernehmen.
Einen Moment später hatte Wilhelm von Fliesteden sich aus der Menge geschält und schaffte es, sich zu ihm durchzuschlagen. Während sich das unstete Licht einer Fackel auf dem schmalen Gesicht des Deutschen abzeichnete, empfing Bertrand ihn stumm mit dem überkreuzten Handschlag der Templer.
»Im Stollen ist irgendetwas Entsetzliches geschehen, Bruder Bertrand«, berichtete Fliesteden atemlos. »Wir haben etliche Verletzte, die ungewöhnliche Verbrennungen aufweisen. Aber ich war selbst nicht vor Ort, als es geschah. Deshalb kann ich nur ahnen, was der Grund für diese Katastrophe ist. Ich habe die Arbeiter, ganz gleich ob tot oder lebendig, allesamt mit einem Wagen vom Eingang des Berges hierher transportieren und notdürftig versorgen lassen.«
»Gut gemacht«, lobte ihn Bertrand, dem auch nichts anderes eingefallen wäre. »Aber ich muss die Einzelheiten des Vorfalls aus dem Mund eines Betroffenen hören. Sonst hilft mir das alles nicht weiter.«
Bruder Wilhelm ließ umgehend einen Vorarbeiter zu Bertrand bringen, der das Unglück halbwegs unbeschadet überlebt hatte.
Der Mann war ein erfahrener Hauer, um einiges kleiner als Bertrand, aber stämmiger. Er trug sein graues, kurz geschorenes Haar wie ein Templer und vermittelte den Anschein, ein zuverlässiger, rechtschaffener Kerl zu sein.
Fliesteden bestätigte diesen Eindruck. Er habe in diesem Mann einen verlässlichen und mutigen Anführer gefunden, erklärte er, der seine Leute zusammenhielt und zur Arbeit anzutreiben verstehe, ohne ihnen gegenüber grob zu werden.
»Es … es ist meine Schuld«, stammelte der unbedarfte deutsche Hauer, als sie gemeinsam über schlammige Wege zum Versammlungshaus der Bergarbeiter marschierten, gefolgt von den anderen Arbeitern, die natürlich den Grund dieser Katastrophe wissen wollten. Dort hatte man die Verletzten untergebracht.
»Wie ist Euer Name?«, sprach Bertrand den Vorarbeiter auf Deutsch an.
»Rudo von Köln, Herr.«
»Also gut, Rudo.« Bertrand klopfte dem Mann beschwichtigend auf die Schulter. »Fasst Euch erst einmal. Niemand macht Euch einen Vorwurf.«
»Ihr habt gut reden.« Der Deutsche warf ihm einen aufgebrachten Blick zu. »Ihr habt ja nicht gesehen, was ich gesehen habe.«
»Was habt Ihr denn gesehen?«, fragte Bertrand zögernd, nicht sicher, ob er es wissen wollte.
»Ich habe in die Hölle geschaut, Beau Seigneur«, erklärte Rudo mit gebrochener Stimme.
»Habt Ihr den Teufel gesehen?«, kam ihm Bertrand zuvor und hob eine Braue.
»Das nicht, Herr, dem Heiland sei Dank«, entgegnete der Deutsche beklommen. »Aber es hätte nicht schlimmer sein können, wäre mir der Leibhaftige persönlich erschienen.«
Bertrand, der keine Ahnung hatte, worauf Rudo hinauswollte, atmete hörbar aus, als er mit dem Deutschen das einzige vollständig gemauerte Haus in der Mitte des Dorfes erreichte. Bevor er mit Rudo und Bruder Wilhelm das Gebäude betrat, um nach den Verletzten zu schauen, bat Bertrand die übrigen Bergleute, die ihnen gefolgt waren, draußen zu warten. Im Inneren des Hauses hatte man einige der Männer, die lebend, aber verletzt aus der Höhle entkommen waren, auf Strohmatten und weiche Filzdecken gebettet. Ihre Blicke waren allesamt starr nach oben gerichtet, wie eingefroren, und sie sprachen kein Wort.
»Wenn sie nicht atmen würden, könnte man denken, sie sind tot«, kommentierte Rudo zutiefst erschüttert den bedenklichen Zustand seiner Kameraden.
Andere hockten stumm am Boden und wippten immer wieder mit dem Oberkörper vor und zurück. Allen gemeinsam war der starre Blick, der Bertrand den Eindruck vermittelte, als hätten diese Männer, entgegen Rudos Beteuerungen, sehr wohl in die Fratze des Satans geschaut.
»Seht Euch dieses Elend an«, jammerte der Deutsche mit einer verzweifelten Geste. Zur Verdeutlichung seiner Worte riss er den Männern die Kleidung hoch und beleuchtete mit seiner Laterne deren nackte, stark gerötete Haut, um ihm die seltsamen Verbrennungen der Kameraden vorzuführen.
Bertrand hatte schon einige Menschen aus nächster Nähe auf einem Scheiterhaufen brennen sehen und eine ziemlich genaue Vorstellung davon, wie verbrannte Haut aussah. Doch das hier war anders.
Schweigend hockte er sich neben jeden Einzelnen, um dessen Wunden genauer in Augenschein zu nehmen. Irgendetwas hatte durch das Leinen hindurch die Haut der Unglücklichen versengt, aber nicht den darüberliegenden Stoff.
Bertrand erinnerte sich an Montbards Ausführungen über die Entdeckung der Bundeslade unter dem Tempelberg. Der Sklave, der die Kiste aus Neugier geöffnet hatte, war auf der Stelle gestorben, ohne einen Mucks von sich gegeben zu haben. Nachdem die Brüder ihn von der Lade weggezerrt und den Deckel in sicherem Abstand mit einer Lanze geschlossen hatten, war das Gesicht des Toten nicht mehr zu erkennen gewesen. Die Haut hatte ausgesehen wie geschmolzenes Wachs. Der Bedauernswerte war nicht an seinen Verbrennungen gestorben, sondern erstickt, weil Mund und Nase zu einer kompakten, hässlichen Masse verschmort waren, die es ihm unmöglich gemacht hatte, zu atmen oder auch nur einen Schrei von sich zu geben.
Bei den Deutschen hatte sich die Haut auf ähnliche Weise verändert, wie Bertrand bei genauem Hinsehen nun feststellen musste. Sie war rot und sah aus wie verschmort, wenn auch nicht so entsetzlich wie in Montbards Beschreibungen über den unseligen Sklaven. Vermutlich hatten diese Männer das Gestein nicht einmal berührt, sondern waren ihm nur zu nahegekommen.
»Ich verstehe das alles nicht!«, jammerte Rudo und bedachte Bertrand mit einem anklagenden Blick. »Als ich heute früh am Eingang zum Stollen die Schichten für den Tag eingeteilt habe, war noch alles in Ordnung. Dann wurden Rufe laut, einem meiner Leute sei der Durchbruch zu einem Hohlraum gelungen. Erst als ich die Schreie hörte, wusste ich, dass etwas Furchtbares geschehen sein musste. Ich bin den Männern gleich hinterher, aber …« Dem Deutschen versagte die Stimme, und er schluckte schwer. »Ich war wie gelähmt«, fuhr er aufgewühlt fort, »und konnte nicht einschreiten, als ich sah, wie andere Kumpel tiefer in die Höhle vordrangen, um festzustellen, woher die Schreie kamen. Ich hatte Angst und habe gezögert, anstatt ihnen zu folgen. Ich habe meinen Leuten hinterhergebrüllt, sie sollten sofort umkehren, aber sie reagierten nicht. Sie erschienen mir wie besessen!« Tränen schimmerten in seinen Augen. »Ich hätte sie vor einem solchen Unglück bewahren müssen! Es ist meine Schuld, dass sie von diesem verteufelten Berg verschluckt wurden.«
»Es ist nicht Eure Schuld, so etwas konnte niemand ahnen«, versuchte Bertrand den Mann zu beruhigen, obwohl er selbst die Aufregung verspürte, die ein solches Erlebnis mit sich brachte.
»Als mir die ersten Unglücklichen aus dem Loch entgegentaumelten, war es bereits zu spät«, fuhr Rudo weinerlich fort. »Ihre Arme und Beine brannten wie Feuer, obwohl anfangs nichts zu sehen war, hatten sie vor lauter Schmerzen ihren Verstand verloren. Ich wollte in die Höhle zurück, um den anderen zu helfen, doch ein stetiges Hämmern und ein blaugrünes Leuchten jagten mir eine höllische Angst ein. Trotzdem kletterte ich in den Durchbruch hinein. Ich sah einige Kameraden, die sich wie Schlafwandler in einem grünblauen Nebel bewegten. Ich rief ihre Namen, doch sie hörten mich nicht, weil das Hämmern aus dem Innern der Höhle immer lauter wurde. Dort konnte ich erkennen, dass die Wände mit grünlich funkelnden Kristallen bedeckt waren, von denen eine unerträgliche Hitze ausging, die bis zu mir drang, sobald ich mich ihnen näherte. Ich sah, wie sich der farbige Nebel immer rascher verdichtete und einen rasenden Wirbel bildete wie bei einer Windhose oder einem Orkan.«
Er stockte, ehe er fortfuhr: »Dann tat sich in der Mitte ein Fenster auf, in dem ich Gestalten sah … längst Verstorbene, aber auch bekannte Gesichter von noch Lebenden.« Tränen liefen ihm über die Wangen. »Da waren meine Frau und meine Kinder. Sie riefen mir zu, ich solle endlich nach Hause kommen. Ich wollte zu ihnen, aber je näher ich ihnen kam, umso stärker wurde das Hämmern und die Hitze. Dann erschienen eine Reihe bereits verstorbener Menschen, wie die Geister meiner Ahnen, und ich sah riesige Gebäude, größer als die größten Kathedralen. Und immer wieder gleißende grünblaue Lichter, die vor meinen Augen tanzten und auf meiner Haut brannten wie Feuer. Meine Arbeiter gingen währenddessen stumpfsinnig weiter, wie Motten, die vom Licht einer Fackel angezogen werden und darin verbrennen. Spätestens in diesem Augenblick wusste ich, bei dieser Sache kann nur der Leibhaftige seine Finger im Spiel haben und dass ich mich selbst retten musste, bevor ich die anderen rette. Ich habe mich unter Aufbringung meiner letzten Kräfte abgewandt, um nicht tiefer in diesen Sog zu geraten, und bin gelaufen, so schnell ich konnte. Einige wenige vermochte ich zu überzeugen, mir zu folgen. Als wir dann glücklich den Durchbruch erreichten und hinausklettern konnten, nahmen unsere Kameraden uns draußen in Empfang. Dort war es fast Abend! Dabei war es früher Morgen, als das alles begann! Wir müssen den ganzen Tag im Berg gewesen sein und haben es nicht einmal bemerkt.« Er bekreuzigte sich und deutete mit wutverzerrtem Gesicht zum Pech de Bugarach. »Seid gewiss, Herr, in diesem Monstrum haust der Teufel mit seinen Gesellen. Ich werde keinen meiner Männer jemals mehr dort hineinschicken, ganz gleich, was Ihr uns bietet. Wir vermissen acht Kameraden, und diese armen Seelen dort drüben sind so gut wie erledigt!«, rief er und deutete mit abgrundtiefer Verzweiflung im Blick auf seine versteinert wirkenden Gefährten.
»Danke für Euren Bericht, Rudo«, entgegnete Bertrand nüchtern. »Ich gebe zu, ein solches Desaster konnte keiner von uns vorausahnen«, log er und wich tunlichst dem gehetzten Blick des Bergmanns aus. »Niemand wird von Euch verlangen, den Stollen noch einmal zu betreten. Ich werde unverzüglich nach einem Medikus schicken lassen, der Euren verletzten Kameraden hilft. Ihr und eure Leute seid umgehend von allen vertraglichen Verpflichtungen gegenüber dem Templerorden befreit. Wir werden Euch im Gegenzug für das Erlittene fürstlich entschädigen. Die Familien der Vermissten erhalten für ihre Verluste einen angemessenen Ausgleich. Auch werden wir Eure Entlohnung und die der Verstorbenen und Verletzten doppelt so hoch ansetzen wie abgemacht. Die Auszahlung erfolgt sofort und wie vereinbart in purem Silber.
Selbstverständlich dürft Ihr so rasch wie möglich in die deutschen Lande zurückkehren. Das Einzige, was ich von Euch verlange, ist absolutes Stillschweigen über alles, was hier geschehen ist und was Ihr gesehen habt. Wir werden das Tor zu Hölle, wie Ihr es nennt, unverzüglich verschließen, indem wir es wieder zuschütten und dafür sorgen, dass es für alle Zeiten verschlossen bleibt. Ihr habt mein Wort.«
»Das ist das Mindeste, was ich erwarte«, erwiderte Rudo mit einem waidwunden Blick auf die Opfer, bei denen zum Teil noch nicht sicher war, ob sie ihre Begegnung mit dem Mysterium der Templer überlebten. Falls doch, stand für Bertrand jetzt schon fest, dass die Männer dieses Ereignis niemals würden vergessen können.
Bevor Bertrand die Hütte verließ, erteilte er Fliestedens Knappen die Anweisung, einen Boten zur Templerfestung von Bézu zu entsenden, die sich einen eigenen Medikus leisteten, der seine Ausbildung im Morgenland absolviert hatte. »Bittet bei den dortigen Brüdern um heilkundigen Beistand«, befahl er dem Boten. »Sagt ihnen, es ist dringend.«
»Wie beurteilst du die Lage, Bruder?«, raunte Fliesteden ihm zu, als Bertrand ihn bat, ihm zu folgen, um abseits der Hütten ein Gespräch unter vier Augen zu führen.
»Wir haben gefunden, Wilhelm, wonach wir gesucht haben«, stellte Bertrand sachlich fest. »Alles ist genauso gekommen, wie Bruder André es damals beschrieben hat«, fügte er leise hinzu. »Im Augenblick heißt es deshalb, Ruhe zu bewahren. Womöglich bleibt uns in Zukunft nichts anderes übrig, als einen sogenannten Pakt mit dem Teufel einzugehen, um die Kräfte im Innern des Berges zu zähmen.«
Er behielt den Pech de Bugarach entschlossen im Blick, als er nach einem Moment des Schweigens von Neuem anhob: »Bring die Deutschen heim zu ihren Familien, Wilhelm, und sorge dafür, dass sie ein striktes Schweigegebot einhalten, nachdem sie in die deutschen Lande zurückgekehrt sind. Ich lasse das vermeintliche Tor zur Hölle heute Nacht vorerst verschließen und stelle, bis wir mit den übrigen Brüdern des Hohen Rates zu einem Ergebnis gekommen sind, wie wir weiter verfahren, doppelte Wachen auf.«
»Und dann?« Fliesteden warf ihm einen zweifelnden Blick zu. »Was ist, wenn wir tatsächlich finstere Mächte auf den Plan gerufen haben? Du hast mir doch selbst erzählt, was Bruder André über diese Prophezeiung berichtet hat.«
»Rede keinen Unsinn Wilhelm. Spätestens seit ich mich mit den CAPUT LVIII beschäftige, weiß ich, dass alles, was um uns herum geschieht, eine nachvollziehbare Ursache hat und man somit Einfluss auf negative Entwicklungen nehmen kann, wenn man früh genug darum weiß.« Bertrand schaute ihm verschwörerisch in die Augen. »Wir werden gemeinsam herausfinden, was genau es mit diesem neuen Vorkommen des ›Lapis ex celis‹ auf sich hat und ob wir den Stein nicht doch für unsere Zwecke nutzen können. Oder glaubst du ernsthaft, ich lasse mich wegen André de Montbards düsterer Prophezeiung von weiteren Untersuchungen abhalten?«
KAPITEL 1
Januar 1316 Paris / Festung Bois de Vincennes
Im Auftrag des Königs
Die Pflastersteine waren mit Eis überzogen und so glatt, dass nicht einmal die Kaltblüter mit ihren speziellen Hufeisen Halt darauf fanden, als der Wagen der Gens du Roi in den Innenhof der Festung Bois de Vincennes einbog. Kaum, dass sie die Zufahrt passiert hatten, glitt eines der Tiere aus und ging in die Knie. Dabei rutschte das hölzerne Gefährt auf dem glatten Eis mit Wucht zur Seite und schmetterte Rufus de la Motte im Innern des Wagens von seinem provisorischen Lager gegen die Wand aus massiven Eichenbrettern. Er schrie heiser auf, als ein Schmerz durch ihn hindurch raste, den er wie glühendes Eisen empfand, das man ihm durch Hüfte und Oberschenkel rammte. Er hatte alle Mühe, sich nicht zu übergeben, während sein Atem so schnell ging, dass sich in der Kälte helle Wölkchen vor seinen Lippen bildeten, die sich in der frostigen Luft sofort wieder auflösten.
Unvermittelt riss von außen jemand die Tür auf. Es war der Wagenlenker, der auf einem der beiden Zugpferde gesessen hatte. Man sah ihm nicht an, ob er auch verletzt war, doch er schien zu ahnen, welche Qualen de la Motte wegen seiner ungeschickten Fahrweise erleiden musste.
»Verzeiht mir, edler Herr«, nuschelte er, weil ihm vorne sämtliche Zähne fehlten. Er setzte zu einer unterwürfigen Verbeugung an. »Ihr könnt nun aussteigen.«
»Ach ja? Und wie soll ich das anstellen, du Tollpatsch?«, polterte de la Motte. »Ich kann mich kaum bewegen! Man sollte dich häuten und bei lebendigem Leib den Schweinen zum Fraß vorwerfen.«
Der Kopf des Mannes zog sich abrupt aus der Tür zurück und wich dem schmalen Gesicht von Baptiste de Neuville. Der heldenhafte Agent der Gens du Roi hatte ihm durch seinen furchtlosen Einsatz das Leben gerettet. Er gehörte zu den wenigen Offizieren, die das Massaker von Waldenstein unverletzt überlebt hatten.
»König Louis erwartet dich schon ungeduldig«, stieß er aufgeregt hervor. »Du sollst ihm umgehend Meldung machen, was in den deutschen Landen geschehen ist.«
»Der König kann mich mal«, zischte de la Motte, der nach tagelanger Reise in eisiger Kälte dem Tod näher war als dem Leben. Louis X. war der Letzte, dem er in diesem Zustand Bericht erstatten wollte. Und das nicht nur, weil er den Sohn Philipps IV. von Franzien für einen eingebildeten, launischen Gecken hielt.
Äußerlich kam der junge Thronerbe ganz nach seinem Vater. Ein blonder Schönling, der keinerlei Rücksicht auf das Wohlergehen seiner Untertanen nahm, wenn es für ihn darum ging, einen Sieg zu erringen. Im Unterschied zu seinem Sohn war König Philipp auch bei schlechten Nachrichten beherrscht geblieben. Sein ältester Sprössling dagegen war ein über die Landesgrenzen hinaus bekannter Choleriker, der keine kriegerische Auseinandersetzung scheute, was Louis X. schon vor seiner Thronbesteigung den Beinamen »der Zänker« eingebracht hatte.
Entsprechend vorgewarnt, ließ sich de la Motte nur ungern von den herbeieilenden Pagen auf eine Trage betten und in die königlichen Gemächer bringen. Laufen konnte er mit seiner verletzten Hüfte und dem aufgeschlitzten Oberschenkel beim besten Willen nicht mehr.
»Was soll das? Könnt Ihr nicht aufrecht stehen und Euch vor Eurem König verbeugen, wie es sich geziemt?«, krakeelte Louis X. mit rotem Kopf, als er de la Motte auf der Trage liegend erblickte. Die Diener hatten ihn hastig und ohne ein Wort der Erklärung vor dem lodernden Kaminfeuer abgesetzt und sich mit unterwürfigen Verbeugungen wohlweislich aus dem Staub gemacht.
»Bei Gott, schaut Euch nur an!«, lamentierte der junge König weiter. »Konntet Ihr Euch nicht wenigstens waschen, bevor ihr vor Eurem Herrscher erscheint? Ihr stinkt wie ein Ziegenbock, und Euer Bart sieht aus wie das Nest einer Amsel. Lasst Euch dieses hässliche Gestrüpp noch heute von einem Diener abnehmen! Nicht nur, weil es mich an die Templer erinnert, auch wegen der Läuse, die sich darin tummeln.«
De la Motte schloss gequält die Augen und gab sich seinen gewalttätigen Phantasien hin, in denen er aufsprang und den König mitsamt seinen üppigen Gewändern ins Kaminfeuer stieß. Während der Monarch in seiner morbiden Vorstellung lichterloh brannte, versuchte er für einen Moment zu verdrängen, warum er überhaupt hier war.
Doch der König, der an seinem Bericht interessiert war, dachte nicht einmal daran, ihn einfach ziehen zu lassen.
Als de la Motte den Fehler beging, seine verquollenen Lider wieder zu öffnen, sah er, dass Louis X. sich ihm mit dem lauernden Blick eines Reptils genähert hatte, das sichergehen will, ob sein Opfer auch stillhält, während es bei lebendigem Leib gefressen wird.
»Was ist geschehen? Und wo ist Inquisitor Eugene Lacroix mitsamt den Soldaten der Gens du Roi, die ihm bei der Erfüllung seines Auftrages zur Seite stehen sollten?«, raunte der König gefährlich leise und verengte die Lider wie eine Raubkatze kurz vor dem Sprung. »Wie kann es sein, dass nur ein kleiner Teil der Leute zurückgekehrt ist, die wir, wie von Lacroix verlangt, nachträglich zur Unterstützung in die Grafschaft Luxemburg entsandt haben. Und warum, bei allen Heiligen, seht Ihr aus wie der leibhaftige Tod. Gab es auf Eurer Reise denn nichts zu essen? Und wer hat Euch diese grauenhafte Verletzung beigebracht? Wenn mich nicht alles täuscht, wütet bereits der Wundbrand darin. Ihr bietet ein Bild des Jammers, das einem Marschall der königlichen Geheimpolizei nicht würdig ist. Ich sollte Euch auf der Stelle gegen einen anderen Offizier austauschen lassen. Aber ich will mich gnädig erweisen und gebe euch eine letzte Gelegenheit, Euren Fehler wieder gut zu machen. Also berichtet.«
»Es ist eine längere Geschichte, Sire«, versuchte de la Motte sein Glück, wohl wissend, dass er bereits zum Scheitern verurteilt war.
»Dann fasst Euch kurz«, schnappte der König ungehalten. »Damit Ihr fertig werdet, noch bevor Ihr zur Hölle fahrt«, fügte er unfein hinzu.
»Wir haben die Templer, die in Chinon entkommen sind, in den deutschen Landen gestellt«, stieß de la Motte unter heftigen Schmerzen hervor. »Und wir konnten ihren ehemaligen Kommandeur-Leutnant auf der Festung von Vianden festsetzen. Doch er ist uns durch einen Zauber entkommen. Als wir ihn und seine Männer schließlich auf einer Burg in Lothringen gefangen nehmen wollten, kam es zum Kampf. Unsere Feinde verfügten über eine unerwartet schlagkräftige Verstärkung, mit der keiner von uns gerechnet hatte. Wenn Ihr mich fragt, waren es allesamt ehemalige Templer, denen nach dem Prozess in Paris die Flucht gelungen ist. Inquisitor Eugene Lacroix und unseren tapferen Hauptmann Michelle de Thionville hat es dabei erwischt. Sie und auch noch andere von uns wurden von diesen Teufeln getötet. Ich selbst wurde von einer Übermacht der Feinde niedergerungen und mit dem Schwert zum Krüppel geschlagen. Nur weil ich mich totgestellt habe, bin ich noch am Leben. Hauptmann Baptiste de Neuville hat mir das Leben gerettet, indem er mich später halbtot vom Schlachtfeld aufgelesen hat. Es wäre zu gnädig, mein König, wenn Ihr mir Euren Medikus zur Verfügung stellen könntet, damit ich so rasch wie möglich wieder auf die Beine komme und eine neue Mannschaft aufstellen kann, um unsere Niederlage bitter zu rächen.«
»Wovon redet Ihr überhaupt?« Der König starrte ihn an wie eine unerwünschte Erscheinung. Offenbar hatte er irgendwo auf dem Weg zum Ende der Geschichte den Faden verloren.
»Äh …« De la Motte überlegte rasch, ob er trotz seines jämmerlichen Zustands von Neuem beginnen sollte, oder ob der König sich mit dem bisherigen Bericht womöglich zufriedengab.
Louis X. schaute ihn unterdessen lauernd an. »Was habt Ihr da von einem Zauber gefaselt? Könnt Ihr Euch nicht präziser ausdrücken? Was soll das sein?«
»Wir haben den CAPUT LVIII gefunden, jenes geheimnisvolle Haupt, das durch sämtliche Verhörprotokolle der Templer geistert und das Euer Vater zu Lebzeiten sehnlichst begehrte«, berichtete de la Motte mit schwacher Stimme. »Dieses merkwürdige sprechende Haupt hat ihm bis zu seinem allzu frühen Tod keine Ruhe gelassen, weil es seinem Besitzer angeblich sämtliche Wünsche erfüllt, wie die Legenden behaupten. Bisher dachten wir, Thionville und Lacroix wären nur einem Hirngespinst hinterhergejagt, aber nun steht fest, dieses Haupt existiert tatsächlich. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie sich Gerard von Breydenbach, der ehemalige Kommandeur-Leutnant der Templer von Bar-sur-Aube im Kerker von Vianden mithilfe dieses magischen Hauptes vor unseren Augen in Nichts aufgelöst hat. Nur Stunden später stand er quicklebendig und voll aufgerüstet vor uns, als wir seine Burg in Lothringen angegriffen haben. Und das, obwohl Lacroix ihn zuvor in Vianden so sehr aufs Rad geflochten hat, dass ihm sämtliche Knochen gebrochen und Sehnen gerissen sind. Doch als Breydenbach uns dann später mit seiner Armee auf freiem Feld attackierte, fehlte ihm nicht das Geringste! Er konnte reiten wie der Teufel und erschien mir vollkommen gesund.«
»Ihr fiebert«, erklärte der König kalt. »Das kommt vom Wundbrand. Sobald wir hier fertig sind, werde ich sogleich meinen Medikus holen lassen.«
Obwohl ihm die Aussicht auf einen Medikus wie eine Erlösung erschien, hätte de la Motte fluchen können vor Wut. Anscheinend hatte der König ihm gar nicht zugehört, geschweige denn, ihm auch nur ein Wort geglaubt. »Mag ja sein, dass mein Gesicht glüht, weil ich zu nah am Feuer liege«, krächzte er mit ausgetrocknetem Mund, »aber ich habe kein Fieber und bin im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte, Gott sei mein Zeuge.« Mit theatralischer Miene streckte er seine Rechte wie zum Schwur zur Decke, obwohl ihn die Schmerzen beinahe umbrachten. »Außerdem war ich nicht allein bei dieser Beobachtung«, stieß er keuchend hervor, »Baptiste de Neuville war auch dabei und kann es bezeugen. Euer Vater hatte recht: Der Orden war und ist mit dem Teufel im Bunde.«
Der unübersehbar verwirrte König wies seinen Diener mit einem ungehaltenen Fingerschnippen an, de la Motte von seinem Wein einzuflößen. »Und wo ist dieser CAPUT LVIII jetzt? Habt ihr diesen sprechenden Kopf wenigstens mitgebracht?«
»Nein. Er ist ebenso verschwunden wie Breydenbach und sein Begleiter, der mit ihm im Kerker war und sich mit dem Haupt auszukennen schien«, antwortete de la Motte kraftlos, nachdem er einen großen Schluck Weißwein aus dem dargebotenen Kelch getrunken hatte. »Aber seine Besitzer wissen ganz bestimmt, was genau es mit diesem Kopf auf sich hat und wo er sich befindet, da bin ich mir sicher. Wenn wir diesen Teufelsbrüdern endlich Herr werden und sie gefangen setzen, werden wir es erfahren.«
»Nicht gerade das, was wir uns erhofft hatten«, befand der König knapp und schien erneut über de la Mottes unglaubliche Aussagen nachzugrübeln. »Also gut. Ich werde Eure überlebenden Mitstreiter ebenso zu der Sache anhören und sehen, ob mich ihre Aussage zusätzlich zu überzeugen vermag. Wenn es stimmt, was Ihr sagt, und dieses Haupt solche Wunder vollbringen kann, muss ich es unbedingt haben. Danach sehen wir weiter, ob man sich tatsächlich mit dem Teufel verbünden muss, um seine Zauberkraft zu nutzen. Da ich den Kreis der Mitwisser klein halten möchte, werden wir mit einer neuen Mission zumindest so lange warten, bis Ihr genesen seid. Dann werdet Ihr Euch inkognito, nur in Begleitung einiger Agenten, zurück in die deutschen Lande begeben. Ich will diesen Kopf und das Geheimnis, das sich darum rankt, mit eigenen Augen sehen. Und natürlich auch deren Besitzer solltet ihr tunlichst verhaften und hierherschaffen. Also werdet Ihr einen Plan ausarbeiten, wie wir die Leute fassen und zum Reden bringen können. Und was die Einzelheiten betrifft, so erwarte ich schnellstmöglich einen ausführlichen Bericht, den ich umgehend an Bernardus Guidonis nach Toulouse überbringen lasse. Er wird künftig als oberster Inquisitor des Landes die Aufgaben von Eugene Lacroix übernehmen.«
Bevor de la Motte auch nur aufstöhnen konnte, fügte der König hinzu: »Ich werde Euch außer meinem Leibarzt zudem einen Schreiber, einen Diener und eine Leibeigene zur Verfügung stellen, die für die Befriedigung Eurer … Bedürfnisse sorgen wird, damit es Euch möglichst bald besser geht.« Mit einem Grinsen wandte er sich ab und rief seinen Kammerdiener herbei, der die ganze Zeit wie eine Statue regungslos in einer Ecke des Raumes gestanden hatte. »Geh und hol Justine. Sie soll sich waschen und etwas Hübsches anziehen. Wenn sie nichts hat, gib ihr ein paar Kleider von der Zofe meiner Gemahlin.«
Der Diener eilte davon.
Kurz darauf erschien eine anmutige Frau mit rotblondem Haar, das zu dicken Zöpfen geflochten war, die ihr bis aufs Hinterteil reichten. Ihrem reifen Gesichtsausdruck nach zu urteilen war sie mindestens fünfundzwanzig, vielleicht sogar älter, was aufgrund ihrer aufreizenden Kleidung und ihrer drallen Gestalt nicht zweifelsfrei zu ersehen war. Sie trug ein enges, bodenlanges Kleid aus hellblauer Seide, mit einer raffinierten Schnürung und einem tiefen Ausschnitt versehen, der ihre vollen Brüste erst so richtig zur Geltung brachte. Ihr Hintern war rund und prall, was nicht zu übersehen war, als sie sich anmutig vor dem König verbeugte.
Trotz seiner Pein konnte sich de la Motte beim Anblick ihrer vollen Lippen ohne weiteres vorstellen, wie es sein würde, wenn sie sich mit ihrer flinken Zunge seinem Allerheiligsten widmete. Prompt wurde er hart. Was er als gutes Zeichen wertete. Offenbar hatte der König instinktiv das richtige Weib ausgewählt, um seine Lebensgeister zu wecken und ihn damit so rasch wie möglich wieder auf die Beine zu bringen.
»Das ist Justine«, stellte der König sie mit hintergründigem Grinsen vor. »Sie verfügt über Begabungen, die sogar Totgeglaubte wieder ins Leben zurückholen können, wenn ihr wisst, was ich meine.« Er ließ seinen Blick auffällig zu de la Mottes Schritt wandern, der aller Pein zum Trotz auf Justines Auftritt gut sichtbar reagierte. »Deshalb bin ich guter Dinge, dass die Gesellschaft dieses Weibes Euch in jeder Hinsicht rasch wieder aufrichten und Eure Genesung schnell voranschreiten wird, so dass Ihr Euren Auftrag zu meiner Zufriedenheit zu Ende führen könnt.«
Mit einer affektierten Bewegung drehte Louis X. sich zu der jungen Frau um, die seine herablassende Vorstellung mit einem unterwürfigen Lächeln honorierte.
»Das, meine Liebe«, sagte er und deutete auf de la Motte, »ist der oberste Befehlshaber meiner Geheimpolizei, Marschall Rufus de la Motte. Ich will, dass du ihm jeden Wunsch von den Augen abliest und alles tust, was er verlangt, auf dass er bald wieder ganz der Alte ist. Es wäre jammerschade, würde er stattdessen das Zeitliche segnen. Denn für dich würde es bedeuten, dass ich dich bei lebendigem Leib mit ihm zusammen begraben lassen müsste.« Er machte eine kurze Pause, um das aufflackernde Entsetzen in Justines blauen Augen zu genießen. »Haben wir uns verstanden?«
»Sehr wohl, mein König«, flüsterte sie mit zitternden Lippen.
»Brav«, lobte Louis und erwiderte ihre Demut mit der Miene eines unschuldigen Lammes, in dessen glühenden Augen die Anwesenheit des Leibhaftigen loderte. »Dann kannst du jetzt gehen.«
Die schöne Rothaarige entschwand spürbar erleichtert zur Tür hinaus, nachdem der König sie mit einer wedelnden Handbewegung entlassen hatte.
Louis wandte sich daraufhin wieder seinem ungeliebten Patienten zu und schnippte erneut mit den Fingern in Richtung seines Dieners. »Sorge dafür, dass man dem Marschall ein angemessenes Quartier im Westflügel gleich neben meinen Gemächern zur Verfügung stellt. Außerdem soll sich mein Leibarzt um seine Wunden kümmern.«
Der Diener nickte und machte sich augenblicklich davon, während der König einen Schritt auf de la Motte zuging und ihm verbindlich in die Augen sah.
»Und nun zu Euch, mein Lieber. Dies alles geschieht nur, damit Ihr das unfassbare Geheimnis der Templer lüftet, verstanden? Ich brauche wohl nicht zu betonen, dass Euer Leben nach der schmachvollen Niederlage in den deutschen Landen keinen Pfifferling mehr wert ist. Aber ich gebe Euch eine allerletzte Chance. Denkt ja nicht, ich belohne Euch am Ende noch für Eure Unfähigkeit!«
»Gewiss nicht, Sire«, antwortete de la Motte gepresst und senkte unterwürfig den Blick, obwohl Zorn in ihm aufloderte. Er hätte sich denken können, dass dieser Idiot seine Tapferkeit nicht zu schätzen wusste.
»Sobald Ihr halbwegs wieder laufen könnt, werdet Ihr eine neue Truppe zusammenstellen und mir das Mysterium der Templer so rasch wie möglich überbringen. Allerdings nicht, indem Ihr wie letztes Mal mit der Tür ins Haus fallt und dabei fast die gesamte Truppe verliert. Diesmal werdet Ihr Euch zusammen mit Euren Männern auf die natürlichen Qualitäten eines Geheimagenten besinnen und eine List anwenden. Lasst Euch etwas einfallen, wie Ihr die Ordensbrüder dorthin bringt, wo wir sie haben wollen. Zeit genug habt Ihr.«
»Zu Euren Diensten, mein König«, stieß de la Motte unterwürfig hervor, obwohl er diesen Dämon in Menschengestalt am liebsten gevierteilt hätte.
Er hatte nicht die geringste Ahnung, wie er eine neuerliche Mission zum Erfolg führen sollte, schon gar nicht in seinem Zustand, aber das würde er gegenüber Louis X. nicht zum Besten geben. »Ich schwöre Euch bei meinem Leben, Sire«, sagte er fest und versuchte trotz seiner Schwäche, seiner Aussage mehr Überzeugungskraft zu verleihen, indem er seine Stimme hob. »Diesmal werden wir Euch liefern, was Ihr begehrt. Und die Hüter des Mysteriums gleich mit dazu.«
KAPITEL 2
April 1316 – drei Monate später – Herzogtum Lothringen / Burg Waldenstein
Schuldgefühle
Der Morgen dämmerte bereits über Burg Waldenstein, als Amelie erwachte. Draußen war es kalt und neblig. In der Nacht hatte es geregnet, was sie an den Tropfen erkennen konnte, die an dem kleinen Burgfenster herunterperlten.
Noch immer müde, streckte sie sich unter ihrer gemütlichen Daunendecke und gähnte. Struan hatte ihr gemeinsames Baldachinbett bereits verlassen und stieg vor ihren Augen – nackt wie er war – in seine Unterkleider. Zuvor hatte er Holz nachgelegt. Im offenen Kamin prasselte ein munteres Feuer, das die kleine Kammer zunehmend wärmte und in der Dämmerung neben den Stundenkerzen für heimeliges Licht sorgte.
Während Struan sich über die Schüssel auf der Kommode beugte und das Gesicht wusch und die Zähne putzte, suchte Amelie nach einer passenden Gelegenheit, ihn anzusprechen. Sie hatte schon wieder von ihrem Vater geträumt. So war es schon, seit ihre Schwangerschaft sichtbar voranschritt. Meistens lächelte der alte Bratac milde und empfing sie herzlich und mit offenen Armen. Amelie weinte dagegen oft im Traum und versuchte ihm zu erklären, warum sie ihn vor Jahren ohne ein Lebenszeichen zurückgelassen hatte. Doch bevor sie ihm versichern konnte, wie sehr sie ihn vermisste und dass er schon bald Großvater sein würde, verblasste sein Bild, und der Traum verflüchtigte sich.
Struan, der von alledem nichts ahnte, kämmte seine störrischen schwarzen Locken und den kurz geschorenen Bart, bevor er sich zu ihr umwandte und ihr mit einem Lächeln und einem Augenzwinkern seine Liebe gestand.
Vielleicht war das der Grund, warum Amelie sich ermutigt fühlte, nicht länger zu warten und ihm zu beichten, was ihr seit Monaten auf dem Herzen brannte. »Ich möchte nach Franzien reisen, um herauszufinden, ob mein Vater noch lebt«, erklärte sie schlicht. »Falls es so ist, soll er wissen, dass ich ein Kind erwarte, und dass er noch zu Lebzeiten einen Enkel haben wird.«
Struans freundlicher Gesichtsausdruck erstarrte augenblicklich zu Eis.
»Wir können nicht zurück nach Franzien«, beschied er ihr schroff, nur um gleich um einiges sanfter hinterher zu schieben: »Verstehst du das denn nicht?«