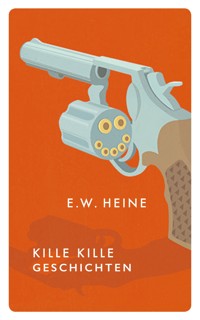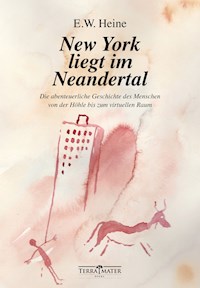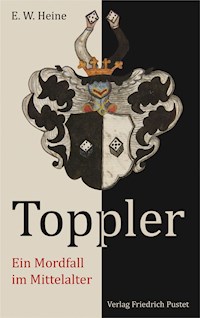Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Geschichte des Christentums wurde mit Blut geschrieben: Der historische Roman "Die Raben von Carcassonne" von E.W. Heine als eBook bei dotbooks. Es ist ein grausames Schauspiel: Zu Beginn des 13. Jahrhunderts strömen die Menschen zusammen, wenn Ketzer hingerichtet werden. Gnadenlos verfolgt die Kirche alle, die gegen ihre Gesetze verstoßen – und doch scheint nichts die Katharer aufhalten zu können, deren Lehre sich wie ein Steppenbrand ausbereitet. Papst Georg IX. entsendet daher einen Spion nach Südfrankreich: Die Nonne Thekla soll die Anführer der Andersgläubigen finden und verraten. Von all dem ahnt Leander nichts, der Henker von Carcassonne. Er versteht sein blutiges Handwerk wie kein zweiter; heimlich erspart er den Totgeweihten dabei die grausamen Schmerzen. Doch vor allem hütet Leander ein ungeheuerliches Geheimnis … Glaube und Hoffnung, Brutalität und kostbare Momente des Glücks – ein kraftvoller Roman von Bestsellerautor E.W. Heine: "Für alle, die sich nicht vor Provokantem fürchten und poetische Sprache lieben." BUCHKULTUR Jetzt als eBook kaufen und genießen: "Die Raben von Carcassonne" von E.W. Heine. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 425
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Es ist ein grausames Schauspiel: Zu Beginn des 13. Jahrhunderts strömen die Menschen zusammen, wenn Ketzer hingerichtet werden. Gnadenlos verfolgt die Kirche alle, die gegen ihre Gesetze verstoßen – und doch scheint nichts die Katharer aufhalten zu können, deren Lehre sich wie ein Steppenbrand ausbereitet. Papst Georg IX. entsendet daher einen Spion nach Südfrankreich: Die Nonne Thekla soll die Anführer der Andersgläubigen finden und verraten. Von all dem ahnt Leander nichts, der Henker von Carcassonne. Er versteht sein blutiges Handwerk wie kein zweiter; heimlich erspart er den Totgeweihten dabei die grausamen Schmerzen. Doch vor allem hütet Leander ein ungeheuerliches Geheimnis …
Glaube und Hoffnung, Brutalität und kostbare Momente des Glücks – ein kraftvoller Roman von Bestsellerautor E.W. Heine: „Für alle, die sich nicht vor Provokantem fürchten und poetische Sprache lieben.“ BUCHKULTUR
Über den Autor:
E.W. Heine (1935–2023) wurde in Berlin geboren und studierte Architektur und Stadtplanung. Er verbrachte viele Jahre in Südafrika, wo er ein Architekturbüro unterhielt und verschiedene internationale Projekte realisierte. Parallel dazu widmete sich E.W. Heine seiner anderen Leidenschaft, dem Schreiben: Aus seiner Feder stammen neben dem Bestseller »Das Halsband der Taube« unter anderem Drehbücher, Sachbücher, historische Romane und die makabren Kille-Kille-Geschichten, die Kultstatus erreichten.
Zu E.W. Heines bekanntesten Werken gehört die Trilogie, in der er sich mit den großen Weltreligionen Islam, Judentum und Christentum auseinandersetzt: »Das Halsband der Taube«, »Der Flug des Feuervogels« und »Die Raben von Carcassonne«. Außerdem veröffentlichte er bei dotbooks den Roman »Das Geheimnis der Hexe«, auch bekannt unter dem Titel »Papavera – Der Ring des Kreuzritters«.
***
eBook-Neuausgabe Juni 2016, April 2024
Copyright © der Originalausgabe 2003 beim C. Bertelsmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2016 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz unter Verwendung von Shutterstock/Andrey_Kuzmin, 100ker, RODINA OLENA, RealArtStudio, StockSmartStart
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)
ISBN 978-3-98690-945-1
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die Raben von Carcassonne«an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
E. W. Heine
Die Raben von Carcassonne
Historischer Roman - »Die Säulen der Welt«-Saga 3
dotbooks.
Die Katharer glauben, oder vielmehr haben geglaubt,
denn sie wurden ausgerottet, die Schöpfung sei nicht das Werk Gottes, sondern des Teufels.
Wenn ich religiös wäre, wäre ich Katharer.
Frei nach Alfred Andersch
Kapitel 1
In der Nacht hatte es geregnet. In den schlammigen Pfützen auf dem Platz vor der Basilika Saint Nazaire spiegelten sich die Türme des Gotteshauses. Von allen Dächern tropfte die Nässe, rann über zerfurchtes Gemäuer und altersrissige Fassaden, nährte rostige Rinnen und versickerte in ungepflasterten Gassen.
Im ersten Morgengrauen hatten sie auf einem Ochsengespann die Balken für das Gerüst herbeigekarrt, auf dem der Scheiterhaufen brennen sollte. Nun waren die Knechte des Henkers damit beschäftigt, sie zusammenzunageln. Dumpf und drohend wie Trommelschlag vor der Schlacht klang ihr Hämmern durch das noch schlafende Carcassonne. Die Raben vor dem Tour de Prison beobachteten sie gespannt, so als wüssten sie, dass es hier bald Fleisch geben würde. Die Stadt erwartete ihr Opfer.
Wäre sein Name im Taufregister verzeichnet gewesen, so hätte dort Leander Luis Latour gestanden. Da sich aber kein Priester gefunden hatte, der bereit gewesen wäre, den Bastard des Henkers zu taufen, so war seine irdische Existenz in den Kirchenbüchern von Carcassonne nicht dokumentiert worden.
Er hieß Leander, aber niemand nannte ihn so. So wie sich keiner erdreistet hätte, seinen Bischof oder König mit Taufnamen anzusprechen, so wie man davor zurückschreckte, ihm ins Angesicht zu blicken oder ihm gar die Hand zu geben. Er war namenlos, namenlos wie der Allmächtige. Er stand außerhalb der Gesetze, denn er war der Einzige, der eigenhändig ungestraft töten durfte. Er brach einem Menschen das Genick und besuchte anschließend die heilige Messe in der Basilika, nicht durch das Kirchenportal wie alle anderen, sondern durch die eigens für ihn errichtete Henkerspforte, um sich auf dem für ihn frei gehaltenen Platz niederzulassen, ein Vorrecht, das sonst nur dem hohen Adel eingeräumt wurde. Wenn er durch die Menge ging, wichen die Menschen respektvoll zurück, wie einst das Meer vor Moses und dem auserwählten Volk.
Sie liebten ihn nicht, sie fürchteten ihn. Aber war nicht auch ihre Gottesfurcht größer als ihre Liebe zum Allmächtigen?
Der Henker von Carcassonne stand vor der eisenbeschlagenen Kerkertür im Kellergeschoss des Henkerturms und betrachtete die Verurteilte. Er beobachtete sie mit der wachen Sorgfalt, mit der Eulenvögel ihre Opfer beäugen, bevor sie ihnen den Garaus machen.
Der Sehschlitz oberhalb des Türschlosses war so geschickt angebracht, dass die Gefangenen ihn nicht wahrzunehmen vermochten. Dennoch schien die Frau die Blicke des Henkers zu spüren. Sie verdeckte ihr Gesicht mit den Handflächen wie ein Kind, das sich schämt. Nach einer Weile erhob sie sich und begann umherzulaufen, mit müden, schlurfenden Schritten wie einer, der einen langen beschwerlichen Fußweg hinter sich gebracht hat.
Mein Gott, wie mager diese Vandalmonde de Castanier war! Jetzt blieb sie stehen. Ihre Augen suchten das Licht, das über ihr durch eine vergitterte Maueröffnung fiel. Das kalte Licht des neuen Tages erhellte ihre Gesichtszüge. Sie waren von gespenstischer Blässe. Das Haar hing ihr wirr bis über die Augen. Das blutige Kinn, die aufgeplatzte Oberlippe – der Henker nahm das alles zur Kenntnis wie ein Maler, der das Bild dieser todgeweihten Frau in sich aufnehmen will, um es zu einem Kunstwerk zu verarbeiten. Nun, auch der Henker war ein Künstler. Eine gute Hinrichtung erforderte allerhöchste Kunstfertigkeit, Beobachtungsgabe und anatomische Studien.
Körpergewicht, Alter und die richtige Einschätzung des Knochenbaus bestimmten die Länge des Galgenstricks. Um einem Mann das Genick zu brechen, musste die Fallhöhe sorgfältig berechnet werden. War sie zu kurz, wurde der Ärmste stranguliert. Zappelnd wie ein Fisch an der Angel hing er dann am Galgenholz. War der Strick zu lang oder der Mann zu schwer, so wurde ihm mit einem Ruck der Kopf abgerissen.
Noch schwieriger verhielt es sich mit der Enthauptung. Es bedurfte höchster Zielgenauigkeit und eines kräftigen Hiebes, um die Nackenwirbel mit einem Schlag zu durchtrennen.
Mit Recht wurde die Arbeit des Scharfrichters höher honoriert als die des Stadtmedikus. Der brauchte dem kranken Körper nur zu helfen, mit dem Leiden allein fertig zu werden. Ein zum Tode Verurteilter aber wehrte sich mit jeder Faser seines Leibes gegen seine Vernichtung. Da gab es keine natürliche Kraft, die dem Henker geholfen hätte. Er musste seine verantwortungsvolle Aufgabe allein bewältigen, vor den Augen der ganzen Stadt.
Aber diesem Weib hier würde er nicht den Kopf abschlagen. Sie würde auch nicht ihre Seele am Galgen aushauchen, sie würde wie alle Hexen und Häretiker brennen.
Die Gefangene stand jetzt mit erhobenen Händen unter dem Fensterloch, als wollte sie nach dem Licht greifen. Die Morgensonne färbte ihre Finger blutrot. Ihre Lippen bewegten sich wie im Gebet.
»Gott sei deiner Seele gnädig«, sagte Leander Latour, »niemand sonst wird es sein.«
Sie hörte seine Worte nicht. Die Glocken der Basilika Saint Nazaire, die zur Frühmesse riefen, verschluckten sie.
***
Die Hinrichtungen erfolgten immer in den frühen Morgenstunden, nicht aber die Verbrennungen. Sie begannen erst nach Sonnenuntergang, wenn die Flammen vor dem nachtschwarzen Himmel am wirkungsvollsten in Erscheinung traten.
Leander Latour hatte Zeit.
Kapitel 2
Bevor die Nachmittagssonne hinter der hohen Stadtmauer versank, stieg Leander hinab in den unterirdischen Kerker, um mit der Verurteilten zu sprechen. Nirgendwo sonst war man dem Geheimnis Mensch so nahe wie auf der Schwelle zwischen Tod und Leben. Alle Verstellung, falsche Hoffnung und Selbstbetrug waren abgefallen wie Gewänder. Übrig blieb der nackte Mensch, häufig hässlich, erschreckend abstoßend, bisweilen bewundernswert schön – eine wahrhafte Entblößung.
Was ist das Leben, was der Tod? Auf der Grenzlinie zwischen beiden Welten offenbaren sich die letzten Dinge deutlicher als anderswo, weil wir den wahren Wert der Dinge erst erkennen, wenn sie uns entgleiten. Die Farben des Paradieses, der Jugend und der Liebe – nie leuchten sie kraftvoller als nach ihrem Verlust.
Als Leander den Kerker betrat, hockte die Frau auf dem Strohsack, der den Gefangenen als Schlafstelle diente. Die brennende Fackel in der Faust, ließ sich Leander auf der Bank an der gegenüberliegenden Zellenwand nieder und fragte: »Du weißt, wer ich bin?«
»Du bist mein Arzt.«
»Dein Arzt?« Leander glaubte, nicht recht verstanden zu haben. »Ich bin der Henker.«
»Das ist dasselbe«, sagte die Frau. »Das Leben ist eine Krankheit. Du wirst mich davon befreien.«
Leander betrachtete sie. Aus der Nähe wirkte sie viel jünger, aber welk und matt, ein Blütenzweig in einem Gefäß ohne Wasser. Aber die Ausgezehrtheit ihres hageren Leibes hatte keine Gewalt über das Feuer in ihren Augen – Augen so tief wie Festungsbrunnen und so lebhaft wie Funkenflug. Sie betrachtete ihn ohne Furcht.
Er fragte: »Hast du keine Angst vor dem Sterben?«
»Das kann so schwierig nicht sein. Denn bisher hat es noch jeder geschafft. Schlimmer als das Sterben ist für die meisten Menschen die Angst vor dem Sterben. Dabei ist es viel leichter als Gebären.«
»Woher willst du das wissen?«
»Nun, sterben kann jeder ohne Ausnahme. Gebären aber ist eine schwierige Kunst, und nicht jede Geburt verläuft weiß Gott erfolgreich.«
»Warum wurdest du verurteilt?«
»Weil ich eine Frau bin.«
»Noch nie wurde jemand verurteilt, weil er eine Frau ist.«
»Die erste Sünde kam von einer Frau, und alle müssen wir um ihretwillen sterben. Sie hat das Menschengeschlecht zugrunde gerichtet. Weib, du bist die Pforte zur Hölle. Wenn das keine Verurteilung ist, was ist es dann?«
»Wo steht das geschrieben?«
»Im Alten Testament und bei Tertullian.«
»Du bist eine Hexe?«
»Ich bin eine Katharerin.«
»Man sagt, euch Katharer graut es nicht einmal vor dem Feuer.«
Sie betrachtete ihren Henker und fragte: »Graut dir nicht vor dem, was du tust?«
»Ich erfülle einen Auftrag. Schuld verlangt Sühne.«
»Sühne von wem?«
»Von allen, die da schuldig sind.«
»Von allen, die schuldig sind? Du irrst dich. Wenn alle, die die Gesetze brechen, schuldig wären, so müssten alle Könige und Kardinäle verbrannt werden, alle Fürsten, Feldherren und ein Gutteil des Volkes dazu.«
Sie erhob sich, so als könnte das, was sie zu sagen hatte, nur im Stehen gesagt werden: »In allen alten Religionen werden der Gottheit Opfer dargebracht. Ein Schaf wird abgestochen, damit die Götter einem Sünder vergeben. Stiere müssen auf brennenden Opferaltären sterben, damit der Allmächtige einem Fürsten zum Sieg verhilft. Unschuldige Geschöpfe müssen leiden, um die Götter gnädig zu stimmen oder, richtiger: um sie zu bestechen. In unserer Rechtsprechung ist es nicht besser. Ein Dieb wird am Galgen geopfert, um Gott zu versöhnen: Schau, in unserer Gesellschaft herrschen Recht und Ordnung. Wir halten die göttlichen Gebote ein. Zum Beweis dafür opfern wir dir einen von uns, einen in Vertretung für all die anderen, die sich ungestraft weiter an dem Gesetz vergehen. Dabei spielt es keine Rolle, ob einer schuldig ist oder nicht. Die Rolle des Unschuldslammes schützt ihn nicht. Im Gegenteil, gerade das Lamm ist das ideale Opfertier. Ausschlaggebend sind nicht Schuld oder Unschuld des Geopferten, sondern Schuld und Reue der Opfernden. Schuld und Unschuld liegen in ihrem Ermessen. Sie bestimmen, wer gut und wer böse ist.«
Leander schüttelte den Kopf, wollte widersprechen, doch sie ließ sich nicht beirren. »Mord ist ein Verbrechen, so sollte man meinen. Liebe ist gut. Wenn ich aber im Auftrag der Priester töte, so ist das lobenswert. Heiliger Krieg! Sieg der Gerechtigkeit! Liebe ich jedoch, was meinen stets opferbereiten Herren missfällt, meines Nachbarn Weib oder einen anderen Gott, so bin ich böse, ganz gleich, wie viel Gutes ich getan habe.«
Sie schlug sich vor die Brust und sagte: »Ich werde nicht verbrannt, weil ich schuldig bin, sondern weil ich nicht so bin wie meine Richter, ein Schaf unter Wölfen. Deshalb muss ich brennen.«
Das Gespräch hatte sie erregt. Sie begann wieder, hin und her zu laufen, blieb einen Schritt vor Leander stehen und sagte: »Wenn es wirklich so etwas wie Hexerei und Teufelswerk gibt, dann ist der eher ein Teufel, der den Scheiterhaufen anzündet, als der, den man verbrennt.«
Leander holte aus den Taschen seiner ledernen Weste eine Phiole hervor, nicht größer als die Länge eines Fingers. »Ich habe hier eine Arznei aus Wasserschierling und Bilsenkraut. Sie macht die Glieder gefühllos. Beginnend bei Händen und Füßen, steigt die Taubheit zum Herzen empor. Es ist ein gutes Gift. Schon Sokrates nahm es. Du wirst die Glut des Scheiterhaufens nicht spüren. Trink es, jetzt gleich. Es dauert, bevor die Wirkung einsetzt.«
»Warum tust du das für mich?«
»Ich gebe es allen Verurteilten.«
»Ist das erlaubt?«
»Nein.«
»Warum tust du es dann?«
Als Leander schwieg, sagte sie: »Mitleid gilt unter den Katharern als Königin aller Tugenden. Wir essen kein Fleisch aus Mitleid mit den Tieren. Unser Verbot des Mundes lautet: Keine fleischliche Nahrung, keine Lügen! Wir dürfen nicht einmal schwören. Unser Verbot der Hand verlangt absolute Gewaltlosigkeit gegenüber allen und jedem.«
Das laute Schlagen der Kirchenglocken unterbrach ihr Gespräch.
»Die Zeit drängt. Du musst den Schierlingssaft nehmen«, sagte Leander. »Komm!«
Die Frau schüttelte ihren zerzausten Haarschopf.
»Was soll das heißen? Noch keiner hat mein Angebot abgelehnt. Nimm es! Es wird dir helfen.«
»Es geht nicht.«
»Warum nicht?«
»Das Consolament.«
»Consolament. Was ist das?«
»Die verbleibende Zeit ist zu kurz, um es dir zu erklären.«
»Ich will es dennoch wissen.«
Sie strich sich das Haar aus der Stirn: »Ein Schwerkranker oder Sterbender, der das Consolamentum erhält, erfährt die Gnade der letzten Reinheit. Der so Getröstete ist reingewaschen und frei von aller Schuld. Er darf im Angesicht der ewigen Seligkeit keinerlei Nahrung mehr zu sich nehmen. Mir ist das Consolamentum vor meiner Festnahme zuteilgeworden. Ich stehe unter Endura.«
»Endura?«
»Reinigung durch Verzicht.«
»Das ist Selbstmord!«
Die Frau schwieg. Ihre Augen schienen im Halbdunkel der Zelle zu leuchten.
»Der Gekreuzigte steh dir bei«, sagte Leander.
»Nein, nicht der«, widersprach sie.
»Glaubst du nicht an Gott?«
»Natürlich glaube ich an ihn. Wie kann es anders sein? Aber ich glaube nicht an den Gekreuzigten.«
»Der Schöpfer von allem, was ist …«
»Der ist kein anderer als der Teufel in Person.«
»Weib, du versündigst dich im Angesicht des Todes. Wie willst du deinem Schöpfer gegenübertreten?«
»Er ist nicht der Schöpfer von allem, was da ist. Er ist der Schöpfer von allem, was da nicht ist.«
Den letzten Satz sprach sie so leise, als redete sie mit sich selbst.
»… von allem, was da nicht ist.« Leander wiederholte ihre Worte und dachte: Jetzt hat sie den Verstand verloren. Er sagte: »Du redest wirres Zeug.«
»Tue ich das?« Ein trotziges Lächeln umspielte ihre Lippen: »Glaubst du allen Ernstes, dass diese elende Welt voller Leid, Bosheit und Ungerechtigkeit das Werk eines Schöpfers ist, der selbst Inbegriff der Vollkommenheit ist? Wie kann das sein? Nein, glaube mir, diese irdische Welt ist das Werk des Bösen. Er ist der Schöpfer von allem, was da ist. Er ist die grausame Gottheit der Genesis und der Gesetzestafeln des Alten Testaments, im Gegensatz zur körperlichen Welt des Lichts und des Geistes. Gott ist frei von aller irdischer Stofflichkeit. Er ist der Gott der Güte und der Liebe.«
»Du meinst, es gibt zwei Götter? Wie kann das sein? Lautet nicht das erste Gebot: Es gibt nur einen Gott.«
»Du irrst. Es heißt nicht ›Es gibt nur einen Gott‹, sondern ›Du sollst nicht andere Götter haben neben mir‹. Das kann doch nur heißen, dass es noch andere gibt. Und die gibt es: die Gottheit des Bösen – Satan. Er ist nicht der untertänige Diener Gottes, wie manche naiven Seelen glauben. Warum sollte ein gütiger Gott sich solch eines grausamen Knechtes bedienen?«
»Um die Menschen auf die Probe zu stellen, um sie zu prüfen, so wie man Gold prüft.«
»Du meinst, um die Sünder von den Frommen zu scheiden? Nach der Lehre Roms sind alle Nachkommen Adams Sünder, ohne Rücksicht auf das, was sie tun. Böse ist nicht Mangel an Gut, wie der heilige Augustinus glaubte. Das Böse ist eine Macht, die von Anfang an existent war. Denn die Freiheit hätte keinen Sinn, wenn das Übel nicht schon als Alternative da gewesen wäre, um sich als freie Wahl anzubieten. Nichts beginnt ohne Ursache.«
»Und wie sieht deiner Meinung nach der gute Gott aus?«, fragte Leander.
»Er hat kein Aussehen. Wir können von ihm nicht sagen, wie er ist, sondern nur, wie er nicht ist. Er ist unsichtbar, unbegreiflich, unerforschlich. Jede sinnliche Vorstellung macht aus Gott einen Abgott. Wäre Gott begreiflich, könnte er nicht Gott sein. Er erschuf alles, aber die sichtbare Welt ist nicht sein Werk. Alles Materielle ist unrein, weil es unserem Geist ein Kerker ist. Wahrer Glaube ist innerlich und gegenstandslos. Gotteshäuser sind Steinhaufen. Das Kreuz ist Menschenwerk. Die kirchliche Hierarchie taugt zu nichts.«
»Du sprichst wie eine Ketzerin«, sagte Leander.
Die Frau überhörte seinen Einwand. »Das Paradies bezeichnet den körperlosen Zustand der Schöpfung. Der Sündenfall, das ist die Fleischwerdung der Geistwesen. Nicht die geschlechtliche Vereinigung, wie viele Pfaffen glauben, vertrieb uns aus dem Paradies, sondern die darauf folgende Geburt in die Stofflichkeit unserer Leiber. Mit ihr begann alles Leid, alle Schuldfähigkeit und der Tod.«
»In der Bibel steht es aber anders«, widersprach Leander. »Dort steht, dass Gott die Dinge erschuf, so wie sie sind.«
»Du irrst. Es heißt: Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Alle Dinge sind durch das Wort geworden. Was aber so gemacht wurde, in dem war Leben. So steht es bei Johannes.«
»Du sprichst wie eine Priesterin«, sagte Leander.
»Bei uns Katharern gibt es keine Priester. Ich bin eine Parfait.«
»Was ist das?«
»Der Parfait ist mehr als ein Priester. Er ist nicht nur Mittler zwischen Gott und den Menschen. Der Parfait lebt als Eingeweihter bereits in einer anderen Welt.«
Überzeugungskraft und Sendungsbewusstsein gingen von der Frau aus, so als bewegte sie sich wirklich in einer anderen Welt.
Leander sagte: »Der Allmächtige sei dir gnädig.«
»Gott ist nicht allmächtig. Denn er ist nicht mit der Allmacht ausgestattet, auch Übel zu erzeugen. Er ist ganz allein mächtig in seiner Güte. Urgrund und Ursache von allem Guten, kann er niemals Teil des Bösen sein. Die Schöpfung ist unvollendet, weil Gott die leidvolle Bosheit der materiellen Existenz erst an der Schwelle der Ewigkeit auslöschen kann. Erst dann wird der paradiesische Urzustand wiederhergestellt sein.«
»Wenn das stimmt, was du da sagst«, meinte Leander, »so wäre der Tod nichts weiter als ein Wechsel vom Übel zum Guten.«
»So ist es«, sagte die Frau. »Und nun weißt du, warum ich dich als meinen Medikus begrüßt habe.«
Inzwischen hatte sich ein Gewitter über dem Tal der Aude zusammengeballt. Wolken verdunkelten den Himmel und tauchten das Verlies in düsteres Halbdunkel. Ein Blitz zuckte auf. Die Fackel entglitt der Faust, fiel zu Boden und verlosch beinahe. Ein wilder Schrei. Die Gefangene war aufgesprungen. Ein zweiter Blitz zerriss die Finsternis.
»Heiliger Gral«, stöhnte sie. »Wie kann das sein! Nein!«
Sie starrte auf seine Stirn, als leuchtete dort ein Kainsmal oder ein Heiligenschein. Ihre Schultern zuckten vor wildem Schmerz. Oder war es Freude?
Sie sank vor Leander auf die Knie, umfasste seine Füße.
Leander wollte sich befreien, versuchte, sie abzustreifen. Dabei verlor er das Gleichgewicht und fiel auf die Frau.
»Bist du von Sinnen? Das ist doch bloß ein Gewitter.«
Er wollte sich aufraffen, aber sie klammerte sich an ihn wie eine Ertrinkende. Die fast erloschene Fackel war wieder aufgeflammt. Sie rückte mit ihrem Gesicht ganz nah an das seine, als wollte sie ihm in die Augen sehen.
»Du bist … o mein Gott, du bist …«
Leander stieß sie von sich: »Was bin ich?«
»Ein Henker von seinem Blut – wie kann das sein?«
»Wovon redest du? Hör auf mit diesem Unsinn!«
Sie betrachtete ihn liebevoll und sagte: »Ich bin nicht verrückt, obwohl es zum Verrücktwerden ist.«
Ein Hustenanfall schüttelte sie: »Mir fehlt die Zeit, es dir zu erklären. Das Erbe der Merowinger. Ein Schatz von unerhörtem Ausmaß. Le sang de Saint. Der Heilige Gral. Du hältst ihn in deinen Händen. Baphomet queribus.«
Die letzten Worte hatte sie mehr geflüstert als gesprochen. Sie war ganz offensichtlich am Ende ihrer Kräfte. »Mir ist so kalt. Ich sehne mich nach dem Feuer. Segne mich«, flüsterte sie, »bitte, segne mich.«
Leander legte ihr die Hände auf den Scheitel, um sie zu beruhigen.
»Ja, so ist es gut«, hauchte sie. Sie griff sich ins Haar und holte ein Amulett hervor, eine Gemme, groß wie eine Bohne, befestigt an einem dünnen goldenen Kettchen. »Für dich. Trag es. Es wird dich beschützen. Mein Obolus für die Fahrt über den Styx.«
Kapitel 3
Die Sonne war schon hinter den fernen Rebhügeln versunken. Feurig spiegelte sich das Abendrot im Fluss bei der steinernen Brücke. Über den Pyrenäen türmten sich die Regenwolken, schwarz und bedrohlich. Auf dem Platz vor der Basilika drängten sich die Herbeigelaufenen, Kopf an Kopf, Schulter an Schulter bis tief in die angrenzenden Gassen. Seit dem ersten Ave-Läuten strömten sie in die Stadt. In ihrer Mitte wie ein Altar der Scheiterhaufen, noch verhüllt von Zeltplanen, mit denen die Henkersknechte die Regennässe von dem trockenen Reisig ferngehalten hatten.
Die kantigen Holzscheite zeichneten sich unter dem grauen Stoff ab wie das knochige Gerippe eines riesigen Tieres, ein Höllenhund oder Drachen, der darauf wartet, einen von ihnen zu verschlingen.
Leander hörte das alles, bevor er es sah. So wie der Wind in den Bäumen oder der Wellenschlag an steiniger Küste, so hatte auch die Masse ihr eigenes, unverkennbares Geräusch: ein brodelndes Stimmengewirr, böse, bedrohlich, unberechenbar wie ein Heuschreckenschwarm. Das waren nicht mehr einzelne Menschen – der Gerber aus der Rue Saint Michel oder der Gürtelschneider von Corbieres. Das blutige Schauspiel nahm ihnen alle Individualität, verschmolz sie zu einem Geschöpf. Wenn sie mit fiebrigen Augen mit ansahen, wie er einem von ihnen den Kopf abhackte, so entrang sich aus Hunderten von Kehlen ein einziger Schrei, Urschrei der Masse. Kein Priester, nicht einmal der Papst, schlug die Menge so sehr in seinen Bann wie der Carnifex im Augenblick der Menschenschlachtung: Siehe, das ist euer Blut, das vergossen wurde zur Sühne für euch alle!
Leander hatte das Blutkleid aus rotem Leinentuch angelegt, das Messgewand des Scharfrichters. Er hatte den Gürtel mit dem Schwert umgebunden, das er auch trug, wenn es nicht zum Einsatz gelangte. Es war sein Marschallstab und Zepter. Zuletzt zog er sich die Kappe aus Katzenleder über die Ohren. Caput mortuum. Sie bedeckte sein Gesicht bis zur Nasenwurzel. Die Augen lagen jetzt hinter zwei Sehschlitzen. Nur der Mund und die Nasenlöcher waren zu erkennen. Das Gesicht ohne Augen hatte nichts Menschliches mehr. Wie konnte es anders sein. Ist nicht aller Tod ein Maskentanz!
Für einen Augenblick glaubte er, die Zelle sei leer. Dann sah er sie. Sie lag auf dem kalten Steinboden mit dem Gesicht zur Wand.
»Vandalmonde de Castanier, dein letzter Gang ist gekommen.«
Als sie sich nicht rührte, beugte er sich mit brennender Fackel über sie. Sie schien fest zu schlafen. Lächelte sie, oder war das nur das Spiel der Flammen auf ihren Lippen! Er berührte ihre Schulter und dachte: Welch ein Weib! Sie schläft wie in Abrahams Schoß, während ihr Scheiterhaufen schon brennt.
»Komm, steh auf! Wir müssen gehen.«
Er ergriff ihre Hand und fuhr erschrocken zurück. Es war die Hand einer Toten, kalt und starr. Der Spiegelscherben, den er ihr vor den Mund hielt, beschlug nicht mehr. Ihr Atem war erloschen. Es gab keinen Zweifel: Sie war tot.
Er hob sie auf. Sie war so leicht wie ein aus dem Nest gefallener kleiner Vogel. Durch den Stoff des Gewandes fühlte er ihre Rippen und Wirbelknochen.
Das Consolament! Sie hatte sich zu Tode gehungert.
Er strich ihr das Haar aus der Stirn. Der Tod hatte ihr nichts von der Würde genommen, die sie umgab wie eine Aura. Wie hatte sie gesagt: Ich bin eine Parfait, eine Reine.
Leander betrachtete sie lange. Sie war schön. Tote Menschen waren zumeist abstoßend hässlich: die Gesichter zur Fratze verzerrt, die Münder offen, die Augen verdreht, die Leiber von Kot und Urin besudelt. Völlig anders diese Frau. Sie erinnerte ihn an einen toten Vogel. Tiere besitzen auch im Sterben Würde. Der Schritt vom Leben zum Tod ist bei ihnen nicht so groß wie beim Menschen. Sie sind mehr Bestandteil der Natur als wir. Sie haben noch Zugang zu dem verlorenen Paradies, so wie diese Frau.
Als Leander hinaustrat auf den Platz vor der Basilika, verebbte das Stimmengewirr. Es schien, als hielte die Menge den Atem an. Dergleichen hatte niemand erwartet noch jemals gesehen. Oben auf der Freitreppe, die den Justizturm mit dem tieferliegenden Platz verband, stand zwischen zwei Fackelträgern der Unaussprechliche, bekleidet mit den Insignien der Menschenschlachtung. Daneben, auch mit Gesichtsmaske, sein Knecht Bero, ein Hüne von Mensch, der seinen Herrn um eine Elle überragte.
Auf seinen Armen trug er eine Frau. Sie lag da, leicht und entspannt wie ein schlafendes Kind. Ihr Haar hatte sich aufgelöst und reichte bis zum Boden.
Leander stieg die Stufen hinab. Die Trommler begannen zu schlagen. Gleichzeitig ertönte das Arme-Sünder-Glöckchen von Saint Nazaire. Der Lärm löste die Gaffer aus ihrer Erstarrung. Leander und Bero hatten den Platz zur Hälfte überquert, da wurden die ersten Protestrufe laut.
»Hat die Hexe keine Beine? Dann macht ihr welche!«
»Holt sie aus ihrer Ohnmacht. Wir wollen sie winseln hören.«
»Kaltes Wasser her. Die verstellt sich doch bloß.«
Bero trug sie zu dem Holzstoß auf dem Blutgerüst, neben dem die Vertreter der Kirche, des Rates und der Adelsfamilien bereits warteten. Auch sie blickten verstört auf das seltsame Schauspiel, und aus ihren Gesichtern und Gebärden sprach Arger: Was in drei Teufels Namen ging hier vor sich?
Leander winkte den Stadtmedikus herbei. Der untersuchte die Leblose und meinte: »Der könnt ihr das Leben nicht mehr nehmen.«
Die Priester schlugen das Kreuz über sie. Dann legte Bero die Tote auf den Scheiterhaufen. Sie lag da wie ein Opfertier. Das Prasseln der Flammen übertönte das Stimmengewirr der Menge, die aus ihrer Enttäuschung kein Hehl machte. Die Leute waren von weit her zusammengeströmt, um eine Hinrichtung zu erleben, und waren nun Zeugen einer Leichenverbrennung.
Zum Ärgernis aller begann es nun auch noch zu regnen, so als wollte der Himmel das Feuer löschen, in dem die Reine verbrannte.
Der flackernde Schein der Flammen leuchtete noch lange und schien bis in den Garten hinter dem Henkersturm. Dort kauerte eine gespenstische Gestalt im Gras, die Arme um den Kopf geschlungen, als verursachte ihr das Licht Schmerz. Der Feuerschein fiel auf eine lederne Maske. Jeder kannte sie in der Stadt: Bero, der Gehilfe des Henkers, das Phantom, der Einzige, der Leander nahestand. Bei seinem Anblick erstarrten die Menschen wie Mäuse im Angesicht der Schlange. Schaurig, erschreckend schaurig war dieser Unmensch. Das Gesicht zur starren Maske vernarbt, die Augen ohne Wimpern und Brauen, viel zu groß, weil auch Teile der Lider fehlten; die Lippen schorfig und dünn, so dünn, dass die Schneidezähne wie bei einer wütenden Ratte hervorbleckten; die Ohren verstümmelt; die Wangen blaurot, wie von Pocken zerfressen. Dabei war es das Feuer, das ihn so grausam entstellt hatte, so grausam, dass er in der Öffentlichkeit eine Ledermaske trug, was ihn noch unheimlicher erscheinen ließ. Wenn er durch eine Gasse lief, schlossen die Menschen erschrocken Fenster und Türen. Die Kinder, die für gewöhnlich ihren Spaß daran fanden, die Krüppel der Stadt zu verhöhnen, rannten kreischend davon, als wäre der Leibhaftige hinter ihnen her. In Wahrheit war Bero ein gutmütiger Riese von über sechs Fuß Körperlänge, mit breiten Schultern und großen Händen voller Brandflecken. Was ihn vollends unmenschlich erscheinen ließ, war seine Sprachlosigkeit. Er war stumm wie ein Tier, gab aber Laute von sich, die wie Bärengebrumm klangen oder wie das freudige Quieken von Ferkeln oder wie Hundehecheln.
Die Leute in der Stadt erzählten sich, die Kreuzritter hätten ihm die Zunge abgeschnitten, bevor sie ihn auf den Scheiterhaufen schickten. Vielleicht hatte ihm aber auch die Glut oder das Grauen die Sprache genommen.
Leanders Vater hatte Bero von einem Ritt aus Minerve mitgebracht. Seitdem hing das Phantom, wie die Bürger der Stadt ihn nannten, an seinem Meister wie ein Hund an seinem Herrn. Obwohl er selber keine Worte formen konnte, verstand er dennoch die der anderen. Und Leander, dem die Sprache der Tiere nicht fremd war, wusste stets, was sein stummer Begleiter wollte.
Sie ergänzten sich wie zwei Hände an einem Leib, voller Muskelkraft der eine, der andere überlegen durch Geschicklichkeit.
Bero wohnte in der Kammer über dem Pferdestall. Er schien dort nichts zu vermissen. Seine Nahrung holte er sich vom Markt. Das wenige, das er benötigte, erhielt er dort ohne Bezahlung. Kein Händler hätte gewagt, ihn nach Geld zu fragen. Man betrachtete seine Versorgung als Opfergabe, so wie man der Heiligen Jungfrau Blumen auf den Altar stellte.
»Er ist nicht nur stumm wie ein Tier, er frisst auch wie ein Tier«, erzählten die Marktfrauen. Er rührte grundsätzlich keine gekochten, gebackenen oder gebratenen Speisen an. Zu groß war seine Abneigung vor dem Feuer, das ihn fast verschluckt hätte. Selbst Eier verspeiste er roh. Am liebsten aß er, was auch die Pferde bekamen: in Wasser aufgeweichten Dinkel- und Roggenschrot.
Da auch seine innere Nase vernarbt war, schlief er mit weit geöffnetem Mund und schnarchte dabei so laut, dass es durch alle Wände bis auf die Straße drang.
Wenn er wach war, starrte er mit seinen großen Augen hinter den ledernen Sehschlitzen ins Leere. Dabei bewegte er seinen Oberkörper hin und her wie ein gefangener Bär hinter den Gitterstäben seines Käfigs.
Zurückgekehrt in seinen Wohnturm an der äußeren Stadtmauer, öffnete Leander die Ebenholztruhe, die ihm vom Großvater über den Vater vererbt worden war, und holte das Richtschwert hervor. Seine Schneide war blank wie Spiegelglas. Das bartlose Gesicht eines blassen jungen Menschen blickte ihm aus kritisch blinzelnden Augen entgegen. Waren das die Augen eines Menschen, der in den Abrechnungsbüchern der Stadt unter der Bezeichnung Carnifex geführt wurde, was aus dem Lateinischen wörtlich übersetzt »Der Fleischmacher« heißt? Er hatte mehr Ähnlichkeit mit einem Gelehrten oder einem Barden als mit einem Menschenschlächter. Da war mehr Gemeinsamkeit mit den Heiligen und himmlischen Heerscharen auf dem Altarbild in der Stadtkirche als mit den Teufeln, die die Sünder mit glühendem Eisen peinigten. Nur die blauen Augen erinnerten an den Vater, an Luis Latour.
Der hatte das Urbild eines Henkers verkörpert.
Den Verurteilten pflegte er zu sagen: »So wie eure Mutter bei der Geburt dabei war, so werde ich bei eurem Tod dabei sein.«
Nach der Hinrichtung von vier jungen Männern hatte Leander ihn gefragt, wie er so gefasst und so heiteren Sinnes so viel junge Leben auslöschen könne. Und der Alte hatte geantwortet: »Pah, in einer einzigen Mondnacht wird in dieser Stadt mehr Leben gezeugt, als wir heute ins Jenseits befördert haben.«
Auf die Frage, was die Jungen denn verbrochen hätten, gab er zur Antwort: »Das weiß ich nicht. Ich bin nicht ihr Richter, sondern ihr Hinrichter. Ich helfe ihnen aus dem irdischen Leben, so wie der Pfaffe ihnen ins ewige hilft. Unsere Arbeit unterscheidet sich nur wenig von der Arbeit der Bonne mère, der Hebamme. In beiden Fällen handelt es sich um Geburtshilfe von einer Daseinsform in eine andere. Gebären und Sterben sind wichtige Angelegenheiten am oberen und unteren Ende unseres Lebensfadens, schmerzvoll und blutig wie alle großen Schlachten, die geschlagen werden müssen.«
Die Qualen, die er den Verurteilten zufügte, schienen ihn nicht sonderlich zu belasten. »Diese Menschen haben mit ihren Verbrechen schwere Schuld auf sich geladen. Auf sie wartet die Hölle. Was sind die Schmerzen des Handabhackens oder des Räderns gegen die Torturen des Teufels. Kurz ist das Sterben auf dem Scheiterhaufen, ewig die Qual im Höllenfeuer. Je schmerzhafter die Hinrichtung, umso mehr büßen sie noch zu Lebzeiten von ihrer Schuld ab, umso leichter und kürzer wird ihr Leiden im Fegefeuer sein. Glaube mir, was auf den ersten Blick wie Grausamkeit aussieht, ist in Wirklichkeit Wohltat. Mehr als alle Priester mildern wir ihr Höllenleid.«
Der Alte kannte keine Gewissensbisse. Er hatte das Henkerhandwerk von Kindheit an erlernt.
»Ich frage mich«, hatte er sinniert, »ob der gewaltsame Tod, den wir ausüben, nicht ehrlicher ist als all die Verirrungen unserer christlichen Moral. Wo gibt es das in der Natur, dass ein Geschöpf am Leben erhalten wird, bis es halbblind, taub, lahm und zahnlos sämtliche Gebrechen des körperlichen Verfalls durchlitten hat?« Oder: »Die Natur hat das Altern nicht vorgesehen. Kein Tier stirbt auf freier Wildbahn an Altersschwäche. Wenn ein Hase so alt ist, dass er nicht mehr schnell genug laufen kann, holt ihn der Fuchs. Der gewaltsame Tod ist das natürliche Finale von allem, was da lebt. Gott ist nicht nur der große Schöpfer, sondern auch der oberste Henker.«
Er lebte so, wie er dachte. Mit dem Tod stand er auf gutem Fuß.
Leander musste an den Großvater denken, ein muselmanischer Kamelmetzger aus dem Maghreb, der korsischen Korsaren in die Hände gefallen war. Bei der Belagerung der Stadt Latour, der er seinen Namen verdankte, gehörte er zum Beutegut venezianischer Söldner, die ihn an das Gastrum von Lombers verkauften. Eigentlich für den Steinbruch bestimmt, machte man ihn zum Henker, weil der alte Carnifex am Knochenfraß gestorben war und sich keiner fand, der die Arbeit des Scharfrichters übernehmen wollte.
»Verglichen mit der Schufterei im Steinbruch, war die Arbeit des Henkers ein leichtes Geschäft. Und was macht es schon für einen Unterschied«, soll der Alte gesagt haben, »ob ich ein Kamel schlachte oder einen Christen?« Mohammed bedeutete ihm mehr als Jesus von Nazareth.
Leander konnte sich nur schwach an den Großvater erinnern. Atta hatten sie ihn ehrfürchtig genannt. Ein geheimnisvolles Dunkel hatte ihn umgeben.
Leander legte das Schwert zurück in die Truhe. Seine Hand strich über das blanke Eisen. Er war der dritte Amtsträger einer fast hundertjährigen Henkersdynastie.
Neben den Hinrichtungen und Leibesstrafen hatte der Carnifex eine ganze Reihe von öffentlichen Pflichten zu erfüllen. In den größeren Städten war er auch Schinder, Abdecker, Hundefänger und Bordellwirt. In Carcassonne unterstanden die Huren dem Bader. Streunende Hunde gab es nicht. Die Arbeit der Schinder und Abdecker aber oblag dem Phantom. Es war Beros Aufgabe, alle Kadaver zu entsorgen. Die meisten verfütterte er an die Raben. Wenn in irgendeiner Gasse ein Tier verendete, so wurde das von den Rabenvögeln mit lautem Geschrei angekündigt. Dann machte sich Bero auf den Weg, um das tote Getier zu holen. Auf einem zweirädrigen Karren zog er es in den Garten zwischen Henkersturm und Stadtmauer. Die kahlen Äste der abgestorbenen Platane waren schwarz vor Raben, wenn er mit seiner Fracht dort aufkreuzte. So gierig erklang das Gezeter, dass die Pferde in dem angrenzenden Stall verängstigt an ihren Halftern rissen.
Dann unterbrach der Schmied beim Osttor sein Hämmern, und der Schreiner legte den Hobel aus der Hand. Die Menschen in den Gassen blieben stehen. Selbst der Priester schlug schaudernd ein Kreuz: Memento mori!
Kapitel 4
Papst Gregor IX. hatte sich nur widerwillig dazu bereit erklärt, noch am gleichen Tag den Abt von Clermont zu empfangen. Jetzt hatte er sich in sein Privatgemach im Lateranspalast zurückgezogen, um dort den Reisebericht des späten Besuchers anzuhören. Gregor liebte diese Stunde des Cherubim; so nannte er die Zeitspanne, in welcher der Tag in der Dämmerung versinkt. Halbdunkel erfüllte den mit Teppichen verhängten Raum. Die weiße Robe des Heiligen Vaters leuchtete wie Muschelkalk. Hager, vom hohen Alter gebeugt, thronte Gregor in dem kunstvoll geschnitzten Sessel. Nur wenige Tage trennten ihn von seinem neunzigsten Geburtstag. Er spürte den Todeskeim in sich. Die Schauer der nahen Vollendung streiften seine Seele. Ihm blieb nicht mehr viel Zeit. Schweiß perlte auf seiner Stirn. Die Augen geschlossen, verharrte er in fast völliger Bewegungslosigkeit, während seine Gedanken zurückeilten. Es war ein langer Weg, und er hatte ihn zu höchster Höhe geführt: Stellvertreter Gottes auf Erden, höchster Richter der Völker, Sonne, um die die Planeten der irdischen Herrscher kreist, Caput mundi.
Seine Gedanken beschworen die Großen, die ihm vorausgegangen waren – lebendige Schatten, unsterbliche Tote: Petrus, der Fels, auf dem die Kirche ruhte; Paulus, der die kleine jüdische Sekte zur erdumspannenden Idee erhoben hatte; Augustinus, der als Erster das Wort vom Gottesstaat ausgesprochen hatte; und übergroß und mächtig Papst Gregor VII., welcher der Kirche zur höchsten Macht verholfen hatte. Sie alle waren ihm auf dem dornenreichen Weg vorausgegangen. Er war nur ein Baustein in der Kathedrale des Christentums. Aber so mächtig dieses Gotteshaus auch aufragte, so bedroht war es ständig von äußeren Kräften.
Da war Kaiser Friedrich II., der sich Romanorum Caesar semper Augustus nannte und sogar Felix Victor ac Triumphator Mundi, Herr der Welt. Ein Anspruch, der einer Gotteslästerung gleichkam.
Die größte Gefahr aber ging von den aufkeimenden Ketzerbewegungen aus, den Katharern und Albigensern. Er hatte sie exkommuniziert, hatte ihnen die kirchlichen Gnadenmittel verweigert: keine Taufe, keine Kommunion, keine gültige Eheschließung, kein letzter Trost im Tod. Nichts hatte genutzt. Sie hatten ihn ausgelacht:
O Rom, du frisst uns das Fleisch vom Gebein,
führst uns in den Abgrund wie blindlings hinein.
Gottes Gebote hast du schmählich entstellt.
Mit Gier vergibst du Sünden für Geld.
O wie gewaltig ist die sündige Last,
die du aufs Haupt dir geladen hast!
Die christliche Ritterschaft hatte er gegen sie zu Hilfe rufen müssen. Unkraut muss brennen! Das Kranke muss weg! Mit Feuer und Schwert sollten sie in die Gemeinschaft des christlichen Abendlandes zurückgeführt werden. Ihre Städte gingen in Flammen auf. Die Einsichtigen kamen mit öffentlicher Kirchenbuße davon; die Unbeugsamen erlitten den Tod. Schreckliche Dinge geschahen. Ungeheuerlich war, was sich in Béziers ereignet hatte. Weil die Bürger sich weigerten, ihre Stadt dem Heer der Kreuzritter zu übergeben, wurden sie alle erschlagen: Männer, Frauen und Kinder, siebentausend an der Zahl. Die alten Hände des Papstes krampften sich wie im Schmerz zusammen, als er an die Verwüstungen und die Grausamkeit der aus aller Welt zusammengelaufenen Soldateska dachte.
»Herr, Dein Reich ist teuer erkauft«, murmelten seine blutleeren Lippen. »Aber der Kampf um den ungestörten Frieden des Gottesstaates darf nicht ruhen. Es rütteln zu viele Ketzer an den Grundfesten der Kirchenmacht.«
Schon einige Male war das erzene Becken vor der Tür angeschlagen worden. Da keine Antwort erfolgte, trat schließlich der Diener in das Kabinett. Er trug eine Öllampe, deren Schein die Dämmerung verdrängte.
»Vergebt, Heiliger Vater«, sagte er, »der Abt von Clermont Henri de Marcy und seine Begleiter bitten um Audienz.«
Mit einer kurzen Handbewegung gab Gregor sein Einverständnis.
Die hereingelassenen Männer beugten ihr Knie vor dem Stellvertreter Gottes und nahmen auf den bereitstehenden Stühlen Platz. Gregor betrachtete sie mit unbewegtem Gesichtsausdruck: »Was habt ihr Uns zu berichten?«
Der Abt von Clermont erhob sich und sagte: »Das Ketzertum im Süden der Provence ist aus der Asche wiederauferstanden wie der Vogel Phönix. Wenn diese Pestilenz sich weiter ungehindert ausbreitet, halte ich einen zweiten Kreuzzug für unumgänglich.«
»Quod deus avertat, was Gott verhüten möge! Kommt zur Sache. Was habt Ihr Uns zu berichten?«
»Begleitet von mehreren Bischöfen und weltlichen Herren, hatte ich Gelegenheit, mich mit eigenen Augen von der wieder aufkeimenden Häresie in der Provence zu überzeugen. Sie ist schlimmer als befürchtet. Toulouse bereitete uns einen Empfang, der Böses ahnen ließ. Die Bürger zeigten johlend mit Fingern auf uns, so als wären wir Ausgeburten der Hölle. Sie beschimpften unsere Bischöfe, nannten sie Schandbuben und Heuchler. Wir flüchteten in unsere Quartiere und predigten anderentags vor der Hauptkirche zu dem versammelten Stadtvolk.«
Der Abt legte eine Pause ein, um zu sehen, welche Wirkung seine Worte auf den Papst ausübten. Der gab durch ein Handzeichen zu verstehen, dass der andere mit seinem Bericht fortfahren solle.
Die näselnde Stimme mit okzitanischem Akzent war ermüdend. Zudem quälte ihn seit Tagen wieder die Podagra. Gregor blickte auf seine gichtknotigen Hände mit den rostgelben Altersflecken und dem Anulus piscatoris, dem goldenen Papstring, den schon Könige und Kaiser geküsst hatten, die sichtbare Verkörperung der Macht, die Gott ihm verliehen hatte.
»Sprecht weiter!«
»Nach unserer Predigt forderte ich sie zu einem friedlichen Streitgespräch über den wahren Glauben auf. Keiner meldete sich. Die verwilderten Hunde hatten sich in Maulwürfe verwandelt.«
»Das ist gut so«, sagte der Heilige Vater.
»Was ist daran gut?«
»Oderint, dum metuant; wenn sie uns schon nicht lieben, so sollen sie uns wenigstens fürchten. Aber fahrt fort. Lasst Euch durch meine Bemerkungen nicht aufhalten!«
»Ich ließ mir von kirchentreuen Bürgern eine Liste der vermeintlichen Häretiker aufstellen und griff mir dann den angesehensten und reichsten heraus, einen gewissen Pierre Maurand, Besitzer mehrerer Häuser in der Stadt. Meine Vorladung ließ er unbeantwortet. Er gab erst nach, als der Graf von Toulouse ihm befahl, unverzüglich zu erscheinen. Den Grafen hatten unsere Bischöfe unter Druck gesetzt. Aus früheren Verhören wussten wir, wie man diese Katharer zum Reden bringt.«
»Und wie macht Ihr das?«, wollte der Papst wissen.
»Weigert sich der Befragte, sein Bekenntnis zum rechten katholischen Glauben abzulegen, so ist er als Katharer entlarvt. Dieser Pierre Maurand zierte sich zunächst mit Ausflüchten, gab dann aber nach. Ich ließ Reliquien und Hostien herbeiholen, bei deren Anblick unsere Kleriker die Gnade des Heiligen Geistes anriefen und in Tränen ausbrachen. Der Verdächtige aber verweigerte unseren heiligen Reliquien den Respekt. Er war der häretischen Überzeugung, dass das Abendmahl nicht der Leib Christi sei. Er wurde sofort von uns ergriffen und eingekerkert.«
»Und das alles geschah so ganz ohne Widerstand?«
»Ganz ohne allen Widerstand. Trotz der immer noch weitverbreiteten Häresie verfügt die Kirche mit dem Grafen als weltlichem Arm in Toulouse über autoritäre Macht.«
»Dieser Mensch verdient unsere Unterstützung.«
»Er hat sie. Er bat den Heiligen Stuhl um die Auflösung seiner Ehe.«
»Sie sei ihm gewährt.«
»Ihr habt sie ihm bereits gewährt«, sagte der Abt.
»Ja, gewiss.« Der Papst nickte, als erinnerte er sich. »Ja, gewiss doch.«
»Wir ließen die Gelegenheit nicht verstreichen, an dem stadtbekannten Maurand ein Exempel zu statuieren. In einer besonders demütigenden Zurschaustellung wurde der reiche und stolze Mann nackt und barfuß durch die Gassen geführt, die Hände in Schulterhöhe festgeschraubt in der Schandgeige, eine entehrende Kappe mit Eselsohren auf dem Kopf und das entblößte Geschlecht mit Henna rot eingefärbt wie ein Affenpenis.«
»Musste das sein?«, fragte Gregor angewidert.
»Es musste sein. Wer Gott verleugnet, stellt sich auf die Stufe des Tieres und wird entsprechend behandelt. So ging es bis zur Abteikirche Saint Sernin, wo er vor den Augen der ganzen Stadt mit Ruten gegeißelt wurde. Danach erfolgte die Verkündigung, dass seine Güter beschlagnahmt seien, dass seine Burg geschleift werden würde und er als Buße eine dreijährige Pilgerreise nach Jerusalem anzutreten habe. Die harte Strafe verfehlte nicht ihre Wirkung. Von Stund an wurde uns der gehörige Respekt erwiesen. Womit ich noch einmal meine Forderung wiederholen möchte, in der Provence härter durchzugreifen. Der römische Politiker Cato pflegte seine Reden vor dem Senat mit dem Hinweis zu beenden, dass Karthago zerstört werden müsse: Ceterum censeo Carthaginem esse delendam! Meine Forderung lautet: Ceterum censeo Katharern esse delendam. Im Übrigen bin ich der Meinung, das Katharertum muss vernichtet werden, mit Stumpf und Stiel und so bald wie möglich.«
»Aber das haben wir doch bereits getan«, meinte Seine Heiligkeit. »Wir tun seit einem halben Jahrhundert nichts anderes. Schon das dritte Laterankonzil schickte ein Kreuzritterheer nach Toulouse, unter Führung des Abtes Heinrich von Clairveaux – wenn ich nicht irre, um dort mit Feuer und Schwert dem wahren Glauben zu seinem Recht zu verhelfen. Das war vor sechzig Jahren.«
»Ergebnislos, wie wir alle wissen«, sagte Kardinal Crispiano.
»Diese Schlangenbrut hatte sich eine besonders raffinierte Art von Widerstand ausgedacht. Sie unterwarfen sich scheinbar, um nach dem Abzug unserer Kreuzritter zu ihrem ketzerischen Glauben zurückzukehren.«
»Dreißig Jahre später unter Innozenz III. haben wir sie dann aber der gerechten Strafe zugeführt.«
»Und wieder haben wir sie nicht ausrotten können«, widersprach Crispiano. »Mit zwanzigtausend Rittern und zweihunderttausend Mann Fußvolk sind wir gegen Okzitanien marschiert. Wir haben Béziers erobert. Die Stadt starb in einem Meer aus Feuer und Blut. Carcassonne wurde belagert und eingenommen, Montreal, Fanjeaux, Limoux, Castres, Lombers und Albi. Wir haben alles niedergemacht, alles außer ihrem Glauben. Mit Waffen ist diesen Ratten nicht beizukommen. Wir haben mit unseren Kreuzzügen mehr Rechtgläubige als Ketzer erschlagen.«
***
»Der Papst ist alt geworden«, sagte Henri de Marcy nach dem Gespräch zu dem weißhaarigen Kardinal Segni. »Ihr kennt ihn länger als ich. Was für ein Mensch ist er?«
»Ja, ich kenne ihn schon sehr lange. Ich hatte die Ehre, ihm einige Male in Padua, Piacenza und Mailand zu begegnen. Damals hieß Seine Heiligkeit noch Hugo von Ostia. Ich halte ihn für einen äußerst leidenschaftlichen, willensstarken Mann, der seine Ziele mit Energie verfolgt. Eigenartig und unbegreiflich erschienen mir jedoch immer seine Hingabe und wahrhaft kindliche Verehrung, die er den wandernden Brüdern der Minoriten entgegenbringt. Der stolze und unbeeinflussbare Mann wird demütig wie ein gehorsamer Mönch, wenn er einem der Jünger des Franziskus oder Domenikus gegenübersteht. Dieser Mensch ist voller Gegensätze. Er hat mir vor Jahren von einer Prophezeiung berichtet, die ihn quält.«
»Was für eine Prophezeiung?«
»Er hat nur bruchstückhaft von ihr gesprochen. Ein Kind aus dem Hause Davids, vom Stamm Christi, ein Merowingerspross habe die Macht, das Papsttum zu Fall zu bringen. Zu seiner Amtszeit würde es geboren, in Okzitanien. Daher sein Interesse an Eurem Bericht und an allem, was dort unten im Süden geschieht.«
»Glaubt Ihr an solchen Unfug?«
»Hoch auf einsamem Gipfel der Majestät wird der Mensch vom Hauch unbegreiflicher Mächte gestreift. Daran glaubt auch Kaiser Friedrich. Sein Hofastrologe Michael Scotus hat ihm prophezeit, er würde sub jiore, unter Blumen, enden. Der Kaiser hat das so gedeutet, dass von Florenz Gefahr ausgeht. Die Stadt ist ihm so unheimlich wie dem Heiligen Vater die Katharer.«
***
Am Abend des darauffolgenden Tages fragte Gregor im Kreis seiner Berater: »Was sind das für Menschen, diese Katharer?«
Als er nicht gleich eine Antwort erhielt, wandte er sich an seinen Neffen, den jungen Kardinal Crispiano, dem er schon aus familiärer Verbundenheit mehr vertraute als allen anderen. »Sind sie wirklich so gottlos und verkommen, wie man sagt?«
»Verkommen? Nein. Verkommen sind sie ganz gewiss nicht.« Der Kardinal strich sich über seinen kurz gestutzten Kinnbart. Dabei schloss er die Augen, so als suchte er die rechten Worte. Und als ihm so schnell nichts einfiel, wiederholte er seinen letzten Satz: »Nein, verkommen sind sie nicht.«
»Aber alle Welt berichtet mir, dass sie die reinste Höllenbrut seien«, sagte Gregor.
»Wollt Ihr hören, was alle Welt sagt, oder wollt Ihr die Wahrheit hören?«
»Wer kennt schon die Wahrheit?«
Eine Frage, die Gottes Stellvertreter auf Erden nicht stellen sollte, dachte Crispiano, behielt den ketzerischen Gedanken aber für sich und sagte: »Bernhard von Clairveaux war zweimal in Südfrankreich, um den Katharern zu predigen, wie Ihr wisst, erfolglos und dementsprechend erbost über sie. Aber was er über sie berichtet, klingt mehr nach Bewunderung als nach Verdammnis.«
»Bewunderung?« Gregor neigte seinen hageren Leib weit über die Tischplatte seinem Neffen zu, als traue er seinem Gehör nicht. »Der heilige Bernhard hat mit Bewunderung von ihnen gesprochen? Was hat er über sie gesagt?«
»Sie seien auffallend tüchtige und ordentliche Leute: Weber, Händler, Hirten und Bauern, in Gemeinschaft mit ehemaligen Geistlichen. Sie selber kennen keine Priester, nur Reine. Das sind Laien – Männer wie Frauen –, die sich durch vorbildliche Lebensführung auszeichnen. Obwohl diese Reinen in strengster Askese leben, erlauben sie ihren Anhängern mehr Freiheiten, als wir es tun, weil sie – so sagen sie – durch ihr opfervolles Leben die Schuld der anderen auf sich nehmen.«
»Ein bequemes, sündiges Leben, das am Ende durch ein falsches Sakrament geheiligt wird«, warf der alte Geistliche ein, den sie innerhalb der Kurie Re-Leone, König der Löwen, nannten. Seine Worte waren wie Prankenschläge. Er verzog angewidert sein faltiges Greisengesicht.
»Sie leugnen die Taufe und das Abendmahl, weil unwürdige Priester unfähig seien, heilige Handlungen zu vollziehen. Sie sagen, das Bekennen des Glaubens sei kein Verdienst. Sündenbekenntnisse könnten nichts wieder gutmachen. Nur vorbildliche Lebensführung würde zählen. Priester seien Menschen wie alle anderen auch. Kirchen seien nutzlose Steinhaufen, in denen weder Gott noch die Heiligen anwesend wären. Das Kreuz …«
»Das alles haben wir bereits vernommen«, unterbrach ihn Gregor. »Aber was hat Bernhard von Clairveaux über sie gesagt?«
»Er hielt sie für Vorbilder der klösterlichen Zucht und Ordnung. Sie treten dafür ein, nicht zu heiraten, sondern das Fleisch von der Begehrlichkeit zu befreien. Niemanden hassen. Gleichgesinnte lieben. Von seiner Hände Arbeit leben, beten und fasten. Ora et labora. Nicht nur zur Fastenzeit verzichten sie auf Fleisch, sondern ständig. Am Ende ihres irdischen Daseins entsagen sie sogar allen Speisen, um sich zu Tode zu fasten und den Märtyrertod in aller Seligkeit auszukosten. Vor die Wahl gestellt, ihrem Glauben abzuschwören oder verbrannt zu werden, gehen sie erschreckend freudig in den Feuertod, erfüllt von der Gewissheit auf ein ewiges Leben.«
»Das klingt gut. Wo ist der Pferdefuß?«
»Sie halten die Welt für eine Schöpfung Satans. Moses ist für sie ein Werkzeug des Teufels. Die Fleischwerdung Christi betrachten sie als eine Art Sündenfall. Im Kreuz sehen sie nicht das sichtbare Zeichen des Trostes und der Rettung, sondern das Symbol von Satans Macht auf Erden.«
Kardinal Adriano Lugano, ein Neffe des päpstlichen Vorgängers Goelestin, hatte seine Vorwürfe gegen die Bugomilen – wie er die Katharer nannte – mit sichtbarer Erregung vorgetragen. Der Abscheu stand ihm ins Gesicht geschrieben.
»Sie leugnen das Jüngste Gericht und die Höllenstrafen für Sünden. Ja, sie versteigen sich sogar in der schwachsinnigen Vorstellung, mit der Erschaffung der irdischen Welt habe das Jüngste Gericht bereits stattgefunden. Wer aber glaubt, dass ihn keine Höllenstrafe mehr erwartet, weil er sich hier auf Erden schon in der Hölle befindet, dem ist mit Androhung von Höllenstrafen nicht mehr beizukommen. Weder Bußen, Kirchenstrafen noch Exkommunikation vermögen ihn zu schrecken. Er benötigt weder Sakramente noch Gnadenvergabe. Taufe, Beichte, Abendmahl – er braucht das alles nicht mehr.«
»Einer, der die Sündenvergebung der heiligen Kirche nicht anerkennt«, sagte der alte Re-Leone, »ist auch nicht bereit, den Zehnten an uns zu zahlen. Damit aber entzieht die katharische Häresie unserer Kirche die irdische Grundlage und bringt die gottgewollte Ordnung aus dem Gleichgewicht. Eine schlimmere Bedrohung für Rom hat es nie gegeben. Und sie greift schneller um sich als die Pest. In Südfrankreich werden die Erzdiözesen Narbonne, Bordeaux und Bourges vom Katharismus bedroht. Toulouse, Albi und Carcassonne sind immer noch infiziert. Auch im Norden Frankreichs, vor allem in Burgund, in der Champagne und in Flandern, mehrt sich ihr Einfluss, in Nevers, in Troyes, in Besançon, in Metz, in Reims, in Rouen, in Arras und vielen anderen Städten. Sie machen sich in Spanien breit und auf der englischen Insel. In den deutschen Landen findet man sie am Rhein entlang vor allem in den Bischofsstädten, aber auch an der Donau. Wien und Passau sind wichtige Mittelpunkte der Häresie. Ihr wahres Paradies aber ist Norditalien von Mailand bis Udine, von Como bis Viterbo. Eine weltweite Verschwörung.«