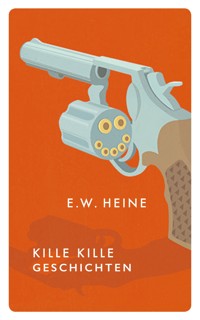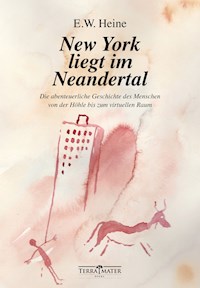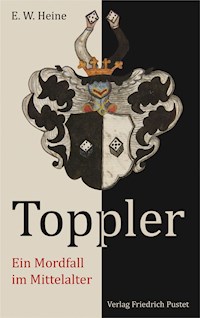Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Ein praller Schmöker für alle, die alles wollen" urteilte der SWR über "Der Flug des Feuervogels" von E.W. Heine – jetzt als eBook bei dotbooks. Rothenburg ob der Tauber, Ende des 14. Jahrhunderts. Der Schrecken kehrt zurück in jene Stadt, die gerade meinte, aufatmen zu können: Bürgermeister Heinrich Toppler hat sich mit dem reichen Juden Josua Süßkind verbündet, um die erdrückende Steuerschuld von der Stadt zu heben. Doch nun gehen immer wieder Häuser in Flammen auf. Sind es tragisches Unfälle – oder ist es die Rache des Adels, der die Bürgerlichen in ihre Schranken weisen will? In dieser Zeit voller Machtgier, Hass und Aberglauben, in der die Schweine in den Straßen freier sind als mancher Mensch, verliebt sich Topplers Sohn in die Tochter Süßkinds. Doch ihre unschuldigen Gefühle drohen für Attila und Judith zur tödlichen Gefahr zu werden … Ein ebenso deftiges wie überbordendes Zeitgemälde, sprachgewaltig erzählt von E.W. Heine, Autor des Bestsellers "Das Halsband der Taube" "Spannend, saftig, hitverdächtig." Welt am Sonntag Jetzt als eBook kaufen und genießen: "Der Flug des Feuervogels" von E.W. Heine. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 571
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Rothenburg ob der Tauber, Ende des 14. Jahrhunderts. Der Schrecken kehrt zurück in jene Stadt, die gerade meinte, aufatmen zu können: Bürgermeister Heinrich Toppler hat sich mit dem reichen Juden Josua Süßkind verbündet, um die erdrückende Steuerschuld von der Stadt zu heben. Doch nun gehen immer wieder Häuser in Flammen auf. Sind es tragisches Unfälle – oder ist es die Rache des Adels, der die Bürgerlichen in ihre Schranken weisen will? In dieser Zeit voller Machtgier, Hass und Aberglauben, in der die Schweine in den Straßen freier sind als mancher Mensch, verliebt sich Topplers Sohn in die Tochter Süßkinds. Doch ihre unschuldigen Gefühle drohen für Attila und Judith zur tödlichen Gefahr zu werden …
Über den Autor:
E.W. Heine (1935–2023) wurde in Berlin geboren und studierte Architektur und Stadtplanung. Er verbrachte viele Jahre in Südafrika, wo er ein Architekturbüro unterhielt und verschiedene internationale Projekte realisierte. Parallel dazu widmete sich E.W. Heine seiner anderen Leidenschaft, dem Schreiben: Aus seiner Feder stammen neben dem Bestseller »Das Halsband der Taube« unter anderem Drehbücher, Sachbücher, historische Romane und die makabren Kille-Kille-Geschichten, die Kultstatus erreichten.
Zu E.W. Heines bekanntesten Werken gehört die Trilogie, in der er sich mit den großen Weltreligionen Islam, Judentum und Christentum auseinandersetzt: »Das Halsband der Taube«, »Der Flug des Feuervogels« und »Die Raben von Carcassonne«. Außerdem veröffentlichte er bei dotbooks den Roman »Das Geheimnis der Hexe«, auch bekannt unter dem Titel »Papavera – Der Ring des Kreuzritters«.
***
eBook-Neuausgabe Januar 2016, März 2024
Copyright © der Originalausgabe 2000 by C. Bertelsmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2016 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/StockSmartStart, RODINA OLENA, RealArtStudios, 100ker, spe und eines Gemäldes von Braun, Rothenburg ob der Tauber
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (fb)
ISBN 978-3-98690-966-6
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Der Flug des Feuervogels«an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
E.W. Heine
Der Flug des Feuervogels
Historischer Roman - »Die Säulen der Welt«-Saga 2
dotbooks.
Gott nur weiß, woher ich stamme.Heiß und hungrig wie die Flamme,brenne ich vor wilder Pein.Glut wird alles, was ich fasse,Asche alles, was ich lasse.Feuer bin ich, will ich sein.
Kapitel 1
Nacht über dem Taubertal. Der Himmel mondlos und schwer von Wolken. Nebelschwaden wallen über sumpfige Wiesen, streifen lautlos um Korbweiden, um Ulmen und Pappeln. In den Gräben schmatzt und gurgelt die Nässe. Bisweilen stöhnen die Äste eines alten Baumes unter der Last der Jahre. Drohendes Dunkel, Einsamkeit. Und mitten darin wie eine Insel im Ozean: die Stadt hinter der hohen Mauer, bewacht vom Türmer und Nachtwächter, behütet von Gott und den Heiligen.
Im Kloster der Franziskaner hatten die Mönche ihre mitternächtlichen Laudes beendet: Media in vita in morte sumus, mitten im Leben sind wir vom Tod umgeben.
Der letzte Kerzenschimmer hinter den Fensterkreuzen war längst erloschen. Nun leuchteten nur noch die ewigen Lichter über den Altären, brennende Botschaft des Auferstandenen an seine Jünger: Pax vobiscum.
Ein Hornsignal!
Ein Hornsignal hoch oben vom Turm zerriss die Stille, gellte wie ein Aufschrei über die Dächer und Zinnen, über Kamine und Mauerkronen, schwoll an wie in höchster Todesangst, erstarb, erhob sich aufs Neue.
Ein zweites Signal vom Osttor!
Zappelig wie Fische an der Angelleine begannen die Glocken im Frauenkloster zu bimmeln. Und dann erwachten wie der Sturmwind die großen Glocken von Sankt Jakob:
Feuer, Feuer, Feuer.
Schreckensbleich, nur mit dem Nötigsten bekleidet, stürzten die Menschen auf die Straßen.
Flüche, Kinderweinen, Hundegebell, Befehle, Rufe: Feuer! Feuer in der Stadt, das war wie die Pest, wie der Teufel im Leib, Höllenfeuer!
Vor dem Feind bot die Stadtmauer Schutz. Die Kornspeicher bewahrten vor Hungersnot. Den Flammen aber waren sie ausgeliefert wie die Wolken dem Sturm.
Heiliger Florian, hilf, hilf uns in der Not! Sankt Jakob steh uns bei! Gütige Mutter Gottes, voll der Gnade, rette unsere Stadt!
Die Menge drängte dem Rödertor zu, wo der Himmel blutrot aufleuchtete, als ginge mitten in der Nacht die Sonne auf. Das Prasseln der Flammen in dem trockenen Gebälk wurde lauter, als sich die Menschen dem Unglücksort näherten. Funken wirbelten durch die Luft, glühende Schneeflocken, toll gewordenes Gestirn vor nachtschwarzem Himmel.
»Das Haus zum Bären brennt!«
In langen Ketten flogen die ledernen Eimer herbei. Schwarzer Rauch mischte sich zischend mit weißem Dampf. Da war keiner, der abseits stand. Schwitzend schaufelten die Knechte nassen Sand in die Glut. Sogar Dreschflegel waren im Einsatz. Hier brannte nicht ein Haus; hier brannte die Stadt. Ein Gebäude aus einem Guß war die Stadt. Giebel an Giebel, Waben in einem Bienenstock. Wehe, wenn der brannte!
Weiber und Männer, Greise und Knaben, alle löschten, so gut es ging. Selbst der alte Priester, der herbeigeeilt war, um seinen Segen zu spenden, hatte sich in die Eimerkette eingereiht, wohl wissend, dass Löschwasser jetzt wichtiger war als Weihwasser.
»Seht nur! Seht!«, rief eine Frau und zeigte in die schwelende Asche. Und nun sahen es alle, den fast völlig verbrannten Körper eines Menschen. Wie gekrümmte Vogelkrallen ragten die Rippen aus dem verkohlten Fleisch des Brustkorbs. Kopf und Gliedmaßen fehlten. Der herbeigeholte Priester erteilte dem Toten den letzten Segen: per aspera ad immortalitatem, aus dem Elend in die Unsterblichkeit, als ein Junge meinte: »Der hat ja einen Schwanz.« Und richtig, an dem verkohlten Korpus befand sich, für alle sichtbar, ein Schwanz.
Erschreckt schlugen die Herbeigelaufenen ein Kreuz.
»Ein Teufel! Heilige Mutter Gottes, ein Teufel!«
Eine verbrannte Ausgeburt der Hölle. Was hatte das zu bedeuten? Hatte die Hölle ihre Pforten geöffnet, um die Stadt zu verschlingen, so wie Sodom und Gomorrha von den Flammen verschlungen worden waren?
Uriel in urbe. Cave malum! Weihwasser wurde verspritzt. Miserere mei, Herr, erbarme dich.
Unfähig davonzulaufen, gelähmt wie Mäuse beim Anblick der Schlange, fielen die Umstehenden auf die Knie.
Uriel in urbe, der Teufel in der Stadt!
Doch dann verflog der böse Zauber. Der einbeinige Fleischhauer Hiob vom Rödertor hinkte zu dem Kadaver, betrachtete ihn mit zusammengekniffenen Augen, riss sich ein Stück aus dem dampfenden Fleisch, beroch es und – alle sahen es mit Entsetzen – schob sich den Satansbraten in den Mund. Dabei schmatzte er mit geschlossenen Augen, so wie es die Kellermeister beim Probieren des jungen Fassweines machen.
»Das ist eine Sau«, sagte er, »eine ganz gewöhnliche Sau.«
Er bückte sich und zeigte den Umstehenden den versengten Saufuß, der bei dem Kadaver lag. Kopfschüttelnd steckte der Priester seine sakralen Gerätschaften fort.
»Es ist unglaublich«, sagte eine Alte, die neben ihm stand. »Er hat einer Sau den Weg in die Unsterblichkeit gewiesen.«
Das Haus zum Bären war verloren; jetzt mussten alle Kräfte aufgebracht werden, um die Ausbreitung der Flammen zu verhindern. Mit feuchten Tüchern erstickten sie die schwelende Glut auf den Nachbardächern. Am Ende kam ihnen der Himmel zur Hilfe. Es regnete aus vollen Kannen, so als hätte der heilige Florian ihr Gebet erhört.
***
Milchig blass wie der Wintermond ging die Sonne am nächsten Tag über der Stadt auf. Ein klebriger Geruch von Rauch und nasser Asche zog durch die menschenleeren Gassen. Bis weit in den Tag hinein lag die Stadt in tiefer, traumloser Erschöpfung. Krieger nach der Schlacht schlafen so.
Nur am Hauptmarkt im Haus Zum goldenen Greifen brannte hinter bleiverglasten Fenstern Licht. Bürgermeister Heinrich Toppler hatte noch in der Nacht den Inneren Rat zusammengerufen. Übernächtigt, mit angesengtem Haupt- und Barthaar, in rußfleckigen Gewändern drängten die Männer sich in der niedrigen Stube.
»Im Namen aller Heiligen, das war der dritte Brand, der dritte innerhalb eines Jahres.«
Der Satz stand im Raum wie eine ungeheure Anklage. Alle dachten sie das gleiche: So viel Unachtsamkeit gibt es nicht. Das war kein Unfall. Was hat das zu bedeuten? Wer steckt dahinter? Gottes Strafgericht oder gar der Teufel, wie es die Pfaffen von den Kanzeln der Kirchen predigten! Nein. Aber dann war es Menschenwerk? Einer von ihnen – war das denkbar? Nein und abermals nein. Und dennoch konnte es nur einer von ihnen gewesen sein. Stadtfeinde kamen nicht in Frage, denn die Stadttore waren des Nachts fest verschlossen.
»Gibt es nicht so etwas wie Selbstentzündung?«, fragte der alte Sylvester. »Feuchtes Heu kann sich so erhitzen, dass es entflammt. Eine meiner Scheunen hat vor ein paar Jahren ...«
»Das Haus zum Bären war keine Scheune«, unterbrach ihn der Bürgermeister. »Dort gab es weder Heu noch Stroh. Es diente den Franziskanern als Gästehaus und als Lager für Leder, Hanf und Pergament.«
»Waren letzte Nacht Gäste in dem Haus?«
»Nein. Dort brannte weder ein offenes Licht noch Feuer. Und Gewitter, wie ihr alle wisst, gab es auch nicht. Blitz und Selbstentzündung scheiden aus. Wer auch immer das Feuer legte, er befindet sich unter uns, innerhalb der Stadtmauern.«
»Was werdet Ihr dagegen unternehmen?«, fragte Gernot, der Gerber, den Bürgermeister.
»Ich werde die Franziskaner mit der Lösung des Falles beauftragen.«
»Die Franziskaner? Seit wann lösen Mönche unsere Probleme?«
»Das Haus zum Bären gehört ihnen. Sie haben folglich ein starkes Interesse daran herauszufinden, wer ihnen den roten Hahn aufs Dach gesetzt hat. Außerdem nennen sie sich voller Stolz canes papae, Spürhunde des Papstes. Wir werden ja sehen, ob auf diese Hunde Verlass ist.«
***
Am darauf folgenden Sonntag – es war der Namenstag des heiligen Kastulus – hielt der Prior der Franziskanermönche, Bernardinus von Babenhausen, die Predigt in Sankt Jakob. Die Kirche vermochte die Menschen nicht alle zu fassen. Wie die Bienen beim Hochzeitsflug drängten sie sich in dichten Trauben vor den Toren des Gotteshauses.
Als Pater Bernardinus die Kanzel betrat, war es so still in dem hohen Kirchenschiff, dass man das Fallen einer Feder vernommen hätte. Sein blasses, hageres Gesicht wirkte noch ernster, als es von Natur aus schon war. Die tief eingegrabenen Falten waren wie in Hartholz geschnitzt. Dünnes weißes Greisenhaar klebte wie Spinnengewebe an Stirn und Schläfen. Alles an ihm war ehrwürdig alt. Umso beeindruckender waren das lebendige Feuer, das in seinen Augen brannte, und die Stimme, die nichts von ihrer jugendlichen Kraft eingebüßt hatte:
»Im Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes. So steht es geschrieben im neunzehnten Kapitel der Genesis: Als die Sonne über dem Land aufgegangen war und sich Lot im Auftrag der Engel nach Zoar begeben hatte, ließ der Herr auf Sodom und Gomorrha Schwefel und Feuer regnen. Von Grund auf vernichtete er ihre Häuser und mit ihnen alle Bewohner der Stadt und alles Vieh und alles, was auf den Feldern wuchs. Und am Morgen begab sich Lot an den Ort, an dem der Herr das Strafgericht vollzogen hatte. Er blickte auf die schwelenden Ruinen und auf das ganze Elend im weiten Umkreis. Schwarzer Rauch wie aus einem Schmelzofen stieg zum Himmel empor und verfinsterte die Sonne.«
Pater Bernardinus hob das blasse Gesicht und starrte zur Kirchendecke empor, als sähe er das rauchende Inferno der sündigen Städte mit eigenen Augen. Dabei senkte er die Stimme, als spräche er zu sich selbst: »Der Geruch von Asche, von verkohltem Holz, nach versengtem Haar und verbranntem Fleisch, nach Schweiß und Angst.«
Er beugte sich über den Rand der Kanzel und sog für alle hörbar die Atemluft durch seine hagere Greisennase ein.
»Riecht ihr es nicht?«
Und alle rochen es mit Schaudern.
»Ubi est gloria nunc Babyloniae? Wo ist nun der Glanz Babylons? Ist nicht die Stadt die Wurzel allen Übels? Ihr Erfinder war Kain, der erste Mörder der Menschheit. Wehe der Stadt, die den Zorn des Herrn auf sich lädt. Sie wird brennen wie Sodom und Gomorrha. Die Pforten der Hölle werden sich öffnen und die vier Reiter der Apokalypse ausspeien. Die Offenbarung des heiligen Johannes wird sich erfüllen. Die Posaune des Jüngsten Gerichtes wird ertönen. Wer Ohren hat zu hören, der höre!«
Es war totenstill in dem mit Menschenleibern gefüllten Raum. Kein Hauch war zu hören. Mit angehaltenem Atem lauschten sie dem Klopfen ihrer Herzen.
Wie ein Stein, der den Wasserspiegel eines schlafenden Sees zerschlägt, zerriss ein furchtbarer Laut die Stille. Was war das? Werwölfe heulen so, die Seelen der Verdammten am Jüngsten Tag.
Alle Augen richteten sich auf den Urheber des Höllengeheules, einen Gnom mit unförmigem Wasserkopf auf dem Körper eines verkrüppelten Kindes. Was seinen Beinen an Länge fehlte, schienen seine Arme zu viel zu haben. Sie baumelten an dem schmächtigen Leib herab wie Affenarme, ständig in nervöser Bewegung, begleitet von fröhlichem Glöckchengebimmel. Denn sie hatten ihm, wie das Gesetz es verlangte, ein Narrengewand mit aufgesetzten Schellen angezogen, damit jedermann schon von weitem erkennen konnte: Nimm dich in Acht! Hier ist einer, der nicht weiß, was er tut, ein toller Hund, ein Narr.
»Wie kommt der Kürbiskopf in die Kirche?«
»Werft ihn hinaus!«
»Stopft ihm das Maul!«
Sie ergriffen ihn. Er schlug um sich, schrie weiter. Einer steckte ihm einen Fußlappen in den aufgerissenen Mund. Ein anderer schnallte ihm mit dem Ledergürtel die Arme an den Leib. Zappelnd und quiekend wie ein Spanferkel wurde er ins Freie befördert, eine Ausgeburt der Hölle, die das Kirchentor ausgespien hat. Mit dem Gesicht in einer Regenpfütze, die Augen schielend zum Himmel verdreht, so lag er dort, bis eine Marktfrau ihm die Fesseln abnahm und ihn aus seiner elenden Lage befreite. Begleitet vom Gelächter der Umstehenden, flatterte er mit ausgebreiteten Armen davon wie ein Huhn.
Angeheizt durch die Predigten der Franziskaner, wucherte schon bald der wildeste Aberglaube in der Stadt. Der Gürtelschneider Adam wollte nach dem Sechserläuten bei den Taubermühlen Stimmen gehört haben, die ihm zuwisperten: »Das Feuer wird euch alle fressen. Lauf, lauf um dein Leben!« Und dabei hatten Lichter unter der Wasseroberfläche geleuchtet. »Flackerndes Feuer, Irrlichter, verlorene Seelen«, wie er angstschlotternd stammelte: »Lauft, lauft um euer Leben!«
Schafhirten von dem Topplerschen Gut hatten in der Nacht Feuerbälle gesehen, die wie Kugelblitze über Stroh und Heu rollten, ohne es zu entzünden. Sie schossen lautlos wie die Fledermäuse zur einen Seite der Feldscheune hinein und zur anderen wieder heraus. Es roch nach verbranntem Pferdehuf, nach Ziegenbock und Verwesung. Heiland, steh uns bei! Dabei schlugen sie das Kreuz und schauten so angewidert drein, als hätten sie sämtliche Ausdünstungen Satans mit der Nase erfahren.
Einer Magd vom Gänsemarkt war die Gottesmutter erschienen. Sie habe bittere Tränen vergossen über die Stadt, deren Schicksal so besiegelt sei wie der Kreuzestod ihres Sohnes. Da die Anna als schwachsinnig galt, nahm niemand ihre Geschichten ernst, aber dennoch – stand nicht geschrieben: Selig sind, die da geistig schwach sind, denn sie werden das Himmelreich erblicken?
Alle spürten die Bedrohung, die wie ein Fluch über der Stadt hing. Kinder hatten einen Salamander mit zwei Köpfen gefangen. Der Einhorn-Wirt hatte zur Mitternacht den Feuervogel Fuhd gesehen, wie er mit flammendem Gefieder um den Turm von Sankt Jakob kreiste. Die Konstellation der Planeten kündete nichts Gutes. Saturn, der Kinderverschlinger, triumphierte über Jupiter. Venus stand im Schatten des Mars, und das bei abnehmendem Mond! In der Nacht ertönte Hundegeheul, ohne dass jemand einen Hund gesehen hätte. Es gab keine Hunde in der Stadt. Man hielt sie für überflüssige Fresser. Es gab auch keine Katzen, obwohl es von Ratten und Mäusen nur so wimmelte. Katzen galten wie die Fledermäuse, Fliegen und Flöhe als Ausgeburten der Hölle. Wenn sich eine in die Stadt wagte, wurde sie gesteinigt und gekreuzigt. Mit auseinandergezerrten Vorderbeinen auf ein Brett genagelt, hing sie dann als Vogelscheuche in einem der Stadtgärten, bis ihr die Raben den letzten Fetzen Fleisch aus dem verluderten Fell gehackt hatten.
Die Nacht gehörte in Rothenburg den Schweinen, hochbeinigen, boshaften Tieren mit spitzen Ohren und wimpernlosen Augen, dicht behaart mit schmutzigen Borsten. Sie, die bei Tageslicht Steinwürfe und Fußtritte genug einstecken mussten, waren des Nachts die Herren der Straßen. Bei Tage schliefen sie im Schatten der Zäune, hinter hoch gestapelten Holzscheiten oder in Regenpfützen, meist zu müde, um die Fliegen zu verscheuchen, die grünschillernd auf ihnen herumkrochen. Aber nach Sonnenuntergang, wenn die Menschen in tiefem Schlaf lagen, erwachten die Schweine zum Leben, um den Unrat zu beseitigen, den die Menschen während des Tages vor ihre Haustüren geworfen hatten. Abfall, Essensreste, faulige Früchte, totes Getier und Kot, alles wurde schnüffelnd und schmatzend zu Schweinemist verdaut, den der Regen fortschwemmte oder den die Bürger sich in ihre Hausgärten holten.
Gegen Mitternacht kamen die Schweine von Rothenburg an bestimmten Plätzen zusammen, die sie von Zeit zu Zeit wechselten. Am häufigsten trafen sie sich vor der steinernen Halle der Fleischhauer beim Hauptmarkt. Dort standen sie mit der feierlichen Scheu von Friedhofsbesuchern, so als wüssten sie, dass in jenem dunklen Gebäude der Tod auf sie wartete. Oder war es die Ausdünstung von totem Schweinefleisch, die sie so erregte, dass ihnen der weiße Schaum aus den Rüsseln quoll?
Der Nachtwächter, der als einziger Mensch um diese Zeit unterwegs war, ging ihnen respektvoll aus dem Weg, ahnend, dass die Schweine ein Geheimnis hüteten, das nur ihnen gehörte.
Die meisten Schweine gab es in der Bäckergasse, denn nirgendwo fiel so viel nahrhafter Abfall an wie bei den Bäckern und Müllern. Aus diesem Grund war es ihnen erlaubt, sich mehr Schweine zu halten als alle anderen Haushalte in der Stadt. Der süßliche Duft von warmem Lebkuchen, Honigbrot und Himbeermus mischte sich mit dem beißenden Gestank von frischem Schweinemist und der sauren Ausdünstung von lebendiger Schweinehaut. Man nahm das als gegeben in Kauf wie den Lärm in der Gasse der Kesselflicker und die Fliegen in der Gerbergasse. Die Schweine gehörten zum Alltag. Sie galten als unentbehrlich. In Friedenszeiten erledigten sie die Abfallbeseitigung; bei Belagerung aber versorgten sie die Eingeschlossenen mit frischem Fleisch. So manche mittelalterliche Stadt verdankte ihr Überleben dem eingebürgerten Borstenvieh, was sich belobigend in ihrem Namen widerspiegelte, von Eberswalde bis Schweinfurt.
»Weg da! Aus dem Weg!«, schimpfte Bruder Barnabas und trat dem jungen Schwein, das ihm den Weg versperrte, in den schmutzigen Schinken. Mit einem Quiekser fuhr der Frischling aus dem Mittagsschlaf. Er schüttelte sich, dass ihm die Schlappohren um den Schädel schlugen. Bruder Barnabas spürte angeekelt, wie ihm der Straßenkot über Stirn und Lippen spritzte.
»Zum Henker, oder nein: zum Metzger mit dir, du Schandfleck der Schöpfung!«
Im Weitereilen dachte er: Jesus wusste schon, was er tat, als er Satan in die Säue fahren ließ, sodass sich diese ins Meer stürzten und jämmerlich ertranken. Nur ein geröstetes Schwein ist ein gutes Schwein. Das haben sie mit den Häretikern gemein. Bruder Barnabas hing düsteren Gedanken nach, denn am Abend zuvor war er damit beauftragt worden herauszufinden, wer oder was hinter den Stadtbränden steckte.
Quousque abuterit patientia nostra? Wie lange missbraucht er noch unsere Geduld, dieser Feuerteufel?, hatte der Abt ausgerufen und dabei mit der Faust so heftig auf den Tisch geschlagen, dass man es noch im angrenzenden Scriptorium gehört hatte.
Zum Teufel, warum ausgerechnet ich?, dachte Bruder Barnabas. Warum hat man ausgerechnet mich mit der Lösung dieses Verbrechens beauftragt? Bin ich denn ein Büttel oder ein Exorzist? Wenn es irgendeinen im ganzen Kloster gibt, der für diese Aufgabe gänzlich ungeeignet ist, dann bin ich es: ein Einzelgänger, der sich lieber mit wissenschaftlichen Studien befasst als mit Menschen. Was weiß ich, was in den Köpfen dieser Bäcker, Metzger und Schneider vorgeht, warum sie ihre eigene Stadt in Brand stecken? Ich will es auch nicht wissen. Es ist mir gleichgültig.
Die Welt ist ein Irrenhaus. Wäre ich sonst ins Kloster gegangen? Das Geschehen da draußen interessiert mich nicht. Nicht dass ich nicht neugierig wäre. O nein, ich bin sehr neugierig, aber nicht auf das, was diese Krämerseelen hier anstellen oder unterlassen. Das geheime Walten der Natur, das Wissen um die Elemente der Alchimie, das ist es, was ich ergründen will. Der Weg zum Stein der Weisen, die Kunst des Goldmachens, die Kräfte des Mondes und des Elektrons, die alten Schriften des Aristoteles und die arabischen Texte des Avicenna und Abulcasis – welch eine Welt voller Wunder, die alle darauf warten, entdeckt zu werden! Das Laboratorium im Kellergewölbe der Mälzerei – das ist meine Welt. Ich bin ein Mann der Wissenschaft, einer, der rechnet, vergleicht, forscht, entdeckt.
»Das ist der Grund, warum ich dich und keinen anderen für diese Aufgabe ausgewählt habe«, hatte der Abt ihm auf seine Einwände erwidert. »Wenn einer diesen rätselhaften Fall lösen kann, dann bist du es. Dominus tecum! Der Herr wird dir helfen.«
Aber der Herr hilft nur dem, der sein Fach versteht, dachte Barnabas. So ist es in der Wissenschaft, und so ist es im Leben. Der erste Schritt ist immer der wichtigste. Doch wo beginnen?
Scheiße! Schon wieder trat er auf ein Schwein. Ein alter einäugiger Eber mit großen gelben Hauern. Er lag da wie tot. Tritte schreckten ihn nicht mehr. Er hatte Schlimmeres erlebt. Die Abgeklärtheit des leiderfahrenen Alters ging von ihm aus. Mit seinem Auge blickte er auf Barnabas, als wollte er sagen: Was weißt du schon vom Leben? Du kennst doch nur die Sonnenseite. Mir aber gehört die Nacht. Ich habe mit meinem einen Auge mehr wahrgenommen, als du mit beiden.
Wenn einer den Brandstifter kennt, so sind es die Schweine, dachte Bruder Barnabas. Ihnen gehört die Nacht. Sie wissen, wo der Feuerteufel ist, der unsere Häuser in Brand steckt.
Kapitel 2
Wolkenbewegter herbstlicher Himmel über dem Fluss. Der gewundene Weg gesäumt von steifen Pappeln. Aufgeregt wirbelte das silbrige Laub im Wind. Im Schatten der Bäume ein Reiter, barhäuptig und jung. Leichtfüßig trabte sein Pferd den Ufersaum entlang. Sie befanden sich auf dem Heimweg. Bei der nächsten Flussbiegung würden in der Ferne die Türme der roten Burg auftauchen.
Attila Toppler lehnte sich zurück und tastete mit der Linken nach den Bienenkörben hinter dem Sattelknauf. Wenn er seine Hand darauf legte, konnte er das vibrierende Brummen spüren. Der Korb bebte vom Zorn seiner Bewohner. Für sie war der rüttelnde Rhythmus des mehrstündigen Rittes eine Kampfansage. Die Knechte beim väterlichen Gut hatten die Fluglöcher mit Siegelwachs verschlossen.
»Gib gut Acht, dass sie nicht aufgehen!«, hatten sie ihn gewarnt, bevor sie die gefährliche Fracht auf sein Pferd geschnallt hatten. »Und bloß nicht vor morgen früh öffnen!«
»Ich werde mich hüten.«
Es war nicht das erste Mal, dass er Bienen transportierte. Die Imkerei war ein einträgliches Geschäft. Vor allem das Wachs war eine begehrte Ware. Attila mochte die Bienen. Wenn man sie richtig behandelte, waren sie harmlose, nützliche Gefährten.
Immen sind schwach in der Einzahl, aber gemeinsam schlagen sie selbst den Bären in die Flucht. Einer für alle, alle für einen. So brachte es Bruder Balduin seinen Schülern bei. Der Stock ist ihre Stadt, der Stachel ihre Wehr, die Wabe ihr Lagerhaus. Mit anderen Worten: Bienen sind Bürger wie wir. Lasst dem Adel seine Löwen und Adler. Unser Wappentier ist die Biene.
Ein auffliegendes Rebhuhn unterbrach Attilas Gedankengang. Er beschloss, eine kurze Rast einzulegen. Da vernahm er das Bellen, Hundegebell. Es klang böse.
Als er näher heranritt, sah er die beiden Männer. Sie schienen etwas zu jagen, das er aus der Entfernung nicht auszumachen vermochte, einen Biber oder einen Dachs. Auf jeden Fall war es ein fliehendes Wild, das im hohen Schilf des Flussufers Schutz suchte und das die Männer immer wieder mit lautem Geschrei und Gejohle aufschreckten und vor sich hertrieben, wobei sie mit ihren Lanzenschäften nach ihm stießen.
In dem älteren der beiden Männer erkannte Attila den Struzz zu Frickenhausen, einen üblen Haudegen, dem man besser aus dem Weg ging. Ritter Falk Struzz zu Frickenhausen trug eine blau-rote Narbe wie ein Kainsmal mitten im Gesicht. Sie zerpflügte Stirn, Braue, rechte Wange und verlor sich in dem struppigen Bart, der den größten Teil seines Gesichts bedeckte. Hemd und Wams waren zerschlissen und geflickt. Die Beine steckten in Lederstiefeln mit spanischen Sporen.
Der andere war mehr Knabe als Mann. Obwohl glattwangig und blond gelockt, hätte er ein Sohn des Bärtigen sein können. Er war aus dem Sattel gesprungen und hielt die Hunde, zwei Doggen mit eisenbeschlagenen Halsbändern. Der Speichel troff ihnen aus den geifernden Lefzen. Sie winselten vor Wut und rissen an ihren Leinen, bereit, ihr Opfer zu zerfleischen. Jäger und Hunde waren so mit sich selbst beschäftigt, dass sie Attilas Kommen nicht bemerkt hatten.
Halb verdeckt von herabhängendem Weidengeäst, beobachtete der junge Toppler das erregende Schauspiel. Jetzt ließ der Knabe den Doggen Leine. Sie schossen mit einem Satz ins Schilf. Gleichzeitig flog aus dem hohen Gras ein aufrecht gehendes, glatthäutiges Geschöpf. Attila fuhr sich erschrocken über die Augen, so als könne nicht wahr sein, was er sah. Er blickte auf ein Mädchen, nackt, mit aufgelöstem, langem schwarzen Haar. Es wollte fliehen. Da war der Bärtige hoch zu Ross schon neben ihm. Aus dem Sattel ließ er sich auf sein Opfer fallen. Der Aufprall warf beide zu Boden. Der Alte lag auf ihr. Mit seinem Gewicht hielt er sie nieder. Die Kleine kratzte und biss um sich wie eine Wildkatze. Sie erwischte seine linke Hand. Ein zorniger Aufschrei. Und schon war das Mädchen wieder frei.
»Na warte, du Hurenkind!«, schrie der alte Struzz. »Dir werde ich's zeigen.«
Sein Gesicht war rot vor Zorn und Anstrengung. Das Mädchen hatte sich dem Schilf zugewandt, wollte die schützende Deckung erreichen, doch dort versperrten ihm die Hunde den Weg. Die junge Frau zögerte, wollte fliehen, wusste nicht, wohin. Da war der Alte wieder bei ihr. Er griff nach ihr. Wie ein Aal entglitt sie ihm. Er erwischte sie bei den Haaren. Sie schrie. Ein hässliches Lachen war die Antwort. Doch bevor der Alte wusste, wie ihm geschah, hatte sie sich erneut in seine Hand verbissen. Ein Faustschlag ins Gesicht streckte sie zu Boden. Leblos wie eine Puppe lag sie im Gras, auf dem Rücken, die Arme ausgebreitet.
Der Alte betrachtete die Nackte mit sichtlichem Wohlgefallen. Er knöpfte sich den Hosenlatz auf und rief: »Komm her, mein Sohn! Schau sie dir an! Ein frisches, kräftiges Stück Fleisch, das nur darauf wartet, bearbeitet zu werden. Pflock die Hunde an!«
Dann streifte er die Stiefel von den Füßen, stieg aus seinem Beinkleid und warf es hinter sich ins Gras. Sein blasses Gesäß, schweißnass, dampfte wie frisch aus dem Backofen gezogenes Ferkelfleisch.
»Pass gut auf, wie ich es mache«, sagte er zu seinem Sohn. »Wenn ich sie gehabt habe, bist du dran.« Dabei kratzte er sich genüsslich den Bauch. Er ließ sich zwischen den Schenkeln des Mädchens auf die Knie fallen.
Attila vermochte nicht genau auszumachen, was weiter geschah. Der Junge verdeckte ihm die Sicht. Da war nur der Wind in den Weiden und das Fließen des Flusses.
Ein wilder Schrei zerriss die Stille.
Doch es war nicht das Mädchen, das da schrie, es war der Alte. Es klang schmerzvoll.
Und plötzlich kam das Mädchen wieder ins Blickfeld, aufrecht auf beiden Beinen.
»Mach die Doggen los!«, schrie der Alte. »Hetz ihr die Hunde auf den Leib!« Die Narbe in seinem Gesicht war aufgeplatzt. Der Bart troff von Blut. Es rann ihm die Brust und den Bauch hinab. »Greif dir das Miststück!«
Das Mädchen blickte sich um wie ein gehetztes Wild.
Da entdeckte es Attila, der sich in der Aufregung weiter aus seinem Versteck herausgewagt hatte, als es klug war. In panischer Angst flog das Mädchen auf ihn zu, die Doggen dicht hinter sich. Es rannte um sein Leben.
Alles, was von nun an geschah, geschah instinktiv. So wie sich beim Heranfliegen eines Gegenstandes unser Augenlid blitzartig schließt, so reagierte Attila, ohne einen Moment zu zögern. Er beugte sich zu der Fliehenden hinab, zog sie zu sich aufs Pferd, wendete den Hengst auf der Hinterhand. Während er das Mädchen mit der rechten Hand hielt, schnitt er mit der linken die Bienenkörbe los, die zu Boden purzelten und den anstürmenden Doggen entgegenrollten. Voller Wut verbissen die sich in den vermeintlichen Angreifer, der es wagte, sich ihnen in den Weg zu stellen. Bevor sie wussten, wie ihnen geschah, waren die erbosten Immen über ihnen. Attila nutzte das heulende Inferno und suchte in gestrecktem Galopp das Weite. Erst als er die Kuppe der bewaldeten Hügel erreicht hatte, wagte er es, sich umzublicken. Was er sah, gefiel ihm.
Am Flussufer schien noch immer die Hölle los zu sein. Die Bienen hatten sich auch über die Rösser hergemacht. Das eine wälzte sich auf dem Rücken im Gras, die Hufe hoch in der Luft. Das andere hatte sich losgerissen und war durch den Fluss geschwommen. Auch Struzz zu Frickenhausen und sein Sohn hatten sich in die Tauber geflüchtet, um ihre Stichwunden zu kühlen. Von den Doggen war nichts zu sehen. Die Bienen hatten sie umgebracht, wie Attila später erfuhr. Er glitt vom Pferd. Das Mädchen folgte seinem Beispiel. Schwer atmend standen sie sich gegenüber, fremd und doch miteinander verbunden durch die gemeinsam gemeisterte Gefahr, zwei Schiffbrüchige, die den Untergang ihres Schiffes überlebt hatten. So fühlten sie sich, erleichtert und erlöst.
Attila hatte zum ersten Mal Gelegenheit, sie aus der Nähe zu betrachten. Trotz Schmutz und blutiger Schrammen, trotz ihrer zerzausten Haare voller Kletten war sie eine junge Frau von außergewöhnlicher Anmut. Noch nie hatte Attila in zwei so nachtschwarze Augen geblickt. Tiere und Kinder haben solche Augen, so nass, leuchtend und beseelt. Überhaupt erinnerte sie ihn an ein junges Tier. Obwohl sie nackt war, schien sie ohne alle Scheu zu sein. Animalische Natürlichkeit ging von ihr aus. Wie eine Katze hatte sie gekämpft. Welch ein Mädchen! Schlank wie ein Knabe. Ganz und gar anders als alle Frauen, die Attila kannte.
Auch sie betrachtete ihn, als wollte sie ihm auf den Grund der Seele schauen. Attila zog sein Hemd aus und gab es ihr. Für einen Augenblick huschte der Anflug eines Lächelns über ihr Gesicht: »Danke.«
Mit raschen Bewegungen zog sie sich das Leinenhemd über den Kopf. Es bedeckte nur knapp ihre Blöße.
»In zwei Stunden geht die Sonne unter«, sagte Attila. »Dann wird es keinem mehr auffallen, dass dein Kleid zu kurz ist.«
»Warum tust du das?«, fragte sie.
»Was?«
»Warum hilfst du mir?«
»Ist es nicht Christenpflicht?«
»Die beiden Männer dort unten am Fluss sind auch Christen.«
»Das sind Schweine. Das sind keine Christen.«
»Auch ich bin keine Christin.«
Und als Attila sie anschaute, als habe er nicht recht verstanden, fügte sie hinzu: »Ich bin Jüdin.«
»Ach, deshalb ...«
»Ich verstehe dich nicht.«
»Ich meine, deshalb kenne ich dich nicht. Ich frage mich die ganze Zeit, wie es möglich ist, dass es in der Stadt ein Mädchen wie dich gibt, dem ich nie begegnet bin. Wie heißt du?«
»Judith. Josua Süßkind ist mein Oheim.«
»Du bist...« Attila brachte den Satz nicht zu Ende. Das Erstaunen stand ihm ins Gesicht geschrieben. Die Jüdin aus Aragon. Natürlich hatte er von ihr gehört. Sie war eine Sephardim, eine spanische Jüdin. Es hieß, der alte Süßkind hütete sie wie einen Schatz. Und jetzt das hier! Das einzige Kind des reichsten Juden der Stadt von zwei Rittern gejagt wie Freiwild. Es war nicht zu fassen.
»Wer bist du?«, fragte sie.
»Attila Toppler.«
»Dein Vater ist der Bürgermeister?«
»Du sagst es.«
»Du kennst die Männer?« Sie blickte hinunter zum Fluss.
»Wer kennt sie nicht: Struzz zu Frickenhausen und sein Sohn.«
Er hob sie aufs Pferd. Sie schien am Ende ihrer Kräfte zu sein. Die Augen geschlossen, das Kinn auf der Brust, kraftlos wie ein krankes Kind. Ihr Haar wehte im Wind. So ritten sie durch die immer länger werdenden Schatten des Tages. Keiner sprach. Sie lag in seinen Armen wie eine Tote. Ein Bauer kam ihnen entgegen. Erschrocken schlug er ein Kreuz, so als sehe er ein Gespenst. Attila wickelte sie in das Tuch, mit dem die Knechte seine Bienen zugedeckt hatten. Zum Glück war es bei ihrer Flucht am Sattelknauf hängen geblieben.
O mein Gott, wird das ein Gerede geben. Die Jüdin aus Aragon! Sie lebte noch nicht lange in Rothenburg. Der alte Süßkind hatte das Kind seines Bruders aus Aragon zu sich geholt, nachdem ihre Familie bei einem Autodafé verbrannt worden war. So wussten es die Leute in der Stadt. Sie erzählten sich auch, dass die kleine Jüdin wild wie ein Tier sei. Sie reitet wie der Teufel! Sie badet im Fluss! Sie jagt mit Pfeil und Bogen. Einige hielten sie sogar für einen Mann. Nun, ein Mann war sie nicht. Davon hatte sich Attila mit eigenen Augen überzeugt.
Das treibende Gewölk am Himmel verfinsterte sich. Kalt stieg der Abendnebel aus dem Taubertal. Weißer Dampf stand dem Pferd vor dem Maul. Aus dem Trab war längst ein schwerfälliger Trott geworden.
Beim Klingentor drängten sich die Herden, die allabendlich in die Stadt getrieben wurden. Zwischen schnatternden, flügelschlagenden Gänsen und brummenden Milchkühen nahm die Torwache nur flüchtig Notiz von ihnen. Ein Ochse, der sich sein Gehörn an der hölzernen Pavese blank scheuerte, beanspruchte ihre ganze Aufmerksamkeit.
»Weiter, weiter, blödes Vieh!«
»Begrüßt man so einen heimkehrenden Bürger?«
»Ach, Unsinn, Attila. Gott zum Gruß!«, lachten die Wächter. »Aber sag, was hast du da vor dir auf dem Pferd? Was verbirgst du da unter dem Tuch?«
»Ein Mädchen.«
»Ein Mädchen?«
»Ja, ein Mädchen. Und so viel ich weiß, ist die Einfuhr von Mädchen in unsere Stadt nicht verboten.«
»Nicht, wenn sie schön sind«, lachten die Wächter. »Ist sie schön?«
»Schöner als die Lilien auf dem Felde.«
Und als Attila weiterritt, ohne sich noch einmal umzudrehen, rief der Kräftigste der Torhüter, der eine Hellebarde in den Händen hielt: »Halt, wir wollen sehen, was du da hast.«
»Lass ihn«, sagte sein kahlköpfiger Kamerad. »Er hat einen langen Ritt hinter sich. Ich weiß, was unter dem Tuch steckt.«
»Woher willst du das wissen?«
»Er hat es mir erzählt, heute Morgen, als er zum Tor hinausritt. Er hat Bienen geholt.«
»Und warum verbirgt er sie vor uns?«
»Bienen brauchen Wärme.«
Mitgespült vom Strom der dampfenden Leiber, hielt sich Attila dicht bei der Stadtmauer, die rechter Hand steil zum Taubertal abfiel. Vorbei am Klingenturm und am Strafturm lenkte er das müde Pferd. Zwei Raben zankten sich laut krächzend um den Kadaver einer toten Henne. Kinder warfen Steine nach einem Schwein, das sich in einer Pfütze wälzte. Darüber trockneten fleckige Laken im Wind.
Ein Geruch von saurem Kohl und gebratenen Zwiebeln, von Holzkohle und heißem Schmalz quoll aus offenen Fenstern und Türen. Eine Klosterfrau eilte vorüber, den Blick zu Boden gesenkt. Der Rosenkranz in ihren Händen bewegte sich im Takt ihrer Schritte: »Christus optimus princeps et dux.« Kinderweinen, das Klappern von Töpfen und Pfannen verschluckten ihre Worte.
Als Attila die Judengasse erreichte, erschrak er für einen Augenblick. Leer und verlassen lag sie vor ihm, als sei sie unbewohnt. Keine Menschenseele, kein Laut, kein Licht. Tiefschwarz die Fensterlöcher: erblindete Augen, frisch ausgehobene Gräber. Nur der harte Schlag der Pferdehufe auf dem Kopfsteinpflaster war zu hören. Doch erklang da nicht Gesang?
In der Synagoge brannte Licht. Dort feierten die Juden der Stadt Schawuot, den Festtag, an dem Moses am Berg Sinai die Zehn Gebote aus der Hand Gottes empfangen hatte.
Als der Hengst anhielt, hob Judith den Kopf.
»Wir sind am Ziel«, sagte Attila. Gleichzeitig glitten sie beide hinab auf die Straße, der eine links, die andere rechts vom Pferd. Der hohe Rücken des Tieres trennte sie für einen Augenblick. Attila vernahm ein paar rasche Schritte. Eine Tür fiel ins Schloss. Dann stand er allein auf der Straße.
Ein paar Herzschläge wartete er noch, so als könnte dieser plötzliche Abschied nicht alles gewesen sein, als müsste noch irgendetwas geschehen. Aber er wartete vergeblich.
Als er zu Fuß – das Ross am Halfter – die Obere Schmiedgasse erreichte, glaubte er, nur geträumt zu haben. Aber wo hatte er dann seine Bienen verloren? Nein, es war kein Traum, und es war dennoch ein Traum.
***
Das Schacharit, das tägliche Morgengebet, war längst gesprochen. Josua Süßkind und Rebecca, seine Frau, hatten sich in den hinteren intimen Teil ihres geräumigen Hauses zurückgezogen, wo die Fenster in einen Innenhof blickten, der von wildem Wein zugewuchert war und von der Straße nicht eingesehen werden konnte. Ein Kerzenleuchter erhellte den Raum. Mehrere gerahmte venezianische Spiegel reflektierten das flackernde Licht. Im Kamin brannte ein Feuer. Dicht daneben hatte sich Rebecca niedergelassen. Josua Süßkind lief im Zimmer auf und ab. Obwohl auf das Äußerste erregt, strahlten seine langsamen, kontrollierten Bewegungen jene Souveränität aus, die ein Ausdruck von Überlegenheit ist.
»Diese Schande! Adonai, diese Schande!«
»Ein Goldstück verliert nicht an Wert, nur weil es von einem Schwein beleckt worden ist. Die Mikwa wird allen Schmutz abwaschen.«
»Schande lässt sich nicht abwaschen, nicht einmal mit Blut.«
»Du übertreibst«, sagte Rebecca. »Was ist geschehen? Nichts ist geschehen, nichts von Bedeutung. Unserer Tochter wurde beinahe Gewalt angetan, beinahe. Beinahe wäre die ganze Stadt abgebrannt. Wie oft sind wir schon beinahe gestorben. Aber wir leben. Das Leben ist voller Beinahe.«
»Aber die Schande ...«
»Niemand wird davon erfahren. Die beiden Ritter werden kein Wort über die Angelegenheit verlieren. Sie würden sich zum Gespött der ganzen Stadt machen. Wer brüstet sich schon mit solch einer Peinlichkeit? Zwei Herrenmenschen lassen sich von einem Jungen und ein paar Bienen in die Flucht schlagen, mit heruntergelassener Hose und zerstochenen Ärschen. Welch ein Bild des Jammers! Nein, glaube mir, sie werden schweigen wie die Fische. Das Gleiche werden wir tun.«
»Und der junge Toppler?«
»Du musst mit seinem Vater reden. Als Bürgermeister ist ihm daran gelegen, Schande und Fehde von der Stadt fernzuhalten. Vor allem sollten wir uns bei dem Jungen bedanken. Ohne ihn wäre die Geschichte schlimm ausgegangen. Wir werden ihn einladen.«
»Einladen?«
»Ja, oder willst du dich auf der Straße bei ihm bedanken?«
»Ein Goi an unserem Tisch? Kennst du nicht die Kaschrut-Vorschriften? Hat Maimonides nicht geschrieben: Das Geheimnis jüdischen Überlebens liegt in der Absonderung. Die Speisegesetze lassen sich nur befolgen, indem ihr euch abseits von denen aufhaltet, die sie ablehnen. Wenn wir mit ihnen zusammen essen, werden sich unsere Söhne mit ihren Töchtern verheiraten. Und das Judentum wird nicht rein erhalten bleiben. So steht es geschrieben.«
»Aber es steht auch geschrieben: Nichts zählt vor dem Herrn so hoch wie eine gute Tat. Und es heißt mit Recht: Dankbarkeit ist das Gold der Großherzigen. Außerdem kannst du dich gar nicht wirklich absondern. Leben wir nicht unter Christen? Wir brauchen sie wie der Bauer den Boden.«
»Kein Bauer holt sich den Boden ins Haus. Er braucht ihn, aber er lässt ihn draußen. Er liebt ihn nicht.«
»Warum sollte er auch? Liebe ist ein kostbares Elixier. Wie unerträglich wäre die Welt, wenn sie voller Liebe wäre. Wenn der Prophet Jesus wirklich gesagt hat: Liebe alle Menschen wie dich selbst, so war er ein lebensfremder Fantast. Achte sie, habe Mitleid mit ihnen, respektiere ihre Würde! Aber lieben? Wie viel verdanke ich denen, die ich nicht liebe? Sie rauben mir nicht die innere Ruhe wie die, an denen mein Herz hängt. Sie lassen mir meinen Frieden und meine Freiheit, die ich so dringend benötige wie die Luft zum Atmen. Vor allem aber brauche ich jetzt Schlaf.«
Sie erhob sich aus ihrem Sessel, küsste Josua auf die Wange und sagte: »Lieber, du siehst müde aus.« Und als sie schon nebeneinander in ihrem Bett lagen, ermahnte sie ihn noch: »Vergiss nicht, dem Jungen die Immen zu ersetzen.«
***
Am anderen Morgen legte Josua Süßkind seinen pelzbesetzten Mantel aus bestem Brabanter Tuch an, nahm Hut und Stock, ohne die er nie das Haus verließ. Wenn es auch in Rothenburg keine demütigende Kleidervorschrift für Juden gab, wie sie seit dem vierten Laterankonzil immer wieder gefordert wurde, so legte er doch großen Wert darauf, schon von weitem als Jude erkannt zu werden. Der Vollbart – nach jüdischer Art ungestutzt – vollendete das Bild. Im Rathaus erfuhr er, dass der Bürgermeister nach Nürnberg zum Burggrafen geritten sei und erst gegen Sonntag zurückerwartet werde.
Vor dem Haus Zum goldenen Greifen drängte sich eine Schar von Bäuerinnen, beladen mit geflochtenen Käfigen voll gackerndem Geflügel. In ihrer Mitte erkannte Josua den jungen Toppler, der damit beschäftigt war, die lebende Pacht der Topplerschen Bauernhöfe in Empfang zu nehmen. Er zählte die zappelnden Hennen, hob sie prüfend an den Füßen empor, übergab sie einem Hausknecht und verzeichnete dann mit einem Gänsefederkiel den Eingang in ein ledergebundenes Buch. Ein kleines Mädchen hielt ihm das Tintenfass. Es war ein Bild bäuerlicher Lebensfreude. Das Flügelschlagen und Gackern der Hennen, begleitet vom Lachen und lauten Reden der Bäuerinnen, die für den Gang in die Stadt ihre guten Gewänder aus den Truhen geholt hatten. Das Spektakel war denkbar ungünstig für ein ernsthaftes Gespräch. Josua Süßkind wollte sich schon zurückziehen, als Attila ihn erkannte: »Bitte bleibt! Ich bin gleich fertig.«
Drei Dutzend Hennen später führte er seinen Gast in ein Zimmer des oberen Stockwerks. Er wollte Zinnkrüge und Wein holen, doch Josua Süßkind wehrte ab: Der Tag ist noch zu jung, und ich bin zu alt. Ich bin gekommen, um dir zu danken und um von dir zu hören, wie sich das Schandwerk zugetragen hat.«
Attila erzählte. Als er zu der Stelle kam, an der Struzz das Mädchen mit einem Faustschlag niedergestreckt und sich seiner Hosen entledigt hatte, schlug der Alte die faltigen Hände vor das Gesicht, um Zorn, Schmerz und Scham zu verbergen.
»Und er hat sie wirklich nicht...?« Er suchte nach dem passenden Verb.
»Nein, sie hat sich gewehrt wie eine Wildkatze.«
»Dieser Höllenhund und sein Geierküken.«
»Vergesst ihn.«
»Ich vergesse nie etwas, weder die Gemeinheiten meiner Gegner noch den Beistand meiner Freunde.« Dabei blickte er Attila in die Augen. Es war wie ein Treueschwur unter Kampfgefährten. Einen Atemzug lang waren sich die beiden unterschiedlichen Männer so nahe wie Vater und Sohn.
Josua holte aus den Falten seines Mantels einen Lederbeutel hervor und legte ihn auf den Tisch.
»Was soll das? Wollt Ihr mich bezahlen?«
»Lass mich wenigstens für den Schaden aufkommen.«
»Ich nehme kein Geld.« Es klang zornig.
»Verzeih mir, Attila, ich wollte dich nicht kränken. Darf ich dir zwei Bienenvölker und ein neues Gewand kaufen?«
»Das ist etwas anderes.«
Der Alte betrachtete den Jungen prüfend, bevor er fragte: »Würdest du in mein Haus kommen, wenn ich dich einlade?«
»Warum wollt Ihr das tun?«
»Judith schuldet dir noch ihren Dank.«
»Wie geht es ihr?«
»Es geht. Sie hat Schlimmeres überlebt. Wirst du kommen?«
»Aber ja, gerne.«
Josua Süßkind bemerkte, dass die Augen des Jungen freudig aufleuchteten: »Aber ja, gerne.« Die Antwort erfolgte rasch und unüberlegt, mehr aus dem Herzen als aus dem Kopf kommend. Und so, als schämte er sich seiner Gefühle, fügte er betont sachlich hinzu:
»Was ich euch schon die ganze Zeit fragen wollte: Wie ist Eure Tochter zur Tauber hinabgelangt? Ich meine, hatte sie ein Pferd? Ich habe keines gesehen.«
»Die Torwächter haben es heute Morgen vor den Mauern der Stadt eingefangen, bis auf ein paar Bienenstiche unversehrt. Woher hattest du überhaupt die Bienen?«
»Ich wollte sie vom Gut Nordenberg in die Stadt holen.«
»Und wie bist du auf die Idee gekommen, sie als Waffe einzusetzen?«
»Ich hatte keine andere Wahl.«
»Fürwahr, eine wirksame Waffe. Wir sollten zur Verteidigung der großen Mauer in Zukunft statt Pech Bienen einsetzen. Im Gegensatz zum Pech würde die neue Stichwaffe der Stadt noch zusätzlich erheblichen Gewinn einbringen.«
Und als Attila lachend den Kopf schüttelte, sagte Süßkind: »Ich meine es ernst. Die Idee ist gut. Ich werde die Anschaffung der ersten Immenvölker aus eigener Tasche finanzieren.«
Kapitel 3
Der Gang hinab in die Unterwelt jagte Judith jedes Mal aufs Neue Schauer über die Haut. Es war nicht die Grabeskühle, die aus dem lichtlosen Schacht aufstieg, es war der heilige Schauer, der von diesem Ort ausging wie von einer geöffneten Gruft, ein Gefühl, als griffe eine kalte Hand nach ihrem Herzen.
Die beiden Frauen hielten sich fest bei den Händen, wie zwei Kinder, die sich im Wald verlaufen haben. Rebecca trug in der Linken eine brennende Fackel. Zappelig wie Fledermausflug huschte das Flammenlicht über die rauen Wände des engen Schachtes, gerade groß genug für die steinerne Treppe. Der Fels hatte die Farbe von Knochen und geronnenem Blut. Fackelruß mischte sich mit dem Rost der eisernen Ringe, die das Geländerseil hielten. Die Meißel, mit deren Hilfe der Brunnenschacht aus dem felsigen Grund geschlagen worden war, hatten wie nagende Zähne sichtbare Kerben hinterlassen. Erdrückender als Finsternis und Enge war die Stille, die nur vom Fallen der Tropfen unterbrochen und gespenstisch verstärkt wurde.
Die Frauen wagten nicht zu sprechen. Schweigend zählten sie die Anzahl der Stufen: zwanzig, dreißig, vierzig, vierundvierzig Schritte hinab in die Unterwelt, in die dunkle Welt der Wurzeln, zum Urgrund allen Wassers.
Als sie die Sohle des Ritualbades erreicht hatten, entzündete Rebecca zwei weitere Fackeln und steckte sie in die dafür vorgesehenen Eisenringe an der Wand. Judith legte ihre Gewänder ab. Ohne einen Atemzug lang zu zögern, stieg sie in das kristallklare Becken. Langsam kniete sie nieder. Das Wasser reichte ihr bis über die Brüste. Die frische Kühle belebte sie. Nie war sie sich ihres Leibes so bewusst wie im Wasser. Sie genoss das wohlige Prickeln auf der nackten Haut, das Anschwellen der Brustknospen. Von den Zehenspitzen bis zu den Ohrläppchen – da war keine Stelle ihres Körpers, die sie nicht mit allen Sinnen empfand. Sie spürte, wie sich ihr After zusammenzog, fühlte den Fluss des Blutes in den Halsschlagadern; deutlich vernahm sie das Pochen ihres Herzens. Wohliges Frösteln ergriff sie.
»Ist es schlimm?«, fragte Rebecca.
»Nein, es ist herrlich!«
»Du bist der reinste Fisch.«
»Ich liebe das Wasser. Es erfüllt mich mit Leben. Für gewöhnlich nehmen wir unseren Körper nur wahr, wenn er uns wehtut. Wir spüren unser Gehirn nur, wenn wir Kopfschmerzen haben. Knochen und Zähne erwachen erst zum Leben, wenn sie schmerzen. Aber im Wasser begegnen wir uns selbst wie nirgendwo sonst.«
»Ist das der Grund, weshalb du in der Tauber badest?«
»Gibt es Schöneres, als in einem Fluss zu schwimmen oder sich von den Wellen des Meeres tragen zu lassen?«
»Wie kann man als Frau in einen Fluss steigen, völlig entblößt?«
»Als Kinder haben wir in Aragon ...«
»Judith, du bist kein Kind mehr. Wann wirst du endlich erwachsen? Du wirst bald sechzehn. Du bist jetzt eine Frau und tätest gut daran, Vernunft anzunehmen.«
Judith überhörte den Einwand. Sie fuhr mit der Hand durch das Wasser und erklärte: »In Aragon bestatten sie ihre Toten im Ozean. Sie sagen nicht: Vom Staube kommst du, zum Staube kehrst du zurück. Sie sagen: Aus dem Wasser kommst du, zum lebendigen Wasser kehrst du heim. Wasser ist Leben. Hast du schon einmal einen Ertrunkenen gesehen? Sie tragen ein Lächeln auf den Lippen. Es muss ein schöner Tod sein, der leichteste, sagen die Fischer auf dem Ebro, im Gegensatz zum Tod in den Flammen, der grausamsten Art, aus dem Leben zu scheiden. Gibt es Schlimmeres, als verbrannt zu werden?«
Rebecca bemerkte, wie Judiths Miene sich verfinsterte. »O Kind«, rief sie, um von dem Thema abzulenken, »pass auf, dass du dich nicht erkältest!« Dabei streckte sie ihr das auseinander gefaltete Leinentuch entgegen: »Komm, lass dich abtrocknen.«
Und als Judith noch tiefer ins Wasser eintauchte, sagte sie: »Die Mikwa ist kein Bad, sondern ein rituelles Becken.«
»Benutzen eigentlich auch Männer die Mikwa?« fragte Judith.
»Früher taten sie es, vor dem Sabbat und vor den Festtagen. Heute gehört sie uns ganz allein, um die Tohora, die Reinheit, nach der Monatsblutung wiederzugewinnen. Erst danach darf ein Mann sein Weib umarmen.«
Judith strich sich die Haare aus der Stirn und fragte: »Was für ein Gefühl ist es, von einem Mann umarmt zu werden?«
Während Rebecca noch nach den richtigen Worten suchte, fragte sie weiter: »Ist es schön?«
»Ja, sehr schön.«
»Wirklich?«
»Ja. Warum fragst du?«
»Ich fand es widerlich, ganz widerlich. Der Mann am Fluss hatte die Haut eines Schweines, bleich und behaart. Er stank wie ein Ziegenbock, nach Schweiß, Schmutz und Fäulnis. Der Speichel floss ihm aus der Schnauze wie einem Schwein. Die Rute rot und klebrig. Wie ekelhaft!«
Sie sprach mit geschlossenen Augen, so als sähe sie das Geschehen noch einmal vor ihrem geistigen Auge. Rebecca beobachtete sie. Sie dachte: Wie heißt es im Talmud? Die Klage ist ein Teil der Befreiung. Auch Worte vermögen zu reinigen.
»Warum benötigen wir Männer«, wollte Judith wissen, »um Kinder zu kriegen? Warum reifen sie in unseren Leibern nicht von allein heran? Legen die Hühner nicht auch Eier ohne den Hahn? Hast du mal zugeschaut, wie eine Kuh gedeckt wird? Ihre Flanken zittern vor Angst, oder ist es Ekel? Der Stier bespringt sie mit der Brutalität eines hungrigen Raubtiers. Da ist keine Spur von Liebe.«
»Du kannst doch nicht Tiere mit Menschen vergleichen.«
»Bei den Menschen ist es nicht anders.«
»Wie kannst du so etwas behaupten?«
»Ich habe als kleines Mädchen in den Ställen mit angehört, wie die Knechte die Mägde geliebt haben. Haben sie sie wirklich geliebt? Ihr Röcheln und Stöhnen war grauenhaft. Es klang schmerzvoll.«
»Eines Tages wirst du anders darüber denken«, sagte Rebecca, »wenn der richtige Mann ...«
»Nein, niemals«, unterbrach sie Judith. »Niemals will ich einem Mann gehören, niemals.«
»Aber Kind, die Männer ...«
»Zur Hölle mit ihnen! Das Feuer soll sie fressen, diese bärtigen Teufel! Die Männer am Fluss haben mich gejagt wie wilde Hunde, tollwütige Wölfe. Es hätte nicht viel gefehlt, und sie hätten mich getötet, aus Geilheit gemordet, nur weil ich eine Frau bin. Sind das noch Menschen?«
»Aber Judith ...?«
»Ich wollte, ich wäre ein Mann und könnte gegen sie kämpfen. Ich würde diese Schweine in Stücke hauen. In ihrem Blut sollten sie sich wälzen. Ich hasse sie. Ich hasse sie alle!«
Die letzten Worte hatte sie so wild ausgestoßen, dass sich Rebecca entsetzt die Ohren zuhielt. Vielfach verstärkt hallte Judiths Zorn durch den engen Schacht. Nie war dieser rituelle Ort so von Hass entweiht worden. Ihre Fäuste peitschten das Wasser. Eine schaurige Klage voller Verzweiflung, Hilflosigkeit und Hass. Am Ende ließ sie sich erschöpft in dem kalten Wasser versinken. Als sie wieder auftauchte, hatte sie ihre Fassung zurückgewonnen. Der Sturm war vorüber.
Die rituelle Reinigung war abgeschlossen.
***
Nach rechts gekrümmt wie die Sichel des abnehmenden Mondes, so stieg die Judengasse zum Weißen Turm hin an, so steil, dass ein beladenes Pferdegespann Mühe hatte, die Steigung zu überwinden. Auf halber Höhe, dort, wo die Deutschherrengasse die Judengasse kreuzte, lag das Haus Süßkind. Seine Fassade unterschied sich nur wenig von den Nachbarhäusern. Die niedrige Pforte und die kleinen Fenster, vergittert mit rostigem Schmiedeeisen, verrieten nichts von dem Wohlstand der Bewohner. Überschritt man aber die Türschwelle, so war man überrascht von der großzügigen Weiträumigkeit des Hauses.
Attila blickte in eine hohe, hallenartige Diele, von der verschiedene Zimmer abzweigten. Eine Treppe verband das Untergeschoss mit den darüber liegenden Stockwerken.
Aus einer geöffneten Doppeltür fiel helles Licht. Dorthin führte Josua Süßkind seinen Gast, nachdem er ihn eigenhändig eingelassen hatte. Sie betraten einen holzgetäfelten Raum, erleuchtet von zahllosen Kerzen. Ihr Licht fiel auf einen festlich gedeckten Tisch mit Trinkbechern, Tellern und Schüsseln von funkelndem Zinn, so blank wie venezianisches Spiegelglas.
»Erwartet Ihr außer mir noch andere Gäste?«, fragte Attila.
»Nein, du bist unser einziger Gast, unser Ehrengast.«
»Ich weiß nicht...«
»Was weißt du nicht?«
Ein Schrei unterbrach ihr Gespräch, ein schrilles Kreischen, eine raue Stimme in höchster Todesangst.
»Um Gottes willen, was ist das?«
»Komm, ich will dir etwas zeigen«, sagte der Hausherr. Er öffnete die Tür zu einem angrenzenden Kabinett. Das Kreischen schwoll an und überschlug sich in höchstem Diskant.
Süßkind lüftete ein Tuch. Darunter kam ein Käfig zum Vorschein. Attila erblickte einen Vogel mit einem Federkleid von so leuchtender Farbenpracht wie ein Kirchenfenster.
»Was ist das für ein prächtiges Geschöpf? Es sieht aus, als käme es direkt aus dem Paradies.«
»Nun, aus dem Garten Eden stammt er nicht«, lachte Süßkind. »Einer meiner Geldboten hat ihn aus dem Maghreb mitgebracht. Die Mauren nennen ihn al-Maharab. Meine Tochter ruft ihn Jakob.«
Er öffnete den Käfig und streckte die Hand aus. Ohne alle Scheu bestieg sie der Vogel. Dabei neigte er den schönen Kopf und betrachtete Attila von der Seite her mit einem Auge. Es war bernsteinfarben und voller Neugier.
»Er sieht so aus, als wäre er nicht nur schön, sondern auch klug.«
»So ist es. Er kann mit menschlicher Stimme sprechen.«
»Er kann sprechen? Ihr scherzt.«
»Nun, nicht wirklich so wie wir. Aber er kann einzelne Wörter, ja ganze Sätze erlernen und aufsagen.«
So als hätte der Wundervogel sie verstanden, reckte er sich zu voller Größe und krächzte: »Judith.«
»Da bin ich ja schon«, lachte eine Stimme hinter ihnen.
Attila fuhr herum. Vor ihm stand das schönste Mädchen, dem er je begegnet war.
Sie gab ihm die Hand und sagte: »Schalom, Attila.«
Ihm war so, als blicke er in das Gesicht eines Engels mit himmlisch leuchtenden Augen, umrahmt von nachtschwarzen Locken. Sie war hoch gewachsen, hatte lange Beine, lange Wimpern, langes Haar; alles an ihr war ungewöhnlich lang wie bei einem jungen Fohlen. Sie entzog ihm die Hand, die er nicht loslassen wollte. Sie lächelte ihn selbstsicher an, so als wüsste sie, wie schön und begehrenswert sie war. Er kam sich klein vor neben ihr, obwohl sie ihm nur bis zur Schulter reichte und jünger war als er. Keine Spur mehr von der gehetzten, hilflosen Halbwilden, die er nackt am Ufer der Tauber aufgelesen hatte. Er spürte, wie ihm die Röte ins Gesicht stieg.
»Du hast dich gut erholt«, sagte er. Sie spürte die freudige Erregung, die ihr Erscheinen ausgelöst hatte, und genoss es. »Schön, dass du gekommen bist, Attila.«
»Ja, es ist schön«, sagte Rebecca, die die Treppe herunterkam und Attila beide Hände entgegenstreckte. Es war eine herzliche Geste, so wie man einen Freund empfängt.
Später auf dem Heimweg wusste Attila nicht mehr mit Bestimmtheit zu sagen, was er gegessen und getrunken hatte. Aber er erinnerte sich sehr genau an die Gespräche, an ihre Gesichter. Da waren Rebeccas Augen, von dem hellen Grün reifer Trauben. Lebhaft und temperamentvoll war die Sprache ihrer Hände. Auffällig glatt und hell ihre Haut. Ein seidenes Tuch bedeckte ihr Haar. Erst später erfuhr er, dass Jüdinnen bei der Hochzeit kahl geschoren werden wie die Nonnen. Sie lachte viel und sprach mit rollendem R.
Im Vergleich zu seinem Weib wirkte der alte Süßkind wie ein alter Mähnenwolf neben einem Reh. Der ergraute Bart ließ ihn älter erscheinen, als er an Jahren war. Wie alle Kurzsichtigen kniff er bei gründlicher Betrachtung die Augen zusammen, wobei er sein Gesicht zu einer Grimasse verzog, die ihm etwas Verschlagenes gab.
Aber da war vor allem Judith. Welch ein Mädchen!
»Warum tut Ihr das für mich?«, hatte er seine Gastgeber gefragt. »Warum bewirtet Ihr mich wie einen großen Herrn?«
»Um dir zu danken.«
Und als Attila noch immer nicht verstand, sagte Süßkind: »Wer so viel Bedrohung überlebt hat wie wir Juden, muss wohl ein besonderes Verhältnis zum Dank entwickelt haben. Dank ist nicht nur eine Tugend, Dank hilft auch zu überleben.« Er hob seinen Weinbecher: »Vor allem aber schafft er Freunde. Ist es nicht so, Rebecca?« Sie legte ihre Hand auf die seine und erwiderte: »Nicht immer gewinnt man zum Freund, dem man hilft. Häufiger gewinnt man zum Freund den, von dem man sich helfen lässt.«
Als Attila den Lammbraten an Judith weiterreichen wollte, sagte sie: »Nein, danke. Wer Fleisch isst, unterstützt das Gesetz der Wildnis. Gott hat uns nicht als Raubtiere erschaffen. Erst der Sündenfall hat uns dazu gemacht. Im Paradies gab es keine Fleischfresser. Der Verzicht auf Fleisch ist mein Bekenntnis zur Schöpfung, wie sie sein sollte.«
»Judith hat ihre eigene Religion«, sagte Rebecca entschuldigend zu Attila. Sie nahm eine Scheibe Fleisch und fügte spöttisch hinzu: »Sie lehnt sogar Bittgebete ab.«
»Und warum?«, wollte Attila wissen.
»Jedermann bettelt heutzutage«, erwiderte Judith lebhaft, »nicht nur die Armen, sondern auch die Reichen: Kauft meine Waren, vergebt mir meine Verbrechen. Selbst der König bettelt um die Gunst der Kurfürsten. Ich verlange von niemandem etwas, nicht einmal von meinen Freunden und erst recht nicht von Gott. Er soll tun, was er für richtig hält. Ist das Sünde?«
»Du sprichst nicht wie ein Mädchen, sondern wie ein Mann«, sagte Süßkind. »Was glaubst du, wer du bist?«
»Judith!« rief der Paradiesvogel aus dem Nebenzimmer.
»Da hast du die Antwort«, lachte Judith. Und nun lachten auch die anderen, der alte Süßkind am lautesten.
Josua füllte ihre Becher mit weißem Wein, den er Jajin mebussam nannte, mit Honig gesüßt und mit Pfeffer gewürzt. Später gab es feinsten Duftwein mit den Blüten des wilden Weinstocks aus dem Heiligen Land.
»Weißt du eigentlich, wer der heilige Attila war?« fragte Rebecca.
Und als Attila verneinend den Kopf schüttelte, sagte sie: »Er war ein Aragonese. Sein Leib ruht in Ildefonso zu Zamora, sein Kopf in der Kathedrale von Toledo.«
»Haben sie ihn enthauptet?«
»Nein«, lachte Rebecca«, sie haben ihn so sehr verehrt, dass sie sich um seine Gebeine stritten.«
Und Judith hatte ihn gefragt: »Unter welchem Sternbild bist du geboren, Attila?«
»Hier, unter den Sternen dieser Stadt.«
»Nein, ich will nicht wissen, wo, sondern wann du das Licht der Welt erblickt hast«, erklärte Judith.
»Am Tag des heiligen Attila.«
»Und wann ist das?«
»Der erste Tag im Erntemonat.«
»Ach, an Rosch ha-Schana«, sagte Rebecca.
»Wann?«
»Am Neujahrstag.«
»Aber der ist doch nicht im Erntemonat.«
»Der jüdische schon«, belehrte ihn Josua.
Seltsam, dachte Attila auf dem Heimweg durch die dunklen Gassen. Wir leben in derselben Stadt, im Schutz derselben Mauer und leben dennoch in verschiedenen Welten. War es nicht allgemein üblich, dass jedermann sein eigenes Messer und seinen Löffel mitbrachte, wenn er zum Essen eingeladen wurde? Bei den Süßkinds aber lagen sie auf dem Tisch und waren nicht etwa aus Holz oder Horn, sondern aus schwerem Silber.
Während es in den meisten Häusern der Stadt an jenem Mittwochabend geselchtes Schweinefleisch mit Kohl gab, wurden hier in der Judengasse Eiersuppen mit Safran serviert, Pfefferkuchen, Ingwer und Mandelbitter, Stockfisch und gesüßter Rahm und Dinge, die er nicht einmal mit Namen kannte.
Selbst die Zeit vergeht anders für sie als für uns. Ihr Kalender ist nicht unser Kalender. Ihre Festtage sind nicht unsere Festtage. Wenn wir von der Arbeit ausruhen, dann arbeiten sie. Ihr Sonntag ist der Samstag. Sie schreiben das Jahr 6160 und wir das Jahr 1390. Gibt es größere Distanzen als die der Zeit? Nichts ist so weit entfernt wie der gestrige Tag. Vielleicht altern sie sogar anders als wir. Vielleicht ist ein Judenlebensjahr viel länger oder kürzer als ein christliches. Judith war sechzehn, aber sie wirkte viel reifer.
Nein, dachte er, das kann nicht sein. Sie sind Menschen wie wir. Aber sind sie das wirklich? Hatte er nicht in der Klosterschule gelernt, dass nur Getaufte eine unsterbliche Seele besitzen? Ein Geschöpf ohne Seele aber war kein Mensch. Was waren sie denn? Tiere? Nein. Ungläubige? Sie hatten einen Gott, aber einen anderen. Es gibt nur einen Gott, so lautet das erste Gebot. Also beteten sie einen falschen Gott an, einen Götzen. Aber wie war das doch: Hatte nicht Moses die Zehn Gebote von Gott empfangen? Und Moses war ein Jude. Das Leben erschien ihm so kompliziert wie nie zuvor. Schade, dass sie eine Jüdin ist, dachte er beim Einschlafen.
In jener Nacht träumte er zum ersten Mal von ihr: Gefühle, Bilder und Berührungen, die sich nicht in Worte fassen ließen.
Kapitel 4
Es regnete seit Sonnenaufgang, oder richtiger: seit Tagesanbruch, denn die Sonne war an jenem Morgen erst gar nicht aufgegangen. Sie hatte sich hinter tief hängenden Wolken versteckt, als schäme sie sich, wie abgezehrt und altersschwach sie in letzter Zeit geworden war.