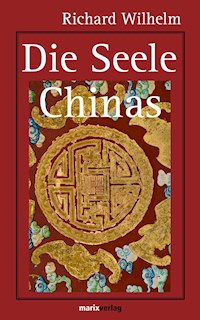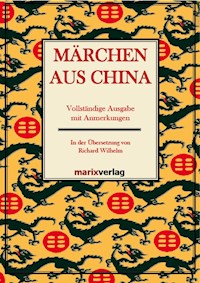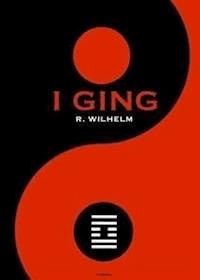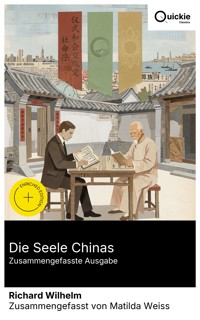0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In 'Die schönsten chinesischen Märchen' präsentiert Richard Wilhelm eine Sammlung faszinierender Geschichten aus der chinesischen Folklore, die sowohl die Fantasie als auch die Weisheit der chinesischen Kultur widerspiegeln. Wilhelm, ein renommierter Sinologe und Übersetzer, verbindet in diesem Buch traditionelle chinesische Erzählungen mit seinem einzigartigen literarischen Stil, der es schafft, die kulturellen Nuancen und die Poesie der Originaltexte ins Deutsche zu übertragen. Diese illustrierte Ausgabe bietet nicht nur eine ansprechende Lektüre, sondern auch einen Einblick in die traditionelle chinesische Erzählkunst und deren Bedeutung für die moderne Literatur. Richard Wilhelm, dessen Leidenschaft für die chinesische Kultur und Sprache in jeder Seite spürbar ist, hat mit diesem Buch einen Klassiker geschaffen, der Leser jeden Alters anspricht. 'Die schönsten chinesischen Märchen' ist ein Muss für alle, die sich für chinesische Folklore, Literatur und kulturelle Vielfalt interessieren. In dieser bereicherten Ausgabe haben wir mit großer Sorgfalt zusätzlichen Mehrwert für Ihr Leseerlebnis geschaffen: - Eine umfassende Einführung skizziert die verbindenden Merkmale, Themen oder stilistischen Entwicklungen dieser ausgewählten Werke. - Ein Abschnitt zum historischen Kontext verortet die Werke in ihrer Epoche – soziale Strömungen, kulturelle Trends und Schlüsselerlebnisse, die ihrer Entstehung zugrunde liegen. - Eine knappe Synopsis (Auswahl) gibt einen zugänglichen Überblick über die enthaltenen Texte und hilft dabei, Handlungsverläufe und Hauptideen zu erfassen, ohne wichtige Wendepunkte zu verraten. - Eine vereinheitlichende Analyse untersucht wiederkehrende Motive und charakteristische Stilmittel in der Sammlung, verbindet die Erzählungen miteinander und beleuchtet zugleich die individuellen Stärken der einzelnen Werke. - Reflexionsfragen regen zu einer tieferen Auseinandersetzung mit der übergreifenden Botschaft des Autors an und laden dazu ein, Bezüge zwischen den verschiedenen Texten herzustellen sowie sie in einen modernen Kontext zu setzen. - Abschließend fassen unsere handverlesenen unvergesslichen Zitate zentrale Aussagen und Wendepunkte zusammen und verdeutlichen so die Kernthemen der gesamten Sammlung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Die schönsten chinesischen Märchen
(Illustrierte Ausgabe)
Books
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
In dem vorliegenden Band der Märchensammlung soll eine Auswahl aus der Märchenwelt Chinas gegeben werden. Die Wahl ist so getroffen, daß möglichst alle Ausprägungsweisen irgendwie vertreten sind. Das Märchen bildet in China kein streng gesondertes Gebiet. Von den Ammengeschichten und Fabeln bis zu Göttermythen, Sagen und Novellen sind die Grenzen durchaus schwankend. Das Wunderbare gehört für China noch zum natürlichen Weltlauf, so daß hier sich keine scharfe Grenze ziehen läßt.
Im allgemeinen wird man sagen können, daß in China besonders das einzelne Bild, die einzelne Situation vorherrscht. Folgerichtige Verbindung der Motive zu einer geschlossenen Handlung ist auch hier dem Kunstmärchen vorbehalten, von dem es wahre Perlen in großer Zahl gibt. Irgendwelche Vollständigkeit konnte nicht erstrebt werden, da sonst der zur Verfügung stehende Raum weit überschritten worden wäre.
Für die Zusammenstellung des Stoffes waren folgende Grundsätze maßgebend:
Fast durchweg ist auf mündliche Überlieferung zurückgegriffen, auch da, wo das betreffende Stück in der Literatur schon vorhanden ist. Der Zweck dabei war, festzustellen, wie die Geschichte tatsächlich heute im Volke lebt. Nur bei den Kunstmärchen ist engerer Anschluß an das Original genommen.
Neben spezifisch chinesischen Märchen sind auch solche aufgenommen, die fremde Einflüsse zeigen, soweit die Verarbeitung dieser Einflüsse in chinesischem Geiste sich vollzogen hat. So ist Stoff zu Vergleichen gegeben, und es ist oft besonders reizvoll, wie der Stoff in dem chinesischen Mittel sich spiegelt.
Außer den eigentlichen Märchen sind Sagenstoffe und Göttermythen mit aufgenommen, soweit sie märchenhaft spielend behandelt sind. Daß durch unsere Sammlung sich auf diese Weise ein Einblick in Sitten und Gebräuche, Glauben und Denkungsart des chinesischen Volks eröffnet, dürfte ein nicht unerwünschter Nebenerfolg der Lektüre sein.
Derbheiten und gewagte Situationen sind, wo es die Vorlage gebot, nicht vermieden, aber auch nicht absichtlich gesucht, um den Tatbestand möglichst unverfälscht wiederzugeben. Die Sammlung gibt Stoff zu Erzählungen für Kinder, ohne daß sie als solche ein Kinderbuch wäre.
Die Anordnung der einzelnen Stücke beginnt mit Ammen- und Kindermärchen, die dem Volksmund abgelauscht sind, 1–10, daran schließen sich einige der in China nicht besonders zahlreichen Tierfabeln 11–14, Sagen und Märchen von Göttern, Zauberern und Heiligen folgen von 15–44, dann kommen Geschichten von Natur- und Tiergeistern 45–61, Gespenstergeschichten und Märchen von Teufeln und Geistern von 62–82, historische Sagen von 83–92, Kunstmärchen von 93–99, endlich ein größeres Stück, das die verschiedenen Motive in sich vereinigt, Nr. 100.
Tsingtau, April 1913D. Richard Wilhelm
1. Weiberworte trennen Fleisch und Bein
Es waren einmal zwei Brüder, die wohnten in demselben Hause. Der Große hörte auf die Worte seines Weibes und kam darob mit seinem Bruder auseinander. Der Sommer hatte angefangen, und es war Zeit, die hohe Hirse zu säen. Der Kleine hatte kein Korn und bat den Großen, ihm zu leihen. Der Große befahl seinem Weib, es ihm zu geben. Die nahm das Korn, tat es in einen großen Topf und kochte es gar. Dann gab sie es dem Kleinen. Der Kleine wußte nichts davon, ging hin und säte es auf seinem Felde. Da aber das Korn gekocht war, kamen die Halme nicht hervor. Nur ein einziger Same war noch nicht gar gewesen; so wuchs ein einziger Halm in die Höhe. Der Kleine war arbeitsam und fleißig von Natur, darum begoß und behackte er ihn den ganzen Tag. Da wuchs der Halm mächtig wie ein Baum, und eine Ähre brach hervor wie ein Baldachin, so groß, daß sie einen halben Morgen Landes beschattete. Im Herbste ward sie reif. Da nahm der Kleine eine Axt und hieb damit die Ähre ab. Kaum war die Ähre auf den Boden gefallen, da kam plötzlich ein großer Vogel Rokh rauschend heran, nahm die Ähre in den Schnabel und flog davon. Der Kleine lief ihm nach bis an den Strand des Meeres.
Der Vogel wandte sich nach ihm und redete auf Menschenweise also: »Ihr müßt mir nichts zuleide tun. Was ist die eine Ähre Euch denn wert? Östlich vom Meer, da ist die Gold- und Silberinsel. Ich will Euch hinübertragen. Da könnt Ihr nehmen, soviel Ihr wollt, und sehr reich werden.«
Der Kleine wars zufrieden und stieg dem Vogel auf den Rücken. Der hieß ihn die Augen schließen. So hörte er nur die Luft an seinen Ohren sausen, als führe er durch einen starken Wind, und unter sich hörte er das Rauschen und Toben von Flut und Wellen. Im Nu ließ sich der Vogel auf einer Insel nieder. »Nun sind wir da«, sagte er.
Da machte der Kleine die Augen auf und blickte um sich; da sah er allenthalben Glanz und Glimmer, lauter gelbe und weiße Sachen. Er nahm von den kleinen Stücken etwa ein Dutzend und barg sie in seinem Busen.
»Ist es genug?« fragte der Vogel Rokh.
»Ja, ich habe genug«, antwortete er.
»Gut so«, sagte der Vogel, »Genügsamkeit schützt vor Schaden.«
Dann nahm er ihn wieder auf den Rücken und trug ihn übers Meer zurück.
Als der Kleine nach Hause kam, da kaufte er sich mit der Zeit ein gut Stück Land und ward recht wohlhabend.
Sein Bruder aber ward neidisch auf ihn und fuhr ihn an: »Wo hast du denn das Geld gestohlen?«
Der Kleine sagte ihm alles der Wahrheit gemäß. Da ging der Große heim und hielt mit seinem Weibe Rat.
»Nichts leichter als das«, sagte das Weib. »Ich koche einfach wieder Getreide und behalte ein Korn zurück, daß es nicht gar wird. Das säst du aus, und wir wollen sehen, was geschieht.«
Gesagt, getan. Und richtig kam ein einzelner Halm hervor, und richtig trug der Halm eine einzelne Ähre, und als es Zeit zur Ernte war, kam wieder der Vogel Rokh und trug sie in seinem Schnabel davon. Der Große freute sich und lief ihm nach, und der Vogel Rokh sprach wieder dieselben Worte wie das vorige Mal und trug den Großen nach der Insel. Dort sah der Große Gold und Silber ringsum angehäuft. Die größten Stücke waren wie Berge, die kleinen waren wie Ziegelsteine und die ganz kleinen wie Sandkörner. Es blendete ihn ganz in den Augen. Er bedauerte nur, daß er kein Mittel wußte, Berge zu versetzen. So bückte er sich denn und hob an Stücken auf, was er konnte.
Der Vogel Rokh sprach: »Nun ists genug! Es geht dir über die Kraft.«
»Gedulde dich noch eine kleine Weile«, sagte der Große. »Sei nicht so eilig! Ich muß noch ein paar Stücke haben.«
Darüber verging die Zeit.
Der Vogel Rokh trieb ihn abermals zur Eile an: »Die Sonne wird gleich kommen«, sagte er, »und die ist so heiß, daß sie die Menschen verbrennt.«
»Wart noch ein bißchen«, sagte der Große.
Im Augenblick aber kam ein rotes Rad mit Macht hervor. Der Vogel Rokh flog in das Meer, breitete seine beiden Flügel aus und schlug damit in das Wasser, um der Hitze zu entrinnen. Der Große aber ward von der Sonne aufgezehrt.
2. Die drei Reimer
In einem Hause waren drei Töchter. Die älteste heiratete einen Doktor, die zweite heiratete einen Magister, die dritte aber, die besondere klug war und geschickt im Reden, heiratete einen Bauer.
Nun traf es sich, daß ihre Eltern Geburtstag feierten. Da kamen die drei Töchter mit ihren Männern, um ihnen Glück und langes Leben zu wünschen. Die Schwiegereltern bereiteten für ihre drei Schwiegersöhne ein Mahl und tischten ihnen Geburtstagswein auf. Der Älteste aber, welcher wußte, daß der dritte Schwiegersohn die Schule nicht besucht, wollte ihn in Verlegenheit bringen.
»Das ist doch gar zu langweilig«, sagte er, »wenn wir nur so trinken; wir wollen ein Trinkspiel machen. Auf die Worte: am Himmel – auf Erden – am Tische – im Zimmer – soll jeder ein Gedicht machen, das sich reimt und Sinn hat. Wer's nicht kann, der muß zur Strafe drei Gläser leeren.«
Alle Anwesenden warens zufrieden. Nur der dritte Schwiegersohn kam in Verlegenheit und wollte durchaus gehen. Aber die Gäste ließen ihn nicht fort und nötigten ihn zum Sitzen.
Da begann der älteste Schwager: »Ich will mit dem Reimen anfangen. Ich sage:
Am Himmel stolz der Phönix fliegt, Auf Erden zahm das Schäflein liegt. Am Tische les ich alte Weise, Im Zimmer ruf der Magd ich leise.«
Der zweite fuhr fort: »Und ich sage:
Am Himmel fliegt die Turteltaube, Auf Erden wühlt der Ochs im Staube, Am Tisch studiert man, was gewesen, Im Zimmer führt die Magd den Besen.«
Der dritte Schwiegersohn aber stotterte und brachte nichts hervor. Als alle ihn nötigten, da brach er mit grobem Ton heraus:
»Am Himmel fliegt – eine Bleikugel, Auf Erden geht – ein Tigertier, Am Tische liegt – eine Schere, Im Zimmer ruf ich – dem Stallknecht.«
Die beiden Schwäger klatschten in die Hände und begannen laut zu lachen.
»Die vier Zeilen reimen sich ja gar nicht«, sagten sie, »und außerdem ist kein Sinn darin. Eine Bleikugel ist doch kein Vogel, der Stallknecht tut seine Arbeit draußen, willst du ihn etwa zu dir ins Zimmer hereinrufen? Unsinn, Unsinn! Trink' aus!«
Aber noch ehe sie fertig geredet hatten, da hob die dritte Tochter den Vorhang des Frauengemachs und trat heraus. Sie war ärgerlich, konnte aber doch ein Lächeln nicht unterdrücken.
»Wieso haben wir keinen Sinn in unseren Zeilen?« sagte sie. »Hört nur zu, ich will's euch erklären: Am Himmel die Bleikugel wird euren Phönix und eure Turteltaube totschießen. Auf Erden das Tigertier wird euer Schaf und euren Ochsen fressen. Am Tisch die Schere wird all eure alten Schmöker zerschneiden. Im Zimmer der Stallknecht endlich, nun – der kann eure Magd heiraten.«
Da sagte der älteste Schwager: »Gut gescholten! Schwägerin, du weißt zu reden. Wärst du ein Mann, du hättest längst den Doktor in der Tasche. Wir wollen zur Strafe unsere drei Gläser leeren.«
3. Wie einer aus Gier nach dem Kleinen das Große verliert
Es war einmal eine alte Frau, die hatte zwei Söhne. Ihr großer Sohn war ohne Kindesliebe und verließ Mutter und Bruder. Der jüngere aber diente ihr, so daß alle Leute von seiner Kindlichkeit erzählten.
Eines Tages wurde draußen vor dem Dorf Theater gespielt. Da trug er seine Mutter auf dem Rücken hin, damit sie zusehen könne. Vor dem Dorf aber war eine Schlucht. Dort glitt er aus und fiel mitten in die Schlucht hinein. Seine Mutter ward von dem Steingeröll totgeschlagen; ihr Blut und Fleisch war rings umhergespritzt. Der Sohn streichelte den Leichnam seiner Mutter und weinte bitterlich. Er wollte sich selbst töten, als er plötzlich einen Priester vor sich stehen sah.
Der sagte zu ihm: »Sei ohne Furcht, ich kann deine Mutter wieder lebendig machen.«
Mit diesen Worten bückte er sich, las Fleisch und Knochen zusammen und fügte sie alle richtig aneinander. Dann blies er sie an, und schon war die Mutter wieder lebendig. Da hatte der Sohn eine große Freude und dankte ihm auf den Knien. Er sah jedoch an einer Felskante noch ein ungefähr zollgroßes Stückchen Fleisch seiner Mutter hängen.
»Das darf man auch nicht liegen lassen«, sagte er und barg es an seinem Busen.
Der Priester sprach: »Wahrlich, du hast die rechte Kindesliebe!«
Dann ließ er sich das Fleischstück der Mutter geben, knetete daraus ein kleines Männchen, blies es an, und mit einem Sprunge stand es da. Es war ein ganz stattlicher kleiner Knabe geworden.
»Der heißt der kleine Vorteil«, wandte er sich an den Sohn, »du magst ihn deinen Bruder nennen. Du bist arm und hast nichts, deine Mutter zu ernähren; wenn du etwas brauchst, kann es Klein-Vorteil dir verschaffen.«
Der Sohn bedankte sich nochmals. Dann nahm er seine Mutter wieder auf den Rücken und seinen neuen kleinen Bruder an die Hand und ging nach Hause. Wenn er zu Klein-Vorteil sagte: Bringe Fleisch und Wein! war Fleisch und Wein sofort auch da, und dampfender Reis kochte auch schon im Topf. Wenn er zu Klein-Vorteil sagte: Bringe Geld und Tuch! so füllte das Geld die Beutel, und das Tuch lag in den Kisten bis zum Rand. Was immer er bat, alles wurde ihm zuteil. So wurden sie allmählich recht wohlhabend.
Sein älterer Bruder beneidete ihn aber sehr, und als im Dorfe abermals ein Schauspiel war, nahm er die Mutter mit Gewalt auf den Rücken und ging hin. Da er zur Schlucht kam, glitt er mit Willen aus und ließ die Mutter in die Tiefe fallen, nur darauf bedacht, daß sie auch wirklich ganz in Stücke ginge. Und richtig, die Mutter fiel so übel, daß Rumpf und Glieder rings umher zerstreut waren. Gemächlich stieg er selbst nunmehr hinab, nahm der Mutter Kopf in seine Hände und stellte sich, als ob er weine.
Schon war auch wieder der Priester zur Stelle und sprach: »Ich kann die Toten wieder auferwecken, weiße Gebeine mit Fleisch und Blut umgeben.«
Dann machte er es wie das letztemal, und die Mutter kam wieder zu sich. Der ältere Bruder aber hatte absichtlich schon vorher eine ihrer Rippen versteckt.
Die zog er nun hervor und sprach zum Priester: »Noch ist ein Knochen übrig. Was soll man damit tun?«
Der Priester nahm den Knochen, umgab ihn mit Lehm und Erde, blies ihn an wie das letztemal, und es entstand ein Männlein, das Klein-Vorteil ähnlich sah, nur war es größer an Gestalt.
»Der heißt die Große Pflicht«, sagte er zu ihm; »wenn du dich an ihn hältst, wird er dir stets zur Hand sein.«
Der Sohn nahm die Mutter wieder auf den Rücken, und die Große Pflicht ging hinter ihm her.
Als er zum Tore des Gehöftes kam, da sah er seinen jüngeren Bruder herbeikommen, der Klein-Vorteil auf den Armen trug.
»Wo gehst du hin?« sagte er zu ihm.
Der Bruder sprach: »Klein-Vorteil ist ein Götterwesen, das nicht dauernd unter Menschen wohnen mag. Er will wieder in den Himmel fliegen, und ich gebe ihm das Geleite.«
»Gib Klein-Vorteil doch mir! Laß ihn nicht gehen!« sagte der Ältere.
Aber ehe er ausgeredet hatte, erhob sich Klein-Vorteil in die Lüfte. Der ältere Bruder ließ nun eilig die Mutter auf den Boden fallen und streckte die Hand aus, um Klein-Vorteil zu erhaschen. Aber es gelang ihm nicht, und schon erhob sich auch die Große Pflicht, faßte Klein-Vorteil bei der Hand, und beide zusammen stiegen zu den Wolken auf und verschwanden.
Da stampfte der ältere Bruder auf den Boden und sagte seufzend: »Ach! Weil ich nach dem kleinen Vorteil gierig war, habe ich die große Pflicht versäumt.«
4. Wer ist der Sünder?
Es waren einmal zehn Bauern, die gingen miteinander über Feld. Sie wurden von einem schweren Gewitter überrascht und flüchteten sich in einen halb zerfallenen Tempel. Der Donner aber kam immer näher, und es war ein Getöse, daß die Luft ringsum erzitterte. Kreisend fuhr ein Blitz fortwährend um den Tempel her. Die Bauern fürchteten sich sehr und dachten, es müsse wohl ein Sünder unter ihnen sein, den der Donner schlagen wolle. Um herauszubringen, wer es sei, machten sie aus ihre Strohhüte vor die Tür zu hängen; wessen Hut weggeweht werde, der solle sich dem Schicksal stellen.
Kaum waren die Hüte draußen, so ward auch einer weggeweht, und mitleidlos stießen die andern den Unglücklichen vor die Tür. Als er aber den Tempel verlassen hatte, da hörte der Blitz zu kreisen auf und schlug krachend ein.
Der eine, den sie verstoßen hatten, war der einzige Gerechte gewesen, um dessentwillen der Blitz das Haus verschonte. So mußten die neun ihre Hartherzigkeit mit dem Leben bezahlen.
5. Das Zauberfaß
Es war einmal ein Mann, der grub auf seinem Acker ein großes, irdenes Faß aus. Er nahm es mit nach Hause und sagte zu seiner Frau, sie solle es rein machen. Wie nun die Frau mit der Bürste in das Faß fuhr, da war auf einmal das ganze Faß voll Bürsten. Soviel man auch herausnahm, es kamen immer neue nach. Der Mann verkaufte nun die Bürsten, und die Familie hatte ganz gut zu leben.
Einmal fiel aus Versehen ein Geldstück in das Faß. Sofort verschwanden die Bürsten, und das Faß füllte sich mit Geld. Nun wurde die Familie reich; denn sie konnten Geld aus dem Faß holen, soviel sie wollten.
Der Mann hatte einen alten Großvater im Haus, der war schwach und zittrig. Da er sonst nichts mehr tun konnte, stellte er ihn an, Geldstücke aus dem Faß zu schaufeln, und wenn der alte Großvater müde war und nicht mehr konnte, ward er böse und schrie ihn zornig an, er sei nur faul und wolle nicht. Eines Tages aber verließen den Alten die Kräfte. Er fiel in das Faß und starb. Schon war das Geld verschwunden, und das ganze Faß füllte sich mit toten Großvätern. Die mußte der Mann nun alle herausziehen und begraben lassen, und dafür brauchte er das ganze Geld, das er bekommen hatte, wieder auf. Und als er fertig war, zerbrach das Faß, und er war wieder arm wie zuvor.
6. Das Glückskind und das Unglückskind
Es war einmal ein stolzer Fürst, der hatte eine Tochter. Die Tochter aber war ein Unglückskind. Als die Zeit herangekommen war, da sie heiraten sollte, da ließ sie alle Freier sich vor ihres Vaters Schloß versammeln. Sie wollte einen Ball von roter Seide unter sie werfen, und wer ihn fing, der sollte ihr Gatte werden. Da waren nun viele Fürsten und Grafen vor dem Schloß versammelt. Mitten unter ihnen stand aber auch ein Bettler. Und die Prinzessin sah, daß ihm Drachen zu den Ohren hineinkrochen und zur Nase wieder herauskamen; denn er war ein Glückskind. Da warf sie den Ball dem Bettler zu, und er fing ihn auf.
Erzürnt fragte ihr Vater: »Warum hast du den Ball dem Bettler in die Hände geworfen?«
»Er ist ein Glückskind«, sagte die Prinzessin, »ich will ihn heiraten, vielleicht bekomme ich dann Teil an seinem Glück.«
Der Vater aber wollte das nicht leiden, und als sie standhaft blieb, da trieb er sie im Zorn aus dem Schlosse.
So mußte die Prinzessin mit dem Bettler ziehen. Sie wohnte mit ihm in seiner kleinen Hütte und mußte Kräuter und Wurzeln suchen und selber kochen, damit sie nur etwas zu essen hatten, und oftmals hungerten sie auch beide.
Eines Tages sprach der Mann zu ihr: »Ich will ausziehen und mein Glück versuchen. Wenn ich's gefunden habe, will ich wiederkommen und dich holen.« Die Prinzessin sagte ja, und er ging weg. Achtzehn Jahre blieb er weg. Und die Prinzessin lebte in Not und Kümmernis; denn ihr Vater blieb hart und unerbittlich. Wenn ihre Mutter nicht im stillen ihr Geld und Nahrung zugesteckt, so wäre sie wohl gar Hungers gestorben in der langen Zeit.
Der Bettler aber fand sein Glück und wurde schließlich Kaiser. Er kam zurück und trat vor seine Frau. Die aber kannte ihn nicht mehr. Sie wußte nur, daß er der mächtige Kaiser war.
Er fragte sie, wie es ihr gehe.
»Warum fragt Ihr mich, wie es mir geht?« erwiderte sie. »Ich bin doch viel zu gering für Euch.«
»Und wer ist denn dein Mann?«
»Mein Mann war Bettler. Er ging hinweg, sein Glück zu suchen. Nun sinds schon achtzehn Jahre, und er ist immer noch nicht zurück.«
»Was tust du denn in dieser langen Zeit?«
»Ich warte auf ihn, bis er wiederkommt.«
»Willst du nicht einen andern zum Manne nehmen, da er so lange ausbleibt?«
»Nein, ich bleibe seine Frau bis in den Tod.«
Als der Kaiser die Treue seiner Frau sah, da gab er sich ihr zu erkennen, ließ sie in prächtige Gewänder kleiden und nahm sie mit sich in sein Kaiserschloß. Da lebten sie nun herrlich und in Freuden.
Nach einigen Tagen sprach der Kaiser zu seiner Frau: »Wir leben jeden Tag so festlich, als wenn Neujahr wäre.«
»Sollen wir nicht festlich leben«, sprach die Frau, »da wir doch Kaiser und Kaiserin sind?« –
Die Frau war aber doch ein Unglückskind. Als sie achtzehn Tage Kaiserin gewesen war, da ward sie krank und starb. Der Mann aber lebte noch lange Jahre.
7. Der neunköpfige Vogel
Vor langen Zeiten lebten einmal ein König und eine Königin, die hatten eine Tochter. Eines Tages ging die Tochter im Garten spazieren. Da erhob sich plötzlich ein sehr großer Sturm, der sie mit sich führte. Der Sturm kam aber vom neunköpfigen Vogel. Der raubte die Prinzessin und brachte sie in seine Höhle. Der König wußte nicht, wohin seine Tochter verschwunden war. So ließ er im ganzen Lande ausrufen: »Wer die Prinzessin wiederbringt, der soll sie zur Frau haben.«
Ein Jüngling hatte den Vogel gesehen, wie er die Königstochter in seine Höhle trug. Die Höhle war aber mitten an einer steilen Felswand. Man konnte von unten nicht hinauf und von oben nicht hinunter. Wie er nun um den Felsen herumging, da kam ein anderer, der fragte, was er da tue. Er erzählte ihm, daß der neunköpfige Vogel die Königstochter geraubt und in die Berghöhle hinaufgebracht habe. Der andere wußte Rat. Er rief seine Freunde herbei, und sie ließen den Jüngling in einem Korb zur Höhle hinunter. Wie er zur Höhle hineinging, da sah er die Königstochter dasitzen und dem neunköpfigen Vogel seine Wunde waschen; denn der Himmelhund hatte ihm den zehnten Kopf abgebissen, und die Wunde blutete immer noch. Die Prinzessin aber winkte dem Manne zu, er solle sich verstecken. Das tat er auch. Der Vogel fühlte sich so wohl, wie die Königstochter ihm die Wunde wusch und ihn verband, daß alle seine neun Köpfe einer nach dem andern einschliefen. Da trat der Mann aus dem Versteck hervor und hieb ihm mit einem Schwert alle seine Köpfe ab. Dann führte er die Königstochter hinaus und wollte sie in dem Korb hinaufziehen lassen. Die Königstochter aber sprach: »Es wäre besser, wenn du erst hinaufstiegst und ich nachher.«
»Nein«, sprach der Jüngling. »Ich will hier unten warten, bis du in Sicherheit bist.«
Die Königstochter wollte anfangs nicht; doch ließ sie endlich sich überreden und stieg in den Korb. Vorher aber nahm sie einen Haarpfeil, brach ihn in zwei Teile, gab ihm den einen und steckte die andere Hälfte zu sich. Auch teilte sie mit ihm ihr seidenes Tuch und sagte ihm, er solle beides wohl verwahren. Als aber jener andere Mann die Königstochter heraufgezogen hatte, da nahm er sie mit sich und ließ den Jüngling in der Höhle, wie er auch rief und bat.
Der Jüngling ging nun in der Höhle umher. Da sah er viele Jungfrauen, die hatte alle der neunköpfige Vogel geraubt, und sie waren hier Hungers gestorben. An der Wand hing ein Fisch, der war mit vier Nägeln angenagelt. Als er den Fisch berührte, verwandelte sich der in einen schönen Jüngling. Er dankte ihm für seine Rettung. Sie schlossen Brüderschaft fürs Leben. Allmählich bekam er grimmigen Hunger. Er trat vor die Höhle, um Nahrung zu suchen, aber da waren überall nur Steine. Da sah er plötzlich einen großen Drachen, der an einem Steine leckte. Das tat der Jüngling auch, und alsbald hatte er keinen Hunger mehr. Nun fragte er den Drachen, wie er von dieser Höhle fortkommen könne. Der Drache neigte seinen Kopf zum Schwanz und deutete ihm an, daß er sich darauf setzen solle. Er stieg nun auf den Schwanz des Drachen, und im Umsehen war er unten auf der Erde, und der Drache war verschwunden. Er ging nun weiter, da fand er eine Schildkrötenschale voll von schönen Perlen. Es waren aber Zauberperlen. Wenn man sie ins Feuer warf, so hörte das Feuer auf zu brennen; wenn man sie ins Wasser warf, tat sich das Wasser auf, und man konnte hindurchgehen. Er nahm die Perlen aus der Schildkrötenschale heraus und steckte sie zu sich. Nicht lange danach kam er an den Strand des Meeres. Er warf eine Perle hinein; da teilte sich das Meer, und er erblickte den Meerdrachen. Der rief: »Wer stört mich hier in meinem Reich?« Der Jüngling sprach: »Ich habe Perlen gefunden in einer Schildkrötenschale und habe sie ins Meer geworfen, da hat das Wasser sich mir aufgetan.«
»Wenn es so ist«, sagte der Drache, »so komm zu mir ins Meer, da wollen wir miteinander leben.« Da erkannte er, daß es derselbe Drache war, den er in jener Höhle gesehen. Auch der Jüngling war da, mit dem er Brüderschaft geschlossen. Es war des Drachen Sohn.
»Du hast meinen Sohn gerettet und mit ihm Brüderschaft geschlossen, so bin ich dein Vater«, sagte der alte Drache. Und er bewirtete ihn mit Wein und Speisen.
Eines Tages sprach sein Freund zu ihm: »Mein Vater wird dich sicher belohnen wollen. Nimm aber kein Geld, auch keine Edelsteine, sondern nur die kleine Kürbisflasche dort; mit der kann man herzaubern, was man will.«
Richtig fragte ihn der alte Drache, was er zum Lohne haben wolle, und er sprach zu ihm: »Ich will kein Geld und auch keine Edelsteine, ich will nur die kleine Kürbisflasche.«
Erst wollte der Drache sie nicht hergeben. Endlich gab er sie ihm doch. Dann ging er von dem Drachenschlosse weg.
Als er wieder aufs trockene Land kam, da wurde er hungrig. Alsbald stand ein Tisch mit vielem, schönem Essen da. Und er aß und trank. Er war eine Zeitlang weitergegangen, da wurde er müde. Schon stand ein Esel da, auf den setzte er sich. Er war eine Zeitlang geritten, da wurde der Esel ihm zu holprig; schon kam ein Wagen, da stieg er hinein. Der Wagen aber schüttelte zu sehr, und er dachte: »Wenn ich nur eine Sänfte hätte! Das ginge besser!« Schon kam eine Sänfte, und er setzte sich hinein. Die Träger trugen ihn bis zu der Stadt, wo der König, die Königin und ihre Tochter waren.
Als jener Mann die Königstochter zurückgebracht hatte, da sollte Hochzeit werden. Die Königstochter aber wollte nicht und sprach: »Das ist doch nicht der Rechte. Mein Retter wird kommen, er hat die Hälfte meines Haarpfeils und die Hälfte meines seidnen Tuches zum Zeichen.« Als der Jüngling aber so lange nicht kam und der andere den König drängte, da wurde der ungeduldig und sagte: »Morgen soll die Hochzeit sein!« Die Königstochter ging betrübt durch die Straßen der Stadt und suchte und suchte, ob sie ihren Retter nicht finde. An jenem Tage gerade kam die Sänfte an. Die Königstochter sah das halbe Tuch in der Hand des Jünglings. Voll Freuden nahm sie ihn mit zu ihrem Vater. Er mußte den halben Haarpfeil zeigen, der paßte genau zur andern Hälfte. Da glaubte der König, daß es der Rechte sei. Der falsche Bräutigam wurde bestraft, und man feierte Hochzeit, und sie lebten vergnügt und glücklich bis an ihr Ende.
8. Die Höhle der Tiere
Es war einmal eine Familie, die hatte sieben Töchter. Eines Tages ging der Vater aus, Holz zu suchen; da fand er sieben Wildenteneier. Er brachte sie nach Hause und dachte nicht daran, sie seinen Kindern zu geben. Er wollte sie selber mit seiner Frau essen. Abends wachte die älteste Tochter auf und fragte, was die Mutter da koche. Die Mutter sagte: »Ich koche Wildenteneier. Ich gebe dir eins; aber du mußt es nicht deinen Geschwistern verraten.« Und sie gab ihr eins. Da wachte die zweite Tochter auf und fragte die Mutter, was sie da koche. Sie sagte: »Wildenteneier. Wenn dus deinen Schwestern nicht verrätst, so will ich dir eins geben.« Und so ging es fort. Schließlich hatten die Töchter die Eier aufgegessen, und es waren keine mehr da.
Am Morgen war der Vater sehr böse auf die Kinder und sagte: »Wer geht mit zur Großmutter?« Er wollte aber die Kinder in die Berge führen und da von den Wölfen auffressen lassen. Die ältesten Töchter merkten es und sagten: »Wir gehen nicht mit.« Aber die zwei jüngsten sagten: »Wir gehen mit.« Sie fuhren mit dem Vater fort. Als sie lange gefahren waren, sagten sie: »Wann sind wir denn bei der Großmutter?« Der Vater sagte: »Gleich.« Und als sie ins Gebirge gekommen waren, sagte der Vater: »Wartet hier! Ich will voraus ins Dorf und es der Großmutter sagen, daß ihr kommt.« Da fuhr er mit dem Eselswagen weg. Und sie warteten und warteten, und der Vater kam nicht. Endlich dachten sie, daß der Vater sie nicht mehr holen würde und sie allein im Gebirge verlassen hätte. Und sie gingen immer tiefer ins Gebirge hinein und suchten ein Obdach für die Nacht. Da sahen sie einen großen Stein. Den suchten sie sich aus als Kopfkissen und rollten ihn an die Stelle, wo sie sich zum Schlafen hinlegen wollten. Da sahen sie, daß der Stein die Tür einer Höhle war. In der Höhle war ein Lichtschein, und sie gingen hinein. Das Licht kam von vielen Edelsteinen und Kleinodien aller Art. Die Höhle gehörte einem Wolf und einem Fuchs. Die hatten viele Töpfe mit Edelsteinen und Perlen, die bei Nacht leuchteten. Da sagten sie: »Das ist aber eine schöne Höhle; wir wollen uns gleich in die Betten legen.« Denn es standen zwei goldne Betten mit goldgestickten Decken da. Und sie legten sich hin und schliefen ein. Nachts kamen der Wolf und der Fuchs nach Hause. Und der Wolf sprach: »Ich rieche Menschenfleisch.«
Der Fuchs sagte: »Ach was, Menschen! Hier können doch keine Menschen hereinkommen in unsre Höhle. Die ist doch so gut verschlossen.« Da sagte der Wolf: »Gut, dann wollen wir uns in unsre Betten legen und schlafen.« Der Fuchs sagte: »Wir wollen uns in die Kessel auf dem Herd legen. Da ist es noch ein bißchen warm vom Feuer.« Der eine Kessel war aus Gold, der andere aus Silber. Da legten sie sich hinein.
Als die Mädchen früh aufstanden, da sahen sie den Fuchs und den Wolf liegen und bekamen große Angst. Und sie deckten die Kessel zu und taten viele große Steine drauf, so daß der Wolf und der Fuchs nicht mehr heraus konnten. Dann machten sie Feuer. Der Wolf und der Fuchs sagten: »O, wie schön warm wird es am Morgen! Wie kommt das bloß?« Endlich wurde es ihnen zu heiß. Sie merkten, daß die zwei Mädchen Feuer gemacht hatten, und sie riefen: »Laßt uns heraus! Wir wollen euch viele Edelsteine und viel Gold geben und wollen euch nichts tun.« Die Mädchen aber hörten nicht auf sie und machten das Feuer nur immer größer. Da starben der Wolf und der Fuchs in den Kesseln.
So lebten die Mädchen viele Tage glücklich in der Höhle. Den Vater aber ergriff wieder Sehnsucht nach seinen Töchtern, und er ging ins Gebirge, sie zu suchen. Er setzte sich gerade auf den Stein vor der Höhle, um auszuruhen, und klopfte die Asche aus seiner Pfeife. Da riefen die Mädchen von innen: »Wer klopft an unsre Tür?« Da sagte der Vater: »Ist das nicht die Stimme meiner Töchter?« Die Töchter riefen: »Ist das nicht die Stimme unsere Vaters?« Da machten sie den Stein auf und sahen, daß es ihr Vater war, und der Vater freute sich, daß er sie wieder sah. Und er wunderte sich, wie sie in diese Höhle voll Perlen und Edelsteinen gekommen seien. Und sie erzählten ihm alles. Da holte der Vater Leute herbei, die sollten ihm die Edelsteine nach Hause tragen helfen. Und als sie zu Hause ankamen, verwunderte sich die Frau, wo sie denn alle diese Schätze her hätten. Da erzählten der Vater und die Töchter alles, und sie wurden eine sehr reiche Familie und lebten glücklich bis an ihr Ende.
9. Der Panther
Es war einmal eine Witwe, die hatte zwei Töchter und einen kleinen Sohn.
Eines Tages sagte die Mutter zu den Töchtern: »Verwahrt mir das Haus gut! Ich will zur Großmutter gehen mit eurem kleinen Bruder.«
Die Töchter versprachen es. Dann ging die Mutter weg. Unterwegs begegnete ihr ein Panther und fragte, wohin sie gehe.
Sie sprach: »Ich will mit meinem Kind zu meiner Mutter gehen.«
»Willst du nicht ein bißchen ausruhen?« fragte der Panther.
»Nein«, sprach sie, »es ist schon spät, und der Weg ist weit zu meiner Mutter.«
Aber der Panther ließ nicht ab, ihr zuzureden, und schließlich gab sie nach und setzte sich am Rand des Wege nieder.
»Ich will dir deine Haare ein bißchen kämmen«, sprach der Panther.
So ließ sich die Frau vom Panther die Haare kämmen. Wie er ihr aber mit seinen Krallen durch die Haare fuhr, da riß er ihr ein Stück Haut ab und fraß es.
»Halt!« schrie die Frau. »Das tut weh, wie du mich kämmst!«
Aber der Panther riß ihr ein noch viel größeres Stück Haut ab. Nun wollte die Frau um Hilfe rufen. Da packte sie der Panther und fraß sie auf. Dann wandte er sich zu ihrem Söhnchen und biß es auch tot. Er zog die Kleider der Frau an und tat die Knochen des Kindes, die er noch nicht gefressen hatte, in ihren Korb.
So ging er nach dem Haus der Frau, wo die beiden Töchter waren, und rief zur Tür hinein: »Macht auf, ihr Töchter! Eure Mutter ist gekommen.«
Sie aber sahen zu einer Spalte heraus und sprachen: »Unsre Mutter hat keine so großen Augen.«
Da sagte der Panther: »Ich war bei der Großmutter und habe gesehen, wie ihre Hühner Eier legen; das hat mich gefreut, und deshalb habe ich so große Augen bekommen.«
»Unsre Mutter hat keine solchen Flecke im Gesicht.«
»Die Großmutter hatte kein Bett, und da mußte ich auf Erbsen schlafen; die haben sich mir ins Gesicht gedrückt.
»Unsre Mutter hat nicht so große Füße.«
»Dummes Gesindel! das kommt vom langen Laufen. Macht jetzt rasch auf!«
Da sagten die Töchter zueinander: »Es muß wohl unsre Mutter sein« und machten auf. Als aber der Panther hereinkam, da sahen sie, daß es doch nicht ihre rechte Mutter war.
Abends, als die Töchter schon im Bett waren, da nagte der Panther noch an den Knochen des kleinen Jungen, die er mitgebracht.
Da fragten die Töchter: »Mutter, was ißt du da?«
»Ich esse Rüben«, war die Antwort.
Da sagten die Töchter: »Mutter, gib uns auch von deinen Rüben! Wir haben solchen Hunger.«
»Nein«, war die Antwort, »ich gebe euch keine. Seid ruhig und schlaft!«
Die Töchter aber baten so lange, bis die falsche Mutter ihnen einen kleinen Finger gab. Da sahen die Mädchen, daß es der Finger von ihrem Brüderchen war, und sie sagten zueinander: »Wir wollen eilig fliehen, sonst frißt sie uns auch noch.«
Damit liefen sie zur Tür hinaus, kletterten auf einen Baum im Hof und riefen der falschen Mutter zu: »Komm heraus! Wir können sehen, wie der Nachbarsohn Hochzeit macht.« Es war aber mitten in der Nacht.
Da kam die Mutter heraus, und wie sie sah, daß sie auf dem Baum saßen, da rief sie ärgerlich: »Ich kann ja doch nicht klettern.«
Da sagten sie: »Setz' dich in einen Korb und wirf uns das Seil zu, so wollen wir dich heraufziehen!«
Die Mutter tat, wie sie gesagt. Als aber der Korb in halber Höhe war, da schwangen sie ihn hin und her und stießen ihn gegen den Baum. Da mußte sich die falsche Mutter wieder in einen Panther verwandeln, damit sie nicht herunterfiel. Der Panther sprang aus dem Korbe und lief weg.
Allmählich wurde es Tag. Die Töchter stiegen herab, setzten sich vor ihre Tür und weinten um ihre Mutter. Da kam ein Nadelverkäufer vorüber, der fragte, warum sie weinten.
»Ein Panther hat unsre Mutter und unsern Bruder gefressen«, sagten die Mädchen. »Jetzt ist er weg, aber er kommt sicher wieder und frißt uns auch.«
Da gab der Nadelverkäufer ihnen ein paar Nadeln und sagte: »Steckt sie in das Kissen auf dem Stuhl mit der Spitze nach oben.« Die Mädchen bedankten sich und weinten weiter.
Dann kam ein Skorpionfänger vorüber; der fragte sie, warum sie weinten.
»Ein Panther hat unsre Mutter und unsern Bruder gefressen«, sagten die Mädchen. »Jetzt ist er weg, aber er kommt sicher wieder und frißt uns auch.«
Da gab ihnen der einen Skorpion und sagte: »Setzt den hinter den Herd in der Küche!« Die Mädchen bedankten sich und weinten weiter.
Da kam ein Eierverkäufer vorüber, der fragte, warum sie weinten.
»Ein Panther hat unsre Mutter und unsern Bruder gefressen«, sagten die Mädchen. »Jetzt ist er fort, aber er kommt sicher wieder und frißt uns auch.«
Da gab er ihnen ein Ei und sprach: »Legt das in die Asche unter den Herd!« Die Mädchen bedankten sich und weinten weiter.
Da kam ein Schildkrötenhändler vorüber, und sie erzählten ihre Geschichte. Da gab er ihnen eine Schildkröte und sagte: »Setzt sie in das Wasserfaß im Hof.« Da kam ein Mann vorüber, der hölzerne Keulen verkaufte. Er fragte sie, warum sie weinten. Und sie erzählten ihm die ganze Geschichte. Da gab er ihnen zwei hölzerne Keulen und sagte: »Die hängt auf über dem Tor an der Straße!« Die Mädchen bedankten sich und taten, wie die Männer gesagt.
Als es Abend wurde, kam der Panther nach Hause. Er setzte sich auf den Stuhl im Zimmer. Da stachen ihn die Nadeln im Kissen. Dann lief er in die Küche, wollte Feuer machen und sehen, was ihn so gestochen; da schlug ihm der Skorpion seinen Stachel in die Hand. Und als das Feuer schließlich brannte, da platzte das Ei und sprang ihm ins Auge, und er ward auf einem Auge blind. Da lief er in den Hof und tauchte seine Hand ins Wasserfaß, um sie zu kühlen. Da biß ihm die Schildkröte die Hand ab. Vor Schmerz rannte er zum Tor hinaus auf die Straße, da fielen ihm die hölzernen Knüppel auf den Kopf und schlugen ihn tot.
10. Das grosse Wasser
Es war einmal eine Witwe, die hatte ein Kind. Das Kind hatte ein gutes Herz, und alle Leute hatten es lieb. Eines Tages sagte das Kind zu seiner Mutter: »Alle andern Kinder haben eine Großmutter, ich allein habe keine. Das macht mich sehr traurig.«
»Wir wollen dir eine Großmutter suchen«, sagte die Mutter.
Nun kam einmal eine alte Bettlerin vors Haus, die war sehr arm und schwach. Als das Kind sie sah, sprach es zu ihr: »Du sollst meine Großmutter sein!« Und es ging zu seiner Mutter und sagte: »Draußen ist eine Bettlerin, die will ich als Großmutter haben.« Die Mutter wars zufrieden und rief sie ins Haus. Die Alte aber war sehr schmutzig und voll von Ungeziefer. Da sagte der Junge zu seiner Mutter: »Komm, wir wollen die Großmutter waschen!« So wuschen sie die Frau. Die aber hatte sehr viele Läuse. Die suchten sie alle und taten sie in einen Topf. Der ganze Topf ward voll davon. Da sprach die Großmutter: »Werft sie nicht weg; vergrabt sie im Garten! Und ihr sollt sie erst wieder ausgraben, wenn das große Wasser kommt.«
»Wann kommt denn das große Wasser?« fragte der Knabe.
»Wenn den zwei steinernen Löwen vor dem Gefängnis die Augen rot werden, dann kommt das große Wasser«, sagte die Großmutter.
Da lief der Knabe zu den Löwen, aber ihre Augen waren noch nicht rot. Die Großmutter sprach auch zu ihm: »Mach ein kleines Schiff aus Holz und verwahre es in einem Kästchen!« Das tat der Junge. Jeden Tag lief er nun zum Gefängnis und sah die Löwen an, also daß die Leute auf der Straße sich darüber verwunderten.
Eines Tages, als er beim Hühnerschlächter vorbeikam, fragte ihn der, warum er immer zu den Löwen laufe. Da sagte der Junge: »Wenn den Löwen die Augen rot werden, so kommt das große Wasser.« Der Schlächter aber lachte ihn aus. Und am andern Morgen in aller Frühe nahm er Hühnerblut und strich es den Steinlöwen auf die Augen. Als der Junge sah, daß die Löwen rote Augen hatten, lief er schnell nach Hause und sagte es seiner Mutter und Großmutter. Da sprach die Großmutter: »Grabt nun rasch den Topf aus und holt das Schifflein aus dem Kasten!« Als sie den Topf ausgruben, waren lauter echte Perlen darin, und das Schiff wurde größer und größer, wie ein wirkliches Schiff. Die Großmutter sprach: »Nehmt den Topf mit euch und steigt in das Schiff! Wenn nun das große Wasser kommt, so mögt ihr die Tiere, die daher getrieben werden, retten; aber die Menschen, die Schwarzköpfe, sollt ihr nicht retten!« Da stiegen sie ins Schiff, und die Großmutter war auf einmal verschwunden.
Nun begann es zu regnen, und der Regen strömte immer stärker und stärker vom Himmel herunter. Schließlich waren es nicht mehr einzelne Tropfen, sondern es war nur noch eine Wasserflut, die alles überschwemmte. Da kam ein Hund vorbeigetrieben, den retteten sie auf ihr Schiff. Bald darauf kam ein Mäusepaar mit ihren Jungen; die quiekten laut aus Angst. Die retteten sie auch. Das Wasser stieg schon bis an die Dächer der Häuser. Auf einem Dach saß eine Katze, die machte einen krummen Buckel und schrie kläglich. Sie nahmen sie auch in ihr Schiff. Aber das Wasser wurde immer größer und stieg bis an die Wipfel der Bäume. Auf einem Baume saß ein Rabe, schlug mit den Flügeln und krächzte. Auch ihn nahmen sie zu sich. Schließlich kam ein Bienenschwarm daher. Die Tierchen waren ganz naß geworden und konnten kaum mehr fliegen. Da ließen sie auch die Bienen zu sich herein. Endlich kam ein schwarzhaariger Mensch auf den Wellen vorüber. Der Knabe sprach: »Mutter, den wollen wir auch retten!« Die Mutter wollte nicht: »Die Großmutter hat uns doch gesagt, wir dürfen keine Schwarzköpfe retten.« Der Knabe sprach: »Wir wollen den Mann doch retten. Ich habe Mitleid mit ihm und kann es nicht mit ansehen, wie er im Wasser dahintreibt.« So retteten sie denn auch den Mann.
Allmählich verlief das Wasser sich wieder. Sie stiegen aus ihrem Schiff und verabschiedeten sich von dem Manne und den Tieren. Da wurde das Schiff wieder klein, und sie packten es in die Schachtel.
Der Mann aber war lüstern nach ihren Perlen. Er ging hin zum Richter und verklagte den Knaben und seine Mutter. So wurden sie beide ins Gefängnis geworfen. Da kamen die Mäuse und gruben ein Loch in die Mauer. Zu dem Loch kam der Hund herein und brachte ihnen Fleisch, und die Katze brachte ihnen Brot, so daß sie im Gefängnis nicht Hunger leiden mußten. Der Rabe aber flog weg und kam wieder mit einem Briefe an den Richter. Der Brief war von einem Gott geschrieben, und es hieß darin: »Ich wandelte als Bettlerin in der Menschenwelt umher. Da hat der Knabe und seine Mutter mich aufgenommen. Der Knabe hat mich behandelt wie seine Großmutter und sich nicht davor geekelt, mich von meinem Schmutz zu waschen. Darum habe ich sie gerettet aus dem großen Wasser, in dem ich die sündige Stadt, darin sie lebten, zerstörte. Du, o Richter, mußt sie freilassen, sonst werde ich Unglück über dich bringen.«
Der Richter ließ sie vor sich kommen und fragte, was sie getan hätten und wie sie durch das Wasser hergekommen seien. Sie erzählten ihm nun alles, und es stimmte mit dem Briefe des Gottes überein. Da strafte er den Mann, der sie verklagt hatte, und ließ sie beide frei!
Als der Knabe herangewachsen war, da kam er in eine Stadt. In der Stadt waren sehr viele Menschen, und es hieß, die Prinzessin wolle heiraten. Um aber den rechten Mann zu bekommen, hatte sie sich verschleiert in eine Sänfte gesetzt und mit vielen anderen Sänften auf den Marktplatz tragen lassen. In allen Sänften saßen verschleierte Frauen, und die Prinzessin war mitten darunter. Wer nun die rechte Sänfte traf, der sollte die Prinzessin zur Frau bekommen. Da ging er auch hin, und als er auf den Platz kam, da sah er, wie die Bienen, die er aus dem großen Wasser gerettet hatte, alle um eine Sänfte schwärmten. Er trat auf die Sänfte zu, und richtig saß die Prinzessin darin. Die Hochzeit wurde nun gefeiert, und sie lebten glücklich bis an ihr Ende.
11. Der Fuchs und der Tiger
Der Fuchs begegnete einst einem Tiger. Der zeigte ihm die Zähne, streckte die Krallen hervor und wollte ihn fressen. Der Fuchs sprach: »Mein Herr, Ihr müßt nicht denken, daß Ihr allein der Tiere König seid. Euer Mut kommt meinem noch nicht gleich. Wir wollen zusammen gehen, und Ihr wollet Euch hinter mir halten. Wenn die Menschen mich sehen und sich nicht fürchten, dann mögt Ihr mich fressen.«
Der Tiger wars zufrieden, und so führte ihn der Fuchs auf eine große Straße. Die Wanderer nun, wenn sie von fern den Tiger sahen, erschraken alle und liefen weg.
Da sprach der Fuchs: »Was nun? Ich ging voran; die Menschen sahen mich und sahen Euch noch nicht.«
Da zog der Tiger seinen Schwanz ein und lief weg.
Der Tiger hatte wohl bemerkt, daß die Menschen sich vor dem Fuchse fürchteten, doch hatte er nicht bemerkt, daß der Fuchs des Tigers Furchtbarkeit entlehnte.
12. Des Tigers Lockspitzel
Daß der Fuchs des Tigers Furchtbarkeit entlehnt, ist nur ein Gleichnis; daß aber der Tiger seine Lockspitzel hat, das liest man häufig in Geschichtenbüchern, und auch Großväter reden viel davon, so daß wohl etwas Wahres daran sein muß. Es heißt, daß, wenn der Tiger einen Menschen frißt, sein Geist sich nicht entfernen kann, und der Tiger benutzt ihn dann als Lockspitzel. Wenn er auf Beute ausgeht, so muß der Geist des Gefressenen voran, um ihn zu verdecken, so daß die Menschen nicht den Tiger sehen. Der Geist verwandelt sich dann wohl in ein schönes Mädchen oder ein Stück Gold und Seidenzeug. Alle Arten von Betörung werden angewandt, um so die Menschen in die Schluchten des Gebirges zu locken. Dann kommt der Tiger vor und frißt das Opfer. Der neue Geist muß dann Lockspitzel werden. Der alte ist dann seines Dienstes ledig und kann gehen. So geht's in stetiger Reihe fort und fort.
Von Leuten, die von listigen und starken Menschen gezwungen werden, zum Schaden anderer sich herzugeben, sagt man darum wohl: »Sie sind des Tigers Lockspitzel«
13. Der Fuchs und der Rabe
Der Fuchs versteht es zu schmeicheln und viele Listen zu gebrauchen. Einst sah er einen Raben, der mit einem Stück Fleisch im Schnabel auf einem Baum sich niederließ. Der Fuchs setzte sich unter den Baum, sah zu ihm empor und begann ihn zu loben.
»Eure Farbe«, begann er, »ist reines Schwarz; das zeigt mir, daß Ihr die Weisheit Laotses habt, der sein Dunkel zu wahren weiß. Die Art, wie Ihr Eure Mutter zu füttern wißt, zeigt, daß Ihr an kindlicher Liebe der Fürsorge Meister Dsongs für seine Eltern gleichkommt. Eure Stimme ist rauh und stark; das zeigt, daß Ihr den Mut besitzt, mit dem einst König Hiang durch seine bloße Stimme seine Feinde zum Fliehen brachte. Ihr seid wahrhaftig der König der Vögel.«
Der Rabe hörte es, ward hocherfreut und sprach: »Bitte sehr, bitte sehr!«
Aber ehe er sichs versah, fiel aus dem geöffneten Schnabel das Fleisch zur Erde.
Der Fuchs fing es auf, fraß es und sagte dann lachend: »Merkts Euch, mein Herr: Wenn jemand ohne Ursach Euch Lob entgegenbringt, so hat er sicher eine Absicht.«
14. Warum Hund und Katze einander Feind sind
Ein Mann und eine Frau hatten einen goldenen Ring. Das war ein Glücksring, und wer ihn besaß, hatte immer genug zu leben. Sie wußten es aber nicht und verkauften den Ring für wenig Geld. Kaum war der Ring aus dem Hause, da wurden sie immer ärmer und wußten schließlich nicht mehr, woher sie genug zum Essen nehmen sollten. Sie hatten auch einen Hund und eine Katze, die mußten mit ihnen Hunger leiden. Da ratschlagten die Tiere miteinander, wie sie den Leuten wieder zu ihrem alten Glück verhelfen könnten. Schließlich fand der Hund einen Rat.
»Sie müssen den Ring wiederhaben«, sagte er zur Katze.
Die Katze sprach: »Der Ring ist wohlverwahrt in einem Kasten, wo niemand dazu kann.«
»Fange du eine Maus«, sagte der Hund. »Die Maus soll den Kasten aufnagen und den Ring herausholen. Sag ihr, wenn sie nicht wolle, so beißest du sie tot, dann wird sies schon tun.«
Dieser Rat gefiel der Katze, und sie fing eine Maus. Nun wollte sie mit der Maus zu dem Haus, wo der Kasten stand, und der Hund ging hinterdrein. Da kamen sie an einen großen Fluß. Und weil die Katze nicht schwimmen konnte, nahm sie der Hund auf den Rücken und schwamm mit ihr hinüber. Die Katze trug die Maus zu dem Haus, wo der Kasten stand. Die Maus nagte ein Loch in den Kasten und holte den Ring heraus. Die Katze nahm den Ring ins Maul und kam zurück zu dem Strom, wo der Hund auf sie wartete und mit ihr hinüberschwamm. Dann gingen sie miteinander nach Hause, um den Glücksring ihrem Herrn und ihrer Frau zu bringen.
Der Hund konnte aber nur auf der Erde laufen; wenn ein Haus im Wege stand, so mußte er immer drum herum. Die Katze aber kletterte hurtig über das Dach, und so kam sie viel früher an als der Hund und brachte den Ring ihrem Herrn.
Da sagte der Herr zu seiner Frau: »Die Katze ist doch ein gutes Tier, der wollen wir immer zu essen geben und sie pflegen wie unser eigenes Kind.«
Als nun der Hund zu Hause ankam, da schlugen und schalten sie ihn, weil er nicht auch geholfen habe, den Ring wieder heimzubringen. Die Katze aber saß beim Herd und schnurrte und sagte nichts. Da wurde der Hund böse auf die Katze, weil sie ihn um seinen Lohn betrogen, und wenn er sie sah, jagte er ihr nach und wollte sie packen.
Seit jenem Tage sind Hund und Katze einander feind.
15. Die Menschwerdung der fünf Altem
Ehe Himmel und Erde sich getrennt hatten, war alles ein großer Ball von Wasserdunst, der hieß das Chaos. Zu jener Zeit formten sich die Geister der fünf Grundkräfte, und es wurden fünf Alte daraus. Der eine hieß der gelbe Alte, das war der Beherrscher der Erde. Der zweite hieß der rote Herr, das war der Beherrscher des Feuers. Der dritte hieß der dunkle Herr, das war der Beherrscher des Wassers. Der vierte hieß der Holzfürst, das war der Beherrscher des Holzes. Die fünfte hieß die Metallmutter, das war die Beherrscherin der Metalle. Diese fünf Alten setzten alle ihren Urgeist in Bewegung, so daß Wasser und Erde nach unten sanken. Der Himmel schwebte in die Höhe, und die Erde wurde fest in der Tiefe. Dann ließen sie die Wasser sich sammeln in Flüssen und Meeren, und Berge und Ebenen tauchten hervor. Also öffnete sich der Himmel, und die Erde teilte sich. Da gab es Sonne, Mond und alle Sterne, Wind, Wolken, Regen und Tau. Der gelbe Alte ließ der Erde reinste Kraft kreisen und fügte des Feuers und Wassers Wirkungen hinzu. Da sproßten hervor Gräser und Bäume, Vögel und Tiere und die Geschlechter der Schlangen und Kerfe, der Fische und Schildkröten. Der Holzfürst und die Metallmutter vereinigten das Lichte und das Trübe und schufen dadurch das Menschengeschlecht als Männer und Weiber. Allmählich entstand so die Welt.
Zu jener Zeit gab es Einen, der hieß der wahre Fürst des Jaspisschlosses. Er hatte durch Pflege der Magie Zauberkraft erlangt. Die fünf Alten baten ihn, als höchster Gott zu herrschen. Er wohnte über den dreiunddreißig Himmeln. Er besaß das Jaspisschloß aus weißem Nephrit mit goldenen Toren. Vor ihm standen die Verwalter der achtundzwanzig Mondhäuser und die Götter des Donners und des großen Bären, auch außerdem eine Klasse von unheilvollen Göttern mit schlimmem, tötendem Einfluß. Sie alle halfen dem wahren Fürsten des Jaspisschlosses, die tausend Geschlechter unter dem Himmel zu beherrschen, Leben und Tod, Glück und Unglück auszuteilen. Dieser Herr des Jaspisschlosses ist nun der große Gott: der Nephritherrscher.
Jene fünf Alten zogen sich zurück, nachdem sie ihr Werk vollendet, und leben seitdem in stiller Reinheit. Der rote Herr wohnt im Süden als Feuergott. Der dunkle Herr wohnt im Norden als großer Herr des dunklen Nordpolhimmels. Er wohnt in einem Schloß von Wasserkristall. Er hat in späterer Zeit den Konfuzius als Heiligen auf die Erde herabgesandt. Deshalb heißt dieser Heilige der Sohn des Kristalls. Der Holzfürst wohnt im Osten. Er wird verehrt als grüner Herr und waltet über Zeugung und Entstehen aller Geschöpfe. Er ist im Besitz der Frühlingskraft und ist der Gott der Liebe. Die Metallmutter wohnt im Westen am Jaspissee, sie heißt auch Königin-Mutter des Westens. Sie führt den Reigen der Feen und waltet über Wandlung und Wachstum. Der gelbe Alte wohnt in der Mitte. Er wandelt immer in der Welt umher, um zu retten und zu helfen aus allerlei Not. Als er zum erstenmal auf die Welt kam, war er der gelbe Herr, der die Menschen allerlei Künste lehrte. In seinem späteren Alter erforschte er den Weltsinn auf dem Ätherberg und flog zur strahlenden Sonne empor. Unter der Herrschaft des Hauses Dschou wurde er wieder geboren als Li Oerl. Seine Mutter ging einundachtzig Jahre schwanger, ehe sie ihn gebar. Bei seiner Geburt waren sein Bart und sein Haar weiß, darum wurde er Laotse (altes Kind) genannt. Er schrieb das Buch vom »Sinn und Leben« und verkündete seine Lehren der Welt. Er wird als Haupt des Taoismus verehrt. Zu Beginn der Herrschaft des Hauses Han kam er wieder als Alter am Fluß (Ho Schang Gung). Er breitete mächtig aus die Lehre des Tao, so daß von jener Zeit an der Taoismus zu großer Blüte kam. Diese Lehre heißt noch heute die Lehre des gelben Alten. Auch geht ein Wort um: »Erst war Laotse da, nach ihm der Himmel.« Das bezieht sich wohl darauf, daß Laotse eben jener gelbe Alte der Urzeit war.
16. Der Kuhhirt und die Spinnerin
Der Kuhhirt war von Hause aus arm. Mit zwölf Jahren trat er bei einem Bauern in Dienst, seine Kuh zu weiden. Nach einigen Jahren ward die Kuh fett und groß, und ihre Haare glänzten wie gelbes Gold. Es war wohl eine Götterkuh.
Eines Tages, als er im Gebirge weidete, begann sie plötzlich mit Menschenstimme zu dem Kuhhirten also zu sprechen: »Heute ist der Siebenabend. Der Nephritherr hat neun Töchter, die baden heute im Himmelssee. Die siebente ist über alle Maßen schön und klug. Sie spinnt für den Himmelskönig und die Himmelskönigin die Wolkenseide und waltet über die Näharbeiten der Mädchen auf Erden. Darum heißt sie die Spinnerin. Wenn du hingehst und ihr die Kleider wegnimmst, kannst du ihr Mann werden und erlangst die Unsterblichkeit.«
»Das ist ja im Himmel«, sagte der Kuhhirt, »wie kann man da hinkommen?«
»Ich will dich hintragen«, antwortete die gelbe Kuh.
Da stieg der Kuhhirt auf den Rücken der Kuh. Im Nu strömten aus ihren Füßen Wolken hervor, und sie erhob sich in die Lüfte. Es schwirrte ihm um die Ohren wie der Ton des Windes, und sie fuhren dahin, schnell wie der Blitz. Plötzlich hielt die Kuh an.
»Nun sind wir da«, sagte sie.