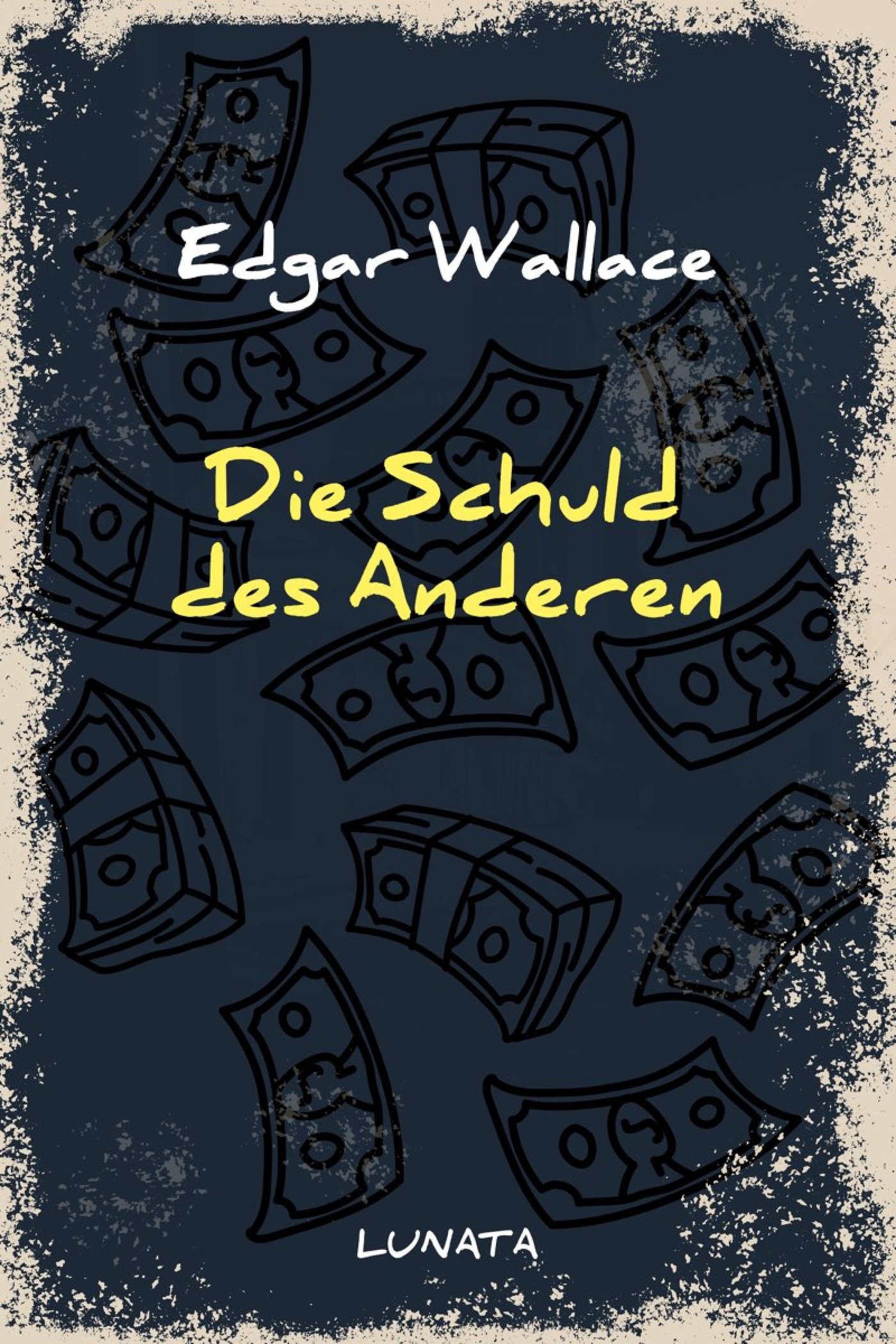
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
In Paris ist zehn Jahre zuvor Falschgeld durch einen ominösen ›Klub der Verbrecher‹ in Umlauf gebracht worden. Hauptverdächtige waren der Künstler Willetts und der reiche Bell, zwei Amerikaner, die sich nach England absetzten. Nun sind in London erneut gefälschte Banknoten aufgetaucht. Haben Willetts und Bell etwas damit zu tun? Spannende Unterhaltung vom Großmeister der Kriminalliteratur.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 224
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LUNATA
Die Schuld des Anderen
Kriminalroman
Edgar Wallace
Die Schuld des Anderen
Kriminalroman
© 1916 by Edgar Wallace
Originaltitel A Debt Discharged
Aus dem Englischen von Ravi Ravendro
© Lunata Berlin 2020
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
1
Monsieur Trebolino, der Chef der französischen Kriminalpolizei, saß in seinem Büro und tat genau das, was von ihm erwartet wurde – er dachte nach. Den Schreibtischsessel hatte er an das lodernde Kaminfeuer geschoben; es war unangenehm kalt an diesem Märznachmittag, ganz Paris lag unter einer dichten Schneedecke begraben.
Eigentlich hätte sich Monsieur Trebolino nicht den Kopf zu zerbrechen brauchen. Der Tatkraft dieses klugen Italieners, der schon als junger Mann die französische Staatsbürgerschaft angenommen hatte, war es zu verdanken, daß in Frankreich kaum noch Verbrechen größeren Ausmaßes begangen wurden.
Aber gerade weil Monsieur Trebolino nicht viel zu tun hatte, kümmerte er sich zur Zeit auch um kleinere Dinge, die er früher seinen Untergebenen überlassen hatte. Einen solchen Fall ließ er sich gerade durch den Kopf gehen, und merkwürdigerweise schien ihm verschiedenes daran durchaus nicht klar zu sein.
Er drückte auf einen Klingelknopf neben dem Kamin, und gleich darauf klopfte es. Monsieur Lecomte, der dazu ausersehen war, einmal der Nachfolger seines Vorgesetzten zu werden, trat ins Zimmer und wurde von seinem Chef mit einem wohlwollenden Lächeln begrüßt.
»Setzen Sie sich bitte«, sagte Monsieur Trebolino und wies auf einen Ledersessel in seiner Nähe. »Eine Frage – haben Sie schon einmal von dem ›Klub der Verbrecher‹ gehört, der hier in Paris bestehen soll?«.
Lecomte nickte.
»Dieser Klub mag ja ganz interessant sein«, fuhr Trebolino fort. »Meiner Meinung nach sollte man aber doch daran denken, damit Schluß zu machen – Studenten sind nun einmal unruhige Leute.«
»Ich glaube, daß der Verein bald ganz von selbst eingehen; wird – wie es meist in solchen Fällen ist«, entgegnete Lecomte verwundert.
Trebolino zog die Stirn in Falten.
»Was wissen Sie überhaupt davon?«
»Nicht mehr, als Sie selbst«, sagte Lecomte achselzuckend. »Eine Anzahl von Studenten hat einen Verein gegründet. Bei ihren Zusammenkünften befolgen Sie feierliche Rituale, gebrauchen Kennworte, leisten Eide – kurz, treiben all den Unsinn, der bei Geheimbruderschaften und Logen nun einmal üblich ist. Ihre Treffen finden jeweils an irgendeinem anderen geheimen Platz statt – der der Polizei aber jedesmal schon mindestens eine Woche vorher bekannt ist.«
Lecomte amüsierte sich, und Trebolino nickte ihm verständnisinnig zu.
»Jedes Klubmitglied schwört, irgendein französisches Gesetz zu übertreten«, fuhr Lecomte dann fort. »Bis jetzt haben sich ihre Gesetzwidrigkeiten allerdings darauf beschränkt, daß sie einen Polizisten belästigten.«
»Sie haben ihn in die Seine geworfen, nicht wahr?« warf Trebolino ein.
»Ganz richtig – und zwei der bösen Buben wären beinahe ertrunken, als sie ihn wieder herausfischten. Wir haben sie zwei Tage lang eingesperrt und ihnen außerdem noch zweihundert Franc Geldstrafe aufgebrummt. – Was sie sonst noch anstellen, kann man übrigens nur als Kindereien und den üblichen Studentenulk bezeichnen.«
Der Chef der Kriminalpolizei schien trotzdem nicht befriedigt zu sein.
»Das klingt alles sehr harmlos«, meinte er nachdenklich, »aber es wäre mir trotzdem lieber, wenn diesem Unfug ein Ende gemacht würde. Es gibt immerhin einige Klubmitglieder, die mir durchaus nicht so harmlos zu sein scheinen – ich denke zum Beispiel an diesen Willetts.«
Lecomte nickte.
»Soviel ich weiß«, fuhr Trebolino fort, »ist Mr. Willetts eine Art Künstler. Er wohnt mit einem jungen Amerikaner – ich glaube, er heißt Comstock Bell – zusammen.«
»Das heißt, er wohnte«, verbesserte Lecomte. »Mr. Bell ist sehr reich und lebt ganz seinen Neigungen. Er ist ein Mann von Geschmack – Mr. Willetts dagegen trinkt ziemlich viel.«
»Dann haben sie sich also getrennt«, entgegnete Trebolino überrascht. »Das wußte ich noch gar nicht. Bis jetzt wurde ich nur darüber informiert, daß die beiden sich vorgenommen hatten, uns einige ziemlich unangenehme Überraschungen zu bereiten. Überraschungen, die keine Lausbubenstreiche mehr gewesen wären, sondern die man unter die Kategorie schwerer Verbrechen – bis zum Mord – hätte einreihen müssen.«
Er stand auf und trat ans Fenster.
»Also, Monsieur Lecomte«, sagte er dann nach einigen Minuten nachdenklichen Schweigens, »sorgen Sie dafür, daß dieser ganze Unfug ein Ende findet. Studenten schlagen manchmal über die Stränge, gewiß – aber hier scheint sich etwas anzubahnen, was man durchaus nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Berichten Sie mir dann bitte, was Sie unternommen haben!«
Lecomte verließ das Büro seines Vorgesetzten und war eigentlich ein wenig belustigt. Lohnte es sich wirklich, dieser Sache so viel Bedeutung beizumessen? Noch dazu, da er alle Mitglieder des ›Klubs der Verbrecher‹ sehr gut kannte und sogar von Zeit zu Zeit zu ihren Zusammenkünften eingeladen wurde. Na, man würde sehen ... Noch am gleichen Abend ging Monsieur Lecomte nach Dienstschluss in das ›Café der Barbaren‹, einen der Treffpunkte der Studenten.
Er wurde mit Hallo begrüßt, ein Student machte ihm sofort an einem großen Tisch einen Platz frei, während ein anderer, ein gutaussehender junger Mann, ein Glas Wein für den Beamten bestellte. Lecomte betrachtete ihn interessiert. Er war groß und schlank, dabei aber sehr kräftig gebaut. Seine grauen Augen blickten so freundlich und unbekümmert in die Welt, wie man es bei einem jungen Mann seines Alters erwarten konnte.
»Sie sind gerade zur rechten Zeit gekommen, um einer Unterhaltung beizuwohnen, die Sie persönlich besonders interessieren dürfte«, sagte der Student lachend und deutete auf einen seiner Kommilitonen, einen bärtigen, hageren Jüngling. »Mein Freund hier vertritt eben die Ansicht, daß die Ermordung eines Polizeispitzels nach der Lehre des Aristoteles durchaus entschuldbar wäre. Was halten Sie davon?«
»Nicht viel, wie Sie sich denken können«, entgegnete Lecomte grinsend und leerte sein Glas zur Hälfte. »Aber wenn Sie unbedingt die Probe aufs Exempel machen wollen – der Staatsanwalt wird bestimmt gerne mit Ihnen debattieren.«
»Vielleicht wäre das am besten«, rief der Bärtige trotzig. »Mein Freund Willetts jedenfalls ...« Er fuhr fort, seine Theorie durch allerhand Erlebnisse und Erfahrungen zu bekräftigen, die sein Freund Willetts – ein blasiert dreinschauender Mann mit bleichem Gesicht, der etwas älter als seine Kommilitonen zu sein schien – angeblich gemacht hatte.
»Ist dieser Willetts auch Ihr Freund, Mr. Bell?« fragte Lecomte leise.
Der Student mit den grauen Augen, an den die Frage gerichtet war, machte eine abwehrende Handbewegung.
»Wie meinen Sie das?« erkundigte er sich kühl.
Lecomte zuckte die Schultern.
»In meinem Beruf hört man so allerlei«, sagte er leichthin. »Besonders was den ›Klub der Verbrecher‹ angeht.«
Comstock Bell sah ihn argwöhnisch, fast ängstlich an.
»Die ganze Angelegenheit ist doch nur ein Scherz ...«, begann er, verstummte aber sofort wieder. Lecomte gab sich vergeblich Mühe, ihn noch einmal zum Reden zu bringen.
Plötzlich erhob sich allgemeines Stimmengewirr. Lecomte gebot mit einer Handbewegung Schweigen und beantwortete die Frage, die ein Student aufgeworfen hatte.
»Nein – gestorben ist er nicht, bloßes Untertauchen genügt nicht, um einen richtigen Polizisten ins Jenseits zu befördern. Aber da Sie gerade diese Sache erwähnen, meine Herren, möchte ich Ihnen auch gleich sagen, daß es höchste Zeit ist, Ihren ›Klub der Verbrecher‹ aufzulösen. Der Chef der Kriminalpolizei persönlich hat mich beauftragt, Ihnen dies mitzuteilen!«
»Und wir sollen natürlich brav gehorchen!« rief Willetts mit schriller Stimme. Es war das erste Mal, daß er sich in die Unterhaltung mischte.
Lecomte beobachtete ihn. Er sah ungesund aus, jeder Zug in seinem Gesicht zeugte von einem sehr unsoliden Lebenswandel.
»Na schön«, fuhr Willetts mit lauter Stimme fort. »Wir werden den Klub schließen – aber sein Geist soll wenigstens in einigen Mitgliedern weiterleben.«
Lecomte sah Comstock Bell an, dem diese Worte offensichtlich galten. Der Student wurde blaß, als der anscheinend ziemlich betrunkene Willetts weitersprach.
»Mr. Bell natürlich ist fahnenflüchtig geworden. Noch vor kurzem war er mein Komplice – aber jetzt vertragen wir uns nicht mehr richtig. Er ist eben Amerikaner – und außerdem ein Kapitalist! Vielleicht ist er aber auch nur ein Feigling ...!«
Die letzten Worte hatte er laut über den Tisch gerufen. Willetts war in betrunkenem Zustand zu allem fähig, das wußte jeder.
Comstock Bell antwortete nicht.
»Wir haben nämlich ...«, wollte Willetts eben fortfahren, als ein Herr das Café betrat, sich suchend umschaute und auf Lecomte zuging.
»Entschuldigen Sie mich einen Augenblick, meine Herren«, sagte der Polizeibeamte, stand auf und trat zu dem Fremden. Sie unterhielten sich leise miteinander. Die Studenten sahen, daß Lecomte die Stirn runzelte und hörten einen unterdrückten Ausruf. Nach einer Zeit kam er zurück.
»Meine Herren«, sagte er, und seine Stimme klang durchaus nicht mehr freundlich. »Heute nachmittag wurde in Cooks Reisebüro eine englische Fünfzigpfundnote gewechselt – und diese Note war gefälscht!«
Niemand sprach. Es herrschte tödliches Schweigen.
»Der Geldschein wurde von einem Studenten gewechselt, und auf der Rückseite standen die Buchstaben ›K. d. V.‹. Hier hört der Spaß auf, und ich möchte den Verantwortlichen ersuchen, morgen früh auf das Polizeipräsidium zu kommen!«
Am nächsten Morgen kam niemand in Trebolinos Büro. Willets wurde noch am selben Abend telegrafisch nach London zurückgerufen, und Comstock Bell verließ Paris mit demselben Zug.
Die beiden wußten nicht, daß sie hei der Abfahrt von Lecomte beobachtet wurden. Drei Tage später erhielt er eine englische Fünfzigpfundnote in einem Briefumschlag. Es war kein Absender angegeben, und außer dem Geldschein befand sich in dem Kuvert nur noch ein Stück Papier, auf dem in Maschinenschrift stand: »Bitte leiten Sie dieses Geld an die Firma Cook weiter.«
Lecomte berichtete seinem Vorgesetzten von dieser Sache. Trebolino nickte.
»Wir wollen die Angelegenheit damit erledigt sein lassen. Es hat keinen Zweck, die Öffentlichkeit deswegen zu alarmieren.«
Er legte die gefälschte Banknote in seinen Schreibtisch und vergaß sie bald. –
Einige Jahre später wurde Monsieur Trebolino, der Chef der französischen Kriminalpolizei, bei der Festnahme eines Verbrechers erschossen. Ein Beamter, der seinen Schreibtisch aufräumte, fand in einem Fach eine englische Fünfzigpfundnote, die offensichtlich gefälscht war. Unschlüssig hielt er sie eine Zeitlang in der Hand und gab sie dann seinem Sekretär mit dem Auftrag, den Geldschein an die Bank von England zu schicken.«
»Vielleicht können sie etwas damit anfangen«, meinte er achselzuckend.
Lecomte hätte erklären können, wie diese Banknote in Trebolinos Besitz gekommen, war, aber er befand sich zu dieser Zeit in Lyon.
Im Terriers-Klub fand ein großer Empfang statt – vor dem vornehmen Gebäude stand eine lange Reihe chromblitzender Wagen. ›Terriers‹ ist einer der vornehmsten Klubs, und dieser große Empfang bedeutete wie jedes Jahr den Beginn der Saison.
Zahlreiche der alten Klubmitglieder fühlten sich ziemlich ungemütlich. Es war ihnen gar nicht recht, daß die Räume, in denen sie sich sonst wie zu Hause fühlten, heute von einer plaudernden, eleganten Gesellschaft belebt waren. Am meisten störten sie die vielen Damen – ein ganz ungewohnter Anblick in einem Herrenklub.
Draußen regnete es, und Wentworth Gold stieg schnell die Marmortreppen hinauf, um in die große Empfangshalle zu gelangen. An der Garderobe legte er Hut und Mantel ab und ordnete vor dem Spiegel seine Krawatte.
Wentworth Gold war ein außergewöhnlicher Mann – und er hatte auch außergewöhnliche Interessen. Von mittlerer Größe, mit buschigen Brauen, unter denen seine grauen Augen durch einen Klemmer lebhaft in die Welt blickten, konnte man ihn. nicht gerade einen gutaussehenden Mann nennen. Er war eher häßlich, übte aber doch auf Frauen eine faszinierende Wirkung aus. Als Amerikaner hatte er sich außerdem eine gewisse Unbekümmertheit des Auftretens bewahrt, die fast schon an Frechheit grenzte.
In England lebte Mr. Gold schon seit langer Zeit. Er hatte die Engländer gern – und sagte das mit einem liebenswürdigen, mitleidigen Lächeln und einem Ton, als ob er arme Mitmenschen darüber trösten wollte, daß sie nicht das Vorrecht mit ihm teilten, in Amerika geboren worden zu sein. Im übrigen fand ihn jedermann sympathisch, gerade weil er so offen und typisch amerikanisch war.
Welchen Beruf Mr. Gold eigentlich hatte, wußte niemand so richtig. Ein- oder zweimal in der Woche machte er dem amerikanischen Konsulat seinen Besuch, »um seine Post abzuholen«. Merkwürdigerweise holte er diese Post manchmal um drei Uhr morgens ab, und Seine Exzellenz der Konsul kam dann im Pyjama zu einer Unterredung ins Büro herunter.
Solch ein Gespräch fand auch statt, als der Präsident einer kleinen südamerikanischen Republik, die als sehr aggressiv bekannt war, einer benachbarten größeren Republik den Krieg erklären wollte. Die wichtigsten darauffolgenden Ereignisse dieses Tages kann man folgendermaßen zusammenstellen:
5.00 nachmittags. Senor de Silva (Privatsekretär des Präsidenten von Furina) kommt ins Carlton-Hotel.
5.30 nachmittags. Monsieur Dubec (Generalvertreter der Vereinigten Belgischen Waffen- und Munitionsfabriken) erscheint ebenfalls im Carlton-Hotel und führt eine geheime Besprechung mit dem vorerwähnten Privatsekretär.
8.00 abends. Beide essen zusammen in einem Einzelzimmer.
9.00 abends. Monsieur Dubec reist nach Belgien ab.
2.00 nachts. Wentworth Gold kommt in das amerikanische Konsulat.
5.00 morgens. Senor de Silva erhält den Besuch des Polizeiinspektors Grayson (Spezialabteilung der Interpol).
9.00 vormittags. Senor de Silva verläßt London in größter Eile und offensichtlicher Verwirrung, um sich nach Paris zu begeben.
11.00 vormittags. Inspektor Grayson und Wentworth Gold begegnen sich zufällig am Themse-Ufer und grüßen einander sehr formell und höflich.
Wentworth Gold hatte überall zu tun. Anscheinend war es sein Beruf, alles zu wissen – und tatsächlich wußte er auch alles. Das meiste, was er erfuhr, behielt er für sich, denn er vertraute niemand. Er hatte kein Büro, keine Angestellten und bekleidete keine offizielle Stellung. Aber in seiner Westentasche trug er einen kleinen silbernen Stern, der einen überwältigenden Eindruck auf gewisse Leute machte. Er verkehrte in den ersten Kreisen der Gesellschaft, doch sah man ihn auch häufig mit Leuten aus der Unterwelt. Gerade deshalb wußte er alles.
Gold ging zur Eingangshalle zurück, stieg eine große breite Treppe empor, lehnte sich über die Brüstung und beobachtete das farbenprächtige Schauspiel, das sich seinen Augen bot.
Unten stand der spanische Botschafter mit seiner hübschen Tochter und nickte dem italienischen Geschäftsträger zu. Es entging Gold auch nicht, daß Mrs. Granger Collok in die große Halle trat, gefolgt von einer Schar junger Herren. Manche Frauen besaßen eben eine außerordentliche Gabe, sich über die Meinung ihrer Mitmenschen hinwegzusetzen, und erschienen auch nach einem aufsehenerregenden Scheidungsprozess unbefangen in der Öffentlichkeit.
2
Jetzt sah er unten in der Menge auch Comstock Bell und behielt ihn im Auge, denn er interessierte sich zur Zeit sehr für diesen jungen Amerikaner. Comstock Bell war ein auffallend gutaussehender Mann, hochgewachsen und bis auf einen kleinen Schnurrbart glattrasiert. Man erzählte sich, daß er sehr reich sei und trotzdem noch nicht geheiratet habe. So war es nur natürlich, daß sich die Damenwelt auffallend viel und eingehend mit ihm beschäftigte.
Gold stützte sich mit den Ellbogen auf die Brüstung. Er ließ den jungen Mann nicht aus den Augen. Comstock Bell erwiderte nur nachlässig die Zurufe der anderen und machte keinen besonders glücklichen Eindruck.
Der junge Mann hatte sich soeben an eine kleine Gruppe von Herren gewandt, die ihn sehr zuvorkommend begrüßten. Aber die Unterhaltung dauerte nicht lange, gleich darauf ging er zum Empfangssalon.
»Sehr merkwürdig«, sagte Mr. Gold in Gedanken versunken vor sich hin.
»Was ist merkwürdig?« fragte jemand.
Dicht neben Gold stand ein Herr an der Brüstung.
»Hallo, Helder! Interessieren Sie sich auch für gesellschaftliche Ereignisse?«
»Eigentlich nicht besonders«, antwortete der andere nachlässig. Teilweise finde ich sie sogar furchtbar langweilig. Aber Sie sagten doch eben, daß etwas sehr merkwürdig sei. Was meinten Sie damit?«
Gold lächelte, nahm seinen Klemmer ab und schaute Helder aufmerksam an.
»Die Jagd nach Vergnügen, Ehrgeiz, Modetorheiten, all das ist vom Standpunkt eines vernünftigen Menschen aus ungewöhnlich und merkwürdig, finden Sie nicht auch?«
Helder war offenbar auch Amerikaner. Er war groß, aber viel fülliger als Comstock Bell und sah aus, als ob er Essen und Trinken zu schätzen wüßte. In London war er bekannt als ein Mann, der immer Bescheid über den neuesten Klatsch wußte.
»Haben Sie schon gesehen, daß Comstock Bell da ist?« fragte Helder plötzlich.
Gold nickte.
»Finden Sie nicht, daß er einen merkwürdigen Gesichtsausdruck hat – so, als ob ihm etwas Sorgen machen würde?«
Gold streifte Helder mit einem schnellen Seitenblick.
»Ist Ihnen das aufgefallen?« fragte er dann gleichgültig.
»Meiner Meinung nach steht ihm die Nervosität auf der Nasenspitze geschrieben. Das ist bei einem reichen und unabhängigen jungen Mann ziemlich seltsam.
»Es gibt noch seltsamere Dinge.«
»Neulich habe ich mit Villier Lecomte gesprochen«, sagte Helder, der nicht lockerließ.
Gold wurde aufmerksam. Es war klar, daß sich Helder nicht nur mit ihm unterhalten wollte, sondern daß er etwas ganz Bestimmtes, das Comstock Bell betraf, an die richtige Adresse bringen wollte.
»Mit wem haben Sie gesprochen?«
»Mit Villier Lecomte – Sie kennen ihn doch?«
Gold kannte Lecomte sehr gut und wußte, daß er ein hoher französischer Kriminalbeamter war. Ohne zu übertreiben, konnte man sagen, daß er mit ihm so gut bekannt war wie mit seinem eigenen Bruder – aber es gab viele Gründe, aus denen er es nicht gern sah, daß das jemand wußte.
»Nein«, antwortete er deshalb, »nur den Namen muß ich schon irgendwo gehört haben.«
»Er ist ein hohes Tier bei der Pariser Kriminalpolizei. Neulich war er hier, und ich sprach mit ihm.«
»Sehr interessant«, entgegnete Gold. »Und was hat er Ihnen denn erzählt?«
»Ob, er wußte einiges über Comstock Bell«, erwiderte Helder und beobachtete Gold dabei scharf.
»Und wie kommt es, daß Mr. Bell die Aufmerksamkeit der französischen Polizei auf sich gelenkt hat? Er hat doch niemand ermordet?«
»Aber wissen Sie denn wirklich nicht, daß Comstock Bell früher einmal Mitglied des ›Klub der Verbrecher‹ war?«
›Klub der Verbrecher‹? Noch nie etwas davon gehört«, sagte Gold lachend.
Helder zögerte. Es standen außer ihnen noch andere Leute in der Nähe der Brüstung und schauten auf die Leute hinunter. Eine junge Dame zum Beispiel, die sich neben ihnen über das Geländer lehnte, konnte ohne weiteres jedes Wort ihres Gesprächs verstehen.
»Gut, ich will es Ihnen sagen; selbst auf die Gefahr hin, daß es nichts Neues für Sie ist. Meiner Meinung nach kann man Ihnen überhaupt nichts Neues erzählen! Also – vor einigen Jahren, als Bell in Paris studierte, gründete er mit einer Anzahl anderer Studenten den ›Klub der Verbrecher‹. Es war so eine Idee, wie sie querköpfige junge Leute manchmal haben, jedes Klubmitglied legte ein Gelübde ab, irgendwie das Gesetz zu übertreten, und zwar mußte es ein Verbrechen sein, das bei Entdeckung mindestens eine Gefängnisstrafe eintrug.«
»Sehr lustig! Wie viele der Mitglieder sind denn schon aufgehängt worden?«
»Niemand, soviel ich weiß. Der Klub wurde rechtzeitig aufgelöst, ohne daß man jemand festgenommen hätte. Die Mitglieder hatten übrigens Decknamen angenommen, die in den Geheimakten des Klubs vermerkt waren. Ein einziges schweres Verbrechen hätte man dem Klub eventuell zur Last legen können, gerade dieses Verbrechen wurde aber niemals ganz aufgeklärt, da man den mutmaßlichen Verbrecher nicht überführen konnte.«
»Es handelte sich doch nicht etwa um Falschmünzerei?« erkundigte sich Gold harmlos.
Helder lächelte.
»Sie wissen also doch von der Sache?«
»Wenn Sie die Geschichte von dem Studenten meinen, der eine Fünfzigpfundnote fälschte und sie in Zahlung gab – ja«, erwiderte Gold. »Ich erinnere mich jetzt ganz genau. Aber was hat denn das alles mit Comstock Bell zu tun?«
»Es ist mir zufällig bekannt, daß er Mitglied des ›Klubs der Verbrecher‹ war«, sagte Helder leichthin. »Ich weiß auch, daß die französische Polizei im Zusammenhang mit der Falschgeldgeschichte zwei Personen verdächtigte.«
Gold wandte sich ihm zu und sah ihm gerade ins Gesicht.
»Wenn Sie so viel wissen, können Sie mir vielleicht auch sagen, wer die beiden Leute sind?« fragte er in ungewöhnlich scharfem Ton.
Helder schaute sich nervös um.
»Wenn Sie es unbedingt wissen wollen – einer der beiden ist Comstock Bell.«
»Und der andere?«
»Den kenne ich nicht. Er soll aber auch in London leben – ein Börsenmakler oder so etwas Ähnliches.«
»Ihre Mitteilungen sind wirklich interessant«, meinte Gold spöttisch und ging lächelnd die Treppe hinunter.
Comstock Bell war inzwischen in den Empfangssalon getreten. Er schien wirklich nicht in der besten Laune zu sein, als er auf die Frau des Klubpräsidenten zuging. Vom Billardzimmer drangen die Klänge einer Musikkapelle herüber. Jemand sprach ihn an. Er wandte sich halb um und erkannte Lord Hallindale.
»Bell, ich habe gerade nach Ihnen gesucht«, sagte der Lord. »Ich mache nächsten Monat eine Reise zum Mittelmeer und möchte Sie fragen, ob Sie keine Lust haben mitzukommen?«
Comstock Bell lächelte.
»Es tut mir leid, aber ich habe andere Pläne.«
»Werden Sie London verlassen?«
»Ja, ich habe die Absicht, nach den Vereinigten Staaten zu gehen. Meine Mutter fühlt sich nicht recht wohl, und ich möchte sie wieder einmal besuchen.«
Er ging weiter. Diese Ausrede hatte er schnell erfunden. Er beabsichtige keineswegs, England zu verlassen, bevor nicht eine gewisse Angelegenheit endgültig geregelt war.
Langsam schlenderte er zum Speisesaal, wo der Vortrag eines bekannten Pianisten eine Menge Zuhörer angelockt hatte.
Bell stand in der hintersten Reihe, aber da er sehr groß war, konnte er ohne Schwierigkeit über die Köpfe der anderen hinwegsehen. »Sie haben es gut«, flüsterte jemand neben ihm.
Als er sich umschaute, bemerkte er Mrs. Granger Collaks bewundernden Blick. Auch er war von der Schönheit dieser lebenslustigen Frau beeindruckt.
»Soll ich Sie ein wenig hochheben?« fragte er lächelnd.
Er hatte bis jetzt noch nie versucht, näher mit ihr bekannt zu werden, obwohl er wußte, daß sie ihn gerne sah.
»Sie können mich in eine ruhige Ecke führen«, sagte sie. »Dieser Trubel hier ist mir unangenehm.«
Er brachte sie zu einer Nische in der äußersten Wandelhalle und nahm neben ihr Platz.
Sie seufzte erleichtert auf.
»Comstock«, begann sie, »ich möchte, daß Sie mir helfen.«
Ihre Blicke begegneten sich, und sie las in seinen Augen Zuneigung, aber auch ein wenig Mitleid.
»Sie brauchen mich nicht wie einen armen Sünder anzuschauen«, sagte sie abwehrend. »Daß an mir nicht viel Gutes dran ist, weiß ich selbst – und es stimmt auch, daß ich fast am Ende meiner Kraft bin. Ich müßte Geld haben, um einmal weit fortzugehen, einige Jahre auf Reisen zu sein. Die Leute halten mich für schamlos, weil ich mich hier wieder sehen lasse nach all dem – aber Sie wissen es ja.
Für einige Jahre verschwinden, allein sein – das möchte ich, Comstock. Und doch bin ich an Händen und Füßen gebunden.«
Er hörte, wie jemand in ihre Nähe kam. Als er aufschaute, sah er Helder, der vor sich hinlächelte, dann aber sofort nach der anderen Seite schaute.
»Besuchen Sie mich morgen in meiner Wohnung am Cadogan Square«, entgegnete er freundlich und stand auf. Vielleicht kann ich etwas für Sie tun.«
Sie legte leicht ihre Hand auf seinen Arm.
»Das ist sehr lieb von Ihnen«, sagte sie leise. »Ich könnte Ihnen das Geld aber nicht zurückgeben, wenn Sie mir damit aushelfen wollten ... Wie soll ich Ihnen danken?«
Er schüttelte lächelnd den Kopf und verabschiedete sich mit einer Verbeugung von ihr. Langsam ging er zur Garderobe, um Hut und Mantel zu holen. Dort traf er Gold, der sich ebenfalls seinen Mantel hatte geben lassen.
»Wollen Sie schon gehen?«
Bell nickte.
»Ja, diese gesellschaftlichen Verpflichtungen langweilen mich – ich glaube, ich werde alt. Aber Sie scheinen es doch auch ziemlich eilig zu haben, von hier fortzukommen?«
»Ich habe zu tun, meine Geschäfte lassen mir keine Ruhe«, erwiderte Gold freundlich. »Gehen wir ein Stück zusammen?«
Comstock nickte, und die beiden traten, auf die Straße. Neugierig verfolgte sie jemand mit den Augen.
Schweigend, gingen sie ein Stück zu Fuß, dann wurde der Regen stärker, und als ein Taxi vorbeifuhr, hielt es Gold an.
»Fleet Street!« rief er laut.
Sie waren noch nicht weit gefahren, als er dem Chauffeur auf die Schulter klopfte und ihm eine andere Instruktion gab.
»Bringen Sie mich zur Victoria Station. Fahren Sie durch den Park.«
»Haben Sie Ihre Absicht geändert?« fragte Bell.
»Nein, aber ich bin leider für viele Leute so interessant, daß sie ihre Zeit anscheinend nicht besser verwenden können, als mich zu beobachten. Haben Sie nicht bemerkt, daß wir verfolgt wurden?«
»Nein«, erwiderte Bell erstaunt.
»Ich möchte Sie etwas fragen« – der Wagen bog in den Park ein –, »kennen Sie einen gewissen Willetts?«
»Willetts?«
»Er ist Börsenmakler und hat ein Büro in der Nähe der Moorgate Street. Aber ich habe eigentlich noch nie gehört, daß er Aktien gekauft oder verkauft hätte.«
»Ich kenne ihn nicht«, sagte Bell kurz.
Eine lange Pause trat ein. Gold lehnte sich vor, schaute zum Fenster hinaus und bewegte in unregelmäßigen Zwischenräumen die Lippen.
»Ich glaube, ich muß hier aussteigen«, sagte er dann plötzlich und bat den Chauffeur zu halten.
Sie verabschiedeten sich, und Gold stieg aus. Nachdenklich folgte ihm Bell mit den Augen. Der Motor des Taxis war abgestorben, und der Chauffeur mühte sich mit dem Anlasser ab. Bell sah, wie ein Mann aus einer dunklen Seitenstraße auf Gold zutrat. Er kurbelte das Fenster herunter und hörte zu.
»Sind Sie Mr. Gold?« fragte der Mann.
»Ja.«
»Sie sind hier verabredet?«
»Woher wissen Sie denn, daß ich mich hier verabredet habe?« entgegnete Gold ärgerlich.
»Das muß ich Ihnen wohl nicht erst erklären!« rief der Fremde böse.
Gleich darauf hörte man einen scharfen Schuss.
Bell sprang aus dem Wagen. Gold stand unverletzt an der Ecke der Seitenstraße. Der Mann, der geschossen hatte, war davongelaufen und in der Dunkelheit verschwunden.
»Das war nur einer meiner Freunde«, sagte Gold liebenswürdig. Er bückte sich und hob die Pistole auf, die der Mann hatte fallen lassen.
3
Wentworth betrat an diesem Abend um elf Uhr die Victoria-Station und löste eine Fahrkarte nach Peckham Rye.
Er steckte sich eine Zigarre an, ging langsam den Bahnsteig entlang und stieg in den wartenden Zug ein. Im Abteil schloß er die Tür, schaute durchs offene Fenster und beobachtete aufmerksam alle Leute, die vorbeikamen.
Die Theater- und Kinovorstellungen waren um diese Zeit noch nicht zu Ende, und der Zug fuhr deshalb nur mäßig besetzt aus dem Bahnhof. Gold holte einen Brief hervor, den er erhalten hatte, bevor er an diesem Abend seine Wohnung verließ. Er las ihn mehrere Male sorgfältig durch, bis er den Inhalt auswendig kannte. Dann zerriß er ihn in kleine Fetzen, die er in Abständen zum Fenster hinauswarf.
Das Attentat, das heute Abend auf ihn verübt worden war, beunruhigte ihn wenig. Aber er wunderte sich darüber, daß der Mann, den er im Park hatte treffen wollen, nicht gekommen war.
In Peckham Rye verließ er den Zug und ging zu Fuß zur Christal Palace Road. Vor einer größeren Villa blieb er stehen. Das Haus lag im Dunkeln, aber er wußte, daß man ihn erwartete. Er ging zur Tür, drückte auf die Klingel, und gleich darauf wurde ihm geöffnet.
»Sind Sie Mr. Gold?« fragte eine weibliche Stimme.
»Diese Frage wurde mir heute Abend schon einmal gestellt«, sagte er und lachte.
Die junge Dame schloß die Tür hinter ihm und half ihm beim Ausziehen seines Mantels.
»Sie kommen spät«, sagte sie, und er hörte die Besorgnis aus ihrer Stimme.
»Nun ja, ich wurde aufgehalten«, entgegnete er. »Wo ist Ihr Onkel?«
Sie antwortete nur mit einem Seufzer, und er schüttelte den Kopf. Maple war zwar ohne Zweifel ein genialer Mann, aber auch bei ihm bestätigte sich wieder einmal die alte Wahrheit, daß Genialität nicht weit von Verrücktheit entfernt ist.
Sie führte ihn durch einen dunklen Gang zu einer kleinen Küche, die an der Rückseite des Hauses lag.





























