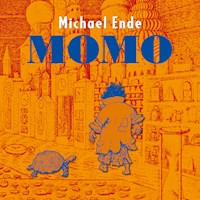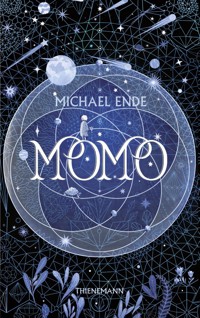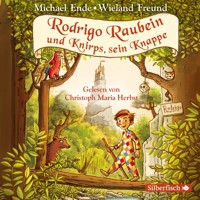6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks: Edition Michael Ende
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Ein mysteriöser Wohltäter will sein Erbe unter Fremden aufteilen: Dem Träumer, der adlige Lady, dem Ex-Offizier, der Dienstmagd bis zur blinden, verhärmten Bauersfrau – jeder erhält nur ein Stück des Testaments. Um das Erbe antreten zu können, müssen sie nur all ihre Stücke zusammenfügen. Doch nun beginnt ein Ränkespiel, das in einem apokalyptischen Alptraum endet. Denn je mehr sich die Erben streiten, gegenseitig ausspielen, Komplotte schmieden, umso mehr verändert sich die Realität um sie herum. Das Schloss, der Butler, alles scheint eine organische Einheit zu sein, in welcher der Geist des Verstorbenen noch immer sein Wesen treibt. Und auf Lügen, Betrug und Intrige reagiert er mit Verfall und Dunkelheit …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 193
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Michael Ende
Die Spielverderber
Oder:Das Erbe der Narren
Commedia Infernale
Vorwort
Die Uraufführung dieses Stückes im Jahre 1967 an den Frankfurter Städtischen Bühnen endete mit einem Tumult im Zuschauerraum. Ein Teil des Publikums, zugegeben der kleinere, klatschte ostentativ Beifall, der andere, größere, buhte und pfiff. Ich erinnere mich noch an einen Herrn in einer der ersten Reihen, der auf seinen Sitz gestiegen war und heftig gestikulierend nach hinten auf die Protestierenden einredete. Der Kampf dauerte immerhin fast eine halbe Stunde.
Die Kritiken waren, von sehr wenigen Ausnahmen abgesehen, vernichtend. Man fand das Stück wirr, unverständlich, symbolüberladen, mystisch verquast und vor allem schrecklich pessimistisch. Man hielt es für »absurdes Theater« und verglich es – natürlich sehr zu seinen Ungunsten – mit den Stücken von Ionesco und Beckett. An denen gemessen, war es freilich nicht absurd genug. Dass es sich bei meinem Stück um eine kritische Parabel, ein zorniges Narrenspiel handelte, das der Zeit den Spiegel vorhalten wollte, wurde entweder überhaupt nicht wahrgenommen, oder der gleichnishafte Charakter des Stückes wurde als äußerst ärgerlich empfunden. Niemand erkannte sich oder unser aller Situation in dem Bild wieder, das mein Spiegel zeigte.
Die Spielverderber oder Das Erbe der Narren ist – nach meiner Ansicht – ein optimistisches Stück. Es geht nämlich von der Hoffnung aus, dass ein auf dem Theater vorgeführter, imaginärer Weltuntergang – bei dem ja keiner Fliege etwas zuleide getan wird – auf irgendeine wenn auch noch so bescheidene Art dazu beitragen könnte, den wirklichen Weltuntergang zu verhindern. Das war freilich naiv. Doch konnte ich mich dabei immerhin auf die Naivität meines damaligen Lehrmeisters Brecht berufen, der gesagt hatte: »Es geht mir nicht darum, meine Figuren auf der Bühne sehend zu machen, sondern den Zuschauer.« Bisweilen kann man sich allerdings des Eindrucks nicht ganz erwehren, dass viele Leute die wirklichen Weltuntergänge weniger deprimierend finden als jene, die ihnen auf der Bühne oder in der Kunst vor Augen geführt werden. Meine späteren Arbeiten waren dann ja auch viel weniger aggressiv – und ich weniger optimistisch.
Ich hatte schon vor 1960 erste Entwürfe für dieses Stück niedergeschrieben, hatte es unzählige Male umgearbeitet, immer wieder von Neuem versucht, es knapper und noch deutlicher zu formulieren. Mein Ziel war eine Art moderner Comedia del Arte, ein Typentheater, das mehr auf drastische Handlung setzt als auf die psychologische Auslotung der Figuren. Ich wollte paradigmatisch die typischen Verhaltensmuster darstellen, die man tagtäglich im nationalen und internationalen politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben beobachten konnte und die seit dem Anbruch des mit Hiroshima eingeleiteten Atomzeitalters allesamt unsinnig, ja selbstmörderisch geworden waren. Die Metapher dafür ist in meinem Stück eine Erbengesellschaft, die sich zur Eröffnung des Testaments eines geheimnisvollen Erblassers in einem Zauberschloss voller unbekannter Kräfte zusammenfindet und sich vor die Wahl gestellt sieht, entweder im gemeinsamen Interesse aller zusammenzuwirken oder auf grausige Art zugrunde zu gehen. In dieser Situation völliger Verunsicherung, in der jede Entscheidung unvorhersehbare Auswirkungen hat, müssten die Erben ganz neue, ihren bisherigen Konventionen entgegengesetzte Verhaltensweisen an den Tag legen. Doch das können sie nicht. Sie halten an ihren gewohnten Grundmustern fest bis zum bitterbösen Ende.
Man erinnert sich: Es waren die Jahre des »kalten Krieges«; 1961 war die Berliner Mauer gebaut worden; Adenauers »Politik der Stärke« war endgültig gescheitert; 1962 hatte die Kubakrise die Welt an den Rand einer globalen Katastrophe gebracht – nicht weil den beiden Großmächten an dem winzigen Kuba viel lag, sondern weil es ihnen ums Prinzip ging; der absurdeste und infamste Krieg tobte in Vietnam; in der Bundesrepublik protestierten die Studenten, vereinigten sich 1966 in der »außerparlamentarischen Opposition«, um sich schon zwei Jahre später in zahllose Splittergruppen aufzulösen, die sich untereinander ideologisch bis aufs Messer bekämpften; kaum ein halbes Jahr nach der Uraufführung der Spielverderber verzögerten sich die geplanten Verhandlungen über einen Waffenstillstand in Vietnam um Monate, weil die Delegationen sich nicht darüber einigen konnten, ob an einem runden oder einem rechteckigen Tisch verhandelt werden sollte. Allein diese Verzögerung kostete auf beiden Seiten zahllose Menschenleben – und das auf die grauenhafteste Art. Die Höllengroteske der Realität hatte mein »schwarzes Märchen« an Zynismus bei weitem überholt. Dennoch, da in meinem Stück nicht ausdrücklich von Politik die Rede war, wurde die Parallele nicht zur Kenntnis genommen. Man darf nicht vergessen, damals beherrschte die sogenannte »Eskapismusdebatte« die kulturelle Szene. Was nicht wortwörtlich von politischer oder gesellschaftlicher Problematik sprach, galt als irrelevant und wurde von den tonangebenden Berufs-Urteilern kurzerhand als »Fluchtliteratur« abgetan.
Aber es kam auch noch anderes dazu, was dem Start des Stückes nicht gerade förderlich war. Die Inszenierung durch den Oberspielleiter Heinrich Koch war sicherlich nicht eine seiner glücklichsten Leistungen; die Besetzung der Rollen war durch die Bank falsch oder unzulänglich; sogar das Bühnenbild war gegen den Sinn des Stückes. Da es nach allen Seiten hin offen war, konnte der beklemmende Eindruck eines immer enger werdenden Gefängnisses natürlich nicht entstehen. Da es keine Türen gab, konnten diese auch nicht »zuwachsen« oder verschwinden. Anstatt dass der Boden unter den Füßen der Erben zu glühen begann – was diese dazu veranlasst, auf den Verhandlungstisch zu klettern –, fing ausgerechnet die Tischplatte an zu glühen und die Erben sprangen unverständlicherweise auf diesen Grill. So ging es im Grunde von Anfang bis Ende.
Der Intendant der Städtischen Bühnen Frankfurt, Harry Bukwitz, und sein Oberspielleiter Heinrich Koch befanden sich zu jener Zeit in einer schon seit längerem schwelenden Fehde mit der Frankfurter Presse. Sie standen sozusagen auf der Abschussliste. Die zweifellos sehr angreifbare Aufführung meines Stückes bot also willkommenen Anlass, mit ihm zugleich die beiden Herren zu erledigen. Bei solchen öffentlichen Keilereien werden ja bekanntlich keine feinen Unterschiede gemacht, und so bekam ich eben auch meine blutige Nase ab.
Noch erschwerender war allerdings ein anderer Umstand. Ich hatte einige Jahre zuvor meinen ersten Erfolg mit den beiden Jim-Knopf-Büchern gehabt. Dass das Schreiben von Kinderbüchern – und gar noch mit Erfolg – einem von der »seriösen« Kritik nicht vergeben wird, hat ja außer dem großen Rudyard Kipling schon mancher Autor erfahren müssen. Warum das so ist, weiß der Teufel. Aber der ist offenbar der einzige und hat es bisher niemandem erklärt. Jedenfalls gab es kaum eine Besprechung, in der nicht dem Sinne nach zu lesen stand: Kinderbuchautor, bleib gefälligst bei deinem Leisten und versteige dich nie wieder dazu, fürs »richtige« Theater zu schreiben!
Aber nun ist es zweifellos Zeit, auch von den Fehlern meines Stückes zu sprechen, und deren gibt es nicht wenige. Am gravierendsten ist wohl folgender: In jenen Jahren war man, vor allem am Theater, ungeheuer revolutionär und »antiautoritär«. Da gab es ein Schlagwort, das an allen Bühnen hitzig diskutiert wurde und das hieß: »Ensembletheater«. Das bedeutete, dass alles, aber auch alles konsequent demokratisiert werden sollte. Man wollte nicht nur den Theaterdirektor, sondern auch den Regisseur abschaffen. Alle Entscheidungen – nicht nur die wirtschaftlichen, sondern auch die künstlerischen – sollten aufgrund von freien Diskussionen innerhalb des Kollektivs gefällt werden, wobei nicht nur jedes Ensemblemitglied, sondern auch jeder Bühnenarbeiter und jede Garderobenfrau das gleiche Mitspracherecht haben sollte. Vor allem aber sollte mit dem Unterschied zwischen Hauptdarstellern und Chargenspielern endgültig Schluss gemacht werden. Jeder sollte alles spielen.
Ich muss zugeben, dass ich für solche Ideen damals durchaus empfänglich war. Ich glaubte sogar, dass sich daraus auf längere Sicht eine neue Theaterästhetik entwickeln würde. Ich begann mir den Kopf darüber zu zerbrechen, wie man diese neue Haltung bis in die Form eines Stückes, seine dramaturgische Struktur hinein verwirklichen könne. Keine Hauptfigur mehr, der die anderen nur zuspielen, sondern lauter gleichwertige Rollen, sowohl was den Szenenumfang als auch was die Wichtigkeit für den Handlungsfortgang betrifft. Ähnliche Entwicklungen gab es ja in der zeitgenössischen Musik und im modernen Tanztheater schon längst. Das Thema der Spielverderber bot dazu ideale Möglichkeiten. Da alle Figuren im gleichen Konflikt stehen, haben auch alle die gleiche Bedeutung für dessen Lösung oder Nicht-Lösung.
Allerdings musste ich bald einsehen, dass die ganze Diskussion um das »Ensembletheater« – wie so vieles andere – rein rhetorisch gewesen war. Da mein Stück keine Hauptrolle enthielt, fand sich auch kein Hauptdarsteller dafür. Auch bei der Frankfurter Uraufführung waren alle Protagonisten des Theaters zufällig anderweitig ausgebucht. Kein Berufstheater in Deutschland hat das Stück seither nachgespielt. Dagegen ist es fast so etwas wie ein Standardstück für Studentenbühnen und Schülertheater geworden – vielleicht gerade wegen der Gleichwertigkeit aller zwölf Rollen. Und sicherlich wegen seines Parabelcharakters.
Natürlich würde ich das Stück heute so nicht mehr schreiben. Damals stand ich, wie fast alle, die sich mit den Fragen eines neuen Theaters herumschlugen, stark unter dem Einfluss der dramaturgischen Theorien Bertold Brechts. Sein »episches Theater« will ja den Zuschauer mittels der sogenannten »Verfremdungseffekte« daran hindern, sich mit einer Figur auf der Bühne gefühlsmäßig zu identifizieren, will eine kritische Distanz des Zuschauers in Bezug auf die gezeigten Vorgänge erreichen, indem es »das Übliche und Gewohnte als Merkwürdiges und Unbekanntes« darstellt, um so beim Publikum Nachdenken darüber zu provozieren, oh die gezeigten Vorgänge und Verhältnisse tatsächlich ewige und unveränderbare, oder nicht vielmehr kritisierbare und veränderbare sind. Brechts Theater ist dialektisch und hat das Ziel, der gesellschaftlichen Aufklärung und Belehrung zu dienen. Es macht »Abbildungen der Wirklichkeit zum Zwecke der Veränderung der Wirklichkeit«. Das heißt, das Theater soll keine Pseudo-Wirklichkeit herzustellen versuchen (wie etwa das von Stanislawski), sondern seinen Demonstrationscharakter deutlich ausweisen. Daraus ergeben sich seine stilisierenden Elemente.
Damals schien mir dieses Konzept die einzige Möglichkeit, modernes Theater zu machen, oder besser gesagt, dem Theater in der modernen Gesellschaft eine sinnvolle Funktion zu geben. Allerdings bemühte ich mich, nicht an Brechts Tonfall anzuknüpfen – wie es damals viele taten –, sondern eben nur an seine Dramaturgie. Der Marxismus schien mir in den wesentlichen Punkten längst überholt, an den Klassenkampf, aus dem Brecht sein raubeiniges Pathos bezog, glaubte ich damals schon nicht mehr, weil es inzwischen in den hochindustrialisierten Ländern längst keine proletarische Klasse mehr gab, die politischen und gesellschaftlichen Probleme hatten durch Atomphysik und technologisch-industrielle Weiterentwicklung Dimensionen erreicht, die jede Klassenfrage weit überstiegen.
Im Sinne der »Verfremdung« dieser neuen Situation schien mir gerade die phantastische Metapher ein geeignetes künstlerisches Mittel, um die höchstreale Frage nach Sein oder Nichtsein, vor die die Menschheit sich gestellt sieht, deutlich zu machen. Ich war zum Beispiel davon überzeugt, dass ein »magischer Vorgang« wie die »große Multiplikation«, mittels welcher im Stück die Schlüssel und die Zettel ihre eigene Bedeutung, ihren Wert durch Überangebot selbst vernichten, von jedermann als ein Kürzel, eine poetische Formel für die zum ständigen Wachstum verdammte industrielle Massenproduktion von Gütern verstanden werden würde. Darin habe ich mich geirrt. Was wurde nicht alles in die Sache hineininterpretiert!
In späteren Jahren habe ich mich dann mehr und mehr von den Theorien Brechts entfernt – vor allem, als ich mir klar darüber wurde, dass er selbst sich im Grunde herzlich wenig an sie gehalten hat (glücklicherweise, wie man hinzufügen muss). Heute glaube ich, dass das Theater – wie übrigens alle Künste – ganz und gar nicht die Aufgabe hat, aufzuklären oder zu belehren, ja dass es zu diesen Zwecken geradezu das aller ungeeignetste Mittel ist. Das Theater ist weder Schule, noch Kirche, und es verliert seine Lebenssubstanz, wenn es versucht, eines von beidem zu sein. Theater ist Freiraum der Imagination, und wer meint, dass das wenig oder zu wenig sei, der sollte sich besser anderen Möglichkeiten öffentlicher Äußerung zuwenden. Theater ist für die Gesellschaft, was der Traum für das einzelne Individuum ist: jener unerlässliche Spiel-Raum des schönen oder auch schrecklichen Wahnsinns, der notwendig ist, um die wache Vernunft gesund zu erhalten. Wir wissen es inzwischen: Wer längere Zeit am Träumen gehindert wird, verliert buchstäblich den Verstand. Könnte es nicht sein, dass unsere Gesellschaft eben an dieser Krankheit leidet?
Heute bin ich überzeugt, dass der Zuschauer ein durchaus legitimes Anrecht darauf hat, sich mit der Hauptfigur auf der Bühne gefühlsmäßig zu identifizieren und in ihrer stellvertretenen Gestalt den schönen oder schrecklichen Traum zu träumen.
Als ich die Spielverderber schrieb, wollte ich durch einen komödienhaften Tonfall das Publikum sozusagen in eine Falle locken. Es sollte lachen, aber das Lachen sollte ihm nach und nach im Halse stecken bleiben, bis es schließlich im Untergangsgebrüll der Narren im Feuer ein Menetekel für seine eigene mögliche Zukunft erkennen würde. Heute befürchte ich, gerade damit dem guten Willen des Publikums zu viel zugemutet zu haben. Niemand lässt sich gern an der Nase herumführen, am wenigsten derjenige, der Eintrittsgeld bezahlt hat. Ich glaube, zu Recht. Es gibt so etwas wie ein stillschweigendes Übereinkommen zwischen Bühne und Publikum, eine Form der Höflichkeit: Der Zuschauer erwartet, von Anfang an durch Tonfall und Gebärde auf das eingestimmt zu werden, was ihn erwartet – ob er lachen oder weinen soll, ohne sich nachträglich dafür schämen zu müssen. Gerade weil es in der Lebenswirklichkeit meist anders zugeht, sollte das Theater diesen Wunsch respektieren. Ich habe es damals aus Zorn und Eigensinn nicht getan.
Inzwischen ist fast ein Vierteljahrhundert vergangen. Nun soll dieses Stück noch einmal – diesmal in Buchform – einem breiten Publikum vorgestellt werden. Natürlich taucht die Frage auf, ob es nicht angebracht wäre, es ganz und gar zu überarbeiten, all seine Unverdaulichkeiten und Übertreibungen zu glätten oder zu eliminieren, um es so, in gefälligerer Form, vielleicht doch noch einmal auf die Bühne zu bringen. Aber dann wäre es ein völlig anderes Stück geworden. Darum meine ich, es ist besser, es zu lassen, wie es ist, mit all seinen Fehlern. Dass ich heute das meiste anders machen würde, soll nicht heißen, dass ich in seiner ursprünglichen Form nicht mehr zu ihm stehe. Ich halte es nach wie vor für sehr gut spielbar und mir scheint, dass seine Aktualität – seit die ökologische Katastrophe sich immer deutlicher abzeichnet – eher noch zugenommen hat. Möglicherweise wird inzwischen auch manches besser verstanden werden – auf beiden Seiten der Rampe. Im Grunde kann über die Brauchbarkeit dieses Stückes erst wirklich geurteilt werden, wenn es wenigstens einmal zu einer adäquaten Realisation auf der Bühne gekommen ist – und die steht bis heute noch aus.
Michael Ende im September 1988
Synopsis der Handlung
Von einem geheimnisvollen Erblasser sind zehn Personen äußerst unterschiedlicher Herkunft als Erben eingesetzt worden. Sie kennen jedoch weder den Verstorbenen noch sich untereinander. Auch weiß niemand, worin die Hinterlassenschaft eigentlich besteht. Zur Eröffnung des Testaments versammeln sich die zehn in einem höchst merkwürdigen Schloss, dem ehemaligen Wohnsitz des Verstorbenen, das in abgelegener Gegend steht.
Nachdem alle vollzählig sind, händigt der Notar jedem von ihnen ein verschlossenes Kuvert aus, in welchem sich ein Stück des in zehn Teile zerrissenen Testaments befindet. Um zu erfahren, welcher Anteil des Nachlasses jedem Einzelnen zufällt, sollen die Erben diese zehn unregelmäßig geformten Papierfetzchen zusammensetzen wie ein Puzzle. Ihnen wird ausdrücklich mitgeteilt, dass der Sinn des Gesamttextes unverständlich bleiben wird, wenn auch nur einer von ihnen sich weigert, das Spiel mitzuspielen, denn auf jedem der Zettel steht eine wichtige Einzelheit, die aus dem übrigen Wortlaut unmöglich zu erraten ist. Jeder der Erben kann also das Gelingen des Ganzen beliebig verzögern oder auch verhindern, andererseits kann aber jeder von ihnen an das ihm zugedachte Erbteil nur heran, wenn er zugleich allen anderen zu dem ihren verhilft.
Doch die Beteiligten hegen von Anfang an Misstrauen gegeneinander und gegen die ganze sonderbare Veranstaltung. Schon dass einer sich zunächst einmal Bedenkzeit ausbittet, genügt, um den allgemeinen Argwohn zu schüren. Da jeder auf die anderen angewiesen ist, vermutet jeder bei den anderen unfaires Spiel. Pläne werden geschmiedet, um sich gegen mögliche Benachteiligung zu schützen. Überlegungen werden angestellt, wie man die ehrliche Teilnahme aller am Spiel erzwingen könnte. Doch die verschiedenen Projekte durchkreuzen sich gegenseitig, so dass binnen kurzem die Sache völlig verfahren, jedes gegenseitige Vertrauen unmöglich geworden ist. Das Spiel kommt nicht zustande, offene Feindseligkeit bricht aus.
Nun tritt ein, was der alte wunderliche Diener des Hauses, der als Einziger den Verstorbenen kannte, von Anfang an warnend vorausgesagt hat: Das magische Schloss beginnt auf alles, was die Erben gegeneinander planen und tun, zu reagieren. Es verändert sich – zunächst unmerklich, dann immer drastischer. Das Haus erkrankt und bekommt Fieber. Die Temperatur in seinem Innern steigt. Als einer der Erben heimlich alle Ausgänge, die ins Freie führen, versperrt, um so zu verhindern, dass ein anderer sich vorzeitig davonmachen kann, ehe das Testament zusammengesetzt ist, fehlen am nächsten Tag diese Türen. Sie sind verschwunden. Alles im Palast verliert seine Farben, die Vögel, die anfangs in Schwärmen durch die Säle zogen, fallen tot zu Boden, die Karyatiden magern zusehends ab, Moder und Verfall breiten sich aus. Die Temperatur steigt weiter.
Diese warnenden Signale werden von den Erben nur insofern zur Kenntnis genommen, als sie sich davon eine repressive Wirkung auf die jeweils anderen versprechen. Je bedrohlicher die Verhältnisse werden, desto eher – so hofft jeder – wird die Gegenpartei die Nerven verlieren und nachgehen.
Als schließlich einer von ihnen versucht, die Lösung des Konfliktes mit Gewalt zu erzwingen, indem er die ganze Gesellschaft mit der Waffe bedroht, um sie zur Vernunft zu bringen, kommt es unversehens zu einem blutigen Unfall, bei dem ausgerechnet der Harmloseste von allen schwer verwundet wird. Um ihn vielleicht doch noch zu retten, müsste man einen Arzt rufen oder ihn in ärztliche Obhut bringen, doch dazu müssten die Türen nach draußen wieder erscheinen und geöffnet werden. Alle Beteiligten wissen, dass dies nicht geschehen kann, solange sie ihr Verhalten nicht ändern, doch eben das fordert jeder nur von den anderen.
Der Notar, von zunehmenden Skrupeln geplagt, verletzt seine Schweigepflicht, indem er dem Sterbenden heimlich den Inhalt des Testaments verrät, den er als Einziger kennt, weil er zur Kontrolle eine Abschrift des gesamten Textes besitzt. Danach besteht das eigentliche Erbe in nichts anderem als dein Vertrauen, das die Erben einander schenken mussten, um die Teile zusammenzusetzen und so das Testament lesbar zu machen. Für den Notar ist das ganze nichts als der üble Scherz eines Misanthropen. Der Sterbende dagegen begreift die Bedeutung dieses Vermächtnisses und teilt sein Wissen den anderen mit. Natürlich glaubt ihm keiner, zumal der Notar, in seiner Angst, die Erben könnten sich aus Wut und Enttäuschung an ihm vergreifen, alles abschwört. In diesem Augenblick entwerten sich die Anteile des Testamentes selbst, indem sie sich wie Krankheitserreger ins Uferlose vermehren und als ein Schneesturm aus Papierfetzen durch alle Räume des Palastes wirbeln.
Noch immer fühlt keiner der Erben sich schuldig, jeder beruft sich auf die »Sachzwänge«, jedem scheint die eigene Handlungsweise vernünftig oder angesichts der sich zuspitzenden Notlage entschuldbar – so summieren sich Egoismus, Engstirnigkeit und Fanatismus, bis schließlich die große Katastrophe eintritt. Das Innere des magischen Schlosses verwandelt sich in eine gespenstische Höllenszenerie. Der Kampf aller gegen alle bricht aus. Zuletzt sitzt die ganze Gesellschaft in einem Raum zusammengepfercht, dessen Türen ebenfalls verschwinden. Feuer ist ausgebrochen, vielleicht durch die immer noch zunehmende Hitze, vielleicht durch Brandstiftung – jeder von ihnen kann es gelegt haben. Doch keiner denkt ans Löschen. In der verzweifelten Hoffnung, sich dadurch doch noch zu retten, dass sie den eigentlichen Schuldigen unter sich herausfinden und hinrichten, improvisieren die Erben in panischer Hast eine Gerichtsverhandlung, in der jeder Ankläger und jeder Angeklagter ist. Der gemeinsame Schuldspruch trifft zuletzt den Erblasser, der sie alle in diese infernalische Situation gebracht hat, aber an ihm ist das Urteil eben nicht zu vollstrecken.
Da ihnen buchstäblich der Boden unter den Füßen zu glühen beginnt, klettern die Erben schließlich auf denselben Konferenztisch, auf welchem sie zu Anfang des Stückes ihre Anteile hätten zusammenlegen sollen, klammern sich aneinander und brüllen sich gegenseitig die sinnlosen Wortfetzen ins Gesicht, die sie ursprünglich einmal auf ihren Zetteln gelesen haben, um so vielleicht doch noch die Aufgabe zu lösen, die ihnen gestellt war, aber auch die Sprache zerfällt ihnen nun im Munde zu einem absurden Gelall und Gebrabbel. Das Feuer bricht in den Saal ein und verschlingt sie.
Ich lebe und ich sterbemit dir, o Menschenkind.Drum ist der Narren Erbeein Rauch im kalten Wind.
Ich blühe und verderbe,wie du verdirbst und blühst.Drum ist der Narren Erbeein Abgrund leer und wüst.
Dass jeder nur erwerbe,was aus ihm selbst entsprang,drum ist der Narren Erbeder Narren Untergang.
Du selbst wirst dir bescheret.Sei klug, o Menschenkind!Der Narren Erbe fähretdahin wie Rauch im Wind.
Inschrift über dem Portal des Palastesvon Johannes Philadelphia
Das Bühnenbild
Ein großer Festsaal im magischen Schloss des Johannes Philadelphia, das irgendwo fernab von menschlichen Behausungen steht. Ein Labyrinth von Nischen, Balkonen, Galerien, Wendel- und Freitreppen, nach vielen Seiten Türen und Durchblicke auf Gänge und immer fernere Räume wie auf den architektonischen Phantasien von Piranesi oder Desiderio Monsú. Durch hohe Fenster aus buntem Glas flutet Sonnenlicht herein und taucht den Saal in farbigen Glanz. Schwärme von Paradiesvögeln fliegen umher und erfüllen den Palast mal fern, mal nah mit melodischen Rufen. An Säulen und Wänden Karyatiden aller Art, Heroen und Götter, Tiere und Fabelwesen. Bildnisse und Gobelins, darunter der Einhorngobelin aus Cluny »a mon seul désir«. Der Raum ist angefüllt mit Kostbarkeiten, Wundern und Gerümpel wie ein Museum: Vitrinen, Statuen, Musikinstrumente, alchemistische Apparate, Planetarien, aber auch Wurlitzer, Autoteile, Computer, Gen-Modelle, Stereoanlagen und so weiter. Auf der linken Seite der Bühne schräg in den Hintergrund ein langer, mit grünem Filz bezogener Konferenztisch, umgeben von Sitzmöbeln, welche den Figuren der Handlung entsprechen, also ein Küchenstuhl, ein lederner Direktorensessel, ein Zellenhocker, ein Bauernstuhl und ähnliches. Auf der rechten Seite ein Podest, auf dem ein vergoldeter Thron steht, darüber ein Baldachin aus rotem Samt.
Während des ersten Aktes herrscht schwüle Sommerhitze. Die Beleuchtung verändert sich nach und nach, verdüstert sich, wird fahl. Draußen zieht ein Gewitter auf. Die ersten Blitze zucken.
Während des zweiten Aktes, der in der Nacht spielt, nimmt die Hitze weiter zu. Das Schloss bekommt Fieber und beginnt, schlecht zu träumen. Säulen neigen sich, Proportionen verschieben sich langsam aber sichtbar, in den Wänden entstehen Risse, sonderbare Geräusche werden hörbar.
Im dritten Akt nimmt die Hitze weiter zu. Alle Farben sind aus dem Schloss verschwunden. Der grüne Konferenztisch ist grau, der rote Baldachin ebenso. Die bunten Vögel sind schwarz geworden. Auch die handelnden Personen tragen nun graue Kostüme, wie auf einer Schwarzweißfotografie. Alles ist staubig und zunderdürr.
Im vierten Akt sind die Fenster und ein großer Teil der Durchblicke »zugewachsen«, d. h. verschwunden oder nur noch als architektonische Attrappe, sogenannte »blinde Fenster« vorhanden. Die Karyatiden sind zu Hungergestalten abgemagert und haben Gebärden des Flehens oder des Zorns angenommen. Auch die Bilder und Figuren zeigen erschrockene, schmerzverzerrte oder wütende Gesichter. Die Vögel sind tot und liegen in Haufen auf dem Boden herum. Die Gobelins und der Baldachin hängen zerschlissen herunter. Den Personen zerfallen die Kleider am Leib, wenn sie sich bewegen. Die Hitze ist inzwischen unerträglich.
Im fünften Akt sind nun auch die letzten der bisherigen Lichtquellen erloschen. Der Palast phosphoresziert leichenhaft. Manche Gegenstände glühen ab und zu auf. Entladungen rätselhafter Energien zucken über die Wände und sprühen Funken. Die Luft ist wie von glimmenden Nebelschwaden erfüllt. Brütende Hitze und Stickigkeit. Das Interieur hat sich in eine groteske Höllenszenerie verwandelt. Die Säulen stehen schief und krumm, die Treppen führen nirgendwo mehr hin oder sind zerbrochen, die Karyatiden und Statuen haben sich in Mumien und Gerippe wie aus der Kapuzinergruft in Palermo verwandelt oder in grausiges chirurgisches Anschauungsmaterial. Die Bildnisse zeigen wüste Fratzen und Missbildungen aller Art. Alle Stoffe sind zu Fetzen zerfallen. Die Personen gehen um wie Gespenster, ihre Gesichter sind kalkweiß, ihre Kleider Spinnweben. Die letzten Türen schließen sich und verschwinden. Das Feuer bricht aus.
Die Personen der Handlung
in der Reihenfolge ihres Auftretens:
Ninive Geryonein vierzehnjähriges Mädchen, sehr hübsch, sehr verwöhnt, sehr frühreif, das seine Eltern und deren Welt hasst und sich deshalb in den Dschungel seiner Phantasien geflüchtet und darin verirrt hat.
Egon S. Geryon