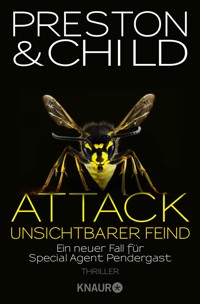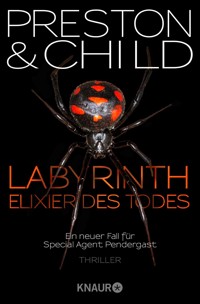9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Deutsche Verlags-Anstalt
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Eine wahre Indiana-Jones-Geschichte - eine archäologische Sensation
Schon seit dem 16. Jahrhundert gab es Gerüchte über eine Provinz im Regenwald von Honduras, deren Städte reich und prachtvoll seien, ganz besonders die Weiße Stadt, auch Stadt des Affengottes genannt. Immer wieder machten sich Abenteurer und Archäologen auf die Suche nach den Zeugnissen dieser Zivilisation, die offenbar nicht zu den Mayas gehörte. Manchmal stießen sie tatsächlich auf Ruinen, aber eine wirkliche Erforschung war in dem von giftigen Schlangen und tödlichen Krankheitserregern verseuchten und vom Dschungel überwucherten Gelände unmöglich. Erst die moderne Lasertechnik, mit deren Hilfe das Gelände aus der Luft gescannt wird, ermöglichte genauere Hinweise, wo sich größere Ansiedlungen befinden. Um sie vor Ort zu untersuchen muss man sich allerdings auch heute noch auf den beschwerlichen Weg durch den Dschungel machen. Der Schriftsteller und Journalist Douglas Preston schloss sich kürzlich einer archäologischen Expedition an. Sie fand tatsächlich die eindrucksvollen Ruinen einer untergegangenen Stadt, aber sie zahlte am Ende auch einen hohen Preis.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 537
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Über das Buch:
Schon seit dem 16. Jahrhundert gibt es Gerüchte über eine Provinz im Regenwald von Honduras, deren Städte reich und prachtvoll seien, ganz besonders die Weiße Stadt, auch Stadt des Affengottes genannt. Der Legende nach ruht ein Fluch auf ihr. Immer wieder machten sich Abenteurer und Archäologen auf die Suche nach den Zeugnissen dieser Zivilisation, die offenbar nicht zu den Mayas gehörte – und scheiterten ein ums andere Mal.
Erst die moderne Lasertechnik, mit deren Hilfe das Gelände aus der Luft gescannt wird, förderte die gänzlich überwucherten Reste einer bis dahin unbekannten archäologischen Stätte zutage. Um sie vor Ort zu untersuchen, muss man sich allerdings auch heute noch auf den beschwerlichen Weg durch den Dschungel machen. Der Bestsellerautor Douglas Preston hat sich zusammen mit einer archäologischen Expedition auf die Spuren der sagenumwobenen Stadt begeben. Er kämpfte gegen Regen, Insekten, giftige Schlangen und die dichte Vegetation – und fand tatsächlich eindrucksvolle Relikte einer untergegangenen Zivilisation. Aber auch er zahlte am Ende einen hohen Preis.
Über den Autor:
Douglas Preston wurde 1956 in Cambridge, Massachusetts, geboren. Er studierte in Kalifornien zunächst Mathematik, Biologie, Chemie, Physik, Geologie, Anthropologie und Astronomie und später Englische Literatur. Preston arbeitete mehrere Jahre am American Museum of Natural History in New York und an der Princeton University, bevor er sich dem Schreiben widmete. Zusammen mit Lincoln Child verfasste er zahlreiche Thriller, die weltweit Bestseller sind. Daneben hat er Sachbücher zur amerikanischen Geschichte verfasst und veröffentlicht außerdem regelmäßig in Magazinen wie Harper’s, The Atlantic und National Geographic.
Douglas Preston
Die Stadt des Affengottes
Eine unbekannte Zivilisation, ein mysteriöser Fluch, eine wahre Geschichte
Aus dem Englischen von Jürgen Neubauer
Deutsche Verlags-Anstalt
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel The Lost City of the Monkey God bei Head of Zeus, London.1. AuflageCopyright © Splendide Mendax, Inc. 2017Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2017Deutsche Verlags-Anstalt, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 MünchenAlle Rechte vorbehaltenUmschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, MünchenUmschlagabbildung: © Mike Lanzetta/Getty ImagesTypografie und Satz: DVA/Andrea MogwitzGesetzt aus der GaramondISBN 978-3-641-20392-4V003www.dva.de
Für meine Mutter Dorothy McCann Preston, die mich zum Forscher gemacht hat
Inhalt
1 Das Tor zur Hölle
2 Irgendwo in Amerika
3 Der Teufel hat ihn geholt
4 Grausamer Urwald
5 Eines der letzten Geheimnisse des Kontinents
6 Das Herz der Finsternis
7 Der Fisch, der den Wal verschluckt
8 Laser im Dschungel
9 Glücksspiel
10 Der gefährlichste Ort der Erde
11 Unbekanntes Gelände
12 Eine große Stadt
13 Die Lanzenotter
14 Blumen pflücken verboten!
15 Von Menschenhand geschaffen
16 Ich versinke!
17 Ein verzauberter Ort
18 Im Morast
19 Streit
20 Die Höhle der leuchtenden Schädel
21 Das Symbol des Todes
22 Und die Blumen verwelkten
23 Weiße Lepra
24 Im Nationalen Gesundheitsinstitut
25 Eine isolierte Art
26 La Ciudad del Jaguar
27 Wir sind Waisen
Dank
Quellen
Bildteil
Ganz im Osten von Honduras, in einem Landstrich namens La Mosquitia, befinden sich einige der letzten weißen Flecken unserer Landkarte. Die Mosquitia ist eine etwa 80000 Quadratkilometer große Bergregion, die von Regenwäldern, Sümpfen, Seen und Flüssen durchzogen ist. Die ersten spanischen Entdecker markierten sie auf ihren Karten mit Portal del Infierno, »Tor zur Hölle«. Die Mosquitia ist eine der unzugänglichsten Gegenden der Welt, jahrhundertelang scheiterte jeder Versuch, in sie vorzudringen. Bis heute, zu Beginn des 21. Jahrhunderts, wurden Tausende Quadratkilometer nicht erforscht.
Im Herzen der Mosquitia überwuchert der dichteste Urwald der Welt eine wilde Berglandschaft. Einige der Gebirgszüge ragen über anderthalb Kilometer hoch auf und sind von tiefen Schluchten, hohen Wasserfällen und reißenden Bächen durchsetzt. Pro Jahr gehen hier mehr als drei Meter Regen nieder, weshalb die Gegend regelmäßig von Überschwemmungen und Erdrutschen heimgesucht wird. Die Schlammlöcher können einen Menschen bei lebendigem Leib verschlingen. Im Unterholz lauern tödliche Giftschlangen und Jaguare, Dornen bohren sich in Kleider und Fleisch. Selbst erfahrene und mit Macheten und Sägen ausgerüstete Forscher müssen damit rechnen, an einem brutalen Zehn-Stunden-Tag bestenfalls vier oder fünf Kilometer voranzukommen.
Aber nicht nur natürliche Gefahren erschweren die Erkundung der Mosquitia. Honduras hat neben El Salvador die mit Abstand höchste Mordrate der Welt. Vier Fünftel des Kokains, das von Südamerika in die Vereinigten Staaten kommt, wird durch Honduras geschleust. Weite Teile des Landes werden von Drogenkartellen beherrscht. Regierungsbeamte der Vereinigten Staaten dürfen derzeit nicht in die Mosquitia und den Bezirk Gracias a Dios reisen, »aufgrund ernstzunehmender Drohungen gegen US-amerikanische Staatsbürger«, wie das Außenministerium mitteilt.
Aufgrund der Abgeschiedenheit der Mosquitia hält sich seit vielen Jahrhunderten eine faszinierende Legende. Tief in der undurchdringlichen Wildnis liege eine geheimnisvolle Stadt aus weißem Stein, heißt es. Es sei die Ciudad Blanca, die Weiße Stadt, die auch die »Stadt des Affengottes« genannt wird. Manche behaupten, dass die Stadt von den Maya erbaut wurde, andere glauben, dass sie schon vor Jahrtausenden von einem unbekannten und längst untergegangenen Volk gegründet wurde.
Am 15. Februar 2015 saß ich in einem Konferenzraum des Hotels Papa Beto in der honduranischen Kleinstadt Catacamas und nahm an einer Einsatzbesprechung teil. Schon in wenigen Tagen sollte unser Team per Hubschrauber in ein unerforschtes Tal tief in den Bergen der Mosquitia geflogen werden, das nur als »Target One« oder T1 bezeichnet wurde. Der Hubschrauber sollte uns am Ufer eines namenlosen Bergbachs absetzen, damit wir dort, mitten im Regenwald, allein auf uns gestellt ein primitives Camp errichteten. Das sollte unser Basislager sein, von dem aus wir etwas erkunden würden, das wir für die Ruinen einer bislang unbekannten Stadt hielten. Wir würden die ersten Wissenschaftler sein, die diesen Teil der Mosquitia betraten. Keiner von uns hatte eine Vorstellung davon, was uns dort erwartete, im tiefen Urwald und in einer Wildnis, die seit Generationen kein menschlicher Fuß mehr betreten hatte.
Es war Abend in Catamacas. Am Kopfende unseres großen Tisches stand der Einsatzleiter der Expedition, ein pensionierter Soldat namens Andrew Wood, den alle nur Woody nannten. Als früherer Angehöriger der Coldstream-Garde und Oberstabsfeldwebel der britischen Spezialeinheit SAS war Woody ein Experte für Urwaldeinsätze. Zur Einleitung erklärte er uns, seine Aufgabe sei ganz einfach: Er solle uns lebend wieder nach Hause bringen. Er hatte uns zu dieser Einsatzbesprechung eingeladen, um uns ins Bewusstsein zu rufen, mit welchen Gefahren wir bei der Erforschung des Tals konfrontiert werden konnten. Er ließ keine Zweifel daran aufkommen, dass sein Team von ehemaligen SAS-Elitesoldaten das Sagen hatte, solange wir in der Wildnis waren: Die Expedition war eine quasi-militärische Operation, und wir – die eigentlichen Expeditionsleiter eingeschlossen – hatten seinen Anweisungen ohne Widerworte Folge zu leisten.
Es war das erste Mal, dass alle Expeditionsteilnehmer – Wissenschaftler, Fotografen, Filmleute, Archäologen und ein Schriftsteller, nämlich meine Wenigkeit – an einem Ort zusammenkamen. Wir waren eine bunt zusammengewürfelte Truppe und bislang in sehr unterschiedlichem Maße in Kontakt mit der Wildnis gekommen.
Woody erklärte uns in seiner abgehackten Sprechweise die Sicherheitsvorkehrungen. Noch ehe wir überhaupt einen Fuß in den Urwald setzten, mussten wir schon auf der Hut sein. Catacamas ist eine gefährliche Stadt und wird von einer brutalen Drogenbande beherrscht – keiner von uns durfte ohne bewaffneten Begleitschutz das Hotel verlassen. Wir durften niemandem verraten, wozu wir nach Honduras gekommen waren, nicht in Hörweite von Hotelangestellten über das Projekt sprechen, keine mit der Expedition zusammenhängenden Unterlagen herumliegen lassen und nicht telefonieren, wenn fremde Ohren mithören konnten. Im Gepäckraum des Hotels gab es einen großen Safe, in dem wir unsere Papiere, Geldbeutel, Landkarten, Computer und Pässe lassen konnten.
Dann ging Woody zu den Gefahren des Urwalds über. Ganz oben auf der Liste standen die Giftschlagen, allen voran die Lanzenotter, die in Mittelamerika als barba amarilla (»Gelbbart«) bezeichnet wird. Dieses Reptil, das zur Familie der Grubenottern zählt, ist in der Neuen Welt für mehr Todesfälle verantwortlich als jede andere Schlangenart. Sie kommt nachts aus ihrem Versteck und wird von Menschen und Aktivität angelockt. Sie ist aggressiv, reizbar und unglaublich schnell. Mit ihren Giftzähnen durchschlägt sie den dicksten Lederstiefel und speit ihr Gift mehr als zwei Meter weit. Gelegentlich beißt sie zu, verfolgt ihr Opfer und beißt ein weiteres Mal zu. Oft zuckt ihr Kopf nach oben und schlägt über dem Knie ins Bein. Ihr Gift wirkt tödlich. Wer nicht sofort an Hirnblutungen stirbt, erliegt später einer Blutvergiftung. Wer wider Erwarten doch überlebt, dem muss oft das Bein amputiert werden, weil das Gift eine Nekrose bewirkt. Bis ein Bissopfer geborgen werden kann, können einige Tage vergehen, denn die Mosquitia ist so schwer zugänglich, dass selbst Hubschrauber nur tagsüber und bei gutem Wetter einfliegen können. Daher legte uns Woody dringend ans Herz, immer unsere Schlangengamaschen zu tragen, auch und vor allem, wenn wir nachts zum Wasserlassen aufstanden. Wenn ein umgefallener Baum den Weg versperrte, sollten wir immer erst auf den Stamm steigen und dann erst den Fuß auf die andere Seite setzen; niemals sollten wir auf eine Stelle treten, die wir nicht einsehen konnten. Auf diese Weise wurde nämlich Steve Rankin, der Produzent des Dokumentarfilmers und Abenteurers Bear Grylls, von einer Lanzenotter gebissen, als er in Costa Rica einen Drehort inspizierte. Rankin trug zwar seine Kevlar-Gamaschen, doch die Schlange, die auf der anderen Seite eines umgestürzten Baumstamms versteckt lag, biss ihn unterhalb des Schutzes in den Stiefel. Die Zähne fuhren durch das Leder, als sei es aus Butter. »Und dann ist das hier passiert«, sagte Woody und reichte sein Handy herum. Es zeigte ein entsetzliches Foto von Rankins Fuß während der Operation. Obwohl er sofort ein Gegengift erhalten hatte, nekrotisierte der Fuß, und die abgestorbenen Muskeln mussten bis auf die Knochen und Sehnen hinunter entfernt werden. Rankins Fuß konnte zwar gerettet werden, aber um den Muskel zu ersetzen, musste ein Stück aus dem Oberschenkel transplantiert werden.1 Unser Tal sehe so aus, als könnte es der ideale Lebensraum für die Lanzenotter sein, meinte Woody.
Verstohlen blickte ich in die Runde. Die heitere Stimmung des Nachmittags, als wir mit einem Bier in der Hand am Swimmingpool des Hotels gesessen hatten, war verflogen.
Als Nächstes kam Woody auf die sechsbeinigen Krankheitsträger zu sprechen, denen wir begegnen würden, zum Beispiel Moskitos2, Sandmücken, Milben, Zecken, Kusswanzen (die so heißen, weil sie mit Vorliebe ins Gesicht beißen), Skorpione und die Riesenameisen, deren Stich so schmerzhaft sein soll wie eine Schusswunde. Die vielleicht furchterregendste Krankheit der Mosquitia ist die Schleimhautleishmaniose, die manchmal auch als weiße Lepra bezeichnet und von infizierten Sandmücken übertragen wird. Der Erreger, ein Parasit, wandert in Mund- und Nasenschleimhäute, frisst diese auf und hinterlässt da, wo einst das Gesicht war, eine riesige, nässende Wunde. Woody schärfte uns ein, uns regelmäßig von Kopf bis Fuß mit DEET einzusprühen, unsere Kleidung ebenfalls damit zu behandeln und uns nach Einbruch der Dunkelheit sorgfältig zu bedecken.
Dann berichtete er von Skorpionen und Spinnen, die nachts in unsere Stiefel krochen, weshalb wir diese auf Stöcke stülpen und morgens gründlich ausschütteln sollten. Er warnte uns vor den heimtückischen roten Ameisen, die durchs Unterholz schwärmten und bei der leisesten Erschütterung eines Zweigs von oben auf uns herunterregneten, sich in die Haare setzten, den Nacken hinunterliefen, blindwütig zubissen und ein Gift verspritzten, das einen sofortigen Transport ins Krankenhaus erforderlich machte. Schaut genau hin, ehe ihr einen Zweig, Ast oder Stamm anfasst, mahnte er uns. Schlagt euch nicht blind durch die dichte Vegetation. Dort lauern nicht nur Insekten und Baumschlangen, sondern auch Pflanzen mit spitzen Dornen und Stacheln. Im Urwald sollten wir immer Handschuhe tragen, am besten Taucherhandschuhe, die besser vor Dornen schützen. Eindringlich schilderte er, wie leicht man sich im Urwald verirren konnte. Oft reichte es schon, sich vier oder fünf Meter von der Gruppe zu entfernen. Nie und unter gar keinen Umständen sollte es sich irgendjemand von uns einfallen lassen, sich allein vom Camp oder im Urwald von der Gruppe zu entfernen. Bei jeder Exkursion waren wir angehalten, einen Rucksack mit einer Notfallausrüstung – Proviant, Wasser, Kleidung, DEET, Taschenlampe, Messer, Streichhölzer, Regenkleidung – dabeizuhaben, für den Fall, dass wir uns verirrten und eine Nacht im Schutz eines tropfenden Baumstamms verbringen mussten. Jeder von uns bekam eine Trillerpfeife, und sobald wir glaubten, uns verlaufen zu haben, sollten wir stehen bleiben, pfeifen und warten, bis uns jemand holte.
Ich hörte aufmerksam zu. Ehrlich. Aber ich hatte den Eindruck, dass Woody uns nur Angst einjagen wollte, damit wir uns brav an seine Anweisungen hielten. Ich nahm an, dass er den Greenhorns unter uns lieber ein bisschen zu viel Vorsicht einbläuen wollte. Ich war einer von drei Teilnehmern, die bereits über Target One geflogen waren. Aus der Luft hatte es ausgesehen wie ein sonniges Tropenparadies und nicht wie der gefährliche, düstere, von Ungeziefer und Schlangen verseuchte Dschungel, den Woody an die Wand malte. Uns würde schon nichts passieren.
1 Wenn Sie etwas aushalten, können Sie sich das Foto im Internet ansehen.
2 Der Name Mosquitia hat nichts mit dem Insekt zu tun, sondern geht auf die Küstenbewohner zurück, eine Mischung aus Ureinwohnern, Europäern und Afrikanern. Nachdem sich diese vor einigen Jahrhunderten Musketen (spanisch mosquetes) beschafft hatten, wurden sie als Miskitos oder Mosquitos bezeichnet.
Zum ersten Mal hörte ich von der Legende der Weißen Stadt 1996, als ich im Auftrag der Zeitschrift National Geographic eine Geschichte über die alten Tempel von Kambodscha recherchierte. Die NASA war kurz zuvor mit einer DC-10 über verschiedene Urwaldregionen der Welt geflogen, um zu ermitteln, ob man mit einem neuen, hochentwickelten Radarsystem das dichte Blätterdach durchdringen und Aufnahmen vom Boden machen konnte. Experten, die sonst Satellitenaufnahmen der Erdoberfläche analysierten, hatten die Bilder in den NASA-Labors im kalifornischen Pasadena ausgewertet. Dabei hatten sie im kambodschanischen Urwald die Ruinen eines bislang unbekannten Tempels aus dem 12. Jahrhundert entdeckt. Um mehr darüber zu erfahren, traf ich mich mit dem Teamleiter Ron Blom.
Blom hatte wenig Ähnlichkeit mit dem Klischee eines Wissenschaftlers. Er war braun gebrannt und durchtrainiert, trug Bart sowie Fliegerbrille und Indiana-Jones-Hut. International bekannt geworden war er, weil er die verschollene Stadt Ubar in der Arabischen Wüste entdeckt hatte. Als ich ihn fragte, an welchen Projekten er arbeitete, ratterte er gleich eine ganze Reihe herunter: Er suchte die Routen der Weihrauchhändler durch die Wüste der Arabischen Halbinsel, rekonstruierte den Verlauf der alten Seidenstraße und kartierte Schlachtfelder des Amerikanischen Bürgerkriegs in Virginia. Wenn man Radar- und Infrarotaufnahmen mit verschiedenen Wellenlängen kombinierte und die digitalisierten Bilder am Computer bearbeitete, konnte man heute bis fünfzehn Meter tief unter den Wüstensand blicken, durch das Blätterdach eines Urwalds spähen und sogar unter der Teerdecke von modernen Straßen alte Wege erkennen, erklärte er mir.
Alte Wege waren ganz nett, aber ich interessierte mich vor allem dafür, ob man mit dieser neuen Technik noch weitere untergegangene Städte wie Ubar entdecken könnte. Als ich ihn danach fragte, antwortete er plötzlich ausweichend. »Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir uns auch andere Regionen ansehen.«
Wissenschaftler sind schlechte Lügner. Ich wusste sofort, dass er mir etwas verheimlichen wollte. Als ich nachhakte, gab er schließlich zu, dass es »eine sehr große Fundstätte sein könnte. Aber ich darf nicht darüber sprechen. Ich arbeite für einen privaten Kunden und habe eine Vertraulichkeitserklärung unterschrieben. Wir gehen von einer Legende um eine versunkene Stadt aus. Ich kann Ihnen nur sagen, dass sie irgendwo auf dem amerikanischen Kontinent liegt. Der Legende nach befindet sie sich an einem ganz bestimmten Ort, und wir suchen auf Satellitenaufnahmen danach.«
»Und haben Sie sie gefunden?«
»Das kann ich Ihnen nicht sagen.«
»Für wen arbeiten Sie?«
»Auch das darf ich Ihnen nicht verraten.«
Blom willigte aber ein, seinem geheimnisvollen Auftraggeber von meinem Interesse zu berichten und ihn zu bitten, mich anzurufen. Versprechen konnte er mir allerdings nichts.
Neugierig geworden, rief ich verschiedene Archäologen an, die in Mittelamerika arbeiteten, um herauszufinden, um welche Stadt es sich handeln könnte. Der Maya-Experte David Stuart, der damals am Peabody Museum der Universität Harvard an der Entschlüsselung von Maya-Schriftzeichen arbeitete, sagte mir: »Ich kenne die Gegend ganz gut. Teile davon sind quasi unerforscht. Die Leute vor Ort haben mir immer von Tempeln im Wald erzählt, auf die sie bei der Jagd gestoßen waren – große Ruinen mit Skulpturen. Die meisten Geschichten stimmen. Warum sollten die Leute uns anlügen?« In den Texten der Maya ist immer wieder von Städten und Tempeln zu lesen, die nichts mit bekannten Anlagen zu tun haben. Es ist eine der letzten Regionen der Welt, in der seit Jahrhunderten unberührte Ruinenstädte zu finden sein könnten.
Der inzwischen verstorbene Maya-Forscher Gordon Willey von der Universität Harvard brachte sofort die Legende der Weißen Stadt zur Sprache. »Als ich in den siebziger Jahren in Honduras war, war die Rede von einem Ort namens Ciudad Blanca, die Weiße Stadt, irgendwo im Urwald hinter der Küste. Es war das Gerede der üblichen Schwätzer, und ich habe gedacht, dass es sich wahrscheinlich um ein paar Kalkfelsen handelt.« Trotzdem war Willeys Interesse geweckt, und er wollte der Sache nachgehen. »Leider habe ich keine Erlaubnis bekommen.« Die Regierung von Honduras genehmigte nur selten archäologische Expeditionen in diesen abgelegenen Urwald, weil die Gegend zu gefährlich war.
Eine Woche später erhielt ich einen Anruf von Bloms Auftraggeber. Er hieß Steve Elkins und beschrieb sich als Filmemacher und als ein von Neugierde getriebener Abenteurer.
Ich sagte ihm, ich würde gern für den New Yorker einen kurzen Artikel über seine Suche nach der legendären versunkenen Stadt schreiben – welche Stadt es auch sein mochte. Zögernd willigte er ein, aber nur unter der Bedingung, dass er weder die Stadt noch das Land preisgeben musste. Im Vertrauen gab er schließlich zu, dass er tatsächlich nach der Ciudad Blanca, der Weißen Stadt oder der Verschollenen Stadt des Affengottes, suchte. Aber das durfte ich in meinem Artikel nicht erwähnen, denn zunächst wollte er der Sache am Boden nachgehen. »Sagen Sie einfach, dass es sich um eine Tempelstadt in Zentralamerika handelt. Aber sagen Sie nichts von Honduras, sonst fliegt alles auf.«
Elkins kannte die Legenden der Europäer und Ureinwohner über eine hochentwickelte und reiche Stadt mit einem großen Handelsnetz, die sich tief in den unzugänglichen Bergen der Mosquitia befand und seit Jahrhunderten im Dornröschenschlaf lag. Es wäre eine archäologische Entdeckung von allergrößter Bedeutung. »Wir haben gedacht, dass wir das Zielgebiet auf Satellitenbildern ausfindig machen und vielversprechende Stellen für spätere Expeditionen identifizieren könnten«, erklärte er mir. Blom und sein Team hatten sich auf ein rund zweieinhalb Quadratkilometer großes Gebiet konzentriert – der Einfachheit halber Target One oder kurz T1 genannt –, auf dem große, von Menschenhand geschaffene Bauwerke zu sein schienen. Mehr wollte er mir nicht verraten.
»Mehr kann ich dazu nicht sagen, weil jeder diese Satellitenaufnahmen kaufen kann. Was wir gemacht haben, kann jeder tun und dann den Ruhm einheimsen. Oder die Stätten plündern. Wir müssen nur noch hin, und das haben wir für kommendes Frühjahr geplant. Dann können wir der Welt hoffentlich mehr sagen.«3
3 Der Artikel erschien im New Yorker vom 20. und 27. Oktober 1997.
Heilige katholische und kaiserliche Majestät: … Ich habe Kunde von großen und reichen Provinzen mit mächtigen Herrschern … Man hat mir berichtet, dass sie acht oder zehn Tagesmärsche, also fünfzig oder sechzig Leugen, von Trujillo entfernt liegt. Was man von dieser Provinz berichtet, ist so wunderbar, dass sie, selbst wenn zwei Drittel davon falsch sind, Mexiko an Reichtum übertrifft und in der Pracht der Städte, Bevölkerung und Kultur gleichkommt.
Als der spanische Eroberer Hernán Cortés diese Zeilen im September 1526 zu Papier brachte, befand er sich an Bord eines Schiffs in der Bucht von Trujillo vor der Küste von Honduras. Historiker glauben, dass er mit seinem berühmten fünften Bericht, den er fünf Jahre nach dem Untergang von Mexiko-Tenochtitlan an Kaiser Karl V. schickte, die Saat für den Mythos der Weißen Stadt des Affengottes legte. Wenn man bedenkt, dass Mexiko, also das Reich der Azteken, atemberaubende Reichtümer barg und eine Hauptstadt mit etwa 300000 Einwohnern hatte, dann war die Aussage, dass diese unbekannte Gegend noch prächtiger sein sollte, sehr bemerkenswert. Die Ureinwohner nannten es das Alte Land der roten Erde, so Cortés, und nach dieser vagen Beschreibung musste es irgendwo in den Bergen der Mosquitia liegen.
Doch damals befand sich Cortés gerade auf einem Feldzug gegen einen seiner ehemaligen Weggefährten, der sich gegen ihn aufgelehnt hatte, weshalb er sich nie auf die Suche nach dem Alten Land der Roten Erde begab. Vielleicht schreckten ihn auch die zerklüfteten Berge ab, die von der Bucht aus zu sehen waren. Doch der Mythos lebte weiter, genau wie die Geschichten von El Dorado, die man sich jahrhundertelang in Südamerika erzählte. Zwanzig Jahre später behauptete ein Missionar namens Cristóbal de Pedraza, der später zum ersten Bischof von Honduras geweiht werden sollte, er sei auf einer seiner beschwerlichen Missionsreisen tief in den Urwald der Mosquitia vorgedrungen und habe dort etwas ganz Erstaunliches gesehen: Von einem hohen Felsen aus habe er hinunter auf eine weitläufige und blühende Stadt in einem Flusstal geblickt. Sein einheimischer Führer habe ihm berichtet, dass die Herrschenden dieses Reichs von goldenen Tellern aßen und aus goldenen Tassen tranken. Da sich Pedraza nicht für Gold interessierte, zog er weiter und stieg nicht hinunter in das Tal. Aber sein späterer Bericht an Kaiser Karl V. gab dem Mythos neue Nahrung.
In den nächsten drei Jahrhunderten berichteten Geografen und Reisende immer wieder von geheimnisvollen Städten in Zentralamerika. In den dreißiger Jahren des 19. Jahrhunderts war ein New Yorker namens John Lloyd Stephens regelrecht besessen von dem Gedanken, in den Regenwäldern der Region nach versunkenen Zivilisationen zu suchen, wenn es sie denn gab. Es gelang ihm, einen Termin beim Botschafter der kurzlebigen Konföderation von Zentralamerika zu bekommen, doch als er 1839 in Honduras ankam, ging diese gerade in einem Bürgerkrieg unter. Inmitten der Wirren sah er für sich die Chance, allein aufzubrechen und sich auf die Suche nach den geheimnisvollen Ruinen zu machen.
Mit dem Briten Frederick Catherwood begleitete ihn ein hervorragender Maler, der eine Camera lucida im Gepäck hatte, um mögliche Entdeckungen bis ins kleinste Detail abzeichnen zu können. Wochenlang wanderten die beiden mit ihren einheimischen Führern durch Honduras, immer den Gerüchten über eine große Stadt auf der Spur. Tief im Landesinneren stießen sie schließlich am Ufer eines Flusses nahe der Grenze zu Guatemala auf ein elendes, abweisendes und von Mücken geplagtes Dorf namens Copán. Von den Einwohnern erfuhren sie, dass es auf der anderen Seite des Flusses uralte Tempel gab, in denen nur noch die Affen hausten. Tatsächlich war am Ufer gegenüber eine Mauer aus behauenem Stein zu sehen. Sie überquerten den Fluss auf Eseln, kletterten eine Treppe hinauf und betraten die Stadt.
»Wir stiegen große Steinstufen hinauf«, schrieb Stephens später. »An manchen Stellen waren sie bestens erhalten, an anderen zerstört durch Bäume, die zwischen den Ritzen hervorgewachsen waren. Schließlich standen wir auf einer Terrasse, deren Form wir nicht ausmachen konnten, da der Wald, der sie überwucherte, zu dicht war. Unser Führer hieb mit seiner Machete einen Weg frei … Auf dem Weg durch das Dickicht stießen wir auf eine rechteckige Steinsäule … Auf der Vorderseite war ein sonderbar, aber reich gekleideter Mann zu sehen, und das Gesicht, offenbar ein Porträt, war ernst, streng und geeignet, dem Besucher Angst einzuflößen. Die Rückseite zeigte ein Muster, das mit nichts Ähnlichkeit hatte, das wir bis dahin gesehen hatten, und die Seiten waren mit Hieroglyphen bedeckt.«
Vor dieser Entdeckung glaubten die meisten von Stephens’ amerikanischen Landsleuten, dass die Ureinwohner der Neuen Welt von den Jägern und Sammlern abstammten, die westlich des Mississippi lebten. Auch in den Augen der meisten Europäer waren die »Indianer« halbnackte Wilde, die nichts hervorgebracht hatten, was den Namen »Kultur« verdiente.
Stephens’ Expeditionen vermittelten ein ganz neues Bild. Plötzlich erkannte die Welt, dass es auf dem amerikanischen Doppelkontinent atemberaubende Zivilisationen gegeben hatte. Er schrieb: »Der Anblick dieses unerwarteten Bauwerks widerlegte ein für alle Mal jegliche Zweifel hinsichtlich des amerikanischen Altertums und bewies, genau wie die neu entdeckten historischen Dokumente, dass die Menschen, die auf dem amerikanischen Kontinent lebten, keine Wilden waren.« Diese Menschen, die die weitläufige Stadt aus Pyramiden und Palästen errichtet und ihre Denkmäler mit Inschriften bedeckt hatten, waren die Maya; sie hatten eine Zivilisation geschaffen, die den antiken Kulturen der Alten Welt in nichts nachstand.
Als geschäftstüchtiger Amerikaner kaufte Stephens dem Großgrundbesitzer die Ruinen von Copán für 50 Dollar ab und überlegte, die Pyramiden abzutragen, auf Schiffe zu verladen, in die Vereinigten Staaten zu transportieren und dort als Vergnügungspark wiederaufzubauen – eine Idee, die er später zum Glück wieder verwarf. In den folgenden Jahren erkundeten, kartografierten und beschrieben Stephens und Catherwood alte Maya-Städte von Mexiko bis Honduras. Aber in die Mosquitia wagten sie sich nie, vielleicht abgeschreckt durch die Berge und Urwälder, die abweisender waren als alles, was ihnen auf dem Gebiet der Maya begegnet war.
Später veröffentlichten sie zwei Bände über ihre Entdeckungen, randvoll mit abenteuerlichen Geschichten über Ruinen, Banditen und die Strapazen der Reisen durch den Urwald, das Ganze aufwändig illustriert mit Catherwoods prächtigen Stichen. Die Reiseerlebnisse in Centralamerika, Chiapas und Yucatan wurden ein Bestseller und eines der erfolgreichsten Sachbücher des 19. Jahrhunderts. Die nordamerikanischen Leser waren begeistert von der Vorstellung, dass es in der Neuen Welt Städte, Paläste und riesige Tempel gab, die es mit den Pyramiden des Alten Ägypten und den Prunkbauten des antiken Rom aufnehmen konnten. Die Expeditionen von Stephens und Catherwood entfachten ein romantisches Interesse an untergegangenen Kulturen und weckten die Erwartung, dass in den Urwäldern Zentralamerikas noch mehr Geheimnisse ihrer Entdeckung harrten.
Schon bald waren die Maya die am besten erforschte alte Kultur der Neuen Welt. Aber nicht nur weltliche Wissenschaftler interessierten sich für sie. Die Mormonen sahen in den Maya einen der verlorenen Stämme Israels, die Lamaniten, die ihr Prophet Joseph Smith im Jahr 1830 im Buch Mormon beschrieben hatte. Demnach sollten die Lamaniten um das Jahr 600 vor unserer Zeitrechnung Israel verlassen haben und nach Amerika gesegelt sein; dort sei ihnen Jesus erschienen und habe sie zum Christentum bekehrt. Daneben schildert Das Buch Mormon noch zahlreiche andere Ereignisse, die sich vor der Ankunft der Europäer abgespielt haben sollen.
Noch im 20. Jahrhundert statteten die Mormonen eine Expedition von Archäologen aus und schickten sie nach Mexiko und Zentralamerika, um diese Geschichten durch Ausgrabungen zu bestätigen. Die Wissenschaftler leisteten wertvolle Forschungsarbeit, doch sie standen vor einem Dilemma: Nachdem sie klare Hinweise fanden, die das Geschichtsbild der Mormonen widerlegten, fielen einige vom Glauben ab, und andere, die ihre Zweifel äußerten, wurden aus ihrer Religionsgemeinschaft ausgeschlossen.
Das Gebiet der Maya, das sich vom Süden Mexikos bis nach Honduras erstreckt, schien in Copán zu enden. Die gewaltigen Bergwälder östlich von Copán, vor allem die der Mosquitia, waren derart unwegsam und gefährlich, dass dort kaum Erkundungen und noch weniger Ausgrabungen durchgeführt wurden. Östlich von Copán entdeckte man Spuren anderer prähispanischer Kulturen, die nicht zu den Maya gehörten, doch diese versunkenen Völker blieben im Dunkeln und weitgehend unerforscht. Genauso wenig wusste man, wie weit der Einfluss der Maya östlich von Copán reichte. Angesichts der Wissenslücken wucherten die Gerüchte von vielleicht noch größeren und reicheren Städten, die in diesen undurchdringlichen Urwäldern lagen, und diese Geschichten faszinierten Archäologen und Schatzsucher gleichermaßen.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatten sich die vielen Gerüchte und Geschichten zu einer Legende um eine heilige und verbotene Stadt namens Ciudad Blanca verdichtet. Der Name stammte vermutlich von den Pech (auch Paya genannt), einem Volk von Ureinwohnern der Mosquitia. Als Anthropologen die Mythen der Pech sammelten, hörten sie unter anderem die Geschichte eines Kaha Kamasa, eines Weißen Hauses, das jenseits eines Bergpasses im Quellgebiet zweier Flüsse liegen sollte. Einige der Indios beschrieben es als Ort, an den sich ihre Schamanen während der spanischen Conquista geflüchtet hatten und vom dem sie nie wieder zurückgekehrt waren. Andere behaupteten, die Spanier hätten die Weiße Stadt gefunden, doch die Götter hätten sie verflucht, und sie seien im Urwald umgekommen oder verschwunden, ohne dass man je wieder von ihnen hörte. Wieder andere Geschichten erzählten von einer tragischen Stadt, die nach einer Reihe von Katastrophen untergegangen sei; weil die Bewohner erkannten, dass ihnen die Götter zürnten, hätten sie die Stadt verlassen. Danach war die Stadt ein verbotener Ort, und wer sie betrat, starb an einer Krankheit oder wurde vom Teufel getötet. Daneben gab es auch moderne Versionen der Legende: Immer wieder berichteten Entdecker, Goldsucher und Flugzeugpioniere, sie hätten irgendwo im Herzen der Mosquitia zwischen dem Blätterdach die Kalksteinmauern einer verfallenen Stadt gesehen. Offenbar flossen all diese Geschichten in die Legende von der Weißen Stadt des Affengottes ein.
Nach Stephens’ Entdeckungen strömten zahlreiche Abenteurer in die Urwälder Zentralamerikas, doch kaum einer wagte sich in die Respekt gebietende Wildnis der Mosquitia. In den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts erforschte der Luxemburger Ethnologe Eduard Conzemius als einer der ersten Europäer die Mosquitia und ruderte mit einem Einbaum den Río Plátano hinauf. Auf seiner Expedition hörte er »von weitläufigen Ruinen, auf die vor zwanzig oder fünfundzwanzig Jahren ein Kautschuksammler gestoßen war, als er sich zwischen dem Río Plátano und dem Río Paulaya verirrt hatte«, schrieb Conzemius. »Dieser Mann malte seine Entdeckung in den schillerndsten Farben aus. Es handele sich um die Überreste einer bedeutenden Stadt mit weißen Gebäuden aus einem Stein, der an Marmor erinnerte, und mit einer Stadtmauer aus demselben Material.« Doch kurz nachdem der Kautschuksammler von der Stadt berichtet hatte, verschwand er spurlos. Ein Indio erklärte Conzemius, »der Teufel hat ihn geholt, weil er sich an diesen verbotenen Ort gewagt hat«. Als Conzemius versuchte, einen Führer anzuheuern, der ihn zur Weißen Stadt bringen sollte, taten die Einheimischen so, als wüssten sie von nichts – aus Angst, dass sie sterben müssten, wenn sie den Ort verrieten; das sagte man zumindest dem Ethnologen.
Anfang der Dreißiger weckte die Legende die Aufmerksamkeit nordamerikanischer Archäologen und Forschungseinrichtungen, die es nicht nur für möglich, sondern für wahrscheinlich hielten, dass in den unerforschten Urwäldern an der Grenze zum Siedlungsgebiet der Maya eine Ruinenstadt verborgen sein könnte. Dabei könnte es sich um eine Stadt der Maya handeln oder um eine ganz neue Kultur.
Zur selben Zeit entsandte die Abteilung für amerikanische Ethnologie des Smithsonian einen Archäologen, um die Region östlich von Copán zu erforschen und herauszufinden, ob die Maya bis in die Urwälder der Mosquitia vorgedrungen waren. William Duncan Strong war ein Gelehrter, der seiner Zeit voraus war: ein stiller, gewissenhafter und akribischer Forscher, der das Licht der Öffentlichkeit scheute. Er stellte als einer der Ersten fest, dass in der Mosquitia einst ein anderes Volk als die Maya gelebt haben musste, über das man bis dahin nichts wusste. Im Jahr 1933 reiste Strong fünf Monate lang durch Honduras und ruderte im Einbaum den Río Patuca und einige seiner Zuflüsse hinauf. Seine Erlebnisse hielt er in einem Tagebuch fest, das jede Menge Einzelheiten und Zeichnungen von Vögeln, Fundstücken und Landschaften enthält; es wird heute in der Sammlung des Smithsonian aufbewahrt.
Seine Expedition war nicht ungefährlich. Er kämpfte gegen Regen, Insekten, giftige Schlangen und den dichten Dschungel. Einmal wurde ihm sogar ein Finger abgeschossen, wobei die genauen Umstände unklar sind – womöglich hat er sich aus Versehen auch selbst verletzt.
Strong entdeckte bedeutende archäologische Stätten, die in seinem Tagebuch sorgfältig beschrieben und nachgezeichnet sind, und führte erste Probegrabungen durch. Unter anderem fand er die prähispanischen Siedlungen von Floresta, Wankibila und Dos Quebradas. Strong sah auf den ersten Blick, dass es sich hier nicht um Städte der Maya handeln konnte: Diese bauten ihre Tempel und Paläste aus Stein, während die Bewohner der Mosquitia Erdhügel errichteten. Es handelte sich offenbar um eine ganz eigene Kultur. Strong konnte zwar mit seiner Forschung eindeutig zeigen, dass es sich bei der Kultur der Mosquitia nicht um die Maya handelte, doch seine Entdeckungen warfen mehr Fragen auf, als sie beantworteten. Wer waren diese Menschen? Woher kamen sie? Warum werden sie in historischen Dokumenten nicht erwähnt? Wie in aller Welt war es ihnen gelungen, in dieser unwirtlichen Gegend zu leben und Landwirtschaft zu betreiben? In welcher Beziehung standen sie zu ihren mächtigen Nachbarn, den Maya? Die Erdhügel stellten ein weiteres Rätsel dar: Verbargen sich darunter Bauwerke oder Gräber, oder waren sie aus anderen Gründen angelegt worden?
Während Strong diese geheimnisvollen Siedlungen aufspürte, kamen ihm immer wieder Geschichten von der größten aller untergegangenen Städte, der Ciudad Blanca, zu Ohren. Für ihn waren das allerdings nicht mehr als »hübsche Legenden«. Am Ufer des Río Tinto in der Mosquitia erzählte ihm ein Mann eine Geschichte, die er unter der Überschrift »Die verbotene Stadt« in seinem Tagebuch festhielt.
Diese geheimnisvolle Stadt liege weiter nördlich am Ufer eines Sees tief in den Bergen, und um ihre weißen Mauern wuchsen Bananen-, Orangen- und Zitronenhaine. Aber wer von diesen verbotenen Früchten esse, finde nie mehr aus den Bergen heraus. »Soweit die Geschichte«, schrieb Strong. »Aber man hält es besser wie der Vater eines Informanten, der dem Bach folgte, bis er nur mehr ein Rinnsal zwischen finsteren Felsen und Wäldern war, und dann umkehrte. So bleibt die Stadt weiter bestehen. Wie die Ciudad Blanca werden auch die verbotenen Früchte auf ewig Neugierige anlocken.«
Tatsächlich lockten diese Gerüchte, Legenden und Geschichten eine neue Generation von Neugierigen an, besessene Goldsucher genauso wie ernsthafte Archäologen. Beide sollten dazu beitragen, dem Geheimnis der Weißen Stadt näher zu kommen.
An diesem Punkt betritt George Gustav Heye die Bühne. Durch den Verkauf seines Ölunternehmens an John D. Rockefeller war Heyes Vater ein reicher Mann geworden, und sein Sohn mehrte das Vermögen als Investmentbanker in New York. Aber Heye interessierte sich nicht nur für Geld. Kurz nach dem Studium, 1897, ging er zum Arbeiten nach Arizona und begegnete dort einer Ureinwohnerin, die auf dem herrlichen Rehlederhemd ihres Mannes herumkaute, »um die Flöhe zu töten«. Aus einer Laune heraus kaufte er das verlauste Kleidungsstück.
Es war der Beginn einer einzigartigen unersättlichen Sammelleidenschaft in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Heye war besessen von allem, was mit den amerikanischen Ureinwohnern zu tun hatte, und sollte im Laufe der Zeit mehr als eine Million Objekte anhäufen. Im Jahr 1916 richtete er am New Yorker Broadway das Museum of the American Indian ein, um seiner Sammlung ein Zuhause zu geben. (Das Museum zog 1990 nach Washington D.C. um und wurde Teil des Smithsonian.)
Heye war ein Hüne von 1,95 Meter und 135 Kilogramm, zu dem die polierte Glatze und das pausbäckige Kindergesicht nicht recht passen wollten. Er trug schwarze Anzüge, über seiner breiten Brust spannte sich die goldene Kette einer Taschenuhr, und zwischen seinen schmalen Lippen steckte eine Zigarre. Mit seiner Limousine fuhr er oft auf Einkaufstour durch das ganze Land: Er studierte die Todesanzeigen der Regionalzeitungen und suchte die Angehörigen auf, um zu fragen, ob der Verstorbene nicht zufällig eine Sammlung von indianischen Artefakten hinterlassen hatte, die keiner wollte. Hin und wieder setzte er sich bei diesen Fahrten selbst ans Steuer – er fuhr wie der Teufel – und ließ seinen Chauffeur auf dem Rücksitz Platz nehmen.
Sein Interesse an Honduras erwachte, als ihm ein Arzt aus New Orleans die Skulptur eines Gürteltiers verkaufte, die angeblich aus der Mosquitia stammte. Die merkwürdige, aus Basalt gehauene Figur hatte ein neckisches Gesicht, einen runden Rücken und nur drei Beine, sodass sie wackelte, wenn man sie hinstellte. (Sie gehört bis heute zur Sammlung des Museums.) Fasziniert organisierte Heye eine Expedition in die gefährliche Region auf der Suche nach weiteren Kunstwerken. Er verpflichtete einen Forscher namens Frederick Mitchell-Hedges, einen britischen Abenteurer, der behauptete, die Maya-Stadt Lubaantun in Belize entdeckt zu haben, wo seine Tochter den berühmten Kristallschädel »Skull of Doom« gefunden haben wollte. Der braungebrannte Mitchell-Hedges sah aus wie der Inbegriff des britischen Entdeckers, Tabakpfeife inklusive.
In den dreißiger Jahren erforschte Mitchell-Hedges für Heye die Randgebiete der Mosquitia, bis ihn ein Anfall von Malaria und Ruhr außer Gefecht setzte. Der Erkrankung traf ihn so schwer, dass er zeitweise auf einem Auge erblindete. Nach seiner Genesung kehrte er mit mehr als tausend Fundstücken zurück. Außerdem brachte er eine beeindruckende Geschichte mit: Tief in den Bergen liege eine Ruinenstadt, die von den Einheimischen »die versunkene Stadt des Affengottes« genannt wurde und in der eine riesige Affenstatue vergraben sein sollte. Postwendend schickte Heye den Entdecker abermals in die Mosquitia, diesmal wurde die Expedition vom Britischen Museum mitfinanziert.
Diese zweite Entdeckungsreise stieß auf großes Interesse. In einem Interview mit der New York Times erklärte Mitchell-Hedges: »Unsere Expedition wird in eine Region vordringen, die in den Landkarten von heute als unerforscht ausgewiesen ist … Soweit ich das beurteilen kann, befinden sich in dieser Region gewaltige Ruinen, die bislang noch nicht entdeckt worden sind.« Es handelte sich um die Mosquitia, doch den genauen Ort wolle er nicht verraten. »Die Gegend lässt sich als grausamer Urwald mit kaum zugänglichen Gebirgszügen beschreiben.« Allerdings drang Mitchell-Hedges auf seiner neuen Expedition gar nicht ins Landesinnere vor, die Strapazen seiner ersten Reise hatten ihn womöglich abgeschreckt. Stattdessen erforschte er die Sandstrände der Islas de la Bahía im Golf von Honduras. Im flachen Wasser vor der Küste fand er einige Statuen, die vermutlich durch Erosion dorthin gelangt waren. Mitchell-Hedges rechtfertigte seine Entscheidung, nicht in die Mosquitia zurückzukehren, mit einer angeblich noch viel bedeutenderen Entdeckung: Er wollte die Überreste von Atlantis und »die Wiege der amerikanischen Rassen« gefunden haben. Außerdem kam er mit neuen Geschichten von der Stadt des Affengottes zurück, von denen er auf seiner Reise an der Küste entlang gehört hatte.
Heye begann sofort mit der Planung einer neuen Honduras-Expedition, allerdings unter einem neuen Leiter. Auf Mitchell-Hedges verzichtete er klugerweise, vermutlich weil ihm ein wenig spät aufgegangen war, dass der Mann ein Hochstapler sein könnte. Tatsächlich war Mitchell-Hedges ein waschechter Münchhausen. Er war nicht der Entdecker von Lubaantun, und auch der Kristallschädel entpuppte sich (sehr viel später) als Fälschung. Dennoch gingen ihm viele Zeitgenossen auf den Leim. Selbst in seinem Nachruf in der New York Times waren die Lügengeschichten nachzulesen, die er jahrelang verbreitet hatte: dass er »acht Schusswunden und drei Narben von Messerstichen« habe; dass er in der mexikanischen Revolution an der Seite von Pancho Villa gekämpft habe; dass er während des Zweiten Weltkriegs ein Spion der Vereinigten Staaten gewesen sei; und dass er zusammen mit dem Sohn von Arthur Conan Doyle im Indischen Ozean nach Seeungeheuern gesucht habe. Einige skeptische Archäologen hatten Mitchell-Hedges allerdings schon vor seiner zweiten Honduras-Expedition als Märchenonkel bezeichnet, und nach seiner vermeintlichen Entdeckung von Atlantis überhäuften sie ihn mit Spott. Mitchell-Hedges schilderte seine Abenteuer in einem Buch mit dem Titel Land der Wunder und Schrecken, und ein Archäologe schrieb dazu: »Für mich bestand das Wunder darin, wie jemand so viel Unsinn schreiben konnte, und der Schrecken, dass die nächste Lügengeschichte noch haarsträubender war als die vorige.«
Für seine neue Honduras-Expedition tat sich Heye mit dem Nationalmuseum von Honduras und dem Präsidenten des Landes zusammen, der sich davon erhoffte, dass sich die gewaltige Region der Mosquitia für Siedler öffnen würde. Da eine solche Besiedlung mit der Vertreibung der Ureinwohner einhergehen würde, wollten die Regierung und das Nationalmuseum gerne deren Kultur dokumentieren, ehe sie für immer verschwand. Daher sollte es nicht nur eine archäologische, sondern auch eine ethnografische Expedition werden.
Obwohl die Unternehmung diesmal von einem seriösen Forscher geleitet werden sollte, offenbarte sie einmal mehr Heyes Schwäche für Abenteurer von zweifelhaftem Ruf. Der Mann, der für Heye diese »großen, von dichtem Urwald überwucherten Ruinen« finden sollte, war ein kanadischer Journalist namens R. Stuart Murray. Dieser hatte sich fünfzehn Jahre zuvor den Titel des »Hauptmanns« zugelegt, als er in Santo Domingo bei einer schäbigen Revolution mitgemischt hatte. Vor seiner Abreise erklärte er in einem Interview: »Angeblich gibt es eine versunkene Stadt, nach der ich suchen soll und die von den Indios Stadt des Affengottes genannt wird. Sie haben Angst, sich der Stadt zu nähern, weil sie glauben, dass jeder Besucher binnen eines Monats vom Biss einer Giftschlange getötet wird.«
In den Jahren 1934 und 1935 leitete Murray je eine Expedition in die Mosquitia, die Heye verwirrenderweise als Erste und Zweite Honduras-Expedition bezeichnete. Murray ging Geschichten und Beschreibungen der Stadt des Affengottes nach und schien fest davon überzeugt, dass er kurz vor ihrer Entdeckung stand. Doch jedes Mal, wenn er sich kurz vor dem Erfolg glaubte, scheiterte er – am Urwald, an Flüssen, an Bergen oder dem Tod eines seiner Führer. In den Archiven des Museum of the American Indian befindet sich ein Foto, das Murray am Ufer eines Bachs zeigt; er kniet neben einer Reihe von kleinen metates, von Mahlsteinen, die mit den Köpfen von Vögeln und anderen Tieren verziert sind. Auf der Rückseite der Aufnahme hinterließ Murray eine Nachricht an Heye:
Diese stammen aus der »Verlorenen Stadt des Affengottes« – der Indio, der sie mitgebracht hat, ist im September an dem Biss einer Lanzenotter gestorben. Er hat das Geheimnis der Lage der Stadt mit ins Grab genommen. Mehr nach meiner Rückkehr. R.S. Murray.
Unter den vielen Gegenständen, die er zurückbrachte, waren zwei, von denen man sich Hinweise auf die geheimnisvolle Stadt versprach: ein Stein mit hieroglyphenartigen Zeichen und die kleine Statue eines Affen, der sich mit den Pfoten das Gesicht bedeckt.
Nach der Expedition des Jahres 1935 wandte sich Murray anderen Unternehmungen zu. 1939 heuerte er als Gastredner auf der Stella Polaris an, dem elegantesten Kreuzfahrtschiff seiner Zeit. Dort lernte er einen jungen Mann namens Theodore A. Morde kennen, er gab die Bordzeitung heraus. Die beiden freundeten sich an. Murray unterhielt Morde mit Anekdoten über seine Suche nach der Stadt des Affengottes, und Morde berichtete Murray von seinen Abenteuern als Journalist im Spanischen Bürgerkrieg. Wieder in New York, war Murray der Ansicht, dass Heye Morde kennenlernen müsse, und stellte die beiden einander vor. »Ich habe Jahre mit der Suche nach der verschollenen Stadt zugebracht«, sagte Murray. Nun war ein anderer an der Reihe.
Heye verpflichtete Morde vom Fleck weg als Leiter einer neuen Expedition in die Mosquitia, nach seiner Zählung der dritten. Endlich würde er der Welt die Stadt des Affengottes präsentieren können, so hoffte er. Morde war gerade einmal 29 Jahre alt, doch seine Expedition und seine gewaltigen Entdeckungen sollten in die Geschichtsbücher eingehen. Die amerikanische Öffentlichkeit war längst im Bann dieser sagenumwitterten Ruinenstadt und verfolgte die Vorbereitungen mit Interesse. Die Expedition würde künftigen Historikern und Abenteurern vieldeutige und nicht unumstrittene Hinweise liefern. Ohne Morde und seine verhängnisvolle Forschungsreise hätten die vielen aberwitzigen Suchprojekte in den fünfziger bis achtziger Jahren vermutlich nie stattgefunden. Ohne Morde hätte Steve Elkins wohl nie von der Legende gehört und sich nie selbst auf die Suche nach der Verlorenen Stadt des Affengottes gemacht.
Theodore Morde, der 1911 in New Bedford, Massachusetts als Spross einer alten Walfängerfamilie das Licht der Welt erblickt hatte, war ein attraktiver Mann mit schmalem Oberlippenbärtchen, hoher Stirn und nach hinten gegeltem Haar. Er kleidete sich stilvoll und trug mit Vorliebe helle Anzüge, gestärkte Hemden und weiße Schuhe. Seine journalistische Laufbahn begann schon während seiner Schulzeit als Sportreporter der Regionalzeitung, dann wechselte er zum Radio, wo er Beiträge schrieb und Nachrichten kommentierte. Zwei Jahre lang studierte er an der Brown University, um dann Mitte der Dreißiger als Bordjournalist auf verschiedenen Kreuzfahrtschiffen anzuheuern. Im Jahr 1938 ging er als Kriegsberichterstatter und Fotograf nach Spanien. Später behauptete er, einmal sogar durch einen Fluss geschwommen zu sein, der die Front markierte, um sowohl Faschisten als auch Republikaner interviewen zu können.
Heye wollte, dass Morde so schnell wie möglich aufbrach, weshalb dieser bei den Vorbereitungen keine Zeit verlor. Er fragte seinen Studienfreund Laurence C. Brown, einen Geologen, ob er ihn nicht begleiten wollte. Im März 1940, während sich in Europa der Krieg ausweitete, machten sich Morde und Brown mit einer halben Tonne Ausrüstung und Proviant von New York aus auf den Weg nach Honduras. Dann hörte man vier Monate lang nichts mehr von den beiden. Als die beiden Entdecker schließlich aus der Mosquitia zurückkehrten, schrieb Morde einen Brief an Heye, in dem er eine erstaunliche Entdeckung vermeldete: Sie hatten etwas geschafft, das vor ihnen keiner anderen Expedition gelungen war. Am 12. Juli 1940 druckte die New York Times folgende Nachricht:
Stadt des Affengottes gefunden
Expedition meldet Erfolg bei Erkundung in Honduras
»Laut einer Nachricht an die Stiftung hat die Forschergruppe die ungefähre Lage der mythischen ›Verlorenen Stadt des Affengottes‹ in einer nahezu unzugänglichen Region zwischen dem Río Paulaya und dem Río Plátano ausfindig gemacht«, hieß es unter anderem in dem Artikel. Die amerikanische Öffentlichkeit brannte vor Neugier.
Als Morde und Brown im August nach New York zurückkamen, wurden sie von einem großen Aufgebot empfangen. Am 10. September gab Morde dem Radiosender CBS ein Interview. Das Skript mit Mordes handschriftlichen Anmerkungen ist die vollständigste erhaltene Darstellung des Funds. »Ich komme gerade von der Entdeckung einer versunkenen Stadt zurück«, erklärte er den Zuhörern. »Wir haben eine Region von Honduras erkundet, die noch nie erforscht worden ist … Wochenlang haben wir uns mühsam durch zugewucherte Urwaldflüsse gekämpft. Wo wir nicht weiterkamen, mussten wir uns mit Macheten einen Weg bahnen … Nach einigen Wochen waren wir ausgezehrt und geschwächt und hatten jeden Mut verloren. Aber gerade als wir schon aufgeben wollten, sah ich von einem kleinen Felsen aus etwas, das mich den Atem anhalten ließ. Es war die Mauer einer Stadt – die versunkene Stadt des Affengottes! … Ich konnte nicht sagen, wie groß die Stadt war, aber ich weiß, dass sie weit in den Urwald hineinreichte und dass dort einst 30000 Menschen gelebt haben könnten. Aber das war vor zweitausend Jahren. Heute ist nichts mehr übrig als die Erdhügel über den verfallenen Mauern einstiger Häuser und die Grundmauern von Gebäuden, die Paläste gewesen sein könnten. Ich erinnerte mich an eine uralte Legende, die die Indios erzählten. Sie berichtet davon, dass in der versunkenen Stadt eine gewaltige Affenstatue als Gott verehrt wurde. Ich sah einen riesigen, vom Urwald überwucherten Hügel, der bei einer künftigen Ausgrabung die Affengottheit freigeben könnte. Die Indios der Region fürchten allein den Gedanken an die Stadt des Affengottes. Sie glauben, dass sie von großen, affenähnlichen, haarigen Menschen bewohnt wird, die sie Ulaks nennen … In den Bächen nahe der Stadt stießen wir auf Gold, Silber und Platinvorkommen. Ich fand eine Maske, die aussah wie das Gesicht eines Affen … Auf fast allem war das Gesicht eines Affen eingraviert, des Affengottes … Wir werden in die Stadt des Affengottes zurückgehen, um eines der letzten Geheimnisse des Kontinents zu lüften.«
Aus Angst vor Plünderungen wollte Morde die genaue Lage der Stadt geheim halten. Nicht einmal Heye scheint er eingeweiht zu haben.
In einem Bericht für eine Zeitschrift schilderte Morde die Ruinen genauer: »Die Stadt des Affengottes hatte eine Stadtmauer. Wir entdeckten einige Mauerreste, die von der grünen Flut weitgehend verschont geblieben waren und der Vegetation standgehalten hatten. Wir folgten einer Mauer, bis sie unter Hügeln verschwand, die allem Anschein nach einst große Gebäude gewesen sein müssen. In der Tat befinden sich unter diesen uralten Schleiern noch Gebäude.«
»Es war ein idealer Ort«, fuhr er fort. »Die schroffen Berge geben den perfekten Hintergrund ab. In der Nähe sprudelt ein Wasserfall, schön wie ein mit Pailletten besetztes Abendkleid, der sich in das grüne Tal der Ruinen ergoss. Vögel, leuchtend wie Juwelen, schwirrten von Baum zu Baum, und aus dem dichten Laub schauten kleine Affengesichter neugierig auf uns herab.«
Er befragte ältere Indios und erfuhr, »was diese von ihren Vorfahren wussten, die die Stadt selbst gesehen hatten«.
Weiter schrieb er: »Dort würden wir eine hohe Treppe finden, versprachen sie uns, die denen der Maya-Ruinen im Norden ähnelt. Steinfiguren von Affen säumen diese Rampen. Im Herzen des Tempels befindet sich ein hoher Steinsockel, auf dem die Statue des Affengottes selbst steht. Davor ist eine Opferstätte.«
Morde brachte eine Menge Funde mit – Affenfiguren aus Stein und Ton, sein Kanu, Töpfe und Steinwerkzeuge. Viele davon befinden sich bis heute in den Sammlungen des Smithsonian. Er kündigte an, dass er im Jahr darauf zurückkehren wolle, »um mit den Ausgrabungen zu beginnen«.
Doch der Zweite Weltkrieg hinderte ihn daran. Morde wurde Spion des amerikanischen Geheimdienstes OSS, und in seinem Nachruf heißt es, er sei an einer Verschwörung zur Ermordung Hitlers beteiligt gewesen. Er kehrte nie wieder nach Honduras zurück. Er versank im Alkohol, seine Ehe ging in die Brüche, und 1954 erhängte er sich in der Dusche des elterlichen Sommerhauses in Dartmouth, Massachusetts. Das Geheimnis um die Lage der Stadt des Affengottes nahm er mit ins Grab.
Mordes Beschreibungen von der Entdeckung der geheimnisvollen Ruinenstadt wurden von der Presse aufgegriffen und regten die Fantasie der Leser in den Vereinigten Staaten und Honduras an. Nach seinem Tod begannen Spekulationen und Debatten um die genaue Lage der Stadt. Dutzende Abenteurer machten sich auf die Suche oder durchforsteten seine Aufzeichnungen nach versteckten Hinweisen, doch niemand wurde fündig. Ein Gegenstand wurde so etwas wie der Heilige Gral der Schatzsucher: Mordes geliebter Wanderstock, der sich noch im Besitz der Familie befand. Morde hatte vier rätselhafte Spalten von Buchstaben und Zahlen in den Stock geschnitzt, die man als Richtungsangaben oder Koordinaten deuten konnte – zum Beispiel »NE300; E 100; N 250; SE300«. Derek Parent, ein kanadischer Kartograf, war geradezu besessen von diesen Markierungen; er brachte Jahre mit der Erforschung und Kartierung der Mosquitia zu und versuchte, mit ihrer Hilfe die Stadt des Affengottes zu finden. Ihm verdanken wir die detailliertesten und genauesten Karten, die je von der Mosquitia angefertigt worden sind.
Die jüngste Suche nach Mordes Ruinenstadt fand 2009 statt. Christopher S. Stewart, Journalist des Wall Street Journal und Pulitzer-Preisträger, scheute keine Anstrengungen, in das Herz der Mosquitia vorzudringen, um Mordes Route zu rekonstruieren. Begleitet wurde er von einem Archäologen namens Christopher Begley, der seine Doktorarbeit über die Ruinenstädte der Mosquitia geschrieben hatte und mehr als einhundert davon besucht haben will. Begley und Stewart ruderten den Río Plátano hinauf zu einer Ruinenstadt namens Lancetilla, die sich am Oberlauf des Flusses befindet und von demselben Volk erbaut worden war, das nach den Erkenntnissen von Strong und anderen Archäologen die Mosquitia besiedelt hatte. Sie besteht aus 21 Erdhügeln, die vier Plätze und möglicherweise einen mesoamerikanischen Ballspielplatz markieren. Diese Stadt war 1988 von Freiwilligen des Peace Corps freigelegt und kartiert worden und befand sich ungefähr in der Region, die Morde besucht haben musste, jedenfalls nach Begleys und Stewarts Berechnungen. In einiger Entfernung zu den Ruinen entdeckten sie einen weißen Felsen im Urwald, den man nach Stewarts Ansicht aus der Ferne mit einer Mauer verwechseln könnte. Nach ihrer Rückkehr veröffentlichte Letzterer ein Buch mit dem Titel Jungleland – eine faszinierende Lektüre, doch sosehr sich Begley und Stewart auch bemühten, es gab einfach nicht genug Beweise, dass es sich bei den Ruinen von Lancetilla tatsächlich um Mordes Stadt des Affengottes handelte.
Heute wissen wir, dass all diese Forscher und Journalisten fast ein Dreivierteljahrhundert lang auf der falschen Fährte waren. Die Tagebücher von Morde und Brown sind erhalten und wurden in Mordes Familie weitervererbt. Die archäologischen Funde wurden dem Museum of the American Indian übergeben, nur die Aufzeichnungen nicht – eine sonderbare Abweichung von der gängigen Praxis, denn solche Tagebücher enthalten oft wichtige wissenschaftliche Informationen; sie gehören der Einrichtung, die eine Expedition finanziert, und nicht dem Forscher. Bis vor kurzem befanden sich die Tagebücher im Besitz von Theodores Neffen David Morde, der sie 2016 für einige Monate der National Geographic Society auslieh. Dort interessierte sich niemand dafür, aber der Archäologe war so freundlich, mir für meine Arbeit an dem Zeitschriftenartikel eine Kopie zur Verfügung zu stellen. Ich wusste, dass Chris Stewart zumindest einen Teil eingesehen hatte, doch er war enttäuscht, weil sie keinerlei Hinweise auf die Lage der Stadt des Affengottes enthielten. Er schloss daraus, dass Morde diese Information aus Sicherheitsgründen nicht einmal seinem Tagebuch anvertraut hatte. Ich blätterte durch die Seiten, auch wenn ich nicht davon ausging, etwas Interessantes zu finden.
Es waren drei Tagebücher: zwei Kladden, auf deren festen und schmutzigen Leineneinband jemand »Dritte Honduras-Expedition« geschrieben hatte, sowie ein kleinerer Spiralblock mit schwarzem Deckel und der Aufschrift »Feld-Notizen«. Die insgesamt dreihundert eng beschriebenen Seiten sind eine umfassende Darstellung der Forschungsreise vom ersten bis zum letzten Tag. Es fehlen keine Einträge oder Seiten, jeder Tag wurde detailliert beschrieben. Die Aufzeichnungen waren eine Gemeinschaftsarbeit von Brown und Morde, und während die beiden in das Herz der Finsternis vordrangen, hielt jeder seine Eindrücke in derselben Kladde fest. Browns leicht zu lesende runde Handschrift wechselt sich mit Mordes eckigen, schrägen Lettern ab.
Die Lektüre dieser Tagebücher war ein unvergessliches Erlebnis. Zuerst las ich verwundert, dann ungläubig und schließlich schockiert.
Es macht ganz den Eindruck, als seien Heye, das Museum of the American Indian und die gesamte amerikanische Öffentlichkeit hinters Licht geführt worden. Aus den Tagebüchern geht hervor, dass Morde und Brown einen geheimen Plan hatten. Von Anfang an hatte keiner der beiden die Absicht, nach einer versunkenen Stadt zu suchen. Der einzige Hinweis auf eine Ruinenstadt ist eine kurze Notiz auf einer der letzten Seiten, fast eine Art Nachklapp, der sich offenbar auf Conzemius bezieht. Das ist der gesamte Eintrag:
Weiße Stadt
1898 – Paulaya, Plátano, Wampu – Oberläufe dieser Flüsse sollten in der Nähe der Stadt sein.
Timoteteo, Rosales – einäugiger Kautschuksucher kommt von Paulaya zu Plátano – sieht Säulen, die 1905 noch stehen.
Das war alles, was sie auf mehreren Hundert Seiten über die versunkene Stadt schrieben, nach der sie angeblich gesucht und die sie den amerikanischen Medien so lebhaft geschildert hatten. Sie hatten nicht nach archäologischen Stätten Ausschau gehalten und nur sehr oberflächliche Nachforschungen angestellt. Aus ihren Tagebüchern geht eindeutig hervor, dass sie in der Mosquitia keine Ruinen, keine Kultgegenstände und schon gar keine Stadt des Affengottes gefunden hatten. Aber was trieben Morde und Brown dann während dieser Monate des Schweigens in der Mosquitia, während Heye und der Rest der Welt den Atem anhielten? Wonach suchten sie?
Gold.
Diese Umwidmung der Expedition war keineswegs eine spontane Idee. In der halben Tonne Gepäck, die Morde und Brown mitführten, befanden sich moderne Gerätschaften zur Goldsuche, darunter Sichertröge, Schaufeln, Pickel, Werkzeuge zum Bau von Waschrinnen sowie Quecksilber zur Amalgamierung. Nicht umsonst hatte sich Morde als Begleiter keinen Archäologen gewählt, sondern einen Geologen. Sie kamen mit detaillierten Informationen über mögliche Goldvorkommen entlang der Zuflüsse des Río Blanco in den Urwald und planten ihre Route entsprechend. Schon lange ging das Gerücht um, dass in den Kiesbänken und Seifenlagerstätten der Bäche und Flüsse der Mosquitia Gold zu finden war. Der Río Blanco verläuft viele Kilometer südlich von dem Ort, an dem sie die Stadt des Affengottes gefunden haben wollten. Als ich die Einträge Tag für Tag rekonstruierte, wurde mir klar, dass sie niemals den Río Paulaya oder den Río Plátano hinaufgefahren waren. Auf dem Weg den Río Patuca hinauf kamen sie am Zufluss des Río Wampu vorbei und setzten ihre Reise nach Süden zum Río Cuyamel fort; den ruderten sie hinauf zum Río Blanco. Das war sechzig Kilometer entfernt vom Quellgebiet der Flüsse Paulaya, Plátano und Wampu, wo sie angeblich die Stadt des Affengottes gefunden hatten.
Die beiden Männer waren auf der Suche nach einem neuen Kalifornien, einem neuen Yukon. Wohin sie auch kamen, durchsuchten sie Bachbetten nach Goldklümpchen und hielten akribisch jedes Krümelchen fest, das sie entdeckten. Im Ulak-Was, einem kleinen Zufluss des Río Blanco, wurden sie schließlich fündig. Hier hatte ein Amerikaner namens Perl oder Pearl schon 1907 Rinnen gebaut, um Gold zu waschen (das alles findet sich in ihren Aufzeichnungen). Doch Perl, der nichtsnutzige Sohn eines reichen New Yorkers, vergeudete seine Zeit lieber mit Alkohol und Prostituierten, weshalb sein Vater die Zahlungen einstellte. Ein Jahr später gab der Sohn die Anlage auf. Zurück blieben ein Damm, Wasserrohre, Schleusen, ein Amboss und anderes nützliches Gerät, das Morde und Brown instand setzten und gebrauchten.
An der Mündung des Ulak-Was schickten Morde und Brown ihre einheimischen Führer zurück, fuhren allein weiter den Bach hinauf und schlugen neben Perls Damm ihr »Camp Ulak« auf. Die nächsten drei Wochen – ihre eigentliche Expedition – verbrachten sie mit der Schwerstarbeit der Goldsuche.
Sie reparierten Perls alten Damm, um den Bach in die Waschrinne zu leiten, wo das Wasser über einen geriffelten Untergrund lief und die schwereren Goldbröckchen vom Kies getrennt wurden. Ihre Erträge hielten sie penibel in ihrem Tagebuch fest. Sie arbeiteten hart, Wolkenbrüche und Sandmücken machten ihnen zu schaffen. Täglich lasen sie sich dreißig bis fünfzig Zecken vom Körper. Sie lebten in dauernder Angst vor Giftschlagen, die überall lauerten. Bald gingen ihnen Kaffee und Tabak aus, und sie hatten nichts mehr zu essen. Wenn sie nicht Gold schürften, spielten sie Karten. Morde schrieb: »Immer wieder diskutieren wir über unsere Goldfunde, sprechen über den möglichen Verlauf des Krieges und fragen uns, ob Amerika auch schon darin verwickelt ist.«
Sie gaben sich ihren Träumen hin. Brown schrieb: »Wir haben einen guten Standort für einen Flugplatz entdeckt, gleich am anderen Flussufer. Wenn alles nach Plan läuft, werden wir wahrscheinlich auf demselben Plateau unser festes Camp errichten.«
Dann brach mit Macht die Regenzeit herein. Aus Wolkenbrüchen, die als Tosen in den Baumwipfeln begannen, ergossen sich täglich Dutzende Zentimeter Wasser auf sie herab. Nach jeder Sturzflut schwoll der Ulak-Was weiter an, und sie hatten mit dem steigenden Pegel zu kämpfen. Am 12. Juni 1940 kam es zur Katastrophe. Nach einem gewaltigen Regenguss rauschte eine Flutwelle den Bach herunter, sprengte den Damm und riss sämtliche Gerätschaften mit sich fort. »Wir können nicht weiter nach Gold suchen«, klagte Morde im Tagebuch. »Der Damm ist vollständig verschwunden, genau wie die Rinnen. Das Beste ist, wir brechen hier so schnell wie möglich unsere Zelte ab und fahren wieder flussabwärts.«
Sie gaben die Arbeit auf, luden ihr Gold und ihre Ausrüstung ins Boot und paddelten mit halsbrecherischer Geschwindigkeit die überfluteten Flüsse hinunter: Vom Ulak-Was rasten sie hinunter zum Río Blanco, von dort in den Río Cuyamel und schließlich in den Río Patuca. Innerhalb eines einzigen Tages legten sie eine Strecke zurück, für die sie auf dem Hinweg zwei Wochen gebraucht hatten. Als sie schließlich die ersten Ausläufer der Zivilisation erreichten, ein Hüttendorf am Río Patuca, hörte Morde im Radio die Nachricht von der Kapitulation Frankreichs. Die Vereinigten Staaten befänden sich »praktisch schon im Krieg, sie würden in ein oder zwei Tagen eintreten«, erfuhr er. Die beiden Männer waren in Sorge, dass sie nicht mehr aus Honduras wegkommen würden. »Wir beschlossen, das Ziel der Expedition rasch zum Abschluss zu bringen.« Man kann darüber streiten, was dieser rätselhafte Satz zu bedeuten hatte, aber ihnen schien zu dämmern, dass sie sich eine Geschichte ausdenken und ein paar archäologische Fundstücke auftreiben mussten, die sie Heye als vermeintliche Mitbringsel aus der Stadt des Affengottes präsentieren konnten. (Bis zu diesem Punkt ist in den Tagebüchern nicht die Rede davon, dass die beiden in der Mosquitia historische Objekte gefunden hätten.)
Also setzten sie ihre rasante Fahrt den Río Patuca hinunter fort und waren an manchen Tagen noch nach Einbruch der Dunkelheit auf dem Wasser. Am 25. Juni erreichten sie Brus Laguna an der Küste. Dort verbrachten sie eine ganze Woche; nun waren sie nicht mehr in Eile, weil sie erfuhren, dass die Vereinigten Staaten weit davon entfernt waren, in den Krieg einzutreten. Am 10. Juli erreichten sie schließlich die Hauptstadt Tegucigalpa. In der Zwischenzeit muss Morde den fiktiven Bericht für seinen Auftraggeber George Heye geschrieben haben, auf dem der Artikel in der New York Times basierte.
Nach ihrer Rückkehr nach New York erzählte Morde die Geschichte von der Entdeckung der Stadt des Affengottes wieder und wieder, jedes Mal mit neuen Ausschmückungen. Die Öffentlichkeit nahm ihm alles ab. Ihre bescheidene Sammlung von archäologischen Fundstücken wurde zusammen mit einem Kanu im Museum ausgestellt. Aus den Tagebüchern geht hervor, dass die beiden Männer ihre »Funde« in Wirklichkeit in einem Dorf westlich von Brus Laguna zusammengesucht hatten. Ein Spanier hatte ihnen eine Grube gezeigt, in der einige Tonscherben herumlagen, und dort hatten sie ein wenig gegraben. Wahrscheinlich hatten sie bei dieser Gelegenheit den Dorfbewohnern einige Gegenstände auch abgekauft, doch darüber schweigen sich die Tagebücher aus.
In ihren Aufzeichnungen gaben sich Morde und Brown nicht die geringste Mühe, ihr Handeln zu vertuschen. Es ist schwer nachvollziehbar, warum sie keinen Hehl aus ihrem Schwindel machten. Ganz offensichtlich hatten sie nie die Absicht, ihren Auftraggeber Heye oder die Öffentlichkeit einen Blick in ihre Kladden werfen zu lassen. Vielleicht war es Eitelkeit, vielleicht träumten sie von einem sensationellen Goldfund und wollten die Geschichte für die Nachwelt erhalten. Vielleicht entschlossen sie sich erst spontan und in letzter Minute, die Entdeckung der Stadt des Affengottes zu verkünden, aber es sieht doch eher so aus, als sei das von Anfang an Teil des Plans und eine Tarnung für ihr eigentliches Vorhaben gewesen.