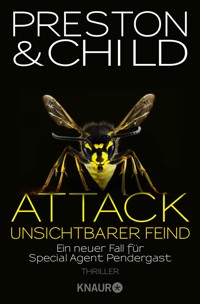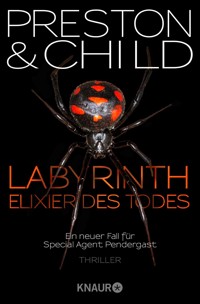
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Fall für Special Agent Pendergast
- Sprache: Deutsch
"Labyrinth - Elixier des Todes. Ein neuer Fall für Special Agent Pendergast": Der Erfolgsthriller des unvergleichlichen Bestseller-Duos Preston & Child - spannend, schnell und hochexplosiv. Vor seinem Haus in New York findet Special Agent Aloysius Pendergast einen seiner unversöhnlichsten Feinde tot auf. Pendergast hat keine Ahnung, wer ihm die Leiche vor die Tür gelegt haben könnte – und warum. Aber es gibt ein rätselhaftes Indiz: einen Türkis, der bei der Obduktion im Magen des Opfers gefunden wird. Der Edelstein führt Pendergast zu einer verlassenen Mine am Ufer eines Salzsees in Südkalifornien – und tief in die eigene Familiengeschichte. "Viele Verwicklungen, Wendungen und Action erwarten einen in "Labyrinth - Elixier des Todes". Es bleibt kaum Zeit zum Luftholen. Aloysius Pendergast ist wieder in Hochform! Eine Story, die so nur Preston & Child schreiben können." Denglers-buchkritik.de
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 603
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Douglas Preston / Lincoln Child
Labyrinth – Elixier des Todes
Ein neuer Fall für Agent Pendergast
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Agent Pendergast erhält Besuch aus der Vergangenheit – in Form einer Leiche. Sein neuester Fall führt den Kult-Ermittler tief in die eigene Familiengeschichte. Alles beginnt Ende des 19. Jahrhunderts, als Hezekiah Pendergast, ebenso genial wie niederträchtig, ein Elixier entwickelt, das seine teuflische Wirkung über Generationen entfaltet, bis in die Gegenwart. Und das bekommt Agent Pendergast nun am eigenen Leib zu spüren. Preston & Child haben für »Labyrinth – Elixier des Todes« alles aufgefahren, was ihre Fans weltweit begeistert: das Spiel mit den Möglichkeiten der Wissenschaft, atmosphärische Schauplätze, überraschende Wendungen, rasante Action – und natürlich das Mysterium Pendergast.
Inhaltsübersicht
Widmung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
75. Kapitel
76. Kapitel
77. Kapitel
Epilog
Danksagung
Die Pendergast-Romane in der inhaltlich chronologischen Reihenfolge
Unsere anderen Romane
Lincoln Child widmet dieses Buch seiner Tochter Veronica
Douglas Preston widmet dieses Buch Elizabeth Berry und Andrew Sebastian
1
Die herrschaftliche Beaux-Arts-Villa am Riverside Drive zwischen der 137. und 138. Straße war zwar sorgfältig gepflegt und in makellosem Zustand, aber sie wirkte unbewohnt. An diesem stürmischen Abend im Juni ging niemand unruhig auf dem Witwengang mit Blick auf den Hudson River auf und ab, kein gelblicher Lichtschein fiel aus dem Inneren durch die dekorativen Erkerfenster nach draußen. Das einzig sichtbare Licht drang aus dem Vordereingang und erhellte die Wagenauffahrt des Gebäudes.
Doch der äußere Schein kann trügen, manchmal absichtlich. Denn am Riverside Drive 891 lag das Stadthaus von FBI-Special Agent Aloysius Pendergast, und Pendergast war ein Mann, der größten Wert auf den Schutz seiner Privatsphäre legte.
In der vornehmen Bibliothek der Villa saß Pendergast in einem ledernen Ohrensessel. Obschon Frühsommer, war es ein windiger, kühler Abend, weshalb ein kleines Feuer im Kamin brannte. Pendergast blätterte in einem Exemplar des Manyoshu, einer alten und berühmten Sammlung japanischer Gedichte aus dem Jahr 750 n. Chr. Auf dem Tisch neben ihm standen ein kleiner Tetsubin, ein gusseiserner Teekessel, und eine zur Hälfte mit grünem Tee gefüllte Porzellantasse. Nichts störte seine Konzentration. Die einzigen Geräusche waren das gelegentliche Knistern in sich zusammenfallender Holzscheite und das Donnergrollen hinter den geschlossenen Fensterläden.
Jetzt erklangen in der Empfangshalle leise Schritte, und im Durchgang zur Bibliothek erschien Constance Greene. Sie trug ein schlichtes Abendkleid. Ihre veilchenblauen Augen und die dunklen, zu einem altmodischen Bob frisierten Haare hoben sich deutlich gegen ihren blassen Teint ab. In der einen Hand hielt sie ein Bündel Briefe.
»Die Post.«
Pendergast neigte den Kopf und legte das Buch beiseite.
Constance setzte sich neben ihn. Nach seiner Rückkehr vom »Colorado-Abenteuer«, wie er es genannt hatte, wirkte er zumindest nach außen hin wiederhergestellt. Seit den schrecklichen Ereignissen im Vorjahr hatte seine Gemütslage sie in ängstliche Unruhe versetzt.
Sie fing an, den kleinen Stapel Briefe durchzusehen, und legte diejenigen Schreiben beiseite, die ihn nicht interessieren würden. Pendergast konnte es nicht leiden, sich mit alltäglichen Dingen zu beschäftigen. Eine alteingesessene, diskrete Anwaltskanzlei in New Orleans, die schon lange in Diensten der Familie stand, bezahlte die Rechnungen und verwaltete einen Teil seiner außergewöhnlich breitgefächerten Einkünfte. Ein ebenso ehrwürdiges New Yorker Bankhaus verwaltete die Investments, Stiftungen und den Grundbesitz. Zudem ließ er sich alle Briefe in ein Postfach zustellen, das Proctor, sein Chauffeur, Leibwächter und »Mädchen für alles«, in regelmäßigen Abständen leerte. Weil Proctor zurzeit Vorkehrungen für seinen Besuch bei Verwandten im Elsass traf, hatte Constance eingewilligt, sich um die postalischen Angelegenheiten zu kümmern.
»Hier ist ein Brief von Corrie Swanson.«
»Bitte öffne ihn.«
»Sie hat die Fotokopie eines Briefs des John Jay College beigefügt. Sie hat für ihre Diplomarbeit den Rosewell-Preis erhalten.«
»In der Tat. Ich war bei der Feier zugegen.«
»Corrie hat sich darüber bestimmt sehr gefreut.«
»Es kommt selten vor, dass eine Graduiertenfeier mehr als ein geisttötendes Einerlei aus Plattitüden und Verlogenheiten bietet, begleitet von den ermüdenden Klängen von Pomp and Circumstance.« Pendergast trank einen kleinen Schluck Tee und erinnerte sich. »Diese hat mehr geboten.«
Er neigte den Kopf, als sie den Brief beiseitelegte. Einen Monat vorher, am Vorabend von D’Agostas Hochzeit, hatte Pendergast für das Paar ein privates Dinner gegeben, das aus mehreren, von ihm selbst zubereiteten Gängen bestand, dazu gab es Raritäten aus seinem Weinkeller. Es war diese Geste gewesen, mehr als alles andere, die Constance davon überzeugt hatte, dass Pendergast von seinem kürzlich erlittenen emotionalen Trauma genesen war.
Sie überflog noch ein paar Briefe, dann legte sie die, die von Interesse waren, zur Seite und warf den Rest ins Feuer.
»Wie geht’s mit deinem Projekt voran, Constance?«, fragte Pendergast und goss sich eine weitere Tasse Tee ein.
»Sehr gut. Erst gestern habe ich ein Paket aus Frankreich erhalten, vom Bureau Ancestre du Dijon. Ich versuche jetzt, die Informationen in das zu integrieren, was ich bereits aus Venedig und Louisiana gesammelt habe. Wenn du Zeit hast, würde ich dir gern einige Fragen zu Augustus Robespierre St. Cyr Pendergast stellen.«
»Das meiste, was ich weiß, stammt aus mündlicher Überlieferung innerhalb der Familie und ein paar geflüsterten Horrorgeschichten. Ich würde dich gern am Großteil davon teilhaben lassen.«
»Am Großteil? Ich hatte gehofft, dass du mir alles erzählst.«
»Ich fürchte, die Familie Pendergast hat Leichen im Keller, im buchstäblichen wie im übertragenen Sinne, die ich selbst vor dir verbergen muss.«
Seufzend erhob sie sich. Als Pendergast sich wieder seiner Gedichtlektüre widmete, verließ sie die Bibliothek, durchquerte die Empfangshalle mit den Museumsschränken voller Kuriositäten und betrat durch eine Durchgangstür einen langen, schummrigen Bereich, der mit nachgedunkeltem Eichenholz getäfelt war. Hauptmerkmal dieses Zimmers war ein Refektoriumstisch, der beinahe so lang war wie der Raum selbst. Auf dem nahen Ende des Tisches lagen Zeitschriften, alte Briefe, Volkszählungsunterlagen, vergilbte Fotografien und Kupferstiche, Gerichtsprotokolle, Lebenserinnerungen, Kopien von Zeitungsmikrofilmen sowie weitere Schriftstücke, allesamt zu ordentlichen Stapeln aufgereiht. Daneben stand ein Laptop-Computer, dessen Bildschirm in dem schummrigen Raum ein unpassendes Licht spendete. Mehrere Monate vorher hatte Constance es auf sich genommen, eine Ahnentafel der Familie Pendergast zu erstellen. Damit wollte sie sowohl die eigene Neugier befriedigen als auch Pendergast dabei helfen, aus seinen Grübeleien herauszukommen. Es war ein irrsinnig komplexes, äußerst ärgerliches und dennoch unendlich faszinierendes Unterfangen.
Am hinteren Ende des langgestreckten Zimmers, hinter einer Rundbogentür, lag die Eingangshalle, die zur Vordertür der Villa führte. Constance wollte gerade am Tisch Platz nehmen, als es laut klopfte.
Sie runzelte die Stirn. Sie empfingen nur selten Besucher am Riverside Drive 891 – und niemals ohne Voranmeldung.
Wieder ertönte vom Vordereingang lautes Klopfen, untermalt von leisem Donnergrollen.
Constance strich ihr Kleid glatt und ging bis ans Ende des Zimmers, durch die Rundbogentür und in die Eingangshalle. Die schwere Haustür bestand aus massivem Holz, einen Spion gab es nicht, und deshalb zögerte sie kurz. Als sie kein drittes Klopfen hörte, löste sie erst das obere, dann das untere Schloss und öffnete langsam die Tür.
Dort stand im Licht der Wagenauffahrt, sich als Silhouette abzeichnend, ein junger Mann. Seine blonden Haare waren nass und hingen am Kopf hinunter. Die regennassen Gesichtszüge waren fein geschnitten und wirkten durch und durch nordisch, hinzu kamen eine hohe Stirn und ein markanter Mund. Er trug einen durchnässten Leinenanzug, der ihm schlaff am Körper herunterhing.
Der junge Mann war mit dicken Seilen gefesselt.
Erschrocken streckte Constance die Hand nach ihm aus. Doch die hervortretenden Augen nahmen keine Notiz von der Geste, sondern blickten unverwandt geradeaus.
Einen Moment lang blieb der Mann stehen und schwankte ganz leicht, wobei er in unregelmäßigen Abständen von Blitzen in ein grelles Licht getaucht wurde. Und dann fiel er um wie ein umstürzender Baum, langsam zuerst und dann schneller, ehe er mit dem Gesicht nach unten krachend auf die Türschwelle prallte.
Mit einem Aufschrei wich Constance zurück. Pendergast kam herbeigelaufen, dichtauf gefolgt von Proctor. Pendergast packte sie, zog sie zur Seite und kniete rasch neben den jungen Mann nieder. Er packte ihn an den Schultern und drehte ihn um, strich ihm die Haare aus den Augen und tastete den Puls, der unter der kalten Haut am Hals so offensichtlich nicht mehr schlug.
»Tot.« Seine Stimme klang leise und unnatürlich gefasst.
»O mein Gott«, sagte Constance mit brechender Stimme, »das ist dein Sohn Tristram.«
»Nein. Das ist Alban. Sein Zwilling.«
Nur einen Augenblick noch kniete er neben dem Leichnam, dann sprang er auf und entschwand blitzschnell und katzenhaft in den heulenden Sturm.
2
Pendergast spurtete zum Riverside Drive, blieb an der Ecke stehen und schaute die breite Straße in nördlicher und südlicher Richtung entlang. Inzwischen goss es in Strömen, es herrschte wenig Verkehr, und nirgends waren Fußgänger zu sehen. Sein Blick fiel auf das nächstgelegene Fahrzeug, etwa drei Blocks weiter südlich. Ein neuerer Lincoln Town Car, schwarz, wie man ihn zu Tausenden auf den Straßen von Manhattan sah. Weil das Licht am Nummernschild ausgeschaltet war, war das New Yorker Kennzeichen nicht vollständig zu entziffern.
Pendergast rannte hinter dem Auto her.
Es beschleunigte aber nicht, sondern fuhr mit derselben gemächlichen Geschwindigkeit weiter den Riverside Drive hinunter, überquerte an jeder Querstraße die auf Grün stehende Ampel und entfernte sich immer weiter. Die Ampeln sprangen auf Gelb, dann Rot. Doch das Fahrzeug setzte seine Fahrt fort, fuhr bei Gelb und bei Rot über eine Ampel, ohne schneller oder langsamer zu werden.
Pendergast zog sein Mobiltelefon heraus und tippte im Laufen eine Nummer ein. »Proctor, kommen Sie mit dem Wagen her. Ich laufe auf dem Riverside Drive Richtung Süden.«
Der Town Car war fast verschwunden, abgesehen von den beiden matten Hecklichtern, die im strömenden Regen verschwammen, aber als der Drive an der 126. Straße eine leichte Kurve machte, verschwanden auch diese.
Pendergast rannte weiter, setzte die Verfolgung in vollem Lauf fort, seine schwarze Anzugjacke flatterte hinter ihm her, der Regen peitschte ihm ins Gesicht. Ein paar Häuserblocks weiter sah er den Town Car erneut, diesmal stand er an einer Ampel, hinter zwei anderen Autos. Noch einmal zog er sein Handy hervor und wählte.
»Revier sechsundzwanzig. Officer Powell.«
»Special Agent Pendergast, FBI. Ich verfolge gerade einen schwarzen Town Car, New Yorker Kennzeichen nicht identifiziert, fährt auf dem Riverside an der Ecke Hundertvierundzwanzigste in Richtung Süden. Fahrer steht unter Mordverdacht. Benötige Unterstützung, um Fahrzeug zu stoppen.«
»Nachricht erhalten«, lautete die Antwort. Und kurz darauf: »Wir haben einen Wagen in der Gegend, zwei Blocks weiter. Halten Sie uns auf dem Laufenden.«
»Außerdem Unterstützung aus der Luft«, sagte Pendergast, immer noch in vollem Lauf.
»Sir, wenn es sich bei dem Fahrzeugführer lediglich um einen Verdächtigen handelt …«
»Es handelt sich um eine vorrangige Zielperson des FBI«, sagte Pendergast ins Handy. »Ich wiederhole, um eine vorrangige Zielperson.«
Kurze Pause. »Wir lassen den Vogel aufsteigen.«
Während Pendergast das Handy einsteckte, bog der Town Car unvermittelt um die Autos, die vor der roten Ampel standen, herum, fuhr über den Kantstein auf den Gehweg, pflügte im Riverside Park durch mehrere Blumenbeete, dass die Erde nur so aufspritzte, und raste schließlich in entgegengesetzter Richtung die Ausfahrtrampe zum Henry Hudson Parkway hinunter.
Abermals telefonierte Pendergast mit der Einsatzzentrale und brachte die Beamten auf den neuesten Stand, was den Standort des Fahrzeugs betraf, sofort danach rief er Proctor an, dann bog er in den Park, sprang über einen niedrigen Zaun und sprintete durch irgendwelche Tulpenbeete, den Blick auf die Rücklichter des Wagens geheftet, der auf der Ausfahrtrampe runter zum Parkway schlitterte, wobei das Reifenquietschen bis zu ihm herüberwehte.
Mit einem Satz sprang er über die niedrige Steinmauer auf der anderen Seite der Ausfahrt, dann rannte und rutschte er die Böschung hinunter. Bei seinem Versuch, dem Fahrzeug den Weg abzuschneiden, spritzten Müll und Glasscherben in alle Richtungen. Er stürzte, rollte und rappelte sich auf; seine vom Regen durchnässte Brust hob und senkte sich, das weiße Hemd klebte an der Brust. Pendergast sah, wie der Town Car um 180 Grad wendete und auf der Ausfahrt auf ihn zugerast kam. Er griff nach seiner Les Baer, aber seine Hand schloss sich über einem leeren Holster. Rasch blickte er sich auf der dunklen Böschung um, musste sich dann aber – als ein strahlend helles Licht über ihn hinwegstrich – zu Boden werfen. Kaum war der Wagen vorbeigefahren, rappelte er sich auf und schaute dem Fahrzeug hinterher, das im Hauptstrom des Verkehrs entschwand.
Kurz darauf näherte sich ein alter Rolls-Royce und bremste scharf am Kantstein ab. Pendergast zog die hintere Tür auf und sprang in den Wagen.
»Folgen Sie dem Town Car«, sagte er zu Proctor und schnallte sich an.
Sanft beschleunigte der Rolls. Von hinten hörte Pendergast leise Polizeisirenen, aber die Streifenwagen waren zu weit weg und würden bei dem starken Verkehr zweifellos nicht rechtzeitig durchkommen. Aus einem Seitenfach zog er ein Polizeifunkgerät. Die Verfolgungsjagd nahm Tempo auf. Der Town Car wechselte die Spur und wich den anderen Wagen mit einer Geschwindigkeit von annähernd hundertfünfzig Stundenkilometern aus, noch während beide Fahrzeuge in einen Baustellenbereich hineinfuhren; Betonbarrieren säumten die Schnellstraße.
Im Polizeifunk herrschte Hochbetrieb, aber Proctor und er waren die Verfolger, die am dichtesten dran waren. Der Heli war nirgends zu sehen.
Plötzlich zuckten aus den Fahrzeugen vor ihnen mehrere helle Blitze, denen augenblicklich der Knall von Schüssen folgte.
»Es wird geschossen!«, rief Pendergast in den offenen Kanal. Ihm war sofort klar, was passierte. Direkt voraus schleuderten mehrere Wagen unkontrolliert nach rechts und links, dazu zuckten die Mündungsblitze weiterer Schüsse auf. Dann ertönte ein Rumms-Rumms-Rumms: Einige Fahrzeuge fuhren mit hoher Geschwindigkeit aufeinander auf, was eine Kettenreaktion auslöste, so dass die Straße ziemlich schnell mit zischendem, zerbeultem Metall verstopft war. Außerordentlich gekonnt bremste Proctor den Rolls ab und versuchte mit einem Powerslide, den Wagen an der Kettenreaktion der Kollisionen vorbeizumanövrieren. Der Rolls prallte schräg gegen eine Betonabsperrung, wurde auf die Fahrbahn zurückgeschleudert und von hinten von einem Fahrzeug gerammt, das, begleitet von ohrenbetäubendem metallischem Krachen, in den stehenden Verkehr hineinraste. Pendergast wurde auf dem Rücksitz erst nach vorn geschleudert, heftig gebremst vom Sicherheitsgurt, dann wieder nach hinten. Etwas benommen hörte er das Zischen von Dampf, Schreie und Bremsenkreischen und weitere krachende Zusammenstöße. Die Autos fuhren weiter aufeinander auf, das Ganze untermalt vom anschwellenden Chor von Polizeisirenen und jetzt, endlich, dem Flapp-Flapp-Flapp von Hubschrauberrotoren.
Nachdem Pendergast eine Schicht Glassplitter abgeschüttelt hatte, bemühte er sich, seine Benommenheit loszuwerden und den Sicherheitsgurt zu lösen. Er beugte sich vor, um sich Proctor genauer anzusehen.
Proctor war bewusstlos, der Kopf blutig. Pendergast tastete nach dem Funkgerät, wollte Hilfe rufen, aber da wurden die Türen schon aufgezogen. Sanitäter drängten sich ins Wageninnere, Hände packten ihn.
»Fassen Sie mich nicht an. Kümmern Sie sich um ihn.«
Pendergast riss sich los und rannte hinaus in den strömenden Regen, wobei noch ein paar mehr Glasscherben von ihm abfielen. Geradeaus sah er das undurchdringliche Gewirr von Autos, das Meer von Blaulichtern und hörte die Rufe der Sanitäter und Polizisten und das Flappen des nutzlos kreisenden Hubschraubers.
Der Town Car war längst verschwunden.
3
Mit einem Magister in klassischer Philologie, den er an der Brown University gemacht hatte, und als ehemaliger Umweltaktivist war Lieutenant Peter Angler kein typischer Polizist des New York Police Department. Es gab allerdings gewisse Eigenschaften, die er mit seinen Kollegen teilte. Es gefiel ihm, seine Fälle schnell und sauber zu lösen, und auch, die Täter hinter Gittern zu sehen. Derselbe unbeirrbare Antrieb, der ihn dazu gebracht hatte, 1992, im zweiten Studienjahr, Der Peloponnesische Krieg von Thukydides zu übersetzen und sich an Redwood-Baumriesen anzuketten – was die Holzfäller mit ihren Kettensägen später im selben Jahrzehnt zur Verzweiflung treiben sollte –, führte außerdem dazu, dass Angler bereits im Alter von sechsunddreißig Jahren zum Lieutenant-Commander Detective Squad aufgestiegen war. Er führte seine Ermittlungen gleich militärischen Feldzügen, wobei er sicherstellte, dass die ihm unterstellten Detectives ihren Pflichten gründlich und präzise nachkamen. Die Ergebnisse, die eine solche Strategie erzielte, machten Angler stolz.
Und genau deswegen bereitete ihm sein derzeitiger Fall so heftige Magenschmerzen.
Zugegeben, der Fall war nicht mal vierundzwanzig Stunden alt, und sein Team traf auch keinerlei Schuld daran, dass es kaum Fortschritte gab. Alles war vorschriftsmäßig abgearbeitet worden. Die Ersthelfer hatten den Tatort gesichert, Aussagen aufgenommen, die Zeugen so lange festgehalten, bis die Leute von der Spurensicherung vor Ort eintrafen. Diese Ermittler wiederum hatten den Tatort gründlich bearbeitet, Beweismaterial gesucht, begutachtet und gesammelt. Sie hatten eng mit den Tatortleuten zusammengearbeitet, dem Fingerabdruckteam, den forensischen Ermittlern, den Fotografen und dem Rechtsmediziner.
Nein, seine Unzufriedenheit beruhte auf dem ungewöhnlichen Charakter des Verbrechens selbst … und, ironischerweise, dem Vater des Verstorbenen, einem Special Agent des FBI. Angler hatte eine Abschrift der Aussage gelesen, die bemerkenswert war wegen ihrer Kürze und ihrem Mangel an hilfreichen Informationen. Zwar hatte der Mann streng genommen das Tatortteam nicht behindert, doch er war auffälligerweise nicht bereit gewesen, seine Leute außerhalb des Tatorts in sein Haus zu lassen – was so weit ging, dass ein Beamter nicht mal das Klo benutzen durfte. Natürlich war das FBI nicht offiziell mit dem Fall befasst, aber Angler war bereit gewesen, dem Mann Einblick in die Fallakte zu gestatten, sollte dieser es wünschen. Allerdings hatte der Agent kein entsprechendes Ersuchen gestellt. Hätte Angler es nicht besser gewusst, er hätte fast vermutet, dass dieser Pendergast gar nicht wollte, dass der Mörder seines Sohnes gefasst wurde.
Was auch der Grund dafür war, dass er sich entschlossen hatte, den Mann selbst zu befragen, und zwar – er sah auf seine Uhr – in exakt einer Minute.
Und genau eine Minute darauf wurde der Agent in sein Büro hereingeführt. Der Mann, der ihn begleitete, war Sergeant Loomis Slade, Anglers »rechte Hand«, persönlicher Assistent und oft auch Diskussionspartner. Mit geübtem Blick nahm Angler die hervorstechenden äußeren Merkmale des Besuchers wahr: hochgewachsen, hellblondes Haar, pastellblaue Augen. Der schwarze Anzug und eine dunkle Krawatte mit dezentem Muster vervollständigten das asketische Äußere. Das war kein typischer FBI-Agent. Beim Gedanken an seine Wohnsitze – die Wohnung in Dakota, die Riesenvilla am Riverside Drive, vor der man die Leiche deponiert hatte – entschloss sich Angler jedoch, seine Verwunderung zu verbergen. Er bot dem Besucher einen Stuhl an, dann setzte er sich wieder hinter seinen Schreibtisch. Sergeant Slade nahm in einer der hinteren Ecken Platz, hinter Pendergast.
»Agent Pendergast. Danke, dass Sie gekommen sind.«
Der Mann im schwarzen Anzug neigte kurz den Kopf.
»Zunächst möchte ich Ihnen mein herzliches Beileid aussprechen.«
Der Agent gab keine Antwort. Im Grunde wirkte er gar nicht wie ein Hinterbliebener. Mehr noch, er verzog keine Miene. Seine Gesichtszüge waren nicht zu deuten.
Anglers Büro unterschied sich von denen der meisten Lieutenants der New Yorker Polizei. Gewiss, es beherbergte jede Menge Akten und Stapel mit Ermittlungsberichten und Protokollen. Doch an den Wänden hingen statt Auszeichnungen und Fotos mit Vorgesetzten ein Dutzend gerahmte alte Landkarten. Denn Angler war ein leidenschaftlicher Sammler von Karten. Normalerweise fühlten sich die Besucher sofort zu der Seite aus dem Französischen Atlas von LeClerc aus dem Jahr 1631 hingezogen, dem Druck 58 aus Ogilbys Britannia Atlas, der die Straße von Bristol nach Exeter zeigte, oder auch – sein Ein und Alles – der vergilbten, unvollständigen Seite aus der Peutingerschen Tafel, nach der Ausgabe von Abraham Ortelius. Doch Pendergast schenkte der Sammlung nicht mal einen flüchtigen Blick.
»Ich möchte auf Ihre Eingangsbemerkung zurückkommen, wenn Sie gestatten. Wobei ich gleich hinzufügen sollte, dass ich Ihnen einige peinliche und peinigende Fragen stellen muss. Dafür entschuldige ich mich im Voraus. Aber angesichts Ihrer Erfahrungen in Strafermittlungsverfahren haben Sie sicherlich Verständnis dafür.«
»Selbstverständlich«, entgegnete der Agent. Er sprach mit einem weichen Südstaatenakzent, hinter dem sich aber auch etwas Hartes, Metallisches verbarg.
»Diese Straftat hat mehrere Aspekte, die ich offen gestanden verwirrend finde. Laut Ihrer Aussage und der Ihres …«, kurzer Blick auf den Bericht auf seinem Schreibtisch, »… Mündels Miss Greene klopfte es gestern Abend gegen zwanzig Minuten nach neun an der Tür Ihres Hauses. Als Miss Greene öffnete, fand sie Ihren Sohn mit dicken Seilen gefesselt vor der Tür liegend vor. Sie vergewisserten sich, dass er tot war, und verfolgten einen Town Car auf dem Riverside Drive Richtung Süden, während sie Neun-Eins-Eins anriefen. Richtig?«
Agent Pendergast nickte.
»Was hat Sie veranlasst zu glauben – zunächst jedenfalls –, dass der Mörder in diesem Wagen saß?«
»Es handelte sich um das einzige Fahrzeug, das sich zu jenem Zeitpunkt in Bewegung befand.«
»Sie sind also nicht auf den Gedanken gekommen, dass der Täter sich irgendwo auf Ihrem Grundstück aufgehalten haben und auf irgendeinem anderen Weg geflüchtet sein könnte?«
»Das Fahrzeug ist mehrfach bei Rot über eine Kreuzung gefahren, über einen Gehweg und durch ein Blumenbeet gerast, auf einer Ausfahrtrampe auf den Parkway gebogen und hat ein illegales 180-Grad-Wendemanöver vollzogen. Anders ausgedrückt: Es hat den recht überzeugenden Eindruck vermittelt, dass es sich der Verfolgung zu entziehen versuchte.«
Die leicht ironische Erwiderung verärgerte Angler.
Pendergast redete weiter. »Darf ich fragen, warum der Polizeihubschrauber so spät eingetroffen ist?«
Angler ärgerte sich noch mehr. »Er ist nicht verspätet eingetroffen, sondern fünf Minuten nach dem Anruf. Das ist ziemlich gut.«
»Aber nicht gut genug.«
Weil er die Kontrolle über die Befragung zurückgewinnen wollte, sagte Angler, und zwar in deutlich schrofferem Ton, als er beabsichtigt hatte: »Kommen wir auf das eigentliche Verbrechen zurück. Trotz einer sorgfältigen Überprüfung der Nachbarschaft haben meine Detectives keine Zeugen gefunden – außer denen am West Side Highway, die den Town Car gesehen haben. Es gibt keinerlei Hinweise auf Gewaltanwendung, keine Drogen oder Alkohol im Blut Ihres Sohnes. Er verstarb nach einem Genickbruch, fünf Stunden bevor Sie ihn gefunden haben. Zumindest ist dies die vorläufige Einschätzung, bis er zur Obduktion kommt. Laut Aussage von Miss Greene brauchte sie fünfzehn Sekunden, um auf das Klopfen zu reagieren. Also haben wir einen Mörder – oder mehrere Mörder –, der Ihren Sohn umbringt, ihn fesselt – nicht unbedingt in dieser Reihenfolge – und Ihnen vor die Haustür legt, wobei die Totenstarre bereits eingesetzt hat; der an Ihrer Tür klingelt; sich wieder in den Town Car setzt und es schafft, mehrere Häuserblocks weit zu fahren, ehe Sie sich selbst an die Verfolgung machen konnten. Wie konnte der Mörder – oder die Mörder – derart schnell agieren?«
»Das Verbrechen wurde fehlerfrei geplant und ausgeführt.«
»Nun, das mag sein, aber könnte es nicht sein, dass Sie unter Schock standen – was angesichts der Umstände völlig verständlich wäre –, und nicht so schnell reagierten, wie Sie in Ihrer Aussage angedeutet haben?«
»Nein.«
Angler dachte über die knappe Antwort nach. Er blickte zu Sergeant Slade, der wie üblich so reglos wie ein Buddha dasaß, und dann wieder zu Pendergast. »Dann hätten wir da noch den, ähm, dramatischen Charakter der Straftat selbst. Mit Seilen gefesselt, Ihnen vor die Tür gelegt – das hat durchaus gewisse Merkmale eines Bandenmords. Was mich zu meinen wesentlichen Fragestellungen bringt, und wieder bitte ich um Entschuldigung, dass einige Fragen aufdringlich oder beleidigend wirken. War Ihr Sohn in irgendwelche Bandenaktivitäten verstrickt?«
Agent Pendergast erwiderte Anglers Blick mit dem gleichen ausdruckslosen, undeutbaren Gesichtsausdruck. »Ich habe keine Ahnung, in was mein Sohn verwickelt war. Wie ich in meiner Aussage angedeutet habe, hatten mein Sohn und ich uns voneinander entfremdet.«
Angler schlug eine Seite in dem Bericht um. »Die Spurensicherung und mein eigenes Team haben den Tatort genau in Augenschein genommen. Der Tatort war insofern bemerkenswert, da sich dort keinerlei offensichtliche Beweise befanden. Wir haben keine Fingerabdrücke gefunden, weder ganze noch partielle, abgesehen von denen Ihres Sohnes. Keine Haare, keine Fasern, wiederum abgesehen von denen Ihres Sohnes. Seine Kleidung war brandneu und von der einfachsten Art, obendrein war sein Leichnam sorgfältig gewaschen und angekleidet worden. Wir haben auf der Schnellstraße keine Patronenhülse gefunden, da die Schüsse aus dem Fahrzeug heraus abgefeuert wurden. Kurz: Die Täter waren mit den Ermittlungstechniken eines Tatorts vertraut und haben außergewöhnlich sorgfältig darauf geachtet, keinerlei Spuren zu hinterlassen. Sie wussten genau, was sie taten. Ich bin neugierig, Agent Pendergast: Wie erklären Sie sich etwas Derartiges aus Ihrer Sicht als Bundespolizist?«
»Auch hier möchte ich lediglich wiederholen, dass es sich offensichtlich um ein minutiös geplantes Verbrechen handelt.«
»Dass der Leichnam vor Ihrer Haustür abgelegt wurde, deutet darauf hin, dass die Täter Ihnen eine Botschaft senden wollten. Irgendeine Idee, wie diese Botschaft lauten könnte?«
»Ich sehe mich außerstande, hierüber zu spekulieren.«
Außerstande, hierüber zu spekulieren. Angler musterte Agent Pendergast. Er hatte schon viele Eltern befragt, die nach dem Verlust ihres Kindes niedergeschmettert waren. Es war gar nicht ungewöhnlich, dass die Hinterbliebenen wie betäubt waren, unter Schock standen. Ihre Antworten auf seine Fragen waren oftmals zögernd, unzusammenhängend, unvollständig. Aber Pendergast war ganz anders. Er war offenkundig im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte. Es war, als ob er gar nicht kooperieren wollte oder keinerlei Interesse daran hätte.
»Dann lassen Sie uns über das, ähm, Geheimnis Ihres Sohnes sprechen«, sagte Angler. »Der einzige Beweis, dass er tatsächlich Ihr Sohn ist, ist Ihre diesbezügliche Aussage. Er befindet sich in keiner der Datenbanken der Strafverfolgungsbehörden, in denen wir nachgeschaut haben, weder in der CODIS noch der IAFIS oder der NCIC. Wir haben keine Erfassung seiner Geburt gefunden, keinen Führerschein, keine Sozialversicherungsnummer, keinen Reisepass, keinen Bildungsgang und kein Einreisevisum in dieses Land. Er hatte nichts in den Taschen. Vorbehaltlich des DNA-Abgleichs mit unserer Datenbank scheint es nach allem, was wir erfahren haben, so zu sein, dass Ihr Sohn im Grunde nie existiert hat. In Ihrer Aussage haben Sie zu Protokoll gegeben, dass er in Brasilien geboren und kein US-Staatsbürger sei. Aber er ist auch kein brasilianischer Staatsbürger, denn er ist in diesem Land nirgendwo erfasst. Die Stadt, von der Sie sprachen, scheint nicht zu existieren, zumindest offiziell. Es gibt keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass er Brasilien verlassen oder in die USA eingereist ist. Wie erklären Sie sich das alles?«
Agent Pendergast schlug langsam ein Bein über das andere. »Das kann ich nicht erklären. Wie ich bereits in meiner Aussage erwähnt habe, ist mir die Existenz meines Sohnes – beziehungsweise der Umstand, dass ich einen Sohn habe – erst vor anderthalb Jahren zur Kenntnis gelangt.«
»Und sind Sie ihm damals begegnet?«
»Ja.«
»Wo?«
»Im brasilianischen Dschungel.«
»Und seither?«
»Habe ich ihn weder gesehen noch mit ihm kommuniziert.«
»Wieso nicht? Warum haben Sie denn nicht den Kontakt mit ihm gesucht?«
»Wie gesagt, wir hatten uns voneinander entfremdet.«
»Weshalb genau kam es zu dieser gegenseitigen Entfremdung?«
»Weil unsere Persönlichkeiten unvereinbar waren.«
»Können Sie etwas zu seinem Charakter sagen?«
»Ich habe ihn kaum gekannt. Er hat Gefallen an bösartigen Spielchen gefunden. Er verstand sich wie kein anderer darauf, Menschen zu verhöhnen und zu demütigen.«
Angler holte tief Luft. Diese Nicht-Antworten gingen ihm allmählich auf die Nerven. »Und seine Mutter?«
»Meiner Aussage ist zu entnehmen, dass sie kurz nach seiner Geburt verstorben ist, in Afrika.«
»Richtig. Der Jagdunfall.« Auch an dieser Sache stimmte irgendetwas nicht, aber er konnte sich ja nicht mit allen Absurditäten gleichzeitig befassen. »Kann es sein, dass Ihr Sohn in irgendwelchen Schwierigkeiten steckte?«
»Daran habe ich keinerlei Zweifel.«
»Was für Schwierigkeiten?«
»Ich habe keine Ahnung. Er besaß die herausragende Fähigkeit, auch mit den größten Schwierigkeiten fertigzuwerden.«
»Woher wissen Sie, dass er in Schwierigkeiten steckte, ohne zu wissen, von welcher Art diese waren?«
»Weil er ausgeprägte kriminelle Neigungen besaß.«
Das Gespräch drehte sich im Kreis. Angler hatte das unabweisbare Gefühl, dass Pendergast nicht nur kein Interesse daran hatte, der New Yorker Polizei dabei zu helfen, den Mörder seines Sohnes zu fassen, sondern vermutlich auch noch Informationen zurückhielt. Aber warum tat er das? Es gab keine Garantie, dass es sich bei der Leiche um Pendergasts Sohn handelte. Sicher, es bestand eine bewerkenswerte Ähnlichkeit. Aber nur Pendergast hatte ihn identifiziert. Es wäre interessant zu sehen, ob die DNA des Opfers in der Datenbank irgendwelche Treffer ergab. Außerdem wäre es einfach, seine DNA mit Pendergasts abzugleichen – die ja, da er FBI-Agent war, bereits gespeichert war.
»Agent Pendergast«, sagte Angler in kühlem Tonfall. »Ich muss Sie noch einmal fragen: Haben Sie eine Ahnung, eine Vermutung, irgendeinen Anhaltspunkt hinsichtlich der Frage, wer Ihren Sohn ermordet hat? Irgendwelche Informationen über die Umstände, die möglicherweise zu seinem Tod geführt haben? Irgendeinen Hinweis darauf, warum sein Leichnam vor Ihrer Tür abgelegt worden ist?«
»Dem, was in meiner Aussage steht, habe ich nichts hinzuzufügen.«
Angler schob den Ermittlungsbericht von sich weg. Aber das hier war erst die erste Runde. Er war noch lange nicht fertig mit diesem Mann. »Ich weiß nicht, was merkwürdiger ist, die genauen Umstände des Mordes, Ihre Nicht-Reaktion darauf oder der Nicht-Hintergrund Ihres Sohnes.«
Pendergast verzog keine Miene und sagte: »O schöne neue Welt, die solche Bürger trägt.«
»Sie ist dir neu«, gab Angler zurück.
Woraufhin Pendergast zum ersten Mal überhaupt Interesse an dem Gespräch zeigte. Seine Augen weiteten sich ganz leicht, und er schaute den Detective mit einer Art Neugier an.
Angler beugte sich vor und setzte die Ellbogen auf den Schreibtisch. »Ich denke, das wär’s einstweilen, Agent Pendergast. Lassen Sie mich daher zum Abschluss einfach Folgendes sagen: Es mag ja sein, dass Sie nicht wollen, dass der Fall aufgeklärt wird. Aber er wird gelöst werden, und ich bin der Mann, der das bewerkstelligt. Ich werde in dem Fall so weit ermitteln, wie er mich führt, wenn nötig, bis vor die Tür eines gewissen unkooperativen FBI-Agenten. Haben wir uns verstanden?«
»Ich habe nichts anderes erwartet.« Pendergast stand auf, nickte Slade zu, zog die Tür auf und verließ das Büro, ohne ein weiteres Wort zu sagen.
Zurück am Riverside Drive, schritt Pendergast zielstrebig durch die Eingangshalle in die Bibliothek. Dort ging er zu den hohen Bücherregalen mit den in Leder gebundenen Büchern und zog ein Holzpaneel so beiseite, dass ein Laptop-Computer zum Vorschein kam. Indem er schnell tippte und, wenn nötig, Passwörter eingab, verschaffte er sich zuerst Zugang zu den Servern der New Yorker Polizei mit den Ermittlungsakten und dann zur Datenbank mit den ungelösten Mordfällen. Er notierte sich bestimmte Aktenzeichen und öffnete sodann die DNA-Datenbank des Morddezernats, in der er schnell die gerichtsmedizinischen Untersuchungsergebnisse zu den DNA-Proben des mutmaßlichen Hotel-Mörders fand, der die Stadt vor eineinhalb Jahren in Angst und Schrecken versetzt hatte.
Obwohl Pendergast sich als autorisierter Nutzer eingeloggt hatte, waren die Daten gesperrt und durften weder verändert noch gelöscht werden.
Einen Moment lang blickte er auf den Bildschirm. Dann zog er sein Handy aus der Tasche und wählte eine Fernwahlnummer in River Pointe in Ohio. Beim ersten Klingeln nahm jemand ab.
»Na«, tat die leise, atemlose Stimme kund. »Wenn das mal nicht mein Lieblings-Geheimdienstagent-Mann ist.«
»Hallo, Mime«, antwortete Pendergast.
»Wie kann ich Ihnen heute behilflich sein?«
»Ein paar Eintragungen müssen aus der Datenbank der Polizei New York entfernt werden. Unauffällig und ohne Spuren zu hinterlassen.«
»Ich freue mich immer, wenn ich den Jungs in Blau eins auswischen kann. Sagen Sie mal, hat die Sache irgendetwas mit der – wie war noch gleich der Name? – Operation Wildfire zu tun?«
Pendergast hielt inne. »Ja. Aber bitte, Mime, keine weiteren Fragen.«
»Sie können mir nicht vorwerfen, neugierig zu sein. Aber was soll’s. Haben Sie die erforderlichen Aktenzeichen?«
»Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie bereit sind.«
»Ich bin jetzt bereit.«
Langsam und deutlich, den Blick auf den Bildschirm gerichtet, Finger auf dem Touchpad des Laptops, begann Pendergast die Aktenzeichen aufzusagen.
4
Es war halb sieben am selben Abend, als Pendergasts Mobiltelefon klingelte. Auf dem Display erschien UNBEKANNTE NUMMER.
»Special Agent Pendergast?« Kein Name, die Stimme monoton und trotzdem vertraut.
»Ja.«
»Ich bin Ihr Freund in der Not.«
»Ich höre.«
Ein kurzes, ironisches Lachen. »Wir sind uns schon mal begegnet. Ich bin zu Ihnen nach Hause gekommen. Wir sind unter der George-Washington-Brücke hindurchgefahren. Ich habe Ihnen eine Akte gegeben, wenn Sie sich erinnern.«
»Natürlich. Betreffend Locke Bullard. Sie sind der Gentleman, der bei der …« Pendergast stockte, ehe er die Arbeitsstelle des Mannes erwähnte.
»Ja. Es wäre allerdings klug, wenn Sie diese ärgerlichen Akronyme für Regierungsbehörden aus ungeschützten Handygesprächen heraushalten würden.«
»Was kann ich für Sie tun?«, fragte Pendergast.
»Sie sollten stattdessen fragen: Was kann ich für Sie tun?«
»Wieso glauben Sie, dass ich Hilfe benötige?«
»Zwei Worte: Operation Wildfire.«
»Verstehe. Wo wollen wir uns treffen?«
»Kennen Sie den FBI-Schießstand in der Zweiundzwanzigsten Straße?«
»Natürlich.«
»In einer halben Stunde. Schießstand sechzehn.« Der Mann legte auf.
Pendergast trat durch die doppelflügelige Tür des langgestreckten Flachbaus an der Ecke Zweiundzwanzigste Straße und Eighth Avenue, zeigte der Frau an der Sicherheitsschleuse seinen FBI-Dienstausweis, stieg eine kurze Treppe hinunter, hielt dem Leiter seinen Ausweis hin, nahm sich mehrere Papierziele und einen Gehörschutz und betrat den eigentlichen Schießstand. Er ging den vorderen Abschnitt entlang, vorbei an Agenten, Auszubildenden und Schusswaffen-Instruktoren, bis zur Schießbucht 16. Alle zwei Schießbuchten gab es Schallschutzwände, und Pendergast fiel auf, dass sowohl Bucht 16 als auch die daneben gelegene 17 unbesetzt waren. Die Schusssalven aus den anderen Buchten wurden von den Schallwänden nur teilweise gedämpft, deshalb setzte Pendergast – der immer geräuschempfindlich war – den Gehörschutz auf.
Als er vier leere Magazine und eine Schachtel Munition auf der kleinen Ablagefläche vor sich auslegte, spürte er, wie jemand in die Bucht kam. Ein großgewachsener, schlanker Mann mittleren Alters in grauem Anzug, mit tiefliegenden Augen und einem Gesicht, das für sein Alter schon recht faltig war. Pendergast erkannte ihn sofort. Vielleicht war das Haar etwas dünner als bei der einzigen vorherigen Begegnung – vor ungefähr vier Jahren –, aber in jeder anderen Hinsicht sah er unverändert aus, unauffällig, immer noch umgeben von einer Aura leichter Anonymität. Er gehörte zu jenen Menschen, von denen man, wenn man ihnen auf der Straße begegnete, schon Augenblicke später keine Beschreibung mehr liefern konnte.
Der Mann erwiderte Pendergasts Blick nicht, sondern zog stattdessen eine Sig Sauer P229 aus dem Sakko und legte sie auf die Ablage von Bucht 17. Er setzte keinen Gehörschutz auf und machte mit einer diskreten Geste – immer noch nicht in Pendergasts Richtung blickend – deutlich, dass der Agent seinen abnehmen sollte.
»Interessante Wahl des Ortes«, sagte Pendergast und blickte den Schießstand hinunter. »Sehr viel öffentlicher als ein Wagen unter der Zufahrt zur George Washington Bridge.«
»Gerade weil der Ort so öffentlich ist, ist er besonders anonym. Nur zwei Feds, die in einem Schießstand üben. Keine Handys, die man anzapfen, keine Nachrichten von Funkmikros, die man aufzeichnen kann. Und natürlich, bei all dem Lärm, keine Chance, dass man belauscht wird.«
»Der Leiter dürfte sich an das Auftauchen eines CIA-Agenten im FBI-Schießstand erinnern – besonders weil ihr normalerweise keine verdeckten Schusswaffen tragt.«
»Ich habe alternative Identitäten. Er wird sich an nichts Besonderes erinnern.«
Pendergast öffnete die Munitionsschachtel und begann, die Magazine zu laden.
»Mir gefällt Ihre maßangefertigte 1911er«, sagte der Mann mit einem Blick auf Pendergasts Waffe. »Les Baer Thunder Ranch Special? Hübsche Kanone.«
»Vielleicht möchten Sie mir mitteilen, warum Sie hier sind.«
»Ich habe Sie ein wenig im Auge behalten seit unserem ersten Treffen«, erwiderte der Mann, immer noch ohne Augenkontakt herzustellen. »Als ich von Ihrer Beteiligung an der Anbahnung von Wildfire erfuhr, war mein Interesse geweckt. Eine unauffällige, aber aufwendige Überwachungsoperation seitens gewisser Angehöriger des FBI und der CIA, zur Feststellung des Aufenthaltsorts eines Jugendlichen, der sich Alban nennt oder auch nicht, sich vielleicht in Brasilien oder angrenzenden Ländern aufhält oder auch nicht, fließend Portugiesisch, Englisch und Deutsch spricht und vor allem als außergewöhnlich befähigt und äußerst gefährlich eingeschätzt wird.«
Statt zu antworten, klippte Pendergast ein Ziel – eine herkömmliche Zielscheibe mit einem roten X in der Mitte – an das Laufband, drückte den HINAUS-Knopf zu seiner Linken und beförderte die Zielscheibe auf die Höchstentfernung von 25 Metern. Der Mann neben ihm klippte eine FBI-Zielscheibe an – eine graue, flaschenähnliche Gestalt ohne Skalierungen oder Markierungen – und beförderte sie bis zum Ende von Bucht 17.
»Und gerade heute kommt mir ein Bericht der New Yorker Polizei zu Ohren, in dem Sie aussagen, dass Ihr Sohn, ebenfalls Alban mit Namen, vor Ihrer Haustür abgelegt worden sei, tot.«
»Reden Sie weiter.«
»Ich glaube nicht an Zufälle. Daher dieses Treffen.«
Pendergast griff nach einem der Magazine und lud seine Waffe. »Bitte halten Sie mich nicht für unhöflich, wenn ich Sie bitte, zum Thema zu kommen.«
»Ich kann Ihnen helfen. Sie haben im Fall Locke Bullard Wort gehalten und mir eine Menge Ärger erspart. Ich glaube daran, dass man sich erkenntlich zeigen soll. Und wie schon gesagt, ich habe Sie im Auge behalten. Sie sind ein ziemlich interessanter Mann. Es ist durchaus möglich, dass Sie mir behilflich sein könnten, irgendwann später mal. Eine Partnerschaft, wenn Sie so wollen. Ich würde das gern fest vereinbaren.«
Pendergast erwiderte nichts darauf.
»Sicher wissen Sie, dass Sie mir vertrauen können«, sagte der Mann durch den gedämpften, jedoch allgegenwärtigen Klang der Schüsse. »Ich bin verschwiegen wie ein Grab – wie Sie auch. Jede Information, die Sie mir liefern, bleibt unter uns. Ich verfüge über Ressourcen, an die Sie ohne mich nicht herankommen würden.«
Nach einem Moment nickte Pendergast. »Ich nehme Ihr Angebot an. Was die Hintergrundinformationen betrifft: Ich habe zwei Söhne, Zwillinge, von deren Existenz ich erst vor anderthalb Jahren erfahren habe. Einer dieser Söhne – Alban – ist beziehungsweise war ein soziopathischer Mörder von der sehr gefährlichen Sorte. Er ist der sogenannte Hotel-Mörder, ein Fall, den die New Yorker Polizei immer noch nicht gelöst hat. Ich wünsche, dass das so bleibt, und habe Maßnahmen ergriffen, dass sich nichts daran ändert. Kurz nachdem ich von seiner Existenz Kenntnis erhielt, ist er im brasilianischen Urwald untergetaucht und wurde erst wieder gesehen, als er gestern Abend vor meiner Haustür auftauchte. Ich habe immer geglaubt, dass er eines Tages auftauchen und dass das katastrophale Folgen haben würde. Darum habe ich Operation Wildfire eingeleitet.«
»Aber Wildfire hat keinerlei Erfolge gebracht.«
»Richtig.«
Der namenlose Mann lud seine Waffe, schob eine Patrone in die Kammer, zielte mit beiden Händen und feuerte das komplette Magazin in die FBI-Schulungs-Schießscheibe ab. Jeder Schuss traf die graue flaschenförmige Fläche. Der Klang war ohrenbetäubend in dem schallgedämmten Raum.
»Bis gestern. Wer hat davon gewusst, dass Alban Ihr Sohn ist?«, fragte der Mann, während er das Magazin auswarf.
»Nur eine Handvoll Leute – die meisten gehören zur Familie oder zum Hauspersonal.«
»Und trotzdem hat jemand Alban nicht nur ausfindig gemacht und arretiert, sondern es auch geschafft, ihn zu ermorden, vor Ihrer Haustür zu deponieren und dann praktisch unentdeckt zu entkommen.«
Pendergast nickte.
»Kurz: Unser Täter war in der Lage, wozu das FBI und die CIA nicht imstande waren, und noch sehr viel mehr.«
»Genau. Der Täter verfügt über bedeutende Fähigkeiten. Es kann durchaus sein, dass er bei den Strafverfolgungsbehörden tätig ist. Weswegen ich kein Vertrauen darin habe, dass das NYPD in diesem Fall irgendwelche Fortschritte erzielen wird.«
»Angler ist ein guter Polizist, wie ich höre.«
»Aber das ist ja das Problem. Er ist gerade so gut, dass er für meine Bemühungen, den Mörder zu finden, ein massives Hindernis darstellt. Es wäre besser, er wäre unfähig.«
»Und das ist der Grund, warum Sie so wenig hilfreich waren?«
Pendergast schwieg.
»Sie haben keine Ahnung, warum Alban ermordet wurde oder welche Botschaft die Täter Ihnen zukommen lassen wollten?«
»Das ist ja das Grauenvolle daran. Ich habe absolut keine Ahnung, weder was die Nachricht noch was ihren Überbringer angeht.«
»Und Ihr anderer Sohn?«
»Ich habe arrangiert, dass er im Ausland in Schutzhaft lebt.«
Wieder schob der Mann ein Magazin in seine Sig, löste den Verschluss, schoss das Magazin leer und drückte den Knopf, um die Zielscheibe zurückzuholen. »Und was denken Sie? Über den Mord an Ihrem Sohn, meine ich.«
Pendergast schwieg lange. »Im Jargon des Tages würde die treffende Antwort wohl lauten: Ich bin da im Konflikt. Er ist tot. Das ist ein gutes Ergebnis. Andererseits … war er mein Sohn.«
»Was sind Ihre Pläne, wenn – oder falls – Sie den Verantwortlichen finden?«
Wieder gab Pendergast keine Antwort. Stattdessen hob er die Les Baer mit der rechten Hand und legte die linke auf den Rücken in lockerer Schusshaltung. Rasch, Schuss um sorgfältigen Schuss, leerte er die Waffe ins Ziel, dann wechselte er blitzschnell das Magazin, legte die Pistole in die Linke, wandte sich erneut dem Ziel zu und feuerte, diesmal von der anderen Seite und viel schneller, alle sieben Schuss ab. Dann betätigte er den ZURÜCK-Knopf an der Schallschutzwand, um die Zielscheibe zurückzuholen.
Der CIA-Beamte warf einen kurzen Blick darauf. »Sie haben das Schwarze total durchlöchert. Einhändig, und dazu noch in lockerer Stellung sowie unter Einsatz Ihrer starken und Ihrer schwachen Hand.« Er hielt inne. »War das die Antwort auf meine Frage?«
»Ich habe nur den Augenblick genutzt, um meine Fertigkeiten zu vervollkommnen.«
»Sie müssen Ihre Fertigkeiten nicht vervollkommnen. Aber egal, ich setze meine Leute sofort darauf an. Sobald ich etwas herausgefunden habe, gebe ich Ihnen Bescheid.«
»Vielen Dank.«
Der Agent nickte. Dann setzte er den Gehörschutz auf, legte die Sig zur Seite und begann, seine Magazine wieder aufzufüllen.
5
Lieutenant Vincent D’Agosta stieg die breite Granittreppe zum Haupteingang des New York Museum of Natural History hinauf. Im mittäglichen Licht warf er einen Blick auf die mächtige Beaux-Art-Fassade – vier Häuserblocks lang, im herrschaftlichen römischen Stil errichtet. Das Gebäude weckte in ihm sehr unschöne Erinnerungen, und es kam ihm wie eine üble Laune des Schicksals vor, dass er es wieder betreten musste, ausgerechnet jetzt.
Erst am Vorabend war er von den schönsten zwei Wochen seines Lebens zurückgekehrt, den Flitterwochen mit seiner frisch Angetrauten, Laura Hayward, im Turtle Bay Resort am berühmten Nordstrand von Oahu. Sie hatten sich die Zeit mit Sonnenbaden, langen Spaziergängen am makellosen Strand, Schnorcheln in der Kuilima-Bucht und, natürlich, mit weiterem Kennenlernen vertrieben. Es war buchstäblich paradiesisch gewesen.
Deshalb war es ein übler Schock gewesen, als er am Morgen – und auch noch an einem Sonntag – wieder zur Arbeit erschien und feststellte, dass er als leitender Detective einen Mord an einem Techniker in der Osteologie-Abteilung des Museums zugeteilt bekommen hatte. Nicht nur hatte man ihm einen Fall aufgebürdet, kaum dass er aus dem Urlaub zurückgekehrt war, sondern er musste die Ermittlungen auch noch in einem Gebäude durchführen, von dem er sich wirklich, wirklich gewünscht hätte, es nie wieder zu betreten.
Dennoch war er entschlossen, den Fall zu lösen und den Täter vor Gericht zu bringen. Denn das hier war genau die Art von Bullshit-Mord, der New York in Verruf brachte – ein wahlloser, sinnloser, gemeiner Mord an irgendeinem armen Kerl, der sich zufällig zur falschen Zeit am falschen Ort befunden hatte.
Er hielt inne und atmete durch. Verdammt, er musste Diät halten nach den vergangenen zwei Wochen voller poi, kalua pig, opihi, haupia und Bier. Nach einem Moment stieg er die Treppe weiter hoch und schritt durch den Eingang in die riesige Große Rotunde. Hier blieb er wieder stehen, holte sein iPad aus der Tasche und frischte seine Kenntnisse über die Details des Falls auf. Der Mord war spät am gestrigen Abend entdeckt worden. Alle Anfangsarbeiten am Tatort waren beendet worden. D’Agostas erste Aufgabe bestand nun darin, den Sicherheitsbeamten, der die Leiche gefunden hatte, noch einmal zu befragen. Anschließend hatte er einen Termin beim PR-Manager, der sich – so wie D’Agosta das Museum kannte – mehr dafür interessieren würde, die schlechte Presse zu neutralisieren, als dafür, den Fall aufzuklären. Noch ein halbes Dutzend andere Namen befanden sich auf seiner Liste mit Personen, die er zu befragen hatte.
Er zeigte einem der Sicherheitsleute seinen Ausweis, trug sich als Besucher ein und erhielt einen Interimsausweis. Dann machte er sich auf, ging durch die große, hallende Eingangshalle, vorbei an den Dinosauriern, vorbei an einem weiteren Kontrollpunkt, durch eine nicht gekennzeichnete Tür und durch eine Reihe labyrinthischer Korridore hinunter zum Zentralbüro der Security – ein Weg, an den er sich nur allzu gut erinnerte. Im Wartebereich saß ein uniformierter Wachmann, allein. Als D’Agosta eintrat, sprang er auf.
»Mark Whittaker?«, fragte D’Agosta.
Der Mann nickte hastig. Er war klein – knapp einen Meter sechzig – und rundlich, hatte braune Augen und schütteres blondes Haar.
»Lieutenant D’Agosta, Mordkommission. Ich weiß, Sie haben das alles schon einmal beantwortet, ich werde mich deshalb bemühen, nicht mehr von Ihrer Zeit zu beanspruchen als unbedingt nötig.« Er schüttelte dem Mann die schlaffe, schwitzige Hand. Seiner Erfahrung nach gab es unter privaten Sicherheitsleuten zwei Typen – Möchtegern-Cops, reizbar und streitsüchtig, oder freundlich gestimmte Türsteher, eingeschüchtert und verängstigt, wenn sie’s mit einem richtigen Cop zu tun bekamen. Mark Whittaker gehörte definitiv zur zweiten Gattung.
»Können wir uns am Tatort unterhalten?«
»Sicher, ja, natürlich.« Whittaker war beflissen, wollte es ihm recht machen.
D’Agosta legte erneut eine längere Strecke zurück, während er Whittaker aus den Tiefen des Museums wieder in die öffentlichen Bereiche folgte. Während sie über die verwinkelten Korridore schritten, konnte er nicht anders, als sich die Exponate anzuschauen. Es war Jahre her, seit er einen Fuß in das Museum gesetzt hatte, aber es schien sich nicht viel verändert zu haben. Sie gingen durch den dunklen, zwei Stockwerke hohen Saal »Afrika«, vorbei an einer Herde Elefanten, von dort in den Saal »Afrikanische Völker«, die Säle »Mexiko« und »Mittelamerika«, »Südamerika«, Saal um hallenden Saal voller Vögel, Gold, Töpferwaren, Skulpturen, Textilien, Speere, Kleidung, Masken, Skelette, Affen … D’Agosta merkte, dass er schnaufte, und fragte sich, wieso er mit diesem kleinen dicken Sicherheitsmann kaum mithalten konnte.
Sie gelangten in den Saal »Meeresflora und -fauna«, und schließlich blieb Whittaker vor einer der entlegeneren kleinen Nischen stehen, die mit gelbem Tatortband abgesperrt war. Ein Museumswärter stand vor dem Absperrband.
»Bauchfüßler«, las D’Agosta die Bezeichnung von einem Messingschild ab, das neben dem Eingang hing.
Whittaker nickte.
D’Agosta zeigte dem Wärter seinen Ausweis, beugte sich unter das Absperrband und bedeutete Whittaker, ihm zu folgen. Der Raum dahinter war dunkel, die Luft stickig. Vor den drei Wänden der Nische standen Glasvitrinen, vollgestopft mit Gehäusen aller Größen und Formen, von Nadelschnecken über Klaffmuscheln bis zu Wellhornschnecken. Vor den Vitrinen standen hüfthohe Schaukästen, voll mit weiteren Schneckengehäusen. D’Agosta schnüffelte. Das hier musste der am wenigsten besuchte Raum im ganzen verdammten Museum sein. Als sein Blick auf eine Königinnenmuschel fiel, rosafarben und glänzend, fühlte er sich einen Moment lang zurückversetzt an einen ganz besonderen Abend am Nordstrand von Hawaii, der Sand immer noch warm von der gerade untergegangenen Sonne. Laura lag neben ihm, die schaumige Brandung ringelte sich um ihre Füße …
Seufzend holte er sich in die Gegenwart zurück und warf einen Blick unter eine der Vitrinen, wo ein mit Kreide gezeichneter Umriss und mehrere kleine Beweisschilder zu sehen waren, darum ein langes Rinnsal getrockneten Bluts. »Wann haben Sie den Leichnam gefunden?«
»Samstagabend. So gegen zehn nach elf.«
»Und wann haben Sie Ihren Dienst angetreten?«
»Um acht.«
»Dieser Saal ist Teil Ihrer normalen Schicht?«
Whittaker nickte.
»Wann schließt das Museum samstags?«
»Um sechs.«
»Wie oft patrouillieren Sie in diesem Saal außerhalb der Öffnungszeiten?«
»Das ist unterschiedlich. Die Runden dauern so zwischen einer halben und einer Dreiviertelstunde. Ich habe eine Karte, die ich an verschiedenen Stellen durchziehen muss. Die Museumsleitung möchte nicht, dass wir unsere Runden nach einem festen Zeitplan drehen.« Aus der Hosentasche zog D’Agosta einen Übersichtsplan des Museums, den er sich bei seiner Ankunft mitgenommen hatte. »Könnten Sie darauf Ihre Patrouillen, oder wie immer Sie das nennen, einzeichnen?«
»Na klar.« Whittaker kramte einen Stift aus der Hosentasche und zeichnete auf dem Museumsplan eine geschlängelte Linie ein, die durch einen Großteil dieses Stockwerks führte. Er reichte D’Agosta den Plan zurück.
Der schaute ihn sich genauer an. »Sieht nicht so aus, als würden Sie normalerweise in diese besondere Nische gehen.«
Whittaker hielt kurz inne, als handelte es sich um eine Fangfrage. »Normalerweise nicht. Ich meine, sie ist eine Sackgasse. Ich gehe daran vorbei.«
»Wieso haben Sie dann gestern Abend um dreiundzwanzig Uhr in die Nische geschaut?«
Whittaker tupfte sich die Stirn. »Das Blut hatte sich auf dem Fußboden ausgebreitet. Als ich mit meiner Taschenlampe herumgeleuchtet habe, ist der Lichtstrahl darauf gefallen.«
D’Agosta erinnerte sich an das Blut, das er auf den digitalen Fotos gesehen hatte. Die Rekonstruktion des Verbrechens ließ vermuten, dass dem Opfer, einem älteren Techniker namens Victor Marsala, in dieser entlegenen Nische mit einem stumpfen Instrument auf den Kopf geschlagen und die Leiche unter die Vitrine geschoben worden war. Uhr, Portemonnaie und Kleingeld fehlten.
D’Agosta konsultierte sein Tablet. »Irgendwelche besonderen Vorkommnisse gestern Abend?«
»Nein.«
»Keine Pyjama-Party, private Feier, Filmvorführung, Führung außerhalb der Öffnungszeiten. Solche Sachen?«
»Nichts.«
D’Agosta wusste zwar schon das meiste, redete mit Zeugen aber gern über bereits bekannte Aspekte, für den Fall der Fälle. Im Bericht des Coroners stand, dass der Tod wohl um halb elf eingetreten war. »Ist Ihnen in den vierzig Minuten vor der Entdeckung des Leichnams irgendjemand oder irgendetwas Ungewöhnliches aufgefallen? Ein Tourist, der sich nach der Öffnungszeit noch im Haus befand und behauptete, sich verlaufen zu haben? Ein Museumsangestellter außerhalb seines gewöhnlichen Arbeitsbereichs?«
»Ich habe nichts Merkwürdiges bemerkt. Nur die üblichen Wissenschaftler und Kuratoren, die noch spätabends arbeiten.«
»Und in diesem Saal?«
»War niemand.«
D’Agosta nickte vorbei an der Nische in Richtung einer unauffälligen Tür in der gegenüberliegenden Wand mit dem roten EXIT-Schild darüber. »Wo führt die hin?«
Whittaker zuckte mit den Achseln. »Nur ins Untergeschoss.«
D’Agosta überlegte. Der Saal mit dem Gold Südamerikas lag nicht weit entfernt, aber dort war nichts angerührt, gestohlen oder durcheinandergebracht worden. Durchaus möglich, dass Marsala auf seinem Weg nach draußen, nachdem er einen spätabendlichen Arbeitsauftrag erledigt hatte, einen Obdachlosen gestört hatte, der in diesem verlassenen Winkel des Museums ein Nickerchen hielt, aber D’Agosta bezweifelte, dass die Geschichte überhaupt so exotisch war. Ungewöhnlich an dem Fall war allerdings, dass es dem Mörder offenbar gelungen war, das Museum unbemerkt zu verlassen. Der einzige Weg nach draußen zu der Zeit am Abend führte durch einen schwer bewachten Kontrollpunkt im Erdgeschoss. War der Mörder ein Museumsangestellter? D’Agosta besaß eine überraschend lange Liste mit allen, die gestern Abend noch gearbeitet hatten. Andererseits war das Museum riesig, die Mitarbeiterzahl ging in die Tausende.
Er stellte Whittaker noch eine paar weitere nebensächliche Fragen und dankte ihm schließlich. »Ich möchte mich noch etwas umsehen, gehen Sie ruhig schon allein zurück.«
In den folgenden zwanzig Minuten durchsuchte er die Nische und die angrenzenden Areale, wobei er sie regelmäßig mit den Tatortfotos auf seinem Tablet verglich. Aber er sah nichts Neues, fand nichts, was anscheinend übersehen worden war.
Seufzend steckte D’Agosta das iPad zurück in seine Aktentasche und machte sich auf zur Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit.
6
Einer Obduktion beizuwohnen, das rangierte auf der Liste der Lieblingsbeschäftigungen Lieutenant Peter Anglers ganz weit unten. Was nicht daran lag, dass er mit dem Anblick von Blut ein Problem hatte. Während seiner fünfzehnjährigen Tätigkeit bei der Polizei hatte er mehr als genug Leichen gesehen – erschossen, erstochen, erschlagen, überfahren, vergiftet, auf dem Bürgersteig plattgemacht, auf den U-Bahn-Gleisen in Stücke gerissen. Von den eigenen Verletzungen ganz zu schweigen. Aber er war auch kein Weichei; ein Dutzend Mal hatte er im Dienst die Waffe gezogen und zweimal benutzt. Er konnte mit gewaltsamen Toden umgehen. Was ihn unsicher machte, das war diese Gefühlskälte, diese klinische Art und Weise, mit der die Leiche systematisch auseinandergenommen wurde, Organ um Organ, wie sie bearbeitet, fotografiert wurde, Kommentare dazu abgegeben, ja darüber Witze gerissen wurden. Das, und natürlich der Geruch. Doch im Laufe der Jahre hatte er sich mit dieser Pflichtaufgabe abgefunden und ging sie inzwischen mit stoischer Gelassenheit an.
Diese Obduktion hatte jedoch etwas Makabres an sich. Angler hatte schon viele erlebt, aber noch nie eine, die vom Vater des Opfers mit Argusaugen überwacht wurde.
Fünf Personen befanden sich im Raum – soll heißen, lebende Personen: Angler; einer der Detectives, Millikin; der forensische Pathologe, der die Obduktion leitete; der Sektionsgehilfe, klein und hutzelig und bucklig wie Quasimodo; und Special Agent Pendergast.
Natürlich war Pendergast nicht in offiziellem Auftrag hier. Als er seine bizarre Anfrage stellte, hatte Angler erwogen, ihm den Zutritt zu verweigern. Der Agent hatte sich schließlich in den bisherigen Ermittlungen als unkooperativ erwiesen. Doch Angler hatte ein bisschen über Pendergast recherchiert und dabei herausgefunden, dass er – obwohl im Bureau für seine unorthodoxen Methoden bekannt – wegen seiner erstaunlichen Erfolgsquote auch gewaltigen Respekt genoss. Angler hatte noch nie eine Personalakte gesehen, die so voll sowohl von Belobigungen als auch Abmahnungen war. Und so war er zum Schluss gekommen, dass es einfach nicht lohnte, den Mann von der Obduktion auszuschließen. Es ging schließlich tatsächlich um seinen Sohn. Außerdem hatte er das ziemlich untrügliche Gefühl, dass Pendergast einen Weg gefunden hätte, anwesend zu sein, gleichgültig, was er, Angler, dazu sagte.
Der Pathologe wusste anscheinend auch über Pendergast Bescheid. Dr. Constantinescu wirkte mehr wie ein freundlicher alter Landarzt und weniger wie ein Rechtsmediziner, und die Anwesenheit des Special Agent hatte ihn aus dem Konzept gebracht. Er war so nervös und ängstlich wie eine Katze im neuen Zuhause. Von Zeit zu Zeit, während er seine medizinischen Beobachtungen in das herabhängende Mikrofon murmelte, hatte er innegehalten, über die Schulter zu Pendergast geblickt und sich dann geräuspert und von neuem begonnen. Für die äußere Untersuchung allein hatte er fast eine Stunde benötigt – bemerkenswert angesichts der fast völligen Abwesenheit von Beweismitteln, die man hätte entdecken, sammeln und bezeichnen können. Das Entkleiden, Fotografieren, Röntgen, das Wiegen, das Testen auf Giftstoffe, das Notieren der besonderen Merkmale und der ganze Rest waren Angler endlos vorgekommen. Es schien, als hätte der Pathologe Angst, auch nur den kleinsten Fehler zu machen, oder als würde es ihm irgendwie widerstreben, mit der Arbeit fortzufahren. Der Gehilfe, der in die Geschichte offenbar nicht eingeweiht war, war ungeduldig, stieg von einem Fuß auf den anderen und ordnete die Instrumente und ordnete sie noch einmal. Die ganze Prozedur hindurch stand Pendergast reglos da, ein wenig hinter den anderen, wobei der Kittel an ihm wie ein Leichenhemd wirkte und seine Blicke von Constantinescu zur Leiche seines Sohnes und zurück wanderten, ohne dass er irgendetwas sagte oder irgendein Gefühl zum Ausdruck brachte.
»Keine offensichtlichen äußeren Verletzungen, Hämatome, Einstichstellen oder sonstige Verletzungen«, sagte der Pathologe jetzt ins Mikrofon. »Die vorläufige äußere Untersuchung sowie die Röntgenbilder deuten darauf hin, dass der Tod durch eine Quetschverletzung der Halswirbel C3 und C4 erfolgte, möglicherweise in Verbindung mit einer lateralen Rotation des Schädels, wodurch die Wirbelsäule durchtrennt und ein spinaler Schock ausgelöst wurde.« Dr. Constantinescu trat vom Mikro zurück, räusperte sich noch einmal. »Wir können nun mit der, ähm, inneren Besichtigung beginnen.«
Noch immer stand Pendergast regungslos da, außer vielleicht, dass er ganz leicht den Kopf neigte. Er war sehr blass, seine Gesichtszüge wirkten so starr, wie Angler das noch nie bei einem Menschen gesehen hatte. Je besser er diesen Pendergast kennenlernte, desto unsympathischer fand er ihn. Der Mann war eine Art Freak.
Angler wandte sein Augenmerk wieder der Leiche zu, die auf dem Tisch lag. Der junge Mann war in ausgezeichneter körperlicher Verfassung gewesen. Während er die geschmeidigen Muskeln, die klassischen Konturen des Leichnams betrachtete, die selbst im Tod noch anmutig wirkten, fielen Angler gewisse Darstellungen von Hektor und Achilles auf antiken Vasenmalereien ein, die der Antiope-Gruppe zugeschrieben wurden.
Wir können jetzt mit der inneren Besichtigung beginnen. Die Leiche würde nicht mehr lange schön sein.
Auf ein Nicken Constantinescus hin holte der Assistent die Stryker-Säge. Der Pathologe schaltete sie ein, führte sie um Albans Kopf – als die Säge in den Knochen schnitt, machte sie dieses winselnde, knirschende Geräusch, das Angler so sehr hasste – und entfernte die Schädeldecke. Das war ungewöhnlich: Anglers Erfahrung nach wurde das Gehirn gewöhnlich als letztes Organ entfernt. Die meisten Obduktionen begannen mit dem üblichen Y-Schnitt. Vielleicht hatte dies mit der Todesursache zu tun: Genickbruch. Aber der wahrscheinlichere Grund dürfte der andere Beobachter im Raum sein. Angler warf Pendergast einen verstohlenen Blick zu. Der Mann wirkte noch blasser, die Gesichtszüge noch verschlossener als ohnehin schon.
Constantinescu untersuchte das Gehirn, nahm es behutsam aus dem Schädel, legte es auf eine Waage und murmelte ein paar weitere Bemerkungen ins Mikro. Er entnahm einige Gewebeproben und reichte sie dem Sektionsgehilfen. Dann sagte er – diesmal ohne den Kopf zu wenden – an Pendergast adressiert: »Agent Pendergast … haben Sie die Absicht, den Leichnam offen im Sarg aufzubahren?«
Einen Augenblick lang herrschte Stille. Schließlich antwortete Pendergast: »Es wird keine Totenfeier und auch keine Beisetzung geben. Sobald die Leiche freigegeben ist, werde ich die notwendigen Vorkehrungen für ihre Einäscherung treffen.« Dabei klang seine Stimme wie eine Messerschneide, die auf Eis kratzt.
»Verstehe.« Constantinescu legte das Gehirn in die Schädelhöhle zurück – und zögerte. »Ehe ich fortfahre, möchte ich Ihnen eine Frage stellen. Die Röntgenaufnahmen zeigen offenbar einen gerundeten Gegenstand im Magen des Verstorbenen. Trotzdem finden sich keine Narben am Körper, die auf verheilte Schusswunden oder chirurgische Eingriffe hindeuten. Wissen Sie von irgendwelchen Implantaten, die der Leichnam haben könnte?«
»Nein«, sagte Pendergast.
»Nun gut.« Constantinescu nickte bedächtig. »Ich mache jetzt den Y-Schnitt.«
Als niemand etwas sagte, nahm der Pathologe die Stryker-Säge erneut zur Hand, machte Einschnitte in der linken und der rechten Schulter und führte die Schnitte nach unten, so dass sie sich am Brustbein trafen. Dann beendete er die Inzision mit einem einzigen geraden Schnitt bis zum Schambereich. Der Gehilfe reichte ihm eine Schere. Constantinescu beendete die Eröffnung des Brustkorbs, hob die durchtrennten Rippen und das Fleisch zur Seite, so dass das Herz und die Lunge zum Vorschein kamen.
Pendergast, der hinter Anglers Schulter stand, rührte sich nicht. Im Raum breitete sich ein gewisser Geruch aus – ein Geruch, den Angler, so wie das Gewinsel der Stryker-Säge, einfach nicht vergessen konnte.
Nacheinander entfernte Constantinescu das Herz und die Lunge, untersuchte beide Organe, legte sie auf die Waage, nahm Gewebeproben, murmelte seine Beobachtungen ins Mikro und legte die Organe in Plastikbeutel, so lange, bis sie während der letzten der Wiederherstellungsphase der Obduktion in die Körperhöhle zurückgelegt werden konnten. Die Leber, die Nieren und anderen größeren Organe wurden auf die gleiche Weise behandelt. Dann widmete sich der Pathologe den Zentralarterien, durchtrennte sie und begutachtete sie schnell. Inzwischen arbeitete er flott, im Gegensatz zu seiner Bummelei bei den vorbereitenden Maßnahmen.
Als Nächstes kam der Magen dran. Nach der Untersuchung und dem Wiegen, dem Fotografieren und der Gewebeentnahme griff Constantinescu nach einem großen Skalpell. Das war der Teil, den Angler wirklich hasste: die Untersuchung des Mageninhalts. Er trat ein wenig zurück vom Leichentisch.
Der Pathologe beugte sich über das Edelstahlbecken, in dem der Magen lag, und befingerte ihn mit seinen behandschuhten Händen, wobei er hin und wieder das Skalpell oder eine Pinzette zum Einsatz brachte und sein Gehilfe sich nahe zu ihm hinunterbeugte. Der Geruch im Raum wurde übler.
Plötzlich ein Geräusch, ein lautes Klirren von etwas Hartem im Edelstahlbehältnis. Der Pathologe atmete hörbar ein. Er murmelte dem Gehilfen etwas zu, der ihm eine frische Pinzette reichte. Constantinescu hielt die Pinzette in das Behältnis, in dem der Magen samt Inhalt lag, hob etwas daraus hervor – etwas Rundes, überzogen mit einer undurchsichtigen Flüssigkeit – und wandte sich zu einem Spülbecken um, in dem er den Gegenstand sorgfältig abspülte. Als er sich wieder umdrehte, sah Angler zu seiner großen Verwunderung, dass es sich bei dem, was die Pinzette hielt, um einen kleinen Stein handelte, unregelmäßig geformt und kaum größer als eine Murmel. Einen dunkelblauen Stein – einen Edelstein.
Aus dem Augenwinkel sah er, dass Pendergast schließlich doch eine Reaktion zeigte.
Constantinescu hielt den Stein in der Pinzette hoch, warf einen Blick darauf, drehte ihn hin und her und murmelte: »Na, was haben wir denn da?«
Er legte den Edelstein in einen Beweismittelbeutel und verschloss ihn. Dabei bemerkte Angler, dass Pendergast neben ihn getreten war und den Stein ungläubig anstarrte. Verschwunden waren der distanzierte, undeutbare Gesichtsausdruck, der ferne Blick. Jetzt lag darin ein so jähes, drängendes Verlangen, dass Angler beinahe zurückgewichen wäre.
»Dieser Stein«, sagte Pendergast. »Ich muss ihn haben.«
Angler meinte, sich verhört zu haben. »Ihn haben? Dieser Stein ist der erste eindeutige Beweis, auf den wir gestoßen sind.«
»Genau. Und eben deshalb muss ich Zugriff darauf haben.«