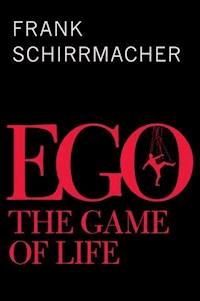6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Karl Blessing Verlag
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Frank Schirrmacher erkundet die Bedeutung von Georg Trakl, Rainer Maria Rilke, Hugo von Hofmannsthal, Stefan George und Gottfried Benn, deren ästhetische Errungenschaften die literarische Moderne prägten und bis heute nachwirken.
"Diese fünf Dichter sind Erscheinungsformen jenes Ausbruchs an Begabung, Energie und eines auf Totalität zielenden Verlangens, der die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts prägte. Sie waren Entdecker, Eroberer, Besitzergreifer - und zwar in einer Vollständigkeit, die noch heute die Kunst zu lähmen scheint. Dergleichen hat es später nie wieder gegeben." Frank Schirrmacher.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 186
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Das Buch
Franz Joseph I. bestieg mit knapp 18 Jahren 1848 den Thron und regierte fast sieben Jahrzehnte. In jedem Klassenzimmer, in jeder Amtsstube hing ein Bild des Kaisers. In den letzten 25 Jahren seines Bestehens brachte die Habsburger Monarchie eine unvergleichliche Fülle von Talenten hervor: zum Beispiel Hugo von Hofmannsthal, der sich mit elegischen Versen wie »Ganz vergessener Völker Müdigkeiten/kann ich nicht abtun von meinen Lidern« den Ruhm eines literarischen Wunderkinds erschrieb. Doch den Modernisierungsschüben, die folgten, konnte er nichts mehr entgegensetzen. Als der Kaiser 1916 starb und der Untergang der Habsburger Monarchie begann, versiegte auch Hofmannsthals Inspiration.
Rainer Maria Rilke stammte aus dem kleinbürgerlichen, mittleren k.u.k.-Beamtentum, weigerte sich, einen Brotberuf zu ergreifen und erlebte den Ausbruch des Ersten Weltkriegs als vermeintliche Befreiung, der schnell Ernüchterung und Sprachlosigkeit folgten. Im November 1917 interessierte er sich lebhaft für die linken revolutionären Bewegungen, sympathisierte mit ihnen. Doch dann stilisierte er sich selbst zu einem Dichter, der »rein« aus den Ruinen »neu« erstanden sei. In seinen Gedichten sollte kein Wort identisch mit den gleich lautenden Konversationsworten sein, es sollte bis in den Kern seiner Natur verändert werden, »unberührbar und bleibend«.
Wie Rilke konnte auch sich auch Stefan George nach dem Ende des Ersten Weltkrieges vorübergehend an dem revolutionären Begehren seiner Umgebung wärmen und messen. Die Gesellschaft, die sich nun entgeistert fragte, warum sie so bereitwillig ihre eigenen Söhne in den Tod geschickt hatte, fand ihren Visionär aber in Georg Trakl. Seine dunklen Bilder schöpften offensichtlich nicht nur aus seinen privaten Traumata – die obsessive Liebe zu seiner Schwester, die Drogenhalluzinationen –, sondern auch aus seinen universal gültigen Erfahrungen als Assistenzart eines Garnisonshospitals.
Der Autor
Frank Schirrmacher, Jahrgang 1959, Studium in Heidelberg und Cambridge, Promotion. Seit 1994 war er einer der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. 2004 sagte er dem Altersrassismus den Kampf an – für sein Buch Das Methusalem-Komplott erhielt er u. a. den Corine-Sachbuch-Preis und die Auszeichnung Journalist des Jahres 2004. Mit Minimum landete er 2006 erneut einen publizistischen Coup und setzte das Thema des Jahres. 2007 erhielt er als erster Journalist den Jacob-Grimm-Preis-Deutsche-Sprache und wurde 2009 mit dem Ludwig-Börne-Preis ausgezeichnet. 2009 erschien bei Blessing Payback und 2013 Ego. Das Spiel des Lebens. Frank Schirrmacher verstarb am 12. Juni 2014 in Frankfurt am Main.
FRANK
SCHIRR
MACHER
Die Stunde der Welt
FÜNF DICHTER – EIN JAHRHUNDERT
George · Hofmannsthal · Rilke · Trakl · Benn
BLESSING
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2017 by Karl Blessing Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
© 1996 by Nicolaische Verlagsbuchhandlung
Covergestaltung: Geviert, Andrea Hollerieth
Covermotiv: Porträt von Hugo von Hofmannsthal
Fotograf: unbekannt (Österreich), 20. Jh. © Bridgeman Images/Privatsammlung
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-20814-1V002
www.blessing-verlag.de
Inhalt
Vorwort
Einleitung
DIE EROBERUNG DES MONDES ODER EINE ANEKDOTE ÜBER DEN KUNSTWILLEN
Das alte Märchen vom großen Abschied
HUGO VON HOFMANNSTHAL ODER EINE JAHRHUNDERTWENDE, DIE NICHT ZU ENDE GING
Das Lied von Kaspar Hauser
GEORG TRAKLS STILLE
Es schafft der Mann sich eine große Zeit
RAINER MARIA RILKE, DER KRIEG UND DIE REVOLUTION
Dies ist der Pfeil des Meisters
DER STAAT DES DICHTERS STEFAN GEORGE, DER VERRAT UND DER ÄSTHETISCHE FUNDAMENTALISMUS
Dem Licht ergeben und doch den Ratten pfeifend
GOTTFRIED BENNS LEID UND LIEBE IN DEN KRISENJAHREN 1930 BIS 1937
Zu diesem Buch
Gedichtnachweise
Vorwort
Aristoteles vermutete den Sitz der Seele im Herzen, Descartes glaubte sie in der Zirbeldrüse. Jahrhunderte hatten, worauf der Mediziner Gottfried Benn mit Nachdruck hinwies, über das Gehirn nichts zu sagen gewusst. Die Literaturgeschichte hat lange Zeit den Sitz der Seele im Gedicht lokalisiert. Sie redete von der »Stimmung« und vom »Gemüt«, von »Mond« und »Liebe« und dem, was dem Dichter in seiner Not ein Gott zu sagen empfiehlt. Durch Heine wurde die lyrische Seele kollektiv, durch die Psychoanalyse demokratisch, durch die moderne Lyrik anachronistisch. Seit Benn spricht die Literatur wenig von der Seele und viel vom Gehirn. Wie Gedanken eine immer undurchsichtiger werdende und schließlich rational kaum mehr rekonstruierbare Emotionalität gewinnen können, das lässt sich nirgendwo so genau studieren wie im Gedicht und bei seinem Urheber. Es ist ein Studium, das eines Tages einen Beitrag zu der Frage leisten könnte, warum ein monströser politischer Einfall das Jahrhundert ruinierte.
Die Aufsätze dieses Bandes erheben nicht den Anspruch, Neuigkeiten über das Werk der hier besprochenen Schriftsteller zu verbreiten. Das Augenmerk gilt den Künstlern in ihrem Verhältnis zur Politik. Es handelt sich um Essays, deren Blickrichtung durch den Anlass vorgegeben war. Dass es diese fünf Schriftsteller geworden sind, ist kein Programm. Natürlich ist die Anthologie der Epoche ohne Brecht unvollständig. Die Wahl ist aber auch nicht ohne Vorsatz. George, Hofmannsthal, Rilke und Trakl zählen zu den vier Lyrikern, denen Gottfried Benn, der letzte der hier erörterten Dichter, konstitutive Bedeutung für den eigenen Kopf zugeschrieben hat. Damit sind ihre Werke, was immer sie sonst sind, Tatbestände einer gedanklichen Krise geworden, das heißt jenes Wortbruchs, der das Versprechen der modernen Literatur widerrief.
»Die scheinbare Stille, mit welcher die Tage,
die Jahreszeiten, die Generationen, die Jahrhunderte
aufeinanderfolgen, bedeutet Aufhorchen: so traben
Pferde vor dem Wagen.« Franz Kafka
»Es gibt fast unerträglich viel, das wir nicht wissen, und
der Gründe zum Klagen und Verzweifeln sind Legion.
Aber es wird so sein müssen und es wird unsere Aufgabe
bleiben, die Stunde dieser geistigen Welt, solange sie
dauert, weiter mit unseren menschlichen Bildern zu
erfüllen, so trauerüberladen, so untergangssicher, so
monologisch oder so hybrid sie sind.« Gottfried Benn
Stefan George, 12. Juli 1868 – 4. Dezember 1933 – © Stefan George Archiv in der WLB, Stuttgart
Rainer Maria Rilke, 4. Dezember 1875 – 29. Dezember 1926 – © Schiller-Nationalmuseum/Deutsches Literaturarchiv, Marbach
Hugo von Hofmannsthal, 1. Februar 1874 – 15. Juli 1929 – © Freies Deutsches Hochstift/Hofmannsthal-Archiv, Frankfurt am Main
Georg Trakl, 3. Februar 1887 – 3. November 1914 – © Archiv für Kunst und Geschichte, Berlin
Gottfried Benn, 2. Mai 1886 – 7. Juli 1956 – © Schiller-Nationalmuseum/Deutsches Literaturarchiv, Marbach
Einleitung
DIE EROBERUNG DES MONDES ODER EINE ANEKDOTE ÜBER DEN KUNSTWILLEN
Kafka träumte davon, seine Sätze so gegen die Welt zu richten, dass sie wie ein unverrückbar gegen den leeren Himmel gestelltes Teleskop geduldig auf die lang vorausberechnete Erscheinung warten. So wie Kafkas Teleskop scheint uns die literarische Vergangenheit der ersten Jahrhunderthälfte zu erfassen. Denn bis heute prägt sie nicht nur unsere Imagination und Phantasie, sondern sie scheint auch die nachfolgenden Künstler seltsam abhängig und unfrei gemacht zu haben. Vieles spricht dafür, dass wir uns am Ende des 20. Jahrhunderts noch immer im Gesichtskreis des Fin de Siècle befinden.
Die fünf Dichter, die in den folgenden Stücken gestreift werden, sind Erscheinungsformen jenes Ausbruchs an Begabung, Energie und eines auf Totalität zielenden Verlangens, der die erste Hälfte des 20. Jahrhundert prägte. Sie waren Entdecker, Eroberer, Besitzergreifer – und zwar in einer Vollständigkeit, die noch heute die Kunst zu lähmen scheint. Dergleichen hat es später nie wieder gegeben. Vielleicht, so eine der geläufigen Thesen, weil der Wille, der sich darin artikulierte, diskreditiert und unglaubwürdig geworden ist. Sie, die nach den Worten Georges, den »Stern« erobern wollten, waren Kinder einer Zeit, die uns Heutigen fremd und in ihren Motivationszusammenhängen unverständlich erscheint. Ehe man von der Größenphantasie der seit 1868 geborenen Generation redet, von ihren Versmonden und literarischen Sternbildern, den unerreichbaren Zielen, die sie wie die nächste Straßenbahnhaltestelle in ihren Blick nahmen, könnte es hilfreich sein, die Größenphantasie ihrer Zeit zu mustern.
In einer der seltenen poetischen Stellen der Kritik der reinen Vernunft vergleicht Kant sich mit einem Landvermesser, der auf große Seefahrt geht, um einen Ort zu suchen, den er womöglich nie erreichen wird. Das Land des reinen Verstandes habe er jetzt gemeinsam mit dem Leser kartographiert, und nun führe er ihn auf das Meer (»dem eigentlichen Sitze des Scheins«), »um es nach allen Breiten zu durchsuchen, und gewiss zu werden, ob etwas in ihnen zu hoffen sei«. Kants Vermessungs- und Navigationsmotiv steht in der unabsehbaren Kette der Expeditions- und Eroberungsmetaphern, die aus der Lebenswelt in die Wissenschaften und Künste eindringen und bald keinen seiner Nachfolger mehr loslassen. Mitte des 19. Jahrhunderts beginnen die Künstler, gleichsam als Funktionäre einer romantischen Universalkartographie, die Welt ein letztes Mal zu vermessen. Sie koalieren mit der Wissenschaft. Sie erobern sich fremde Gebiete, beanspruchen die Herrschaft, beginnen mit der Topographie der Seele, jagen den weißen Flecken nach, und, wenn diese getilgt sind, dem auf- und abtauchenden Schimmer Moby Dicks, bis am Ende, wenn schon gar nichts mehr zu sagen übrig zu sein scheint, auch das noch gesagt wird, wenn im Bilde von Kafkas Schloss der Landvermesser K. den Sitz des Scheins neu bestimmt und die Geschichte all dieser Entdeckungen und Eroberungen als Satyrspiel den Abschluss findet.
Der Eingeborene, der als erster das Schiff des Kolumbus am Horizont auftauchen sah, machte eine furchtbare Entdeckung. Lichtenbergs berühmter Satz ist aus der Perspektive desjenigen gesprochen, der im Augenblick seiner Entdeckung seine eigene Geschichte verliert. Am Ende des 20. Jahrhunderts müssen wir uns eingestehen, dass es nicht nur einen Kolonialismus des Raumes, sondern auch einen der Zeit gibt. Die Vorstellungswelt der Gegenwart ist von der Vergangenheit besetzt und annektiert, ganze Kontinente der Phantasie und Einbildungskraft sind von ihr ausgebeutet worden. Jetzt zeigt sich, welchen Preis es kostet, eine Jahrhundertwende zu erleben, an dessen Anfang eine visionäre und vorausdeutende Kunst stand. Sie hat, wie einst die Astronomie bei der Bestimmung der Planetenbahnen, scheinbar jede künftige Bewegung und jede Revolution der Einbildungskraft vorherberechnet.
Vor dem Horizont der Moderne wird jeder Nachgeborene zu einem Lichtenbergschen Indianer. Er erlebt nicht nur den Fluch der Entdeckung. Er erlebt alle Formen der Unterdrückung, Enteignung und Selbstentfremdung. Die Vergangenheit, die einmal Gegenwart war, hat ihre Zukunft, die wir geworden sind, bis in die letzten Winkel erfasst und ausgebeutet. Wenn heute so viel von der erschöpften Phantasie die Rede ist und davon, dass die erste Jahrhunderthälfte eine bislang unüberschrittene Steigerungsform der Kunst hervorbrachte, wenn allenthalben die Suche nach den Ursprüngen beginnt und die Entstehung des wissenschaftlichen und ästhetischen Weltbildes in den Schriften der Feyerabend, Serres, Foucault wie die Ankunft einer fremden Macht erzählt wird, dann meint man in diesen Wendungen die Qual und Klage eines seiner selbst und der eigenen Legitimität längst unsicher gewordenen Stammes von Eingeborenen zu hören.
Man kennt die soziale Energie, die sich am Ende des letzten Jahrhunderts in expansionistische und kolonialistische Politik umsetzte. Aber man zögert, dieses Modell auf die Künste und in die Literatur zu übertragen. Der Herrschafts- und Unterwerfungswille, der sie seit Mallarmé den definitiven Vers, das endgültige Bild, den unübertroffenen Ausdruck suchen lässt, die psychischen und physischen Energien, die nun den wie besessen, bis zur Selbstverstümmelung arbeitenden Künstler produzieren, die neuen Idiome der Verrechtlichung, mit der sie moralische und soziale Ansprüche einklagen – dies alles gibt eine Ahnung von Umfang und Kraftzentrum einer kollektiven Anstrengung, die, wie der Literaturkritiker Harold Bloom sagt, die Kinder, Enkel und Urenkel stumm und blind machen sollte angesichts der Größe des Erreichten.
Die Pariser Weltausstellung von 1889 hat den Abdruck der Energien empfangen. In der Mitte der Stadt erhebt sich der Eiffelturm, auf dessen oberster, über dem Dunst liegende Plattform bald wissenschaftliche Experimente durchgeführt werden. Ein Teleskop wird auf der Spitze montiert, eine Sternwarte und ein Laboratorium werten astronomische und meteorologische Daten aus. In gewaltigen Ausstellungen werden neue Mond- und Sternenkarten, Himmelsgloben, Fotografien des Weltalls gezeigt, und gleichzeitig – worauf Albert Boime in seiner Deutung von van Goghs »Sternennacht« hingewiesen hat – werden die neuen Entdeckungen und Eroberungen der Erde vorgestellt. Erde und Himmel treten in den Augen des Betrachters zu einer pathetischen Selbstfeier der französischen Kolonialpolitik zusammen. Die Doppeleroberung des Erreichbaren und des Unerreichten, der Gegenwart und der Zukunft hat von Anfang an eine mondäne und eine ästhetische Variante. Camille Flammarion, einer der bedeutendsten Astronomen seiner Zeit, annonciert die Astronomie als Mittel zur »geläuterten Eroberung«, die anders als die Kolonialisierung der Erde nicht »Blut und Tränen« kostet. Der bloße Anblick des bestirnten Himmels habe den Menschen seit Jahrtausenden Wissen und Herrschaft über die Zukunft versprochen. Nun stehe der Augenblick bevor, da die Zukunft, die eine friedliche sein werde, buchstäblich betreten werden könne.
Nur wenig später bekennt Cecil Rhodes beim Anblick des Sternenhimmels: »Die Welt ist fast vollständig parzelliert. Was übrig blieb, wurde aufgeteilt, erobert und kolonialisiert. Denken wir nun an diese Sterne, die wir nachts über uns sehen, diese ungeheuren Welten, die wir niemals erreichen können. Ich würde die Planeten annektieren, wenn ich könnte. Oft denke ich darüber nach. Es macht mich traurig, sie so klar und doch so unerreichbar zu sehen.« Man muss durch die Resignation hindurch das Bekenntnis einer realpolitischen Wunschvorstellung lesen, um in den Energiekern der kollektiven Wunschvorstellung vorzustoßen.
Hierher, in die ausgestellte Welt des Jahres 1889, gehört eine Äußerung eines in diesem Jahr Geborenen, die in anderem Zusammenhang Hans Blumenberg zitiert und deren Zitation er »hart, aber unumgänglich zur Herstellung des Phrasierungsbogens« nennt. Er »habe veranlasst«, so bemerkt Hitler am Mittag des 5. Juni 1942 in seinem Hauptquartier, »dass – soweit nur irgend möglich – in allen größeren Städten Sternwarten errichtet würden, da Sternwarten erfahrungsgemäß das beste Mittel darstellten, um das Weltbild des Menschen zu vergrößern und damit geistigen Verkümmerungen vorzubeugen«.
Flammarions »Blut-und-Tränen«-Rede, Rhodes’ planetare Annektionsgelüste angesichts der aufgeteilten Welt, Hitlers Sternwarten, die das Bild der Welt vergrößern sollen, die er in Besitz zu nehmen gedenkt – man erlebt hier in der Echtzeit historischer Metaphorik die Geburt einer Größenphantasie, die bis heute jeden in die Zukunft weisenden imaginativen und gedanklichen Willen behelligt und bricht.
Es bedarf nicht der These des Vorläufertums, um von der Zerstörung Europas in der Jahrhundertmitte zu den europäischen Wunschprojektionen um 1890 zurückzurechnen. Aber der Blick zurück zeigt, wie sich damals die Welt um eine noch in den Kinder- und Jugendjahren steckende Generation herum reisefertig machte zu einer Expedition. »Warum, frage ich mich«, notiert van Gogh, »sollten uns die leuchtenden Punkte am Himmelsgewölbe weniger zugänglich sein als die schwarzen Punkte auf der Karte von Frankreich.« Noch glaubt er, dass man, »wie wir den Zug nehmen, um nach Tarascon zu fahren«, den Tod nehmen muss, »um auf einen Stern zu gelangen«. Aber die Verschiebung des Eroberungsimpulses hat bereits begonnen. Die planetarische Phantasie wird von den Künstlern als Erfahrungstatsache verbucht und nun sehr rasch aus dem Raum in die Zeit verlegt.
In einer eminent populären Schrift von 1884 aktualisiert Flammarion den Mythos und verkündet ein Universum, in dem die Künstler und Denker nicht sterben können, weil sie »die Arbeit, die sie auf der Erde unterbrochen haben, in anderen Welten fortsetzen«. Albert Boime hat gezeigt, wie dieser Gedanke zu einem Inspirationskern van Goghs wurde. Doch die Welle, die das große Expeditionskorps der Kunst transportiert, erreicht fast alle Protagonisten der europäischen Moderne: den französischen Symbolismus, den mit Wissenschaft und Kunst experimentierenden August Strindberg, Georges Kosmikerrunde und Rainer Maria Rilke und schließlich auch den Salon Elsa Bruckmanns. Was anfänglich noch unter dem Tarnnamen der Unsterblichkeit segelte, erwies sich sehr bald als ein Verfahren, all die Regionen und Gebiete zu erobern und zu besetzen, die der imaginative Zugriff bisher verschont hatte.
Fast überall in den europäischen Metropolen wirft diese Größenphantasie jetzt ihre Schatten, gleich dem Eiffelturm, der die Sterne zu berühren scheint und, wie eine zeitgenössische Beobachtung mitteilt, als künstlicher Mond über der Stadt aufgeht: eine »endlose Spirale, die die Menschheit, in immerwährendem Aufstieg erklimmt«. Gewiss ist der Umweg über die Sterne nur eine von vielen Reisen, um Distanz zu erlangen, aber anders als der schon bei Rimbaud und Gauguin spürbare ethnographische Blick erlaubt er nicht, über die Erfahrung des Fremden das Eigene zu durchschauen. Er ist absolute Betrachtung, Selbstentdeckung, gleichsam eine Form kontemplativer Herrschaft. Man muss nicht auf die ungeheure Erfolgsgeschichte der Psychoanalyse verweisen, deren Urdokument am 4. November 1899 erscheint, um die Dynamik dieser scheinbaren Passivität zu ermessen. Wenn es stimmt, dass der Ethnograph der »reisende Revolutionär« ist, so ist der Künstler der Jahrhundertwende der träumende Revolutionär, der, wie die berühmte Prophezeiung Coleridges lautet, die Rose, die ihm soeben im Traum geschenkt wurde, beim Erwachen in Händen hält. Dazu verhalf ihm die Wissenschaft. Die brüderliche Verwandtschaft zwischen ihr und der Kunst, die die Zeit erwarten durfte, gehört zu den großen Verlustanzeigen unseres heutigen Fin de Siècle. Das Bündnis zwischen Romantik und Technik, zwischen Wissenschaft und dem Gedicht hat am Ende jene Katastrophengeschichte ausgelöst, die in den beiden wissenschaftlich sich missverstehenden Totalitarismen des 20. Jahrhunderts zum unüberschreitbaren Zeichen wurde.
Bei dem Versuch, sich zurückzuversetzen in das, was damals gewollt und bewiesen werden sollte, gerät man an die Besucher und Sympathisanten der Weltausstellung von 1889. Die Illustrierten und wissenschaftlichen Fachzeitschriften schreiben den Panegyrikus der neuen Zeit. Van Gogh, der das alles liest, erwägt, seine »Sternennacht über der Rhône« einzureichen. Einen Monat später beendet er seine »Sternennacht über Saint Rémy«, die, wie Boime nachgewiesen hat, einer Art wissenschaftlicher Astralpsychologie zum Ausdruck verhilft. Auffallend ist van Goghs Mond, dessen Lichtwellen keinem Mond der bildenden Kunst mehr ähneln und die Kunstwissenschaft bis heute nicht mehr losgelassen haben. Dieses Bild des Erdtrabanten beginnt die realistischen Varianten der Vergangenheit zu verdunkeln. Ein anderer, den die Weltausstellung faszinierte, war der Physiker William Crookes. Crookes wurde im Todesjahr Goethes geboren und starb 1919. Mitglied der Royal Society und vieler gelehrter Akademien, zählte er zu den bedeutendsten Forschern seiner Zeit. Er hat das Thallium gefunden, das Sonnenspektrum erforscht, das Licht gemessen. Gemeinsam mit Henri Becquerel und den beiden Curies, deren Forschungen er begleitete, eröffnet er das Atomzeitalter.
Als Präsident der Photografischen Gesellschaft war Crookes stolz darauf, den Mond fotografiert zu haben. Seit Humboldts Besuch bei Daguerre im Februar 1839 war die Mondfotografie zum Faszinationstopos der Zeit geworden, der Planet selber in den Interieurs der Salons aufgegangen. Crookes war von der Authentizität des Verfahrens begeistert. Streng genommen, musste niemand mehr den Mond sehen, damit er gesehen wurde. Unabhängig vom Menschen existierte er, denn das ideale Auge der Kamera hatte ihn aufgenommen und belichtet.
Jahrhunderte des lunaren Deutens waren durch die ersten Mondfotografien in eine neue Phase getreten. Als das gewöhnlichste und nächstliegende Gestirn war der Mond trotz der Anfechtungen der Wissenschaften im imaginativen Besitz der Künstler geblieben. Längst war die Topographie des Mondes durch Karten erfasst und in reliefartiger Prägung auch betretbar geworden. Schiller, im nächtlichen Garten mit Teleskop und Schröterscher Mondkarte bewaffnet, berichtet in einem Brief an Goethe von der »angenehmen Empfindung, einen so bedeutenden Gegenstand, von dem man vor kurzer Zeit so gut als gar nichts gewusst, um so viel näher und genauer kennen zu lernen«.
Die Fotografie macht aus dieser ersten Bekanntschaft eine Besitznahme. Nur der fotografierte Mond ist wirklich. Er wird archivierbar und also historisch und damit dem ursprünglichen Naturkontext geraubt. Es gibt jetzt bereits vier Perspektiven zur Betrachtung des Mondes: die des gewöhnlichen Himmelsbeobachters, der Kunst, des Teleskops und schließlich die der Fotografie. Im Vorfrühling des Jahres 1894 macht August Strindberg sich auf, den vier Sichtweisen noch eine fünfte hinzuzufügen. Ihn fasziniert die von Crookes vorbereitete Entdeckung der unsichtbaren Strahlung, und er folgert, dass man nun »jede Unwirklichkeit« in Besitz nehmen könnte. »Ich benutzte die Methode und erhielt vom Licht des Mondes ein Bild, das Bienenwabenzellen glich.« Es ist, als hätte Strindberg das ihm unbekannte, fünf Jahre zuvor entstandene Bild van Goghs gesehen. Doch die Pointe war, dass Strindberg den Planeten »ohne Kamera und Linse« fotografierte und den Film, eine Bromsilberplatte, einfach auf die Erde legte. Jetzt fehlte nicht mehr nur das Auge des Menschen, sondern auch das der Kamera. Der Mond ist als Wabenzelle in unüberbietbarer Genauigkeit dargestellt: als geborgtes Licht, das sich im Medium verfängt.
Nicht nur Strindbergs Kunst, sondern die ganze Anthologie der sich jetzt eröffnenden Epoche wiederholt dieses Experiment. Die Seele ist der Mond, der Dichter die fotografische Platte, die Sprache das allsehende Auge der Kamera. Belehrt durch die Perspektivenvielfalt der Mond- oder Seelenbetrachtung wagt die Kunst, die Stimmen durcheinanderreden zu lassen, das stabile Ich in unzählige Ableitungen aufzuspalten und vor allen Dingen die Zeitformen zu vertauschen.
Wir sind heute darin geübt, in dieser Operation eine ästhetische Epochenschwelle aufzudecken. Auf der Flucht vor der Definitionsmacht der Wissenschaften, so lautet eine gängige These, hätten die Künstler den Raum erobert, in dem die Empirie der exakten Wissenschaften unzuständig bleiben musste. Aber die These unterschlägt die Radikalität des Paktes, den für einige unendlich nachwirkende Augenblicke die Künste mit den Wissenschaften und diese mit den Künsten eingingen.
William Crookes, der den Mond fotografiert hatte, wurde zum europäischen Gesprächsthema, das von Anatole France bis Hugo von Hofmannsthal reichte, weil er eines Tages vierundvierzig Fotos von Katie King, seiner Geliebten, aufnahm und behauptete, auf den Fotos sei ein Gespenst zu sehen. Er präsentierte der Öffentlichkeit die Fotografien und die Geschichte ihrer Entstehung mit dem gleichen Entdeckerstolz wie einst die Aufnahmen des Mondes. Sechs Monate habe er die Frau geprüft, befragt, vorgeführt – schließlich war Crookes überzeugt, einen Geist zu lieben. Zum Beweis seiner Existenz fertigte er die Fotografien an, auf denen er, ein wenig linkisch, Katie King mit dem Arm gegen die Kamera dreht.
Crookes’ kurioses Experiment mit einem Medium verläuft in den Tiefenströmungen der Wissenschaftsgeschichte. Noch 1923 hält der französische Nobelpreisträger Charles Richet die Fotografien Crookes’ für im höchsten Grade beunruhigend. Beunruhigend aber war nicht das Resultat, sondern die eigentümliche Energie, der es sich verdankte. Denn das Crookessche Medium sollte empirisch über die Zukunft reden, das »Wissen künftiger Jahrhunderte vorhersagen«, um es für die Welt des ausgehenden neunzehnten zu erobern.
Crookes, überflüssig zu sagen, ist gescheitert, und wie van Goghs Mond und Strindbergs fotografische Platte haben auch seine Bilder eine verräterische Rezeptionsgeschichte. Hugo von Hofmannsthal hält sie für den Beweis des Übersinnlichen, weil sie zeigten, dass selbst »sehr logische Menschen« von der Sehnsucht nach dem »Traum« ergriffen werden könnten. Die späten zwanziger Jahre vermuten, ganz im Stile der aufgeklärten Gesellschaft, ein abgekartetes Spiel, bei dem die Angst vor Entdeckung und sozialer Diskriminierung die Regeln lieferte. Crookes habe seine Geliebte zum Medium erklärt, um im eigenen Haus und unter den Augen seiner Frau sein Liebesverhältnis unterhalten zu können. Heute erklärt man sich Crookes’ Blamage mit einer Thallium-Vergiftung, die Psychosen hervorrufe und den weltberühmten Forscher den Betrug glauben ließ – Katie King ist der Preis der Entdeckung. Das alles sind Evidenzen, die immer nur für die jeweilige Zeit glaubwürdig sind, aber das eigentlich Verstörende nicht aufheben.