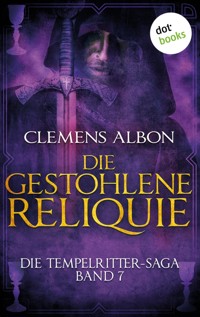Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Tempelritter-Saga
- Sprache: Deutsch
"Hältst du diesen Ort für gefährlich?", fragte Henri. Der Mann nickte und antwortet: "Gefährlich ist es immer." Henri erhob sich. "Nun denn", sagte er, "nehmen wir unsere Waffen und gehen an Land." Das Reich der Khasaren – ein Hort von Frieden und Toleranz mitten im Kaukasus. Hier wollen der schottische Tempelritter Henri de Roslin und seine Freunde endlich Zuflucht finden vor den Verfolgungen der vergangenen Jahre. Doch kaum sind sie ankommen, müssen sie erkennen, wie sehr der Schein trügt: Bei den Khasaren herrscht religiöser Aufruhr, und machthungrige Männer gieren nach der Vorherrschaft im Reich. Erneut sehen sich die Gefährten von allen Seiten bedroht – und allzu rasch wird aus dem vermeintlichen Paradies die Hölle auf Erden … Die Tempelritter, der mächtigste Orden des Mittelalters: Eine packende Abenteuer-Saga, die mehrere Kontinente und Jahrzehnte umspannt!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 382
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Das Reich der Khasaren im Kaukasus – ein Hort von Frieden und Toleranz! Hier wollen der schottische Tempelritter Henri de Roslin und seine Freunde endlich Zuflucht finden vor den Verfolgungen der vergangenen Jahre. Doch als sie dort ankommen, müssen sie erkennen, wie sehr der Schein trügt: Bei den Khasaren herrscht religiöser Aufruhr und machthungrige Männer gieren nach der Vorherrschaft im Reich. Erneut sehen sich die Gefährten von allen Seiten bedroht – und allzu rasch wird aus dem vermeintlichen Paradies die Hölle auf Erden …
Die Tempelritter, der mächtigste Orden des Mittelalters: Eine packende Abenteuer-Saga, die mehrere Kontinente und Jahrzehnte umspannt!
Über den Autor:
Der französische Autor Clemens Albon ist ein Experte für die Geschichte der Provence als Wiege der europäischen Dichtkunst. Nicht nur die Zeugnisse der mittelalterlichen Minnesänger, auch die Artus-Epik mit ihren Legenden der Gralssucher boten ihm einen breiten Fundus, aus dem er sich für die Tempelritter-Saga geschickt bediente. Clemens Albon lebt und arbeitet im französischen Lirey, nahe Troyes in der Champagne, wo der Tempelritterorden Anfang des 12. Jahrhunderts gegründet wurde.
Für die Tempelritter-Saga schrieb Clemens Albon auch folgende Bände:
»Die Tempelritter-Saga – Band 7: Die gestohlene Reliquie«
»Die Tempelritter-Saga – Band 11: Die Macht der Worte«
***
eBook-Neuausgabe Februar 2015
Copyright © der Originalausgabe 2006 bei Pabel-Moewig Verlag KG, Rastatt
Copyright © der Neuausgabe 2014 bei dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Bildmotiven von shutterstock/bazzier und Kiselev Andrey Valerevich
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH
ISBN 978-3-95520-787-8
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Das Reich der Khasaren« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Clemens Albon
Das Reich der Khasaren
Die Tempelritter-Saga
Band 10
dotbooks.
ERSTER TEIL
1
Januar 1317, in der Stadt des Krieges
Es waren die Tage nach dem Sturm.
Die beiden Handelsschiffe hatten sich von Jaffa aus mit ihrer kostbaren Fracht gegen die Unwetter nach Westen gekämpft. Als sie die griechischen Inseln erreichten, fingen die Stürme an, und sie ließen nicht nach, bis die Dardanellen erreicht waren. Erst nach zehntägiger Reise kam das Meer von Marmara in Sicht, die vorgelagerten Inseln mit der Abtei von St. Stephan und dann – endlich – die goldenen Türme und hochfahrenden Minarette Konstantinopels, und alle an Bord waren erleichtert. Die Schiffe fuhren an den Seemauern vorbei, passierten Schwärme von schwankenden Fischerbooten, liefen in den Hafen ein und wurden von dunkelhäutigen Tagelöhnern belagert, die zum Löschen der Ladung bereitstanden.
Henri de Roslin und seine beiden Freunde Uthman ibn Umar und Joshua ben Shimon gingen von Bord. Sie verabschiedeten sich vom Schiffseigner Alexandre Jevault und seiner Freundin, der Pilgerin Blanca de Brie. Die beiden wollten weiter nach Frankreich segeln, wenn Alexandre neue Fracht aufgenommen hatte. Gewinn versprachen vor allem Gewürze, Goldschmiedearbeiten, Tuche und Heiligenbilder.
Blanca rückte ihren roten Hut, der breit wie ein Schild auf ihrer Mähne saß, gegen den Wind zurecht. Sie war froh, dass ihre Begleiterinnen, die mit ihr ins Heilige Land gepilgert waren, inzwischen auf zwei byzantinischen Karacken von Jaffa nach Marseille zurückgesegelt waren und sich um die überlebenden Kinder kümmerten. Der Kinderkreuzzug hatte so ein unerwartet glückliches Ende genommen. Aber keiner dachte gern an dieses traurige Kapitel aus dem Heiligen Land zurück.
In Konstantinopel war es kalt. Die Freunde suchten eine warme Behausung in der Nähe des Hafens. Dazu mussten sie sich zunächst durch zahlreiche Schafherden kämpfen, die durch die gewundenen Straßen mit den reich verzierten Holzhäusern zogen. Immer wieder wurde das Einerlei der Holzhäuser von zweistöckigen Steinbauten unterbrochen, die von den byzantinischen Christen errichtet worden waren.
Manche Straßen waren völlig verstopft von Wagen und Karren, die von schreienden und fluchenden Händlern gezogen und geschoben wurden. Träger schleppten ihre Waren auf den Schultern oder dem Kopf umher. Die Gefährten kämpften sich friedlich durch das Gewühl, bis sie schließlich eine saubere Herberge in der Nähe ihrer Anlegestelle fanden, vor der Wasserverkäufer aus langen Schläuchen frisches Trinkwasser verkauften. Dieses Wasser zu trinken war nach der langen Schiffsfahrt ein Genuss.
Rauch lag über der Stadt auf den sieben Hügeln, und über den Bosporus zogen Vogelschwärme gen Süden. Die Luft war weich, es roch nach Winter. Uthman und Joshua suchten in der Stadt, die so viele Glaubenskriege erlebt hatte, ihre Gebetsstätten auf. Henri wollte nicht in der gewaltigen Hagia Sophia, der Kirche der Orthodoxen, beten, er erinnerte sich einer kleinen Kapelle, in der er ganz für sich sein konnte.
Es war die Zeit der geheimnisvollen Zwölf Nächte. In diesen so genannten Rauhnächten erreichte die dämonische Macht der Finsternis ihren Höhepunkt. Die wenigen lateinischen Christen in der Stadt versanken im stillen Gebet, um die Dämonen abzuwehren. Die Muslime dagegen erzeugten Lärm und zogen mit Masken umher, um sie zu vertreiben. Wer jüdischen Glaubens war, sang in einer der übrig gebliebenen Synagogen inbrünstige, an die zwölf semitischen Stämme Israels erinnernde Lieder, deren Klänge bis hinaus auf die Straße drangen. Und die Orthodoxen zogen mit Heiligenbildern und dicken weißen Kerzen zwischen dem Palast der Sultane und der Hagia Sophia einen großen Kreis, der ein Sinnbild des Lebens darstellen sollte.
Henri kannte die Kapelle aus früherer Zeit; sie stand neben dem Studioskloster, in dem sich jetzt auch eine Übersetzerschule befand. Als er in der schlichten Basilika eintraf, war er darin der einzige Betende. Vielleicht tatsächlich der einzige verbliebene lateinische Beter in dieser kriegerischen Stadt wechselnder Besatzer.
Henri war froh, dass er allein war und dass sich in der Kapelle eine feierliche Stille ausbreitete. Er erwartete nicht, dass er der Gestalt der wilden Perchta begegnete, wie vor Jahresfrist an der deutschen Ostsee, als er die Zwölfte Nacht der langen Zwölf Nächte gefeiert hatte. Die wilde Perchta war eine alte Frauenfigur aus der germanischen Mythologie; sie damals zu erblicken war für ihn ein eindrucksvolles Erlebnis gewesen. Sie hatte wilde Jäger mit einer Peitsche durch die Kirche vor sich hergetrieben, die nach altem Glauben in diesen geheimnisvollen Nächten mit bösen Absichten unterwegs waren.
Henri versenkte sich in die Gebete der Epiphanie, der Erscheinung des Herrn. Er dankte seinem Herrn für das Glück des Überlebens. Er fühlte seine Nähe. Es ist wirklich Gott der Herr, dachte Henri, der sich in Jesus dem Menschen zuwendet und seine Königsherrschaft über die Welt errichtet.
Es schmerzte Henri besonders, dass er die Gegenwart seines alleinigen Gottes im Heiligen Land nicht gespürt hatte. Er war in allen Gefahren mit seinen Freunden allein gewesen. Nur im Tempel von Jerusalem hatte ihn der König der Ehren, Davids Sohn, mit seinem Heiligen Geist angerührt und tief bewegt. Aber der christliche Glaube war im Heiligen Land geschändet, er war tot.
Auf dem Weg zurück zu ihrem gemeinsamen Treffpunkt in den Souks zeigte sich Henri empfänglich für die Stimmung in der Stadt. Er kannte die wechselvolle Geschichte Konstantinopels und erinnerte sich an die Erzählungen aus den Kriegen. Die Stadt kam ihm jetzt heiterer vor. Er sah in bunte Gewänder gehüllte junge Frauen auf den Märkten und Männer mit luftigen Kaftanen und roten Turbanen, die unter hohen grünen Baldachinen am Wasser saßen, Pfeife rauchten und den kreuzenden Schiffen zusahen, deren vorbeiziehende Maste einen lebhaften Kontrast zu den stolzen Minaretten an den Ufern bildeten.
Als die drei Freunde zusammentrafen, um sich zu stärken und ihr weiteres Vorgehen zu beraten, fielen ihnen die vielen Liebespaare auf. Sie gingen ungeniert umher. Konstantinopel war immer eine kämpfende Stadt gewesen, eine in Händel der Zeiten verwickelte Metropole, aber nun schien sie zur Ruhe zu kommen. Die Stadt besann sich auf ein Leben zwischen den Kriegen. Und sie schien reich zu sein. Ihre Einwohner trugen Hermelinpelze und Kopfschmuck mit Juwelen, goldbestickte Tücher und Seidengewänder.
Eine Gruppe junger Tscherkessinnen mit goldblonden Haaren und durchsichtig scheinenden weißen Gesichtern zog vorbei, sie lächelten den drei Freunden ohne Scheu zu. Es lag nichts Anzügliches in ihrem Lächeln.
Aber es gab auch Armut. Die Hafenarbeiter waren sämtlich Sklaven, viele waren dunkelhäutig, aber es befanden sich auch Bulgaren, Armenier und Moldawier darunter, die alle mit glanzlosen Blicken vor sich hin starrten.
Henri konnte nicht umhin, an das Blut zu denken, das hier vergossen worden war. Die Christen, die Kreuzfahrer, die Lateiner hatten gewütet, vielleicht würden eines Tages Mongolen, Seldschuken oder Turkmenen einfallen, oder die Anhänger Mohammeds würden die Stadt erobern und neues Unheil anrichten. Man hörte schon jetzt vom Vorrücken einer neuen Dynastie, der Osmanen, die von Sögüt aus die Lehre Mohammeds nach Westen trugen.
Wir leben in einer blutgetränkten Zeit, dachte Henri. Sein Blick schweifte über die leichten, lebendigen Bilder, die der geschäftige Hafen bot, aber darunter war etwas anderes zu spüren. Jedes Haus hat hier schon die Wehklagen gehört. Hier wurde geplündert und gemordet und Leid verbreitet, bis alles ein einziges Jammertal war.
»Düstere Stimmungen, mein Henri?«, fragte Uthman. »Was ist es, das dich bedrückt?«
»Vielleicht ist es gerade der Eindruck der stillen Heiterkeit, der mich misstrauisch macht. Überall, wohin wir bisher kamen, ereignete sich Tragisches. Wenn man genau genug hinschaut, sieht man die Keime unter der Oberfläche. Aber ich genieße jetzt die Ruhe nach dem Sturm. Ich hoffe nur, sie ist nicht trügerisch.«
»Ich kann das nachempfinden«, sagte Joshua. »Manchmal denke ich, der Boden schwankt. Vor allem nach der Erfahrung von Gewalt und Ungerechtigkeit. Und ich denke, wir müssen aufpassen, dass wir nicht durch eine Regenpfütze fallen und in die Unterwelt stürzen.«
»Joshua!«, sagte Uthman bestürzt. »So kenne ich dich gar nicht! Wo ist dein jüdisches Urvertrauen geblieben?«
»Jüdisches Urvertrauen erlebe ich nur noch beim Gebet in der Synagoge«, sagte Joshua wehmütig. »Wenn ich im Haus unseres Herrn bin, die schwarz gewandeten Männer hinter den hohen Betpulten sehe, die schönen, mit Schaufäden versehenen Tücher aus weißer Seide und goldenen Tressen auf ihren Köpfen; wenn der Gelehrte am vergoldeten Eisengitter um die viereckige Bühne anhält, wo die Lade steht, getragen von hohen Säulen mit üppigen Kapitellen; wenn ich die silberne Gedächtnis-Ampel und den siebenarmigen Tempelleuchter sehe und den Vorsänger höre, seine inbrünstige Stimme, begleitet von der sehnsüchtigen und melancholischen Stimme eines jungen und dem tiefen Bass eines alten Sängers. Dann spüre ich mein Vertrauen in die Schöpfung.«
»Das kann ich verstehen«, sagte Henri. »Der Lobgesang Gottes steigt am erbaulichsten auf, wenn er ohne Instrumente nur aus der Brust von Sängern kommt.«
»Ich war noch nie in einer Synagoge«, meinte Uthman. »Was geschieht während eurer Feiern?«
»Stelle es dir vor, mein Uthman. Versuche, diese Bilder zu sehen. – Jetzt treten drei alte Männer ehrfurchtsvoll vor die heilige Lade, schieben den glänzenden Vorhang zur Seite, schließen den Kasten auf und nehmen sorgsam jenes Buch heraus, das in unserem Glauben Gott mit eigener, heiliger Hand geschrieben hat. Das Buch ist eine in roten Samt gehüllte große Pergamentrolle, oben, auf den beiden Hölzern, auf die sie aufgerollt wird, stecken silberne Gehäuse mit Glöckchen, und vorn, an silbernen Ketten, hängen goldene Schilde mit bunten Edelsteinen. Und dann steigen die Stimmen der drei Sänger in den schönsten Psalmen empor wie Blumen und Blätter der Kapitelle, die bei diesem Gesang aufzublühen scheinen. Das Pergament wird unter atemloser Spannung aufgerollt, und der Vorsänger trägt die Geschichten vor, die zu dem jeweiligen Feiertag passen.«
»Auch ich bin nur im Gebet ganz bei mir«, gestand Henri. »Nur wenn ich in einer stillen Kapelle bin, spüre ich, dass die Schöpfung schön ist.«
Uthman wunderte sich. »Ich habe dieses Gefühl mindestens fünfmal am Tag. Immer dann, wenn ich meinen Gebetsteppich ausrolle und mich nach Mekka verneige. Ich brauche keine Moschee, um das Gefühl zu bekommen, mit meinem Herrn zu sprechen. Mein Allah, Friede sei mit ihm, sitzt in mir. Ihr Altchristen und Neuchristen seid zu sehr an der Welt der Dinge und äußerlichen Erscheinungen orientiert.«
»Darüber ließe sich streiten«, meinte Henri. »Aber – ohne ketzerisch sein zu wollen – wir erfahren doch jeden Tag, dass uns die Schöpfung auch ausspeien kann. Kriege, Gewalt, Überfälle. Wir sind ein paarmal nur haarscharf dem Tod entkommen. Gewiss, es lag immer in der Hand Gottes ...«
»... Und er hat uns niemals im Stich gelassen! ...«
»... Ja, Uthman. Aber was ich sagen will, ist, unsere Erfahrungen sind davon erfüllt, dass es überhaupt keine Sicherheit gibt. Wir leben tatsächlich auf schwankendem Boden. Und die Schöpfung lässt es zu.«
»Schau doch über den Hafen dieser herrlichen Stadt! Wie friedlich alles ist!«
»Gewiss, Uthman! Aber es war gerade hier oft anders. Der Erste, der in diese Stadt Gewalt brachte, war der römische Kaiser Konstantin. Er nahm den christlichen Glauben an, und als er diese Stadt, die damals noch Byzanz hieß und den Griechen gehörte, eroberte, floss viel Blut. Und der Friede wird wieder dem Krieg weichen. Auf Konstantinopel werfen zu viele ihren begehrlichen Blick.«
»Wer auch immer diese Stadt eroberte«, sagte Henri, »übte Gewalt aus. Konstantin war nur der Anfang. Am furchtbarsten wüteten leider die Kreuzfahrer, als sie im Jahr des Herrn 1097 gegen die Türken und 1204 gegen die Byzantiner in die Mauern von Galata einfielen.«
»Du schmähst die Kreuzfahrer?«, staunte Uthman. »Du warst selbst einer von ihnen.«
»Jeder Eroberer verhielt sich so«, sagte Henri. »Ich gebe nur weiter, was man mir erzählt hat. Man darf vor der Gewalt der eigenen Leute nicht die Augen verschließen. All die Tränen, die damals flossen, waren nur ein paar Tropfen in den Strömen von Blut, die die Unsrigen vergossen.«
»Zur Verteidigung muss gesagt werden, dass die Kreuzfahrer von Soldaten des Dogen von Venedig unterstützt wurden, die nicht weniger zimperlich waren.«
»Da hast du Recht, Uthman. Aber das mindert unsere Vergehen nicht.«
»Und auf Seiten der Byzantiner standen Pisaner, die ihren Kleinkrieg gegen die Venezianer ausfochten.«
»Auch das stimmt. Aber in der byzantinischen Armee waren zunächst nur die verbündeten Waräger bewaffnet – mit Streitäxten. Später brachte man natürlich schwere Waffen in die Stadtmauern hinein.«
»Die Kämpfe dauerten lang, soweit ich weiß«, sagte Uthman. »Und sie forderten Tausende Tote.«
»Vor allem nach dem Sieg! Selbst der Führer der Kreuzfahrer, Gottfried von Villehardouin, bekannte, dass das Heer am Abend des ersten Tages vom Abschlachten müde gewesen sei. Die Einwohner ergaben sich. Dennoch wurden sie von den Unsrigen mit Wurfgeschossen, Pfeilschüssen und Steinwürfen verfolgt. Wir plünderten und machten Gefangene; die Überrumpelten, die sich zu widersetzen wagten, wurden ohne Gnade erschlagen. An manchen Orten war die Erde nicht mehr zu sehen vor lauter Toten. Sie führten die Gefangenen in die Sklaverei, auch junge Mädchen, auch gottgeweihte Jungfrauen, man zerrte sie aus den byzantinischen Kirchen, kümmerte sich nicht um die Entsetzensschreie, entweihte die heiligsten Orte.«
»Ging die Stadt damals nicht sogar in Flammen auf?«, fragte Joshua.
»So war es, mein Joshua. Sie steckten die Stadt an, alles zwischen dem Blachernenhügel und dem Euergeteskloster brannte nieder. Die ganze Nacht griff das Feuer um sich, es brannte bis zum Abend des folgenden Tages und verzehrte alles. Es muss ein Anblick gewesen sein, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hatte. An vielen Stellen teilte sich das Feuer und lief auseinander, vereinigte sich dann wieder und wälzte sich wie ein einziger glühender Strom dahin. Hallen stürzten ein, die Herrlichkeit der Marktplätze sank in sich zusammen, mächtige Säulen zerfielen, als wären sie Brennholz. Glutstücke dieses brausenden, unwiderstehlichen Brandes rissen sich los, flogen durch die Luft und setzten weit entfernte Häuser in Flammen. Hinweggeschleudert über weite Strecken, zogen sie wie Sternschnuppen am Himmel ihre Bahn.«
»Es war Krieg«, versuchte Uthman eine weitere Verteidigung. Das ehrte ihn, denn beim ersten Kreuzzug waren ausschließlich Muslime die Opfer gewesen. »Und waren nicht unter den Christen auch Barone des Heeres, die großes Mitleid hatten, als sie sahen, wie die hohen Kirchen und die prächtigen Paläste in Schutt und Asche fielen?«
Henri überhörte seinen Einwand. »Sie wüteten in den Gotteshäusern«, redete er sich in Fahrt, »zerstörten heilige Reliquien und liturgische Geräte, trampelten auf den Ikonen, den Bildnissen der heiligen Mutter Maria und des Jesuskinds, herum, verwendeten sie als Sitzgelegenheiten und Tische, streuten den Leib Christi in den Staub, stahlen den Schmuck. Sie wollten Rache für das Heilige Grab nehmen und wüteten offen gegen Christus. Im Namen des Kreuzes stürzten sie das Kreuz und schreckten nicht davor zurück, wegen einer Handvoll Gold oder Silber das gleiche Zeichen, das sie auf der Schulter trugen, mit Füßen zu treten. Sie kleideten ihre Reittiere in die heiligen Gewänder aus golddurchwirkter Seide, schändeten die Gebeine der Heiligen. Und das im Angesicht der christlichen Schöpfung! Ich kann das nicht verstehen!«
»Rechtgläubige Muslime verhielten sich nicht so«, sagte Uthman. »Sie benahmen sich – ich las das in vielen Schriften – geradezu menschenfreundlich und milde gegen die Landsleute der Lateiner, als sie Jerusalem einnahmen. Sie fielen nicht brünstig wiehernd über lateinische Frauen her, sie machten nicht Christi leeres Grab zu einem Massengrab, sie gewährten allen Lateinern den Abzug.«
»Ich erlebte das genauso in Akkon, als die Hauptstadt des Outremer fiel«, bestätigte Henri. »Damals war ich noch ein Knappe und voller falscher Meinungen über die Lehre Mohammeds. Aber hier in Konstantinopel herrschten jetzt die lateinischen Christen, zu denen auch ich gehöre. Man sah den herrlichen Dom der göttlichen Weisheit, diesen Himmel auf Erden, die zweite Himmelsveste, schön und überschön, und darin unsere Plünderer, ungebildet, roh, wie sie auf den Altartischen aßen und tranken und ihren Gelüsten mit Weibern und bedauernswerten Jungfrauen freien Lauf ließen. Es war ihr versprochener Lohn. Und als sie Tage später Balduin von Flandern als ersten Kaiser des lateinischen Reichs von Konstantinopel krönten, da segnete der alle verübten Untaten ab.«
»Sprich weiter! Ich habe eine so lebendige Anklage noch von keinem Christen gegen seine eigenen Leute gehört«, sagte Uthman. »Es tut richtig gut nach all der Selbstgerechtigkeit.«
Henri blickte versonnen über das Wasser, als sähe er die geschilderten Untaten in diesem Moment vor sich. Dann deutete er mit einer ausholenden Geste auf die umliegenden Gassen. »Aus diesen Häusern ertönte ein Jammern«, sagte er, »auf den Gassen vernahm man nichts als Wehklagen, die Gotteshäuser waren erfüllt von Schmerzensrufen, dem Ächzen von Männern und dem Weinen von Frauen, es herrschten Gewalt gegen Gefangene, Rohheit und Barbarei. Edle wurden entehrt, Reiche zu Armen gemacht. Alle Gassen und Plätze waren voll von Unheil jeder Art. Das alles sehe ich leider auch, wenn ich hier sitze und mich über den Frieden freue, der jetzt über den Wassern liegt.«
»Gibt es überhaupt einen Ort«, sagte Joshua, »an dem Frieden ist? Dauerhafter Frieden? Es würde das Paradies sein. Gibt es irgendwo ein Paradies auf Erden?«
»Nein«, sagte Uthman. »Deshalb ist es auch einerlei, wohin wir reisen.«
»Ich kenne nur kleine, gefährdete Orte des Friedens«, ergänzte Henri. »Sie befinden sich in uns selbst. Und wo wir hingehen, müssen wir versuchen, sie geltend zu machen.«
»Schön gesagt«, meinte Uthman. »Aber wohin gehen wir nun tatsächlich?«
»Ich will ins Reich der Khasaren«, erklärte Joshua. »Ich erzählte euch schon davon. Vielleicht ist es dieses letzte Paradies auf Erden.«
»Vielleicht existiert es auch überhaupt nicht mehr«, zweifelte Henri. »Vielleicht ist es längst in den Weiten des Ostens untergegangen.«
»Ich habe von einem solchen Reich nie etwas gehört«, meinte Uthman. »Möglicherweise ist es ein Hirngespinst, ebenso wie die Geschichte über den sagenhaft reichen Großpriester Johannes, der angeblich hinter den Reichen der Rechtgläubigen in Afrika residiert und nach dem seit zweihundert Jahren alle suchen.«
»Auch ich habe in Abessinien nach diesem Priester gesucht«, sagte Henri.
»Und – hast du ihn gefunden?«
»Nein.«
»Mag sein«, sagte Joshua. »Aber ich glaube, es ist einen Versuch wert, nach dem Reich der Khasaren zu suchen. Denn wenn es wirklich existiert, muss es das wahre Paradies sein.«
»Aber ich werde mich dir nicht anschließen. Du kannst gerne dorthin gehen«, meinte Henri. »Ich will nach Frankreich zurück. Auf mich warten nahe liegende Dinge. Ich muss meine Verhältnisse in der Heimat ordnen. Ich will, wie ihr wisst, den Tempel neu aufbauen, der in Trümmern liegt. Ich muss mich meinen Feinden stellen, ich kann nicht ewig vor ihnen davonlaufen.«
»Du läufst vor keinem Feind davon«, sagte Uthman. »Du hast nur beschlossen, zu überleben.«
»Und es ist töricht, in die Falle zu laufen«, ergänzte Joshua. »Ein kluger Mann weicht den schon gestellten Fallen aus.«
»Dann wird er aber auch niemals erfahren«, entgegnete Henri, »wer sich in diesen Fallen schon alles verfangen hat. Nein, mich zieht es nach Frankreich. Ich habe das Bedürfnis, Tempelbrüdern in die Augen zu sehen, denen zu begegnen, mit denen ich eine gemeinsame Vergangenheit teile.«
»Die teilst du auch mit uns«, sagte Joshua.
»Richtig. Aber ihr seid vom anderen Ufer!«
Sie mussten lachen. In das Lachen hinein mischte sich ein Aufschrei. Sie erblickten einen jungen Mann mit feinen Gesichtszügen und einer blonden Mähne unter einem Gelehrtenhut. Er stand am Wasser und befand sich im Streit mit einem dunkelhaarigen, kräftigen Mann, der wie ein Franzose gekleidet war. Dieser stieß dem Blonden die Hände vor die Brust, der Blonde wehrte sie ab, vollführte eine verächtliche Geste und verschwand im Gewimmel der Menschen. Der Franzose blickte ihm lange mit angespanntem, hartem Gesicht nach, dann folgte er ihm.
Die Freunde beobachteten die seltsame Szene. Sie berührte sie, ohne dass sie wussten, was sich dort abspielte. Erst später sollten sie das Ausmaß dieses Auftrittes begreifen.
*
Joshua hatte während der zurückliegenden Überfahrt immer sehnsüchtiger an das Paradies gedacht. Während die Stürme zunahmen, die Ladung unter Deck immer wieder neu verzurrt werden musste und die Besatzung Schwerstarbeit in den Brassen verrichtete, während die Freunde darüber nachdachten, wie es weitergehen sollte, las Joshua im Buch der Genesis. Wo lag das Paradies? Im Heiligen Land hatten sie es nicht gefunden. Hatte es jemals existiert?
Joshua las.
So sind Himmel und Erde geworden, als sie geschaffen wurden. Es war zu der Zeit, da Gott der Herr Erde und Himmel machte. Und alle die Sträucher auf dem Feld waren noch nicht auf Erden, und all das Kraut auf dem Felde war noch nicht gewachsen, denn Gott der Herr hatte es noch nicht regnen lassen auf Erden. Und kein Mensch war da, der das Land bebaute, aber ein Nebel stieg auf von der Erde und feuchtete alles Land. Da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Und Gott der Herr pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte.
Joshua hielt inne. Das Paradies lag im Osten. Ganz am Rand der Weltenscheibe. Man musste also weiter reisen als bis nach Jerusalem.
Aber wenn man zunächst nach Norden ritt und von dort aus nach Osten? Dann lag das Paradies genau dort, wo das Reich der Khasaren war!
Joshua setzte seine Lektüre fort.
Und Gott der Herr ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen, und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und es ging aus von Eden ein Strom, den Garten zu bewässern, und teilte sich von da in vier Hauptarme. Der erste heißt Pischon, der fließt um das ganze Land Hawila, und dort findet man Gold, und das Gold des Landes ist kostbar. Auch findet man da Bedolachharz und den Edelstein Schoham. Der zweite Strom heißt Gihon, der fließt um das ganze Land Kusch. Der dritte Strom heißt Tigris, der fließt östlich von Assyrien. Der vierte Strom ist der Euphrat.
Das Paradies liegt also in Mesopotamien, dachte Joshua. Dort, wohin die junge Sarazenin Laila jetzt ritt, die sie in Byblos getroffen hatten und die ihnen bei der Befreiung der Kinder aus den Händen der Sklavenhändler behilflich gewesen war.
Aber, dachte Joshua, wenn es stimmen würde, was die alten Astronomen, Nautiker und Weltenreisenden sagen, was der Ptolemäus sagt, nämlich dass die Welt einer Kugel gleicht? Dann wäre das Paradies überall! Denn für jeden Menschen, der auf dieser Weltenkugel steht, ist der Osten woanders. Schließlich ist dann der Osten auf der ganzen Welt!
Ist das nicht ein schöner Gedanke?, dachte Joshua. Das Paradies ist da, wo immer sich Menschen befinden! Es ist in uns selbst! Gott der Herr hat es geschaffen, damit wir Menschen darin wohnen, wir müssen es nur erkennen und es erhalten. Wir müssen es pflegen wie einen Garten.
Joshua nahm sich vor, mit den Freunden über seine Erkenntnisse zu sprechen. Er klappte die Bibel zu. Doch dann spürte er, dass die Antworten ihn nicht befriedigten. Die Welt, dachte er, ob Kugel oder Scheibe, mag das Paradies sein, wenn wir es dazu machen. Aber dennoch muss es besondere Orte geben, an denen man das Paradies deutlich spürt. Dorthin will ich! Denn ich bin all dieser Leiden, die uns umgeben, überdrüssig!
Dann ging er zu den Gefährten hinüber, die achtern unter dem Aufbau des Kastells saßen und den Matrosen beim Flicken der Seile halfen. Joshua wartete, bis diese Arbeit verrichtet war. Dann sagte er bestimmt:
»Ich habe beschlossen, ins Reich der Khasaren zu reisen.«
Henri und Uthman blickten ihn freundlich an. Uthman fragte:
»Und wo liegt dieses Reich, mein gelehrter Freund?«
»Weit im Osten«, erklärte Joshua.
»In der mesopotamischen Wüste also«, sagte Henri. »Dort, wo Laila nun versucht, Mohammeds Lehre in einer strengeren Form zu verbreiten.«
»Nein, eben nicht dort«, sagte Joshua. »Wenn ich annähme, das Reich der Khasaren läge dort, hätte ich im Heiligen Land bleiben können. Die Khasaren siedeln irgendwo zwischen dem Schwarzen und dem Kaspischen Meer. Sie sind ein geheimnisvolles Volk. Niemand weiß etwas Genaues über sie. Aber alle sprechen mit dem allergrößten Respekt von ihnen. Und sie gehören dem jüdischen Glauben an. Deshalb vermute ich, dass sich in diesem Reich das Paradies befindet.«
»Ich legte dir schon immer nahe, du solltest nicht zu viel lesen«, sagte Uthman mit todernster Miene.
»Erzähle uns, was du von den Khasaren weißt, mein Joshua«, sagte Henri.
Sie setzten sich bequemer hin, blickten über die aufgewühlte See, und Joshua begann zu erzählen.
»Was ich von ihnen weiß, steht in den alten Papierrollen, die ich in Toledo studieren konnte. Daher besitze ich vorerst nur höchst unvollkommene Kenntnisse. Aber ich weiß zumindest ein wenig über dieses Turkvolk, das aus den Weiten Asiens kam.«
»Das will ich hoffen«, meinte Uthman.
Joshua blickte ihn treuherzig an. »Die Khasaren sind ein nomadisches Volk gewesen. Sie kamen aus den zentralasiatischen Steppen. Ein Teil von ihnen ließ sich im sechsten Jahrhundert im östlichen Kaukasus nieder. In den ersten Jahrzehnten kamen sie über den Stand von Vasallen westtürkischer Stämme nie hinaus. Später, im neunten Jahrhundert, erstreckte sich das Khasarische Khaganat jedoch über das gesamte Steppengebiet zwischen der Wolga und dem Dnjepr bis an das Schwarze Meer, dort, wo die Tscherkessen, die Armenier und die Georgier leben. Etwa bis zur Jahrtausendwende kontrollierten die Khasaren den Handel mit Gewürzen und Textilien, aber auch mit Sklaven auf Teilen der alten Seidenstraße und auf den Handelswegen zwischen Byzanz und dem Baltikum an der Ostsee.«
»Jetzt fällt mir ein«, erinnerte sich Uthman lebhaft, »dass mir einmal jemand in Cordoba erzählt hat, die Khasaren seien sogar bis ins Kalifat von Cordoba vorgedrungen! Stimmt das?«
»Sie unterhielten zumindest weitreichende Handelsbeziehungen bis nach Cordoba«, erwiderte Joshua. »In drei Jahrhunderten wuchs ihre Macht enorm. Deshalb glaube ich kaum, dass von diesem starken Volk heute nichts mehr übrig sein soll – auch wenn wir nichts von ihm wissen. Zu Beginn ihrer Reichsgründung konnte man die Khasaren kaum von anderen westtürkischen Stämmen wie den Sabiren, den Awaren und den Hunno-Bulgaren unterscheiden, sie wurden von den mächtigen Kök-Türken regiert. Dann jedoch begannen die Khasaren ihre Eroberungszüge und unterwarfen weite Teile der einstigen Altyn Oba-Horde. Spätestens im achten Jahrhundert müssen sie eine selbständige Größe geworden sein und besaßen eine mächtige Hauptstadt im Mündungsgebiet der Wolga. Sie kämpften immer wieder gegen starke benachbarte Großmächte. Erst als Verbündete von Byzanz in jahrhundertelangen Kämpfen gegen die Perser und die Araber, dann auch gegen Byzanz selbst.«
»Das alles klingt zwar aufregend, vor allem, weil du es so leidenschaftlich ausschmückst«, meinte Henri. »Aber wie kommst du darauf, das Khasarenreich könnte das Paradies sein?«
»Warte es ab«, sagte Joshua, als sich plötzlich ein Brecher vor dem Bug ihres Schiffes aufbaute. Er stand unbeweglich in der Höhe, als würde er es auskosten, das Schiff zu zerschlagen, dann stürzte er brüllend über die Takelage. Das Schiff wurde am Bug zuerst heruntergedrückt, dann zu achtern emporgehoben, anschließend folgte die umgekehrte Bewegung. Kurz danach hatte das tüchtige Schiff den Angriff der Wellen abgewehrt und glitt wieder in sanfteren Bewegungen dahin.
»Ein Auf und Ab, wie im Reich der Khasaren!«, meinte Uthman. Die leichte Ironie seiner Worte konnte seinen angespannten Tonfall jedoch nicht verbergen.
»Wie ging es weiter?«, wollte Henri wissen.
»Nun«, erwiderte Joshua, »die Geschichte der Khasaren setzt sich fort mit einer kleinen Besonderheit, und genau die ist es, die mich zu dem Gedanken führte, dort im Osten läge das Paradies. Ich meine die Tatsache, dass die Bewohner des Reichs runde zweihundert Jahre, über fünf Generationen hinweg, mit dem Beginn der Herrschaft von Khagan Obadja, bis zum Bündnis mit Chorezm, dem jüdischen Glauben angehörten.«
»Aha!«
»Stellt euch das vor! Außerhalb des jüdischen Reiches, in Palästina und Syrien, befindet sich ein Reich, in dem das Judentum die vorherrschende Religion ist!«
»Wirklich überraschend«, gab Uthman zu.
»Das muss bedeutet haben, dass zumindest ein Großteil der Oberschicht zum Judentum übergetreten ist, während die übrigen Einwohner, die ganz verschiedenen Volksstämmen angehörten, auch teils heidnisch, teils christlich, teils muslimisch geblieben sein könnten. Aus dieser Zeit gibt es einen berühmten Briefwechsel zwischen dem jüdischen Gelehrten Chasdai ibn Schafrut, einem Hofbeamten des Kalifen Abd al-Rahman III. al-Nasir, und dem khasarischen Herrscher Khagan Joseph. Diesen Briefwechsel konnte ich in Toledo einsehen. Darin wird geschildert, wie es zur Hinwendung der Khasaren zum jüdischen Glauben kam. Ich werde versuchen, das Manuskript in Konstantinopel zu kaufen.«
»Dieser gemeinschaftliche Glaubensübertritt wäre ein ziemlich einmaliger Vorgang in der Geschichte außerhalb des Heiligen Landes«, meinte Henri.
»Eben! Als die Khasaren ihre schamanistische Religion aufgaben, machten sie einen Riesenschritt nach vorn. Ich entnahm dem erwähnten Briefwechsel, dass der Khagan eines Tages die Vertreter der drei Religionen, die an einen einzigen Gott glauben, zu einer religiösen Disputation an seinen Hof gerufen habe. Er habe sich von allen beraten lassen, bis ein Rabbi ihm vorschlug, die Mehrheit entscheiden zu lassen. Und da alle drei Religionen unser heiliges Buch, also das der Juden, als Basis ihres Glaubens anerkannten, Koran und Evangelium aber von jeweils zwei anderen abgelehnt wurden, nahmen die Khasaren den jüdischen Glauben an. Ist jemals eine Staatsreligion durch eine solche weise, gleichberechtigte Entscheidung entstanden? Ich wüsste es nicht. Deshalb glaube ich, das Reich der Khasaren ist das irdische Paradies.«
»Eine nicht ganz schlüssige Gedankenführung, mein Joshua«, entgegnete Uthman, »aber eine spannende Geschichte.«
»Du bist also wirklich entschlossen, die Khasaren zu suchen?«, fragte Henri.
»Ja, aus den erwähnten Gründen. Und es wäre wunderbar, wenn ihr euch dazu durchringen könntet, mich zu begleiten.«
»Oh, mein Joshua«, seufzte Uthman, »hast du nicht berichtet, die Khasaren hätten jahrhundertelang die Rechtgläubigen und Araber bekämpft? Was soll ich an einem Ort, wo solch abscheuliche Menschen leben?«
»Später bekämpften sie auch das christliche Byzanz«, besänftigte ihn Henri.
Joshua sagte: »Das Judentum macht den Reiz des Khasarenreichs aus. Ihr beide akzeptiert doch den jüdischen Glauben, ebenso, wie es die Philosophen der Khasaren taten, als sie daraus ihre Staatsreligion machten. Wir sind schon zusammen in Länder gereist, in denen die Lehre Mohammeds streng befolgt wurde, und ebenso in Länder mit entschieden christlichen Grundsätzen – es wäre nur gerecht, wenn ihr mich jetzt zu den Juden begleiten würdet.«
»Gib uns Zeit, darüber nachzudenken«, meinte Henri. »Wenn wir diese nächsten Wellenberge überstanden haben und den Sturm überhaupt, wenn wir bis ans Ziel nach Konstantinopel kommen – dann sprechen wir noch einmal über deinen Reiseplan.«
»Achtung!«, rief Joshua, als sich wieder einmal haushohe Wellen neben dem Schiff aufbäumten. »Diese Wellen sind noch gewaltiger als die vorherigen!«
*
Als die Gefährten am Abend an der blauen Moschee, die in der Nähe des Hafens lag, miteinander speisten, ließen sie noch einmal die Abenteuer im Heiligen Land an sich vorüberziehen. Sie schickten stille Gebete zum Himmel, damit die überlebenden Kinder des unseligen Kreuzzuges unbeschadet nach Marseille kamen. Und sie dankten noch einmal der mutigen Blanca de Brie und ihren Pilgerinnen für ihre tatkräftige Hilfe.
Joshua kam anschließend gleich wieder auf die Khasaren zu sprechen. Der Plan, in ihr Reich zu reisen, hielt ihn vollkommen gefangen. Er hatte sich inzwischen tatsächlich den Briefwechsel zwischen dem Herrscher der Khasaren und dem jüdischen Gelehrten, von dem er gesprochen hatte, als abgegriffene Pergamentsammlung kaufen können.
Plötzlich erhob sich am Nebentisch ein Mann. Er trat mit festem Schritt auf sie zu und stellte sich vor. Die Gefährten erkannten in ihm den Franzosen, der ihnen im Streit mit dem schönen blonden Jüngling aufgefallen war.
»Ihr Herren, verzeiht, wenn ich störe. Ich hörte Euch vom Reich der Khasaren sprechen. Ich bin in der Lage, Euch über diesen höchst interessanten Stamm und sein Reich Auskunft zu geben.«
»Wer seid Ihr?«, fragte Joshua freundlich.
Der Franzose nahm Haltung an. »Jean de Longjumeau, zu Diensten. Vor zwei Generationen reiste ein Franziskanermönch aus meiner Familie zu den Khasaren. Er und seine Gefährten kamen jedoch nie zurück. Und es gab damals großen Streit um die Belohnung, die der Heilige Stuhl den Reisenden für ihre Expedition versprochen hatte. Nun, das ist eine eigentümliche und lange Geschichte, mit der ich Euch nicht langweilen möchte. Aber wenn die Herren wollen, führe ich sie zu einem Mann, der alles über die Khasaren weiß.«
»Tatsächlich?« Joshua war begeistert. »Wer ist dieser Mann?«
»Ein alter Schamane. Er behauptet, über hundert Jahre alt und meinem Verwandten noch selbst begegnet zu sein. Damals lebte er noch in Itil, der Hauptstadt des khasarischen Reiches.«
»Ein Khasare!«, rief Joshua laut.
»Ja. Seid ihr interessiert?«
»Unbedingt«, sagte Joshua. »Jedenfalls, was mich betrifft.«
Henri und Uthman blieben skeptisch. Als der Franzose zu seinem Tisch zurückgerufen wurde, wo seine Begleiter auf ihn warteten, berieten sich die Freunde kurz.
»Es kommt mir seltsam vor«, sagte Henri. »Wir haben noch nie etwas von den Khasaren gehört. Und jetzt, wo wir zum ersten Mal in der Öffentlichkeit über sie sprechen, nimmt sofort ein Mann mit uns Kontakt auf, der über nichts anderes nachzudenken scheint als über die Khasaren und ihr sonderbares Reich!«
»Es ist Zufall!«, sagte Joshua. »Seid nicht so misstrauisch! Ich sehe darin eine glückliche Fügung und sonst gar nichts!«
»Er macht mir auch keinen zuverlässigen Eindruck«, meinte Uthman. »Aber wenn er wirklich etwas weiß, das unseren Joshua erfreut, sollten wir mit ihm gehen.«
»Geht ihr beide«, meinte Henri. »Ich werde mich in der Stadt umschauen. Wir treffen uns um Mitternacht in unserer Herberge.«
Der Franzose kam mit federnden Schritten zurück, seine Augen blitzten. »Nun, ihr Herren? Gehen wir?«
Uthman und Joshua erhoben sich und gingen mit ihm. Henri blieb sitzen. Er versuchte, sich selbst zu erklären, was ihn dem Franzosen gegenüber so misstrauisch machte. Die handgreifliche Szene, die sich am Nachmittag am Hafen zugetragen hatte, wirkte in ihm nach. Etwas Unzuverlässiges und Vages umgab diesen Mann. Gleichzeitig trat er bestimmend auf.
Henri seufzte auf. Joshua und Uthman würden schon herausfinden, was es mit ihm auf sich hatte. Und mit seinen Kenntnissen über das geheimnisvolle Reich der jüdischen Khasaren.
*
Langsam senkte sich die Nacht über die Stadt, und wieder lag leichter Dunst über dem Wasser. Das gegenüberliegende Galata war nur zu erkennen, weil dort tausend Fackeln brannten und Kohlebecken glühten.
In der Patriarchatskirche war ein Gottesdienst im Gange. Jean de Longjumeau führte Joshua und Uthman durch enge Gassen, über eine Uferpromenade, dann wieder hinein in das Gewimmel der Altstadt. An der Selimiye-Moschee, die von den Byzantinern unbeschädigt gelassen worden war, hielten sie an. Ihr Führer deutete auf ein Eckhaus, vor dem sich ein runder Pavillon mit byzantinischem Dach wölbte. Davor waren mehrere Pferde angebunden. Und auf einem hohen Stapel standen Holzstühle aufgeschichtet.
»Hier wohnt der Schamane, er heißt Patai«, sagte der Franzose. »Ich lasse euch jetzt allein. Sprecht mit ihm. Fragt ihn aus. Ich muss gehen.«
Noch ehe die beiden Gefährten begriffen, dass der Franzose nicht mitkam, war er schon in der Dunkelheit verschwunden. Joshua und Uthman blickten sich verblüfft an, dann traten sie auf das Haus zu. Es lag im Dunkeln.
Die Haustür hing schief in den Angeln. Sie ließ sich zwar leicht öffnen, verursachte dabei aber ein schrilles Quietschen. Hinter der Tür lag ein langer Gang, in dem es muffig roch.
»Hier soll jemand wohnen?«, zweifelte Uthman. »Doch höchstens Ratten und Kakerlaken.«
Sie durchquerten den Gang, hinter dem ein verwilderter Garten lag, der, wie das Zwielicht vermuten ließ, einmal sehr prächtig ausgesehen haben musste. Inmitten dieses Gartens erblickten sie einen vergitterten Arkadengang, in dem Kerzen brannten. Und Stimmen drangen heraus. Mehrere Menschen hielten sich dahinter auf.
Uthman und Joshua traten näher. Und dann sahen sie den Schamanen.
Es war ein Mann mit dem Gesicht eines Reptils. Er saß mit untergeschlagenen Beinen auf einem Stapel von Teppichen. Zu beiden Seiten brannten Kerzen und Räucherstäbchen. Vor dem Alten saß ein Dutzend Männer, die ihn befragten. Er sprach zu ihnen, gab Antworten auf ihre Fragen. Dann blickte er die Neueintretenden an und machte eine schwache Handbewegung, die vieles bedeuten konnte.
Uthman und Joshua setzten sich hinter die bereits anwesenden Besucher. Der Schamane blickte sie aus halb geschlossenen Reptilienaugen unverwandt an.
»Ihr wollt zu den Khasaren«, sagte er. Es war eine Feststellung, weniger eine Frage. »Eine gefährliche Reise.«
»Woher wisst Ihr davon?«, fragte Joshua überrascht.
»Was solltet ihr sonst von mir erfahren wollen«, antwortete der Schamane gänzlich unbeeindruckt.
»Dann wollen alle diese Männer hier etwas über die Khasaren erfahren?«, fragte Uthman.
»Nein«, sagte der Schamane. »Wie kommst du darauf, mein Sohn?«
Uthman schluckte eine Antwort hinunter. »Was weißt du über die Khasaren, Meister?«, fragte er stattdessen.
»Gemach, ihr seid noch nicht dran«, sagte der Schamane. Er wendete sich den anderen Männern zu.
Fragen und Antworten wechselten sich ab. Der Schamane gab zu allem Auskunft. Die Freunde warteten geduldig. Nach einer Weile, als die Besucher einer nach dem anderen gegangen waren, nicht ohne eine Geldmünze in einen Zinnteller gelegt zu haben, sprach der Schamane unvermittelt: »Wir Khasaren sind die wahren Juden. Der dreizehnte Stamm Israels. Unser Glaube ist der reinste.«
»Ich bin Jude«, sagte Joshua. »Ich will ins Reich der Khasaren. Erzähle uns doch, was du weißt, kluger Mann.«
»Das Reich geht unter«, sagte der Schamane. »Die Wikinger aus dem Norden, die man Waräger nennt oder auch Rus, lassen es verkommen. Der Mongolensturm hat ihm fast den Rest gegeben. Doch wir Khasaren sind stark, und wir sind auserwählt. Ja, wir sind ein auserwähltes Volk. Wir überleben die Stürme, wir werden nach Westen ziehen, uns mit den Magyaren verschwistern, in Pannonien einfallen, und wir werden in Serbien, Ungarn und Polen siedeln, dort werden wir eine neue Sprache sprechen und unzerstörbar sein. Wir werden aus uns selbst heraus leuchten, und niemand wird es wagen, uns anzugreifen. Erst nach sechshundert Jahren wird ein großer Zerstörer kommen, der uns vernichtet. Aber bis dahin lebt unser großes Volk.«
»Wo finden wir es?«, fragte Joshua, der atemlos zugehört hatte.
»Reist nach Sarkel. Reist nach Itil. Dorthin, wo alle Flüsse dieser Erdenscheibe zusammenfließen und das Inselreich ein Paradies auf den Wassern bildet, umgeben von Scharen kreisender Vögel, dorthin reist. Reitet einfach nach Nordosten und fragt niemanden nach dem Weg. Die Khasaren wissen alles, sie werden euch finden.«
*
Seltsam angerührt von dem Gehörten, gingen Joshua und Uthman in die Stadt zurück. Weil es noch weit vor Mitternacht war, streiften sie durch die belebten Straßen und sprachen über alles. Es war wärmer geworden, wärmer jedenfalls, als es tagsüber gewesen war, auch der Wind war zur Ruhe gekommen.
In Joshua wuchs die Begeisterung über die geplante Reise stetig an. Uthman hingegen blieb ablehnend. Ihm behagten weder die Umstände, noch traute er dem Gerede des Schamanen. Aber war es nicht einerlei, wohin sie sich wandten? War es nicht überall gefährlich? Und vielleicht gab es das Paradies tatsächlich! Sprachen nicht alle großen Schriften immer wieder davon?
Als die Freunde später mit Henri zusammentrafen und erzählten, blieb er zurückhaltend.
»In sechshundert Jahren werden die Khasaren vernichtet? Das ist im zwanzigsten Jahrhundert. Bis dahin gibt es doch keinen einzigen Menschen mehr auf der Erde.«
»Warum nicht?«
»Sie haben sich vorher längst gegenseitig umgebracht.«
»Das ist sehr pessimistisch gedacht, mein Henri! Gibt es keine Rettung?«
»Demut, Gebet, Unschuld«, sagte Henri, »wo finden wir diese Tugenden noch?«
»Lasst uns zusammen nach Khasarien reisen«, insistierte Joshua. »Unsere gemeinsamen Reisen waren zwar immer ein gefährliches Abenteuer, aber für mich war es immer die schönste Zeit. Eine Zeit, in der ich an nichts anderes dachte als daran, dass alles immer so weitergehen sollte.«
»Oho!«, sagte Uthman. »Ich erinnere dich nur an bestimmte Situationen! An den Angriff auf die Kabbala-Schule in Toledo und die Gefährdung des ganzen Ghettos! An die Zeit auf der Piratengaleere in der Ostsee – du warst halb tot!
An die Sträflingsinsel Tauris vor Marseille! An die Stürme auf hoher See! – Das hätte immer so weitergehen sollen?«
»Du weißt schon, was ich meine, Uthman.«
»Nein, nicht ganz! Aber ...«
»Freunde!«, schaltete sich Henri ein. »Streitet nicht! Aber ich gebe dir Recht, Joshua. Wenn man schon den Gefahren gegenübertreten muss, dann ist es am besten, man tut es gemeinsam.«
»Also kommst du mit zu den Khasaren?«
»Nein«, sagte Henri. »Schon deshalb nicht, weil mir dieser Jean de Longjumeau, dem wir den Kontakt mit dem Khasaren-Schamanen verdanken, unsympathisch ist. Ich werde morgen früh die Kaufmannsmesse aufsuchen. Ich treffe dort einen Mann, der Beziehungen zum Tempel unterhielt. Wenn es mir gelingt, werde ich Geld auftreiben. Denn wir brauchen dringend Geld. Außerdem hatte ich vorhin das Gefühl, jemand folge mir hierher. Vielleicht war es nur ein Schatten in der Dunkelheit, der mich ärgerte. Ich will sehen, ob ich mich täusche oder ob doch jemand in dieser Stadt ist, der irgendetwas von mir will.«
»Also reise ich allein nach Khasarien«, stellte Joshua enttäuscht fest.
»Das solltest du nicht, Joshua«, meinte Uthman. »Es täte uns nicht gut. Nein – was ich wirklich meine, ist: Ich fühle Unheil, wenn du allein reist.«
»Wir können unserem Schicksal nicht entkommen«, sagte Joshua. »Dann ist es auch egal, ob wir es aufschieben wollen oder nicht.«
2
Februar 1317, Theodoros
Sie kamen in der Nacht. Die Soldaten des Königs waren ohne Vorwarnung über die Brüder, hergefallen, hatten sie in Ketten gelegt und in die Kerker geworfen. Es waren Tausende gewesen. Hunderte starben noch in der ersten Nacht. Alle anderen später. Sie waren erschlagen, zu Tode gequält, ertränkt, verbrannt worden, sie verhungerten oder verdursteten, und dann wurden sie von Würmern und Maden in den feuchten, stockdunklen Kerkern aufgefressen.
Man hatte sie verraten. Und niemand übernahm dafür die Verantwortung. Niemand war da, der diese abscheulichen Untaten sühnte. Nur Henri und seine beiden Gefährten konnten die Toten nicht vergessen und auch nicht verzeihen. Und töteten die beiden Verantwortlichen, König Philipp den Schönen und Papst Clemens, noch im gleichen Jahr, in dem die beiden letzten Führer des Tempels auf öffentlichen Scheiterhaufen verbrannten.
Noch während die Flammen auf der Pariser Seineinsel hoch aufloderten, schwor er Rache. Er sah, wie der letzte Großmeister des Templerordens, Jacques de Molay, und der Präzeptor der Normandie, Geoffroy de Charney, verbrannten, bis ihre Gesichter nicht mehr ihnen gehörten, und wusste bei diesem Anblick, dass er den Mord zu sühnen hatte.
Henri schrak hoch. Jedes Mal, wenn er diesen Traum hatte, rückten ihm die von den Flammen zerstörten Gesichter seiner geliebten Brüder so nahe, dass er glaubte, sie berührten ihn. Er schrak von seinem Strohlager auf und lauschte in die Dunkelheit. Nein, es bestand keine Gefahr. Es war tiefe Nacht. Er hörte neben sich die ruhigen Atemzüge seiner beiden Gefährten. Doch dann begriff er, dass da doch etwas war. Etwas Beunruhigendes. Etwas, das ihn geweckt hatte.
Er erhob sich leise. Vor der Tür des Schlafraums vernahm er ein Geräusch. Ein leises, widerspenstiges Geräusch, das nicht aufhören wollte. Ein Kratzen. Als wollte etwas um jeden Preis eingelassen werden.
Henri trat kurzerhand an die Tür und riss sie auf.
Im Gang war es dunkel, aber dennoch war der Schatten des Mannes zu erkennen. Henri spürte die Nähe des anderen, er roch ihn förmlich. Er griff nach ihm, doch er bekam ihn nicht zu fassen.
»Wer ist da?«
Der Fremde ließ etwas fallen, fluchte leise und huschte davon. Henri sah, wie er durch den Flur sprang, am kleinen Patio vorbei, im Laufen gegen die Eingangstür trat und hindurchlief. Er verschwand auf die Straße.
Henri rannte hinterher. Als er am Hauseingang stand, blickte er rasch die Treppen der ansteigenden Straße nach rechts und die der abfallenden Straße nach links hinunter. Er sah niemanden. Der Eindringling musste sehr schnell gewesen sein. Oder er hielt sich im Schatten irgendeines Hauseingangs versteckt.
Henri spähte an den unzähligen Holzterrassen und Wintergärten empor, die sich an die umliegenden Häuser schmiegten. Ein spärliches Feuer aus zwei Kohlenbecken erleuchtete die Straße, durch die in der Nacht gewöhnlich immer wieder bewaffnete Soldaten patrouillierten, nur spärlich. Es ließ sich kein Einwohner blicken. Henri erinnerte sich, dass er nur notdürftig bekleidet war, er fror bereits. In diesem Zustand konnte er keine Verfolgung aufnehmen.
Er ging ins Haus zurück. Die beiden Freunde erwarteten ihn. Joshua hielt ein Eisen empor und sah ihn fragend an.
»Ein Brecheisen. Jemand wollte uns besuchen.«
»Wer war es?«, fragte Uthman.
»Ich konnte ihn nicht erkennen. Auf der Straße war er verschwunden. Es hat kaum Zweck, ihm draußen nachzulaufen, es gibt zu viele Verstecke für jemanden, der sich auskennt.«
»War es ein gewöhnlicher Dieb?«
Henri zuckte mit den Schultern. »Kann sein. Kann auch nicht sein. Es könnte auch jemand gewesen sein, der wusste, wer wir sind.«
»Aber das ist doch ausgeschlossen! Niemand kennt uns!«