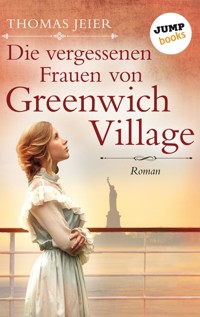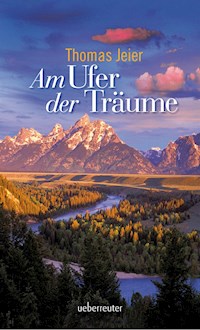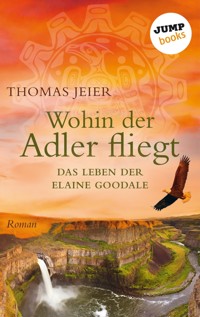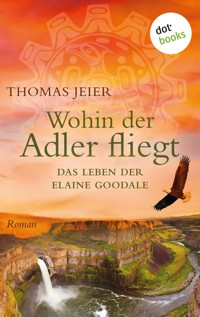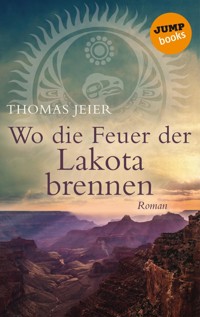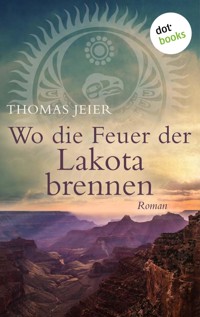Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Frau zwischen Erdenbewohnern und Geisterwelt – und zwischen zwei Männern: "Die Tochter des Schamanen" von Thomas Jeier als eBook bei dotbooks. Seit Jahrhunderten leben die Anishinabe friedlich und genügsam im Norden Amerikas – bis der Weiße Mann kommt … Schon lange vor den großen Schlachten sieht die Schamanin Otterfrau das Schicksal ihres Volkes in ihren Träumen. Der große Ottawa-Häuptling Pontiac ist der Einzige, der die weit verstreuten Stämme des Nordens vereinen und erfolgreich gegen die brutalen Eroberer in den Krieg führen kann – und Otterfrau muss ihm mit ihren Kräften zur Seite stehen. Als sie jedoch den englischen Soldaten David trifft, droht die Heilige Frau von ihrer Mission abzukommen. Kann von dem Mann mit den sanften Augen wirklich eine Gefahr ausgehen? Nur der Große Geist Kitche Manitu kennt die Antwort – und gibt den Weg vor, den Otterfrau mutig beschreiten muss … Hervorragend recherchiert und einfühlsam geschrieben: "Es ist immer ein Genuss, ein Buch von Thomas Jeier zu lesen." Bücherschau, Wien Jetzt als eBook kaufen und genießen: "Die Tochter des Schamanen" von Thomas Jeier. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 490
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Seit Jahrhunderten leben die Anishinabe friedlich und genügsam im Norden Amerikas – bis der Weiße Mann kommt …
Schon lange vor den großen Schlachten sieht die Schamanin Otterfrau das Schicksal ihres Volkes in ihren Träumen. Der große Ottawa-Häuptling Pontiac ist der Einzige, der die weit verstreuten Stämme des Nordens vereinen und erfolgreich gegen die brutalen Eroberer in den Krieg führen kann – und Otterfrau muss ihm mit ihren Kräften zur Seite stehen. Als sie jedoch den englischen Soldaten David trifft, droht die Heilige Frau von ihrer Mission abzukommen. Kann von dem Mann mit den sanften Augen wirklich eine Gefahr ausgehen? Nur der Große Geist Kitche Manitu kennt die Antwort – und gibt den Weg vor, den Otterfrau mutig beschreiten muss …
Hervorragend recherchiert und einfühlsam geschrieben: „Es ist immer ein Genuss, ein Buch von Thomas Jeier zu lesen.“ Bücherschau, Wien
Über den Autor:
Thomas Jeier wuchs in Frankfurt am Main auf, lebt heute bei München und „on the road“ in den USA und Kanada. Seit seiner Jugend zieht es ihn nach Nordamerika, immer auf der Suche nach interessanten Begegnungen und neuen Abenteuern, die er in seinen Romanen verarbeitet. Seine über 100 Bücher wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt und mehrfach ausgezeichnet.
Bei dotbooks erscheint auch:
Biberfrau
Weitere Titel sind in Vorbereitung.
Die Website des Autors: www.jeier.de
Der Autor im Internet: www.facebook.com/thomas.jeier
***
eBook-Neuausgabe April 2017
Copyright © der Originalausgabe 1996 by Schneekluth
Copyright © der Neuausgabe 2017 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/TTStudio (Landschaft), robert cicchetti (Tipi), bastinda 18 (Ornament)
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (sh)
ISBN 978-3-96148-012-8
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort Die Tochter des Schamanen an: [email protected]
Gerne informieren wir Sie über unsere aktuellen Neuerscheinungen und attraktive Preisaktionen – melden Sie sich einfach für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Thomas Jeier
Die Tochter des Schamanen
Roman
dotbooks.
FÜR PHILIP
Ich komme aus dem alten Leben, ich suche neues Leben.Lied der Midewiwin
Engländer, deine Nation denkt, daß wir wie die weißen Männer sind und nicht ohne Brot und Schweinefleisch und Feuerwasser leben können. Aber du solltest wissen, daß uns der Herr des Lebens in diesen Wassern und Wäldern alles gegeben hat, was wir zum Leben brauchen.
Pontiac
1 DIE STIMMEN DER GEISTER
DIE BÄUME WUSSTEN, daß ihr Vater sterben würde. Das Rascheln ihrer Blätter klang bedrohlich und erschreckte die Tiere und die Pflanzen und die Steine. Der sanfte Wind, der beinahe liebkosend über den Fluß strich, frischte auf und versteckte sich zwischen den Buchen und Birken, die am Ufer wurzelten. Auch er wußte, was geschehen würde. Die Stimmen der Geister waren überall zu hören und verkündeten den gewaltsamen Tod eines weisen Mannes, der auf die andere Seite ins Land der Seelen wandern würde.
Otterfrau zog das Paddel durch den schäumenden Fluß und spürte den Wind in ihrem Gesicht. Sie hatte siebzehn Winter gesehen und gehörte zu den schönsten Frauen ihres Dorfes. Ihr Körper war schlank und biegsam, die weiche Haut leuchtete kupferfarben in der Sonne. Ihre Augen glänzten geheimnisvoll und erinnerten an die verträumte Sanftmut eines jungen Rehs. Ihre Bewegungen waren geschmeidig wie bei einem Berglöwen, und die jungen Krieger, die ihr geheimnisvolles Lächeln gesehen hatten, beteten zu Kitche Manitu, daß sie ihr Werben erhöre. Sie war noch keinem Mann versprochen und verbrachte die meiste Zeit bei ihrem Vater, der sie zu seiner Nachfolgerin erkoren hatte und ihr alles beibrachte, was eine Heilerin wissen mußte.
Sie drehte sich um und sah, daß er mit offenen Augen träumte. Sieht-über-den-Fluß saß gebückt im hinteren Teil des Kanus und bewegte gedankenverloren das Paddel. Er träumte oft und hatte schon als junger Mann mit den Geistern gesprochen, noch bevor er zum Ufer des großen Wassers gezogen war und seine Vision erlebt hatte. Im Totem der Schildkröte wurden große Heiler geboren, aber er war auch ein Denker, der über den Sinn des Lebens nachdachte und als führendes Mitglied der Midewiwin ein vorbildliches Leben führte. Nur wer danach trachtete, möglichst weise zu leben, wurde in die Medizingesellschaft aufgenommen.
Auch der Schamane hatte die Bäume verstanden. Er glaubte die Stimme von Chibiabos zu hören, der im Land der Seelen wohnte und mit den Bäumen, Bergen, Flüssen und Tieren musizierte. Die Lieder des geheimnisvollen Wesens erzählten von dem Leben, das er bei den Anishinabe geführt hatte, als vergnügter Sänger, Tänzer und Geschichtenerzähler, der niemals auf die Jagd und niemals in den Krieg gezogen war. Als er von den jungen Kriegern gehänselt wurde, fuhr er in einem Kanu auf das große Wasser, um den starken Sturm zu besiegen. Das Boot kenterte, und er ertrank. Seine Brüder und Schwestern fühlten sich schuldig und sangen und musizierten so lange, bis er sich aus dem Wasser erhob. Er bekam einen Ehrenplatz im Land der Lebenden und wurde als Herr der Erde und des Wassers im Land der Seelen verehrt.
Sieht-über-den-Fluß schmunzelte, als ihm die Geschichte durch den Kopf ging. Er hatte sie oft erzählt, und vor allem die Kinder waren begeistert gewesen von der wundersamen Rettung des Mannes. Jetzt würde er über den dunklen Fluß paddeln und im Land der Seelen eine neue Heimat finden. Die Lieder seines Volkes würden ihn nicht zurückholen. Er war ein Schamane, und er hatte sich als Mitglied der Midewiwin bemüht, ein vollkommenes Leben zu führen. Er hatte das Leben vieler Menschen gerettet, weil er die bösen Geister beschwichtigt hatte und die Geheimnisse der Pflanzen kannte, aber er würde es nicht schaffen, seinen eigenen Tod zu besiegen. Das hatte noch kein Sterblicher fertiggebracht.
Er fürchtete den Tod nicht. Auf der anderen Seite des Flusses gab es keinen Kummer, und die Fleischtöpfe waren immer gefüllt. Er würde seine zweite Frau wiedertreffen, die im letzten Winter an einer Krankheit des weißen Mannes gestorben war, und er würde vor seinem Wigwam sitzen und den Kindern die Geschichten erzählen, die sie nie gehört hatten. Der Gedanke machte ihn froh. Er hatte noch keine sechzig Winter gesehen, aber hinter ihm lag ein ganzes Leben, und wenn sein Tod vorherbestimmt war, gab es nichts, was er dagegen tun konnte. Inaen-daug-wut, so wird es geschehen.
Seine Tochter wußte genug, um als Heilerin zu den Wigwams der Anishinabe zurückzukehren. Sie hatte seine geheimnisvollen Kräfte geerbt und kannte die Macht der Geister. Die weisen Männer des Volkes würden sie einladen, der Midewiwin beizutreten, und sie würde ein beispielhaftes Leben führen. Die Bäume wußten nichts davon, und auch der Fluß erwähnte seine Tochter nicht, aber wenn er in ihre verträumten Augen blickte, gab es keinen Zweifel. Otterfrau war eine Träumerin. Sie wußte, welche Macht von den Geistern ausging, und welche Bedeutung die Träume hatten.
Otterfrau hörte das Summen der Moskitos, die über dem Wasser schwirrten. Der Fluß war ruhig und glatt und breitete sich träge zwischen den bewaldeten Ufern aus. Die Sonne warf helle Blitze auf das dunkle Wasser. Ein Raubvogel krächzte am Himmel und verschwand im dunklen Wald. Die Bäume waren verstummt, und selbst der Fluß und die Steine am Ufer schwiegen jetzt, aber in diesem Schweigen lag etwas Bedrohliches, und Otterfrau blickte sich besorgt zu ihrem Vater um. »Die Stille ist unheimlich.«
Sieht-über-den-Fluß lächelte bedrückt. Die Bäume hatten nur zu ihm gesprochen, und er wollte seine Tochter nicht erschrecken. »Ich weiß, mein Kind. Die Hitze erstickt alles Leben. Anim-kee ist böse, weil wir ihn vergessen haben. Wenn die Sonne über den Bäumen verschwindet, wird er die Wolken schlagen, bis sie zu weinen anfangen und feurige Blitze auf die Erde schicken.«
Otterfrau blickte erstaunt zum Himmel. Es sah nicht nach einem Gewitter aus, aber ihr Vater kannte die geheimnisvollen Kräfte besser als sie, und die Geister hatten ihm wahrscheinlich längst erzählt, daß es regnen würde. »Schaffen wir es bis zum Dorf?«
»Nein«, antwortete er, »aber hinter der nächsten Biegung finden wir Schutz.« Er wußte, daß es dort steil aufragende Felsen gab, die den Regen abhielten. Ein guter Platz zum Sterben.
Sie wichen einem entwurzelten Baumstamm aus, der träge mit der schwachen Strömung trieb. Das Kanu lag ruhig im Wasser, und ihre gleichmäßigen Paddelschläge verursachten kaum Wellen. ›Der Fluß, der schläft‹ nannten die Anishinabe dieses Wasser. Er floß direkt an ihrem Sommerlager vorbei und versorgte sie mit allem, was sie während der heißen Monate zum Leben brauchten. Es gab Fische im Überfluß, fette Schildkröten, die über dem großen Feuer gebraten oder in den Suppentopf geworfen wurden, und an seinen Ufern wuchsen Brombeeren, Heidelbeeren und wilde Pflaumen.
Otterfrau hatte die Bäume nicht verstanden, spürte aber, daß ihnen Unheil drohte. Großvater Donner war ein grimmiger Mann, der böse war, weil er nicht wie Vater Sonne und Mutter Erde verehrt wurde, und Menschen, Tiere und Pflanzen mit seinen glühenden Pfeilen tötete, wenn er besonders wütend war. »Sind die Geister böse auf uns?« fragte sie. »Wir haben viel gebetet in diesem Sommer, und wir haben ihnen viel Tabak geopfert.«
»Ich weiß es nicht«, antwortete er wahrheitsgemäß. Er hatte keine Ahnung, warum ihn die Geister schon jetzt ins Land der Seelen riefen. Hatte er ein Unrecht begangen? Sehnte sich seine tote Frau nach ihm? Wurde er in dem Land jenseits des dunklen Flusses gebraucht? Er würde es bald erfahren, aber er wollte nicht, daß sich seine Tochter um ihn sorgte und ebenfalls getötet wurde, wenn es soweit war. Sie mußte leben. Die Bäume wußten nur, daß er sterben würde.
»Du verbirgst die Wahrheit vor mir«, erkannte Otterfrau. Sie ließ das Paddel treiben und sah ihn ernst an. »Warum sagst du mir nicht, was dich bedrückt? Was haben dir die Bäume erzählt?«
»Sie wollen nicht, daß du es weißt«, wich er aus.
»Wirst du sterben?« fragte sie direkt.
»Das weiß nur der Herr des Lebens«, antwortete er.
Otterfrau gab sich damit zufrieden und paddelte weiter. Sie fühlte, wie sich ein schweres Gewicht auf ihre Brust legte.
Das Lederkleid und die Leggins, mit bunten Blumenmustern kunstvoll verziert, klebten an ihrem Körper und nahmen ihr die Luft zum Atmen. Ihre langen Haare klebten an der Stirn. Die Hitzeschleier hingen bedrohlich über dem Fluß und wurden zu einem Nebel, der sie verschlingen und in die Dunkelheit locken wollte. Die Geister kündigten großes Unheil an, und es gab nichts, was sie tun konnte.
Sie paddelten um die Biegung und ließen sich minutenlang von der Strömung treiben. Vor ihnen lag eine weite Lichtung, aus der sich graue Felsen bis in den Himmel erhoben. Eine beinahe unheimliche Stille erwartete sie. Der Fluß schwieg, die Steine verharrten stumm am Ufer, und die Bäume hielten den Atem an. Ein Reh erschien auf der Lichtung und verschwand im Wald. Im lauen Sommerwind zitterten Grashalme und bunte Blumen.
Wenn die Natur schwieg, geschah etwas Unheilvolles, das hatte sie vor vielen Wintern gelernt. Wenn selbst die Bäume und die Blumen erstarrten und die Tierwesen keinen Laut mehr von sich gaben, waren die bösen Geister aus ihrem Reich gekommen. »Ich habe Angst«, sagte sie leise, »ich spüre die bösen Geister.«
»Anim-kee«, erwiderte ihr Vater, »der Herr des Donners.«
Fast unbemerkt waren dunkle Wolken aufgezogen. Sie schoben sich vor die Sonne und warfen dunkle Schatten auf die Lichtung. Ein leises Grollen kündigte ein Gewitter an. Die schwüle Luft hing naß und schwer über dem Wasser und lähmte die Bewegungen des Schamanen und seiner Tochter. Sie paddelten ans Ufer, stiegen aus dem Kanu und zogen es an Land. Otterfrau band das Boot mit einer Rohhautschnur an einen tiefhängenden Weidenast, ihr Vater nahm seine Flinte und die Ledertasche mit den Kräutern, die sie im Tal der Singenden Winde gesammelt hatten. Das war der Platz, an dem Sieht-über-den-Fluß vor vielen Wintern seine Vision gehabt hatte, und wo es die besten Heilkräuter gab.
»Wir lagern dort drüben«, sagte der Schamane, »in der kleinen Höhle. Dort sind wir sicher vor Anim-kee und seinem Zorn.«
Die Höhle war nicht mehr als eine Einbuchtung in der grauen Felswand. Die Spuren eines alten Feuers zeigten ihnen an, daß schon andere Menschen hier gelagert hatten. Sie entzündeten ein kleines Feuer, und Otterfrau kochte Kräutertee in dem Blechnapf, den sie von dem Mehtikosch bekommen hatte. Sie handelten seit vielen Wintern mit den Händlern der Blauröcke, und Otterfrau hatte sogar gelernt, mit ihrer Zunge zu sprechen. Auch das Messer mit der harten Klinge und ein Löffel stammten von den Franzosen.
Vater und Tochter hüllten sich in die Baumwolldecke, die der Schamane gegen einige Biberfelle eingetauscht hatte, und setzten sich ans Feuer. Sieht-über-den-Fluß warf etwas Tabak in die Flammen und sprach ein kurzes Gebet. »Beschütze die junge Frau, die mein Erbe antreten wird, und gib ihr die Kraft, ein vorbildliches Leben zu führen. Sei bei ihr, wenn sie dich braucht, und schenke ihr die Bedachtsamkeit eines Falken.« Er atmete den Tabakduft ein, der aus dem Feuer stieg, und wandte sich an Anim-kee, der immer stärker auf die Wolken einschlug und eine erste Feuerlanze auf das Land schleuderte. »Richte deinen Zorn gegen unsere Feinde, und vernichte sie, denn wir haben so gelebt, wie du es verlangst.«
Otterfrau trank von dem Kräutertee und blickte nachdenklich in den Regen. Der Himmel war noch dunkler geworden, und schwere Tropfen prasselten auf den Boden. Der Fluß erzitterte unter dem Regen und nahm eine schiefergraue Färbung an. Die Bäume sprachen wieder und verrieten dem Schamanen, daß sein Ende bald bevorstand. Er blickte nachdenklich ins Feuer und stimmte das traurige Lied an, das er beim Tod seiner Frau gesungen hatte.
Jetzt verstand auch seine Tochter. Sie griff in panischer Angst nach seinem Arm und rief: »Das darfst du nicht tun! Du darfst dieses Lied nicht singen! Du wirst leben, mein Vater!« Sie begann zu schluchzen, und er nahm sie in den Arm und drückte sie.
»Der Herr des Lebens hat es so bestimmt«, erwiderte er leise. »Ich weiß nicht, wie ich sterben werde, aber ich weiß, daß ich über den dunklen Fluß paddeln und ins Land der Seelen ziehen werde.«
»Das ist nicht wahr!« rief sie. »Das ist nicht wahr, Vater!«
»Sei stark, meine Tochter.«
Sie ließ von ihm ab und weinte leise vor sich hin. Der Schmerz fraß sich langsam in sie hinein und nagte an ihrem Körper. Sie liebte ihren Vater, und sie verehrte ihn, weil er so gelebt hatte, wie es die Midewiwin von einem Schamanen verlangten. Warum wollte der Herr des Lebens, daß er die Erde schon jetzt verließ?
Salzige Tränen rannen über ihr Gesicht und blieben an ihren Lippen hängen. »Das darf nicht sein!« rief sie immer wieder. Sie reckte eine Faust zum Himmel und verhöhnte das Donnern von Anim-kee, der wütend über den Wolken tobte. »Ich werde nicht zulassen, daß sie dich holen! Ich werde es nicht zulassen, Vater!«
Sie blickte in den grauen Regen und sah ein Kanu über den Fluß kommen. Ein großes Boot mit sechs Kriegern. Sie duckten sich unter dem prasselnden Regen und steuerten genau auf sie zu. Nadowa, erkannte sie entsetzt. Sechs kräftige Männer, die ihr Feuer längst gesehen hatten und Flinten und Kriegsbeile in den Händen hielten. Sie waren auf der Jagd gewesen, und nur das Gewitter hatte sie um die Biegung des Flusses getrieben, aber sie kamen, um zu töten. Sie waren die Todfeinde ihres Volkes.
Sieht-über-den-Fluß ahnte, was sie vorhatten und warf die Flinte seiner Tochter zu. »Ich werde sterben«, sagte er ruhig, »nimm die Flinte und klettere in die Felsen. Du wirst leben.«
»Ich lasse dich nicht allein, Vater!«
»So will es der Herr des Lebens«, sagte der Schamane. Er zog sein Kriegsbeil und rannte den angreifenden Nadowa entgegen. Sein heiserer Kriegsruf hallte unheilvoll über die Lichtung.
Otterfrau gehorchte ihrem Vater und stieg in die Felsen hinauf. Sie wußte, daß es keinen Zweck hatte, sich gegen den Herrn des Lebens aufzulehnen. Kitche Manitu war der Schöpfer aller Dinge, er hatte Menschen, Tiere und Pflanzen erschaffen, und die Bisamratte, die das Erdreich der großen Insel zusammengetragen hatte, war von ihm gekommen. Er hatte alles gegeben, und er konnte alles nehmen. Wenn er beschlossen hatte, ihren Vater in das Land der Seelen zu schicken, dann gab es einen Grund dafür.
Sie kletterte über den steilen Pfad, den irgendwelche Tiere in das Erdreich getreten hatten. Der Regen peitschte ihr ins Gesicht, und der Donner grollte als vielfaches Echo zwischen den Felsen. Ein Blitzt zuckte vom Himmel. Sie blickte zurück und sah, wie ihr Vater von einer Kugel ins Gras geworfen wurde und sich die Nadowa siegestrunken auf ihn stürzten. Streitäxte blitzten auf und gruben sich in seinen leblosen Körper. Ein Krieger griff nach seinem Messer und schwenkte dann den blutigen Skalp ihres Vaters.
Otterfrau spürte die Waffe in ihren Händen. Sie riß die Flinte nach oben und drückte den Abzug durch. Die Kugel zischte wirkungslos in den Regen. Höhnisches Gelächter antwortete ihr. Die Nadowa riefen etwas in ihrer Sprache und machten sich an ihre Verfolgung. Sie bewegten sich mit der Sicherheit erfahrene Jäger, die überzeugt waren, ihre Beute zu erwischen.
Sie ließ die Flinte fallen und griff nach ihrem Messer. Mitten in der Bewegung hielt sie inne. Kitche Manitu wollte, daß sie lebte, das hatte ihr Vater gesagt. Sie durfte sich den Nadowa nicht entgegenstellen. Sie hatte keine Chance gegen die riesigen Krieger.
Wütend ergriff sie die Flucht. Sie hatte keine Angst, und der Schmerz über den Tod ihres Vaters war noch nicht in ihre Seele gedrungen. Sie wußte nur, daß sie den Feinden entkommen mußte. Ein heftiger Windstoß schleuderte sie zu Boden. Sie fiel in den Morast und warf instinktiv die Arme über den Kopf, als ein neuer Donnerschlag die Erde erzittern ließ. Wollte der Herr des Lebens das Land zerstören? Wollte er alles vernichten, was er geschaffen hatte? Sie verdrängte die quälenden Gedanken und stützte sich vom Boden hoch. Der Regen wurde immer stärker. Sie konnte nicht einmal die Bäume erkennen, die zwei oder drei Schritte von ihr entfernt zwischen den Felsen wuchsen. Aber sie mußte weiter.
Mit aller Kraft stemmte sie sich gegen den stürmischen Wind. Sie senkte den Kopf gegen den prasselnden Regen und hastete den schmalen Pfad hinauf. Die Krieger waren dicht hinter ihr. Wie eine Blinde tastete sie sich durch das Unwetter, immer weiter, bis sie keine Luft mehr bekam und die Erschöpfung sie zu Boden drückte. Sie klammerte sich mit beiden Händen an den nassen Fels. Ein Blitz flammte auf und tauchte die Felsen in geisterhaftes Licht. Kalt und naß ragten sie aus dem verwaschenen Grau des Regens. Heftiger Donner rollte und verklang in der Ferne.
Otterfrau atmete tief durch und blickte zurück. Die Nadowa waren keine hundert Schritte hinter ihr und benahmen sich wie Wölfe, die ein krankes Reh gestellt hatten. Sie wußten, daß es kein Entkommen für die junge Frau gab, und wollten so lange wie möglich ihren Spaß mit ihr haben. Sie scherzten und tauschten obszöne Bemerkungen aus. Sie würden die junge Frau vergewaltigen, der Reihe nach, und dann würden sie ihren leblosen Körper von den Felsen werfen. So redeten sie, und Otterfrau konnte froh sein, daß sie die Sprache ihrer Feinde nie gelernt hatte. Sie kam vom Boden hoch und rannte weiter.
Jetzt empfand sie Angst, und als sie das Ende des Pfades erreicht hatte, erkannte sie, daß es keine Hoffnung mehr gab. Hundert Schritte unter ihr bewegte sich der Fluß. Wenn sie sprang, brach sie sich das Genick. Wenn sie blieb, wurde sie das Opfer ihrer Feinde. Sie bewegte sich einen Schritt nach vorn und verlor das Gleichgewicht. Mit einem heiseren Schrei stürzte sie in die Tiefe.
2 NANABUSH IST EIN VOGEL
OTTERFRAU SPÜRTE NOCH, wie der Fluß über ihr zusammenschlug. Heftiger Schmerz durchzuckte ihren Körper, und auf ihrem Rücken loderte ein großes Feuer. Sie hörte, daß der Fluß zu ihr sprach, und sie fühlte den Druck des Wassers, der immer stärker wurde und alle Luft aus ihrem Körper preßte. Ich werde sterben, dachte sie, und als sie verzweifelt nach Luft rang und einen Schwall des grauen Wassers in ihren Lungen spürte, wurde es dunkel, und sie erwachte in einem Kanu und paddelte durch die mondhelle Nacht.
Sie war trocken und trug ihr schönstes Kleid. Ihre langen Haare waren mit Bärenfett eingeschmiert und glänzten im sanften Licht des Mondes. Sie trug die bunten Glasperlen, die sie von den Mehtikosch bekommen hatte, und die Mokassins mit den blauen und roten Blumenmustern. Von ihren Schultern hingen dünne Streifen aus Hermelinfell. Ihr Körper war durchtrainiert und geschmeidig, und sie zog das Paddel mit kräftigen Schlägen durchs Wasser.
Düstere Nebelschwaden zogen über den Fluß. Die Strömung war stark, und sie brauchte ihre ganze Kraft, um nicht abgetrieben zu werden. Sie wollte zum anderen Ufer. Im Mondlicht, das wie flüssiges Silber im Wasser schwamm, erkannte sie schäumende Stromschnellen und wirbelnde Strudel. Entwurzelte Baumstämme drehten sich und stießen gegeneinander. Weiter flußabwärts war das Wasser ruhiger. Ein frischer Wind trieb über den Fluß und brachte den geheimnisvollen Klang dunkler Trommeln zu ihr.
Sie verschnaufte einen Augenblick und sah, daß noch andere Menschen über den Fluß paddelten. Männer, Frauen und Kinder. Die meisten hatten weißes Haar. Sie wollten alle zum anderen Ufer und kämpften gegen die starke Strömung an. Einige Kanus wurden abgetrieben und verschwanden in der Dunkelheit. Andere kamen besonders schnell voran. Sie erkannte ihren Vater in dem Boot, das keine drei Schritte von ihr entfernt durch das Wasser trieb, und wollte etwas zu ihm sagen, aber die Stimme versagte ihr. Auch er war unfähig, mit ihr zu sprechen. Sie waren durch ein unsichtbares Band verbunden und spürten die Nähe des anderen.
Ein tiefes Glücksgefühl erfüllte Otterfrau. Sie wußte jetzt, daß sie auf dem Fluß waren, der das Land der Lebenden vom Land der Seelen trennte. Sie paddelten zu den ewigen Jagdgründen, die bis zum Ende aller Zeiten ihre Heimat sein würde. Sie würden bei ihrem Vater weilen, in seinem Wigwam wohnen und dieselbe Luft atmen. Sie waren beide gestorben, und ihre Körper existierten nur in ihrer Einbildung. Sie waren geisterhafte Wesen, die ein neues Bewußtsein angenommen hatten und im Land jenseits des Flusses die geheimnisvolle Kraft von Kitche Manitu erfahren würden.
Die Strömung wurde immer stärker. Sie pflügte das Paddel mit aller Kraft durch das Wasser, wirbelte über einem Strudel und schaffte es mit letzter Kraft, aus den Stromschnellen zu entkommen. Ihr Vater war aus ihrem Blickfeld verschwunden. Sie glaubte zu erkennen, wie er am anderen Ufer aus dem Kanu stieg und in den dunklen Wäldern verschwand. Sie wollte nach ihm rufen, aber ihre Stimme versagte wieder. Bekümmert paddelte sie weiter. Sie erreichte das andere Ufer, stieg aus und zog das Boot in den Sand.
Das Trommeln war verstummt. Eine friedliche Stille durchflutete die dunklen Wälder und erfüllte sie mit einem Gefühl, das sie nicht bestimmen konnte. Sie war zufrieden. Sie war glücklich. Sie war in einem Land, in dem alle Wünsche erfüllt wurden und in dem ewiger Frieden herrschte. Obwohl es noch dämmrig war, spürte sie die kräftigen Farben der Blumen, und als sie auf einen Hügel stieg, sah sie endlose Wälder, spiegelklare Seen und sanfte Täler.
Ein bunter Vogel tauchte aus dem Wald und ließ sich auf dem Rand ihres Kanus nieder. »Ich grüße dich, meine Tochter«, sagte er zu Otterfrau. »Ich bin Nanabush, der Abgesandte des großen Kitche Manitu, und ich bin gekommen, um dich zu warnen.«
Otterfrau blieb stehen und blickt den Vogel an. Sie war wenig überrascht, der legendären Gestalt ihres Volkes zu begegnen. Nanabush war von einer menschlichen Mutter und einem Geist gezeugt worden und verfügte über Kräfte, die kein Mensch kannte. »Gehe zu den Anishinabe und lehre sie, bis sie stark sind«, hatte sein Geist-Vater zu ihm gesagt, und er war ins Land der Lebenden zurückgekehrt, um sein Volk zu unterrichten. Er konnte jede Gestalt annehmen. Er konnte ein Mensch, ein Tier oder ein Stein sein, er konnte sich in eine Wolke, einen Windhauch oder einen Regentropfen verwandeln. Nur so war es ihm möglich, sein Volk zu unterrichten. Seine Schwäche war, daß er die irdischen Grenzen jeder Form annehmen und ertragen mußte. Das machte ihn so beliebt bei den Anishinabe. Er war ein übernatürliches Wesen, aber als Mensch zeigte er dieselben Schwächen wie sie.
Als Adler konnte er sich in die Lüfte erheben und den Menschen zeigen, was wirklicher Mut ist, aber er konnte nicht wie eine Ente ins Wasser tauchen und einen Fisch fangen. Als Baum konnte er fest verankert im Boden stehen und den Winden trotzen, aber er konnte nicht wie ein Eichhörnchen durch den Wald huschen. Als Mann oder Frau war er mutig oder feige, aufrichtig oder falsch, liebevoll oder voller Haß wie ein richtiger Mensch. Er hielt den Anishinabe einen Spiegel vor und bewies ihnen, daß es selbst für ein übernatürliches Wesen schwierig ist, vollkommen zu leben.
»Was willst du mir sagen?« fragte Otterfrau.
Der Vogel blickte die junge Frau an. Sein buntes Gefieder glänzte im Mondlicht, als er sprach. »Zwei Winter sind vergangen, seit die Krieger der Ottawa gegen die Agalaschima kämpften«, sagte er. »Der große Pontiac zog mit den Mehtikosch in eine große Schlacht und kämpfte neben dem Häuptling der Blauröcke gegen eine Übermacht des Feindes. Erinnerst du dich daran, meine Tochter?«
Otterfrau nickte bedrückt. Sie würde den Tag, an dem Pontiac aus dem Krieg zurückgekehrt war, niemals vergessen. Die Blätter der Bäume waren bunt, und über dem Fluß, an dem sie lagerten, wogte dichter Nebel. Die langen Kanus tauchten aus dem weißen Dunst. Der Kriegshäuptling stand im vordersten Boot, über den Schultern die blaue Uniformjacke seines französischen Freundes. General Montcalm hatte ihm die Jacke geschenkt, nachdem er von der Kugel eines Engländers getroffen worden war. »Die Franzosen sind eure Freunde«, sagte er, »sie kommen zurück und helfen euch, die Engländer zu vertreiben. Vertrau unserem König, Pontiac!«
Zwei Winter waren vergangen, und der blutige Krieg zwischen Franzosen und Engländern tobte immer noch. Sie bekämpften sich auf dem großen Wasser, das keine Ufer hat, und in den Wäldern jenseits des mächtigen Flusses. Die Anishinabe beteiligten sich nicht mehr an den Kämpfen. Es war wichtiger, den Mais und den Reis zu ernten, frische Beeren zu sammeln und auf die Jagd zu gehen. Sie hatten keine Zeit mehr für den Krieg. Solange die Händler der Mehtikosch in ihr Dorf kamen und die Waren des Weißen Mannes brachten, gab es keinen Grund, sich gegen die Agalaschima aufzulehnen. Der König der Mehtikosch war mächtig. Er würde dafür sorgen, daß die Agalaschima das Land verließen.
»Das große Fort am Roten Fluß, das sie Detroit nennen, ist in die Hände der Agalaschima gefallen«, erklärte der Vogel.
»Auch das weiß ich«, erwiderte Otterfrau. Das Sommerlager ihres Volkes war damals nur einen Tagesmarsch vom Fort des weißen Mannes entfernt gewesen, und sie hatte den Lärm gehört, als die Agalaschima das Fort übernommen und ihre Fahne gehißt hatten.
»Die Agalaschima sind eure Feinde«, sagte der Vogel. Seine Stimme war laut und klar, wurde aber nur von ihr gehört. Die anderen Menschen, die ihre Kanus auf den Sand zogen und das Ufer betraten, gingen achtlos vorbei. »Sie sind mächtig und haben viele Feuerrohre. Sie vertreiben alle Händler der Mehtikosch aus eurem Land und schicken ihre eigenen Händler zu euch.«
Otterfrau blickte den Vogel erstaunt an. Davon hatte sie noch nichts gehört. »Die Händler der Mehtikosch sind unsere Freunde«, erwiderte sie erstaunt, »warum sollten sie das Land verlassen? Sie sind stark und haben keine Angst vor den Agalaschima.«
»Die Agalaschima jagen sie davon. Sie werden euch billige Waren anbieten und teure Felle dafür verlangen. So habe ich es von Kitche Manitu erfahren. Du wirst es wissen, wenn du in euer Dorf zurückkehrst und vor dem Kriegshäuptling stehst.«
»Pontiac?«
»Pontiac«, wiederholte der Vogel.
»Warum läßt Kitche Manitu das zu?« fragte sie bedrückt. »Er ist der Herr des Lebens, er hat uns erschaffen, und er ist für unser Wohl verantwortlich. Warum duldet er, daß die Soldaten mit den roten Röcken unsere Freunde vertreiben und das Land besetzen?«
»Das weiß ich nicht, meine Tochter. Ich bin Nanabush und teile dir mit, was Kitche Manitu entschieden hat. Mehr kann ich nicht tun. Es steht mir nicht zu, seine Entscheidungen in Frage zu stellen.«
Otterfrau dachte darüber nach. Die Wege von Kitche Manitu waren unergründlich, und es fiel ihr schwer, ihn zu verstehen. Warum schickte er einen kalten Winter und ließ die Kinder verhungern? Warum lockte er die Männer in einen Krieg, den sie nicht gewinnen konnten? Warum nahm er den Anishinabe, was sie zum Leben brauchten? War er zornig, weil so viele Menschen ihres Volkes den Männern in den schwarzen Kutten glaubten? Wollte er die Anishinabe bestrafen, weil es Männer und Frauen gab, die das Kreuz des weißen Gottes an einer Kette um den Hals trugen? Sie hatte oft mit ihrem Vater darüber gesprochen, und der hatte mit den anderen Mitgliedern der Midewiwin diskutiert, aber niemand hatte eine Lösung gewußt. »Warum erzählst du mir das alles?« fragte sie.
»Das will ich dir verraten«, antwortete der Vogel, »höre gut zu, denn ich werde es nur einmal sagen. Es wird zu einem großen Krieg kommen. Pontiac, der große Kriegshäuptling, wird die Männer gegen die Agalaschima führen. Er ist der Einzige, der diese schwierige Aufgabe bewältigen kann.«
»Krieg?« rief Otterfrau entsetzt.
»Es gibt keinen anderen Weg.«
»Aber die blauen Soldaten der Mehtikosch haben uns verlassen! Wir dürfen keinen Krieg führen, solange sie uns nicht zur Seite stehen. Die Agalaschima sind stark und mächtig, das hast du selbst gesagt. Ohne unsere weißen Freunde haben wir keine Chance.«
»Pontiac weiß, wie er die Agalaschima besiegen kann«, sagte der Vogel.
»Er ist ein tapferer Mann«, stimmte Otterfrau zu, »der beste Kriegshäuptling, den unser Volk je hatte. Er ist viermal gestorben und viermal wiedererweckt worden, als er die Prüfungen der Midewiwin ablegte, und die Anishinabe bewundern ihn. Aber selbst er ist nicht unsterblich. Die Agalaschima werden ihn töten.«
Der Vogel blieb geduldig sitzen. »Pontiac hat keine Angst vor den weißen Männern. Er ist tapfer wie ein Bär und ausdauernd wie ein Wolf. Er wird die weißen Männer aus dem Land verjagen.«
»Das verspricht der Herr des Lebens?«
»Das sagt Nanabush, sein Gesandter.«
»Ich will dir glauben, Nanabush.«
Der Vogel spreizte sein Gefieder und badete im Mondlicht. Seine Stimme klang bedeutungsvoll, als er fortfuhr: »Du wirst bei dem Häuptling sein, wenn er gegen die weißen Männer zieht. Du wirst ihn beschützen. Du hast die Kraft, mit den Geistern zu sprechen. Du hörst, was die Bäume und die Steine sagen. Du wirst ihn auf seiner langen Reise begleiten und die bösen Geister von ihm abhalten.«
Otterfrau brauchte einige Zeit, bis sie die Worte des Vogels verstanden hatte. Sie sah ihn entgeistert an. »Wie kann ich das tun? Ich bin eine schwache Frau. Wie soll ich ihn beschützen?«
»Du weißt, was die Träume bedeuten«, erwiderte der Vogel ernst.
»Du bist stärker als die meisten Krieger. Du spürst, wenn dem Häuptling eine Gefahr droht, und du durchschaust die bösen Geister, die sich in seine Nähe schleichen und ihn töten wollen.«
»Ich bin nicht vollkommen, Nanabush!«
»Kitche Manitu hat dich erwählt«, bestimmte der Vogel. »Er hat deinem Vater die Kraft gegeben, dich in den Geheimnissen des Lebens zu unterrichten, und er hat dich vor den Kriegsbeilen der Nadowa gerettet. Er will, daß du den Häuptling beschützt. Du hast die Kraft, Otterfrau! Inaen-daug-wut, so soll es geschehen.«
»Ich bin schwach«, versuchte sie es noch einmal. »Warum hat Kitche Manitu nicht meinen Vater geschickt? Warum mußte er sterben, und warum soll ich leben? Warum, Nanabush?«
Der Vogel ging nicht darauf ein. »Hüte dich vor dem Krieger, der hinkt«, sagte er, »paß auf die Männer auf, die hinter dem Rücken deines Häuptlings nach dem Messer greifen. Der Häuptling stirbt, wenn du deine Augen vor der Falschheit verschließt.«
»Das verstehe ich nicht, Nanabush.«
»Du wirst es verstehen«, versprach der Vogel, »wenn die Gefahr droht, wirst du sie erkennen. Und jetzt steige in dein Kanu und fahre ins Land der Lebenden zurück. Lebwohl, Otterfrau.«
Der Vogel flog davon und verschwand in der Dunkelheit. Sie blickte ihm besorgt nach. Die Worte des legendären Wesens standen in der Luft, und sie wußte noch immer nicht, was sie davon halten sollte. Nachdenklich kletterte sie in das Kanu. Sie griff nach dem Paddel und ruderte ans andere Ufer zurück. Diesmal gab es keine Stromschnellen, und sie kam gut voran.
Auf der anderen Seite spürte sie den Schmerz, der nach dem Sturz durch ihren Körper gefahren war, und sie fühlte, wie der Fluß versuchte, sie in die Tiefe zu ziehen.
Sie öffnete die Augen und sah, daß sich ihr Körper im Geäst eines entwurzelten Stammes verfangen hatte. Vom Blitz getroffene Bäume verfügten über eine besondere Macht. Der Stamm hatte sich im Ufergehölz verfangen, und sie hing bis zur Taille im aufgewühlten Flußwasser.
Otterfrau klammerte sich an einen festen Ast. Sie übergab sich und spuckte das Wasser aus ihren Lungen. Ihr Hals brannte. Sie sehnte sich nach dem Frieden und der stillen Schönheit, die sie im Land der Seelen erfahren hatte. Warum muß ich leben, dachte sie, warum darf ich meinen Vater nicht begleiten? Warum stellst du mir eine Aufgabe, die ich nicht bewältigen kann? Beinahe gegen ihren Willen zog sie sich aus dem Fluß. Sie verharrte minutenlang im Uferschilf, dann kroch sie auf eine Lichtung und blieb liegen.
Die Sonne weckte sie zu neuem Leben. Die warmen Strahlen fielen auf die Lichtung und zauberten helle Flecke auf das Gras. Nur der feuchte Boden zeigte noch Spuren des Gewitters. Sie öffnete erneut die Augen und erblickte zwei Rehe, die friedlich am Waldrand grasten. Ein bunter Vogel stieg singend in die Luft, und sie wurde an Nanabush erinnert, obwohl er anders aussah und keine Anstalten machte, zu ihr zu sprechen. Eine Schildkröte plätscherte im warmen Wasser und verschwand im Uferschilf.
Die Schildkröte war ihr Totemtier. Ein gutes Zeichen, dachte sie erfreut. Vielleicht hilft sie mir, den Traum zu deuten und den schweren Auftrag von Kitche Manitu zu erfüllen. Sie stemmte sich vom Boden hoch und hielt sich an einem Birkenstamm fest. Ihr Körper war schwach. Ihre Beine zitterten, und sie kämpfte verzweifelt gegen eine Ohnmacht an. Dunkle Schatten tanzten vor ihren Augen. Sie wartete, bis sie wieder bei Kräften war, und setzte langsam einen Fuß vor den anderen. Ich muß den Körper meines Vaters nach Hause bringen, sagte sie zu sich. Wenn ich ihn nicht begrabe, findet er keine Ruhe im Land der Seelen.
Sie pflückte ein paar Preiselbeeren und stärkte sich. Unterwegs schöpfte sie Wasser aus einem schmalen Bach. Sie erreichte einen engen Pfad, den ihre Vorfahren durch das Unterholz getreten hatten, und wußte jetzt, daß sie nur einen kurzen Marsch von der Felshöhle entfernt war. Wenn Kitche Manitu ein Einsehen mit ihr hatte, lag ihr toter Vater immer noch im Ufersand. Sie stärkte sich erneut mit einigen Preiselbeeren und machte sich auf den Weg. Die Schmerzen waren immer noch in ihrem Körper, aber sie schwanden mit jedem Schritt, der sie ihrem Vater näherbrachte.
Sie bewegte sich mit äußerster Vorsicht. Es war möglich, daß die Nadowa noch vor der Höhle lagerten, und sie wollte nicht unter den Hieben ihrer Streitäxte sterben. Sie hoffte, daß die Feinde verschwunden waren und ihren toten Vater und das Kanu am Ufer zurückgelassen hatten. Sie war nicht stark genug, um gegen sechs ausgewachsene Krieger anzutreten, und sie hatte keine Waffe außer ihrem Messer. Sie hatte nie eine Flinte gebraucht.
Die Sonne stand schon weit im Westen, als sie die Biegung des Flusses erreichte. Sie war jetzt noch vorsichtiger und zögerte vor jedem Schritt. Für die letzten hundert Schritte brauchte sie fast eine Stunde. Sie hatte den Pfad verlassen und kauerte im dichten Unterholz, verschmolz mit dem Halbdunkel des Waldes. Ihre rechte Hand lag am Messer. Sie spähte auf die Lichtung und sah, daß die Krieger verschwunden waren. Auch ihre Kanus waren nicht mehr da. Der verstümmelte Körper ihres toten Vaters lag im Ufersand, und sein Birkenkanu hing zwischen den Weidenästen.
Otterfrau wartete lange, bis sie die Lichtung betrat. Sie wollte vermeiden, in eine Falle der Nadowa zu laufen. Dann ging sie zu ihrem toten Vater und schloß ihn in die Arme. So verharrte sie, bis es dunkel war. Erst als der Mond aufging und sein blasses Licht auf die Felsen fiel, ließ sie von ihm ab. Sie trocknete ihre Tränen und versprach ihrem toten Vater, ihn nach Hause zu bringen.
Gedankenverloren suchte sie nach ihrer Vorratstasche und der Flinte. Die Waffe war verschwunden, doch die Tasche lag immer noch in der Höhle, und selbst den Blechtopf hatten die Feinde nicht mitgenommen. Sie verstaute ihn und hängte sich die Tasche um. Die Spuren der Feinde verrieten ihr, daß sie nicht lange geblieben waren. Gleich nach dem Gewitter waren sie weitergezogen.
Mit tränenden Augen machte sie sich daran, den leblosen Körper ihres Vaters in das Kanu zu laden. Sie schob das Boot in den Fluß und stieg hinein. Mit kräftigen Schlägen paddelte sie auf dem Fluß. Der Fahrtwind blies ihr ins Gesicht und trocknete ihre Tränen.
3 AM FEUER DES FRANZOSEN
OTTERFRAU PADDELTE DURCH die Nacht. Der Bug ihres Kanus schob sich durch das dunkle Wasser und zerteilte die hellen Flecken, die der Mond auf die Wellen zauberte. In den Bäumen flüsterte der Wind. Ein Biber schwamm durch die Dunkelheit, den Kopf scheinbar hilfesuchend aus dem Wasser gereckt, und verschwand in seinem Bau. Die Steine lagen stumm im Uferschilf. Die Natur entbot dem toten Schamanen die letzte Ehre und hielt den Atem an.
Ein Otter tauchte aus dem Wasser auf und blickte zu dem Kanu hinüber. Er verfolgte das Boot mit seinen dunklen Augen und schien etwas sagen zu wollen, aber sein Mund bewegte sich nicht, und er schwamm ruhig zum Ufer. Auch die Schildkröte, das Totemtier des toten Schamanen, verharrte schweigend, als das Kanu vorbeifuhr. Das war ihre Art, den Medizinmann zu ehren. Sie tauchte in das dunkle Wasser und paddelte traurig davon.
Otterfrau hatte die blaue Decke über den Körper ihres toten Vaters gebreitet. Im Dorf würde sie ihn mit den Füßen nach Westen aufbahren und vier Tage warten, bis seine Seele den Körper verlassen hatte. Erst dann konnte sein Geist auf die andere Seite wandern. Sie hatte Angst vor diesem Augenblick. Wenn sein Geist im Land der Seelen war und sein Körper unter der Erde lag, würde sie allein sein. Ihre Mutter und ihre Schwester wohnten im selben Wigwam, aber sie war ihnen nie so nahe gewesen wie dem Vater. Nur mit ihm hatte sie über die großen Geheimnisse sprechen können.
Sie ließ die Hände mit dem Paddel sinken und sich von der Strömung treiben. Der Tod war schmerzhaft, besonders wenn er einen geliebten Menschen traf. Sie hatte ihrem Vater sehr nahe gestanden. Er hatte tief in ihre Seele geblickt und ihre Gedanken erraten. Er war näher bei ihr gewesen als alle Verwandten und alle Brüder und Schwestern ihres Totems. Sogar die Großmutter, die bei ihr gewesen war, als sie zum ersten Mal geblutet hatte, wußte nicht was sie dachte und welche Bilder in ihren Träumen erschienen und ihr Rätsel aufgaben.
Jetzt verließen sich die Dorfbewohner auf ihre magischen Kräfte. War sie erfahren genug, ihrem Volk als Seherin und Heilerin zu dienen? Sieht-über-den-Fluß hatte ihr alles beigebracht, was sie wissen mußte. Das hatte er vor einigen Tagen gesagt, als sie zu ihrer letzten gemeinsamen Reise aufgebrochen waren.
»Du bist alt und erfahren genug, der Midewiwin beizutreten, meine Tochter, die Alten sprechen schon davon. Sogar Pontiac hat deinen Namen erwähnt.« Sie hatte nichts erwidert. Sie zweifelte daran, daß sie schon erfahren genug war, die schwere Aufgabe ihres Vaters zu übernehmen. Kitche Manitu hatte geantwortet, indem er den Schamanen ins Land der Seelen geholt hatte. Und Nanabush hatte am fremden Ufer zu ihr gesprochen. Ihr blieb keine Wahl.
Sie paddelte an einigen Felsen vorbei, die wie schlafende Tiere aus dem Wasser ragten. Das Mondlicht floß über ihren nackten Rücken und schmolz in dem dunklen Wasser. Sie fuhr dicht am Ufer entlang und hielt sich im Schatten der überhängenden Bäume, damit sie von ihren Feinden nicht gesehen wurde. Sie war nur noch eine Tagesreise von ihrem Dorf entfernt, und die Nadowa kamen selten so weit nach Westen, aber sie wollte kein Risiko eingehen. Wenn sie die sterblichen Überreste ihres Vaters nicht nach Hause brachte und begrub, gelang es seinem Geist nicht, auf die andere Seite zu paddeln. Dann geriet sein Kanu in einen Strudel und wurde von den bösen Mächten in die Tiefe gezogen.
Ihr Paddel verursachte kaum einen Laut. Von ihrem Vater hatte sie gelernt, es beinahe geräuschlos durch das Wasser zu ziehen.
»Es genügt nicht, die Kräuter des Waldes zu kennen und die Macht des Großen Geistes zu erfahren, du mußt auch lernen, dich gegen deine Feinde zu behaupten. Du weißt alles, was eine Frau wissen muß, jetzt mußt du lernen, was einen erfahrenen Jäger ausmacht. Als Heilerin bist du oft allein unterwegs. Du darfst dich nicht darauf verlassen, daß dich der Wind oder die Bäume vor den Feinden warnen. Sei vorsichtig und erkenne die Gefahren rechtzeitig, dann geschieht dir nichts. Du mußt leben, damit dein Volk leben kann.«
Sie dachte an die Worte, die Nanabush zu ihr gesprochen hatte. Er hatte noch mehr von ihr verlangt. Er hatte von einem blutigen Krieg gegen die Agalaschima gesprochen und ihr aufgetragen, dem Häuptling zu folgen. Wie konnte sie den großen und mächtigen Pontiac beschützen? Er war der tapferste Krieger und der beste Jäger ihres Volkes. Was konnte sie tun, um die bösen Geister von ihm abzuhalten? Du hast die Kraft, hatte Nanabush gesagt. Du weißt, was die Träume bedeuten. Welche Träume? Und wo waren die Verräter, die es auf das Leben des Häuptlings abgesehen hatten? Wenn sein Leben von ihrem Schutz abhing, brauchte sie die geheimnisvolle Kraft eines Kitche Ojibwa, des hünenhaftesten Kriegers, der allein gegen die Dakota gezogen war.
Ihr Vater hatte die Geschichte von Kitche Ojibwa oft erzählt. Der legendäre Krieger war größer als ein Bär, und hatte so viele Heldentaten vollbracht, daß er einen Kopfschmuck tragen durfte. Eines Tages kehrte er von einem Kriegszug zurück. Sein Dorf war von den Dakota überfallen worden, und viele Frauen und Kinder lagen tot auf dem Boden. Der Schamane spürte eine schlechte Medizin und wollte ihn zurückhalten, aber Kitche Ojibwa schäumte vor Wut und machte sich an die Verfolgung der feindlichen Krieger. Zwanzig junge Männer gingen mit ihm auf den Kriegspfad. Sie ritten bis dicht an das feindliche Dorf heran und versteckten sich in einem Dickicht. Dort wurden sie von einigen Kindern entdeckt und an die Dakota verraten. Über hundert feindliche Krieger schwangen sich auf ihre Pferde und griffen an. Kitche Ojiwa schickte seine Begleiter nach Hause und stellte sich den Feinden allein entgegen. Er tötete viele Krieger, bevor er starb.
An den Feuern ihres Volkes wurde diese Geschichten oft erzählt. Die Männer verehrten den legendären Krieger, weil er noch viele Feinde getötet hatte, bevor er gestorben war. Die Frauen bewunderten ihn, weil er sich für seine Begleiter geopfert hatte. So einen Mann gab es nur in den Geschichten. Otterfrau erinnerte sich daran, daß sie oft von ihm geträumt hatte. Auch die anderen Mädchen hatten ihn verehrt. Jetzt glaubte sie, daß Kitche Ojibwa umsonst gestorben war.
Es hatte keinen Grund gegeben, sein Leben zu opfern, er hätte mit den anderen Kriegern fliehen und die Dakota später angreifen können, wenn sie in der Überzahl waren. So machten es alle großen Kriegshäuptlinge. Sie warteten, bis der Vorteil auf ihrer Seite war. Es brachte nichts, einen sinnlosen Krieg zu führen.
Die jungen Männer mochten den Krieg, sie wollten ihren Mut beweisen. Von den Alten hatte sie erfahren, daß es wichtigere Dinge als den Krieg gab.
Die Familie mußte versorgt werden. Erst wenn der Mais geerntet und der Reis gesammelt war, und die Männer von einer erfolgreichen Jagd zurückkehrten, durfte man an den Krieg denken. Auch ihr Vater hatte so gedacht, und er war ein weiser Mann gewesen.
»Ich war viele Male auf dem Kriegspfad«, hatte er gesagt, »und ich habe mich mit dem Blut meiner Feinde gestärkt. Aber der Herr des Lebens wollte etwas anderes. Er wollte, daß ich die vier Stufen der Midewiwin durchlief und ein vorbildliches Leben führte. Er wollte, daß ich die Geheimnisse des Lebens erforschte und unseren Brüdern und Schwestern half, in eine bessere Zukunft zu gehen.«
Jetzt sprach der Herr des Lebens selber vom Krieg, von einem blutigen Krieg gegen die Agalaschima. Ihr müßt die Engländer töten, sonst werden sie euch töten. Das war seine Botschaft gewesen. War ihr Vater deshalb gestorben? Hatte sich die Welt geändert? War er zum Fremden in seiner Heimat geworden? Sie spürte die neue Verantwortung, die schwer auf ihren Schultern lastete, und zeichnete die Umrisse ihres Vaters mit den Augen nach. Sein Tod hatte sie nachdenklich gemacht. Sie dachte über Dinge nach, die sie früher nicht gekümmert hatten, und die Leichtigkeit der Jugend war endgültig von ihr abgefallen. Ihr Leben hatte neu begonnen. Sie war ein anderer Mensch geworden.
Sie hörte einen Vogel krächzen und zog das Paddel aus dem Wasser. Irgend etwas stimmte nicht. Sie suchte den Waldrand ab und sah nur die dunklen Schatten der Bäume. Der Vogel tauchte aus er Dunkelheit und hob sich gegen den mondhellen Himmel ab. Wollte ihr der Vogel etwas sagen? Sie blickte ihm nach und verharrte schweigend im Boot. Die Strömung war schwach, und sie trieb nur langsam unter den überhängenden Zweigen dahin.
Ein Windhauch streichelte den Fluß. Er brachte den vertrauten Geruch von verkohltem Holz mit. Der würzige Geruch war kaum zu spüren, berührte ihre Nase wie leichter Flaum und verflüchtigte sich in der schwülen Nachtluft. Ein kleines Lagerfeuer, erkannte sie, hinter den Bäumen, nur ein paar Schritte vom Ufer entfernt. Ein weißer Mann hatte es entzündet, ein sehr erfahrener Mann, der schon lange in diesem Land war, und sich darauf verstand, ein Feuer so klein zu halten, daß es nur wenige Feinde entdeckten. Das Lager eines roten Mannes hätte auch Otterfrau nicht gefunden.
Sie paddelte ans Ufer und stieg aus dem Kanu. Nachdem sie stehengeblieben und in die Dunkelheit gehorcht hatte, zog sie das Boot mit ihrem toten Vater auf eine Sandbank. Sie wickelte die Rohhautschnur um einen abgestorbenen Baum. Der Geruch des Feuers war stärker geworden, und sie roch jetzt auch den scharfen Tabak des weißen Mannes. Der Verstand riet ihr, ins Kanu zu steigen und weiterzufahren, aber ihr Dorf war nicht mehr weit entfernt, und sie wollte wissen, welcher blasse Mann in ihren Jagdgründen war. Ein Franzose? Ein Engländer? Wenn sie es herausfand, brauchte Pontiac keinen Späher loszuschicken. Dann konnte er etwas unternehmen.
Schon nach wenigen Schritten sah sie die Flammen. Sie züngelten aus einer kleinen Grube empor, die sie vor den Blicken der Feinde verbergen sollten. Aber der blasse Mann war nicht vorsichtig genug. Die Holzscheite in der Grube waren zu groß, und die Flammen flackerten über den Rand hinweg. Das Feuer schimmerte geheimnisvoll zwischen den dunklen Bäumen und zauberte glutrote Flecken in die Nacht. Sie hörte leise Stimmen, das Klappern von Blechgeschirr und das Knarren von Leder. Dunkle Schatten tanzten zwischen den Bäumen.
Sie bewegte sich lautlos durch das Unterholz, bis sie die kleine Lichtung mit dem Feuer erreichte. Drei Gestalten hockten in der Dunkelheit. Ein weißer Mann, der wie ein Trapper gekleidet war und eine Mütze aus Biberfell trug, ein junger Indianer mit kahlgeschorenen Kopf und silbernen Armreifen, und eine Frau in ihrem Alter. Sie trug ein schmuckloses Kleid und hatte ihre Haare zu einem Zopf gebunden. Auf ihrer Brust hing ein silbernes Kreuz, das Totem der Schwarzkittel, die mit den Franzosen gekommen waren.
Der Trapper rauchte Pfeife, der Indianer kaute Trockenfleisch. Alle drei hielten Trinkbecher. Sie unterhielten sich leise und merkten nicht, daß Otterfrau nur wenige Schritte von ihnen entfernt war.
Otterfrau atmete erleichtert auf, als sie den blassen Mann erkannte. Jean Baptiste, der französische Händler. Ein Mehtikosch, ein Freund. Nur der Anblick der Indianerin hielt sie davon ab, aus ihrer Deckung zu treten. Sie gehörten zu den drei Ratsfeuern, zu einem der drei Stämme, die ihr Volk ausmachten, aber in ihren Augen war ein böses Flackern, das Otterfrau selbst in ihrem Versteck spürte. Sie beobachtete die junge Frau lange. Wenn sie den Kopf drehte, und der Mond direkt in ihre Augen schien, sah sie den seltsamen Ausdruck, der von den bösen Geistern zu kommen schien. Oder bildete sie sich das nur ein? Sie lauschte angestrengt und schnappte das eine oder andere Wort auf, erkannte aber nicht, worüber die Männer und die Frau sprachen.
Jean Baptiste, der coureur de bois, war ein alter Bekannter der Anishinabe. Er transportierte die Felle zahlreicher Krieger zu den französischen Handelsposten und tauschte sie gegen wertvolle Handelswaren ein. Gewehre, Munition, Werkzeuge, Messer, Töpfe, Glasperlen und Decken. Einen Teil der Felle durfte er behalten. Er war mit einer jungen Potawatomi verheiratet gewesen und hatte in einem ihrer Dörfer gewohnt, bis seine Frau an einer Krankheit des weißen Mannes gestorben war. Seitdem zog er rastlos durch die Wälder. Den letzten Sommer hatte er bei den Anishinabe verbracht, und auch im Frühling war er oft gekommen. Sie mochte ihn, weil er offen und ehrlich war und kein Feuerwasser brachte.
Otterfrau haßte das scharfe Wasser. Es vernebelte den Geist von erwachsenen Männern und macht sie zu hilflosen Kindern. Ihr Großvater war dem Feuerwasser verfallen, und es schmerzte sie, mitanzusehen, wie er seine Weisheit verlor und langsam zugrunde ging. Sogar ein tapferer Krieger wie Schwarzer Bär, der viele Feinde getötet hatte, benahm sich wie eine tollpatschige Ente, seitdem er seine Felle gegen den Rum eingetauscht hatte.
»Bon soir«, sagte Otterfrau laut, bevor sie auf die Lichtung trat.
»Ich bin Otterfrau, die Heilerin der Anishinabe. Darf ich mich zu euch setzen? Ich habe dein Feuer gesehen, Jean Baptiste.«
Der Franzose sah sie erstaunt an. Als er die Indianerin erkannte, breitete er erfreut die Arme aus. »Otterfrau, meine Freundin! Die Frau, die mit den Geistern spricht!« Er sprach ein Kauderwelsch aus Französisch und dem Dialekt der Potawatomi, das auch Otterfrau verstand. »Wo kommst du mitten in der Nacht her?«
»Vom Fluß«, antwortete sie ernst, »ich bringe meinen Vater nach Hause. »Die Nadowa haben ihn getötet.« Sie berichtete, was sich an der Biegung des Flusses zugetragen hatte.
»Ich will ihn im Dorf begraben, damit sein Geist den Weg ins Land der Seelen findet.«
»Die Nadowa?«, erschrak Atawang. So hieß der junge Krieger der Peoria, der seit einigen Tagen mit dem Franzosen durch die Wälder zog. »Sind sie in der Nähe?«
»Ich weiß nicht«, antwortete Otterfrau. Der Krieger gefiel ihr noch weniger als die junge Frau. Sein Gesicht war hart, und in seinen Augen wohnte Bebon, der Wintergeist. Bebon kam aus dem hohen Norden und war beinahe so mächtig wie die Sonne und die Erde. Er konnte Blätter und Beeren verdorren lassen und das Wasser der Flüsse und Seen, in hartes Eis verwandeln. Wenn er schlechte Laune hatte, und das war fast immer der Fall, schickte er Krankheiten in die Dörfer der Anishinabe. Otterfrau vermied es, den Krieger anzusehen. Ich glaube nicht, daß sie Krieg wollen.«
»Woher willst du das wissen?« fragt Atawang.
»Nanabush hat es mir erzählt. Sie waren ein Werkzeug des Großen Geistes, der meinen Vater ins Land der Seelen holen will.«
»Das ist Unsinn!« sagte Catherine, die junge Indianerin. Sie hatte einen Namen der blassen Menschen angenommen, nachdem der Schwarzkittel sie getauft hatte. »Es gibt keinen Nanabush, und das Land der Seelen liegt im Himmel und heißt Paradies. Dort wartet der liebe Gott auf uns. Und Jesus, sein Sohn. Er ist für uns alle am Kreuz gestorben und hat uns alle Sünden vergeben.«
»Ich habe das schwarze Buch gelesen«, erwiderte Otterfrau, »und ich habe den Schwarzkitteln zugehört. Ihre Geschichten gefallen mir, aber unsere gefallen mir besser. Diesen Mann, den du Jesus nennst, habe ich nie in meinen Träumen getroffen. Mit Nanabush habe ich gesprochen. Er ist ein Geist, und er ist ein Mensch, und niemand kommt ihm gleich. Er hat gesagt, was ich wissen muß.«
»Ah, du bist eine Wilde!«
Otterfrau mochte die junge Frau nicht und hatte keine Lust, mit ihr zu streiten. Es war Nacht, und sie war müde, und in ihrem Kanu lagen die sterblichen Überreste ihres Vaters. »Jetzt ist nicht die Zeit, darüber zu reden«, entschied sie barsch.
»Aber, Mademoiselle!« mischte sich der Franzose ein. Er hatte immer gute Laune und lächelte auch jetzt. »Sie hat es nicht so gemeint, da bin ich ganz sicher. Catherine ist böse, weil ich keinen Rotwein dabeihabe, das ist alles. Möchtest du einen Kaffee?«
Otterfrau mochte das starke Getränk der Mehtikosch nicht, hatte aber gehört, daß es den Schlaf vertrieb. »Oui«, sagte sie zu dem coureur de bois, »aber mit viel Zucker. Du hast doch Zucker?«
Der Trapper wußte, wie süß die Indianer ihre Speisen mochten, und hatte immer eine Dose mit Ahornzucker dabei. Er lächelte. »Natürlich, Mademoiselle. Dein Vater war ein großer Mann!«
Sie nickte dankbar und setzt sich auf einen entwurzelten Baumstamm, ohne Atawang und Catherine eines Blickes zu würdigen. Es tat ihr bereits leid, daß sie an Land gegangen war. Die beiden waren mit den bösen Geistern im Bunde, und sie wollte so schnell wie möglich weiter, um ihren Vater aufzubahren.
»Kommst du von Pontiac?« fragte Otterfrau den Franzosen. Sie trank vorsichtig von dem Kaffee und verzog das Gesicht, als das heiße Getränk durch ihre Kehle rann.
Jean Baptiste schüttelte den Kopf. »Ich will nach Süden, in das Land, das sie Louisiana nennen. Dort wohnt mein Volk. Hier gibt es nichts mehr für mich zu holen. Die Engländer haben ihre eigenen Händler mitgebracht und wollen, daß wir verschwinden.«
»Denken alle Mehtikosch so?«
»Alle Händler, die ich kenne«, antwortete der Trapper, »wer bleibt, wird von den Engländern getötet.« Er klopfte seine Pfeife aus und blickte sie nachdenklich an. »Es kommen schwer Zeiten auf uns zu, Otterfrau. Auf die Menschen in diesen Wäldern, und auf mein Volk, daß immer noch Krieg gegen die Engländer führt.«
Otterfrau dachte an die Worte, die Nanabush über die Engländer gesprochen hatte. »Sie sind mächtig und haben viele Feuerrohre. Sie vertreiben alle Händler der Mehtikosch aus eurem Land und schicken ihre eigenen Händler zu euch.«
Der Bote des Großen Geistes hatte gewußt, was die Agalaschima im Schilde führten.
»Du darfst nicht gehen«, sagte sie.
»Mir bleibt keine Wahl«, erwiderte er niedergeschlagen. Er war immer gut mit den Indianern ausgekommen, hatte sogar eine ihrer Frauen geliebt, und jetzt tat es ihm leid, sie verlassen zu müssen. »Ich bleibe nicht lange«, fuhr er fort. Seine Augen leuchteten schon wieder, »wenn unser König aus seinem Schlaf erwacht ist und die Engländer vertrieben hat, komme ich zurück.«
»Dafür werde ich beten, mein Freund.« Sie trank den Kaffee aus und stellte den Becher ins Gras. Nach einem schnellen Blick auf Atawang und Catherine schüttelte sie dem Franzosen die Hand. »Ich muß weiter, Jean, mein Volk wartet. Möge der Herr des Lebens dich auf deinem Weg nach Süden beschützen.«
»Au revoir, meine Freundin.« Er begleitete sie zu ihrem Kanu und umarmte sie freundschaftlich. Vor dem toten Schamanen blieb er stehen. »Er war ein großer Mann, und ich werde oft für ihn beten.«
»Ich danke dir.« Sie band das Boot los und griff nach dem Paddel. »Warum sind Atawang und Catherine bei dir?« fragte sie leise. »Du bist ein furchtloser Mann. Du brauchst keine Beschützer.«
Er half ihr, das Kanu in den Fluß zu schieben. »Du magst sie nicht, was?« Er lachte. »Ich mag sie auch nicht, aber sie gehören zu unseren Freunden. Ich teile nur das Feuer mit ihnen, Otterfrau.«
»Sie sind mit den bösen Geistern im Bunde!«
»Meine Flinte ist geladen!« Er hob die Waffe.
Sie stieg in ihr Kanu und tauchte das Paddel ins Wasser. »Wende ihnen nicht den Rücken zu, mein Freund. Mache es heute nacht wie ich. Bleibe wach und beobachte, was sie tun.«
»Ich paß auf mich auf, Otterfrau. Bestimmt.« Er winkte ihr zu und zeigte ihr noch einmal das Gewehr. »Sage Pontiac, daß ich wiederkommen werde. Unser König wird die Engländer besiegen.«
»Das werde ich tun, Jean Baptiste. Au revoir.«
4 TRÄUME SIND DIE WAHRHEIT
AM FRÜHEN MORGEN erreichte Otterfrau das Sommerlager ihres Volkes. Die dunklen Wolken waren verschwunden, und die Sonne brannte von einem klaren Himmel. Helle Flecken tanzten auf dem Wasser und begleiteten die Tochter des Schamanen zum flachen Ufer. Sie stemmte das Paddel nach oben und ließ das Boot mit der Strömung treiben.
Ihr Klagelied rief die Bewohner des Dorfes zusammen. Wie das schmerzvolle Stöhnen eines sterbenden Tieres, drang ihr trauriges Lied über den Fluß. Ihr Geist vereinte sich mit der Seele ihres toten Vaters und wiederholte die Worte, die er nach der vierten Prüfung der Midewiwin als junger Schamane gesprochen hatte: »Ich komme, um zu sterben, ich komme für das Leben.«
Ihre Mutter stand in gebückter Haltung am Ufer und fiel in das Wehklagen ein. »Es ist leicht zu sterben, aber es ist schwer zu leben«, antwortete sie traurig. Sie verletzte sich mit einem Messer und verschmierte das Blut auf ihren Körper. »Aiiih!« schrie sie.
Ihre Schwester weinte laut, als sie ihren toten Vater im Kanu von Otterfrau entdeckte. Sie hielt beide Hände vor ihr Gesicht und sank auf die Knie. Ihre Großmutter, die zu oft geweint hatte, um noch Tränen vergießen zu können, legte ihr beide Hände auf die Schultern. Der Großvater hielt einen Krug und verstand nichts. Er hatte die ganze Nacht wachgelegen und Feuerwasser getrunken.
Otterfrau stieg aus dem Kanu und zog es an Land. Der Boden war noch feucht vom Regen, und sie versank bis zu den Knöcheln im Schlamm. Sie hob die Arme und sprach ein Gebet. »Großer Geist, wir verehren dich! Du schickst die Sonne und vertreibst die Nacht. Wir verneigen uns vor deiner Macht. Mit der Sonne schickst du uns neues Leben. Du erweckst die Bäume und die Blumen, und irgendwo in deinem Reich werden heute neue Menschen geboren. Gestern hast du einen Menschen von uns genommen. Wir sind traurig, denn wir haben ihn geliebt. aber wir wissen auch, daß seine Seele weiterlebt. Sein Geist wird auf die andere Seite paddeln und im Land der Seelen eine neue Heimat finden. Dafür danken wir dir, Herr des Lebens.
Zwei Krieger hoben den toten Sieht-über-den-Fluß aus dem Kanu und bahrten ihn am Ufer auf. Seine Beine zeigten nach Westen, denn dort lag das Land der Seelen. Otterfrau führte ihre Mutter und ihre Schwester zu den sterblichen Überresten des Schamanen und sprach ein zweites Gebet. Die Großmutter blieb im Hintergrund und verschloß die Augen vor der Wirklichkeit. Neben ihr tauchte der Großvater auf und blickte verständnislos in die Sonne. Er trank von seinem Feuerwasser und rief lallend nach seiner Frau.
Otterfrau brachte ihn mit einem strengen Blick zum Schweigen und wandte sich an die anderen Dorfbewohner. »Laßt uns allein«, sagte sie, »wir wollen meinen toten Vater ehren und seiner Seele helfen, eine neue Zukunft zu finden. Wenn die Sonne zum vierten Mal über dem Wald steht, werde ich mit dem Häuptling reden.«
Sie blieb neben ihrem toten Vater stehen und betete zum Herrn des Lebens, bis sie keine Kraft mehr fand. Die Sonne schien in ihre Augen und blendete sie. Sie setzte sich auf einen Felsbrocken, trank von dem Wasser, das ihre Mutter geholt hatte, und betete weiter. Sie wiederholte das Klagelied, das sie auf dem Fluß gesungen hatte, und reckte ihre Hände flehend empor.