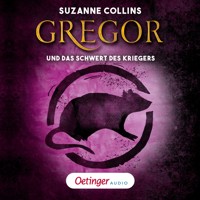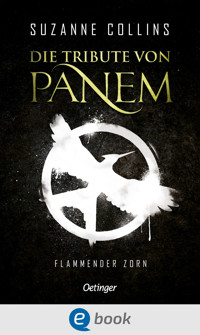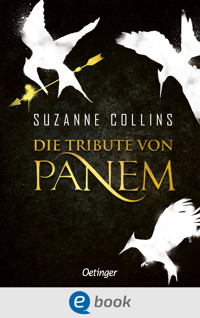15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Oetinger
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Ein Kampf ums Überleben - und um die Liebe Wenn du dazu bestimmt bist, alles zu verlieren, was du liebst, wofür lohnt es sich dann noch, zu kämpfen? Als der Tag der Ernte anlässlich der Fünfzigsten Hungerspiele anbricht, erfasst Angst die Distrikte von Panem. In diesem Jahr werden zu Ehren des Jubel-Jubiläums doppelt so viele Tribute aus ihrem Zuhause gerissen. In Distrikt 12 versucht Haymitch Abernathy, nicht allzu sehr über seine Chancen nachzudenken. Alles, was ihn interessiert, ist, den Tag zu überstehen und bei dem Mädchen zu sein, das er liebt. Als Haymitchs Name aufgerufen wird, spürt er, wie all seine Träume zerbrechen. Er wird von seiner Familie und seiner großen Liebe getrennt und zusammen mit den drei anderen Tributen aus Distrikt 12 zum Kapitol gebracht: einer Freundin, die fast wie eine Schwester für ihn ist, einem besessenen Quotenmacher und dem arrogantesten Mädchen der Stadt. Als die Spiele beginnen, wird Haymitch klar, dass er nur verlieren kann. Aber etwas in ihm will kämpfen - und diesen Kampf weit über die tödliche Arena hinaus klingen lassen. Die Tribute von Panem L. Der Tag bricht an: Ein MUSS für alle Tribute von Panem-Fans - The Hunger Games: Die fesselnde Vorgeschichte der Bestsellerreihe von Suzanne Collins bringt Fans zurück nach Panem. - Vielschichtige Charaktere: Endlich erfahren die Leser*innen mehr über das Schicksal von Haymitch, den Fans der Original-Trilogie bereits kennen und lieben gelernt haben. - Spannend, klug und hochaktuell: Das Tribute von Panem-Buch behandelt zentrale ethische und moralische Fragen um wichtige gesellschaftliche Themen wie Politik, Machtmissbrauch und Widerstand. - Über 5 Millionen verkaufte Bücher: Bestsellerautorin Suzanne Collins trifft mit ihrer intelligenten Erzählweise den Nerv der Zeit. - Bestseller Platz 1: Die deutsche Ausgabe von Sunrise on the Reaping ist der Top-Titel bei #BookTok und auf der SPIEGEL-Bestsellerliste. In der internationalen Megaseller-Reihe "Die Tribute von Panem" (The Hunger Games) schreibt Suzanne Collins über menschliches Verhalten, die dunklen Seiten der Gesellschaft und die Kraft des individuellen Widerstands. Die dystopischen Young Adult Romane spielen in einer postapokalyptischen Welt. Die zentrale Trilogie erzählt die packende Geschichte der jungen Katniss Everdeen, die gegen andere Jugendliche um ihr Überleben kämpfen muss. Alle Bände der spannenden Reihe sind auch als E-Book und Hörbuch und E-Book erhältlich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 589
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über dieses Buch
WENN DU ALLES VERLIERST, WAS DU LIEBST – WOFÜR LOHNT ES SICH DANN NOCH, ZU KÄMPFEN?
Es ist der Tag der Ernte. Die 50. Hungerspiele fordern doppelt so viele Tribute wie sonst.
Haymitch aus Distrikt 12 will nur eines: den Tag überstehen und bei dem Mädchen sein, das er liebt. Doch sein Name wird gezogen. Und Haymitch weiß, dass er kämpfen muss – um mehr als nur sein eigenes Überleben.
Suzanne Collins
Die Tribute von Panem L
Der Tag bricht an
Deutsch von Sylke Hachmeister und Peter Klöss
Für Richard Register
»Alle Propaganda ist Lüge, auch wenn man die Wahrheit sagt. Das spielt aber keine Rolle, solange man weiß, was man tut und warum.«
– George Orwell
»Wahrheit, die aus Mißgunst spricht, Schlägt alle Lügen, die erdicht’t.«
– William Blake
»Betrachtet man die menschliche Gesellschaft von einer philosophischen Warte aus, überrascht mehr als alles andere die Leichtigkeit, mit der die vielen von den wenigen regiert werden; und die stillschweigende Unterwerfung, mit der die Menschen ihre eigenen Gefühle und Leidenschaften jenen ihrer Herrscher unterordnen. Untersuchen wir weiter, womit dieses Wunder vollbracht wird, stellen wir fest, dass die Regierenden, da die Stärke immer aufseiten der Regierten liegt, sich lediglich auf Meinungen stützen. Einzig auf Meinungen begründet sich folglich eine Regierung; und diese Maxime gilt für despotische Militärherrschaften ebenso wie für freiheitliche Volksherrschaften.«
– David Hume
»Dass die Sonne morgen nicht aufgehn wird, ist kein weniger verständlicher Satz und enthält nicht mehr Widerspruch als die Bejahung: sie wird aufgehn.«
– David Hume
Teil IDer Geburtstag
1
»Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Haymitch!«
Ein Gutes hat es, am Tag der Ernte Geburtstag zu haben: Man kann ausschlafen. Das war’s aber auch schon an Vorteilen. Ein schulfreier Tag kann die Angst vor der Ziehung der Namen kaum wettmachen. Und spätestens wenn man mitansehen muss, wie zwei Kinder ins Kapitol verschleppt werden, um abgeschlachtet zu werden, vergeht einem der Appetit auf Kuchen, selbst wenn man noch mal davongekommen ist. Ich drehe mich auf die andere Seite und ziehe mir die Bettdecke über den Kopf.
»Herzlichen Glückwunsch!« Mein kleiner Bruder Sid rüttelt mich an der Schulter. »Du hast gesagt, ich soll dich früh wecken. Du willst doch in den Wald, wenn es hell wird, hast du gesagt.«
Stimmt. Ich möchte unbedingt rechtzeitig vor der Zeremonie mit der Arbeit fertig sein, damit ich am Nachmittag Zeit für meine beiden Lieblingsbeschäftigungen habe – Nichtstun und mit meinem Mädchen zusammen sein, Lenore Dove. Leider funkt meine Ma mir bei beidem oft dazwischen, denn sie findet keine Arbeit zu hart, zu schmutzig oder zu schwierig für mich, und selbst die Ärmsten, sagt sie, könnten immer noch ein paar Pennys auftreiben, um ein wenig von ihrem Elend auf jemand anders abzuwälzen. Aber heute gibt es ja zwei besondere Anlässe, und da gönnt sie mir bestimmt ein bisschen Freiheit, solange ich meine Arbeit nicht vernachlässige. Nur die Spielmacher könnten mir einen Strich durch die Rechnung machen.
»Haymitch!«, quengelt Sid. »Die Sonne geht auf!«
»Schon gut, schon gut, dann steh ich jetzt auch auf.« Ich rolle mich von der Matratze runter auf den Boden und ziehe die Shorts an, die aus einem Mehlsack der Regierung geschneidert sind. Die Aufschrift MIT FREUNDLICHER UNTERSTÜTZUNG DES KAPITOLS prangt wie ein Stempel auf meinem Hintern. Meine Ma wirft nichts weg. Sie ist schon früh Witwe geworden. Seit mein Pa bei einem Feuer im Bergwerk gestorben ist, bringt sie Sid und mich durch, indem sie die Wäsche anderer wäscht und noch das letzte Fitzelchen wiederverwertet. Aus der Asche von der Feuerstelle macht sie Seifenlauge. Eierschalen werden zermahlen und zu Gartendünger. Und diese Shorts wird eines Tages in Streifen gerissen und als Teppich enden.
Ich ziehe mich zu Ende an und schubse Sid zurück in sein Bett. Sofort vergräbt er sich in seiner Flickendecke. In der Küche nehme ich mir ein Stück Maisbrot, das es zur Feier meines Geburtstags anstelle des groben, dunklen Zeugs aus Kapitolmehl gibt. Hinter dem Haus rührt Ma schon mit einem Stab in einem dampfenden Kessel voller Bergarbeitermonturen. Als sie einen Overall wendet, sieht man ihre Muskeln. Sie ist erst fünfunddreißig, aber die Alltagssorgen haben ihr bereits Furchen ins Gesicht gegraben.
Sie sieht mich in der Tür stehen und wischt sich den Schweiß von der Stirn. »Alles Gute zum Sechzehnten. Auf dem Herd steht ein Topf mit Kompott.«
»Danke, Ma.« Ich löffele mir etwas von den eingekochten Pflaumen aufs Brot und gehe wieder nach draußen. Die Pflaumen habe ich neulich im Wald gefunden, aber heiß und gezuckert schmecken sie doppelt gut.
»Du musst heute noch die Zisterne auffüllen«, sagt Ma, als ich an ihr vorbeigehe.
Fließend kaltes Wasser haben wir zwar, aber es läuft so spärlich aus der Leitung, dass man ewig braucht, um einen Eimer zu füllen. Es gibt noch ein Fass mit reinem Regenwasser, das sie extra berechnet, weil die Kleider damit weicher werden, aber für die normale Wäsche nimmt sie unser Brunnenwasser. Zwei Stunden muss man pumpen und schleppen, um die Zisterne vollzukriegen, selbst wenn Sid mithilft.
»Hat das nicht Zeit bis morgen?«, frage ich.
»Sie ist fast leer, und es wartet noch ein ganzer Berg Wäsche«, antwortet sie.
»Dann heute Nachmittag, ja?«, sage ich und versuche, meine Ungeduld zu verbergen. Wenn die Ernte um eins vorbei ist, kann ich um drei mit dem Wasser fertig sein und immer noch Lenore Dove sehen. Vorausgesetzt, wir sind keine von den Opferlämmern.
Eine Nebeldecke legt sich schützend um die verwitterten grauen Häuser im Saum. Es könnte so friedlich sein, wären da nicht die vereinzelten Schreie von Kindern, die von Albträumen gequält werden. Je näher die Fünfzigsten Hungerspiele in den letzten Wochen rückten, desto häufiger wurden diese Schreie, desto häufiger wurden die bangen Gedanken, die ich mit aller Kraft fernzuhalten versuche. Das zweite Jubel-Jubiläum. Doppelt so viele Tribute wie sonst. Spar dir deine Sorgen, sage ich mir, kannst sowieso nichts dagegen tun. Wie zwei Hungerspiele auf einmal. Du hast keinen Einfluss auf den Ausgang der Ernte und was danach kommt. Also gib den Albträumen kein Futter. Verlier nicht die Nerven. Tu dem Kapitol nicht den Gefallen. Sie haben uns schon genug genommen.
Ich folge der verlassenen Straße aus Schlacke zum Friedhofshügel, wo die Bergarbeiter begraben sind. Der Hang ist mit einem Sammelsurium von Grabsteinen gespickt. Einige mit eingravierten Namen und Jahreszahlen, auf anderen Gräbern nur einfache Holzbretter, von denen die Farbe abblättert. Mein Pa liegt in der Familiengrube. Ein Fleckchen für die Abernathys, mit einer Kalksteinplatte für uns alle.
Hier kommt kaum jemand her, schon gar nicht so früh am Morgen. Nachdem ich mich rasch vergewissert habe, dass keiner mich sieht, krieche ich unter dem Zaun durch, der Distrikt 12 umgibt, und mache mich auf den Weg durch den Wald zur Brennerei. Es ist ziemlich riskant, zusammen mit Hattie Meeney klaren Schnaps zu brennen, aber immer noch ein Spaziergang verglichen mit Ratten killen oder Plumpsklos ausschippen. Sie lässt mich ganz schön malochen, aber sie malocht selbst ganz schön, und obwohl sie die sechzig schon hinter sich hat, schafft sie mehr weg als viele, die halb so alt sind. Das meiste ist Routinearbeit. Brennholz holen, Getreide schleppen, die vollen Flaschen ausliefern, die leeren zum Nachfüllen zurückbringen. Und genau hier komme ich ins Spiel. Ich bin Hatties Packesel.
An unserem »Depot«, wo Hattie ihre Vorräte versteckt, bleibe ich stehen. Eigentlich ist es nur ein kahler Fleck Erde, verborgen hinter den herabhängenden Zweigen einer Trauerweide. Zwei Halbzentnersäcke mit Getreideschrot warten auf mich, ich hieve mir einen auf jede Schulter.
Bis zur Brennerei ist es eine halbe Stunde. Als ich ankomme, steht Hattie neben den Resten eines kleinen Feuers und rührt in einem Topf mit Maische.
»Da, mach du mal«, sagt sie und hält mir einen langen Holzlöffel hin.
Ich bringe die Getreidesäcke zu dem Verschlag, wo wir die Vorräte aufbewahren, und recke triumphierend den Löffel in die Höhe. »Wahnsinn, eine Beförderung!«
Dass Hattie mich an die Maische ranlässt, ist neu. Vielleicht will sie mich ausbilden und eines Tages zu ihrem Partner machen. Zu zweit könnten wir die Produktion beträchtlich steigern, die Nachfrage ist immer größer als das Angebot, selbst nach ihrem Fusel aus Kapitolgetreide, der einem das Wasser in die Augen treibt. Nach dem sogar besonders, denn er ist so billig, dass die Bergarbeiter ihn sich leisten können. Die bessere Ware wird von nicht ganz so regeltreuen Friedenswächtern und den wohlhabenderen Bürgern aus der Stadt gekauft. So oder so, Schwarzbrennen ist und bleibt illegal, und es muss nur ein neuer Oberster Friedenswächter kommen – einer, der nicht auch gern mal einen hebt –, und wir landen am Pranger oder Schlimmeres. Kohle hauen ist verdammt harte Arbeit, aber wenigstens wird man dafür nicht gehängt.
Während Hattie Halbliterflaschen Klaren in einen mit Moos ausgepolsterten Korb füllt, hocke ich mich hin und rühre immer mal die Maische. Als sie genug abgekühlt ist, gieße ich sie in einen tiefen Kübel, Hattie gibt die Hefe dazu, und ich trage das Ganze in den Verschlag, zum Gären. Heute wird nicht destilliert, denn falls der Nebel sich auflöst, könnte der Rauch auffallen, und das will Hattie nicht riskieren. Die Friedenswächter bei uns drücken ja vielleicht ein Auge zu, was Hatties Brennerei und ihren Verkaufsstand auf dem Hob angeht, unserem Schwarzmarkt im alten Lagerhaus, aber ihre Kameraden aus dem Kapitol in den tieffliegenden, getarnten Hovercrafts könnten uns aus der Luft entdecken. Flaschenholen ist heute auch nicht, also werde ich beauftragt, Holz für die kommende Woche zu hacken. Als der Stapel aufgefüllt ist, frage ich, was als Nächstes zu tun ist, doch sie schüttelt nur den Kopf.
Hattie hat bei mir einen Stein im Brett, weil sie mir manchmal was extra gibt. Kein Geld, das händigt sie direkt meiner Ma aus, aber manchmal steckt sie mir heimlich was zu. Eine Handvoll Schrot, den ich Lenore Dove für ihre Gänse mitbringen kann, eine Packung Hefe zum Eintauschen auf dem Hob und heute eine Halbliterflasche Klaren für mich selbst. »Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Haymitch«, sagt sie und grinst mich mit ihren abgebrochenen Zähnen an. »Ich finde, wer alt genug ist fürs Brauen, der ist auch alt genug fürs Trinken.«
Ich stimme ihr zu, und obwohl ich selbst nicht trinke, bin ich froh über die Flasche, weil ich sie mühelos verkaufen oder eintauschen kann, oder ich schenke sie Lenore Doves Onkel Clerk Carmine, vielleicht steige ich dann in seinem Ansehen. Etwas Harmloseres als den Sohn einer Waschfrau kann es eigentlich kaum geben, aber wir Abernathys waren früher Rebellen, und offenbar hängt uns noch immer ein Ruf als Aufwiegler an, was zugleich Angst macht und verführerisch klingt. Nach dem Tod meines Vaters kamen Gerüchte auf, es hieß, das Feuer war kein Unfall. Manche sagten, er ist bei einem Sabotageakt umgekommen, andere, er und seine Leute sind als Unruhestifter ins Visier des Kapitols geraten. Könnte also sein, dass meine Sippe das Problem ist. Clerk Carmine hegt bestimmt keine Sympathien für die Friedenswächter, aber er würde sich auch nie mit ihnen anlegen. Vielleicht gefällt ihm auch nur nicht, dass seine Nichte sich mit einem Schnapsbrenner rumtreibt, obwohl das eine sichere Arbeit ist. Warum auch immer, er hat für mich nie mehr als ein knappes Kopfnicken übrig, und einmal hat er zu Lenore Dove gesagt, ich wär einer von denen, die jung sterben, was wohl eher nicht als Empfehlung gemeint war.
Spontan drücke ich Hattie an mich. »Lass mich los!«, schreit sie. »Schluss damit. Verdrehst du eigentlich immer noch diesem Covey-Mädchen den Kopf?«
»Ich tu mein Bestes«, sage ich lachend.
»Dann geh zu ihr und fall ihr auf die Nerven. Ich kann dich hier heute nicht mehr brauchen.« Sie drückt mir noch einen Beutel mit Getreideschrot in die Hand und scheucht mich davon. Ich stecke den Schrot in die Tasche und verziehe mich, ehe sie es sich anders überlegt und ihr schönstes Geschenk rückgängig macht: unverhoffte Zeit mit meinem Mädchen. Jaja, eigentlich könnte ich jetzt schnell nach Hause und die Zisterne auffüllen, aber die Aussicht auf ein paar heimliche Küsse ist zu verlockend. Heute ist mein Geburtstag, da kann die Zisterne mal warten.
Während ich durch den Wald zur Weide laufe, lichtet sich der Nebel langsam. Die meisten Menschen finden ihn schön, doch für Lenore Dove ist er der Freund der Todgeweihten, weil er uns vor den Friedenswächtern verbirgt. Sie neigt zur Schwarzmalerei, was vielleicht verständlich ist bei einer, die nach einem toten Mädchen benannt ist. Also halb nach dem toten Mädchen Lenore in dem alten Gedicht, und halb nach diesem besonderen Grau, wie ich an dem Tag erfuhr, als ich sie kennenlernte.
Es war der Herbst in dem Jahr, als ich zehn wurde und mich zum ersten Mal unter dem Zaun durchschlich. Bis dahin hatte mich abgeschreckt, dass es verboten ist und man im Wald wilden Raubtieren begegnen kann, auch wenn sie selten sind. Mein Freund Burdock überredete mich schließlich, er würde das ständig machen, wär gar nichts dabei, und wenn man klettern könnte, warteten dort reichlich Äpfel. Ich konnte klettern, und ich mochte Äpfel. Außerdem wäre ich mir vorgekommen wie ein Angsthase, wenn ich es nicht getan hätte, schließlich war ich der Ältere.
»Willst du mal was hören?«, fragte Burdock, während wir tief in den Wald vordrangen. Er legte den Kopf zurück und begann zu singen. Er hat eine bemerkenswerte Stimme, hoch und lieblich wie die einer erwachsenen Frau, aber reiner, kein bisschen heiser. Ringsum wurde es augenblicklich still, und dann nahmen die Spotttölpel sein Lied auf. Ich wusste, dass sie andere Vögel nachahmen, aber ich hatte noch nie gehört, dass sie einen Menschen nachahmen. Ziemlich beeindruckend. Aber da bekam Burdock plötzlich einen Apfel an den Kopf und verstummte jäh.
»Wer quäkt da meine Vögel an?«, wollte ein Mädchen wissen. Und da lag sie, sechs oder sieben Meter über uns, ausgestreckt auf einem Ast, als wäre sie dort zu Hause. Krumme Zöpfe, schmutzige nackte Füße, einen Apfel mampfend, ein kleines, leinengebundenes Buch in der Hand.
Burdock legte den Kopf schief und lachte. »Hey, Cousinchen. Darfst du überhaupt allein hier draußen sein? Bestimmt nicht, oder?«
»Ach, ich hab dich nicht gesehen«, sagte sie.
»Ich dich auch nicht. Schmeißt du uns ein paar runter?«
Wortlos stand sie auf und wippte auf ihrem Ast, dass die Äpfel nur so auf uns herunterregneten.
»Warte mal, ich hole einen Sack aus meinem Versteck für Pfeil und Bogen.« Burdock rannte davon. Sie rutschte die Äste hinunter und schwang sich auf den Boden. Burdocks Everdeen-Cousinen kannte ich alle, von denen war sie keine, sie musste eine entfernte Verwandte mütterlicherseits sein. Ich hatte sie schon ein paarmal in der Schule gesehen – ein bisschen schüchtern, dachte ich, aber wir hatten noch nie miteinander gesprochen. Sie schien es nicht eilig zu haben, daran etwas zu ändern, stand nur da und musterte mich, bis ich irgendwann das Schweigen brach.
»Ich bin Haymitch.«
»Lenore Dove.«
»Dove wie die Taube?«
»Dove wie Taubengrau.«
Da schwirrte mir plötzlich der Kopf, und das hat seitdem nie mehr ganz aufgehört. Nach der Schule winkte sie mich heran und zeigte mir ein Wörterbuch mit lauter Eselsohren. Dove: Ein warmes Grau mit leichtem Purpur- oder Rosastich. Ihre Farbe. Ihr Vogel. Ihr Name. Lenore Dove.
Danach fielen mir plötzlich Sachen an ihr auf. Kleine Farbtupfer an ihren verblichenen Overalls und Hemden, ein hellblaues Taschentuch, das aus ihrer Tasche guckte, ein himbeerrotes Band, das in ihren Ärmelbund eingenäht war. Dass sie immer schnell mit den Aufgaben fertig war, aber kein Aufhebens darum machte, sondern nur aus dem Fenster schaute. Irgendwann fiel mir auf, dass sie dabei die Finger bewegte, als würde sie auf unsichtbare Tasten drücken. Lieder spielen. Ihr Fuß schlüpfte aus dem Schuh, die bestrumpfte Ferse schlug leise den Takt auf den Holzfußboden. Musik im Blut, wie alle Covey. Aber irgendwie auch nicht so wie die anderen. Weniger interessiert an hübschen Melodien als an gefährlichen Reimen. Reimen, die zur Rebellion aufrufen. Die ihr schon zwei Verhaftungen eingebracht haben. Zwölf war sie damals erst, deswegen hat man sie laufen lassen. Jetzt wäre das anders.
Als ich die Wiese erreiche, schlüpfe ich unter dem Zaun durch und bleibe stehen, um zu Atem zu kommen und Lenore Doves Anblick in mich aufzunehmen. Über ein altes Pianoakkordeon gebeugt, sitzt sie auf ihrem Lieblingsstein, das Sonnenlicht lässt den Rotton in ihrem Haar leuchten. Um sie herum grasen ihre Gänse, denen sie auf dem schnaufenden alten Ding ein Ständchen bringt. Ihre Stimme ist weich und eindringlich wie Mondschein.
Ob Mann, ob Frau, sie büßen beide,
Wenn die Gans sie stehlen von der Weide,
Der größre Schuft aber kriegt Kulanz,
Der stiehlt die Weide von der Gans.
Es ist etwas Besonderes, sie singen zu hören, in der Öffentlichkeit tut sie das nie. Keiner der Covey. Ihre Onkel sind eher Musiker als Sänger, sie spielen die Stücke und überlassen das Singen den Zuhörern, wenn denen danach ist. Lenore Dove ist es recht so. Sie ist zu aufgeregt, um vor Publikum zu singen, sagt sie. Es schnürt ihr die Kehle zu.
Clerk Carmine und ihr anderer Onkel, Tam Amber, haben sie großgezogen, denn ihre Mutter starb bei der Geburt, und wer der Vater war, blieb ein Geheimnis. Sie sind nicht blutsverwandt, sie ist ja eine Baird, aber die Covey kümmern sich umeinander. Sie handelten einen Deal mit der Bürgermeisterin aus, in deren Haus das einzige richtige Klavier von Distrikt 12 steht. Lenore Dove darf drauf üben, als Gegenleistung spielt sie ab und zu bei einem Abendessen oder einer Zusammenkunft. Sie in einem verschossenen grünen Kleid, das Haar mit einem elfenbeinfarbenen Band zurückgebunden, die Lippen orange angemalt. Wenn ihre Familie sonst wo in Distrikt 12 gegen Bezahlung auftritt, begnügt sie sich mit dem Instrument, auf dem sie jetzt spielt und das sie ihren Liederkasten nennt.
Nehmen wir, was uns nicht gehört,
Wird sich fürchterlich empört,
Bei den Obren stört sich keiner dran,
Wenn sie berauben den kleinen Mann.
Ihre Onkel erlauben ihr nicht, dieses Lied zu spielen. Weder im Bürgermeisterhaus noch sonst irgendwo in Distrikt 12. Es besteht immer die Gefahr, dass einer den Text kennt, und dann könnte es Krawall geben. Zu rebellisch, finden Clerk Carmine und Tam Amber, und ich muss sagen, da haben sie recht. Wozu Ärger provozieren? Ärger haben wir reichlich, den müssen wir nicht noch herausfordern.
Wird ein armer Wicht zum Dieb,
Muss er es büßen aus Prinzip
Und schaut den Mächtigen bloß zu,
Die Gesetze basteln in aller Ruh.
Ich suche die Weide ab. Sie liegt recht abgeschieden, aber überall sind Augen, das weiß jeder hier. Und wo Augen sind, sind Ohren nicht weit.
Ob Mann oder Frau, das Recht straft beide,
Wenn die Gans sie stehlen von der Weide,
Und Gänsen wird die Weide fehlen,
Bis sie die Weide wiederstehlen.
Unsere Weide, hat Lenore Dove mir mal erklärt, war früher Land, das alle nutzen durften. Manchmal verjagen die Friedenswächter sie und ihre Gänse von dort, einfach so. Aber das, sagt sie, ist nur ein Löffel voll Ärger in einem Fluss voll Unrecht. Sie bereitet mir Sorgen, und dabei bin ich ein Abernathy.
Sobald die Gänse mich bemerken, zischen ein paar von ihnen mich an. Als sie aus dem Ei schlüpften, war Lenore Doves Gesicht das Erste, was sie sahen, deshalb lieben sie nur sie und beschützen sie. Aber heute sind sie gnädig, weil ich Schrot dabeihabe. Um sie abzulenken, werfe ich ihn weit weg, beuge mich vor und küsse Lenore Dove. Noch mal. Und noch mal. Und sie erwidert meine Küsse.
»Herzlichen Glückwunsch«, sagt sie, als wir nach Luft schnappen müssen. »Ich dachte, ich sehe dich erst hinterher.«
Sie meint die Ernte, aber darüber will ich nicht reden.
»Hattie hat mich früher gehen lassen«, sage ich. »Und das hier hat sie mir mitgegeben – als Geschenk für meinen großen Tag.« Ich hole die Flasche heraus.
»Wird nicht schwer sein, die loszukriegen. Heute schon gar nicht.« Heute geben sich alle die Kante, ungefähr so wie an Silvester. »Vier Kinder … Das wird ne Menge Familien treffen.«
Jetzt reden wir doch darüber. »Ach, wird schon gut gehen«, sage ich, aber es klingt hohl.
»Das glaubst du doch selbst nicht, oder?«
»Vielleicht nicht. Aber ich versuche es. Die Ernte findet sowieso statt, egal, was ich glaube. So sicher, wie morgen ein neuer Tag anbricht.«
Lenore Doves Miene verfinstert sich. »Aber es ist überhaupt nicht bewiesen, dass es so kommt. Nur weil etwas in der Vergangenheit passiert ist, muss es doch nicht auch morgen passieren. Das ist ein Trugschluss.«
»Ach ja?«, sage ich. »So planen die Leute aber ihr Leben.«
»Das ist ja das Schlimme. Dass alle denken, man kann sowieso nichts ändern. Dass keiner an eine Veränderung glaubt.«
»Kann schon sein. Aber dass morgen kein neuer Tag anbricht, kann ich mir nicht vorstellen.«
Eine Falte bildet sich zwischen ihren Brauen, während sie sich eine Antwort überlegt. »Kannst du dir vorstellen, dass die Sonne aufgeht in einer Welt, in der es keine Ernte mehr gibt?«
»Nicht an meinem Geburtstag. Ich hatte noch nie Geburtstag ohne Ernte.«
Ich versuche, sie mit einem Kuss abzulenken, aber sie will es mir unbedingt erklären. »Nein, hör zu«, sagt sie ernst. »Denk mal nach. Was du sagst, ist ungefähr das: ›Morgen habe ich Geburtstag, und an dem Tag findet eine Ernte statt. Letztes Jahr an meinem Geburtstag fand auch eine Ernte statt. Also wird jedes Jahr an meinem Geburtstag eine Ernte stattfinden.‹ Dabei kannst du das gar nicht wissen. Ich meine, bis vor fünfzig Jahren gab es überhaupt keine Ernte. Nenne mir einen stichhaltigen Grund, warum sie immer stattfinden soll, nur weil du an dem Tag Geburtstag hast.«
Für ein Mädchen, das in der Öffentlichkeit kaum den Mund aufmacht, redet sie verdammt viel, wenn wir allein sind. Manchmal komme ich kaum mit. Lenore Dove ist immer geduldig, wenn sie etwas erklärt, überhaupt nicht überheblich, aber vielleicht ist sie einfach zu schlau für mich. Denn die Vorstellung von einer Welt ohne Ernte ist zwar wirklich toll, aber ich sehe nicht, dass es so kommen wird. Das Kapitol hat die Macht, so ist das eben.
»Ich hab nicht gesagt, die Ernte gibt es nur, weil ich Geburtstag hab. Ich hab gesagt …« Was hab ich eigentlich gesagt? Ich kann mich nicht mehr erinnern. »Tut mir leid, ich hab den Faden verloren.«
Sie sieht mich erschrocken an. »Nein, mir tut es leid. Es ist doch dein Geburtstag, und ich rede hier über irgendwelchen Quatsch.« Sie kramt in ihrer Tasche und holt ein kleines Päckchen heraus, eingewickelt in ein Stück taubengrauen Stoff und von einem Band zusammengehalten, das so grün gefleckt ist wie ihre Augen. »Herzlichen Glückwunsch. Tam Amber hat es gemacht, aber ich habe ihm bei dem Motiv geholfen. Das Metall habe ich im Tausch für Eier bekommen.«
Tam Amber kann nicht nur richtig gut Mandoline spielen, er ist auch der beste Schmied in Distrikt 12. Wer neue Vorrichtungen oder Ersatzteile für kaputte Maschinen braucht, geht zu ihm. Burdock hat ein Dutzend Pfeilspitzen von seiner Hand, die er hütet wie einen Schatz, und ein paar von den reicheren Leuten in der Stadt besitzen Schmuck aus echtem Gold und Silber, den er aus eingeschmolzenen Erbstücken neu gestaltet hat. Ich habe keinen Schimmer, was er für mich gemacht haben könnte, und ziehe gespannt die Schleife auf.
Ich erkenne nicht sofort, was es ist. Eine dünne Metallplatte, geformt wie ein C. Unwillkürlich umfasse ich es am runden Rücken und betrachte die bunten Tierköpfe, die einander an der offenen Seite anschauen. Eine Schlange, die den Schnabel eines langhalsigen Vogels anzischt. Ich schaue genauer hin und sehe, dass emaillierte Schuppen und Federn über das Schmuckstück laufen und auf halber Strecke miteinander verschmelzen. Hinter jedem Kopf ist ein kleiner Ring angeschweißt. Vielleicht, um eine Kette hindurchzufädeln? »Wie schön«, sage ich. »Man trägt es um den Hals, stimmt’s?«
»Tja, du weißt ja, kein Zierrat ohne Zweck«, sagt Lenore Dove geheimnisvoll. Ich soll selbst herausfinden, was es ist.
Ich drehe das C hin und her und halte es diesmal so, dass ich mit den Fingern die Tierköpfe bedecke. Jetzt weiß ich, was es ist. Die glatte Stahlkante ist nicht nur zur Zierde da.
»Das ist ein Pinkeisen!«, rufe ich.
»Genau! Und du brauchst dafür nicht mal einen Feuerstein. Quarz oder jeder andere halbwegs funkenschlagende Stein tut’s auch.«
Zu Hause haben wir ein ziemlich abgenudeltes altes Schlageisen, das bei uns in der Familie von Generation zu Generation weitergegeben wird. Plump und hässlich. An langen Winterabenden hat Ma mir beigebracht, wie man es benutzt, bis ich damit verlässlich Feuer machen konnte und wir keine Streichhölzer mehr kaufen mussten. Ein gesparter Penny ist ein verdienter Penny.
Ich fahre mit dem Finger über die kunstvoll ziselierten Halsfedern. »Den würde ich ungern kaputt machen.«
»Wirst du nicht. Dafür ist er ja gedacht.« Sie berührt abwechselnd den Kopf der Schlange und des Vogels. »Da braucht es schon einiges, um diese beiden zu zerbrechen. Sie sind Überlebenskünstler.«
»Ich liebe das Teil«, sage ich und gebe ihr einen langen, zärtlichen Kuss. »Und dich lieb ich lichterloh.«
Lichterloh ist Covey-Sprech, aber dieser Satz gehört uns allein. Normalerweise muss sie dann lächeln, aber jetzt ist sie todernst. »Ich dich auch.«
Wir küssen uns, bis ich plötzlich Salz schmecke. Ich muss nicht fragen, warum.
»Hey, es ist okay«, versichere ich ihr. »Das geht schon alles gut.« Sie nickt, aber ihre Tränen fließen weiter. »Lenore Dove, wir werden diesen Tag überstehen, genau wie letztes Jahr und vorletztes Jahr, und irgendwann lassen wir das alles hinter uns.«
»Aber nicht richtig«, sagt sie bitter. »Niemand in Zwölf kann das hinter sich lassen. Das Kapitol achtet darauf, dass die Hungerspiele sich in unser Gehirn einbrennen.« Sie tippt gegen die Flasche. »Ich glaube, Hattie ist in der richtigen Branche. Menschen beim Vergessen helfen.«
»Lenore Dove.« Clerk Carmine brüllt nicht, seine Stimme trägt ganz von selbst. Er steht am Rand der Weide, die Fäuste in den geflickten Overall geschoben. Als Geigenspieler will er seine Hände schützen. »Du machst dich jetzt besser fertig.«
»Ich komme«, sagt sie und wischt sich die Augen.
Über ihre Verfassung verliert Clerk Carmine kein Wort, aber mir schleudert er einen Blick zu, der sagt, dass er mich dafür verantwortlich macht, dann dreht er sich auf dem Absatz um. Bis das mit Lenore Dove und mir ernster wurde, hat er mich gar nicht beachtet. Aber seitdem kann ich ihm nichts mehr recht machen. Ich glaube, er hat was gegen die Liebe, habe ich einmal zu Lenore Dove gesagt. Da eröffnete sie mir, dass er seit dreißig Jahren mit dem Typ zusammen ist, der in der Stadt die kaputten Fenster ersetzt. Sie müssen es geheim halten, weil die Friedenswächter Leute, die anders lieben, gern schikanieren, man kann die Arbeit verlieren, sogar verhaftet werden. Angesichts solcher Herausforderungen könnte man meinen, Clerk Carmine würde unsere Liebe gelten lassen – ich befürworte seine jedenfalls voll und ganz –, aber wahrscheinlich denkt er, Lenore Dove hätte was Besseres verdient.
Sie findet es schrecklich, dass wir uns nicht vertragen, deshalb sage ich: »So langsam wachs ich ihm ans Herz.« Da muss sie lachen, und die schlechte Stimmung verfliegt. »Ich kann ja später noch mal kommen. Ich muss noch was für meine Mutter erledigen, aber um drei müsste ich fertig sein. Dann gehen wir in den Wald, ja?«
»Dann gehen wir in den Wald.« Sie besiegelt es mit einem Kuss.
Zu Hause schütte ich mir einen Eimer kaltes Wasser über und ziehe die guten Sachen an: In der Hose hat mein Pa geheiratet, und das Hemd hat meine Ma aus Taschentüchern genäht, die sie aus dem Kapitol-Laden hat, in dem die Bergleute einkaufen. Man muss wenigstens so tun, als ob man sich zur Ernte fein gemacht hat. Wer in Lumpen erscheint, wird von den Friedenswächtern zusammengeschlagen, oder die Eltern werden verhaftet, denn man hat den Gefallenen des Kapitols gebührenden Respekt zu erweisen. Dass wir selbst viele Kriegstote hatten, zählt nicht.
Ma überreicht mir meine Geburtstagsgeschenke, einen Jahresvorrat Getreidesack-Unterhosen und ein nagelneues Taschenmesser, mit der strikten Anweisung, es nicht für Messerspiele zu benutzen. Sid schenkt mir einen Feuerstein, der in schmuddeliges braunes Papier eingewickelt ist, und sagt: »Ich hab ihn auf der Schotterstraße beim Hauptquartier der Friedenswächter gefunden. Lenore Dove hat gemeint, den hättest du bestimmt gern.« Ich hole mein Pinkeisen hervor und produziere erstklassige Funken. Und obwohl Ma von Lenore Dove wenig begeistert ist, weil sie mich ja nur ablenkt, gefällt ihr das Pinkeisen doch so sehr, dass sie einen Lederriemen durch die Metallringe fädelt und in meinem Nacken verknotet.
»Ist ein verdammt gutes Pinkeisen«, sagt Sid und berührt sehnsüchtig den Vogel.
»Soll ich dir heute Abend beibringen, wie man es benutzt?«, frage ich.
Er strahlt bei der Aussicht, Erwachsenendinge zu tun – und dass ich nirgendwo hingehe. »In echt?«
»In echt!« Ich wuschele ihm seine Locken durcheinander.
»Lass das!« Sid lacht und schlägt meine Hand weg. »Jetzt muss ich mich noch mal kämmen!«
»Dann aber flott!«, sage ich. Er flitzt davon, und ich lasse das Pinkeisen unter meinen Kragen gleiten. Ich bin noch nicht bereit, es mit der Welt zu teilen, nicht am Tag der Ernte.
Ich habe noch ein bisschen Zeit und gehe zum Tauschen in die Stadt. Die Luft steht schwer und still, ein Gewitter braut sich zusammen. Beim Anblick des mit Plakaten zugepflasterten und von Friedenswächtern in ihren weißen Uniformen umstandenen Platzes wird mir ganz elend. »Ohne Frieden« ist das aktuelle Thema, von allen Seiten wird man mit Slogans bombardiert: OHNEFRIEDENKEINBROT! OHNEFRIEDENKEINESICHERHEIT! Und, natürlich: OHNEFRIEDENSWÄCHTERKEINFRIEDEN! OHNEKAPITOLKEINFRIEDEN! Hinter der provisorischen Bühne vor dem Gerichtsgebäude hängt ein riesiges Banner mit dem Konterfei von Präsident Snow und den Worten: PANEMSFRIEDENSWÄCHTERNUMMER1.
Am hinteren Zugang zum Platz lassen die Friedenswächter die Teilnehmer ein. Die Warteschlange ist noch kurz, ich stelle mich an und bringe es hinter mich. Die Friedenswächterin schaut mir nicht in die Augen, offenbar empfindet sie noch Scham. Vielleicht ist es aber auch nur Gleichgültigkeit.
Im Schaufenster der Apotheke hängt eine Fahne von Panem, und ich würde am liebsten gleich wieder umkehren. Aber hier bekomme ich den besten Preis für meinen Klaren. Drinnen sticht mir scharfer Chemikaliengeruch in die Nase. Zum Ausgleich verströmt ein Strauß Kamille, der in einem Glas darauf wartet, zu Tee und Arznei verarbeitet zu werden, einen leicht süßlichen Duft. Burdock hat sie im Wald gepflückt, das weiß ich. Neuerdings hat er sein Jagdgeschäft um Kräutersammeln erweitert.
Bis auf meine Klassenkameradin Asterid March, die kleine Fläschchen in ein Regal hinter der Ladentheke einsortiert, ist die Apotheke leer. Der lange blonde Zopf fällt ihr über den Rücken, aber in der schwülen Hitze haben sich Strähnen herausgelöst, die ihr ebenmäßiges Gesicht einrahmen. Asterid ist die Stadtschönheit und für Distrikt-12-Verhältnisse reich. Ich habe ihr das immer angekreidet, bis sie eines Nachts mutterseelenallein im Saum auftauchte, um eine Nachbarin zu behandeln, die ausgepeitscht worden war, weil sie einem Friedenswächter Widerworte gegeben hatte. Sie brachte eine Salbe mit, die sie selbst angerührt hatte, und danach ist sie einfach gegangen und hat nie eine Bezahlung verlangt. Seitdem wenden sich die Leute Hilfe suchend an sie, wenn ein Angehöriger die Peitsche zu spüren bekommt. Ich glaube, in Asterid steckt mehr, als die schnöseligen Stadtfreunde vermuten lassen, mit denen sie sich umgibt. Außerdem ist Burdock verrückt nach ihr, deshalb versuche ich, nett zu sein, obwohl er bei ihr so große Chancen hat wie ein Spotttölpel bei einem Schwan. Es müsste schon ziemlich viel passieren, damit ein Mädchen aus der Stadt einen Jungen aus dem Saum heiratet.
»Hey. Hast du zufällig hierfür Verwendung?« Ich stelle den Klaren auf die Ladentheke. »Für Hustensaft oder so?«
»Ich werde schon was finden.« Asterid zahlt mir einen fairen Preis und gibt mir noch einen Zweig Kamille obendrauf. »Für heute. Soll Glück bringen.«
Ich stecke den Stängel ins Knopfloch. »Wer sagt das? Burdock?«
Sie errötet leicht, und ich frage mich, ob ich mich vielleicht irre, was seine Chancen angeht. »Vielleicht. Ich erinnere mich nicht.«
»Jedenfalls, ein bisschen Glück können wir heute alle gebrauchen.« Ich schaue zu der Fahne.
Asterid senkt die Stimme. »Wir wollten sie nicht aufhängen. Aber die Friedenswächter haben darauf bestanden.«
Weil sie sonst was getan hätten? Die ganze Familie March verhaftet? Ihren Laden demoliert? Für immer dichtgemacht? Jetzt tut es mir leid, dass ich sie früher verurteilt habe.
»Da muss man dann wohl.« Ich deute mit dem Kinn auf die Kamille. »Steck dir auch eine an, ja?« Sie schenkt mir ein trauriges Lächeln und nickt.
Im Süßwarengeschäft der Donners nebenan kaufe ich eine kleine weiße Tüte mit bunten Gummidrops – es sind Lenore Doves Lieblingsbonbons, die können wir uns später teilen. Sie nennt sie Regenbogen-Gummidrops und behauptet steif und fest, sie könnte die Geschmäcker auseinanderhalten, dabei schmecken sie alle genau gleich. Merrilee Donner aus meiner Klasse bedient mich in einem adretten rosa Kleid und passenden Bändern im sandfarbenen Haar. Die Donners brauchen nicht zu befürchten, dass ihre Kleidung zu schäbig für die Erntezeremonie ist. Zum Glück hat Asterid den Klaren bar bezahlt, die Donners nehmen nämlich nicht die Wertmarken, mit denen das Kapitol die Arbeiter entlohnt. Eigentlich soll man damit nur im Kapitol-Laden einkaufen, aber viele Kaufleute in der Stadt akzeptieren sie auch, und meine Ma kriegt durch ihre Wäscherei jede Menge davon.
Draußen sehe ich das Bonbon-Schild der Donners und denke an Lenore Dove und unser Treffen im Wald. Ich lächle kurz, dann sehe ich, dass es Zeit ist. Die riesigen Bildschirme rechts und links der Bühne sind eingeschaltet und zeigen die wehende Fahne zu Ehren der Hungerspiele. Vor über fünfzig Jahren haben sich die Distrikte gegen die Unterdrückung durch unser Kapitol erhoben und einen blutigen Bürgerkrieg in Panem ausgelöst. Wir haben verloren, und zur Strafe muss seither jeder Distrikt Jahr für Jahr am 4. Juli zwei Tribute schicken, ein Mädchen und einen Jungen im Alter zwischen zwölf und achtzehn, die sich in einer Arena gegenseitig massakrieren, bis nur noch einer übrig ist. Der oder die letzte Überlebende wird zum Sieger gekürt.
Bei der Ernte werden die Namen für die Hungerspiele gezogen. Zwei Areale sind mit orangen Seilen abgetrennt worden, einer für die Mädchen und einer für die Jungen. Traditionell stellen sich die Zwölfjährigen vorne auf, die anderen dem Alter nach dahinter bis zu den Achtzehnjährigen. Es besteht Anwesenheitspflicht für die gesamte Bevölkerung, aber weil ich weiß, dass meine Ma mit Sid bis zum letzten Moment zu Hause bleiben wird, versuche ich erst gar nicht, sie in der Menge zu entdecken. Da ich nirgendwo Lenore Dove sehe, gehe ich zu dem Areal, in dem die vierzehn- bis sechzehnjährigen Jungen eingepfercht sind, und wäge meine Chancen ab.
Zwanzig Zettel mit meinem Namen sind heute in der Lostrommel. Jedes Jahr kriegt man automatisch einen Zettel dazu, aber ich kriege immer noch drei mehr, weil ich jedes Jahr drei Tesserasteine annehmen muss, um mich, Ma und Sid durchzubringen. Ein Tesserastein berechtigt zu einem Kanister Öl und einem Sack Getreide mit der Aufschrift MIT FREUNDLICHER UNTERSTÜTZUNG DES KAPITOLS für eine Person, abholbar monatlich im Gerichtsgebäude. Als Gegenleistung muss man für jeden Tesserastein, den man angenommen hat, seinen Namen ein weiteres Mal in die Trommel werfen. Diese Extrazettel bleiben erhalten und summieren sich. Vier Zettel mal fünf Jahre – so komme ich auf zwanzig. Um die Sache noch schlimmer zu machen: Weil in diesem Jahr das zweite Jubel-Jubiläum zur Feier der Fünfzigsten Hungerspiele stattfindet, muss jeder Distrikt doppelt so viele Kinder schicken wie sonst. Das ist so, als hätte ich bei einer normalen Ernte vierzig Zettel in der Trommel. Keine erfreuliche Aussicht.
In dem zunehmenden Gedränge sehe ich, wie ganz vorn ein Zwölfjähriger seine Tränen zu verbergen versucht. In zwei Jahren wird Sid dort stehen. Ich frage mich, wer von uns beiden sich vorher mit ihm hinsetzt und ihm seine Rolle bei der Ernte erklärt, Ma oder ich. Dass er anständig aussehen und den Mund halten und keinen Ärger machen soll. Und dass er, selbst wenn das Undenkbare geschieht und sein Name gezogen wird, sich damit abzufinden hat, ein möglichst tapferes Gesicht aufsetzen und auf diese Bühne hinaufsteigen muss, denn Widerstand ist zwecklos. Notfalls würden die Friedenswächter ihn hinaufschleifen, auch wenn er noch so schreien und um sich treten würde, deshalb sollte er versuchen, so würdevoll wie möglich zu gehen. Und immer daran denken: Was auch geschieht, seine Familie wird ihn auf ewig lieben und stolz auf ihn sein.
Und falls Sid fragen sollte: »Aber warum muss ich das alles tun?«, können wir nur sagen: »So ist es nun mal.«
Bei dem Satz würde Lenore Dove fuchsteufelswild werden. Aber es ist die Wahrheit.
»Glückwunsch!« Jemand haut mir auf die Schulter. Ich drehe mich um und sehe Burdock in einem ausgefransten Anzug und unseren Freund Blair, der ein drei Nummern zu großes Anzughemd trägt, das er von seinem älteren Bruder geerbt hat.
Blair klatscht mir eine Packung gerösteter Erdnüsse aus dem Kapitol-Laden gegen die Brust. »Mögen all deine Wünsche in Erfüllung gehen.«
»Danke.« Ich stecke die Nüsse und meine Gummidrops ein. »Wär aber nicht nötig gewesen, dass ihr euch für mich so in Schale schmeißt.«
»Ach, sollte halt ein besonderer Tag für dich werden«, sagt Blair. »Welcher Blödmann hat schon am Erntetag Geburtstag?«
»Ein Mann, der die Herausforderung liebt«, sagt Burdock anerkennend.
»Ich spiel mit den Karten, die das Schicksal mir gegeben hat. Aber ihr wisst ja, Pech im Spiel, Glück in der Liebe.« Ich rücke meine Kamille zurecht. »Guck mal, Burdie, was deine Freundin mir geschenkt hat.«
Wir schauen hinüber zum Areal der Mädchen, wo Asterid sich mit Merrilee und ihrer eineiigen Zwillingsschwester Maysilee unterhält, dem eingebildetsten Mädchen der Stadt.
»Wissen ihre Freundinnen eigentlich über euch Bescheid, Everdeen?«, fragt Blair.
»Da gibt’s nichts zu wissen«, sagt Burdock und grinst. »Jedenfalls noch nicht.«
Die Lautsprecher krächzen, und uns vergeht schlagartig das Grinsen. In diesem Augenblick sehe ich, wie Lenore Dove sich an einem Friedenswächter vorbei in das Areal der Mädchen zwängt. Sie sieht schön aus in dem apfelroten Rüschenkleid, in dem sie manchmal auch auftritt, das Haar mit Metallkämmen aus Tam Ambers Schmiede hochgesteckt. Schön und entschlossen.
Eine Tonbandaufnahme der Hymne dröhnt so laut über den Platz, dass meine Zähne klappern.
Juwel von Panem,
Mächtige Stadt …
Eigentlich sollen wir laut mitsingen, aber wir nuscheln nur vor uns hin. Bewegen die Lippen gerade so, dass es passen könnte. Die Bildschirme projizieren Bilder von der Macht des Kapitols: eine Armee marschierender Friedenswächter, eine Luftflotte aus Hovercrafts, eine Panzerparade, die durch die breiten Straßen des Kapitols zum Präsidentenpalast führt. Alles ist sauber, teuer und tödlich.
Als die Hymne verklungen ist, steigt Bürgermeisterin Allister aufs Podium und verliest den Hochverratsvertrag, der die Kapitulationsbedingungen enthält. Die meisten Bewohner von Distrikt 12 waren nicht mal geboren, als der Krieg zu Ende ging, dennoch sind wir alle hier, um den Preis dafür zu zahlen. Die Bürgermeisterin versucht, unbeteiligt zu klingen, aber ihr ist ein derartiger Widerwille anzuhören, dass sie garantiert bald ausgetauscht wird. Wie es mit allen einigermaßen anständigen Bürgermeistern passiert.
Jetzt betritt, frisch aus dem Kapitol, Drusilla Sickle die Bühne, eine Frau mit Plastikgesicht, die jedes Jahr unsere Tribute zu den Hungerspielen begleitet. Ich habe keinen Schimmer, wie alt Drusilla ist, aber sie ist seit dem ersten Jubel-Jubiläum für unseren Distrikt zuständig. Vielleicht so alt wie Hattie? Schwer zu sagen, denn ihr Gesicht wird von so etwas wie extravaganten Reißzwecken eingerahmt, die ihre Haut nach hinten ziehen und straffen. Letztes Jahr war auf jeder Reißzwecke eine kleine Kreissäge abgebildet. Dieses Jahr scheint das Thema die Zahl 50 zu sein. Für ihr Outfit hat Drusilla krampfhaft versucht, zwei Modetrends miteinander zu kombinieren, Military und schick. Das Ergebnis ist eine zitronengelbe Uniformjacke mit passenden Overknee-Stiefeln und ein hoher Hut mit Sonnenblende. Aus dem Hut ragen Federn heraus, sodass sie aussieht wie eine durchgeknallte Osterglocke. Aber keiner lacht, denn hier ist sie das Gesicht des Bösen.
Zwei Friedenswächter platzieren rechts und links auf das Podium zwei voluminöse Glaskugeln mit den Losen. »Ladies first«, sagt Drusilla. Sie taucht ihre Hand in die rechte Kugel und zieht einen einzelnen Zettel heraus. »Und die Glückliche ist …« Sie macht eine effektheischende Pause, wedelt ein wenig mit dem Zettel und lächelt süffisant, dann sticht sie zu. »Louella McCoy!«
Mir wird schlecht. Louella McCoy wohnt drei Häuser weiter, und es gibt keine pfiffigere, mutigere Dreizehnjährige als sie. Ein zorniges Gemurmel wogt durch die Menge, und ich spüre die Anspannung von Blair und Burdock neben mir, während Louella die Stufen zur Bühne hinaufsteigt, die schwarzen Zöpfe über die Schultern wirft und finster dreinschaut, um möglichst taff zu wirken.
»Und dieses Jahr, Ladies auch noch second! Gemeinsam mit Louella fährt …« Drusillas Hand rührt in den Zetteln und fischt einen weiteren Namen heraus. »Maysilee Donner!«
Lenore Dove und ich werfen uns einen Blick zu, und ich kann nur eins denken: Du nicht. Zumindest dieses Jahr nicht. Du bist auf der sicheren Seite.
Wieder regt sich die Menge, aber diesmal mehr aus Überraschung als aus Ärger, denn Maysilee ist ein astreines Stadtmädchen und so dünkelhaft, wie es nur geht, zumal die Donners Kaufleute sind und alle davon ausgehen, dass Maysilees Vater der Nachfolger von Bürgermeisterin Allister wird. Stadtkinder werden selten ausgelost, weil sie im Unterschied zu denen aus dem Saum normalerweise keine Tesserasteine brauchen.
Während Maysilee im Areal der Mädchen nach Asterids Hand greift, umarmt Merrilee sie weinend, drei Blondschöpfe in einem festen Knäuel. Irgendwann löst sich Maysilee behutsam und streicht ihr Kleid glatt, das genauso aussieht wie das rosafarbene ihrer Zwillingsschwester, nur in Lavendel. Hochnäsig ist sie eigentlich immer, doch als sie jetzt zur Bühne geht, trägt sie die Nase extra hoch.
Jetzt sind die Jungen an der Reihe. Ich wappne mich, auf das Schlimmste gefasst, während Drusilla einen Zettel aus der Glaskugel zu ihrer Linken pflückt. »Und der erste Gentleman, der die Ladys begleiten darf, ist … Wyatt Callow!«
Wyatt Callow habe ich schon eine ganze Weile nicht mehr in der Schule gesehen, was vermutlich bedeutet, dass er achtzehn geworden ist und im Bergwerk angefangen hat. Ich kenne ihn kaum. Er lebt auf der anderen Seite des Saums und tritt nicht groß in Erscheinung. Ich hasse mich für die Erleichterung, die ich empfinde, während ich zusehe, wie er gemessenen Schrittes und mit leerem Gesichtsausdruck zur Bühne geht. Auch für ihn tut es mir leid. Es kann nicht mehr lange hin sein bis zu Wyatts neunzehntem Geburtstag, was in den Distrikten eine große Sache ist, weil man dann zu alt für die Ernte ist.
Drusilla taucht die Hand wieder in die Kugel, und irgendwie scheint es zu viel des Guten, darauf zu hoffen, dass wir beide diesem Schrecken entkommen, Lenore Dove und ich. Dass wir in ein paar Stunden weit weg sein werden, fest umarmt im kühlen Schatten des Waldes. Ich halte den Atem an und mache mich bereit, mein Todesurteil zu empfangen.
Drusilla schaut auf den letzten Namen. »Und Junge Nummer zwei ist … Woodbine Chance!«
Unwillkürlich entfährt mir ein lauter Seufzer, und vielen Jungs um mich herum geht es genauso. Lenore Dove schaut herüber, versucht zu lächeln, aber dann zieht es ihren Blick wieder zu dem letzten Opfer.
Woodbine ist der jüngste und hübscheste der verrückten Chance-Jungs. Wenn sie trinken, rasten sie allesamt so dermaßen aus, dass Hattie ihnen schon lange keinen Klaren mehr verkauft, aus Angst, sie könnten die Friedenswächter auf den Plan rufen. Deshalb müssen sie sich beim alten Bascom Pie eindecken, weil der keine Skrupel kennt und seinen Fusel jedem verkauft, der ihn bezahlen kann. Den Abernathys haftet vielleicht der Ruch an, Unruhestifter zu sein, aber die Chance-Familie stinkt regelrecht danach, und sie haben so viele Angehörige durch den Strick verloren, dass ich den Überblick verloren habe. Nichts Genaues weiß man nicht, aber angeblich ist Lenore Dove väterlicherseits mit ihnen verwandt. Und sie mögen sie offenbar sehr gern. So oder so ist da eine Verbindung, die Clerk Carmine nicht in den Kram passt.
Ich sehe Woodbine, der ein paar Reihen vor mir steht, groß auf dem Bildschirm. Es sieht aus, als wollte er Wyatt folgen, doch dann blitzt es trotzig in seinen grauen Augen, er fährt herum und rennt auf eine Seitenstraße zu. Seine Leute feuern ihn lautstark an, instinktiv stellen sich einige den Friedenswächtern in den Weg. Gerade als ich denke, er könnte es vielleicht schaffen – die Chance-Kinder rennen alle wie die Teufel –, knallt vom Dach des Gerichtsgebäudes her ein Schuss, und Woodbines Hinterkopf zerplatzt in tausend Stücke.
2
Die Bildschirme werden kurz dunkel, dann erscheint wieder die Flagge. Offenbar soll der Rest des Landes den Aufruhr in Distrikt 12 nicht mitbekommen.
Auf dem Platz bricht Panik aus, manche flüchten sich in die Seitenstraßen, andere laufen los und wollen Woodbine helfen, obwohl für ihn jede Hilfe zu spät kommt. Die Friedenswächter geben Warnschüsse ab, treffen aber auch Unglückliche in der Menge. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Zu Sid und Ma laufen? Lenore Dove weg von diesem Platz bringen? Deckung suchen?
»Wer war das? Wer war das?«, brüllt Drusilla.
Jemand schiebt einen verstörten jungen Friedenswächter an die Kante des Daches vom Gerichtsgebäude.
»Du Idiot!«, blafft Drusilla ihn von unten an. »Hättest du nicht warten können, bis er in der Seitenstraße ist? Jetzt sieh dir dieses Chaos an!«
Chaos ist das richtige Wort. Ich entdecke Ma und Sid am Rand der Menge und will schon zu ihnen, als eine raue Männerstimme über die Lautsprecher dröhnt.
»Auf den Boden! Auf den Boden, alle! Sofort!« Automatisch lasse ich mich auf die Knie fallen und nehme die verlangte Position ein – Hände in den Nacken, Stirn gegen das rußige Backsteinpflaster. Aus dem Augenwinkel sehe ich, dass alle es genauso machen, nur Otho Mellark, ein beleibter Trampel, dessen Familie die Bäckerei betreibt, steht noch da und schaut verwundert drein. Er weiß nicht, wohin mit den fleischigen Händen, und schlurft mit den Füßen auf der Stelle, und da bemerke ich plötzlich, dass sein blondes Haar mit Blut bespritzt ist. Burdock boxt ihn fest in die Kniekehlen, wodurch auch er auf den Boden sackt, aus der Schusslinie.
Drusilla hat vergessen, das Mikrofon auszuschalten, und jetzt können alle auf dem Platz mitanhören, wie sie ihr Team zusammenstaucht. »Wir haben fünf Minuten! Fünf Minuten Puffer, dann müssen wir das hier live zu Ende bringen. Schafft die Verletzten weg, ich will kein Blut mehr sehen!«
Zum ersten Mal begreife ich, dass die Liveübertragung der Ernte gar nicht live gesendet wird, sondern mit fünf Minuten Verzögerung, für den Fall, dass etwas schiefgeht – so wie jetzt.
Friedenswächterstiefel stampfen durch die Reihen, alle, die Blut an Körper oder Kleidung haben, Otho eingeschlossen, werden gepackt und in die nahen Geschäfte verfrachtet.
»Wir brauchen einen neuen Jungen! Der Tote nützt uns nichts mehr!«, ruft Drusilla, während sie die Treppenstufen auf den Platz hinunterklackert.
Von irgendwoher kommt eine schrille Totenklage, gefolgt von gebellten Befehlen der Friedenswächter. Plötzlich höre ich Lenore Doves Stimme, und mein Kopf fährt unwillkürlich hoch. Sie versucht, Woodbines Mutter beizustehen, die seine Hand umklammert, während zwei Friedenswächter versuchen, ihn wegzutragen. Lenore Dove berührt einen am Arm und bittet ihn, den toten Jungen seiner Mutter zu überlassen, nur einen Moment. Aber offenbar ist das zu viel verlangt.
Das kann nicht gut ausgehen. Soll ich mich einmischen? Lenore Dove da wegholen? Oder mache ich dadurch alles noch schlimmer? Es ist, als wären meine Knie am Boden festgeklebt.
»Was ist da los?«, höre ich Drusilla. »Schafft die Leiche vom Platz!« Ein Trupp von weiteren vier Friedenswächtern kommt angelaufen.
Als sie das Wort »Leiche« im Zusammenhang mit ihrem Sohn hört, rastet Woodbines Mutter aus. Sie stößt grelle Schreie aus, schlingt die Arme um die Brust ihres Sohnes, versucht, ihn von den Soldaten wegzuziehen. Lenore Dove kommt ihr zu Hilfe, zerrt an Woodbines Beinen.
Ma wird stinksauer sein, dass ich mich einmische, aber ich kann hier nicht einfach am Boden rumkriechen, während Lenore Dove in Gefahr ist. Ich springe auf und renne zu ihr, will sie überreden, Woodbine loszulassen. Schon hebt einer der herbeigeeilten Friedenswächter das Gewehr, um sie bewusstlos zu schlagen.
»Nicht!« Ich komme gerade noch rechtzeitig, um den Gewehrkolben abzufangen, der stattdessen gegen meine Schläfe knallt. Der Schmerz explodiert in meinem Kopf, Blitze zucken vor meinen Augen. Noch ehe ich zu Boden gehe, packen mich eiserne Hände an den Oberarmen und schleifen mich fort, meine Nase nur Zentimeter über dem Backstein. Als sie mich loslassen, lande ich auf dem Gesicht, vor mir ein Paar gelbe Stiefel. Eine Stiefelspitze hebt mein Kinn an und lässt es dann wieder auf den Boden knallen.
»Na, da haben wir ja unseren Ersatz.«
Hinter mir höre ich Lenore Dove flehen: »Nicht ihn – es war nicht seine Schuld! Es war meine! Bestraft mich!«
»Kann mal jemand die Kleine da abknallen, bitte?«, sagt Drusilla genervt. Ein Friedenswächter in der Nähe richtet sein Gewehr auf Lenore Dove, aber da schnaubt Drusilla ärgerlich. »Doch nicht hier! Hier ist schon genug Blut, das wir wegwischen müssen. Such dir einen diskreten Ort, verstanden?«
Der Friedenswächter will Lenore Dove packen, als ein Typ im lila Jumpsuit auftaucht und ihn am Ellbogen zurückhält. »Warte. Wenn das ginge, Drusilla, hätte ich sie gern noch für die tränenreiche Abschiedsszene. Die Zuschauer lieben das, und du schärfst uns ja immer ein, wie schwer es ist, ihnen Distrikt Zwölf schmackhaft zu machen.«
»Na gut, Plutarch. Meinetwegen. Die anderen sollen jetzt alle aufstehen. Hoch mit euch! Auf die Füße, ihr Distrikt-Schweine!« Als sie mich hochhieven, sehe ich, dass an einem von Drusillas Stiefeln seitlich eine Reitgerte festgeklemmt ist, und frage mich, ob die nur zur Deko da ist. Ihr fauliger Atem schlägt mir ins Gesicht. »Und du spielst schön mit, oder ich erschieße dich höchstpersönlich.«
»Haymitch!«, ruft Lenore Dove.
Ich will ihr antworten, aber Drusilla legt ihre langen Finger wie eine Klammer um mein Gesicht. »Und sie darf dabei zusehen.«
Plutarch gibt einer Frau aus dem Filmteam ein Zeichen. »Cassia, eine Kamera auf das Mädchen da, ja?« Er läuft hinter Drusilla her. »Hör mal, wir haben prima Bildmaterial, wie die Friedenswächter die Menge in Schach halten. Das wär doch eine schöne Untermalung des Slogans ›Ohne Friedenswächter kein Frieden‹.«
»Dafür hab ich keine Zeit, Plutarch! Ich hab ja kaum Zeit, den Status quo zu managen! Holt den ersten Jungen … Wie heißt der noch mal?«
»Wyatt Callow«, sagt Plutarch.
»Bringt Wyatt Callow zurück in das Areal.« Drusilla schlägt sich gegen die Stirn. »Nein!« Sie denkt einen Augenblick lang nach. »Doch! Ich verkünde beide Namen. Dann haben wir einen glatten Übergang.«
»Kostet dich aber noch einmal dreißig Sekunden.«
»Dann lass uns keine Zeit verlieren.« Sie zeigt auf mich. »Wie heißt du?«
Mein Name klingt fremd aus meinem eigenen Mund. »Haymitch Abernathy.«
»Haymitch Abernanny?«, wiederholt sie.
»Haymitch Abernathy«, korrigiere ich.
Ärgerlich wendet sie sich an Plutarch. »Das ist zu lang!« Er kritzelt etwas auf sein Klemmbrett und reißt einen Zettel ab. Sie nimmt ihn und liest: »Wyatt Callow und Haymitch … Aber…nathy. Wyatt Callow und Haymitch Abernathy.«
»Mann, du bist Profi«, sagt Plutarch. »Jetzt geh auf deinen Platz. Ich postiere ihn.« Während Drusilla die Stufen hinaufeilt, nimmt er mich am Ellbogen und flüstert: »Sei kein Dummkopf, Junge. Wenn du noch mal querschlägst, tötet sie dich mit einem Schnipp.«
Meint er jetzt mit einem Fingerschnippen, oder was könnte es noch für ein schreckliches Schnipp geben? Was weiß ich. Jedenfalls will ich nicht mit einem Schnipp sterben.
Plutarch führt mich an eine Stelle nicht weit von der Bühne. »Das müsste passen. Du wartest hier, und wenn Drusilla deinen Namen verkündet, kommst du ganz ruhig auf die Bühne. Verstanden?«
Ich versuche zu nicken. In meinem Kopf hämmert es, meine Gedanken scheppern umher wie Steine in einer Blechdose. Was ist da eben passiert? Was passiert da jetzt gerade? Irgendwo in mir drin weiß ich es. Ich bin ein Tribut bei den Hungerspielen. In ein paar Tagen werde ich in der Arena sterben. Das alles weiß ich, aber es ist, als würde es jemand anderem widerfahren und ich schaue bloß von fern zu.
Die verbliebenen Zuschauer sind wieder auf den Beinen, aber ihre Fassung haben sie noch nicht zurückerlangt. Sie flüstern eindringlich mit ihrem Nachbarn, versuchen herauszufinden, was los ist.
»Auf Sendung in dreißig«, sagt jemand über die Lautsprecher. »Neunundzwanzig, achtundzwanzig, siebenundzwanzig …«
»Maul halten da unten!«, brüllt Drusilla, während eine Maskenbildnerin ihr das verschwitzte Gesicht pudert. »Maul halten, oder wir töten euch alle!« Wie um ihre Worte zu unterstreichen, feuert ein Friedenswächter neben ihr eine Salve in die Luft, und ein Hovercraft fliegt über den Platz.
Augenblicklich wird es still – so still, dass ich mein Blut in den Ohren wummern höre. Ich spüre den Impuls, es wie Woodbine zu machen und zu fliehen, aber dann sehe ich wieder seinen Schädel vor mir, aus dem das Gehirn raushängt.
»… zehn, neun, acht …«
Auf der Bühne haben alle wieder die Plätze eingenommen, auf denen sie standen, bevor die Schießerei losging: Louella und Maysilee, die Friedenswächter sowie Drusilla, die rasch den Zettel, den Plutarch ihr gegeben hat, in zwei Streifen zerreißt und sie ganz oben auf den Haufen in der Glaskugel positioniert.
Auf der Suche nach Halt taste ich nach Burdock und Blair, aber natürlich sind sie nicht da. Nur ein paar von den Jüngeren, die sich so fern wie möglich von mir halten.
»… drei, zwei, eins – live auf Sendung.«
Drusilla tut so, als würde sie einen Namen ziehen. »Und der erste Gentleman, der die Ladys begleiten darf, ist … Wyatt Callow!«
Es ist schon schräg, noch einmal mitanzusehen, wie Wyatt wieder unerschütterlich an mir vorbeigeht und brav seinen Platz auf der Bühne einnimmt.
Drusilla lässt die Hand über der Kugel schweben und entnimmt ihr mit chirurgischer Präzision einen Zettel. »Und unser zweiter Junge iiist … Haymitch Abernathy!« Ich stehe nur da und rühre mich nicht, falls alles doch nur ein böser Traum ist und ich gleich in meinem Bett aufwache. Das ist alles so verkehrt. Eben noch war ich knapp davongekommen, fast schon auf dem Weg nach Hause, in den Wald, für ein weiteres Jahr gerettet.
»Haymitch?«, wiederholt Drusilla und sieht mich direkt an.
Mein Gesicht füllt den Bildschirm über der Bühne aus. Meine Füße setzen sich in Bewegung. Schnitt, und ich sehe Lenore Dove, die eine Hand vor den Mund geschlagen hat. Sie weint nicht, Plutarch wird seinen tränenreichen Abschied nicht bekommen. Weder von ihr noch von mir. Unsere Tränen werden nicht zum Stoff für ihre Show.
»Meine Damen und Herren, heißen Sie mit mir die Tribute aus Distrikt Zwölf zu den Fünfzigsten Hungerspielen willkommen!«, preist Drusilla uns an. »Möge das Glück STETS mit euch sein!« Sie beginnt zu klatschen, und aus den Lautsprechern kommt der tosende Applaus einer riesigen Zuschauermasse, obwohl hier auf dem Platz in 12 kaum jemand eine Hand rührt.
Ich entdecke Lenore Dove in der Menge, wir schauen uns verzweifelt an. Kurz löst sich alles andere auf, und es gibt nur noch uns. Sie nimmt die Hand vom Mund und legt sie aufs Herz. Ich lieb dich lichterloh, sagen ihre Lippen. Ich dich auch, antworte ich stumm.
Kanonendonner bricht den Zauber. Konfetti regnet auf mich herab, auf die Bühne, auf den ganzen Platz. Inmitten der glitzernden Schnipsel verliere ich sie aus den Augen.
Drusilla breitet die Arme aus. »Allen ein fröhliches Jubel-Jubiläum!«
»Und Schluss – danke, das war’s!«, sagt die Stimme über den Lautsprecher.
Die Regie hat weitergeschaltet zur Ernte in Distrikt 11, der Applaus aus der Konserve verstummt. Drusilla gibt ein Stöhnen von sich und lässt sich dramatisch auf das Podium plumpsen.
Das Team von Kapitol TV jubelt Plutarch zu, der von der Seite auf die Bühne kommt und ruft: »Brillant! Bravo, alle! Wie aus einem Guss, Drusilla!«
Drusilla hat sich wieder erholt und reißt am Kinnriemen ihres Osterglockenhuts. »Keine Ahnung, wie ich das wieder hingekriegt habe.« Sie zieht eine Schachtel Zigaretten aus dem Stiefel, zündet sich eine an und stößt den Rauch durch die Nase aus wie durch einen Schornstein. »Immerhin ne gute Story für die nächste Dinnerparty!«
Einer der Assistenten erscheint mit einem Tablett voller Gläser, die mit einer blassen Flüssigkeit gefüllt sind. Versehentlich bietet er mir eins an – »Champagner?« –, ehe er seinen Fehler erkennt. »Oops! Keinen für die Kinder!«
Drusilla nimmt sich ein Glas und mustert die Bewohner von Distrikt 12, die stumm und verzagt dastehen, während letzte Konfettischnipsel auf sie herabrieseln. »He, was starren die so? Drecksbande. Geht nach Hause! Alle!« Sie wendet sich an einen Friedenswächter. »Schafft sie hier weg, bevor meine Haare ihren Gestank annehmen.« Sie schnuppert an einer Locke und verzieht das Gesicht. »Zu spät.«
Der Friedenswächter gibt ein Signal, und die Soldaten drängen die Menge zurück. Burdock und Blair versuchen, sich zu widersetzen, aber die meisten anderen verschwinden schnell in die Seitenstraßen, froh, der Tortur der Ernte zu entkommen, nach Hause zu gehen, ihre Kinder zu umarmen und sich je nachdem an Hatties Stand nach allen Regeln der Kunst volllaufen zu lassen.
Ein Friedenswächter hält Lenore Dove zurück, und ich gerate in Panik. Wieso bin ich nicht früher dazwischengegangen? Warum habe ich so lange gewartet, bis mir keine andere Wahl blieb und ich diesem Soldaten in die Arme fallen musste? Hatte ich Angst? War ich verwirrt? Oder habe ich mich nur ohnmächtig gefühlt beim Anblick dieser weißen Uniformen? Jetzt sind wir beide dem Untergang geweiht. Der Friedenswächter zieht gerade Handschellen heraus, als Clerk Carmine und Tam Amber dazukommen. Sie reden schnell und leise auf ihn ein, und ich meine zu sehen, dass Geld den Besitzer wechselt. Zu meiner Erleichterung schaut der Friedenswächter sich um, lässt sie frei und geht davon. Lenore Dove will zu mir auf die Bühne, aber ihre Onkel schieben sie schnell in eine Seitenstraße.
Zurück bleiben die anderen unglücklichen Angehörigen der diesjährigen Tribute.
In der Hoffnung, Maysilee irgendwie auslösen zu können, stürmt Mr Donner mit Geldscheinen in der Hand auf die Bühne, während seine Frau und Merrilee dicht aneinandergedrängt vor ihrem Laden warten. »Nicht, Papa!«, ruft Maysilee, aber ihr Vater wedelt den Leuten unbeirrt mit den Scheinen vor der Nase herum.
In einer anderen Familie – ich glaube, es sind die Callows – weint eine Frau hysterisch, während die Männer miteinander streiten. »Weil du es gesagt hast!«, wirft einer einem anderen vor. »Du bist schuld!«
Unsere Nachbarn, die McCoys, kümmern sich liebevoll um Ma, die sich kaum auf den Beinen halten kann. Sid hängt an ihrer Hand und schreit in einem fort: »Haymitch! Haymitch!« Ich könnte jetzt schon sterben vor Heimweh. Ich weiß, ich muss stark sein, aber ihr Anblick macht mich fertig. Wie sollen sie ohne mich zurechtkommen?
Als Nächstes steht der Abschied der Tribute von ihren Familien und Freunden im Gerichtsgebäude auf dem Programm. Ich habe das schon mal mitgemacht. Ma und Pa haben mich damals mitgenommen, als Sarshee Whitcomb, die Tochter von Pas früherem Schichtmeister, bei der Ernte gezogen wurde. Sie war in jenem Jahr Waise geworden, nachdem ihr Vater, Lyle, an einer Staublunge gestorben war. Ma sagte den Friedenswächtern, wir wären Verwandte, woraufhin sie uns in eine Stube voller zerkratzter Möbel führten, die gut mal hätten abgestaubt werden können. Soweit ich weiß, waren wir die Einzigen, die sich von ihr verabschiedet haben.
Eigentlich müsste ich bis zur offiziellen Abschiedszeit warten, aber für mich zählt jetzt nur eins, nämlich Ma und Sid in die Arme zu schließen. In dem Krawall, den Mr Donner und Maysilee veranstalten, schleiche ich mich an den Rand der Bühne, bücke mich und strecke die Arme nach den beiden aus, die zu mir gelaufen kommen.
»Nichts da!« Ein Friedenswächter reißt mich brutal zurück, und Drusilla fährt fort: »Kein Abschied für diese Leute. Dieses Privileg haben sie nach der unerhörten Vorstellung heute verwirkt. Bringt sie direkt in den Zug, und dann lasst uns aus diesem Drecksloch verschwinden.«
Zwei Friedenswächter werfen Mr Donner in hohem Bogen von der Bühne. Die Geldscheine entgleiten ihm, segeln herunter und vermischen sich mit dem Konfetti auf dem Boden. Dann zücken sie Handschellen.
Louella hat sich bisher tapfer gehalten, aber jetzt schaut sie mich mit angstgeweiteten Augen an. Ich lege ihr eine Hand auf die Schulter, um sie zu beruhigen, doch als das kalte Metall ihre Hand berührt, heult sie auf wie ein Tierjunges, das in die Falle geraten ist. In dem verzweifelten Wunsch, uns zurückzuholen, rücken unsere Familien näher an die Bühne.
Während die Friedenswächter sich ihnen in den Weg stellen, ergreift Plutarch das Wort: »Ich will bestimmt nicht nerven, Drusilla, aber ich habe wirklich kaum Material mit Reaktionen, und ich brauch dringend noch was für die Zusammenfassung. Kann ich nicht einfach jetzt noch schnell ein paar einfangen?«
»Wenn’s sein muss. Aber wenn du in einer Viertelstunde nicht im Zug bist, kannst du nach Hause laufen«, sagt Drusilla.
»Hast was bei mir gut.« Plutarch geht rasch unsere Familien durch, dann zeigt er auf mich und Louella. »Lass mir den und die.«