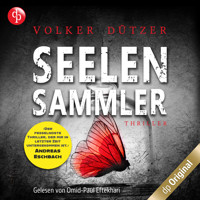Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Hannah Bloch
- Sprache: Deutsch
Frankfurt am Main, 1939. Die vierzehnjährige Hannah bricht vor ihren Mitschülern in einem Krampfanfall zusammen. Bisher war es ihr gelungen, ihre Epilepsie zu verheimlichen, doch jetzt meldet ihr linientreuer Lehrer sie bei der Obrigkeit. Hannah gerät ins Visier des NS-Terrorapparates, denn die Nazis haben sich zum Ziel gesetzt, alles „lebensunwerte Leben“ zu vernichten. Hannahs Schicksal liegt nun in den Händen des Gutachterarztes Joachim Lubeck, einem gewissenlosen Opportunisten, der für seine Karriere über Leichen geht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 602
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Volker Dützer
Die Unwerten
Roman
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind, sofern nicht im Nachwort erläutert,
rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2020 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Daniel Abt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden (Abt. 3008/1, Nr. 1012)
Druck: GGP Media GmbH, Pößneck
Printed in Germany
ISBN 978-3-8392-6364-8
Widmung
Für meine Eltern, die diese dunkle Zeit noch erlebt haben und deren Erinnerungen ich als Kind so gerne gelauscht habe.
Zitat
Wolkenbilder sind sehr schön, doch kann sie nicht jeder sehen.
(John Elsas, 1851–1935)
Charaktere in der Reihenfolge ihres Auftritts
Historische Personen sind mit einem * gekennzeichnet.
Hannah Bloch: Halbjüdin
Reinhold Pilz: Mathematiklehrer, überzeugter Nationalsozialist
Heinrich Berthold: Schulleiter
Malisha Bloch: Hannahs Mutter
Joschi: Hannahs stummer Beschützer
Jakob Blumberg: jüdischer Arzt
Joachim Lubeck: Psychiater, SS-Untersturmführer
Werner Heyde *: Professor für Psychiatrie und Neurologie, Leiter der medizinischen Abteilung der »Euthanasie«-Zentrale und Obergutachter der Euthanasie-Aktion T4
Irmfried Eberl *: medizinischer Leiter der Tötungsanstalt Brandenburg ab Januar 1940
Viktor Brack *: Oberdienstleiter KdF (Kanzlei des Führers) Amt 2
Philipp Bouhler *: Chef der KdF, von Hitler mit der Organisation der Aktion T4 beauftragt
Werner Blankenburg *: Vertretung von Brack
Karl Brandt *: chirurgischer Begleitarzt von Adolf Hitler
Ernst Baumhard *: Oberarzt in der Tötungsanstalt Hadamar Dezember 1940 bis Juni 1941
*
Christian Wirth *: Büroleiter der Tötungsanstalt Brandenburg, ab 1941 Büroleiter in Hadamar
Fritz Brunner: Leiter des Anstaltswesens Hessen-Nassau und Landesrat
Heinz Borsig: Fritz Brunners Adjutant, Mädchen für alles
Claudius Brendel: katholischer Priester
Schwester Agnes: Oberin des Nonnenklosters Schwes-tern der barmherzigen Maria in Seck
Schwester Katharina: Nonne
Schwester Gertrud: Nonne
Arthur Leppin: Passfälscher, Kleinganove
(Mr. Smith)
Robert Krüger: Kriminalkommissar der Gestapo
Horst Schulze: sein Folterknecht
Elisabeth Brunner, geb. zu Hohensolms: Fritz Brunners Ehefrau
Ruth und Thea: ausgekochte Zwillinge
Obermayer
Helma: ihre Zimmergenossin
Hannelore Kowalski: Oberschwester der Zwischenanstalt Herborn
Hermann Pfannmüller *: Psychiater und T4-Gutachter
Wilhelm Traupel *: Landeshauptmann, Brunners Vorgesetzter
Jakob Sprenger *: Gauleiter von Hessen-Nassau
Friedrich Mennecke *: T4-Gutachterarzt
Dr. Paul Schiese *: Anstaltsdirektor in Herborn
Herbert Moor: Arzt in der Zwischenanstalt Herborn
Schwester Franziska: seine Sekretärin
Deubel
*
Christel: Dienstmagd im Haus Brunner
Leni: Köchin im Haus Brunner
Heinrich Richter (Hein das Wiesel): unehelicher Sohn von Franz Schickl und dessen Sekretärin Ilse Richter
*
Josef: polnischer Zwangsarbeiter
Rudolf Klee: Brendels Mentor, alter Pfarrer
Antonius Hilfrich *: Bischof von Limburg
Clemens August : Bischof von Münster
Graf von Galen *
Adolf Wahlmann *: Leitender Oberarzt der Anstalt Hadamar 1942–45
Irmgard Huber *: Oberschwester der Anstalt Hadamar
Hans Simonek: verwundeter Obergefreiter
Karl und Hildegard Simonek: seine Großeltern
Kalle: Ruths Mann fürs Grobe, ihr Joschi
Ernst Weber: Kiesgrubenbesitzer
Willi Wetzel: todkranker Tagelöhner
Gottfried Petzold: Kneipenwirt
Scott Young: Lieutenant der US Air Force
Rolf Heyrich: Bürgermeister, SS-Oberscharführer
Teil 1 Der zerbrochene Himmel
1
Das Notizbuch mit dem speckigen roten Einband landete klatschend auf dem Schreibpult. Die meisten Schüler versuchten, ihre Anspannung zu verbergen, aber es gelang den wenigsten. Hannah zuckte zusammen, als hätte Pilz sie geohrfeigt.
»Heil Hitler«, brüllte er.
Die Klasse brüllte zurück. Die Heranwachsenden machten sich einen Spaß daraus, die heisere Stimme des Mathematiklehrers zu übertönen. Pilz war ein untersetzter Zwerg, kaum größer als Hannah mit ihren vierzehn Jahren, und er war sich seiner mickrigen Erscheinung nur allzu bewusst. Darum bemühte er sich, das fehlende Volumen seiner Stimme auszugleichen, indem er auf den Zehenspitzen wippte und seine Tonlage erhöhte. Heraus kam ein Fiepen, das dem Quietschen nasser Kreide auf einer Schiefertafel ähnelte.
Pilz reckte das Kinn vor, presste die Lippen zusammen und ließ seine Blicke über die Reihen wandern. Manchmal griff er sich einen Schüler heraus, um ihn vor den anderen lächerlich zu machen, bevor der eigentliche Unterricht begann. Hannah hatte bisher nicht herausgefunden, ob er nach einem bestimmten Muster vorging oder nur einer Laune folgte.
»Setzen!«
Stuhlbeine scharrten, Stoff raschelte. Der dicke Koschka – er saß links von Hannah auf der Fensterseite – schwitzte in seiner stramm sitzenden HJ-Uniform. Das kakibraune Hemd war ihm aus dem Hosenbund gerutscht, ein rosiges Speckröllchen quoll hervor. Niemand wagte zu atmen, alle starrten auf das rote Notizbuch.
Pilz hatte die Angewohnheit, jeden Freitag Noten zu verteilen, und auch an diesem 22. Dezember 1939, dem letzten Schultag vor Weihnachten, machte er keine Ausnahme. Mit Vorliebe stellte er Aufgaben, die nicht zu lösen waren und nur dem Zweck dienten, den Prüfling bloßzustellen. Anschließend hagelte es Fünfen und Sechsen. Pilz legte eine zackige Kehrtwende hin, marschierte zu seinem Pult und schrieb etwas an die Tafel.
»Was bedeutet diese Zahl?«
Koschka schnellte hoch. »Die Einwohnerzahl von Frankfurt, Scharführer.«
»Richtig, Koschka.« Pilz’ Mundwinkel zuckte, ein zufriedenes Lächeln huschte über sein rotfleckiges Gesicht. »Den Scharführer lassen wir heute mal zu Hause.«
Er verschränkte die Hände hinter dem Rücken, stolzierte durch den Mittelgang und schoss eine seiner berüchtigten Fangfragen ab: »Wie viele Schüler würde es in den Frankfurter Gymnasien geben, wenn die arischen Eltern ihre Kinder in dem gleichen Umfang an eine höhere Schule geschickt hätten wie die Juden?«
Pilz blieb neben Hannahs Bank stehen. Die Schüler hielten die Luft an. Wen würde es treffen?
Manchmal gelang es, ihn mit seinem Steckenpferd abzulenken, der Schädellehre nach Franz Joseph Gall. Phrenologie, Hannah hatte sich sogar die lateinische Bezeichnung gemerkt. Der Umgang mit Zahlen fiel ihr leicht, und sie konnte sich gut Dinge merken. Trotzdem hoffte sie inständig, Pilz möge einen anderen Schüler aufrufen, denn sein Gebrüll störte ihre Konzentration. Er brachte sie völlig durcheinander, sodass sie kein sinnvolles Wort mehr herausbrachte.
»Hannah Bloch.« Seine Stimme kiekste und kippte über.
Die Klasse stieß kollektiv den Atem aus. Hannah fragte sich, ob Pilz den Windstoß der Erleichterung auf seiner Glatze spürte, die jedes Mal feuerrot anlief, wenn er sich aufregte.
»Bloch!« Ungeduldig klopfte er mit dem Fingerknöchel auf die Bank. »Ja, was nun? Was nun?«
Hannah stand auf, nahm ihr Schreibheft von der Bank und ging nach vorne. Der Boden unter ihren Füßen fühlte sich merkwürdig weich an und schwankte wie das Deck eines Schiffes. Ihr Blickfeld verengte sich, an den Rändern kroch die Dunkelheit heran. Meistens zog sie sich rasch wieder zurück, aber ein paarmal hatte sie die Besinnung verloren. Zuletzt war das vor drei Wochen im Laden ihrer Mutter passiert.
Danach war sie auf dem Sofa in dem winzigen Hinterzimmer erwacht und hatte sich an nichts erinnern können. Malisha hatte sich besorgt über sie gebeugt und ihr einen kühlen Lappen auf die heiße Stirn gedrückt. Hannah nannte sie beim Vornamen, obwohl Mutter behauptete, das gehöre sich nicht. Sie liebte den weichen Klang des seltenen hebräischen Namens. Die Leute hielten sie manchmal für Schwestern, weil Malisha viel jünger aussah, als sie war. Hannah empfand ihr Verhältnis eher als eine innige Zuneigung unter Geschwistern. Vielleicht rührte es daher, dass sie einen Weiberhaushalt führten, in dem ein Mann fehlte.
Obwohl Hannah unter Ohnmachtsanfällen litt, verzichtete Malisha darauf, mit ihr einen Arzt aufzusuchen, was ganz und gar ihrer fürsorglichen Art widersprach. Hannah kannte den Grund dafür nicht, war jedoch insgeheim froh darüber, denn sie fürchtete sich vor Ärzten und Krankenhäusern.
Hannah schickte ein Stoßgebet gen Himmel, dass es nicht wieder geschah, nicht jetzt vor allen Kindern, nicht vor Pilz. Sie war Halbjüdin und hatte Probleme genug.
Krampfhaft umklammerte sie ihr Schreibheft. Die Gesichter verschwammen vor ihren Augen, alle starrten sie gebannt an und warteten auf das Schauspiel, das Pilz inszenieren würde. Schwungvoll klappte er die Tafel auf, die donnernd gegen die Wand krachte. Er liebte es, laut und hektisch aufzutreten, um damit seine Wichtigkeit zu unterstreichen und jeden empfindsamen Schüler einzuschüchtern.
Ihre Blicke trafen sich, Hannah erschrak. Heute war der kleine Mann offensichtlich in der Stimmung, einen seiner Schützlinge restlos zu zerstören, und seine Wahl war auf sie gefallen.
Natürlich hatte er sie nicht zufällig ausgewählt; Pilz war ein glühender Nationalsozialist, der alles Jüdische hasste. Seit einem Jahr mussten jüdische Kinder die für sie eingerichteten Schulen besuchen, und davon gab es viel zu wenige. Dass Hannah, deren Mutter Jüdin war, als Mischling ersten Grades weiterhin an seinem Unterricht teilnehmen durfte, war Pilz unerträglich. Ihre schnelle Auffassungsgabe und die Fähigkeit, komplizierte Rechenaufgaben intuitiv zu lösen, ärgerten ihn maßlos. Offenbar hatte er sich den letzten Schultag des Jahres ausgesucht, um sie vor den Augen der Klasse zu demütigen. Nur ein Wunder konnte sie jetzt noch retten.
Der Arm des hoch aufgeschossenen Krahwinkel flog in die Luft.
»Was denn, was denn?«, rief Pilz, »was gibt es denn so Wichtiges?«
»Stimmt es, dass die Polizei den Mörder, der das arme deutsche Mädchen erwürgt hat, nur anhand seiner Schädelform überführen konnte?«
Hannah warf ihm einen dankbaren Blick zu. Karl war einer der wenigen Schüler, die sie nicht ignorierten oder quälten. Sein Vater war Sozialdemokrat, seit vier Wochen fehlte von ihm jede Spur. Niemand sprach darüber.
»Freilich, freilich«, antwortete Pilz. »Merkt euch, wie dienstbar die Wissenschaft sein kann. Der überzeugte Nationalsozialist ist bestrebt zu lernen und zu forschen. Minderwertige Rassen haben daran kein Interesse, sie sind den Ariern von Natur aus unterlegen.«
Karls Trick, Pilz abzulenken, schien zu funktionieren. Er eilte mit energischen Schritten zu einem Ständer neben der Tür und enthüllte eine Schautafel. Hannah kannte die Bilder darauf auswendig. Sie zeigten Zeichnungen und Fotografien verschiedener menschlicher Köpfe, jeweils von vorne und der Seite dargestellt – manche waren rund wie Äpfel, andere länglich oder übertrieben in die Breite gezogen. Ein Linienraster bedeckte jedes Gesicht.
Pilz erging sich in den Merkmalen der Schädelformen und deren Auswirkungen auf die Eigenschaften ihrer Besitzer. Auf das richtige Stichwort hin konnte es vorkommen, dass er eine Stunde lang über sein Lieblingsthema faselte.
Die tief stehende Dezembersonne warf den kugelrunden Schatten seines Kopfes an die Wand. Ob ihm eigentlich bewusst war, dass sein eigener Schädel wenig Ähnlichkeit mit der Idealform der nordischen Rasse hatte, von der er so schwärmte?
Karl nannte ihn ›Fliegen-Pilz‹. Pilz trug mit Vorliebe Fliegen – gepunktete, karierte oder gestreifte. Nur rot mussten sie sein.
Als hätte er das Ablenkungsmanöver durchschaut, beendete er ganz gegen seine Gewohnheit nach wenigen Minuten seinen Vortrag und rollte die Schautafel zusammen.
Hannahs Herz schlug schneller. Die Finsternis sickerte wie schwarze Tinte aus ihren Augenwinkeln und breitete sich aus, winzige Blitze zuckten darin. Durch einen Schleier sah sie Pilz zur Tafel schreiten, eine Hand auf dem Rücken, mit der anderen nahm er die Kreide auf.
»Die Mathematik«, dozierte er, »die Mathematik ist die edelste aller Wissenschaften, denn sie ist in ihrer Klarheit überlegen wie die Willenskraft des Ariers über die Charakterschwäche der niederen Rassen.«
Er schrieb eine neue Aufgabe an die Tafel. Seine Frage von vorhin schien er völlig vergessen zu haben. Oft sprang er von einem Gedanken zum nächsten, ohne dass die Klasse ihm folgen konnte.
Die quietschende Kreide verursachte stechende Schmerzen in Hannahs Schläfen. Sie kniff die Augen zusammen und versuchte, Pilz’ unleserliche Schrift zu entziffern.
Er tippte auf die Buchstaben und las laut vor: »Ein Irrenhaus kostet zwei Millionen Reichsmark. Wie viele deutsche Familien könnten von dem Geld eine Wohnung bekommen?«
Koschka kicherte.
»Ruhe!«, brüllte Pilz.
Hannah schwankte, alles drehte sich um sie. Die schrille Stimme bohrte sich wie eine Nadel in ihren Kopf. Jedes Scharren auf dem Dielenboden, die Ausdünstungen der dreißig Schüler in dem engen Klassenzimmer, das grelle Sonnenlicht, das durch die Fenster fiel, all das drang ungefiltert und überirdisch klar in ihren Verstand. Die Dunkelheit kam. Es gab nichts, was sie tun konnte, um sie aufzuhalten.
»Nun, was denn, was denn? Zu schwierig für eine Jüdin?« Pilz schlenderte zu Brahmeyers Platz, dessen Vater SS-Standartenführer war, und beugte sich verschwörerisch zu ihm hinab. »Entschuldigung, Halbjüdin«, sagte er leise.
Brahmeyer grinste und präsentierte eine Lücke zwischen den Schneidezähnen, die sein Gebiss seit der letzten Rauferei zierte.
Hannah spürte das Unausweichliche kommen. Das aufziehende Gewitter in ihrem Kopf schränkte ihr Denken ein, bis sie die Worte nicht mehr kontrollieren konnte, die über ihre Lippen wollten. Worte, die sich nicht mehr zurückhalten ließen.
Pilz klatschte mit gespielter Besorgnis in die Hände. »Nun, was denn? Was soll denn nur aus dir werden, Hannah?«
»Hannah will fliegen«, krähte die blonde Ilsa.
»Ja, fliegen. Hannah will fliegen«, riefen alle im Chor.
Pilz wandte sich zu ihr um, seine Glatze glühte tiefrot im Sonnenlicht, die fleckige Haut verlieh ihm tatsächlich Ähnlichkeit mit einem Fliegenpilz.
»Fliegen?« Er blickte sie verblüfft und mit unverhohlener Neugier an.
Koschka sprang auf. »Hannah sagt, ihr Vater ist ein Flieger.«
»Soso. Ja, was denn? Wo doch jeder weiß, dass die Juden lügen wie gedruckt. Sie hat keinen Vater, wisst ihr das denn nicht? Er ist davongelaufen, weil er sich schämt, dass er ein Kind mit einer Jüdin hat.«
Die Klasse lachte schallend.
Hannahs Lippen zitterten, ihre Kehle war so staubtrocken, dass sie nicht antworten konnte. Es hätte ohnehin keinen Sinn gemacht und ihre Qualen nur verlängert.
»Nicht wahr, Sarah-Hannah?«
Pilz wandte sich an die Klasse. »Und wie nennt man ein solches Kind? Na, was denn, was denn?«
»Einen Bastard, Herr Lehrer!«, rief Koschka.
Hannah blinzelte in den fahlgelben Ball, der vor den Fenstern am Himmel stand. Sie hatte das Gefühl, mit ihm zu schweben. Ein winziger Fleck in der Form eines heranfliegenden Flugzeugs verdunkelte ein Stück der Sonne. Der Propeller rotierte so schnell, dass er wie eine flirrende Scheibe auf sie zuraste.
»Wie lautet also die korrekte Lösung der Aufgabe? Wie viele arische Familien könnten eine Wohnung besitzen?«
Pilz’ Fistelstimme drang von weit her an Hannahs Ohr.
»Es kommt auf die Anzahl der Zellen in dem Irrenhaus an«, sagte sie. »Und wie viele Pilze darin Platz haben.«
Das Schreibheft entglitt ihren Fingern, dann war da plötzlich nur noch Dunkelheit.
*
Hannah erwachte auf dem Ohrensofa im Büro des Rektors. Sie öffnete die Augen und sah den hageren Mann mit dem schütteren Haar und den buschigen grauen Augenbrauen an seinem Schreibtisch sitzen. Er hielt den Telefonhörer in der Hand und steckte den Zeigefinger in die Wählscheibe.
»Was ist passiert?«, fragte sie.
Berthold sah auf. Als er bemerkte, dass sie wach war, legte er den Hörer auf die Gabel.
»Du bist uns umgekippt, mein Kind. Hast du heute Morgen nichts gegessen?«
Hannah versuchte, sich aufzurichten. Ihr war etwas schwindelig, aber die dunklen Flecken am Rand ihrer Wahrnehmung waren verschwunden.
»Doch, das habe ich. Es geht mir wieder gut.«
Berthold betrachtete sie sorgenvoll. Im Gegensatz zu Pilz mochte sie ihn. Er ging auf die siebzig zu und war bereits pensioniert. Weil viele Lehrkräfte von der Wehrmacht eingezogen worden waren, hatte er seinen Ruhestand unterbrochen. Berthold hatte ein sanftes Wesen und konnte komplizierte Zusammenhänge anschaulich erklären. Koschka und seine Kumpane aus der Hitlerjugend trieben ihren Spott mit ihm, den er geduldig ertrug. Berthold war als Kind an Polio erkrankt. Er hatte überlebt, behielt jedoch ein verkürztes Bein zurück, das ihn vor dem Militärdienst bewahrt hatte. Wenn er über die Schulflure hinkte, ahmten die Jungen ihn auf grausame Weise nach und nannten ihn einen Krüppel.
»Sie brauchen keinen Doktor zu rufen«, erklärte Hannah. »Ich glaube, es ist alles in Ordnung.«
»Passiert dir das öfter?«
Sie setzte sich auf. »Manchmal. Wie bin ich hierhergekommen?«
»Frau Busch hat dich gebracht.«
Sie war Bertholds Sekretärin.
»Muss ich zurück ins Klassenzimmer?«
Der Rektor schüttelte den Kopf. »Nein, heute nicht.«
Angestrengt versuchte sie, sich zu erinnern. Es war etwas geschehen, kurz bevor sie ohnmächtig geworden war. Sie hatte etwas zu Pilz gesagt, aber die Worte wollten ihr nicht wieder einfallen.
Der alte Rektor nahm ein Heft vom Schreibtisch und setzte sich neben Hannah auf das Sofa. Er begann, darin zu blättern. Es war das Schreibheft, das ihr im Klassenzimmer aus den Händen gerutscht war.
»Was du zu Herrn Pilz gesagt hast, war dumm«, sagte er. »Ich hätte dich für klüger gehalten.«
»Ich kann nichts dafür. Manchmal dreht sich alles, und ich sage Sachen, die ich gar nicht sagen will. Ich weiß, dass sie wahr sind, und kann nicht verhindern, dass sie rauswollen.«
Wenn sie Berthold begegnete, hatte er normalerweise einen Scherz auf den Lippen, wenigstens ein Lächeln. Heute war er ungewöhnlich ernst.
»Die Sache mit Pilz kann ich geradebiegen, aber das hier nicht«, sagte er kopfschüttelnd. »Was hast du dir nur dabei gedacht?«
Sie warf einen Blick auf die Zeichnung und wandte sich ab. In manchen Augenblicken verselbstständigte sich der Stift zwischen ihren Fingern und erschuf Karikaturen, die die Welt auf eine simple und entlarvende Weise zeigten: Lächerlich und grotesk verdreht. Malisha wusste um dieses Talent und hatte ihr eingeschärft, niemandem davon zu erzählen. Oft war ihr während des Kritzelns und Malens, als tauschten Verstand und Stift die Plätze. Was herauskam, war nicht aufzuhalten.
Die Zeichnung in ihrem Heft zeigte einen Ziegenbock, der mit weit aufgerissenem Maul eine Schafherde in seinen Bann zog – ein Ziegenbock mit einem Klumpfuß und dem vor Erregung verzerrten Gesicht von Reichsminister Goebbels.
Hannah wusste, dass sie das Bild gemalt hatte, konnte sich aber nicht mehr erinnern, wann das gewesen war. Sie hatte es einfach vergessen. Dass sie alltägliche Dinge vergaß und sich an andere, weit zurück liegende Begebenheiten mit einer unwirklichen Klarheit entsann, jagte ihr manchmal Angst ein.
»Mach so etwas nie wieder«, sagte Berthold ernst. »Wir leben in …«, er machte eine Pause und suchte nach den richtigen Worten, »… in gefährlichen Zeiten.«
»Was geschieht jetzt?«
»Herr Pilz will die Angelegenheit nicht auf sich beruhen lassen. Er wird sich an den zuständige Amtswalter wenden.«
»Was ist ein Amtswalter?«
»Ein Politischer Leiter, eine Art Wächter der Partei. Er passt auf, dass du auf angemessene Weise erzogen wirst und die richtige Gesinnung entwickelst.« Berthold nahm seine randlose Brille ab, zog ein Tuch aus der Hosentasche und putzte sie umständlich. »Wir wollen überlegen, wie wir das wieder hinkriegen können«, fuhr er fort. »Du wirst … mmh-mmh … sagen, dass du dich nicht wohlgefühlt hast heute Morgen. Und dass du zur Toilette musstest. Du bist zurückgekommen und hast die Zeichnung in deinem Heft entdeckt. Sie stammt nicht von dir. Du hast niemandem davon erzählt, weil du befürchtest, man könne sie dir zur Last legen.«
»Aber das stimmt nicht.«
Berthold setzte seine Brille auf. Die Gläser funkelten im Licht der Schreibtischlampe.
»Es ist wichtig, dass du dabei bleibst, was ich dir gesagt habe. Deine Mutter hat es schwer genug. Du willst doch nicht, dass sie Scherereien bekommt, oder?«
Hannah senkte den Kopf. »Nein.«
»Soll ich wirklich keinen Arzt rufen?«
»Nein. Es geht mir gut. Ich kann allein nach Hause gehen. Es ist nicht weit.«
Berthold nickte. Hannah war entlassen. Sie ging zur Tür, wo sie die sanfte Stimme des alten Mannes einholte.
»Wir haben ein Geheimnis miteinander.«
Sie sah ihn fragend an.
»Was wir hier besprochen haben, bleibt unter uns, hast du das verstanden?«
»Ja.«
»Denk daran, du bist ein braves Mädchen. Du würdest so etwas niemals zeichnen, nicht wahr?«
»Nein, das würde ich nicht.«
Hannah verließ das Büro des Rektors. Der Unterricht war heute, am letzten Schultag des alten Jahres, früher als gewöhnlich zu Ende gegangen. Die Türen der Klassenzimmer standen offen, Hannahs Schritte hallten hohl in den leeren Korridoren.
Ohne einer Menschenseele zu begegnen, durchquerte sie die Eingangshalle und trat ins Freie. Dickbäuchige, dunkelgraue Regenwolken hatten sich vor die Sonne geschoben, doch sogar das trübe Dezemberzwielicht schmerzte in ihren Augen. Sie blieb einen Moment stehen und kniff die Lider zusammen, um sich an das Tageslicht zu gewöhnen.
Ein kaltes Prickeln kroch ihren Rücken herauf und griff nach ihrer Kehle. In dem düsteren Torweg auf der anderen Straßenseite verbarg sich jemand. Sie kannte den Durchgang, durch den die Metzger im Morgengrauen die Schweine in den Schlachthof trieben. Sie wartete eine Minute oder zwei und glaubte beinahe, sich getäuscht zu haben. Die flirrenden Schatten, die an den Rändern ihres Bewusstseins lauerten, spielten ihr häufig Streiche. Jetzt nahm sie deutlich eine Bewegung wahr. Nein, sie hatte sich nicht geirrt! Rasch zog sie sich in den Schutz der Steinsäulen zurück, die den Eingang zum Schulgebäude flankierten. Nach wenigen Augenblicken tauchte das feiste Gesicht Koschkas auf. Er war nicht allein. Maria und die blonde Ilsa, das schlimmste Schandmaul der Schule, lauerten in den Schatten der Einfahrt. Es würde noch mehr Ärger geben.
2
Hannah drückte ihre Wange an die kalte Steinsäule und beobachtete die Straße. Koschka, Maria und Ilsa warteten auf sie, um eine Hetzjagd zu starten. Es würde mit kleinen Sticheleien beginnen und damit enden, dass sie Hannah in den Dreck schubsten und ihre Hefte und Bücher zerrissen. An einem anderen Tag wäre sie vielleicht mit Beleidigungen und Demütigungen davongekommen, die sie inzwischen schweigend ertrug. Aber sie ahnte, dass während ihrer Ohnmacht mehr passiert war. Pilz hatte die Gelegenheit sicherlich genutzt, um die anderen Kinder gegen sie aufzuhetzen, und seine Anstrengung würde bittere Früchte tragen.
Ihr blieb nur zu warten. Hannah fröstelte in der kalten Luft und betrachtete den Winterhimmel. Sie mochte es, in den dahinjagenden, vom Wind zerzausten Wolken nach Bildern und bekannten Formen zu suchen. Heute war die schiefergraue, tief hängende Wolkendecke so dicht und eintönig, dass Hannah vergeblich nach vertrauten Konturen Ausschau hielt. Stattdessen sollte sie besser die Straße beobachten. Die Fassaden der Häuser waren von einem stumpfen Sepiabraun, das nasse Pflaster glänzte matt wie flüssiges Blei. Umso bedrohlicher leuchtete das Rot der Hakenkreuzfahnen, die an Fahnenmasten und Laternen wehten. Für den kommenden Sonntag war einer der vielen Aufmärsche angekündigt. Sie würden einen Mordslärm machen und ein Funktionär der Partei würde eine Rede halten. Danach verprügelten sie jeden, der ihnen nicht zujubelte.
Hannah wärmte ihre Finger in den Manteltaschen. Ein eisiger Wind wehte von Norden her über das Kopfsteinpflaster. Nach einer halben Stunde schien Koschka die Geduld zu verlieren. Hannah beobachtete, dass er mit Maria und Ilsa im Schlepptau auf den Kiosk an der Straßenecke zulief, vermutlich um sich eine Zuckerstange zu kaufen. Eine zweite Chance würde sie nicht bekommen, unbehelligt nach Hause zu gelangen.
Sie wagte sich aus dem Schutz des Portikus und lief los. Nur wenige Menschen waren unterwegs, die meisten Leute beschäftigten sich bereits mit den Vorbereitungen zum bevorstehenden Weihnachtsfest. Malisha feierte mit ihr das jüdische Lichterfest, das am 17. Dezember begann und am 24. endete. Weder Hannah noch ihre Mutter waren gläubig, Religion spielte in ihrem Leben kaum eine Rolle. Dennoch hatten sie früher die Synagoge besucht, weil sie die feierliche Atmosphäre mochten. Und nun brachte sie schlechte Nachrichten mit nach Hause, die die Festtagsstimmung drücken würden.
Hannah blieb stehen, um Atem zu schöpfen, und betrachtete ihr geisterhaftes Spiegelbild in einer Schaufensterscheibe. Sie hatte das dichte schwarze Haar ihrer Mutter geerbt, ihre haselnussbraunen Augen und die schlanke, feingliedrige Gestalt. Sie begriff, dass sie noch keine Frau war, aber auch kein Kind mehr, und man würde sie nicht mehr als solches behandeln. Berthold hatte sich mehr als einmal vor seine Schülerin gestellt und sie versucht zu schützen, doch diesmal würde er nichts ausrichten können.
Etwas hatte sich verändert. Man sah es nicht und konnte es nicht greifen, dennoch spürte Hannah die Krankheit, die die Herzen der Menschen schleichend vergiftete.
Über eine Nebenstraße erreichte sie den Börneplatz. Von hier aus war es nicht mehr weit bis zu dem kleinen Schneiderladen ihrer Mutter. Auf der freien Fläche heulte der Wind um die Ruine der Synagoge, die vor einem Jahr ein Raub der Flammen geworden war. Seitdem hatte man die Mauern abgetragen, um das Baumaterial für andere Vorhaben zu verwenden. Wo das Gebäude nicht bis auf die Grundmauern verschwunden war, ragten vom Feuer geschwärzte Wände in die Höhe. Von der Hitze geborstene Steine hatte man zu riesigen Haufen aufgetürmt. Aus dem Lichterfest würde dieses Jahr nichts werden.
Hannah spürte plötzlich, dass sie nicht allein war. Der Platz war menschenleer, niemand war zu sehen, dennoch hörte sie das leise Getrappel von eiligen Schritten. Sie beeilte sich, die Synagoge hinter sich zu lassen, und lief an einem der Schutthaufen vorbei. Ein Ziegelstein löste sich aus dem Haufen, rutschte herab und zog eine kleine Gerölllawine nach sich.
»Flieger! Grüß mir die Sonne! Grüß mir die Sterne …«
Koschka sprang hinter dem steinernen Berg hervor. Er grinste und sang laut und schief. Seinem Gegröle folgte eine Lachsalve. Die Mädchen bogen sich vor Lachen, Koschkas Kumpane, zwei Jungen in ihren HJ-Uniformen, waren auch da. Hannah versuchte, an Maria vorbei zu laufen, aber sie verstellte ihr den Weg.
»Schau an, die verrückte Hannah. Fliegen-Pilz hat getobt wie ein Irrer«, sagte Ilsa.
»Das weiß sie doch selber«, rief Koschka. »Dein Schauspielern nützt dir gar nichts.« Er verdrehte die Augen und ließ sich platt auf den Schuttberg fallen.
Maria lachte schrill. »Du brauchst nicht mehr zu kommen, hat Pilz gesagt. Dafür wird er schon sorgen.«
»Wird auch Zeit«, japste Koschka, der wieder aufgestanden war. »Juden in einer arischen Schule. Wo gibt’s denn so was?«
Ilsa knuffte sie an der Schulter. »Hannah stört das nicht. Aus ihr wird doch eine Fliegerin.«
»Ja«, rief Koschka. »Was denn, was denn?«, äffte er Pilz nach. Die Mädchen kicherten.
»Ihr Vater holt sie mit seinem Flugzeug ab!«
Die Jungen grölten.
»Ihr werdet dumm schauen, wenn er kommt«, sagte Hannah. »Er muss viel arbeiten, ist immer unterwegs. Aber er kommt.«
»Den gibt’s doch gar nicht«, widersprach Ilsa.
»Und wie bin ich wohl zur Welt gekommen?«
Aus dem Augenwinkel sah sie, dass Koschkas Freunde um den Schuttberg herum auf sie zukamen und sie einkreisten.
»Du bist nichts weiter als ein jüdischer Unfall«, warf Kretz ein. Er war schon sechzehn und kannte sich mit Dingen aus, von denen Hannah nur eine vage Vorstellung hatte. Koschka folgte ihm wie ein fettes Hündchen. »Er hat dafür bezahlt, dass deine Mutter ihn mal rangelassen hat«, fuhr Kretz fort.
»Das ist nicht wahr!« Hannah schossen Tränen die Augen.
»Stimmt wohl«, beharrte Koschka. »Mein Vater sagt, die Malisha Bloch arbeitet in der Pagode beim Bahnhof. Man weiß ja, was da nachts los ist.«
Die gefürchtete Schwärze raste heran, Hannahs Blickfeld verengte sich. Dass es so kurz hintereinander geschah, jagte ihr Angst ein. Vielleicht war sie wirklich verrückt, wie die Mädchen behaupteten. Alles begann, sich um sie zu drehen.
Maria trat dicht an Hannah heran.
»Du hast den Reichsminister Goebbels beleidigt. Dafür wird dich der schwarze Mann holen.«
»An den glaubst du?« Hannah lachte, es klang eher wie ein Aufschluchzen. »Den gibt’s doch gar nicht.«
»Ach nein?«, erwiderte Ilsa. »Und ob’s den gibt. Er trägt eine schwarze Uniform. Er fährt durch das Land und sucht die Kinder aus, die eine Meise haben.« Sie tippte sich an die Stirn. »An deiner Stelle hätte ich ganz schön die Hosen voll.«
»Du spinnst ja.« Hannah drängte sich an dem blonden Mädchen vorbei, aber die beiden Jungen in ihren Uniformen traten ihr in den Weg. Sie schwankte und suchte Halt. Ihre Hand griff ins Leere.
»Gleich kippt sie um.« Koschka torkelte gespielt, stolperte und fiel auf den Hosenboden.
»Zeig mal, was du kannst.«
Kretz warf einen abschätzenden Blick auf die Mauer. Sie war brüchig und etwa drei Meter hoch. Die anderen Jungen grinsten.
»Ja, flieg uns was vor, verrückte Hannah!«, riefen sie im Chor.
»Lasst mich in Ruhe.«
Hannah drehte sich um und versuchte, den Jungen zu entkommen, die sie zur Ruine drängten. Ihr blieb keine Wahl, sie musste auf die frei liegenden Fundamente steigen. Vor ihr ragte die ehemalige Außenwand der Synagoge wie die Treppe eines Riesen in die Höhe.
Koschka zog eine Holzlatte aus dem Schutt und stocherte nach Hannahs Beinen. Sie floh auf die nächste unregelmäßige Stufe. Bald konnte er sie mit der Latte nicht mehr erreichen und begann, mit Steinen nach Hannah zu werfen. Sofort beteiligten sich die anderen.
Die meisten flogen an ihr vorbei, einer traf sie am Knie, ein zweiter an der Schläfe. Es tat weh, doch die Scham und die Angst waren schlimmer. Verzweifelt suchte sie Schutz und kletterte weiter die Mauer hinauf. Von hier oben war immer noch niemand auf dem Börneplatz zu sehen, niemand scherte sich um Jungen in HJ-Uniformen, die eine Jüdin mit Steinen bewarfen. Das scharfkantige Bruchstück eines Ziegelsteins traf sie an der Wade und hinterließ einen Riss, Blut quoll aus ihm hervor. Sie biss die Zähne zusammen und verbarg ihren Schmerz.
Je höher Hannah stieg, desto mehr verstärkte sich die Finsternis an ihren Augenrändern und verengte ihr Blickfeld. Zweimal strauchelte sie und wäre fast gestürzt. Eine Handvoll Kieselsteine prasselte gegen die Mauer und traf sie an Schulter und Kopf.
»Flieg, verrückte Hannah!«, kreischte Koschka.
Auf der innen liegenden Mauerseite ragte ein Sandhügel empor. Er konnte ihre Rettung bedeuten, doch sie traute sich nicht zu springen. Von hier oben sahen Maria und Ilsa winzig aus, nicht größer als Spielzeugfiguren. Koschka starrte sie mit weit aufgerissenen Augen an, das vor Anstrengung feuerrote Gesicht zu einer Grimasse der Wut verzerrt. Hannah hatte ihre Mutter oft gefragt, warum so viele Leute die Juden hassten, obwohl sie bis vor wenigen Jahren einträchtig Tür an Tür mit ihnen gelebt hatten. Sie hatte geantwortet, dass die Nazis das Böse in den Menschen an die Oberfläche zerrten, bis es die Kontrolle übernahm.
Hannah blickte auf die schreienden Jungen hinab, selbst Ilsa und Maria sammelten eifrig Steine und machten bei dem grausamen Spiel mit. Malisha hatte recht.
Ein flacher Stein traf sie hinter dem Ohr. Der Schmerz zwang sie in die Knie. Das Geschrei dröhnte in ihren Ohren und vermischte sich mit der Erinnerung an Pilz’ Gebrüll.
Hannah verdrehte die Augen und fiel. Sie spürte den Wind, der ihr Haar durcheinanderwirbelte und hoffte, dass der Sandhügel ihren Sturz auffing. Dann kehrte die fugenlose Dunkelheit zurück.
3
Hannah kam zu sich, die Welt nahm Konturen, Farben und Geräusche an. Es war wieder geschehen, so schnell hintereinander wie noch nie.
Malisha saß neben ihr auf der Bettkante und strich ihr über das Haar. Wie schön sie war. Ob sie eines Tages genauso schön sein würde? Und ob es wirklich stimmte, was die Leute über ihre Ähnlichkeit sagten?
»Wo bin ich?«, fragte sie.
»Zu Hause. Alles wird gut.«
Malisha tauchte einen Waschlappen in eine Schüssel, wrang ihn aus und legte ihn auf Hannahs Stirn. Er linderte den Schmerz, der in ihren Schläfen pochte.
»Wie bin ich hierhergekommen?«
»Joschi hat dich gefunden«, antwortete Malisha.
Hannah reckte den Kopf und ließ ihn gleich wieder zurück auf ihr Kissen sinken, denn die Bewegung löste heftigen Schwindel aus. Joschi stand neben der Tür zur Diele. Er trat von einem seiner großen Füße auf den anderen und knetete die blaue Schiebermütze, die er bei jedem Wetter trug. Er schaute noch besorgter drein als Malisha.
»Joschi war auf dem Weg zur Pagode und fand dich vor der Synagoge. Was ist denn nur passiert?«
»Ich weiß es nicht mehr.«
Ein Schleier lag über ihrer Erinnerung, nur langsam tauchten Gesichter und Namen auf … Pilz, Bertholds Büro, Koschka und die frechen Mädchen.
»Hast du Schmerzen?«
»Im Kopf. Alles dreht sich.«
Joschi schob die Mütze über sein spärliches Haar und gestikulierte wild. Mühsam folgte Hannah der Gebärdensprache. Er sprach nicht mehr, seit er vor einem Jahr von der Gestapo verhaftet worden war. Sechs Wochen nach seiner Festnahme hatte Malisha ihn halb tot aus dem Main gezogen, seitdem wich er nicht mehr von ihrer Seite. Niemand wusste, warum er verhaftet worden war und was er hatte erleiden müssen. Joschi gehörte auf eine selbstverständliche Weise zu ihnen. Zusammen waren sie die Familie, die Hannah sich wünschte. Genauso wie er Malisha beschützte, würde er auch für Hannah alles tun.
Joschi verdingte sich als Rausschmeißer in der Pagode, einem Nachtklub im Bahnhofsviertel. Die Arbeit fiel ihm leicht, denn die meisten Menschen fürchteten sich vor ihm. Man konnte nicht übersehen, dass er hässlich war. Von den Misshandlungen der Gefängniswärter hatte er Narben davongetragen, die ihn entstellten. Sein dünnes Haar war weiß, obwohl er die dreißig kaum überschritten hatte. Nur selten musste er seine Fäuste einsetzen, wenn es in der Pagode Ärger gab. In der Regel reichte es, wenn die Leute im schummrigen Licht sein vernarbtes Gesicht erblickten. Einmal hatte Hannah seinen nackten Oberkörper gesehen. Brust und Rücken waren mit Striemen übersät, die sich weiß von der dunklen Haut absetzten. Narben, die nur furchtbare Prügel hinterließen. Hannah fühlte sich sicher, wenn Joschi in der Nähe war. Über das Furcht einflößende Zähnefletschen, mit dem er Randalierer im Nachtklub abschreckte, musste sie jedes Mal lachen. Und er lachte mit. Sie hatte niemals erlebt, dass er jemandem ernstlich wehtat.
Mühsam entzifferte sie seine Taubstummengesten. Doktor, deutete er an.
»Joschi hat recht«, sagte Malisha.
»Es ist doch gar nichts geschehen. Es geht mir gut«, log Hannah.
»Du bist heute zweimal ohnmächtig geworden.«
»Aber …«
»Ich weiß, was in der Schule passiert ist. Direktor Berthold hat mich im Laden angerufen.«
Hannah richtete sich mühsam auf. Ihr war übel, das Zimmer drehte sich um sie. Als sie sich auf der Sofalehne abstützte, zuckte sie zurück und bemerkte Schürfwunden an ihren Handballen. Sie mussten von dem Sturz stammen.
Malisha tauchte den Lappen in die Schüssel. »Wer waren die anderen Kinder?«
»Welche Kinder?«
»Die, die mit Steinen nach dir geworfen haben. Joschi hat sie verjagt. Du hattest Glück, dass er ausnahmsweise den Weg über den Börneplatz genommen hat.«
»Sie sind mir nachgelaufen, weil … weil ich …«
»Weil du vor der Klasse ohnmächtig geworden bist«, beendete Malisha den Satz. »Sie haben dich verspottet.«
Sie gab Joschi einen Wink. Er hob Hannah hoch, als wöge sie nicht mehr als eine Feder. Dabei zeigte er sein fürchterliches Zahnlückenlächeln. Sie barg den Kopf an seiner breiten Brust. Die schrecklichen Ereignisse der vergangenen Stunden verblassten für einen Moment.
»Wir gehen zu Dr. Blumberg«, sagte Malisha.
Joschi schüttelte den Kopf.
»Ich weiß, er darf nicht mehr praktizieren, aber niemand kann mir verbieten, ihn zum Tee zu besuchen, nicht wahr?«
Er zuckte mit den Schultern und nickte. Geschickt wickelte er Hannah in eine Wolldecke, ohne sie abzusetzen, und trug sie die Treppe hinunter.
Eine Viertelstunde später klopfte Malisha an eine mit weißer Farbe beschmutzte Hinterhoftür. Die ungelenke Schmiererei zeigte die Karikatur eines Mannes mit übertrieben großer Nase – einen Juden mit hässlicher Fratze. Überall im Viertel gab es inzwischen solche Zeichnungen. Es war sinnlos, sie abzuwaschen, denn am nächsten Morgen waren sie wieder da. Hannah fand sie schlecht. Sie brachten niemanden zum Lachen. Sie wusste, dass sie treffsicherer zeichnen konnte – einen Ziegenbock mit Goebbels’ Gesicht zum Beispiel.
Dr. Blumberg war ein kahlköpfiger Mann um die sechzig mit Hängebacken und feuchten Augen. Er lächelte, als er Hannah sah. Er lächelte immer, egal wie schlecht es stand; sie hatte ihn niemals ernst erlebt. Als sie klein gewesen war, hatte er ihr mit seinen Späßen die unangenehmsten Untersuchungen erleichtert. Sie vertraute ihm, trotzdem hatte sie Angst. Etwas war in ihrem Kopf und es gehörte nicht dorthin.
Der Doktor bat sie in seine Wohnung, die nur aus einem Wohn- und Schlafraum mit niedriger Decke und einer winzigen Küche bestand. Die Toilette befand sich im Treppenhaus auf halber Höhe zwischen dem ersten und zweiten Stock.
Joschi legte Hannah behutsam auf einem zerschlissenen Sofa ab. Blumberg klappte den Deckel einer Holztruhe auf und nahm ein Stethoskop heraus. Hannah bemerkte die hochgezogene Augenbraue ihrer Mutter und den fragenden Blick.
Der Doktor seufzte. »Sie haben mir meine Arzttasche abgenommen. Ich konnte nicht viel retten. Nun muss es eben so gehen.« Er wandte sich an Hannah. »Na, wo fehlt’s denn, Kleines?«
»Ich werde im März fünfzehn«, empörte sie sich.
»Wie die Zeit vergeht. Mir ist es, als wär’s gestern gewesen, dass ich dir auf die Welt geholfen habe.«
»Sie ist ohnmächtig geworden und kann sich an nichts erinnern«, erklärte Malisha.
Blumberg legte eine Manschette um Hannahs Oberarm, pumpte sie auf und maß ihren Blutdruck. Dann horchte er Brust und Rücken ab, anschließend leuchtete er mit einer kleinen Lampe in ihre Augen.
»Und was geschah, bevor du ohnmächtig wurdest?«, fragte er.
»Mir war schwindelig, alles hat sich gedreht. Es ist, als ob ich durch einen Tunnel blicke. Dann wird es dunkel. Ab und zu blitzt es.«
»Mmh. Das Licht erscheint dir grell, nicht wahr? Und jedes Geräusch schmerzt in den Ohren.«
Hannah nickte.
»Was stimmt denn nur mit ihr nicht?« Malisha klang besorgt.
»Wie ist das genau, wenn dir schwarz vor den Augen wird«, fragte Blumberg, »wie fühlt sich das an?«
»Als ob ein Gewitter in meinem Kopf tobt.«
»Nach ein paar Sekunden wird sie wach«, erklärte Malisha, »einmal hat es fast eine Minute gedauert. Ich bin fast gestorben vor Angst.«
»Träumst du wild?«, fragte der Doktor.
»Ja, manchmal. Wenn ich dann aufwache, bin ich nicht richtig wach. Es ist, als ob ich in Pudding oder Sirup feststecke.«
Blumberg schmunzelte. »Ein guter Vergleich. Und du fürchtest dich, weil alles, was du siehst und hörst, sich anfühlt, als wäre es hinter einer Glasscheibe. Du kannst niemanden erreichen, so sehr du es versuchst.«
»Ja.«
Malisha lief auf und ab, setzte sich auf einen Stuhl und sprang gleich wieder auf. »Als sie klein war, ging es manchmal nächtelang so. Heute passiert es nicht mehr so oft. Das ist doch ein gutes Zeichen, oder?«
»Kommen Sie bitte mit, Frau Bloch.«
Malisha folgte dem Doktor in die Küche. Hannah konnte sehen, dass er etwas auf einen Zettel schrieb. Sie spitzte die Ohren, um der Unterhaltung folgen zu können.
»Ich gebe Ihnen die Adresse eines Spezialisten«, sagte der Doktor.
»Sie glauben, es ist Epilepsie, nicht wahr?«
»Alles weist darauf hin – die Absencen, der Pavor Nocturnus. Oft verliert sich die Erkrankung im Lauf der Jahre. Gibt es in Ihrer Familie Fälle von Fallsucht?«
»Nein, nicht … in meiner«, antwortete Malisha.
»Ich verstehe.«
Malisha senkte die Stimme, bis sie flüsterte.
»Es besteht Meldepflicht für seelische Erkrankungen. Und es gibt Gerüchte, dass sie die Kinder in Anstalten stecken. Sie werden mir Hannah wegnehmen.«
»Vertrauen Sie Dr. Rademann. Er ist ein Freund und wird Hannah niemals melden. Sie müssen die Symptome abklären lassen. Es gibt neue Medikamente, die ihr helfen können.«
»Die kann ich nicht bezahlen.«
Blumberg drückte Malisha den Zettel in die Hand. »Haben Sie Zuversicht. Alles wird gut werden. Fragen Sie Rademann nach Phenytoin. Er wird es Ihnen besorgen.«
Malisha kehrte in das mit Möbeln vollgestopfte Wohnzimmer zurück. Hannah legte schnell den Kopf auf das Kissen und blickte zu Joschi hinüber. Er stand unbeweglich neben der Eingangstür. Er würde niemals zulassen, dass man sie in eine Anstalt brachte.
Marias Worte kamen ihr in den Sinn. »Der schwarze Mann wird dich holen!« Aber das war nur eine Lüge gewesen, um ihr Angst einzujagen. Joschi würde sie beschützen. Vorsichtig hob er Hannah hoch.
»Ich kann alleine gehen.«
Sie versuchte, sich zu befreien. Joschi grinste, schüttelte den Kopf und wiegte sie wie einen Säugling.
»Sagen Sie, Jakob schickt Sie, dann wird man Sie rasch vorlassen«, sagte Blumberg.
Joschi trug Hannah die Stufen hinab. Sie hatte Malisha noch nie so verängstigt gesehen.
4
Das Columbushaus am Potsdamer Platz war ein modern anmutendes, beinahe futuristisches Bürogebäude. Lubeck war von der hoch aufragenden, fast vollständig verglasten Fassade beeindruckt. Seine Heimatstadt Würzburg war kein Dorf, konnte sich mit Berlin jedoch nicht messen. Berlin, das bedeutete eine Fülle an Möglichkeiten, Abenteuer und eine strahlende Zukunft, ein Tor zur Welt, das sich für ihn öffnen sollte.
Er stieg aus dem Fond des Maybach und legte den Kopf in den Nacken. In den vergangenen Tagen hatte er so viele imposante Bauwerke und Monumente gesehen, dass ihm von der schieren Größe der Stadt schwindelig war. Hier also sollte sich sein weiterer Lebensweg entscheiden. Beim Anblick des mit Hakenkreuzfahnen beflaggten Platzes glaubte er beinahe an das Gerede seines Vaters. Vor Lubecks Abreise hatte er wieder von Vorsehung und der Führungsrolle der deutschen Rasse gefaselt. Nun glaubte er selbst zu spüren, dass etwas Großes bevorstand, an dem er teilhaben durfte. Ja, das er sogar mitbestimmen durfte.
»Nun kommen Sie schon, Lubeck. Oder wollen Sie hier Wurzeln schlagen? Ihr alter Herr hat mich gewarnt, dass Sie ein Träumer sind.« Werner Heyde lachte, schlug ihm auf die Schulter und schob ihn auf den Eingang des Columbushauses zu. »Na, wir werden Ihnen die Flausen schon austreiben«, fuhr er fort. »Hier beginnt der Ernst des Lebens, große Aufgaben erwarten Sie, der Führer braucht jeden Mann.«
Lubeck lächelte und murmelte etwas von Überwältigung angesichts des historischen Augenblicks – Phrasen voller Superlative, von denen er wusste, dass sie bei Leuten wie Heyde gut ankamen.
Er kannte den Mann kaum, der seine Zukunft entscheidend mitbestimmen sollte. Sein Vater hatte Heyde an die Universität nach Würzburg geholt, wo er an den wissenschaftlichen Veröffentlichungen Hermann Lubecks mitgearbeitet hatte. Heyde besaß einen messerscharfen Verstand und einen ebenso bezwingenden Charme, mit dem er den Alten um den Finger gewickelt hatte. Eben diese Zielstrebigkeit und Klarheit war es, die Heyde ihm voraushatte.
Schnell war Lubeck klar geworden, warum ihn sein Vater nach Berlin geschickt hatte. Heyde besaß beste Kontakte zur Kanzlei des Führers und kannte Gott und die Welt. Um Karriere zu machen, konnte es keinen besseren Mentor geben.
Trotzdem empfand Lubeck das vertraute Gefühl der Demütigung. Sein Vater traute ihm nicht zu, sich allein durchzusetzen und eine Laufbahn als Psychiater aufzubauen. Also hatte er Heyde beauftragt, ihn in die höchsten Berliner Kreise einzuführen. Im Gegenzug teilte er den Ruhm seiner zweifelhaften Veröffentlichungen auf dem Gebiet der Psychiatrie und Rassenkunde mit Heyde, was für sich genommen schon erstaunlich war. Der Alte war eitel, überheblich und beanspruchte alle Aufmerksamkeit für sich. Nichts machte ihm mehr Vergnügen, als im Rampenlicht zu stehen.
Seit drei Tagen hetzten sie von Termin zu Termin. Heyde schleppte ihn hinter sich her wie einen Kofferträger – eine Funktion, die er zuweilen tatsächlich erfüllen musste. Vom Anhalter Bahnhof war es im Eiltempo zur Tiergartenstraße Nummer 4 gegangen. Lubeck hatte erfahren, dass das geheime Projekt, an dem er mitarbeiten sollte, seinen Namen T4 eben jener Adresse verdankte. Von hier aus waren sie in die Reichskanzlei gestürmt, wo sich Heyde alle Türen von selbst öffneten. Man stellte ihnen einen eleganten Maybach nebst Fahrer zur Verfügung, und Lubeck fand kaum Zeit, Luft zu holen, da stoppten sie schon am Potsdamer Platz. Hier sollte er endlich erfahren, was die Zukunft für ihn bereithielt.
Für die Organisation von T4 hatte man im Columbushaus mehrere Büros und Besprechungsräume angemietet. Vor ihm öffnete sich eine Doppeltür, die in einen kleinen Saal führte. Lubeck zählte über zwanzig Männer, teils in den schwarzen Uniformen der SS, teils in Zivil. Sie standen in lockeren Gruppen zusammen, es roch nach Zigarrenrauch, Cognac und Kaffee. Er war 1932 selbst in die SA eingetreten und hatte es nach dem Röhm-Putsch bis zum SS-Untersturmführer gebracht. Der affige Pomp begeisterte ihn wenig, er sah seine Mitgliedschaft lediglich als Mittel zum Zweck. Was ihn dagegen faszinierte, war die Macht, die mit den Privilegien der SS einherging.
Ein Mann mit dunklem, streng gescheiteltem Haar und Hitlerbärtchen begrüßte sie. Heyde stellte ihn als Dr. Irmfried Eberl vor, Direktor der Anstalt in Brandenburg. Eberl machte sie mit den Anwesenden bekannt. Heyde schien die meisten zu kennen und organisierte Cognac. Während er den Branntwein hinunterstürzte, nippte Lubeck nur daran. Er vertrug keinen Alkohol und brauchte seine volle Konzentration.
Schüchtern schüttelte er Hände und versuchte, sich Namen und die dazu passenden Gesichter zu merken – hochrangige Parteimitglieder, die er nur vom Hörensagen kannte. Darunter der verkniffen dreinschauende Viktor Brack, Oberdienstleiter der Kanzlei des Führers Amt 2, und Philipp Bouhler, enger Vertrauter von Hitler und Leiter der geheimnisvollen Aktion T4.
Lubeck schüttelte die schlaffe Hand von Werner Blankenburg, Bracks Vertretung, und begrüßte ehrfürchtig Karl Brandt, den chirurgischen Begleitarzt des Führers. Die Namen der Psychiater und promovierten Ärzte vergaß er so schnell, wie sie genannt wurden – von Hegener, Conti, Linden, Ernst Baumhard und andere. Wozu mochte diese außergewöhnliche Versammlung von Akademikern dienen? Lubeck fühlte sich gehemmt. Er hatte keine Ahnung, was von ihm erwartet wurde. Angesichts der Prominenz war ihm klar, dass seine Laufbahn als Mediziner enden würde, bevor sie begonnen hatte, falls er hier versagen sollte.
Philipp Bouhler klopfte mit den Fingerknöcheln auf die Tischplatte. Als Chef der KdF eröffnete er die Zusammenkunft.
»Meine Herren, Obersturmführer Blankenburg wird Ihnen nun im Einzelnen erläutern, was von Ihnen erwartet wird. Im Anschluss darf ich Sie zu Tisch bitten, für das leibliche Wohl ist selbstverständlich gesorgt. Außerdem wartet da noch eine kleine Vorführung auf Sie, damit Sie sehen, wie die Aktion in der Praxis durchgeführt werden wird.«
»Na, mit deutscher Gründlichkeit, hoffe ich doch«, dröhnte jemand. Die Bemerkung rief allgemeines Gelächter hervor.
Lubeck lachte mit, um seine Anspannung zu lösen. Er schien der Einzige im Raum zu sein, der nicht locker war. Schwatzend und scherzend nahmen alle an den T-förmig aufgestellten Tischen Platz. Bouhler, Brandt und Brack saßen an der Kopfseite, Blankenburg in ihrer Mitte. Er sortierte Unterlagen und begann mit seinen Einführungen.
»Es sind verschiedenste Maßnahmen zur Aufartung des deutschen Volkes unternommen worden, die sich in der Summe aber als unzureichend erwiesen haben«, leitete er in nasalem Tonfall ein. »Aufbauend auf den großartigen Grundsatzwerken zur Rassenhygiene von Hermann Lubeck – und ich freue mich, dass sein Sohn Joachim in seine Fußstapfen tritt und heute anwesend ist – darf ich sagen, dass wir Methoden entwickelt haben, die es nun in der Praxis zu erproben gilt.«
Alle Augen richteten sich einen Moment lang auf Lubeck. Bei der Erwähnung seines Namens schoss ihm das Blut ins Gesicht, eine Schwäche, der er seit seiner Kindheit hilflos ausgeliefert war. Sein hellblondes Haar verstärkte den Kontrast zusätzlich. Die Blicke von Conti und von Hegener ruhten prüfend auf ihm.
Heyde, der neben Lubeck saß, lehnte sich zu ihm herüber. »Blankenburg liebt Schachtelsätze«, bemerkte er glucksend. »Und er macht es gerne spannend.«
»Das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses vom 1. Januar 1935 ist hier ein erster, wenn auch unvollständiger Schritt, und dennoch eine legitime, brauchbare und notwendige Grundlage, um Schaden vom deutschen Volk abzuwenden.« Blankenburg nahm seine Brille ab und blinzelte. »Nun, wovon reden wir hier? Wir müssen jede Art von vererblicher Geisteskrankheit sowie Alkoholismus und andere Suchtkrankheiten als Gefahr für die Reinheit der arischen Rasse ansehen. Wir befinden uns im Krieg, der Feind ist mitten unter uns. Der Vermischung des deutschen Volkskörpers mit minderwertigem Erbgut wird durch das oben genannte Gesetz begegnet, aber das reicht nicht aus. Unser Führer und Reichskanzler Adolf Hitler hat somit in weiser Voraussicht Reichsleiter Philipp Bouhler und Dr. Karl Brandt damit beauftragt, die Befugnisse namentlich zu bestimmender Ärzte dergestalt zu erweitern, dass nach menschlichem Ermessen unheilbar Kranken bei kritischster Beurteilung ihres Krankheitszustandes der Gnadentod gewährt werden kann. Dazu installieren wir ein System, um Volksschädlinge frühzeitig zu erkennen und auszusondern. Kommen wir nun zur praktischen Durchführung und Organisation.«
Lubeck versuchte, das Gehörte zu verarbeiten. Es hatte bereits Gerede gegeben. Er hatte Statistiken von Heilanstalten und psychiatrischen Einrichtungen studiert, die eine signifikante Zunahme an Todesfällen aufwiesen. Was er geahnt hatte, wurde in diesem Moment zur Gewissheit. Wen die Nazis als krank oder unbrauchbar einstuften, der sollte vom Erdboden getilgt werden.
»Endlich hat man sich in der KdF zu einem entschlossenen Handeln durchgerungen«, raunte Heyde ihm ins Ohr. »Das ist die Gelegenheit für Sie, Ihrer Karriere einen ordentlichen Schub zu verpassen.«
Lubeck nickte stumm. Ein Schweißtropfen rann kitzelnd an seinem Rückgrat herab.
»Eine vernünftige Sache ist das«, murmelte Heyde, »und längst überfällig dazu. Denken Sie nur, welche immensen Kosten so ein Schwachsinniger erzeugt – das Essen, die Unterbringung, Medikamente, die das Leiden nur verlängern.«
Blankenburg erklärte die Mechanismen hinter der Aktion T4. Lubecks Aufgabe würde es sein, Patienten zu begutachten und Meldebogen auszufüllen. Mit anderen Worten: Er war fortan Herr über Leben und Tod. Das Blut rauschte in seinen Ohren, Blankenburgs Worte drangen kaum bis zu ihm vor.
Bouhler ließ Muster der Meldebogen austeilen. Alles war bis ins Detail durchgeplant worden, und Lubeck würde ein wichtiges Rad im Getriebe dieser Todesmaschinerie sein.
»Haben Sie, meine Herren, als Gutachter ein Urteil über den Patienten gefällt, tragen Sie es hier in dem vorgedruckten schwarzen Kasten ein«, fuhr Blankenburg fort. »Ein Plus bedeutet, der Gnadentod wird gewährt – bitte mit Rotstift vermerken –, ein blaues Minus, und der Patient darf weiterleben. Wenn Sie unsicher sind, genügt ein Fragezeichen, und der Fall wird vorerst zurückgestellt. Sie haben jetzt Gelegenheit, Fragen zum Ablauf zu stellen.«
Lubeck wagte nicht, bei all der Prominenz nachzufragen, aus Angst, sich zu blamieren. Es würde sich ohnehin nach und nach alles von selbst erklären. Bouhler und Brandt hatten bereits alles bis ins Letzte durchorganisiert und die einzelnen Abteilungen mit ihren jeweiligen Leitern und Ansprechpartnern eingerichtet, es gab sogar schon Briefköpfe. Für einen Transport der Kranken zu ihren Bestimmungsorten hatte man eine eigene Transportfirma ins Leben gerufen, die Gemeinnützige Krankentransport-GmbH, kurz Gekrat.
»Sie werden verstehen, dass wir für die einzelnen Abteilungen Tarnnamen verwenden«, referierte Blankenburg, »in der KdF ist man sich nicht sicher, ob das deutsche Volk den Weitblick besitzt, die Aktion in vollem Umfang zu unterstützen.«
Das wird es nicht, dachte Lubeck, man muss sich das mal vorstellen: Hier wird tausendfacher Mord geplant. Reiß dich zusammen. Schau dir Heyde an, der ist eiskalt. Dennoch, wenn das eines Tages rauskommt, sind wir alle erledigt.
Der Gedanke an absolute Macht gewann schließlich die Oberhand in ihm. Niemand würde ihn mehr verspotten, wenn er errötete wie ein Schuljunge. Mit einem Federstrich bestimmte er, wer leben durfte und wer sterben sollte. Er dachte an die Ratten, die er als Kind in Fallen gefangen und bei lebendigem Leib angezündet hatte, um seine Wut und das Gefühl der endlosen Demütigungen des Alten loszuwerden.
Aber hier ging es nicht um Ratten oder ein paar überzählige Katzen, die man in einen Sack steckte und ertränkte, sondern um Menschenleben. Und gerade das machte den Reiz unwiderstehlich.
Er versuchte, in den Mienen der anderen Ärzte zu lesen. Was ging in ihnen vor? Waren sie so abgebrüht wie Heyde?
Ich weiß nicht, ob ich das kann, dachte er. Lähmende Zweifel plagten ihn. Blankenburg hatte von einem neuen Verfahren gesprochen, einer Methode, die weitaus effizienter war, als Patienten mit einer Überdosis Luminal oder Scopolamin zu töten. Er versuchte, sich vorzustellen, wie er die tödliche Nadel in die Vene eines zur Euthanasie bestimmten Kranken einführte. In ihm kämpfte die Angst zu versagen gegen eine sexuelle Erregung, die wie ein Stromschlag seine Nervenbahnen entlang raste. Sicher würden auch Frauen unter den Opfern sein.
In Gegenwart einer schönen Frau setzte sein Denken aus und er brachte nichts weiter als dümmliches Gestammel hervor. Anschließend brannte meist heiße Wut in seinem Bauch, und er verspürte eine irrsinnige Lust zu bestrafen und zu töten. Wenn er offizieller Gutachterarzt der Aktion T4 war, würden die Frauen ihn anflehen, sie am Leben zu lassen. Dafür wären sie zu allem bereit. Ob es nur um Schwachsinnige ging? Blankenburg hatte erwähnt, dass auch Alkoholiker und notorische Querulanten ins Visier gefasst wurden.
»Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass die Teilnahme an der Aktion T4 freiwillig ist«, sagte Blankenburg. »Sollten Sie also zu dem Entschluss kommen, dass Sie Ihre Pflicht als Nationalsozialist nicht erfüllen können, dann verlassen Sie jetzt den Saal. Selbstverständlich haben Sie über das soeben Gehörte Stillschweigen zu bewahren. Andernfalls müssen Sie mit erheblichen strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Die Aktion T4 ist geheime Reichssache. Wir haben uns verstanden.«
Blankenburg setzte sich. Niemand verließ den Saal. Detailfragen wurden diskutiert, anschließend wurde jedem der anwesenden Psychiater ein Gebiet zugeteilt. Lubeck würde nach Frankfurt gehen.
»Ich bat Blankenburg, Sie zu Landesrat Brunner zu schicken. Er ist Dezernent für das Anstaltswesen in Hessen-Nassau. Schöne Gegend übrigens. Der Fritz ist genau der Richtige, um Sie in die besten Kreise einzuführen«, erklärte Heyde lächelnd.
»Und nun«, er rieb sich mit der flachen Hand über den Bauch, »lassen Sie uns etwas essen gehen. Dieses Gerede macht hungrig.«
Stühlerücken setzte ein, Lubeck folgte den anderen in einen extra für die Gesellschaft hergerichteten Speisesaal. Es gab Gulaschsuppe, die in einem riesigen Kessel dampfte, dazu ofenfrisches Brot. Er musste sich zwingen, einen Bissen herunterzuwürgen. Was mochte es mit der Vorführung auf sich haben? Er kaute auf einem Stück Kruste und schluckte. Der klebrige Teig verstopfte seine Kehle, er hatte das Gefühl zu ersticken und spülte den Klumpen mit Mineralwasser hinunter.
Am Nebentisch unterhielten sich zwei Ärzte über die Vorzüge und Nachteile der verschiedenen Gifte und Narkosemittel, mit denen sie bereits Patienten getötet hatten. Sie sprachen so beiläufig darüber, als ob es darum ging, wie man ein Schwein am besten schlachtete.
Heyde berichtete von seiner Arbeit in Würzburg und lobte den Alten in höchsten Tönen. Lubeck hörte kaum zu, langsam geriet er in Panik. Mitgefangen, mitgehangen. Aber denk an die Frauen. Denk an die Macht in deinen Händen!
Er schaffte es schließlich, den Teller auszulöffeln. Heyde paffte eine Zigarre, Bouhler quatschte von der Überlegenheit der arischen Rasse.
Nach dem Essen fuhren sie mit einem gemieteten Omnibus der Reichspost nach Brandenburg an der Havel, wo die Vorführung, von der Blankenburg gesprochen hatte, stattfinden sollte. Das ehemalige Zuchthaus an der Neuendorfer Straße glich einem gewaltigen Ziegelstein, in den Hunderte Arbeiter Schlitze und Fenster gemeißelt hatten. Die Vorstellung, dass sich hier an diesem 4. Januar 1940 sein Schicksal erfüllen könnte, erzeugte in Lubeck eine Mischung aus Furcht und Erregung. Von der Vorsehung ausgewählt worden zu sein, erfüllte ihn mit Stolz, aber auch mit einer gehörigen Portion Unsicherheit. Ach, Unsinn … Es kam nur darauf an, sich rechtzeitig auf die richtige Seite zu stellen.
Lubeck konnte sich später nicht erinnern, wie er in das Kellergeschoss gelangt war. Es stank nach Desinfektionsmitteln, Schweiß und Angst. In die Zellentüren auf beiden Seiten des schmalen Ganges waren vergitterte Fenster eingelassen. Von Zeit zu Zeit hörte man Wimmern oder irres Gemurmel, ab und zu einen gedämpften Schrei, die meiste Zeit aber herrschte Stille.
Sie verließen den Kellertrakt wieder und betraten einen zentralen Lichthof, wo sie ein Glatzkopf mit Zweifingerschnauzer und Brille empfing. Er schlug die Hacken zusammen und stellte sich als SS-Obersturmführer Christian Wirth vor. Lubeck atmete dankbar die frische Luft ein, ihm war leicht übel.
Wirth führte sie in einen Trakt im gegenüberliegenden Gebäude und stoppte vor einer offenen Tür, hinter der er ein gekachelter Raum lag. Er erklärte, was nun folgen sollte. Seine Worte drangen bald nicht mehr bis an Lubecks Ohren, denn ein Wärter trieb ein Dutzend Menschen den Gang entlang und in den gekachelten Raum. Sie waren nackt und hielten schützend die Hände vor ihre intimsten Stellen. Lubeck starrte eine junge Frau von etwa zwanzig Jahren an, sie wirkte apathisch, in ihre innere Welt zurückgezogen. Doch schien sie zu wissen, was passieren würde.
Die Tür schloss sich. Wirth erklärte die Wirkung des Kohlenmonoxidgases, das nun in die Kammer geleitet wurde. Heyde und Blankenburg drängten sich vor ein Guckloch, das in den Stahl eingelassen war. Lubecks Magen verkrampfte sich. Er machte kehrt, rannte den Korridor entlang, durch den sie gekommen waren, und fand eine Tür mit der Aufschrift Klosett.
Explosionsartig übergab er sich in die stinkende Kloschüssel und würgte, bis sein Magen leer war. Er wollte raus, wollte alles, was er gesehen und gehört hatte, ungeschehen machen und aus seiner Erinnerung verbannen. Er ahnte, dass sich die Bilder der Tür, die sich schloss, für immer in sein Gedächtnis eingefressen hatten. Das Letzte, was er wahrgenommen hatte, waren die Augen der jungen Frau gewesen, teilnahmslos, ergeben und von der fiebrigen Schönheit einer Schwindsüchtigen. Sie hatte ihr Schicksal akzeptiert. Er war überzeugt, dass sie den Tod als Erlösung empfand. Nicht wegen einer unheilbaren Krankheit, die ihr Schmerzen bereitete, sondern weil das Leben in der Welt, die Brandt, Bouhler und er selbst gerade erschufen, für sie nicht schlimmer sein konnte als die Hölle.
Er stemmte sich hoch und drehte den Hahn über dem Waschbecken auf. Dann schöpfte er kaltes Wasser in die hohlen Hände und spülte sich den Mund aus. Die Teilnahme an der Aktion T4 war freiwillig, Blankenburg hatte es bestätigt. So sehr ihn die Vorstellung lockte, Macht über Leben und Tod zu erlangen, war er nicht hart genug dafür. Er würde sich der Schande aussetzen und um seine Entlassung bitten.
Lubeck wischte sich die Lippen mit dem Handrücken ab und verließ den Waschraum. Im Korridor begegnete ihm Heyde, den nach dem vielen Cognac offenbar ein Bedürfnis quälte.
»Wo stecken Sie denn? Sie haben das Beste verpasst. Großartig, das Gas wird die Effizienz der Aktion enorm steigern.« Er runzelte die Stirn. »Geht’s Ihnen nicht gut? Was Falsches gegessen?«
»Es war wohl der Cognac«, antwortete Lubeck. »Ich vertrage keinen Alkohol, trinke sonst nie welchen.« Wie sollte er Heyde beibringen, dass er zu weich war? Was seinem Vater sagen, wenn er nach Würzburg zurückkehrte?
»Sie machen mir doch wohl nicht schlapp?« Heyde legte ihm die Hand auf die Schulter. »Sie müssen härter werden, Mann. Das deutsche Volk braucht Sie!« Er deutete den Gang entlang. »Das sind doch gar keine richtigen Menschen – Schwachsinnige, Epileptiker, Juden und Unruhestifter, die sich nicht anpassen wollen. Sehen Sie es so: Wir tun ihnen einen Gefallen und beenden ihre Leiden auf humane Weise. Sie hätten es erleben müssen, dann würden Sie verstehen, was wir hier leisten.«
Lubeck nickte, unfähig, etwas zu entgegnen.
Heyde trat dicht an ihn heran. »Ich kann Sie zu nichts zwingen«, sagte er leise, »aber wenn Sie jetzt nicht die Arschbacken zusammenkneifen, kann nicht mal ich Sie vor dem Fronteinsatz retten. Oder wollen Sie, dass die Wehrmacht Sie einkassiert? Polen ist erst der Anfang, da kommt noch mehr auf uns zu, glauben Sie mir. Die meisten Ärzte Ihres Jahrgangs schuften schon in den Feldlazaretten. Ich konnte gerade noch verhindern, dass Ihr Einberufungsbescheid rausging – von wegen unabkömmlich aufgrund von T4 und so weiter, Sie verstehen?«
»Es war wirklich nur der Cognac«, versicherte Lubeck.
»Dann lassen Sie in Zukunft die Finger von dem Zeug. Ich dachte schon, ich müsste mir Sorgen machen. Wüsste nicht, wie ich das Ihrem Vater beibringen sollte. Morgen früh ist Abmarsch Richtung Frankfurt. Melden Sie sich bei Landesrat Fritz Brunner. Sie werden dort Meldebogen erstellen, bis Sie zusammenbrechen, haben Sie das verstanden?«
»Jawohl, Hauptsturmführer Heyde.«
»Gut, gut. Und machen Sie mir keine Schande, Lubeck.«
5
Hannah riss ein Blatt vom Kalender ab. Heute war der 12. Januar, ein Freitag. Die Zahl verschwamm vor ihren Augen, in ihrem Kopf kündigte sich ein neues Gewitter an.
Die Weihnachtstage waren vergangen, Schnee fiel und taute wieder, das Wetter schlug Kapriolen. Nachdem sie am 31. Dezember vom Fenster ihrer Wohnung aus das Neujahrsfeuerwerk bestaunt hatten, leisteten sich Hannah und ihre Mutter eine Flasche Sekt und stießen auf das neue Jahr an. Malisha legte Platten auf ein Grammofon, das Joschi besorgt hatte. Sie tanzten zu Jazz und Bebop, der offiziell als entartet galt, aber in den Nachtklubs gespielt wurde, und freuten sich, dass sie lebten. Die Ohnmachtsanfälle hatten sich nicht wiederholt, Hannah schöpfte Hoffnung und überredete Malisha, den Arztbesuch aufzuschieben. Doch nun konnte sie nicht länger verheimlichen, dass es ihr schlechter ging.
Am späten Freitagnachmittag begleitete Joschi die beiden zu Dr. Rademann. Das Universitätsklinikum lag auf der südlichen Mainseite, etwa vier Kilometer von ihrer Wohnung entfernt, die in dem Mietshaus über Malishas Schneiderladen lag. Joschi ließ es sich nicht nehmen, Hannah zu tragen. Ihren Widerstand erstickte er mit einem unwilligen Knurren. Eingehüllt in eine warme Decke, machte das Schaukeln sie schläfrig. Joschi schien die Kälte nichts anhaben zu können. Malisha schützte Hals und Gesicht mit einem dicken Wollschal.
Hannah bemerkte kaum, wie die Zeit verging. Die Dämmerung des kurzen Wintertags brach bereits heran, als Joschi sie durch den Haupteingang der Klinik trug und auf die Füße stellte.
»Mir geht es gut«, sagte sie trotzig. »Ich bin nicht krank.«
»Komm jetzt!«
Ihre Mutter war selten streng, wenn sie allerdings eine Entscheidung durchsetzen wollte, nahm ihre Stimme einen Tonfall an, der keinen Widerspruch duldete. Dann reichte ein einziges Wort, um Hannahs Trotz zu brechen.
Sie liefen durch Korridore, in denen es nach Bohnerwachs und Desinfektionsmitteln roch. Zweimal verirrten sie sich, bis sie die Praxis von Dr. Rademann im dritten Stock fanden.
Hannah setzte sich auf einen Stuhl und wartete, während Malisha mit einer Krankenschwester sprach. Die grauhaarige Frau mit dem verkniffenen Gesicht trug eine weiße Schürze und ein steifes Häubchen.
Joschi blieb draußen auf dem Gang. Hannah beugte sich vor und sah durch den Türspalt, dass er auf und ab lief und seine Mütze knetete. Das tat er immer, wenn er angespannt war. Da er nicht sprechen konnte, achtete sie stets auf seine Körpersprache, seine Haltung und seine Gesten, um zu verstehen, was in ihm vorging. Joschi hatte Angst. War er besorgt, weil sie krank war? Oder fürchtete er sich so wie sie vor Ärzten und den spitzen Instrumenten, mit denen sie einem zu Leibe rückten? Oder argwöhnte er, dass man sie in eine Anstalt stecken würde? Hannah hatte keine klare Vorstellung davon, was sie dort mit den Kranken machten; auf jeden Fall musste es noch schlimmer sein als in einem Krankenhaus.
Sie schloss die Augen und lauschte. Bis auf die leise Unterhaltung zwischen der Schwester und Malisha war es still. Ab und zu quietschten Schuhsohlen auf dem Linoleum, eine Tür wurde geöffnet und wieder geschlossen, Schritte entfernten sich.