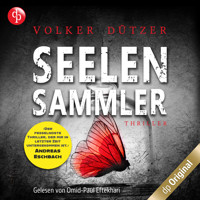Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Hannah Bloch
- Sprache: Deutsch
1964: Die Jagd nach Nazi-Verbrechern ist für Hannah Bloch endgültig vorbei. Sie folgt ihrem Ehemann Scott in dessen Heimatstadt Boston. Doch auch in den USA findet Hannah kein Glück. Ein Schicksalsschlag zwingt sie, nach Deutschland zurückzukehren. In Frankfurt am Main kreuzen ihre Wege die der sechzehnjährigen Marie, die gegen die Doppelmoral der Kriegsgeneration aufbegehrt und in ihrer Familiengeschichte ein dunkles Geheimnis entdeckt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 650
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Volker Dützer
Die Unerhörten
Roman
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2023 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung der Fotos von: © https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MousonHausFrankfurtHauptwache.jpg; Harald-Reportagen, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons
ISBN 978-3-8392-7660-0
Widmung
Für Grete. Du fehlst. Immer und überall, an jedem Tag, für den Rest meines Lebens.
Zitat
»Wir haben gelernt, wie Vögel zu fliegen, wie Fische zu schwimmen, aber wir haben nicht die einfache Kunst gelernt, als Brüder zu leben.«
Martin Luther King
Vorbemerkung des Autors
Lieber Leser,
bevor Sie in den dritten und letzten Teil von Hannah Blochs Lebensgeschichte eintauchen, erlauben Sie mir einige erklärende Worte. Ich habe in diesem Roman rassistische Begriffe und Bezeichnungen verwendet, die aus gutem Grund in unserer heutigen Zeit Empörung hervorrufen. Die Handlung der »Unerhörten« spielt jedoch hauptsächlich in den Jahren 1964/65. Rassismus und seine Auswirkungen auf die Opfer sind Themen dieses Romans, daher treten im Lauf der Handlung teils historische, teils fiktive Personen auf, die als Rassisten erkennbar sind. Ich habe darauf geachtet, rassistische und entwürdigende Äußerungen ausschließlich als wörtliche Rede der betreffenden Figuren zu benutzen, um die zeitgeschichtlichen Hintergründe korrekt und bildhaft darstellen zu können. Ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen, dass diese Stellen keinesfalls meine Haltung als Autor oder die Meinung des Gmeiner-Verlags darstellen.
Charaktere
Historische Personen sind mit einem * gekennzeichnet.
Hannah Bloch: Pilotin
Scott Young: Hannahs Ehemann
Elmar Bär: Rechtsanwalt
Ruth Obermayer: Hannahs beste Freundin
Harald Lenz: Maries Vater
Lothar Hoffmann: Richter am OLG Frankfurt
Vincent Menck: Pater, Heimleiter
Benjamin Morrison: schwarzer Junge
Gracie Robertson: Schulfreundin von Ben
Jim Clark*: Bezirkssheriff von Selma
Joe Strumner: weißer Junge
Bill Hancock: weißer Junge
Ed Walker: weißer Junge
Samuel Robertson: Diakon der Methodistenkirche in Selma
Josh Campbell: Buchhändler
Tyrell Morrison: Bens Vater
Solomon Barrett: Colonel, Scotts Vorgesetzter in Selma
Bruce Parker: weißer Attentäter
Amelia Boynton Robinson*: US-Bürgerrechtlerin
Marie Lenz: Tochter von Harald Lenz
Luise Lenz, geb. von Eick: Maries Stiefmutter
Karl von Eick: Luises Vater
Friederike Bartsch: Maries beste Freundin
Elke Bartsch: Friederikes Mutter
Albert Fenzke: ehemaliger Polizist
Käthe Greiner: Jugendamtsmitarbeiterin
Manni: Maries Bekanntschaft, Betrüger
Harold Des Moines: Rechtsanwalt
Martin Luther King*: Bürgerrechtler und Prediger
Billy und Emma White: Scotts Verwandte
Claudius Brendel: Pfarrer von Schierbach
George Wallace*: Gouverneur von Alabama
Albert J. Lingo*: Colonel der Alabama Highway Patrol, Mitglied des Ku-Klux-Klans
John Lewis*: amerikanischer Bürgerrechtler
John Martinez: Mitglied der Southern Christian Leadership Conference (SCLC)
Glenn Young: Scotts Vater
Major Foley: Scotts Vorgesetzter in Boston
David Woychik: Kriminalkommissar
Walter Breminger: Davids Vorgesetzter
Friedrich Gercke: Lehrer, ehem. SS-Oberscharführer
Bernhard Krämer: Davids Kollege
Alfred Weber: korrupter Standesbeamter
Robert Hornickel, gen. Bommi: Kneipenwirt
Joschi: alter Freund von Hannah
Hans Rosen: Mathematiklehrer
Captain John Miller: Scotts früherer Vorgesetzter, im Ruhestand
Rolf Hahnemann: Klassenlehrer
Klaus Ebert: Mitschüler Bens
Jürgen Hoppe (gen. Bulle): Mitschüler Bens
Holger Karow: Fürsorgezögling
Rainer Harmsen: Dorfpolizist
Hajo Jensen: Dorfpolizist
Klaas Hinrichsen: Bestatter
Teil 1 Das neue Land
Oh freedom over me
And before I’d be a slave
I’ll be buried in my grave
And go home to my Lord and be free
Spiritual
Prolog
Frankfurt am Main, 1949
Der 13. April war für die meisten Frankfurter ein Tag wie jeder andere. Für Hannah Bloch sollte er eine Entscheidung bringen, der sie seit einem Jahr entgegenfieberte.
Hannah schlug den Kragen ihres Mantels hoch, um sich vor dem für diese Jahreszeit ungewöhnlich kalten Wind zu schützen. Sie legte den Kopf in den Nacken und blickte an der Sandsteinfassade des Oberlandesgerichts empor. Ein Fenster im Obergeschoss weckte beklemmende Erinnerungen. In diesem Büro war sie Staatsanwalt Harald Lenz zum ersten Mal begegnet, dem Mann, der so viel Leid über sie gebracht hatte.
Sie dachte an den Schock, den sein Anblick damals bei ihr ausgelöst hatte. Harry war ein Ebenbild ihrer großen Liebe Hans gewesen, den die Nazis ermordet hatten. Wie naiv und unerfahren sie doch gewesen war. Harry hatte es geschickt verstanden, ihr mit seinem unwiderstehlichen Charme den Kopf zu verdrehen. Max Pohl – ihr früherer Geschäftspartner und väterlicher Freund – hatte sie gewarnt, aber sie hatte nicht auf ihn hören wollen und war bald regelmäßig mit Harry ausgegangen. Das Unheil hatte seinen Lauf genommen, ohne dass Hannah ahnte, einem krankhaft eifersüchtigen Egomanen eine Tür in ihr Leben geöffnet zu haben.
Zehn Monate später hatte sie ein Mädchen zur Welt gebracht; ein Kind, das sie niemals im Arm gehalten hatte. Harry hatte dafür gesorgt, dass ihr Malisha fortgenommen wurde – ihr, der verrückten Hannah, die unter epileptischen Anfällen litt, die unerwartet kamen und gingen. Der verantwortungslosen Hannah, die sich weigerte, ein braves Mädchen zu sein und zu tun, was man von ihr erwartete: Harry zu heiraten. Gerade noch rechtzeitig war sie dem goldenen Käfig entkommen, in den er sie hatte sperren wollen.
Für ihre Standhaftigkeit hatte sie einen hohen Preis bezahlt, doch der Tag war nun nicht mehr fern, an dem sie die kleine Malisha würde heimholen können. Hannah hatte viele aussichtslose Kämpfe ausgetragen und Siege errungen, die sich wie Niederlagen angefühlt hatten. Sie hatte Freunde verloren und mehr als einmal vor dem Nichts gestanden. Aufgegeben hatte sie nie. Auch diesmal würde sie erfolgreich sein, sie musste einfach. Die Vorstellung, dass es ihr nicht gelingen könnte, ihr Kind endlich in die Arme zu schließen, verbannte sie aus ihren Gedanken.
»Du siehst gut aus«, sagte Scott, »wie jemand, der bekommt, was er will.«
Hannah prüfte kritisch ihr schemenhaftes Spiegelbild in der Fensterscheibe des Eingangsportals. Sie versuchte sich zu entspannen und musste bei dem Gedanken daran, dass sie nun nicht mehr Bloch, sondern Young hieß, unwillkürlich lächeln. Scott war da, wenn sie ihn brauchte, auf ihn konnte sie sich verlassen. Ihr frischgebackener Ehemann hatte darauf bestanden, dass sie sich konservativ kleidete. In dem hellgrauen Kostüm mit dem knielangen Rock, den dezenten Nylons und den schwarzen Schuhen fühlte sie sich um Jahre älter, als sie war. Der schräg sitzende, dunkle Hut machte die Verwandlung komplett. Missbilligend verzog sie den Mund.
»Sei unbesorgt, kein noch so verknöcherter Richter kann an deinem Erscheinungsbild etwas aussetzen«, fügte Scott hinzu.
Hannah rieb ihre kalten Hände aneinander. »Ich sehe aus wie meine eigene Großmutter.«
Scott lachte. Er trug eine olivgrüne Eisenhower-Jacke über einem Flanellhemd und dazu eine beigefarbene Hose mit messerscharfen Bügelfalten.
»Ich bin sicher, sie war eine wunderschöne Frau«, sagte er.
»Pffh.«
»Wir müssen dem Richter beweisen, dass du deine Vergangenheit hinter dir gelassen hast«, erklärte er. »Die wilden Zeiten sind vorbei, Hannah Bloch ist erwachsen geworden, pflichtbewusst und gesetzestreu. Jemand, dem man jederzeit ein Kind anvertrauen würde.«
»Und du glaubst, ein Paar klobige Schuhe und ein züchtiger Rock reichen aus, um ihn zu überzeugen?«
»Kleider machen Leute. Deine Garderobe wird auf jeden Fall dazu beitragen, ihn zu beeindrucken.«
Hannah war weniger zuversichtlich. Sie fühlte sich unwohl in den steifen Sachen und kam sich vor, als spielte sie jemanden, der sie nicht war.
Scott seufzte und fasste sie bei den Schultern. Stets schien er ihre Gedanken zu lesen. »Du musst diese Rolle nur eine halbe Stunde lang durchhalten.«
»Und wenn der Richter die Maskerade durchschaut und gegen mich entscheidet?«
»Das wird er nicht. Elmar Bär ist überzeugt, dass diesmal nichts schiefgehen kann.«
Hannah nickte zerstreut. Ihre Nerven waren zum Zerreißen gespannt. Sie blickte die Straße entlang und hielt Ausschau nach dem Rechtsanwalt, der den Antrag auf Prüfung des Sorgerechts gestellt hatte und für den wichtigen Termin eigens aus Köln anreisen wollte.
Scott steckte sich eine Chesterfield an und sah auf seine Armbanduhr. »Keine Sorge, er wird rechtzeitig hier sein.«
Sie teilte seine Gelassenheit nicht, Bär hatte sie schon einmal im Stich gelassen. Ihre Gedanken wanderten in der Zeit zurück. Wieder saß sie in dem mit Akten und Papieren vollgestopften Hinterhofbüro in Köln. Es kam ihr vor, als wäre es erst gestern gewesen. Mit den Stiefeln auf der zerkratzten Schreibtischplatte schaukelte ihre Freundin Ruth auf dem Stuhl neben ihr und hörte mit finsterer Miene Bärs Ausflüchten zu.
Der Anwalt sollte das psychiatrische Gutachten entkräften, das Hannah die Eignung absprach, für ihr Kind zu sorgen. Ruth hatte behauptet, Bär könne auch Goebbels erfolgreich verteidigen, hätte der sich nicht vorher umgebracht. Doch der beleibte Rechtsanwalt hatte überraschend einen Rückzieher gemacht. Grund dafür waren die Drohungen alter NS-Seilschaften. Bär hatte Hannah die in eine Hakenkreuzbinde gewickelte Gewehrpatrone präsentiert, die ein anonymer Absender ihm geschickt hatte, und es abgelehnt, für sie tätig zu werden.
Sie ahnte, dass Harry hinter der Warnung steckte, hatte es jedoch nie beweisen können. Er war zu jung, um im NS-Terrorapparat eine Rolle gespielt zu haben, aber zweifelsohne ein Opportunist. Stets hängte er sein Fähnchen nach dem Wind und ließ sich auch mit dem Teufel auf einen Kuhhandel ein, wenn er einen Nutzen daraus ziehen konnte.
Seit damals war ein Jahr vergangen. Vor zehn Tagen hatte Bär Hannah überraschend angerufen und ihr angeboten, im Sorgerechtsstreit um Malisha einen neuen Anlauf zu starten. Was ihn wohl dazu bewogen hatte, seine Meinung zu ändern?
In diesem Augenblick bog der Anwalt um die Ecke des Gerichtsgebäudes und kam schnaufend auf sie zu. Er schleppte einen schweren Aktenkoffer und schwitzte trotz der frischen Morgenluft. Sein Doppelkinn schwang bei jedem seiner schaukelnden Schritte hin und her. Ächzend wechselte er den Koffer in die linke Hand und reichte Hannah die rechte.
»Freut mich, Sie wiederzusehen, Fräulein Bloch. Mein Zug hatte Verspätung, tut mir leid.«
»Young. Ich heiße jetzt Young.«
»Ah ja, richtig.« Er begrüßte Scott. »Ihre Heirat wird für uns von Vorteil sein. Wir sind etwas spät dran, wollen wir?«
Hannah und Scott stiegen hinter ihm die Stufen zum Eingangsportal hinauf. Bär erkundigte sich an einem Empfangsschalter und orientierte sich dann an den Hinweisschildern in der Halle. »Ich denke, wir müssen dort entlang«, erklärte er.
Seine Sohlen quietschten auf dem gefliesten Boden. Irgendwo schlug eine Tür zu, der Knall hallte wie ein Pistolenschuss durch die Korridore. Hannah zuckte bei dem Geräusch zusammen. Sie fühlte sich zurückversetzt in die Villa – die Frankfurter Gestapozentrale mit ihren nach Angst und Blut stinkenden Zellen und Verhörräumen im Untergeschoss. In einem dieser Keller war Hannahs Mutter, der die kleine Malisha ihren Namen verdankte, an den Folgen der Folterungen gestorben.
»Vor einem Jahr lehnten Sie es ab, mich zu vertreten, weil Sie bedroht wurden«, sagte Hannah. »Warum haben Sie Ihre Meinung jetzt geändert?«
»Ihre Frage ist berechtigt«, antwortete Bär. »Ich will Sie gerne beantworten. Wie Sie wissen, hatten wir eine gemeinsame Freundin.«
»Sie meinen Ruth Obermayer?«
»Genau die. Ich erfuhr erst vor zwei Wochen von ihrem Tod. Die Nachricht hat mich sehr getroffen. Mit meiner Weigerung, Ihren Fall weiterzuverfolgen, habe ich Ruth damals tief enttäuscht. Ich kann ihren Tod nicht ungeschehen machen, aber es war ihr Wunsch, dass ich Ihnen beistehe, und dem werde ich nun entsprechen. Ich bin es ihr schuldig.«
Hannah wollte entgegnen, dass Bär seine Chance besser genutzt hätte, als Ruth noch gelebt hatte, aber Scott drückte sanft ihren Arm. Er wusste, wie impulsiv sie reagieren konnte. Bär stand auf ihrer Seite, sie sollte ihn nicht vergraulen.
»Der Vormundschaftsrichter hat das psychiatrische Gutachten, das ich damals teuer bezahlt habe, nicht akzeptiert«, sagte sie stattdessen. »Harry hat vermutlich seinen ganzen Einfluss in die Waagschale geworfen, um das zu erreichen. Warum sollte es heute besser für mich laufen als vor einem Jahr?«
Der Anwalt funkelte sie aus listigen kleinen Augen an und fuhr sich mit der Zungenspitze über die Lippen.
»Es hat sich einiges geändert. Harald Lenz hat sich selbst diskreditiert, in dem er Fluchthilfe für gesuchte Kriegsverbrecher geleistet und dafür abkassiert hat. Ob er sich auch im Sinne des Gesetzes strafbar gemacht hat, ist im Augenblick Gegenstand einer internen Untersuchung. Sein Stuhl in der Staatsanwaltschaft wackelt, Lenz hat massiv an Einfluss verloren.«
»Der Richter wird derselbe sein, oder?«
Bär nickte. »Das will ich doch hoffen. Hoffmann wird Ihnen sehr gewogen sein.«
Hannah blickte ihn zweifelnd an. »Es fällt mir schwer zu glauben, dass dieser Mann seine Ansichten geändert haben soll.«
»Lassen Sie das meine Sorge sein.« Bär tätschelte seinen Aktenkoffer. »Wir sind im Besitz guter Argumente, die ihn überzeugen werden.«
Er klopfte an, trat ein und meldete sich bei einer Vorzimmerdame an, die die Besucher kritisch musterte. Den Mund zu einem blutleeren Strich verkniffen, ging sie voran in einen dunkel getäfelten Raum und bat sie zu warten. Vor einem Schreibtisch standen vier Stühle. Auf einem von ihnen saß Harald Lenz.
»Was macht der denn hier?«, fragte Hannah halb laut.
Lenz drehte sich um, setzte sein gewinnendes Lächeln auf und deutete eine Verbeugung an.
»Hannah, wie schön, dich zu sehen.«
Sie wich unwillkürlich vor ihm zurück und prallte gegen Scott. »Was willst du hier?«
»Das Gleiche wie du, nehme ich an.«
Sie wandte sich an Bär. »Haben Sie davon gewusst?«
»Nein, aber das spielt keine Rolle.«
Ihre ohnehin schwankende Zuversicht schwand vollends. Harry heckte eine neue Teufelei aus, und sie glaubte nicht, dass Bär ihm gewachsen war.
»Du gibst also nicht auf«, sagte Hannah.
»Ein Kind braucht seinen Vater und ein stabiles Umfeld. Du kannst ihm weder das eine noch das andere bieten.«
»Das werden wir ja sehen.«
Lenz schüttelte scheinbar bedauernd den Kopf. »Dieselbe alte Hannah. Dickköpfig, unbelehrbar und … nicht abrichtbar. Das wird dem Richter nicht gefallen.«
Sie kämpfte den Drang nieder, sich auf einen Streit einzulassen, noch bevor die Anhörung begonnen hatte. Harry wusste genau, wie sehr sie Anspielungen auf ihre Vergangenheit trafen. Nur deshalb hatte er aus dem Meldebogen des Gutachterarztes zitiert, der sie als lebensunwert abgestempelt und in eine der Tötungsanstalten eingewiesen hatte. Scott nahm ihre Hand in seine und verlieh ihr Kraft, den Zorn niederzuringen. Harry wollte nichts weiter, als das unbesonnene Verhalten zu provozieren, das der Richter von ihr erwartete.
»Wie willst du eigentlich beweisen, dass du der Vater des Kindes bist?«, fragte sie.
»Das wird gar nicht nötig sein«, antwortete Lenz gelassen. »Ganz gleich, was geschieht, du wirst meine Tochter nicht in die USA entführen.«
Bevor Hannah eine hitzige Antwort geben konnte, öffnete sich eine Tür in der Wandtäfelung. Ein etwa fünfzigjähriger Mann von untersetzter Gestalt schritt energisch auf den Tisch zu. Er hatte eisgraues, streng gescheiteltes Haar und eng beieinanderstehende Augen. Er knallte einen Stapel Akten auf den Tisch, zog lärmend den Stuhl zu sich heran und setzte sich. Der Geruch von kaltem Zigarrenrauch schwebte mit seinem Auftritt in den Raum. Statt einer namentlichen Vorstellung stellte er ein Schild aus Messing auf: »Dr. jur. Lothar Hoffmann«.
»Setzen Sie sich.«
Hannahs Herz gefror. Dieser Mann war derselbe, der 1939 veranlasst hatte, sie wegen drohender Verwahrlosung unter staatliche Vormundschaft zu stellen. Die Endstation der grauenvollen Reise, die Hoffmann ihr aufgezwungen hatte, war die Hölle der Euthanasieanstalt Hadamar gewesen, die sie nur knapp mit Ruths Hilfe überlebt hatte.
Stühlerücken setzte ein, alle nahmen vor dem Schreibtisch Platz. Bär nickte Hannah aufmunternd zu und verzog die Lippen zu einem Schmunzeln, als sei das alles ein Riesenspaß. Hielt er einen Trumpf in der Hand, von dem niemand etwas ahnte?
Hoffmann blätterte in den Akten und rasselte dann in staubigem Amtsdeutsch Paragrafen und Auszüge von Gesetzestexten herunter.
»In der Vormundschaftsangelegenheit Bloch/Lenz sind erschienen: Harald Lenz, wohnhaft in Frankfurt am Main, Friedrichstraße 158, Staatsanwalt, sowie Hannah Young, geborene Bloch …« Er stutzte und heftete seinen stechenden Blick auf Scott. »Hier ist das amerikanische Hauptquartier als Adresse angegeben. Ist das korrekt?«
»Frau Young ist mit ihrem Ehemann Lieutenant Scott Young der US Air Force auf dem Weg in die Vereinigten Staaten von Amerika. Sie ist im I.G.-Farben-Haus nur vorübergehend untergebracht«, beeilte sich Bär mitzuteilen.
»Mmh.«
Der Anwalt wickelte seelenruhig ein Bonbon aus dem Papier und ließ es in seinem Mund verschwinden. Er wirkte entspannt und zufrieden, als hätte er den Rechtsstreit bereits gewonnen.
Der Richter wandte sich an Lenz. »Sie erheben Anspruch auf das Sorgerecht für Ihre gemeinsame Tochter. Können Sie Beweise für die Vaterschaft vorlegen?«
Lenz entnahm seiner Aktentasche einen dünnen Pappordner und gab ihn dem Richter.
»Was ist das?«
»Ein medizinisches Gutachten, das die Vaterschaft beweist.«
Hoffmann überflog das Schreiben und runzelte die Stirn.
Bär streckte die Hand aus. »Darf ich? Das scheint mir sehr interessant zu sein.«
»Bitte.« Hoffmann reichte ihm den Aktendeckel.
Hannah zwang sich, das Schriftstück anzusehen. Es kostete sie enorme Anstrengung. Die Erinnerung kehrte mit der Wucht eines Faustschlags zurück. Sie sah ihre Mutter und sich selbst in Dr. Lubecks Sprechzimmer sitzen. Während er den Meldebogen ausfüllte, der Hannahs Schicksal besiegelte, begaffte er ihre Mutter mit geilen Blicken. Zehn Jahre waren seit jenem Tag vergangen, und wieder hing ihr Schicksal und nun auch das ihrer Tochter vom Urteil eines Mannes ab, der sie für nicht abrichtbar hielt.
Die Buchstaben verschwammen vor Hannahs Augen. Sie las Schlagworte wie Fingerknöchelchen, Nasenansatz, Haar- und Augenfarbe und vergleichende Anatomie.
Sie spürte, wie die Dunkelheit heranraste. Ihr Herz hämmerte, von ihren Augenwinkeln wanderten schwarze Flecken in ihr Sichtfeld, in denen winzige Blitze zuckten. Alles, nur das nicht! Auf keinen Fall durfte sie jetzt ein epileptischer Anfall lähmen. Seit vielen Jahren hatte die Krankheit sie nicht mehr heimgesucht, doch unter extremem Stress geschah es zuweilen, dass sie ausbrach. Verzweifelt kämpfte sie gegen die drohende Ohnmacht an.
Bär saugte schmatzend an seinem Bonbon, schüttelte den Kopf und warf die Akte auf den Tisch. Das Klatschen des Pappdeckels auf dem polierten Holz holte Hannah gerade rechtzeitig in die Wirklichkeit zurück.
»Der Vergleich charakteristischer Körpermerkmale als Nachweis einer Vaterschaft steht erwiesenermaßen auf tönernen Füßen«, erklärte Bär. »Bei einem Säugling gilt er als unzuverlässig und darf in dieser Anhörung nicht verwendet werden. Das wissen Sie so gut wie ich.«
Hannah dachte an den Tag zurück, an dem ihr Leben aus den Fugen geraten war. Es war ihr, als befände sie sich wieder in dem stickigen Klassenzimmer. Pilz, der kahlköpfige Mathematiklehrer und linientreue Nationalsozialist, stolzierte vor der Schautafel auf und ab und frönte seinem Lieblingsthema: der Schädellehre nach Franz Joseph Gall.
Aus weiter Ferne hörte sie die Stimme des Richters. »Ich allein entscheide, welche Beweismittel zugelassen werden. Aber vielleicht sollten wir Frau Young dazu befragen. Sie wird uns den Kindesvater sicher verraten können, nicht wahr?«
»Wir sind nicht dazu verpflichtet, ihn zu nennen«, entgegnete Bär.
Hoffmann trommelte einen leisen Takt und schlug abschließend mit der flachen Hand auf die Tischplatte.
»Da die Vaterschaft nicht eindeutig zu klären ist, sehe ich keinen Grund, am Status quo etwas zu ändern. Das Kind bleibt vorerst unter staatlicher Obhut.«
1
»Meine Lebenssituation hat sich vollständig geändert«, protestierte Hannah. »Ich kann Malisha ein intaktes Zuhause bieten und …«
Hoffmann hob abwehrend die Hand. »Ihr Werdegang ist mir bestens bekannt, Frau Young. Ebenso Ihr Charakter, der mir nicht geeignet erscheint, ein Kind nach den gültigen gesellschaftlichen Gepflogenheiten zu erziehen. Sie galten schon 1939 als … schwierig.«
»Sie meinen nicht abrichtbar.«
Bär beugte sich vor. »Wenn ich …«
Hannah unterbrach ihn. »Das waren doch die Worte, die Sie benutzten, nicht wahr?«
Der Richter schob seinen Stuhl zurück und stand auf. »Sie können in einem halben Jahr einen neuen Antrag stellen.«
Lenz war ebenfalls aufgesprungen. »Das Kind braucht einen Vater.«
»Für das Mädchen wird gut gesorgt.«
»Kann ich Sie einen Augenblick unter vier Augen sprechen?«, fragte Bär.
»Dazu besteht kein Anlass«, entgegnete Hoffmann.
»Ich denke, Sie sollten sich anhören, was ich zu sagen habe.«
Der dicke Anwalt zog ein rotes Taschentuch aus der Hosentasche und putzte sich geräuschvoll die Nase. Hannah riss die Augen auf. Es war eine Hakenkreuzarmbinde.
Hoffmann starrte auf die Binde.
»Ich protestiere«, sagte Lenz.
»Tun Sie das draußen«, antwortete der Richter. »Lieutenant Young wird Ihnen dabei Gesellschaft leisten.«
»Das wird ein Nachspiel haben.«
Harry raffte Gutachten und Aktenkoffer an sich und verließ das Zimmer. Scott schloss sich ihm an, auch Hannah erhob sich.
Bär drückte sie sanft auf den Stuhl zurück. »Meine Mandantin bleibt als Zeugin.«
»Ich warne Sie!«, zischte Hoffmann.
Bär wartete, bis sie zu dritt waren. »Alle Anwesenden vereinbaren, über dieses Gespräch Stillschweigen zu bewahren, nicht wahr, Frau Young?«
Hannah nickte stumm. Was hatte er vor?
Hoffmann setzte sich wieder. »Wollen Sie mir gefälligst erklären, was dieses Theater soll?«
Bär faltete die Hände vor dem Bauch und schaukelte auf seinem Stuhl vor und zurück.
»Aber gerne. Am 5. April 1945 leitete der Chef des Reichshauptsicherheitsamtes Ernst Kaltenbrunner auf Befehl von Hitler ein SS-Standgerichtsverfahren gegen ReichsgerichtsratHans von Dohnanyi, Generalmajor Oster, GeneralstabsrichterKarl Sack, Admiral Wilhelm Canaris sowie Pastor Dietrich Bonhoeffer ein. Die Angeklagten waren durch Geheimakten belastet, die man im OKW-Gebäude in Zossen entdeckt hatte. Von Dohnanyi wurde beschuldigt, sie im September 1944 dort deponiert zu haben.«
»Ich sehe nicht, was das mit diesem Sorgerechtsstreit zu tun hat.«
»Das werden Sie gleich«, sagte Bär. »Obwohl alle Personen der Kriegsgerichtsbarkeit unterstanden, kam es am 6. und 8. April zu Standgerichtsverfahren in den Konzentrationslagern Sachsenhausen und Flossenbürg. In beiden Verfahren trat SS-Standartenführer Walter Huppenkothen als Ankläger auf. Davon dürften Sie Kenntnis haben, sind Sie doch eng mit ihm befreundet.«
»Ich warne Sie, Bär. Ihre Methoden sind mir bekannt. Falls dies ein Erpressungsversuch ist, dann …«
Der Anwalt fuhr unbeeindruckt fort. »In Flossenbürg führte Otto Thorbeck den Vorsitz, im Verfahren gegen von Dohnanyi in Sachsenhausen war es ein SS-Richter namens Lothar Hoffmann. Bisher ist über ihn nichts weiter bekannt. Ich könnte mir vorstellen, dass es Ihnen sehr gelegen käme, wenn dies auch so bleibt.«
»Der Name Hoffmann ist so verbreitet wie Müller oder Schmidt. Und was das Standgerichtsverfahren betrifft, es entsprach der damaligen Rechtsprechung. Niemand kann den Beteiligten einen Vorwurf machen, sie erfüllten nur ihre Pflicht.«
»Nicht so hastig«, sagte Bär. »Den Angeklagten wurde kein Verteidiger zur Seite gestellt, es wurde auch kein Protokoll geführt. Die Art der Vollstreckung der Todesurteile muss man als abscheulich und menschenverachtend bezeichnen, ersparen Sie Frau Young die grausamen Einzelheiten. Mag sein, dass man Sie bei einer gerichtlichen Untersuchung der Vorfälle freisprechen wird, Ihre Karriere als Jurist dürfte auf jeden Fall beendet sein.«
Hoffmann schnaubte verächtlich durch die Nase. »Sie haben doch gar nichts in der Hand.«
Bär betrachtete ein interessantes Detail unter seinem Fingernagel. »Ich nicht, aber die Amerikaner. Genauer gesagt, Lieutenant Scott Young vom Counter Intelligence Corps. Noch hat er die belastenden Dokumente nicht weitergegeben.«
Hannah hörte Bärs Vortrag atemlos zu. Von alldem hatte sie nichts geahnt.
Auf Hoffmanns Stirn perlte ein Schweißtropfen und rann an seiner Schläfe herab. »Und was verlangt er für seine … Nachsicht?«
»Aber das wissen Sie doch: das Sorgerecht für Malisha Bloch.«
Der Richter starrte Bär an, sein Blick war scharf und kalt wie ein SS-Dolch.
»Welche Garantie bekomme ich, dass … gewisse Dokumente … unter Verschluss bleiben?«
»Seit Kriegsende lag mein Streben darin, all die kleinen Mitläufer und Schreibtischtäter, die die Vernichtungsmaschine der Nazis bereitwillig geschmiert haben, zu enttarnen und zur Verantwortung zu ziehen«, mischte sich Hannah ein. »Die Ärzte in den Tötungsanstalten, die Schläger der Gestapo, die meine Mutter ermordet haben, die Parteisoldaten und Juristen, die verhindern wollten, dass die verrückte Halbjüdin Hannah Bloch eines Tages Kinder bekommt. Ich habe einen hohen Preis für mein Verlangen nach Gerechtigkeit bezahlt, und ich bin es müde, euch zu jagen. Alles, was ich will, ist meine Tochter im Arm zu halten und mit ihr und meinem Mann dieses Land zu verlassen. Ich schwöre, Sie werden nie wieder etwas von mir hören, wenn Sie mir erlauben, mein Kind mitzunehmen.«
»Sie sehen, wir haben gemeinsame Interessen«, sagte Bär.
Hoffmann deutete ein Nicken an. »Also gut. Warten Sie hier.«
Er schob seinen Stuhl zurück und verschwand durch die Tür in der Wandtäfelung.
»Woher haben Sie diese Informationen?«, fragte Hannah. »Oder bluffen Sie nur?«
»Die belastenden Dokumente existieren. Dreimal dürfen Sie raten, wer in ihrem Besitz war. Jemand, der gutes Geld damit verdient hat, Leuten wie Brunner und Hoffmann eine neue Identität zu verschaffen.«
Hannah fuhr herum. »Doch nicht etwa …«
»Staatsanwalt Harald Lenz.«
»Wie sind Sie an die Unterlagen gelangt?«
»Bedanken Sie sich bei Ihrem Mann. Die Listen, die Lenz führte, wanderten nach der Durchsuchung seiner Villa in Bockenheim auf direktem Weg zum CIC. Nachdem die Amerikaner die Strafverfolgung von NS-Verbrechern in die Hände der Deutschen gelegt hatten, hat sich jedoch niemand die Mühe gemacht, das Material zu sichten.«
»Warum hat Scott mir nichts davon erzählt?«
»Um Sie zu schützen. Sie haben sich entschlossen, in den USA mit ihm ein neues Leben zu beginnen. Das Letzte, was er will, ist, dass Sie wieder anfangen, ehemaligen Nazis hinterherzujagen. Aber als klar wurde, dass Hoffmann der Richter ist, der über das Sorgerecht für Ihre Tochter entscheidet, mussten wir uns Scotts Wissen zunutze machen.«
»Hoffmann darf nicht davonkommen und vor allem nicht weiterhin ein Richteramt ausfüllen.«
Bär seufzte. »Sehen Sie, das ist es, was Ihr Mann befürchtete. Ich gebe Ihnen einen guten Rat, Mrs Young. Lassen Sie Deutschland und seine braune Vergangenheit hinter sich. Die USA sind ein freies und tolerantes Land, in dem es sich gut leben lässt.«
Die Tür wurde wieder geöffnet. Hoffmann reichte Bär einen Umschlag. »Ich verlasse mich auf Ihr Wort, dass die leidige Angelegenheit damit vom Tisch ist.«
Der Anwalt zog das Schreiben aus dem Kuvert, überflog es und steckte es zufrieden zurück.
»Selbstverständlich. Es hat mich gefreut, Ihre Bekanntschaft zu machen. Leben Sie wohl.«
Sie verließen das Amtszimmer. Als Hannah auf den Korridor hinaustrat, hatte sie das Gefühl, die Temperatur wäre in der vergangenen halben Stunde auf den Gefrierpunkt gefallen. Scott saß scheinbar gelassen auf einer Bank. Hannah fiel sofort seine angespannte Haltung auf: wie ein Tiger, der jederzeit bereit war, anzugreifen. Er ließ Harry nicht aus den Augen. Der lief zwanzig Schritte, die Hände in den Hosentaschen versenkt, und drehte auf dem Absatz um, nur um seine nervöse Wanderung in die entgegengesetzte Richtung fortzusetzen. Er war kalkweiß und presste mit kaum unterdrückter Wut die Lippen zusammen. Als er Hannah sah, hielt er inne.
»Hat dieses lächerliche Theater endlich ein Ende? Wann siehst du ein, dass ich dir niemals erlauben werde, mir meine Tochter zu nehmen?«
Er stürmte an ihr vorbei auf die Tür zu Hoffmanns Vorzimmer zu.
»Spar dir die Mühe. Du hast recht, es ist gelaufen!«, rief Hannah ihm nach. »Allerdings nicht so, wie du es dir vorgestellt hast. Malisha kommt mit uns in die Staaten.«
Hannah eilte den Gang entlang, ohne sich noch einmal umzusehen. Scott hatte Mühe, mit ihr Schritt zu halten.
»Damit kommst du nicht durch!«, rief Lenz. »Du wirst deine Dickköpfigkeit noch bereuen!«
Scott wandte sich angriffslustig um. Hannah griff nach seiner Hand und zog ihn mit sich.
»Lass ihn. Er kann es nicht ertragen zu verlieren«, sagte sie.
»Er wird uns Schwierigkeiten machen.«
»Das kann er nicht mehr. Trotzdem hättest du mich einweihen sollen, was Hoffmann betrifft.«
»Damit du dich darin verbeißt, ihn zur Strecke zu bringen wie Heyrich und Brunner? Sorry, aber das konnte ich nicht zulassen.«
»Willst du Hoffmann etwa davonkommen lassen?«
»Keine Sorge, ich werde mich um ihn kümmern, wenn Sie mit dem Kind in Sicherheit sind«, sagte Bär leise. »Lenz hat Zeugenaussagen von Beteiligten des SS-Standgerichtsverfahrens gesammelt. Sie genügen, um Hoffmann schwer zu belasten.« Er reichte Hannah den Umschlag. »Ich wünsche Ihnen viel Glück.«
»Wie soll ich Ihnen danken?«
»Ich war es Ruth schuldig. Gott habe sie selig.«
Sie umarmte Bär und verabschiedete sich. Er lüftete seinen Homburg und grinste. »Es war mir ein Vergnügen.«
Der Anwalt hielt nach einem Taxi Ausschau und überquerte in seinem Schaukelgang die Straße. Hannah öffnete das Kuvert. Ihr Herz trommelte einen aufgeregten Wirbel gegen ihre Rippen. Scott blickte ihr über die Schulter.
»Sie haben Malisha in ein Kinderheim in Nordhagen gebracht. Wo liegt das?«
»Ich weiß es nicht, aber wir werden es herausfinden.«
Glücklich presste sie das Schreiben an ihre Brust, in dem ihr das alleinige Sorgerecht für ihre Tochter zugesprochen wurde.
2
Am späten Nachmittag des 15. April kamen Scott und Hannah in Nordhagen an. Scott parkte den lindgrünen Ford Sedan vor einem dreistöckigen Gebäude aus gebrannten Ziegeln. Ein scharfer Wind fegte über das flache Land, als sie aus dem Wagen stiegen. Jenseits der Deichkrone erstreckte sich das Watt wie eine schlammige Wüste, vom Meer wehte der Geruch von Salz und Tang über die Ebene. Möwen segelten in der steifen Brise, streiften in pfeilschnellen Manövern beinahe die Dachtraufen und stießen schrille Schreie aus.
Links und rechts des Hauptgebäudes, das von zwei Giebeln und einem gedrungenen Aufbau in der Mitte bestimmt wurde, reihten sich kasernenartige Anbauten aneinander. Die Fassade war von Efeu überwuchert, die Fenster mit den gotischen Spitzbögen waren dunkel und leer wie tote Augen. Das Geschrei der Möwen und das Heulen des Windes waren die einzigen Geräusche, kein Kinderlachen erfüllte die Luft. Das Heim der Barmherzigen Diener Jesu schien ein verlassener und längst vergessener Ort zu sein.
»Nicht besonders einladend, wie?«, sagte Hannah.
Gemeinsam stiegen sie die Stufen zum Eingang hinauf. Scott drückte auf einen Klingelknopf mit der Aufschrift Anmeldung. Kurz darauf erschien eine Nonne in schwarzbraunem Habit und weißer Kopfhaube.
»Sie wünschen?«
»Wir möchten den Leiter dieser Einrichtung sprechen«, sagte Scott.
»Das ist Pater Vincent. In welcher Angelegenheit darf ich Sie anmelden?«
Er erklärte den Grund ihres Besuchs.
»Warten Sie bitte hier«, entgegnete die Nonne. »Ich werde sehen, was ich für Sie tun kann.«
So lautlos, wie sie gekommen war, verschmolz sie wieder mit dem Halbdunkel der Eingangshalle.
»Mein Gott.« Hannah seufzte tief. »Wer hier nicht trübselig wird, muss wahrhaft ein sonniges Gemüt haben.«
Nach geschlagenen zehn Minuten kehrte die Nonne zurück.
»Pater Vincent wird Sie empfangen. Wenn Sie mir bitte folgen wollen?«
Über ausgetretene Stufen und düstere Korridore ging es in den zweiten Stock in das Büro des Heimleiters. Pater Vincent war etwa sechzig Jahre alt. Auf seinem messerscharfen Nasenrücken saß eine Schildpattbrille, das fahlblonde Haar trug er glatt zurückgekämmt. Er reichte ihnen zur Begrüßung die Hand. Sie fühlte sich kalt und schlaff an wie ein toter Fisch, keine Spur eines Lächelns umspielte seine Lippen. Die Vorstellung, dass ihr kleines Mädchen sich in der Obhut dieses griesgrämigen Mannes befand, weckte in Hannah das Verlangen, Malisha auf der Stelle zu sich zu nehmen.
»Mein Name ist Vincent Menck, ich bin der Heimleiter.« Er deutete auf zwei Stühle vor seinem Schreibtisch. »Nehmen Sie bitte Platz. Wie kann ich Ihnen helfen?«
Stuhlbeine scharrten über den Linoleumboden, sie setzten sich. Scott zog das Schreiben des Vormundschaftsgerichts aus der Innentasche seines Mantels und reichte es dem Pater.
»Wir sind gekommen, um ein Kind abzuholen, das aufgrund einer Verfügung des Vormundschaftsgerichts Frankfurt hier untergebracht wurde. Der Richter hat das Sorgerecht der Mutter zugesprochen.«
Menck las mit zusammengekniffenen Augen, als könnte er trotz der starken Brillengläser schlecht sehen. Schließlich faltete er das Schreiben zusammen und gab es Scott zurück.
»Ich bedaure, dass Sie den langen Weg von Frankfurt hierher umsonst auf sich genommen haben.«
Hannah setzte sich kerzengerade auf. Der Albtraum ging weiter. War Harry ihnen zuvorgekommen?
»Was soll das heißen?«
»Sie haben sicher vom Ausbruch der Polio-Epidemie gehört. Ganz Deutschland ist betroffen, und auch unsere Einrichtung blieb nicht verschont. Wir hatten in den letzten beiden Wochen zehn Fälle zu beklagen, drei davon verliefen tödlich. Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Ihre Tochter zu den Opfern zählt.«
»Nein … das … kann nicht sein.« Hannah sprang erregt auf. »Das ist eine Lüge! Dahinter steckt Harry. Er hat geschworen, sich zu rächen. Er will mir Malisha wegnehmen.«
Der Pater schüttelte den Kopf. »Es tut mir leid, Frau Young, aber das sind die Tatsachen. Gott hat es gefallen, das Kind zu sich zu holen, damit müssen Sie sich abfinden.«
Scott legte seine Hand auf ihren Unterarm, doch Hannah wehrte sich gegen seine Berührung. Sie wollte nicht getröstet werden, wollte nicht schon wieder einen geliebten Menschen verlieren.
»Ich will das Grab sehen.«
»Natürlich. Schwester Agnes wird Sie hinführen. Der Friedhof befindet sich unmittelbar hinter dem Gelände unserer Anstalt.«
Er blätterte in einem Ordner und reichte Hannah zwei Dokumente. Es waren Malishas Geburtsurkunde vom 9. Februar 1948 und der Totenschein, ausgestellt am 10. April 1949. Sie war gestorben, drei Tage bevor Hannah sich das Sorgerecht erstritten hatte.
Die schweigsame Nonne betrat wieder das Büro und forderte Hannah und Scott auf, ihr zur Rückseite des Gebäudes zu folgen. Sie durchquerten einen Gemüsegarten, in dem Kinder unter Aufsicht von Nonnen Unkraut jäteten. Sie wirkten freudlos und verängstigt.
Hannah wusste später nicht mehr, wie sie auf den Friedhof gelangt war. Vor dem von einer hohen Mauer umgebenen Gräberfeld erwachte sie aus ihrer Starre. Ein Grablicht flackerte unruhig, auf der sandigen Erde lag ein verwelkter Blumenstrauß. Der Wind wehte Blütenblätter davon. Auf schlichten Holzkreuzen standen die Namen eines Jungen und zweier Mädchen, eins davon war Malisha.
Etwas zerbrach in ihr. Ein Jahr lang hatte sie gehofft und gekämpft, doch am Ende war alles umsonst gewesen. Konnte das Schicksal so grausam sein?
Scott hielt respektvoll Abstand, ließ sie aber spüren, dass er da war, falls sie ihn brauchte.
»Lass uns abreisen«, sagte sie leise, »und nie wieder nach Deutschland zurückkehren. Hier hält mich nichts mehr.«
Am Morgen des 21. April 1949 passierte der Schnelldampfer Edmund B. Alexander, der seit Kriegsende Angehörige der US-Army aus Europa in die USA zurückbrachte, Liberty Island und legte im Hafen von New York an. Am frühen Abend stieg Hannah vor Scotts Elternhaus in Boston aus einem schwarzen Packard, fest entschlossen, ein neues Leben zu beginnen.
3
Selma, USA, 1964
Ben liebte den Fluss. Träge und majestätisch näherte er sich der Stadt von Osten her, mäanderte an ihrer südlichen Grenze entlang nach Westen und beschrieb dann einen Bogen um die Craig Air Force Base, um in mehreren Schleifen nach Süden weiterzufließen. Im ersten Morgenlicht schimmerte der Alabama River in einem stumpfen Grau. Ein feiner Nebel schwebte wie ein Gespinst aus Licht und Schatten über dem Wasser. Ben schlenderte am Ufer entlang, hob einen flachen Stein auf und warf ihn über das Wasser. Er berührte achtmal die Oberfläche, bevor er versank. Nicht schlecht, dachte Ben.
Ein zweiter Stein sauste über den Fluss. Ben beobachtete, wie er von der Wasseroberfläche abprallte und als schillernder Diskus durch die Luft wirbelte. Er schien auf direktem Weg in die Sonne zu fliegen, die in diesem Moment den Frühnebel durchbrach und glitzernde Reflexe auf das Wasser zauberte. Ein untrügliches Zeichen, dass er zu lange getrödelt hatte. Nun musste er wieder rennen wie ein Verrückter, um nicht zu spät zur Schule zu kommen.
Nur einen kostbaren Augenblick wollte er noch bleiben und warten, bis sich die kreisförmigen Wellen legten, die der Stein erzeugt hatte. Er trat dicht ans Ufer heran. Aus dem Fluss, der nun wieder so glatt wie ein Spiegel im Morgenlicht glänzte, blickte ihn ein vierzehnjähriger Junge mit ebenmäßigen Zügen und krausem Haar an. Ein Junge, der Träumen nachhing, die niemals in Erfüllung gehen würden, denn ihm haftete ein Makel an, der wie Pech an seinen Hacken klebte: Seine Haut war so dunkel wie der Alabama River an diesem Morgen.
Hastig klaubte Ben eine Handvoll Kieselsteine auf und schleuderte sie wutentbrannt ins Wasser. Sein Spiegelbild zitterte und löste sich auf. Der Junge an Land dagegen blieb, was er war: zornig und voller Verlangen nach Respekt und Achtung, die ihm verwehrt wurden, weil er schwarz war.
Seufzend wischte er sich die Hände an der Hose ab, hob seine Schulbücher auf und lief nach Norden, der Brücke entgegen, die den Vorort West Selmont mit Selma verband.
Er wusste, dass er eines Tages fortgehen und es besser machen würde als sein Vater, der auf den Feldern am Alabama River seinen Lebensunterhalt verdiente und seinen kargen Lohn für Schnaps verschleuderte. Dad musste jede Arbeit annehmen, die ihm angeboten wurde, wenn er überhaupt etwas verdienen wollte. Die besseren Jobs bekamen nur die Weißen.
Seine Hautfarbe würde sich niemals ändern, aber gegen seine Unwissenheit konnte Ben etwas unternehmen. Alles, was er brauchte, war eine Chance. Dann würden sie schon sehen, was in ihm steckte.
Ben verfiel in einen ausdauernden Laufschritt und hing seinen Träumen nach. Er besaß nicht mehr als eine vage Hoffnung und genug Verstand, um sein Ziel zu erreichen. Das musste genügen.
Die weiß gestrichenen Stahlträger der Edmund Pettus Bridge kamen in Sicht und leuchteten grell in der tief stehenden Sonne. Ben schirmte die Augen mit der Hand ab und bewunderte die große Doppelstrebe, die sich wie ein Halbmond über den Fluss spannte und auf im Flussbett gegründeten Betonfundamenten ruhte. Intuitiv erfasste er die wesentlichen Elemente der Konstruktion und ihre Beziehungen zueinander. Senkrechte Stützen trugen den Bogen mit der eigentlichen Brücke, die in sanftem Schwung über den Fluss führte und West Selmont mit Selma verband.
Jedes Mal, wenn Ben die Edmund Pettus Bridge überquerte, stellte er sich vor, dass er eines Tages überall auf der Welt Brücken wie diese errichten würde. Stark und sicher sollten sie sein. Dazu geschaffen, die Ufer zu verbinden, an denen Menschen darauf warteten, zueinander gelangen zu können.
Ben malte sich zwei Städte aus, die durch einen reißenden Strom getrennt waren. Sehnsuchtsvoll blickten ihre Bewohner auf die jeweils andere Seite, ohne Aussicht, sie je zu erreichen. Sie wollten einander kennenlernen und Freundschaften schließen, aber der Fluss hinderte sie daran. Doch dann würde Ben eine Brücke bauen, eine mächtige Konstruktion wie die Edmund Pettus Bridge, und die Menschen würden aufeinander zugehen können.
Eine schmale Gestalt, die sich im Gegenlicht wie ein schwarzer Scherenschnitt bewegte, riss ihn aus seinen Gedanken. Sie überquerte mit eiligen Schritten die Brücke Richtung Selma.
Bens Herz pochte heftig gegen seine Rippen, was nicht nur eine Folge der Anstrengung war. Dort ging niemand anders als Gracie Robertson. Das Mädchen war fast sechzehn, ein gutes Jahr älter als er, und lebte in der Nachbarschaft. Wann immer er Gracie begegnete, spürte er, wie ihm das Blut in den Kopf schoss. Ben war um Worte nie verlegen, aber in ihrer Gegenwart lähmte ihn eine ungewohnte Befangenheit. Von seinen kühnen Träumereien beflügelt, siegte an diesem Maimorgen jedoch die Kühnheit über die Befürchtung, sich zum Narren zu machen. Er beeilte sich, Gracie einzuholen.
Der Weg zur einzigen Schule, die schwarze und weiße Kinder gemeinsam besuchen durften, führte von Selmont im Süden über die Edmund Pettus Bridge etwa zwei Kilometer in die Stadt hinein und war nicht ungefährlich. Ben hatte dort mehr als einmal Prügel bezogen. Er mied Auseinandersetzungen und hatte einen Instinkt entwickelt, Ärger aus dem Weg zu gehen. Sollte er allerdings auf Bill Hancock oder Joe Strumner treffen, war eine Schlägerei so unausweichlich wie die Tatsache, dass Dad noch vor Ende des Monats den letzten Penny versaufen würde. Bill und Joe provozierten ihn bei jeder Gelegenheit und trieben ihn so lange in die Enge, bis ihm nichts anderes übrig blieb, als sich zur Wehr zu setzen. Niemand kümmerte sich darum, wenn weiße Jungs ihn schikanierten. Es waren immer die Schwarzen, die Schuld hatten. Die Vorstellung, dass auch Gracie von einem Typen wie Strumner belästigt werden könnte, entfachte in Ben den Drang, sie zu beschützen.
Das Mädchen hörte seine eiligen Schritte auf dem Asphalt und drehte sich um. Furcht flackerte in Gracies Augen auf. Erst als sie Ben erkannte, entspannte sie sich. Er konnte ihren Argwohn nur allzu gut nachvollziehen. Wenn man schwarz war, warteten hinter jeder Ecke Scherereien.
»Hi«, sagte er atemlos.
»Hi. Warum rennst du so?«, fragte sie.
»Bin spät dran.«
Sie zuckte mit den Schultern. »Na und? Was verpasst du schon?«
»Lernen ist wichtig. Ich gehe gerne zur Schule. Du nicht?«
»Ich tu’s, weil ich muss. Mein Dad sagt, ich soll hingehen.«
»Er hat recht.«
»Weiß nicht. Ich bin ein Mädchen und ich bin schwarz. Es macht keinen Unterschied, ob ich schreiben, lesen und rechnen kann oder nicht.«
»Meinem Dad ist es egal, ob ich etwas lerne«, erwiderte Ben. »Er hat wieder einen Job, unten am Fluss auf den Feldern. Als er zu Hause rumhing, durfte ich nicht zur Schule, ich musste Geld verdienen.«
Überrascht warf sie ihm einen Seitenblick zu. »Du?«
Ben war plötzlich stolz, schon mal gearbeitet zu haben. »Hab in Dan’s Garage ausgeholfen und Wagen gewaschen. Aber lieber geh ich in die Schule.«
Gracie schwieg.
»Ich bleib sowieso nicht ewig in Selma«, verkündete er.
Bildung war der einzige Weg, der aus der Stadt hinausführte. Ben war wissbegierig und lernte schnell, gehörte jedoch trotzdem zu den schlechten Schülern. Er war als Kind oft und lange krank gewesen und hatte entscheidende Lektionen verpasst. Seine Mutter hatte getan, was sie konnte, ihn zu Hause unterrichtet und sich bemüht, das Versäumte nachzuholen. Sie war eine kluge Frau gewesen, die ihm alles beigebracht hatte, was sie wusste, auch wenn Dad es für Zeitverschwendung hielt. »Ein Schwarzer bleibt ein Schwarzer, ganz gleich wie viel er in seinen Kopf hineinzwängt«, war alles, was er zu Bens mühsamen Lernfortschritten gesagt hatte. Vielleicht stimmte das. Mom hatte bis zu ihrem Tod im städtischen Krankenhaus gearbeitet. All die schlauen Bücher, die sie sich ausgeborgt und gelesen hatte, hatten ihr nicht geholfen, den Krebs zu besiegen. Trotzdem wünschte sich Ben, seinem Vater eines Tages das Gegenteil zu beweisen.
»Meine Mom sagt, wir müssen an dem Ort bleiben, den Gott für uns bestimmt hat«, erklärte Gracie.
Ben verdrehte die Augen. Marge Robertson besuchte sonntags den Gottesdienst in der Kirche der Methodistengemeinde. Sie war streng gläubig und kannte für jede Gelegenheit einen passenden Bibelspruch.
»Glaub ich nicht«, sagte Ben. »Ich werde jedenfalls studieren. Und dann baue ich Brücken.«
Gracie lachte. »Wenn die mal nicht alle einstürzen. Dann kriegst du wieder Ärger, Benjamin Morrison.«
Verdrossen kickte er einen Stein über das Pflaster. Gracie spielte auf einen Tag im vergangenen Sommer an. Er hatte mit Ed und Mikey zusammen einen Damm gebaut und den Bethel Branche umgeleitet, einen kleinen Flussarm, der im Nirgendwo entsprang und westlich von Selmont wieder in der Erde versickerte. Das Ergebnis waren zwei unter Wasser gesetzte Camping-Trailer und ein vollgelaufener Keller gewesen. Seine Freunde hatten die Konstruktion des Dammes als technische Meisterleistung bewundert, Dad war weniger begeistert gewesen. Ben hatte die schlimmsten Prügel bezogen, die Dad jemals ausgeteilt hatte. Dennoch war er von seinen Fähigkeiten überzeugt. Wer Flüsse stauen konnte, würde irgendwann auch in der Lage sein, Brücken zu bauen. Er drückte das verschnürte Bündel Schulbücher an sich. In ihnen stand alles, was man wissen musste; alles, was nötig war, um Selma hinter sich zu lassen.
Sie hatten die Seitenstraße erreicht, in der das Schulgebäude stand. Ein mannshoher Maschendrahtzaun umgab das Gelände, entlang der Straße spendeten Scharlacheichen Schatten. Während Ben das Pflaster unter seinen Schuhen betrachtete und fieberhaft darüber nachdachte, womit er Gracie beeindrucken könnte, verlangsamte das Mädchen seine Schritte.
»He, was ist da los?«, fragte sie.
Ben hob den Kopf. Hundert Meter vor ihnen, dort, wo sich im Zaun ein Tor befand, durch das man ins Schulgelände gelangte, hatte sich eine Menschenmenge versammelt. Ein Streifenwagen parkte quer zur Fahrtrichtung und versperrte die Straße.
»Vielleicht ist etwas passiert«, sagte Gracie, »ein Unglück oder …«
»Nein«, unterbrach Ben sie, »noch ist nichts passiert. Aber das wird es gleich.«
Er wagte sich so nah heran, bis er einzelne Gesichter unterscheiden konnte. An der Motorhaube des Streifenwagens lehnte ein untersetzter Mann in Polizeiuniform. Er verschränkte scheinbar gelangweilt die Arme vor der Brust. Nur die heftigen Bewegungen seiner Kiefermuskeln, mit denen er einen Kaugummi bearbeitete, verrieten seine Anspannung. An seinem Gürtel hing nicht nur die übliche Dienstwaffe, sondern zusätzlich ein Cattle Prod. Normalerweise benutzte man diese Stöcke, um das Vieh anzutreiben. Der Polizist, der seinen Blick jetzt auf Ben richtete, verwendete ihn auf andere Weise. Aus dem stumpfen Ende des Prods ragten zwei Elektroden, die schmerzhafte Stromstöße ausstießen. Der Mann war gekommen, um seinem Lieblingsvieh Beine zu machen, und dieses Vieh war schwarz. Dazu hatte er ein Dutzend State Trooper zur Unterstützung mitgebracht, die mit unbewegten Mienen die Szene beobachteten.
Ben war dem untersetzten Mann mit den pockennarbigen Wangen und den aufgeworfenen Lippen noch nie persönlich begegnet, aber Dad, Nachbarn und Freunde hatten ihn so gut beschrieben, dass Ben ihn sofort erkannte: Jim Clark, Dallas County Sheriff und Polizeichef von Selma – ein Mann, der über nahezu grenzenlose Macht verfügte, zumindest vom Standpunkt eines Afroamerikaners aus betrachtet. An seinem Hemd war ein Sticker befestigt, auf dem Never stand. Das Wort sollte Clarks Ablehnung der Rassenintegration unterstreichen, eine Forderung, die immer lauter schallte und auch von einem Teil der weißen Bevölkerung unterstützt wurde.
In die Menge weißer Männer kam plötzlich Bewegung, als aus einer Seitenstraße mehrere schwarze Erwachsene auftauchten. Von ihren Kindern begleitet, gingen sie auf den Eingang zum Schulgelände zu.
»Lass uns abhauen«, flüsterte Gracie. »Das geht nicht gut aus.«
Ben focht einen schrecklichen inneren Kampf aus. Er wollte weglaufen und kämpfen zugleich. Gracie hatte recht, es hatte keinen Sinn, sich halb totschlagen zu lassen. Auf keinen Fall wollte er riskieren, dass ihr etwas Böses widerfuhr oder sie gar verletzt wurde wegen seiner Starrköpfigkeit. Trotzdem blieb er stehen, weil er nicht wollte, dass sie ihn für einen Feigling hielt. Er ballte die Fäuste und blinzelte die Tränen fort. Sie waren kein Zeichen von Furcht, sondern offenbarten seinen hilflosen Zorn. Seine Beine schienen ein Eigenleben zu entwickeln und in den Boden hineinzuwachsen. Es war ihm unmöglich, einen Schritt zurückzuweichen.
»Lauf«, sagte er. »Das ist nichts für Mädchen.«
»Jungs bluten genauso, und sie weinen auch, wenn man sie schlägt«, antwortete Gracie trotzig. Sie tastete nach seiner Hand. »Warum willst du dich unbedingt verprügeln lassen?«
Die sanfte Berührung ihrer Fingerspitzen schickte ein süßes Prickeln durch seinen Bauch.
»Komm schon, lass uns gehen.«
Er schüttelte den Kopf. »Ich kann nicht.«
Ben blickte in Gesichter, die die ganze Bandbreite seiner eigenen Empfindungen widerspiegelten – Angst, Wut und Zorn, Entschlossenheit und Unsicherheit. Alle schienen zu wissen, was heute Morgen geschehen würde. Es war unausweichlich, wollten sie nicht das letzte Körnchen Selbstachtung verlieren.
Dad hat nichts davon erwähnt, dachte Ben. Warum ist er nicht hier? Er sollte da sein, neben mir. Vielleicht hatte er auch gewusst, dass es zu neuen Zusammenstößen mit den Weißen kommen würde, aber es war ihm gleichgültig gewesen, so wie ihm alles egal war. Seit Moms Tod schien er innerlich zu versteinern und vergessen zu haben, dass sein Sohn ihn brauchte und er ihm ein Vorbild sein sollte. Aber es gab nichts, was Dad aus seiner Lethargie reißen konnte. Er hatte sich nur Arbeit gesucht, damit er ein paar Bucks verdiente, um sich Alkohol kaufen zu können. Der Whiskey war die einzige Medizin, die seinen Schmerz erträglich machte, ihn aber unweigerlich zugrunde richtete.
Die Weißen bildeten eine Kette und blockierten den Zugang zur Schule. Die State Trooper in ihren Uniformen und weißen Helmen hielten sich im Hintergrund wie Jagdhunde, die nur auf ein Zeichen von Clark warteten, um losschlagen zu dürfen. Die Weißen schüttelten jetzt drohend die Fäuste. Familienväter hielten selbst gemalte Schilder hoch, auf denen Stop the race mixing und Race mixing is communism stand. Bens Herz gefror, als er einen Mann sah, der einen kleinen Sarg emporhielt, in dem eine schwarze Puppe lag. Jugendliche, mit denen Ben noch am vergangenen Freitag im selben Klassenzimmer gesessen hatte, schrien ihm »Hau ab, Niggerkid!« entgegen.
Jemand hatte sie aufgehetzt, bis sie nicht mehr klar denken konnten, und es war nicht schwer zu erraten, wer das gewesen war. Jim Clark löste sich von seinem Streifenwagen und spuckte den Kaugummi aus. Seine Hand fuhr tastend über den Cattle Prod, als wollte er sich überzeugen, dass er einsatzbereit war.
4
Ben presste das Bündel mit den Schulbüchern an seine Brust wie einen Schatz. Er spürte, dass Gracies Finger seine Hand umschlossen.
»Komm schon«, sagte sie.
»Nein.«
»Die State Trooper warten nur darauf, loszuschlagen. Sie prügeln auf jeden ein, der schwarz ist.«
»Das dürfen sie nicht«, sagte Ben. »Sie können uns nicht verbieten, zur Schule zu gehen.«
»Eine eingeschlagene Nase ändert nichts daran. Sie machen sowieso, was sie wollen. Lass uns lieber abhauen. Wir könnten den Morgen am Fluss vertrödeln. Ich kenne eine Stelle, wo …«
Ihre Stimme ging im wütenden Geschrei der Menge unter. Ben umklammerte ihre Hand, er spürte ihre Angst. Den Vormittag mit Gracie zu verbringen, hätte ihn eigentlich in Hochstimmung versetzen sollen, aber nicht heute, nicht jetzt. Er blieb standhaft.
»Wenn wir zulassen, dass sie uns fortjagen, wird sich niemals etwas ändern«, sagte er. »Denk daran, was vergangenen Mai in Birmingham passiert ist.«
»Und was hat es gebracht?« Gracie gab die Antwort selbst. »Gar nichts.«
Ben erinnerte sich an den Frühlingstag, an dem er von den Unruhen in der neunzig Meilen entfernten Stadt im Norden gehört hatte. Dad hatte die Ereignisse mit ihrem Nachbarn, dem alten Jimmy, heftig diskutiert. Ben war zu Johnson’s Elektroladen gelaufen, wo Radios, Waschmaschinen und elektrische Rasierer angeboten wurden – sofern man Geld in der Tasche hatte, um sie bezahlen zu können. Im Schaufenster stand ein Fernsehgerät, das auch nach Ladenschluss lief. Als er ankam, hatte sich bereits eine Menschentraube vor dem Geschäft gebildet.
Mehr als tausend Jugendliche und Kinder – manche nicht älter als sechs Jahre – waren am 2. Mai 1963 nach dem Gottesdienst durch die Straßen gezogen, hatten gebetet und Freiheitslieder gesungen. Der Polizeichef von Birmingham hatte Hunderte von ihnen verhaften lassen. Am nächsten Tag hatten sie sich wieder in der Kirche versammelt. Obwohl die Polizei diesmal die Eingänge blockiert hatte, war etwa die Hälfte der Demonstranten entkommen und hatte erneut protestiert.
Ben sah die Bilder vor Augen, die über den Fernsehschirm geflackert waren: weiße Polizisten, die Schwarze zusammenschlugen, schwarze Kinder, die von Wasserwerfern umgerissen und über die Straße gespült wurden wie Unrat, Polizeihunde, die sich in Demonstranten verbissen. Damals hatte er zum ersten Mal von Martin Luther King gehört. Der Baptistenprediger duckte sich nicht weg, er kämpfte für die Rechte der schwarzen Bevölkerung. Jemanden wie ihn brauchen wir hier, dachte Ben. Einen, der uns anführt. King würde sich jetzt nicht umdrehen und weglaufen.
Die weißen Frauen und Männer, die ihm ihre hasserfüllten Parolen entgegenschleuderten, nahmen Ben die einzige Möglichkeit, Selma zu verlassen und seine Träume zu verwirklichen. Diese Vorstellung versetzte ihn in eine irrsinnige Wut. Er ließ Gracies Hand los und ging auf die geifernde Menge zu, aus der sich drei gleichaltrige weiße Jungen lösten und ihm entgegenkamen. Einer von ihnen war Bill Hancock, der andere Joe Strumner. Der dritte bückte sich beiläufig und hob einen Stein auf, den er prüfend wog.
Vielleicht wäre Ben zurückgewichen, wäre er allein gewesen. Später wusste er nicht mehr zu sagen, ob sein Mut aus dem Zorn darüber geboren war, dass sie ihm den Zutritt zur Schule verweigerten, oder ob er in einem Anfall von hirnverbranntem Größenwahn Gracie hatte beeindrucken wollen. Bill Hancock baute sich dicht vor ihm auf und spuckte aus. Ein Spritzer landete auf Bens Schuhen.
»Verzieh dich, Morrison. Diese Schule ist nur für Weiße.«
»Das ist gegen das Gesetz. Am 17. Mai 1954 hat der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten von Amerika die Rassentrennung in öffentlichen Schulen für verfassungswidrig erklärt.«
Joe lachte höhnisch. Er gehörte zu den schlechten Schülern. Nicht weil er dumm war, sondern weil er weiß und arrogant war und sein Vater im Stadtrat saß. Er schien überzeugt zu sein, dass diese Tatsache ihm das Recht verlieh, faul sein zu dürfen.
»Hör sich einer diesen Klugscheißer an!«, rief er laut.
Doch Ben wusste, wovon er sprach. Er hatte in der Schulbibliothek in einer alten Zeitung darüber gelesen und sich den Wortlaut des Urteils eingeprägt. Es hatte den ganzen Nachmittag gedauert, weil in dem Artikel viele Wörter vorkamen, deren Bedeutung ihm schleierhaft war. Er hatte jedes von ihnen in einem dicken, abgegriffenen Lexikon nachschlagen müssen.
Bill Hancock glotzte ihn verständnislos an, er war nicht der Hellste, sondern ein Großmaul, das seine Blödheit mit den Fäusten überdeckte. Er wusste, dass ihn niemand bestrafen würde, wenn er einen schwarzen Jungenverprügelte. Bill war jede Woche in mindestens eine Schlägerei verwickelt. Mit der Meute hinter sich, die Blut witterte, fühlte er sich stark. Er schnellte vor und stieß Ben gegen die Brust.
»Quatsch keinen Scheiß. Wir sind hier das Gesetz.«
Überrumpelt von dem Angriff, stolperte Ben zurück. Aus dem Augenwinkel sah er den dritten im Bunde – Ed Walker, der einen heimtückischen Bogen schlug und sich Gracie von der Seite näherte. Der rothaarige Junge mit der Zahnlücke war ein Feigling, der sich erst einmischte, wenn seine Kumpane die halbe Arbeit erledigt hatten und er sicher war, keine Prügel zu beziehen.
He! Was hast’n da?«
Ben fuhr herum. Von Ed abgelenkt, hatte er nicht aufgepasst. Joe Strumner zerrte am Riemen von Gracies Tragetasche und riss sie ihr von der Schulter. Ben fuhr herum und versuchte gleichzeitig, Bill und Ed nicht aus den Augen zu verlieren. Wenn er Joe jetzt angriff, würden ihm die anderen in den Rücken fallen.
Joe kippte die Stofftasche aus und verstreute Gracies Sachen auf der Straße. Darunter waren zwei Bücher mit dem Stempel der Schulbibliothek auf dem Umschlag. Sie liest, schoss es Ben durch den Kopf.
Gracie bückte sich nach den Büchern. Sie würde Ärger mit Mrs Green bekommen, wenn auch nur eine Seite durch einen Knick verunziert war. Ben begriff sofort, dass sie einen Fehler beging, denn ihre Haltung musste auf Joe wirken, als kniete sie unterwürfig vor ihm im Staub. Als hätte der weiße Junge Bens Gedanken gelesen, setzte er seinen Schuh auf ihre Schulter und stieß sie zu Boden. Ed lachte hämisch.
»Los, zeig’s ihr, Joe!«, rief Bill.
Die Angst um Gracie ließ Ben kalt und klar denken. Bill war der Wortführer, er war es, den er zuerst ausschalten musste. Er drehte sich blitzschnell um und schlug dem fetten Jungen auf die Nase. Bill heulte auf. Blut schoss aus seiner Nase und tropfte auf den Asphalt. Es war das erste Blut, das an diesem Tag floss, und es ließ die aufgeheizte Stimmung in hemmungslose Gewalt umschlagen. Drei Schwarze diskutierten aufgeregt mit Jim Clark und umringten ihn. Aus Bens Perspektive sah es so aus, als würden sie ihn gegen den Streifenwagen drängen. In Wahrheit wich er vermutlich nur vor ihnen zurück, weil er nicht damit gerechnet hatte, wie entschlossen sie für ihre Rechte eintraten. Der Polizeichef zog den Cattle Prod aus dem Gürtel. Die Geste war offenbar das vereinbarte Signal für die State Trooper. Sie begannen, mit ihren Gummiknüppeln wahllos auf die Schwarzen einzuprügeln. Dabei machten sie keinen Unterschied, ob es sich um Männer, Frauen oder Kinder handelte. Durch die Gewalt angestachelt, beteiligten sich nun auch die Weißen, die den Zugang zum Schulgelände blockiert hatten, an der Schlägerei. Auf der Straße brach Chaos aus. Menschen flohen vor den prügelnden Polizisten, andere setzten sich zur Wehr oder brachten ihre Kinder in Sicherheit. Die Luft war erfüllt von Schmerzensschreien, Flüchen und wütenden Beschimpfungen.
Aus einer Seitenstraße erhielt die Fraktion der Schwarzen Verstärkung, darunter Gracies Bruder Samuel. Er war ein Riese, hatte aber ein sanftes Gemüt und arbeitete als Diakon für die Methodistenkirche von Selma. Rasch erfasste er die Situation, kam auf Gracie zu und legte schützend seine Hand auf ihre Schulter. Keiner der drei weißen Jungen würde es jetzt noch wagen, sie anzufassen. Ihre Wut konzentrierte sich stattdessen auf Ben. Sie hatten sich von dem Schock seines Angriffs erholt und begannen, ihn einzukreisen.
Nun, wo er Gracie in Sicherheit wusste, drehte sich Ben um und rannte die Straße entlang Richtung Fluss, bevor die Jungen ihm den Weg abschneiden konnten. Doch er hatte Eds Heimtücke unterschätzt. Er war zwar feige, aber ein guter Werfer. Als Shortstop spielte er in der Baseballmannschaft der Schule.
Ein Kieselstein traf Ben hinter dem rechten Ohr. Der Schmerz ließ ihn taumeln. Er spürte ein warmes Rinnsal an seinem Hals herablaufen, vor seinen Augen drehte sich die Main Street.
Er blieb stehen und blickte zurück. Unter den Anfeuerungen seiner Freunde klaubte Ed weitere Steine vom Boden auf und feuerte sie auf Ben ab. Seine Kumpane spurteten los und nahmen die Verfolgung auf. Niemand würde die Jungen zur Rechenschaft ziehen, denn später würde keiner mehr sagen können, wer wann welchen Streit begonnen hatte. Wen kümmerte es schon, welche Anschuldigungen ein schwarzer Junge aus Selmont erhob?
Ben lief im Zickzack durch das Schachbrettmuster der Nebenstraßen. Wenn sie ihn erwischten, würde er mehr als die üblichen Prügel beziehen. Blutdurst lag in der Luft und wirkte ansteckend wie ein Virus, das die Leute in Mörder verwandelte. Ben war ein guter Läufer, und die Angst verlieh ihm Flügel. Trotzdem konnte er das hohe Tempo nicht mehr lange durchhalten. Er hörte das Tappen schneller Schritte auf dem Asphalt und sah über die Schulter. Joe blieb stehen, um es Bill gleichzutun, und sammelte Steine aus dem Kieshaufen einer Baustelle. Weit hinter ihm näherte sich der fette Bill. Er hechelte wie ein Setter in der Hundstagssonne und schrie etwas, was Ben nicht verstehen konnte. Daraufhin teilten sich Joe und Ed auf und versuchten, Ben zu fassen zu bekommen. Ein Stein traf ihn an der Wade, ein zweiter an der Hüfte. Es tat höllisch weh. Er rannte weiter, bis seine Lungen brannten, schlug Haken, lief durch enge Straßen und Hinterhöfe und kletterte über Mauern und Zäune.
Aus dem Schatten einer Gasse tauchte plötzlich Joe Strumner auf. Ben konnte ihm nicht mehr ausweichen. Er kam zu Fall, überschlug sich und schürfte sich auf dem rauen Pflaster die Handflächen auf. Das Bündel mit den Schulbüchern flog durch die Luft, bis es schließlich vor Joes Füßen landete. Er hob es auf und schwenkte es triumphierend. Dann begann er, Seiten aus den Büchern zu reißen. Ben rappelte sich auf, wollte sich auf ihn stürzen, aber Bill hatte inzwischen aufgeholt.
Ben flüchtete in die Gasse hinein, aus der Joe gekommen war, stieß zwei Mülltonnen hinter sich um, rannte weiter und erreichte einen ruhigen Bereich der Innenstadt, der von den Unruhen noch nicht betroffen war. Zerrissene Bücher schmerzten, aber eine gebrochene Nase war schlimmer.
Am Straßenrand parkte ein Streifenwagen, zwei Cops lehnten an der Motorhaube. Ben hörte, dass sie sich über die Blockade der Schule unterhielten.
Hinter ihm tauchten Bill und Joe auf. Sie waren nur noch fünf Meter von ihm entfernt. Ben ging zögernd auf die Polizisten zu. Sie schienen die Situation auf einen Blick zu erfassen, griffen aber nicht ein. Der Ältere der beiden schüttelte unmerklich den Kopf und gab seinem Kollegen zu verstehen, dass er in den Wagen steigen sollte. Die Geste war klar: Die Auseinandersetzung ging sie nichts an. Sie würden Ben nicht beistehen und wollten auch nicht Zeuge sein, wie weiße Jungen einen Schwarzen verprügelten.
Die Hauptstraße war nicht stark befahren, aber dennoch nicht ohne Gefahr zu überqueren. Von links rollte ein Bus heran, von rechts näherte sich ein rostiger Buick. Ben spurtete los. Der Fahrer des Busses bremste und hupte. Ben schlug einen Haken, wich in letzter Sekunde dem Buick aus und erreichte die andere Seite. Er lief ein paar Meter Richtung Norden über den Gehweg auf der Suche nach einem Versteck. Noch wagten es seine Verfolger nicht, die Straße zu überqueren. Er sah aus dem Augenwinkel, dass Bill vor Ungeduld zappelte.
Ben lief an einem Gemüseladen, einer Drogerie und einem Diner vorbei und stand plötzlich vor Campbell’s Books. Oft schon hatte er sich die Nase an der Schaufensterscheibe platt gedrückt und die Bücher in der Auslage bewundert. Was vom geringen Lohn seines Dads übrig blieb, reichte gerade, um Lebensmittel zu kaufen. Mehr als einmal war Ben versucht gewesen, etwas abzuzweigen, um es für Bücher auszugeben, aber sobald er vor dem Laden stand, verließ ihn der Mut. Wenn Dad dahinterkam, würde er ihn grün und blau schlagen.
Und dann war da noch Josh Campbell, der Besitzer des Buchladens. Campbell war dürr wie ein vertrockneter Ast. Ein Rückenleiden zwang ihn in eine vorgebeugte Haltung, sein Geist jedoch war wach und scharf. Manchmal kam es Ben so vor, als ob der alte Mann mit der Nickelbrille und dem schütteren grauen Haar jedes Buch kannte, das jemals geschrieben worden war. Er schien jeden Quadratzentimeter der vollgestopften Regale in seinem fotografischen Gedächtnis abgespeichert zu haben. Campbell behauptete, jeden Satz aus den Werken eines gewissen Shakespeare frei zitieren zu können.
Dass ein Mann, der über so viel Bildung verfügte, keine Schwarzen in seinem Laden duldete, konnte Ben nicht begreifen. Gracie meinte, der Buchhändler hasse alle Schwarzen, weil ihn eine schwarze Gang überfallen, ausgeraubt und so schwer verprügelt hatte, dass er seitdem nicht mehr aufrecht gehen konnte.
Ben blickte sich um. Bill Hancock und Joe Strumner nutzten eine Lücke im fließenden Verkehr, um die Straße zu überqueren. Ed hielt sich dicht hinter ihnen. Ben drückte die Tür zu Campbell’s Buchladen auf und schlüpfte ins Innere, wo ihn das Dämmerlicht verschluckte. Die Messingstäbe eines Windspiels schlugen leise aneinander, ein helles Läuten erklang.
Ben tauchte in die Schatten zwischen den Regalen ein und hoffte, dass Campbell ihn so lange übersah, bis die Jungen ihre Suche nach ihm aufgaben. Sein Herz hämmerte so laut gegen die Rippen, dass er befürchtete, der alte Buchhändler könnte es hören. Ängstlich beobachtete er die Straße. Bill und Joe hatten den Gehweg erreicht und sahen sich unschlüssig um.
»Was hast du hier zu suchen?«
Erschrocken fuhr Ben herum. Campbell stand hinter ihm und überragte ihn wie ein schief gewachsener, knorriger Baum.