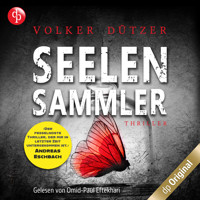5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dp DIGITAL PUBLISHERS GmbH
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Welchen Preis hat dein Leben?
Der spannungsgeladene Thriller voller Nervenkitzel von Volker Dützer
Die neurotische Jule Rahn lebt in einem Käfig aus Angst und Zwangshandlungen, ihre Wohnung verlässt sie nur auf zuvor exakt festgelegten Wegen. Als sie Zeugin eines Mordes wird, gerät ihr streng geregeltes Leben aus den Fugen und sie ist fortan auf der Flucht. Denn der Täter lässt nichts unversucht, um sie zum Schweigen zu bringen. Doch der Mann mit der Narbe ist nicht Jules einziges Problem. Bald wird ihr klar, dass in ihrem Umfeld Menschen spurlos verschwinden. Als sie den Mordermittler Lucas Prinz um Hilfe bittet, schenkt dieser ihrer Geschichte keinen Glauben, denn nach seinen Erkenntnissen starb das Mordopfer bereits vor einem halben Jahr …
„Der fesselndste Thriller, der mir in letzter Zeit untergekommen ist.“ Andreas Eschbach
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 522
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über dieses E-Book
Die neurotische Jule Rahn lebt in einem Käfig aus Angst und Zwangshandlungen, ihre Wohnung verlässt sie nur auf zuvor exakt festgelegten Wegen. Als sie Zeugin eines Mordes wird, gerät ihr streng geregeltes Leben aus den Fugen und sie ist fortan auf der Flucht. Denn der Täter lässt nichts unversucht, um sie zum Schweigen zu bringen. Doch der Mann mit der Narbe ist nicht Jules einziges Problem. Bald wird ihr klar, dass in ihrem Umfeld Menschen spurlos verschwinden. Als sie den Mordermittler Lucas Prinz um Hilfe bittet, schenkt dieser ihrer Geschichte keinen Glauben, denn nach seinen Erkenntnissen starb das Mordopfer bereits vor einem halben Jahr …
„Der fesselndste Thriller, der mir in letzter Zeit untergekommen ist.“ Andreas Eschbach
Impressum
Überarbeitete Neuausgabe Dezember 2023
Copyright © 2025 dp Verlag, ein Imprint der dp DIGITAL PUBLISHERS GmbH Made in Stuttgart with ♥ Alle Rechte vorbehalten
E-Book-ISBN: 978-3-98778-408-8 Hörbuch-ISBN: 978-3-98778-421-7
Copyright © 2019, beThrilled Dies ist eine überarbeitete Neuausgabe des bereits 2019 bei beThrilled erschienenen Titels Das Ambrosia-Experiment (ISBN: 978-3-73256-700-3).
Covergestaltung: Verena Kern unter Verwendung von Motiven von shutterstock.com: © A-Star, © maradon 333 Korrektorat: Birgit Förster
E-Book-Version 18.03.2025, 14:45:44.
Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Sämtliche Personen und Ereignisse dieses Werks sind frei erfunden. Etwaige Ähnlichkeiten mit real existierenden Personen, ob lebend oder tot, wären rein zufällig.
Abhängig vom verwendeten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Unser gesamtes Verlagsprogramm findest du hier
Website
Folge uns, um immer als Erste:r informiert zu sein
Newsletter
TikTok
YouTube
Seelensammler
Jetzt auch als Hörbuch verfügbar!
Welchen Preis hat dein Leben?Der spannungsgeladene Thriller voller Nervenkitzel von Volker Dützer
Für Agentin 00A, die es wieder mal geschafft hat.
I wish I never woke up this morning.
Life was easy when it was boring.
(The Police, Darkness)
1
Der 2. November war kein gewöhnlicher Tag im Leben von Jule Rahn, obwohl er begann wie jeder andere. Jeden Morgen setzte sie den linken Fuß neunhundertdreiundzwanzig Mal vor den rechten, um von der Bushaltestelle am Deutschen Eck zu ihrem Arbeitsplatz im Paracelsus-Labor zu gelangen. Jeden Nachmittag nahm sie denselben Weg zurück. Jule mochte Ordnung. Das Unbekannte, Unvorhersehbare jagte ihr eine Höllenangst ein.
An diesem Montagnachmittag war sie jedoch entschlossen, zum ersten Mal von ihrer exakt berechneten Route abzuweichen. Um die lähmende Angst niederzuringen, bediente sie sich unterschiedlicher Rituale. Sie gaben ihr das Gefühl, dass alles so war, wie es sein sollte. Eines dieser Rituale war das Zählen ihrer Schritte. Das Flüstern der Zahlen, die sich ordentlich wie Perlen auf einer Schnur aneinanderreihten, half ihr, die stets am Rand ihres Bewusstseins lauernden Panikattacken von sich fernzuhalten. Wenn sie einen Fuß auf die Erde setzte, wiederholte sie in Gedanken stumm ihr Mantra: Es kann nicht passieren, nichts passieren, nichts passieren.
Jule war nicht dumm, sie wusste, dass ihr Verhalten nicht normal war, aber sie kämpfte gegen den mächtigsten Gegner, dem sich ein Mensch stellen muss: die eigene Angst.
Der Drang, den Käfig ihrer Zwangshandlungen zu sprengen, war heute so stark wie nie zuvor. Die meisten Tage waren grau, aber dieser war von einem satten Blau erfüllt. So tiefblau wie ein wolkenloser Himmel an einem heißen Sommertag. Blau bedeutete Hoffnung, daher wollte sie den seltenen Anfall von Mut nicht ungenutzt verstreichen lassen.
Mit gesenktem Kopf wich sie den wenigen Passanten aus. Ein scharfer Wind wehte von Norden her über das Rheintal und zwang die Leute, ihre geröteten Nasen und Wangen hinter wärmenden Schals zu verbergen. Der Winter kam früh in diesem Jahr.
Als sie sich allein glaubte, verlangsamte sie ihre Schritte und blieb schließlich stehen. Benutzte sie weiterhin den Uferweg, würde sie nach exakt vierhundertsechzehn weiteren Schritten die Bushaltestelle erreichen. Nichts Außergewöhnliches würde dann geschehen und der Tag wie alle anderen zu Ende gehen.
Zu allem entschlossen, wandte sie sich nach links. Eine Gasse führte zu einer parallel zum Fluss verlaufenden Straße. Folgte sie ihr, würde sie auf eine Gasse treffen, die am Zusammenfluss von Rhein und Mosel endete. Ein kleiner Umweg, ein Kinderspiel, keine große Sache.
Es kann nichts Schlimmes passieren, nichts passieren, nichts passieren.
Einen Umweg von fünfhundert Metern in Kauf zu nehmen erforderte von niemandem Heldenmut. Für Jule allerdings bedeutete der Entschluss ein Abenteuer mit ungewissem Ausgang, ein ungeheures Wagnis, ein tollkühnes Unterfangen.
Vorsichtig, als würde sie sich in einen Dschungel voller tödlicher Gefahren hineinwagen, setzte sie einen Fuß vor den anderen und entfernte sich immer weiter von ihrer gewohnten Strecke. Ihre Hoffnung stieg, das Gefängnis ihrer Zwangsneurosen für kurze Zeit verlassen zu können, doch nach sechsundachtzig Schritten prallte sie gegen eine unsichtbare Mauer. Ein erdrückendes Gewicht senkte sich auf ihre Brust und machte jeden Atemzug zur Qual. Sie blieb so plötzlich stehen, als wäre sie gegen die Gitterstäbe eines imaginären Käfigs gestoßen. Jule fühlte sich wie eine der Mäuse, die in dem Labor, in dem sie arbeitete, für medizinische Versuche benutzt wurden. Sie irrte im Labyrinth ihrer Furcht umher und suchte panisch nach dem Ausgang, ohne Aussicht, ihn jemals zu finden. Die kümmerliche Handvoll Mut, die sich in ihr Herz verirrt hatte, schmolz zusammen wie Schnee in der Frühlingssonne. Wie hatte sie nur glauben können, auszubrechen würde auf eine so einfache Weise funktionieren?
Sie drehte vor der eingebildeten Barriere um und ging zum Uferweg zurück. Jule Rahn, die kleine menschliche Lokomotive, hatte dreist versucht, von den Schienen zu hüpfen. Wo doch jeder wusste, dass ein entgleisender Zug auf eine Katastrophe zusteuerte.
Jule presste die Lippen zusammen und eilte weiter. Enttäuscht wischte sie eine Träne fort, die sich in ihren Augenwinkel verirrt hatte.
Abgesehen von dem Mann, der auf einer Bank saß, war der Uferweg menschenleer. Die Augen auf den nassen Asphalt gerichtet, ging sie zögerlich weiter. Als sie die Bank erreichte, warf sie dem Mann einen scheuen Blick zu und beschleunigte ihre Schritte. Er war hager wie ein trockener Ast. Die Stoffhose und der weite Wintermantel schlotterten um seine ausgezehrte Gestalt. Ohne ihn anzusehen, spürte sie, dass er den Kopf hob und sie anstarrte. Unbeirrt lief sie weiter, denn er war so wenig real wie die unüberwindliche Mauer der Angst. Manchmal tauchte er monatelang nicht auf, dann wieder quälte er sie im Abstand weniger Tage. Seit vergangenem Freitag hatte sie ihn drei Mal gesehen, so kurz hintereinander wie nie zuvor. Dr. Gottfried hatte ihr erklärt, warum sie ihn und die anderen sah – die Frau mit dem toten Kind auf dem Arm, den blutenden Jungen und die blonden Zwillinge. Es hatte etwas mit Schuldgefühlen zu tun. Jule hatte die Visionen ignoriert, doch je heftiger sie sie verdrängte, desto öfter quälten sie sie. Seit sie begonnen hatte, im Labor mit Menschen zu reden, die nicht da waren, musste sie ihre Therapiestunden ernster nehmen. Sie mochte ihren Job, er war alles, was sie hatte. Niemand wollte eine verrückte Laborantin beschäftigen, die tote Menschen sah, also musste sie sich zusammenreißen und damit aufhören.
Die kahlen Zweige der Weiden klapperten wie von der Sonne gebleichte Knochen im Novemberwind. Zwei Nilgänse segelten tief über das Wasser und steuerten in einem eleganten Bogen auf die andere Rheinseite zu. Die Vögel flogen, wohin sie wollten. Jule zählte Schritte.
Sie ging unter der Horchheimer Brücke hindurch. Menschen fuhren darüber hinweg und gingen ihren alltäglichen Geschäften nach, ohne zu ahnen, welche Seelenqualen die unscheinbare junge Frau tief unter ihnen am Rheinufer ausstand.
Unvermittelt traf Jule das Schicksal mit der Wucht einer Sturmbö, die ihr Leben wie einen Haufen welkes Laub durcheinanderwirbelte. Ein schwerer Gegenstand klatschte neben ihr in den Fluss, ein schmutziger brauner Sprühregen benetzte ihren Mantel. Im flachen Wasser trieb bäuchlings ein menschlicher Körper. Der mit spärlichem grauem Haar bedeckte Kopf ruhte – das Gesicht von ihr abgewandt – auf der mit Grauwacke bewehrten Uferböschung. Aus einer Wunde am Hinterkopf sickerte Blut und sammelte sich in einer Lache zwischen den Steinen. Der Kleidung nach zu urteilen, handelte es sich um einen Mann. Er trug eine beigefarbene Regenjacke, eine graue Hose und abgewetzte braune Schuhe, die auf dem Wasser wippten wie Papierschiffchen. Die Strömung zerrte an den Beinen des Toten. Denn tot musste er sein. Niemand konnte einen solchen Sturz überleben.
Jule starrte auf die Leiche, ohne zu begreifen, was geschehen war. In einer mechanischen Bewegung legte sie den Kopf in den Nacken und blickte zur Eisenbahnbrücke hinauf. Eine Gestalt beugte sich über das Geländer des Fußwegs neben den Schienen. Der Mann trug eine dunkle Steppjacke und eine Wollmütze, ein blauschwarzer Bartschatten bedeckte seine hohlen Wangen. Er sah sie an. Jule hatte das Gefühl, als ob er mühelos durch sie hindurchblicken und ihre Gedanken lesen konnte – ein wildes Durcheinander aus Unsicherheit, Angst und Schrecken.
Der Tote im Wasser hatte seinen Sturz nicht durch Leichtsinn herbeigeführt. Er hatte auch nicht selbst sein Leben beenden wollen. Instinktiv erkannte Jule die Verbindung zwischen den beiden Männern – eine mörderische Verkettung, zu der nun auch sie gehörte.
Sie kniff die Augen zusammen und öffnete sie sogleich wieder. Das Gesicht über dem Brückengeländer hatte sich aufgelöst wie ein Spuk. War der Mann real gewesen oder auch nur ein Trugbild ihrer traumatisierten Seele? Sie blickte zum Ende der Brücke, wo eine stählerne Wendeltreppe nach unten zum Uferweg führte. Die obersten Stufen erzitterten unter dem Gewicht schwerer Stiefel. Gespenster verursachten keinen Lärm in der Welt der Lebenden. Jule wandte sich um und hatte nur einen Gedanken: Fort! Sie hatte etwas gesehen, das nicht für ihre Augen bestimmt gewesen war, und sie würde einen furchtbaren Preis dafür bezahlen, wenn ihr Verfolger sie einholte.
Sie rannte, bis ihre brennenden Lungen sie zwangen, langsamer zu gehen. Immer wieder blickte sie sich um. Da sie den Mann nicht mehr sah, wuchs in ihr die Hoffnung, ihn abgeschüttelt zu haben, doch da prallte sie unvermittelt mit einer dicken Frau zusammen, die einen Rauhaardackel spazieren führte. Jule murmelte eine Entschuldigung und hetzte weiter. Die Frau rief ihr eine Beleidigung hinterher, der Dackel kläffte wütend.
Es kann nichts passieren, nichts passieren.
Ihre hilflosen Versuche, sich selbst Mut zuzusprechen, kamen ihr im Licht dessen, was soeben geschehen war, lächerlich und unwirklich vor. Genauso surreal wie der Mord, den sie beobachtet hatte. Was sie gesehen hatte, musste ein Trugbild ihrer überreizten Nerven gewesen sein, das war die einzige Erklärung. Solche Dinge passierten in Romanen oder Filmen, aber nicht im wirklichen Leben. Wenn sie jetzt umkehrte, würde sie nichts weiter vorfinden als den träge dahinfließenden Rhein – aber keine Leichen und keine finster blickenden Männer, die sie verfolgten.
Jule erinnerte sich an das Poltern auf der Wendeltreppe. Nein, was sie erlebt hatte, war real gewesen. Und daher war auch die Gefahr real, dass sie dem Toten im Rhein Gesellschaft leisten würde, wenn der Mörder sie einholte.
Sie erreichte den menschenleeren Schlossvorplatz. Der Wind wirbelte trockenes Herbstlaub über das Pflaster und heulte um die Eisenstäbe des Zauns, der den Platz zur Straße hin abgrenzte. Sie drehte sich im Kreis, bis ihr schwindelig wurde. Auf der freien, ebenen Fläche würde ihr Verfolger sie so deutlich erkennen wie einen Blutfleck auf einer weißen Tischdecke.
Auf der Suche nach einem Versteck lief sie bis zum Schloss und betrat das Foyer in der Absicht, auf der anderen Seite durch die Gartenanlagen zum Rheinufer zurückzukehren. Von dort waren es nur wenige Minuten bis zur Bushaltestelle. Sie hoffte, dass ihr Verfolger so endgültig ihre Spur verlieren würde.
Bevor sie jedoch die Glasfront auf der dem Rhein zugewandten Seite des Gebäudes erreicht hatte, fiel hinter ihr eine Tür ins Schloss. Das Echo hallte wie ein Schuss durch das leere Foyer, Schritte näherten sich. Eine raue Männerstimme summte leise eine Melodie. Jule blieb gerade genug Zeit, um sich in den Toiletten zu verstecken. Sie schloss sich in einer Kabine ein und wartete. Kein Laut drang von draußen herein. Ihr Herz pochte wild wie eine aus dem Takt geratene Standuhr. Sie war fest davon überzeugt, dass er ihren Herzschlag hören musste, obwohl das unmöglich war.
Der Sekundenzeiger ihrer Armbanduhr umrundete mit quälender Langsamkeit das Zifferblatt. Sie konnte sich nicht ewig hier verstecken. Vielleicht hatte sie sich geirrt und der Unbekannte im Foyer war ein harmloser Tourist. Sie hatte nicht gesehen, wie er das Schloss betreten hatte. Vielleicht gehörte die Stimme auch einem Mitarbeiter der Stadt oder einer Reinigungskraft. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Doch sie durfte sich nicht von einer möglicherweise falschen Vermutung leiten lassen, ihr Leben hing davon ab, ob sie die richtige Entscheidung traf.
Als sie zu glauben begann, dass der Unbekannte das Foyer längst wieder verlassen hatte, öffnete sie leise die Kabinentür. Der Waschraum war leer. Sie schlich bis zum Toiletteneingang, zog die Tür einen Spalt auf und spähte hinaus. Der Mann, den sie auf der Brücke gesehen hatte, schlenderte durch das Foyer und spießte mit seinen Blicken jedes Detail auf. Er hatte ein asketisches Gesicht mit einer scharfen, vorspringenden Nase und dicht zusammenstehenden Augen. Von den Mundwinkeln liefen zwei Falten bis zum Kinn, die seiner Miene Ähnlichkeit mit den starren Zügen einer Marionette verliehen. Jule biss sich in den Handrücken und unterdrückte einen Schrei. Von seinem linken Ohr bis zum Kinn zog sich eine feuerrote, dünne Narbe. Seine Hände steckten in schwarzen Lederhandschuhen. Er ballte die Fäuste und verriet damit seine innere Anspannung. Das Leder knirschte und jagte Jule einen kalten Schauer über den Rücken. Diese Hände hatten einen Menschen getötet. Und sie würden es, ohne zu zögern, wieder tun, wenn ihr Besitzer die Augenzeugin seiner Tat entdeckte. In einer direkten Auseinandersetzung mit ihm wäre sie hoffnungslos unterlegen.
Er blieb in der Mitte des Foyers stehen, blickte sich suchend um und starrte dann auf den Eingang zu den Toiletten. Jule schreckte zurück, presste sich mit dem Rücken fest an die Wand und wünschte sich, mit ihr zu verschmelzen. Wenn er den Waschraum durchsuchte, würde er sie sofort entdecken. Hier gab es nirgendwo ein Versteck, und die Zugangstür ließ sich nicht verriegeln.
Sie hörte das hohle Geräusch seiner Schritte auf den glatten Bodenfliesen … und dann plötzlich den Klingelton eines Mobiltelefons. Er blieb stehen und meldete sich mit einer trockenen Stimme, die wie das Rascheln von verbranntem Papier klang.
Jule riskierte einen weiteren Blick durch den Türspalt. Der Mann stand nun etwa sechs Meter links von ihr und drehte ihr den Rücken zu. Eine bessere Chance zu entwischen würde sie nicht bekommen. Lautlos schlüpfte sie aus dem Waschraum und schlich auf die Glastüren zu, die zum Rheinuferweg führten. Wenn er sich jetzt umdrehte, würde er sie sofort sehen. Doch sie hatte Glück. Unbemerkt verließ sie das Foyer und durchquerte den Schlossgarten. So schnell ihre Beine sie trugen, lief sie am Fluss entlang, wich im letzten Moment einer alten Frau mit einem Rollator aus, rempelte Passanten an und rannte kopflos weiter.
Gegen 17 Uhr erreichte sie die Haltestelle am Deutschen Eck. Der Bus, den sie an grauen Tagen benutzte, war bereits vor zwanzig Minuten abgefahren. Sie musste auf den nächsten warten, der erst in einer halben Stunde eintreffen würde. Blieb sie allerdings zu lange am selben Ort, stieg die Gefahr, dass der Mann mit der Narbe sie aufspürte.
Atemlos hetzte sie Richtung Innenstadt. Dort hoffte sie auf zahlreiche Passanten zu treffen, auf gut besuchte Ladenpassagen und Cafés, wo sie in der Menge untertauchen konnte. Ihre Angst vor überfüllten Geschäften und dicht gedrängten Menschenmassen war geringer als die Furcht vor dem Mörder. Er musste davon ausgehen, dass sie sich sein Gesicht eingeprägt hatte, sonst wäre er ihr nicht gefolgt. Dass sie Hals über Kopf vor ihm geflohen war, würde ihm außerdem beweisen, dass sie begriffen hatte, was er getan hatte. Er konnte es sich gar nicht leisten, sie am Leben zu lassen.
Jule überquerte den Zentralplatz und betrat das Mittelrheinforum. Ihre Brillengläser beschlugen in der warmen Luft. Hastig nahm sie die Brille ab und wischte sie sauber. Da sie normalerweise jede Menschenansammlung mied, waren ihre Sinne von der Vielzahl der Eindrücke überfordert. Menschen redeten durcheinander, ein Kind schrie mit heller Stimme, aus versteckten Lautsprechern dudelte Musik. Über großformatige Bildschirme flackerten Werbespots. Aus einem Imbiss drang der Geruch von Frittierfett, und die Ausdünstungen zahlloser Menschen umströmten sie.
Sie durfte nicht stehen bleiben, der Mann mit der Narbe würde sie sofort sehen, falls er hierherkam. Also lief sie auf eine der Rolltreppen zu und fuhr nach oben. Orientierungslos hastete sie weiter und gelangte auf eine umlaufende Galerie, die von Boutiquen und kleinen Läden gesäumt wurde. Hier oben herrschte kaum Betrieb, aber die Geschäfte boten eine Vielzahl von Verstecken.
In der Anwesenheit fremder Menschen überkam sie stets ein beklemmendes Gefühl, das schnell zu Schwindel und Panikattacken führte. Sie hatte gelernt, mit ihren neurotischen Ängsten zu leben und sie als Teil ihres Selbst zu akzeptieren. Der Preis, den sie dafür zahlte, waren Einsamkeit und verpasste Chancen. Die Vorstellung, fortan ein Leben auf der Flucht zu führen, ließ die unterdrückte Verzweiflung aus ihr hervorbrechen.
Vielleicht ließ der Unbekannte von ihr ab, wenn er merkte, dass sie nichts gegen ihn unternahm. Aber machte sie sich nicht strafbar, wenn sie verschwieg, was sie gesehen hatte? Hatte das Opfer möglicherweise noch gelebt? Hätte der Mann gerettet werden können, wenn sie nicht geflohen wäre, sondern einen Notarzt herbeigerufen hätte?
Sie beruhigte sich damit, dass niemand den Sturz aus fünfzehn Metern Höhe überlebte. Schon gar nicht, wenn er auf einen Stein prallte und ein faustgroßes Loch im Kopf hatte.
Sie zwang sich, an den Schaufenstern entlangzuschlendern, um sich nicht von den anderen Passanten zu unterscheiden. Jemand drückte ihr den Werbeflyer eines Speed-Dating-Cafés in die Hand, das in Kürze eröffnen würde. Hastig steckte sie den Flyer in ihre Manteltasche. Die Vorstellung, in einem solchen Café im Minutentakt die Bekanntschaft fremder Männer zu machen, erschreckte sie fast mehr als der Gedanke an das grausame Erlebnis am Fluss.
Wie konnte jemand an solch unwichtige Dinge wie Speed-Dating auch nur denken? Wie konnte überhaupt jemand an etwas anderes denken als an dunkel gekleidete Männer mit fürchterlichen Narben, die alte Menschen von Brücken warfen?
Was mochte der Alte getan haben, um bei dem Täter eine so große Wut zu erzeugen? Oder war er einfach zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen und Opfer eines Raubüberfalls geworden? Sie würde es wohl nie erfahren. Und sie wollte es auch nicht wissen. Alles sollte so bleiben, wie es war, und sich nicht verändern. Nur ein vorhersehbares, langweiliges Leben ließ sich kontrollieren. Chaos bedeutete Unsicherheit, Gefahr, Angst und Panik.
Sie versuchte, sich damit zu trösten, dass sie in einer großen Stadt wohnte. Über hunderttausend Menschen lebten in Koblenz. Die Chancen, dass er sie niemals finden würde, standen nicht schlecht. Er kannte weder ihren Namen noch ihre Telefonnummer und wusste nicht, wo sie arbeitete. Je länger sie sich vor ihm verbergen konnte, desto mehr würde seine Erinnerung an ihr Gesicht verblassen.
Doch dann blitzte ein neuer, erschreckender Gedanke in ihrem Kopf auf: Ihm musste nun klar sein, dass sie den Rheinuferweg zu einer bestimmten Uhrzeit benutzte. Er könnte ihr dort auflauern, morgen oder an einem anderen Tag, wenn sie nicht mehr damit rechnete. Ihr Leben war aus den Fugen geraten wie ein entgleister Zug. Keine Macht der Welt konnte die kleine Lokomotive Jule Rahn wieder in die Spur zurückheben. Es war vorbei. Sie würde in eine andere Stadt ziehen, eine neue Arbeitsstelle suchen müssen.
Aber das war unmöglich. Einen geringfügig anderen Weg zum Labor zu nehmen, hatte sie bereits an die Grenzen ihrer psychischen Belastbarkeit geführt. Sie würde niemals in der Lage sein, ihr Leben so umfassend neu zu gestalten. Sie konnte lediglich Kleinigkeiten in ihrem Alltag verändern, die andere Menschen überhaupt nicht bemerken würden. Mit ihrer eigenen Unfähigkeit zur Veränderung sprach sie selbst das Todesurteil über sich.
Aber es gab noch eine Alternative. Die Polizei musste ihr helfen. Wenn sie die Wahrheit berichtete, würden die Beamten keine andere Wahl haben, als den Mörder aufzuspüren. Ja, sie würde der Polizei erzählen, was sie gesehen hatte. Das war der Ausweg! Sie würden den Mörder jagen, ihn fassen und für immer wegsperren. Dann drohte ihr keine Gefahr mehr.
Jule senkte den Kopf und verkrampfte die Finger ineinander. Nein, es würde nicht funktionieren. Sie würden sie auslachen. Sie würden davon ausgehen, dass der Mann Opfer eines Unglücks war, oder ihn für einen Selbstmörder halten. Warum sollte jemand einen alten Mann von einer Brücke in den Rhein stoßen? Die Vorstellung war geradezu absurd. Sie würden sie für eine hysterische alte Jungfer halten, die sich wichtigmachen wollte, die um Aufmerksamkeit bettelte, weil ihr Leben langweilig und fad war wie eine Tütensuppe. Wie ein grauer Tag.
Der Vorführer in Jules Kopf setzte unaufhaltsam sein destruktives Kino in Gang. Irgendwann würden sie ihre Leiche im Rhein finden, mit einem ausgefransten, tödlichen Loch im Kopf.
„Sie hat wohl doch die Wahrheit gesagt“, hörte sie den Kommissar sagen. „Ein Jammer, dass wir ihr nicht geglaubt haben. Aber wer hätte das ahnen können?“
Unschlüssig, was sie nun unternehmen sollte, trat Jule an die Brüstung der Galerie. Drei Stockwerke unter ihr schimmerte der auf Hochglanz polierte Boden der Eingangshalle. Was es wohl für ein Gefühl war, zu sterben? Was hatte der alte Mann empfunden, als er über das Geländer gestürzt war? Es hieß, ein Sterbender sähe sein Leben in Sekunden an sich vorüberziehen. Hatte er Zeit gehabt, um über sein Leben nachzudenken? Wahrscheinlich dachte man gar nichts. Es passierte wie alles andere, einfach so. Keine große Sache.
Sie beugte sich über das Geländer und schauderte. Plötzlich hatte sie das Gefühl, dass jemand dicht hinter ihr stand und sie anstarrte. Sie fuhr herum. Graue Augen betrachteten sie teilnahmslos. Die feuerrote Narbe leuchtete grell auf der blassen Haut. Vor ihr stand der Mann, den sie auf der Brücke gesehen hatte.
2
Lucas Prinz lehnte an der Motorhaube der Rostlaube, die ihm der Gebrauchtwagenhändler in Frankfurt aufgeschwatzt hatte. Er trank lauwarmen Kaffee aus dem Becher einer Thermoskanne und blickte auf die weite Ebene hinab, die sich tief unter ihm bis zum Horizont erstreckte. Obwohl er das Ziel seiner Reise fast erreicht hatte, blieb es unsichtbar. Koblenz lag unter dichtem Nebel verborgen. Hier und da zeichneten sich verschwommene Konturen unter dem milchigen Dunst ab, der Rhein wand sich als geisterhaft blasse Lebensader durch sein Bett. Was er sah, gefiel Prinz nicht und erschien ihm wie ein unheilverkündendes Omen einer düsteren Zukunft.
Die Stadt am Zusammenfluss von Rhein und Mosel war seine letzte Chance. Wenn er den Job bei der Mordkommission nicht bekam, würde er nicht einmal mehr das nötige Kleingeld besitzen, um weiterzuziehen. Dann wäre er gestrandet.
Staatsanwalt Kai-Uwe Beringer, mit dem er in Frankfurt zusammengearbeitet hatte, war vor einem Jahr nach Koblenz gewechselt und hatte ihm den Tipp gegeben, sich beim K11 zu bewerben. Er hatte angedeutet, dass die zuständige Behörde an Prinz interessiert war, und sich auf seine Ermittlungserfolge in Frankfurt berufen, ohne Einzelheiten zu nennen. Die Andeutungen ließen Prinz nichts Gutes ahnen. Was hinter ihm lag, war Vergangenheit und sollte es bleiben.
Er schraubte den Deckel auf die Thermoskanne und stieg in den rostigen Peugeot 106. Es war ein Wunder, dass der Wagen es bis hierhergeschafft hatte. Der Motor lief ungleichmäßig und klang nach ausgeschlagenen Lagern und verölten Kolben. Und doch stellte er seinen ganzen Besitz dar, abgesehen von dem Armeerucksack auf dem Rücksitz und den beiden Reisetaschen im Kofferraum.
Er fuhr zurück auf die A48 und nahm die letzten Kilometer bergab in Angriff. Je tiefer er in die Nebelbank eintauchte, desto stärker drängte sich ihm das Gefühl auf, mit ihr zu verschmelzen, sich schließlich darin aufzulösen und eins zu werden mit der Anonymität der Großstadt. Eigentlich sollte er für das neblige Wetter dankbar sein, denn darum war er hierhergekommen: um die Erinnerung zu tilgen, die mit seinem Namen verbunden war. Gelingen wollte es ihm nicht.
Nach einer Stunde begann Prinz bereits, Koblenz zu hassen. Fluchend kämpfte er sich durch das Gewirr aus Kreiseln, mehrspurigen Straßen, die nirgendwohin zu führen schienen, unübersichtlichen Kreuzungen und Baustellen. Das Polizeipräsidium am Moselring musste ganz in der Nähe sein, aber das veraltete Navigationssystem, das der Händler ihm als Gratiszugabe zu dem Peugeot aufgedrängt hatte, erwies sich als komplett überfordert. Zu allem Überfluss rasselte der Motor seit zehn Minuten wie ein lungenkranker Kettenraucher. Prinz scherte aus der Kolonne der vorwärts kriechenden Fahrzeuge aus, bog rechts ab in Richtung Deutsches Eck und nahm einen neuen Anlauf.
Als er laut seines Navis nur noch zweihundert Meter vom Ziel entfernt war, gab der Peugeot endgültig den Geist auf. Prinz verfluchte den Händler und seine Not, durch die er gezwungen gewesen war, den Wagen zu kaufen, obwohl er gewusst hatte, dass er bloß einen Haufen Schrott erwarb. Sicherheitshalber verfluchte er gleich alles, was ihm sonst noch in den Sinn kam. Er schlug auf den Schalter der Warnblinkanlage, aber die funktionierte ebenfalls nicht mehr.
Binnen Sekunden bildete sich eine Autoschlange hinter ihm. Die Koblenzer schienen keine geduldigen Menschen zu sein, denn er sah sich mit einem wütenden Hupkonzert konfrontiert. Der Fahrer im Wagen hinter ihm hob in gespielter Verzweiflung die Arme und ließ sie wieder auf das Lenkrad fallen. Durch die Windschutzscheibe sah Prinz ihn schimpfen – einen fetten Mann mit Hamsterbacken und einer Brille mit Gläsern so dick wie Glasbausteine.
Prinz legte den Leerlauf ein, stieg aus und sah sich um. Nicht weit entfernt schimmerte ein blaues Leuchtschild mit der Aufschrift „Polizei“ durch den Dunst, zu allem Überfluss begann es zu regnen.
Der Dicke kurbelte am Lenkrad und fuhr um den liegen gebliebenen Peugeot herum, die nachfolgenden Fahrer taten es ihm gleich. Ein Lastwagen rollte durch eine Pfütze, schmutziges Wasser spritzte auf und durchnässte Prinz’ Hosenbeine. Da ihm niemand Hilfe anbot, sah er sich gezwungen, den Wagen das letzte Stück zu schieben. Er konnte ihn schließlich nicht im Verkehr stehen lassen.
Als er zehn Minuten später den Besucherparkplatz vor dem Präsidium erreichte, war er verschwitzt und nass bis auf die Knochen. Er warf sich den Rucksack mit seinen wenigen Habseligkeiten über die Schulter, ging zur Pforte und erkundigte sich nach Staatsanwalt Beringer. Es war bereits kurz nach halb vier. Damit verspätete er sich zu seinem Antrittsgespräch um mehr als eine halbe Stunde, aber er nahm es mit stoischer Gelassenheit hin. Was blieb ihm übrig? Es war nicht mehr zu ändern.
„Das hier ist das Polizeipräsidium am Moselring“, erklärte der Beamte hinter der Glasscheibe. „Die Staatsanwaltschaft befindet sich in der Deinhardpassage.“
Prinz stöhnte. Er war davon ausgegangen, dass sich Beringers Büro im Präsidium befand. Wenn er wenigstens dieses eine Mal einen Blick in seine Unterlagen geworfen hätte, wäre ihm das nicht passiert.
„Ist das weit von hier?“, fragte er.
„Zehn Minuten, wenn Sie zu Fuß gehen, eine halbe Stunde, wenn Sie bei dem Verkehr den Wagen nehmen.“ Der Beamte reckte den Hals und schielte nach dem Peugeot. „Ich vermute, Sie gehen zu Fuß. Halten Sie sich rechts, dann wieder rechts am Görresplatz vorbei. Sie können es gar nicht verfehlen.“
Prinz machte sich auf den Weg. Sechzehn Minuten später sprach er in Beringers Vorzimmer bei dessen Sekretärin vor. Ein einzelner Schweißtropfen lief kitzelnd an seinem Rückgrat herab. Er strich sich das nasse Haar zurück und war sich bewusst, dass er im Augenblick nicht aussah wie der Bewerber um einen wichtigen Posten bei der Mordkommission.
Die Sekretärin meldete ihn an. Dann legte sie den Hörer auf die Gabel und sagte: „Herr Beringer wird Sie gleich empfangen.“ Sie musterte ihn mit einem kritischen Blick. „Wenn Sie sich ein wenig frisch machen wollen – die Toiletten sind gleich da vorn.“
„Danke.“
Er eilte in die angegebene Richtung, fand die Waschräume und stellte nach einem Blick in den Spiegel fest, dass er tatsächlich ziemlich derangiert aussah. Das dunkle Haar klebte strähnig an seiner Stirn und hatte dringend einen Schnitt nötig. Der Bart, den er seit vier Tagen sprießen ließ, weil sein Rasierapparat den Geist aufgegeben hatte, verlieh ihm den Charme eines Kleinganoven. Auf seiner braunen Lederjacke hatte der Regen Wasserflecken hinterlassen, aber er konnte sie nicht ausziehen, weil sein Hemd von der Hetze völlig verschwitzt war. Alles in allem sah er aus, als hätte er die letzten zwei Nächte unter einer Brücke geschlafen, und so fühlte er sich auch. Ihm kam die Idee, den Kopf unter das Warmluftgebläse des Handtrockners zu halten, aber dadurch ruinierte er seine Frisur vollends. Resigniert kehrte er ins Vorzimmer zurück.
„Herr Beringer hat jetzt Zeit für Sie. Kann ich Ihnen etwas zu trinken anbieten? Einen Kaffee vielleicht?“
Prinz lächelte gequält. „Kaffee wäre wirklich nicht schlecht.“
Sie streifte ihn mit einem amüsierten Blick. Ihr Mundwinkel zuckte, als müsse sie sich ein Lachen verkneifen.
„Mein Wagen hatte eine Panne“, erklärte er überflüssigerweise.
„Na, so ein Pech.“
Sie klopfte an Beringers Tür. Argwöhnisch überlegte Prinz, ob sie ihn verspottete oder ihn anmachen wollte. Die meisten Frauen fanden ihn anziehend und machten keinen Hehl daraus. Dabei tat er nichts, um diese Wirkung hervorzurufen. Es war ihm einfach nur lästig.
„Herr Prinz ist jetzt da.“
Er betrat das Büro des Staatsanwalts. Beringer ging um seinen Schreibtisch herum und streckte ihm die Hand hin.
„Willkommen in Koblenz, Herr Prinz. Freut mich, Sie wiederzusehen.“
„Tut mir leid, mein Wagen hatte …“
„… eine Panne, wie ich hörte.“
Er bot ihm Platz an und setzte sich wieder hinter seinen Schreibtisch. „Ich werde dafür sorgen, dass Sie so schnell wie möglich einen Dienstwagen bekommen.“
„Ich bin ziemlich überstürzt aus Westerburg abgereist.“
„Das wäre ich an Ihrer Stelle vermutlich auch“, sagte der Staatsanwalt. „Vergessen Sie die Provinz und Frankfurt gleich mit und schauen Sie nach vorn. Wissen Sie schon, wo Sie wohnen werden?“
„Ich hatte noch keine Zeit, mir eine Bleibe zu suchen.“
„Wenden Sie sich an meine Sekretärin. Sie kann Ihnen bei der Wohnungssuche helfen.“
„Danke. Ich schätze, ich suche mir erst mal ein günstiges Hotel.“
„Wie Sie wollen. Ich vermute, Sie haben den Verbleib Ihrer Frau noch nicht klären können?“, fragte Beringer.
„Doch, habe ich. Sie hat sich nach Auckland, Neuseeland abgesetzt.“
„Und Kreutzer?“
„Der wird wohl nicht weit weg von ihr sein.“
Beringer musterte ihn kritisch. „Wenn Sie einen Vorschuss brauchen – ich könnte da vielleicht etwas bewegen.“
„Danke, den kann ich gut gebrauchen. Das ist sehr … äh … großzügig von Ihnen.“
„Reden wir nicht drum herum. Sie sind ein erfahrener Ermittler mit einer hervorragenden Aufklärungsquote. Ich bin überzeugt, dass wir auch hier in Koblenz wieder erfolgreich zusammenarbeiten werden. Ihre Arbeit in Frankfurt war exzellent.“
So gut, dass die Hälfte meiner alten Abteilung jetzt im Knast sitzt oder untergetaucht ist, dachte Prinz.
„Man schätzt Sie im Innenministerium, wie mir zu Ohren kam. Die Bewerbung beim K11 ist reine Formsache, der Job ist Ihnen so gut wie sicher. Wir wissen beide, dass manche Kollegen Sie für einen Nestbeschmutzer halten, aber ich habe diese Meinung nie geteilt. Ich habe mich für Sie stark gemacht, weil Sie vorurteilsfrei ermittelt haben.“
Prinz wusste nicht, was er sagen sollte, also nickte er nur.
„Ich will Ihnen nichts vormachen“, fuhr Beringer fort. „Vermutlich weiß hier im Präsidium jeder, was in Frankfurt gelaufen ist. Georg Brockamp, Ihr neuer Chef, ist auf jeden Fall darüber informiert. Und er fragt sich, warum Sie freiwillig den Posten eines Dorfpolizisten annahmen.“
„Ich hatte das Gefühl, es wäre Zeit für eine Luftveränderung.“
„Und da fiel Ihnen nichts Besseres ein als der Westerwald?“
„So kurzfristig konnte ich keinen anderen Job bekommen. Es war eine Übergangslösung.“
„Mmh“, machte Beringer. „Nun ja, ich kann verstehen, dass Sie so schnell wie möglich aus Hessen wegwollten. Brockamp war übrigens nicht begeistert von meinem Vorschlag, dass Sie seinen Liebling Severin ersetzen sollen. Sie werden auf Widerstand stoßen. Aber Sie haben ja bewiesen, dass Sie damit zurechtkommen, nicht wahr?“
Prinz zuckte zunächst mit den Schultern.
„Wenn ich ein Problem damit hätte, mich durchzusetzen, wäre ich in Frankfurt geblieben und hätte den Mund gehalten.“
Beringer lehnte sich zurück. „Warum haben Sie sich nicht weiter weg versetzen lassen? In Hamburg, Berlin oder München kennt niemand Ihre Vergangenheit. Sie hätten einen leichteren Neustart gehabt.“
„Es spricht sich rasch herum, wenn man Kollegen anpinkelt. Ein ruhiger Posten in der Provinz erschien mir als das Beste, um Gras über die Angelegenheit wachsen zu lassen. Aber auf Dauer …“
„… waren Sie dort unterfordert“, beendete Beringer den Satz. „Bei einem Mann mit Ihren Fähigkeiten wundert mich das nicht. Gut, dann hätten wir das geklärt. Kommen wir zu den Details.“
Beringer fixierte ihn, als wolle er prüfen, wie weit er ihm vertrauen könne. „Sie können sich denken, warum man ausgerechnet Sie haben will?“
„Sie suchen einen guten Mordermittler.“
„Offiziell, ja. Und das wird auch Ihre Arbeit beim K11 sein. Tatsächlich … warten noch andere Aufgaben auf Sie. Ich will ganz ehrlich sein. In Brockamps Abteilung stinkt es gewaltig.“
Prinz beschlich eine böse Ahnung.
„Niemand hat mich in Frankfurt bewusst auf Kollegen angesetzt. Es war nicht meine Absicht gewesen, aufzudecken, dass unsere eigenen Leute im Dreck des organisierten Verbrechens steckten.“
Beringer nickte. „Aber Sie haben nicht gezögert, gegen die Korruption in den eigenen Reihen vorzugehen, obwohl Sie mit erheblichem Gegenwind rechnen mussten. Ihre Integrität hat mich damals tief beeindruckt. Sehen Sie, Brockamp steckt ebenfalls im Dreck, er watet darin herum wie ein Flusspferd im Schlamm. Er ist jedoch so clever, kaum Spuren zu hinterlassen. Ich will wissen, was da in meinem Laden vor sich geht.“
Das Spiel ging also weiter. Nichts war es mit Dienst nach Vorschrift, Feierabend um 17 Uhr und ab und zu ein paar Bierchen mit Kollegen, die auf seiner Wellenlänge lagen. Prinz zögerte und geriet in Versuchung, nach einer Ausrede zu suchen und möglichst leise und unauffällig von hier zu verschwinden. Aber er hatte keine Wahl. Er war völlig abgebrannt und genoss den Ruf eines Denunzianten, den niemand im Team haben wollte. Beringer schien das genau zu wissen.
„Verraten Sie mir, warum Sie nicht die interne Ermittlung auf Brockamp ansetzen?“
„Bevor ich den offiziellen Weg gehe, brauche ich Beweise“, antwortete Beringer. „Einen Kollegen grundlos zu verdächtigen, schafft einem keine Freunde und kann der eigenen Karriere enorm schaden. Verfehlungen und Korruption zu dulden allerdings ebenso. Aber Sie wissen ja, wovon ich spreche.“
„Da Brockamp über meine Vergangenheit informiert ist, wird er mir kaum über den Weg trauen und Geheimnisse anvertrauen.“
„Er war mal ein guter Mann, einer der besten, wurde mir mehrfach versichert. Ich will ihn nicht fertigmachen, sondern wissen, was ihn in den vergangenen Monaten so verändert hat. Vielleicht braucht er Hilfe. Ich habe versucht, mit ihm zu reden, aber nichts aus ihm herausbekommen.“
„Ich denke, ich habe verstanden.“
Der Staatsanwalt schob ihm eine Visitenkarte zu. „Sie können mich jederzeit anrufen, wenn Sie Unterstützung brauchen.“
Prinz stand auf und schob den Stuhl an seinen Platz zurück. „Es wäre nützlich, wenn ich wüsste, wonach ich suchen soll.“
„Ich weiß es nicht. Es ist Ihr Job, herauszufinden, was hier so stinkt.“
„Wie begründet sich denn Ihr Verdacht?“
„Der Mann, den Sie ersetzen sollen, war Brockamps rechte Hand. Holger Severin behauptete, Brockamp stecke in einer ziemlich üblen Geschichte drin. Er versprach mir, Beweise zu liefern.“
„Und warum hat er es nicht getan?“
„Er konnte nicht, weil er überraschend starb. Ein plötzlicher Herztod – beim Joggen.“
„Das nennt man Pech.“
„Oder Mord. Severin war erst vierunddreißig und kerngesund; ein Triathlet, der regelmäßig in unserer Polizeimannschaft trainierte.“
„Wurde eine Obduktion vorgenommen?“
„Der Gerichtsmediziner fand keinen Hinweis auf ein Fremdverschulden.“
„Da hat Brockamp ja mächtig Glück gehabt.“
„Das könnte man so sehen. Oder auch nicht. Passen Sie auf sich auf.“
„Werde ich machen.“
Beringer zog eine Schreibtischschublade auf und reichte ihm einen abgegriffenen Pappordner. „Das ist eine Kopie von Brockamps Personalakte. Ich dachte, die könnte hilfreich für Sie sein.“
Prinz nahm sie widerwillig entgegen. Es machte seinen Job als Maulwurf irgendwie offiziell.
„Seine Mannschaft hält zusammen wie Pech und Schwefel“, sagte Beringer. „Nur zwei Kollegen gehören nicht zu seiner alten Seilschaft: Andreas Kehlmann und Jens Salzer. Merken Sie sich die Namen. Beide sind erst seit einem halben Jahr beim K11. Ihnen können Sie vertrauen.“
„Danke für die Informationen. Ich melde mich, wenn ich etwas herausgefunden habe.“
Prinz wandte sich zur Tür.
„Und noch etwas“, sagte Beringer.
„Ja?“
„Keine Alleingänge.“
„Ich dachte, das wäre mein Job. Einer gegen alle.“
„Ich meine damit, dass Sie mich ständig auf dem Laufenden halten sollen.“
„Einverstanden. Geben Sie mir ein bisschen Zeit.“
„Viel Glück.“
„Danke, das kann ich gebrauchen.“
Er verließ Beringers Büro. Seine Sekretärin blickte auf, als er die Tür hinter sich schloss. Ihre stahlblauen Augen blitzten auf.
„Wissen Sie schon, wo Sie heute Nacht schlafen werden?“, fragte sie.
„Im Hotel.“
Sie reichte ihm ein zusammengefaltetes Blatt Papier. Wie zufällig berührten sich ihre Fingerspitzen. „Freie Wohnungen, in denen man es in Koblenz aushalten kann, sind rar. Ich habe Ihnen ein paar Adressen herausgesucht.“
„Danke. Das ist sehr zuvorkommend.“
Er steckte den Zettel ein.
„Haben Sie heute Abend schon was vor? Ich könnte Ihnen die Stadt zeigen“, bot sie an.
„Ich werde erst mal auspacken. Bin ziemlich erledigt von der Fahrt.“ Er lächelte. „Ein anderes Mal gerne.“
„Sie werden uns sicher noch öfter besuchen. Mein Chef hat einen Narren an Ihnen gefressen“, sagte sie.
Und du nicht, was?
„Wir sehen uns dann. Ich muss ins Präsidium.“
„Viel Spaß.“
„Tschüss.“
Wenigstens hatte der Regen nachgelassen, als er auf die Straße trat. Prinz ging gemessenen Schrittes zurück zum Präsidium. Er hatte es nicht eilig, seinen Job anzutreten.
Am Moselring fragte er sich zu KHK Georg Brockamp durch und fand dessen Büro im dritten Stock am Ende eines düsteren Korridors. Das große Eckzimmer gewährte einen großartigen Blick über die City, versprühte aber den Charme eines verstaubten Aktenschranks. Gardinen und Tapeten waren so vergilbt wie Brockamps Teint. Der Marmoraschenbecher, der von der kleinen vergoldeten Figur eines Schnauzers bewacht wurde, war randvoll mit Asche und filterlosen Kippen.
Brockamp hob kaum den Blick von seinem Bildschirm und deutete auf den Stuhl vor seinem Schreibtisch. Sein nikotingelber Zeigefinger hackte auf die Tastatur ein wie der Schnabel einer Saatkrähe, die einen Regenwurm zerteilte.
Prinz musterte seinen neuen Chef. Obwohl er augenscheinlich eine Zigarette nach der anderen paffte, war er nicht so ausgemergelt wie die meisten Kettenraucher. Auf seinem kurzen Hals thronte ein breiter Bulldoggenschädel. Ein Netzwerk tiefer Falten durchzog sein Gesicht. Das aschgraue Haar wich an den Schläfen zurück, wuchs ansonsten aber noch dicht und kräftig. Prinz schätzte ihn auf Mitte fünfzig.
„Wo haben Sie sich herumgetrieben, Herr Prinz?“, fragte er. „Ich warte seit einer Stunde auf Sie.“
„Ich hatte eine Autopanne.“
„Seien Sie morgen pünktlich, oder Sie kriegen Ärger. Wir fangen hier um 8 Uhr an.“
„Selbstverständlich.“
Brockamp zündete sich eine Zigarette an und hustete gleich beim ersten Zug.
„Ich weiß über Sie Bescheid“, sagte er. „Jeder im Präsidium weiß über Sie Bescheid.“ Er lehnte sich zurück und stieß eine Rauchwolke aus.
„Ich gebe nicht viel auf Gerüchte. Die Leute reden viel.“
„So, tun sie das? Ich sage Ihnen was, Prinz: Ich wollte Sie hier nicht haben, aber Beringer hat sich im Innenministerium für Sie eingesetzt. Weiß der Teufel, was ihn dazu getrieben hat.“
Brockamp beugte sich vor, sein Atem stank nach Nikotin und kaltem Kaffee. „Beim geringsten Dienstvergehen sorge ich dafür, dass Sie draußen sind.“
„Sie bestimmen die Regeln.“
„Ganz recht. Jeder hier weiß, dass Sie in Frankfurt vier unserer eigenen Leute hochgehen ließen, und glauben Sie mir, so was gefällt niemandem.“
„Hätte ich weggesehen und geschwiegen, hätte ich mich ebenfalls strafbar gemacht.“
„Mit solchen Aktionen schafft man sich trotzdem keine Freunde unter Kollegen.“
„Aber saubere Luft.“
Brockamp drückte die Kippe im Aschenbecher aus.
„Ich werde Ihnen jetzt erklären, wie es bei uns läuft. Sie bleiben an mir kleben wie ein Schatten. Ich will jeden Abend einen schriftlichen Bericht von Ihnen. Ist das klar?“
„Völlig klar.“
„Sie wollten eine Chance – bitte: Sie bekommen eine, auch wenn ich dagegen war. Ich will nicht verhehlen, dass ich einen Mann mit Ihren Fähigkeiten gut gebrauchen kann. Und ich will nicht unfair sein. Bleiben Sie immer schön in der Reihe, dann sind alle zufrieden.“
„Rüssel an Schwanz“, sagte Prinz.
„Ich sehe, wir verstehen uns. An die Arbeit. Wir haben einen Leichenfund am Rheinufer, und wir sollten längst dort sein.“
Brockamp schob seinen Sessel zurück und stand ächzend auf. Prinz bemühte sich, ihn nicht anzustarren. Wie sich nun zeigte, war der bullige Mann ein Sitzriese. Sein Oberkörper fiel gegenüber seinen Beinen unnatürlich lang aus. Mit seinen Dackelbeinen reichte er Prinz kaum bis zur Schulter. Er warf ihm den Autoschlüssel zu.
„Sie fahren.“
Prinz fing den Schlüssel auf und fügte sich in sein Schicksal. Da hatte er einen schlechten Start hingelegt. Erst die Zeit würde erweisen, ob es richtig gewesen war, sich als Spitzel zu verpflichten. Aber was blieb ihm schon anderes übrig als mitzuspielen, pleite, wie er war?
3
Seine Augen waren grau und kalt wie glatt geschliffene Flusskiesel. Die feuerrote Narbe glühte wie ein brennender Faden. Seine schwarzen Lederhandschuhe knirschten, als er das polierte Stahlrohr des Geländers umfasste. Jule fragte sich, wie viele Kehlen diese Hände für immer zugedrückt hatten. Er beugte sich über die Brüstung und warf einen Blick in die Tiefe.
„Heute ist nicht gerade dein Glückstag.“ Er schürzte die Lippen und betrachtete sie abschätzend. „Was mache ich jetzt mit dir?“
Jule konnte nicht sprechen, ihr Mund war vor Angst und Entsetzen staubtrocken. Sie schluckte und räusperte sich umständlich.
„Ich … ich …“, stammelte sie.
„Sag mir, was du gesehen hast.“
„Wa-was gesehen? Ni-nichts. Ich weiß nicht … wovon Sie sprechen.“
Verzweifelt sah sie sich um. Nur wenige Einkaufslustige hatten sich in die dritte Etage verirrt. Ob ihr jemand zu Hilfe kommen würde, wenn er Gewalt anwendete? Eher nicht. Immer wieder las sie über Leute, die sich beim Anblick von Gewalttätigkeiten wegdrehten und davonliefen, weil sie in keine unangenehme Sache hineingezogen werden wollten. Der Mann neben ihr hatte einen Menschen getötet, ohne mit der Wimper zu zucken. Niemand würde sich mit einem Killer anlegen. Sie in die Tiefe zu stürzen, wäre für ihn nur eine Fingerübung. Er begann, die Melodie zu summen, die sie vorhin schon im Foyer des Schlosses gehört hatte.
Er überlegt, wie er mich am besten töten kann.
Unwillkürlich entfernte sie sich von der Brüstung. Ihr war übel, sie befürchtete, sich übergeben zu müssen. Belustigt verfolgte er ihre hastigen Bewegungen.
„Vielleicht bist du nicht so dumm, wie ich dachte.“ Er verzog die Lippen zu einem Grinsen und entblößte ungepflegte Zähne. Die Narbe spannte und kräuselte sich wie eine stachelige Raupe, die sich an seiner Wange festkrallte.
Sie schüttelte den Kopf und hielt die Hand vor den Mund.
Sein Feixen verschwand. „Kotz mir bloß nicht die Klamotten voll.“
Jule knetete nervös ihre Finger und wagte es nicht, seinen Blick zu erwidern.
„Was wirst du tun, wenn die Polizei bei dir aufkreuzt?“, fragte er.
„Warum … sollte … die Polizei zu mir kommen?“
„Weil die alte Vettel mit dem Dackel gesehen hat, dass du abgehauen bist. Sie wird der Polizei deine Beschreibung geben.“
„Aber ich habe doch nichts …“
„Ich mag’s nicht, wenn man mich für dämlich hält“, unterbrach er sie. „Also, was wirst du sagen?“
„Ich habe gesehen … wie ein Mann …“ – sie verschluckte sich und hustete – „wie ein Mann von der Brücke gefallen ist.“
„Sonst nichts?“
Sie schüttelte den Kopf und starrte dann auf die zitronengelbe Brüstung, die mit weißen, ineinander verschlungenen Linienmustern verziert war. Jule begann, sie zu zählen. Warum konnte er nicht einfach verschwinden und sie vergessen?
Er trommelte mit den Fingernägeln einen leisen Takt auf das Stahlgeländer. Alles an ihm verriet Kaltblütigkeit, Entschlossenheit und Effizienz. Er würde kein Risiko eingehen und sie niemals gehen lassen. Jule hatte gehofft, inmitten der Menge Sicherheit zu finden, aber sie hatte sich geirrt. Die Anonymität der Einkaufsgalerie bedeutete ihren Tod. Sie hoffte nur, dass es schnell ging.
„Du bist hübsch …“, sagte er, „ein bisschen schmal zwar, aber sinnlich, vor allem die Lippen.“ Er beugte sich vor und studierte sie wie einen seltenen Schmetterling, den ein Sammler mit einer Nadel auf ein Blatt Papier gespießt hatte. „Ich glaube, ich werde dich ficken, bevor ich dich töte. Was meinst du? Würde dir das gefallen?“
Jule konnte nicht antworten. Nicht mehr sprechen oder sich bewegen. Das Blut in ihren Adern verwandelte sich in Eiswasser und kam zum Stillstand. Konnte man vor Angst sterben?
„Das hast du doch noch nie gemacht, oder?“, sagte er. „Ich mache dir ein faires Angebot, schließlich bin ich kein Unmensch. Dann hast du wenigstens ein bisschen Spaß, bevor ich dir die Lichter ausdrehe. Ich glaube, ich werde dich erdrosseln, am besten mit einem Seidenschal. Du wirst sehen, es wird dir gefallen. Der Sauerstoffmangel wird dich euphorisch machen. Du wirst einen Orgasmus haben. Ich wette, du hattest noch nie einen.“
„Ich … werde niemandem etwas erzählen.“ Das Blut rauschte in ihren Ohren, ihre Eingeweide zogen sich krampfhaft zusammen. „Ich habe … auch gar nichts gesehen.“
„Mmh. Ich glaube nicht, dass ich dich laufen lassen kann. Die Bullen werden sofort merken, dass du sie belügst. Sie ziehen dir die Wahrheit in fünf Minuten aus deiner hübschen Nase.“
„Mir ist schlecht“, würgte sie hervor.
„Glaube ich gern“, sagte er und grinste. Die Narbe grinste mit.
„Ich muss mal … zur Toi… Toilette“, stammelte sie.
„Vergiss es. Wir gehen jetzt zusammen hinaus wie zwei gute alte Freunde.“
„Ich … gehe … nicht mit Ihnen.“
Der Mann lachte und beugte sich über das Geländer. „Das gibt ’ne ziemliche Sauerei, wenn du da unten aufschlägst. Dein Kopf platzt auf wie ein Kürbis, und dein bisschen Hirn spritzt nach allen Seiten heraus. Ich lasse dir die Wahl. Entweder kommst du mit und erlebst noch was … oder du wirst jetzt gleich sterben.“
„Ich werde schreien.“
Mit einer schnellen, fließenden Bewegung drängte er sich dicht an sie. Sie roch seinen sauren Atem und spürte einen Stich in der linken Seite.
„Wenn ich zusteche, genau zwischen der zweiten und dritten Rippe, dann zischt die Luft aus deinen Lungen heraus wie aus einem löchrigen Reifen. Dann schreist du nicht mehr, glaub mir.“
„Wer sind Sie?“
„Jemand, den du dummerweise bei der Arbeit gestört hast.“
Er hakte sich bei ihr unter und zerrte sie zur Rolltreppe.
„Komm jetzt.“
Jule blieb nichts anderes übrig, als zu gehorchen. Seine Finger gruben sich schmerzhaft in ihren Oberarm. Panisch suchte sie nach einem Ausweg. Wieder hatte sie das Gefühl, vom Rest der Welt durch eine gläserne Wand getrennt zu sein. Sie schrie um Hilfe, aber niemand hörte sie. Ihre flehentlichen Rufe existierten nur in ihrem Kopf.
Passanten zogen an ihr vorbei wie Plastiktauben auf einem Kirmesschießstand: eine dicke Frau in einem roten Wintermantel und mit einem quengelnden Kind an der Hand, ein Pizzabote mit Pappschachteln und ein Mann mit einem Pflaster auf der Nase. Nie zuvor war ihr aufgefallen, wie viele Menschen in der bunten Welt ihrer Smartphones versunken waren. Niemand erwiderte ihre Blicke, niemandem fiel etwas auf. Unbemerkt nahm Jule währenddessen die Rolltreppe hinab in die Hölle.
Sie fand kaum Zeit, einen klaren Gedanken zu fassen. Er schob sie durch das Foyer, die Glastüren glitten zur Seite. Der Wind peitschte ihr kalten Regen ins Gesicht. Jules Hoffnung erfüllte sich nicht. Nur wenige Menschen überquerten, unter Regenschirmen halb verborgen, den Zentralplatz.
„Wohin bringen Sie mich?“, fragte sie.
„Wart’s ab.“
„Lassen Sie mich gehen. Ich werde niemandem etwas erzählen.“
Er antwortete nicht und trieb sie auf eine Fußgängerampel zu. In der Rushhour floss der Verkehr träge, immer wieder bildeten sich Staus. In der Ferne entdeckte sie ein Taxi, das auf der gegenüberliegenden Straßenseite in ihre Richtung fuhr. Jule entschloss sich zu einer Verzweiflungstat. Wenn sie nichts unternahm, würde sie sterben. Hatten sie erst einmal die belebte Zone um den Zentralplatz verlassen, verschlechterten sich ihre Fluchtchancen drastisch.
Das Taxi war noch etwa hundert Meter entfernt, der Verkehr stockte. Wenn sie den richtigen Moment erwischte, könnte sie es schaffen.
Ein Fahrradkurier in einer neonfarbenen Regenjacke raste auf seinem Bike quer über den Platz, ohne auf Hindernisse zu achten. Er wich in einem halsbrecherischen Manöver einem Blumenkübel aus, streifte den Arm des Killers und brachte ihn aus dem Gleichgewicht. Für einen Augenblick lockerte sich sein Griff. Jule riss sich los und rannte um ihr Leben.
4
Brockamp deutete auf den grünen Peugeot.
„Gehört der Laubfrosch Ihnen?“
„Ja.“
„Der kann dort nicht stehen bleiben. Der Platz ist für Bereitschaftsfahrzeuge reserviert.“
„Wenn ich ihn zum Laufen bringe, ist er heute Abend verschwunden. Vielleicht können Sie mir ja eine Werkstatt empfehlen.“
„In Horchheim gibt’s einen Schrotthändler. Der nimmt ihn sicher gern.“
Sie stiegen in den Passat. Brockamp kramte ein Magnetblaulicht hinter dem Rücksitz hervor, ließ die Seitenscheibe herab und befestigte es auf dem Dach. Prinz ließ den Motor an und steuerte den Wagen auf die Straße.
„Wenn Sie jetzt noch einen Tipp haben, wie ich an eine Wohnung komme, bin ich der glücklichste Mensch der Welt“, sagte er.
„Meinen Sie, es lohnt sich? Vielleicht haben Sie ja in ein paar Tagen die Nase voll von Koblenz.“
„Aber woher denn? So eine schöne Stadt mit so netten Menschen – ich werde Koblenz lieben.“
„Wie Sie meinen. Der Tipp mit dem Schrottplatz war übrigens ehrlich gemeint. Es gibt nichts, was Kalupka nicht reparieren kann.“
Brockamp wedelte mit dem Arm und hustete. „Da vorne links rein.“
Sie näherten sich dem Rheinufer. Brockamp zündete sich eine Zigarette an und nebelte das Wageninnere ein.
„Sie müssen das verstehen“, erklärte er. „Was Sie in Frankfurt angestellt haben, hat auch bei uns die Runde gemacht. Wer setzt sich gerne freiwillig eine Laus in den Pelz?“
„Ist es besser, die Augen vor Korruption in den eigenen Reihen zu verschließen?“
„Weiß ich nicht. Mit so etwas hatte ich noch nicht das Vergnügen.“
Prinz warf ihm einen abschätzenden Seitenblick zu. Er hatte befürchtet, dass es Probleme geben würde, aber nicht mit einem so miserablen Start gerechnet. Sein Vorhaben, keinen Ärger zu erregen, war von Anfang an zum Scheitern verurteilt gewesen. Er blickte wieder nach vorn – und trat mit aller Kraft auf die Bremse. Der Passat kam schlitternd zum Stehen.
„Ist die verrückt geworden?“, knurrte Brockamp.
Prinz löste den Sicherheitsgurt und stieg aus dem Wagen. Vor der Motorhaube stand eine junge Frau. Sie war zwischen den parkenden Fahrzeugen auf die Straße gelaufen, ohne auf den Verkehr zu achten. Nur den guten Bremsen des Passats und einer Riesenportion Glück war es zu verdanken, dass Prinz sie nicht überfahren hatte. Er schätzte sie auf Mitte zwanzig. Sie trug eine Brille mit einem altmodischen Horngestell, einen dunklen Wintermantel und eine unförmige blaue Mütze. Ihre Umhängetasche war von ihrer Schulter gerutscht und lag auf der Straße. Sie war kreidebleich, zitterte und starrte ihn an, als hätte sie ein Gespenst gesehen. Prinz löste den Sicherheitsgurt und stieg aus dem Wagen.
„Alles in Ordnung?“, fragte er.
„Dreizehn“, sagte sie leise.
„Dreizehn?“
Sie sah sich hastig um. Prinz folgte ihrem gehetzten Blick. Auf dem Gehsteig hatte sich eine Menschentraube gebildet, ein Mann mit Dreitagebart schien sie zu beobachten. Er trug eine Wollmütze und eine dunkle Steppjacke. Eine feuerrote Narbe zog sich vom linken Ohr bis zum Kinn. Als er Prinz’ Aufmerksamkeit bemerkte, drehte er sich um und verschwand in einem Torweg.
Prinz wandte sich wieder der Frau zu.
„Haben Sie sich verletzt? Brauchen Sie Hilfe?“
„Ich …“
Brockamp war inzwischen ebenfalls aus dem Wagen gestiegen. Er reckte seinen Stiernacken vor und fuhr die Frau wütend an: „Sind Sie blind? Wenn Sie sich unbedingt umbringen wollen, springen Sie doch von einer Brücke! Davon gibt’s in der Stadt mehr als genug.“
„Es tut mir leid. Ich wollte nicht …“ Sie wich erschrocken vor seinem Gebrüll zurück und bückte sich nach ihrer Tasche.
„Sie wollten was nicht? Geben Sie die Straße frei, Sie halten den Verkehr auf.“
Sie wurde knallrot.
„Entschuldigung, ich … wollte das Taxi erreichen und … hab nicht auf den Autoverkehr geachtet.“
„Ihre Lebensgeschichte interessiert mich nicht. Wir haben’s eilig.“
Die Umhängetasche rutschte ihr aus den Fingern und landete abermals auf dem Asphalt. Prinz hob sie auf und reichte sie ihr.
„Passen Sie in Zukunft besser auf, wenn Sie eine Straße überqueren. Ist wirklich alles in Ordnung?“
Sie nickte krampfhaft und lief auf das Taxi zu, das auf der Nebenspur vor einer Ampel stand. Sie wandte sich noch einmal um, beschleunigte dann ihre Schritte und stieg ein.
Brockamp hustete und trat seine Kippe aus.
„Worauf warten Sie noch? Wollen Sie hier Wurzeln schlagen?“
Prinz spürte ein kaltes Kribbeln im Nacken und hatte das seltsame Gefühl, dass er dieser Frau wieder begegnen würde. Er wusste nur noch nicht, ob er sich auf das Wiedersehen freuen sollte.
Brockamp knallte die Tür zu. „Fahren Sie schon los.“
Prinz stieg ein. „Sie war zu Tode erschrocken. Haben Sie nicht bemerkt, wie durcheinander sie war?“
„Kein Wunder. Sie haben sie um ein Haar über den Haufen gefahren.“
Er dirigierte Prinz durch das Straßengewirr zu ihrem Ziel am Rheinufer. Drei uniformierte Beamte hatten den Leichenfundort unter der Eisenbahnbrücke weiträumig abgeriegelt. Rot-weißes Absperrband flatterte im kalten Wind, der von den Höhen des nahen Westerwalds über das Rheintal fegte. Ein Team der Spurensicherung suchte den Tatort ab, in einer Seitengasse stand ein Leichenwagen. Zwei Männer in schwarzen Anzügen lehnten an der Motorhaube, rauchten und warteten darauf, dass sie mit ihrer Arbeit beginnen konnten.
Prinz schlüpfte unter dem Absperrband durch. Brockamp fluchte und murmelte etwas von Hundescheiße. Das Blitzlicht eines Polizeifotografen flammte auf, während ein hagerer Mann in einem weißen Kittel sich über die Leiche eines etwa fünfundsiebzigjährigen Mannes beugte. Er lag auf dem Rücken und starrte blicklos in den grauen Nachmittagshimmel. Seine Beine ragten ins flache Wasser, während der Oberkörper auf den kopfgroßen Steinen ruhte, mit denen die Uferböschung befestigt war.
Prinz ging auf den Mann im Kittel zu und streckte ihm die Hand entgegen. „Sie sind der Gerichtsmediziner?“
Der Angesprochene blickte auf und schüttelte die dargebotene Hand. Er war kahlköpfig, hatte wässrige blaue Augen und die längsten Finger, die Prinz je gesehen hatte.
„Dr. Kasper. Und Sie sind?“
„KHK Lucas Prinz. Ich bin neu im Team.“
Kasper nickte. „Hab schon von Ihnen gehört.“
Selbst in der Gerichtsmedizin wusste man also schon, dass er Kollegen ans Messer geliefert hatte. Prinz drehte sich suchend um. Brockamp stand in einiger Entfernung auf einer Wiese und säuberte seinen Schuh im nassen Gras.
„Wissen Sie schon, wie der Mann gestorben ist?“, fragte Prinz.
„Er weist Verletzungen auf, die für einen Sturz aus großer Höhe typisch sind“, antwortete Kasper. „Ob es ein Unfall war, ob er selbst gesprungen ist oder gestoßen wurde, wird sehr wahrscheinlich nicht zu klären sein – es sei denn, wir stoßen auf Hämatome, die auf eine Auseinandersetzung hinweisen. Bis jetzt konnte ich nichts Derartiges feststellen.“
Prinz legte den Kopf in den Nacken und sah zur Brücke hinauf. Schaulustige glotzten über das Geländer.
„Wieso hat niemand die Brücke abgesperrt?“, plärrte Brockamp. „Die zertrampeln uns da oben sämtliche Spuren.“
Ein Streifenpolizist spritzte los und eilte auf eine Wendeltreppe zu, die zum Fußweg entlang der Schienen hinaufführte. Brockamp betrachtete kritisch seinen Schuh und steckte sich eine seiner filterlosen Zigaretten an. Es war die dritte innerhalb einer halben Stunde.
„Glaube aber nicht, dass wir irgendwas finden“, brummte er zu sich selbst.
„Kann man nie wissen“, sagte Prinz.
Er streifte ein Paar Latexhandschuhe über, kniete sich neben die Leiche und durchsuchte die Kleidung des Toten. Der Mann trug eine graue Stoffhose, einen Wollpullover und eine beigefarbene Regenjacke. In einer Innentasche stieß Prinz auf eine Bahnfahrkarte für die Strecke Mainz-Koblenz mit dem Datum von heute. Er reichte das Ticket einem Mitarbeiter der Spurensicherung, der sie in einem Asservatenbeutel verstaute. In der Gesäßtasche der Hose des Toten steckte ein Portemonnaie. Es enthielt knapp hundert Euro Bargeld, aber keine Bankkarten, Krankenversichertenkarte oder Ausweisdokumente.
„Keine Papiere?“, fragte Brockamp.
„Nein. Auch kein Handy. Nichts, was uns hilft, ihn zu identifizieren.“
„Ich schätze, der Alte hat die Brücke überquert und sich zu weit über das Geländer gebeugt. Dann hat er das Gleichgewicht verloren und ist gestürzt“, vermutete Brockamp.
„Dafür gibt’s keinen Beweis.“
„Was glauben Sie denn? Dass ihn einer runtergestoßen hat?“
„Ein Raubmord war’s jedenfalls nicht, sein Geld ist noch da.“
Der Gerichtsmediziner klappte seinen Koffer zu. „Ich bin hier fertig. Von mir aus können Sie ihn abtransportieren lassen.“
„Wie lange ist er schon tot?“, fragte Prinz.
„Höchstens zwei Stunden.“
„Und keiner hat was gesehen“, sagte Brockamp. „Wie immer.“
Der Streifenpolizist kam die Wendeltreppe herab. „Hab ich ganz vergessen. Im Wagen sitzt eine Zeugin!“, rief er keuchend.
Prinz sah sich um. Die Bestatter schleppten einen Zinksarg zum Ufer. Hinter dem Leichenwagen stand ein Polizeiwagen.
„Ich übernehme das, wenn’s recht ist.“
Brockamp nuschelte eine unverständliche Antwort und hustete, was Prinz als Zustimmung auffasste. Er näherte sich dem Streifenwagen. Eine dicke Frau saß auf dem Rücksitz, ihr Rauhaardackel pinkelte gegen einen Reifen und kläffte Prinz an.
„Kriminalhauptkommissar Lucas Prinz.“ Er wies sich aus. „Sie haben beobachtet, was passiert ist?“
Die Frau wuchtete sich umständlich aus dem Fond und zerrte an der Hundeleine.
„Nein, aber ich habe den armen Kerl gefunden. So erschrocken war ich, dass ich fast eine Herzattacke bekam. Mein Gott, all das Blut. Mir war sofort klar, dass er tot ist.“
„Sie haben also nicht gesehen, wie er stürzte?“
„Nein. Das habe ich den Beamten doch schon erklärt.“
„Würde es Ihnen etwas ausmachen, es mir noch einmal zu erzählen?“
„Er lag einfach da. Aber da war vorher diese Frau. Vielleicht hat sie etwas beobachtet.“
„Eine Frau?“
Sie drehte sich um und wies auf den Anfang einer Querstraße etwa hundert Meter flussabwärts. „Dort an der Ecke bei dem Stromkasten hat sie mich fast umgerannt. Sie hatte es furchtbar eilig.“
„Und sie kam aus dieser Richtung?“
„Ja. Sie war völlig kopflos. Als ob …“
„Ja?“
„Als ob sie etwas Schreckliches getan hätte.“ Sie stemmte die Fäuste in die Hüften. „Ich sage Ihnen, mit der stimmt etwas nicht, Herr Kommissar. Habe ich mir gleich gedacht.“
„Können Sie die Frau beschreiben?“
„Sie war klein und schlank, etwa eins fünfundsechzig … und dunkles Haar hatte sie. Sie trug einen Wintermantel und eine komische blaue Mütze.“ Nachdenklich runzelte sie die Stirn. „Und eine Brille, ein klobiges Kassengestell – ziemlich billig, wenn Sie mich fragen.“
„Alter? Besondere Kennzeichen?“
„Mitte zwanzig, würde ich sagen. Ich habe ihre Augen gesehen, Herr Kommissar. Das waren die Augen einer Mörderin.“ Sie nickte bekräftigend. „Ganz sicher.“
„Würden Sie sie wiedererkennen?“
„Ja, bestimmt.“
„Geben Sie bitte den Kollegen Ihre Adresse und Telefonnummer. Wir melden uns, wenn wir noch Fragen haben.“
Er kehrte zum Ufer zurück. Die Bestatter hatten den Toten in den Zinksarg gelegt und verschlossen den Deckel. Brockamp starrte abwesend auf den Fluss und kickte einen Kiesel ins Wasser. Tat er nur so abgebrüht, oder interessierte es ihn nicht, wie der alte Mann gestorben war?
„Und? Hat sie etwas Brauchbares ausgesagt?“, fragte er.
„Sie hat uns eine recht gute Beschreibung einer jungen Frau gegeben, die es ziemlich eilig hatte, von hier zu verschwinden.“
„Mmh. Könnte sie etwas mit dem Tod des Mannes zu tun haben?“
„Es klang eher, als wäre sie vor etwas geflohen … oder jemandem. Möglicherweise hat sie gesehen, was passiert ist.“
Prinz erinnerte sich an die verhuschte Frau, die er beinahe überfahren hatte. Jetzt wusste er auch, warum sie so verängstigt gewesen war. Brockamp schien den Zwischenfall bereits vergessen zu haben, oder er stellte keinen Zusammenhang her. Prinz ging zum Wagen zurück. Die Motorhaube war mit Steinschlägen und Schrammen übersät. Aus einem unerfindlichen Grund zählte er sie.
Es waren genau dreizehn.
5
Unter normalen Umständen hätte Jule eine Taxifahrt durch die halbe Stadt wie eine Reise durch die Galaxis empfunden. Aber nichts war mehr normal. Als der Wagen anhielt, nahm sie kaum wahr, dass der Fahrer den Fahrpreis nannte. Sie reichte ihm wie in Trance einen Geldschein und steckte das Wechselgeld ein. Ihr Leben hatte sich in einen Film verwandelt, in dem die meisten Einzelbilder fehlten. Hatte sie vor einer Sekunde noch auf dem Rücksitz des Taxis gesessen, stand sie nun wie hingezaubert auf dem Gehweg. Die Zeit dazwischen war ausradiert, als hätte sie nie existiert.
Der Himmel war genauso trüb wie eine Stunde zuvor, und die Graffiti an den Häuserwänden waren immer noch da, ebenso wie die Asphaltflicken zu ihren Füßen. In der Außenwelt hatte sich nichts verändert, die Erde drehte sich unbeeindruckt weiter. In ihrem Inneren braute sich ein Sturm zusammen, der sie hinwegzufegen drohte.
Jules Gedanken kreisten um den Mann mit den schwarzen Handschuhen. Dank ihrer Panikreaktion und ihrer waghalsigen Flucht hatte sie ihn abgeschüttelt. Aber damit war er nicht aus ihrem Leben verschwunden. Die Kaltblütigkeit, mit der er sie im Forum bedroht hatte, bewies, dass er kein gewöhnlicher Verbrecher war. Hinter dem Mord am Rheinufer steckte mehr. Der alte Mann war kein zufällig ausgewähltes Opfer gewesen.
Zwar kannte der Narbenmann, wie sie ihn inzwischen nannte, weder ihren Namen noch ihre Adresse, aber er würde nicht aufhören, nach ihr zu suchen. Ihre einzige Hoffnung bestand darin, dass seine Erinnerung an ihr Gesicht mit der Zeit verblassen würde.