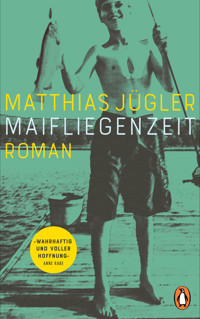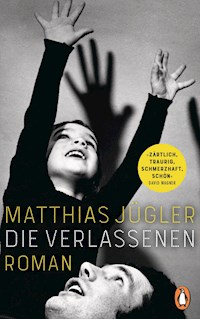
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kein Mensch ist vor den Momenten sicher, die alles von Grund auf ändern
Johannes blickt zurück auf eine ostdeutsche Kindheit, die von feinen Rissen durchzogen war. Der frühe Tod seiner Mutter, das rätselhafte Verschwinden seines Vaters. All seine Fragen dazu blieben unbeantwortet, weshalb er noch als Erwachsener vorsichtig tastend durchs Leben geht. Als Johannes in einer alten Kiste auf einen Brief stößt, verändert dieser Fund nicht nur seine Zukunft, sondern vor allem seine Vergangenheit als Kind der Vorwende-DDR. Seine Erinnerungen sortieren sich neu und mit ihnen sein Blick auf das eigene Leben.
In eindringlicher Dichte und mit kraftvoller Klarheit erzählt Matthias Jügler von Verlust und Verrat, vom Wert des Erinnerns und den drängenden Fragen einer ganzen Generation. Ein warmherziger, leuchtender Roman von außergewöhnlicher sprachlicher Intensität.
»›Die Verlassenen‹ erscheint als ein berückendes, als ein tiefschwarzes Zeugnis ostdeutscher Erinnerungskultur und darin als eines der besten Bücher dieses Literaturfrühlings.« Deutschlandfunk, Büchermarkt, Jan Drees
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 174
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Johannes blickt zurück auf eine ostdeutsche Kindheit, die von feinen Rissen durchzogen war. Der frühe Tod seiner Mutter, das rätselhafte Verschwinden seines Vaters. All seine Fragen dazu blieben unbeantwortet, weshalb er noch als Erwachsener vorsichtig tastend durchs Leben geht. Als Johannes in einer alten Kiste auf einen Brief stößt – adressiert an seinen Vater und abgeschickt nur wenige Tage, bevor dieser den Sohn wortlos verließ –, verändert dieser Fund nicht nur seine Zukunft, sondern vor allem seine Vergangenheit als Kind der Vorwende-DDR. Seine Erinnerungen sortieren sich neu und mit ihnen sein Blick auf das eigene Leben. In eindringlicher Dichte und mit kraftvoller Klarheit erzählt Matthias Jügler von Verlust und Verrat, vom Wert des Erinnerns und den drängenden Fragen einer ganzen Generation. Ein warmherziger, leuchtender Roman von außergewöhnlicher sprachlicher Intensität.
Matthias Jügler, geboren 1984 in Halle/Saale, studierte Skandinavistik und Kunstgeschichte in Greifswald und Literarisches Schreiben am Deutschen Literaturinstitut Leipzig. Für seinen Debütroman »Raubfischen« (2015) erhielt er eine Reihe von Auszeichnungen. Jügler lebt mit seiner Familie in Leipzig, wo er auch als freier Lektor arbeitet.
»Eine am skandinavischen Erzählen geschulte, zurückhaltende Stimme, die den Echoraum DDR aus Sicht der Nachgeborenen bedachtsam widerhallen lässt.« Antje R. Strubel
»Matthias Jügler erzählt eine deutsche Geschichte – zärtlich, traurig, schmerzhaft, schön.« David Wagner
MATTHIAS JÜGLER
DIE VERLASSENEN
ROMAN
Für Bilder und Inspiration danke ich Paula, Grita und Moritz Götze. Die Arbeit an diesem Buch wurde gefördert durch die Kunststiftung Sachsen-Anhalt, unter Bezuschussung der Kloster Bergesche Stiftung. Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2021 Penguin Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München Umschlaggestaltung: Sabine Kwauka Umschlagabbildungen: ullstein bild/Uta Poss Satz: GGP Media GmbH, Pößneck
1
Das letzte Mal habe ich meinen Vater im Juni 1994 gesehen. Der dreizehnte Juni war ein Montag, daran erinnere ich mich genau. Wir saßen in unserem Garten und frühstückten. Vater hatte für jeden ein Ei gekocht, dazu gab es aufgebackene Brötchen, Schinken, Käse, drei Gläser mit Marmelade und geräucherten Lachs.
»Wer soll das denn alles essen?«, fragte ich, denn für gewöhnlich aß ich morgens nicht mehr als ein Brötchen und gab mich mit etwas Butter und einer Scheibe Käse zufrieden. Vater überlegte nicht lange, hielt mir den Teller mit den Lachsstreifen unter die Nase und sagte: »Du, wer sonst?«
Nach dem Frühstück legte er sich auf die Hollywoodschaukel und rief mich zu sich. Ich hatte damit gerechnet, dass wir nun endlich losfahren würden, damit ich noch halbwegs rechtzeitig in die Schule käme. Aber er machte nicht den Eindruck, gleich losfahren zu wollen. Schon während des Frühstücks hatte ich ihm gesagt, dass wir uns beeilen sollten, weil ich noch meine Schulsachen von zu Hause holen müsse und ich sonst zu spät kommen würde.
Seit ein paar Wochen wollte ich unbedingt Meeresbiologe werden. Ich hatte eine Dokumentation über einen holländischen Meeresbiologen gesehen, der erzählte, wie sehr er es genoss, so viel unterwegs zu sein, dass er die beste Arbeit habe, die er sich denken könne, und mit niemandem tauschen würde. Nachdem die Dokumentation zu Ende war, ging ich zu Vater in die Küche und erzählte ihm, dass ich später gerne Meeresbiologe werden möchte. Schon oft hatte er mich gefragt, ob ich wisse, was ich später arbeiten möchte, und immer hatte ich mit den Schultern gezuckt.
»Meeresbiologe?«, sagte Vater. Er faltete die Zeitung zusammen und sah mich ernst an. »Dann musst du dich ranhalten und endlich besser in der Schule werden, verstehst du?«
Dass ich besser in der Schule werden müsse, sagte er oft, mindestens einmal die Woche, dabei war ich gar nicht so schlecht. Kein Einserkandidat, aber auch keiner, um den man sich ernsthaft Sorgen machen musste.
Ich sagte, dass ich das wisse, und blieb eine Weile vor ihm stehen. Die letzten Stunden hatte ich ferngesehen, und nun hatte ich Lust, mich mit ihm zu unterhalten, wusste aber nicht, was ich noch sagen sollte. Selten tauschten wir mehr als ein paar Sätze aus. Ich gab mir Mühe, jedes Mal, und auch wenn das, was ich meinem Vater erzählte, in den meisten Fällen wohl langweilig war – immerzu versuchte ich, meinen Vater zum Reden zu bringen. Ein Klassenkamerad hatte mir einmal erzählt, wie sehr es ihn nerve, dass seine Eltern so viele Ausflüge mit ihm machten, und sein Vater sogar auf dem Nintendo mit ihm spielen wollte. Als er fragte, ob mich mein Vater auch so nerve, sagte ich nichts und war froh, dass er nicht weiter darauf einging.
Weil ich nicht sofort zu ihm kam, rief mich Vater ein zweites Mal. Noch immer lag er auf der Hollywoodschaukel, die er in den Achtzigern gebaut hatte und einmal im Jahr neu lackierte, und noch immer schien er nicht begriffen zu haben, dass wir keine Zeit mehr hatten. Er musste arbeiten und ich in die Schule. Ich ging über die Wiese, vorbei am Blumenrondell, in dem Vater ausschließlich Rittersporn gepflanzt hatte, der gerade anfing zu blühen, blau und violett, was uns beiden gefiel. Vater setzte sich, damit ich neben ihm Platz nehmen konnte. Nun schauten wir beide auf den Rittersporn.
»Wunderschön«, sagte er, »das ist wunderschön«, und mir schien, er wollte gar nicht, dass ich ihn verstehe, so leise, wie er sprach. In diesem Moment wurde ich wütend.
»Ich muss zur Schule«, sagte ich, aber es klang gar nicht so wütend, wie ich war, was mich nur noch wütender machte. Also sagte ich es noch einmal, mit mehr Nachdruck, und jetzt musste er einfach hören, wie ernst es mir war. Vater aber ging nicht darauf ein. Er legte einen Arm um mich und begann zu erzählen. Und während er sprach, fiel mir sein herber Geruch auf, den ich mochte, weil er mich an Sommertage in diesem Garten erinnerte, die wir damit verbracht hatten, Unkraut zu zupfen, Radio zu hören, mit den Rädern durch die umliegenden Dörfer zu fahren, um schließlich erschöpft und schweißnass auf dieser Hollywoodschaukel kalte Limonade zu trinken. Während Vater mich also festhielt, erzählte er von Mutter, was er nicht oft machte, vom Schreiben und wie versöhnlich es sein konnte, etwas zu haben in dieser Welt, worin man gut sei, wirklich gut. Vater kam vom Hundertsten ins Tausendste. Ich konnte ihm kaum folgen, manches verstand ich überhaupt nicht.
Bis zum Mittag saßen wir so, und ich war mir sicher, dass Vater an diesem Vormittag so viel geredet hatte, wie sonst in einem Jahr. Mich hatte er nicht zu Wort kommen lassen, aber auch wenn er mich etwas gefragt hätte, anstatt einfach zu erzählen, ich hätte ihm eine Antwort verweigert. Dass ich alles andere als begeistert war, hatte er sicher gemerkt.
Irgendwann hatte ich mich aus seiner Umarmung befreit, hatte immer wieder tief geseufzt und demonstrativ meine Arme verschränkt. Das alles sah er nicht, oder er wollte es nicht sehen. Gegen zwölf stand er auf, holte unsere Sachen aus der Laube und schloss ab. Auf dem Weg zum Auto fragte er mich, ob ich Hunger hätte, und sagte dann: »Gut, gehen wir essen.«
Während der Fahrt legte Vater eines der Kriminalhörspiele ein, von denen er eine ganze Reihe besaß und die wir alle schon kannten. Trotzdem hörten wir sie immer wieder, und das war etwas, auf das ich mich jedes Mal freute, denn diese Stimmen gehörten genauso zur Fahrt in den Garten oder wieder nach Hause wie die Felder ringsherum, das öde Land, die heruntergekommenen Häuser in den Dörfern, die das Pech hatten, von einer Bundesstraße zerteilt zu werden.
Wir fuhren zu einem Chinesen in Ammendorf, aßen und tranken dazu Cola. Ich hatte damit gerechnet, dass Vater auch während des Essens erzählte. Das tat er aber nicht. Wir waren die einzigen Gäste und aßen schweigend, und ich wusste nicht, warum. Ich wusste weder, warum ich an diesem Tag nicht in der Schule war, noch, warum er mich in dieses Restaurant einlud. Das passte nicht zu ihm. Als wir den Nachtisch serviert bekamen, sah ich ihn an. Ich war immer noch wütend. Ich wollte ihn fragen, was mit ihm los war. Aber er kam mir zuvor, er fragte: »Was ist? Schmeckt es dir nicht?« Die Frage machte keinen Sinn, denn ich hatte den Nachtisch noch nicht angerührt, und das merkte nun auch Vater, und wir lachten, obwohl es gar nicht wirklich witzig war, sondern nur ein bisschen – aber es tat gut, jetzt mit ihm zu lachen, und ich merkte, dass meine Wut verflogen war. Auf einmal kam mir meine Frage sonderbar vor. Ich dachte: Was soll denn schon sein mit ihm? Warum nicht einfach mal auf Arbeit und Schule pfeifen und es sich gut gehen lassen? Also sagte ich nichts. Wir aßen auf, dann zahlte er, und wir gingen.
Vater war mir manches Mal seltsam vorgekommen, zum Beispiel wenn er abends nach der Arbeit stundenlang in der Küche saß und nichts weiter machte. Er sah dann aus, als warte er auf jemanden, aber es kam ja niemand. Ging ich an einem solchen Abend in die Küche, begrüßten wir uns, und ich sagte etwas, zum Beispiel: »Ich trinke jetzt Kakao« oder »Ich habe noch Hunger«, weil ich glaubte, mich rechtfertigen zu müssen, und er sagte dann etwas wie: »Ja, warum nicht« oder »Ja, gute Idee«.
Wir hielten vor dem Haus meiner Großmutter, im Süden der Stadt, ein Fünfgeschosser mit viel zu kleinen Fenstern, wie ich fand. Selbst im Sommer musste man das Licht einschalten, so dunkel war Großmutters Wohnung. Sie schien überhaupt nicht verwundert zu sein, uns zu sehen. Sie umarmte erst mich und dann Vater. Ich hatte die Schuhe schon ausgezogen und wartete darauf, dass auch Vater seine Schuhe auszog und wir uns ins Wohnzimmer setzten, wie wir es sonst auch machten, um Kaffee und Kakao zu trinken, ein bisschen fernzusehen und uns zu unterhalten. Aber Vater zog seine Schuhe nicht aus. Er blieb vor der Wohnungstür stehen und sah mich an, auf eine Art, die mir nicht gefiel. Großmutter ging ins Wohnzimmer und schloss die Tür hinter sich.
»Komm her«, sagte Vater, der immer noch vor der Tür stand. Als ich bei ihm war, drückte er mich, kurz und fest, dann schob er mich ein Stück zurück und hielt mich an den Schultern. Sein Blick beunruhigte mich, ohne dass ich wusste, warum.
»Mach’s gut, Junge.«
Er ging die Treppen nach unten, und ich hörte, wie die Haustür ins Schloss fiel. Im Wohnzimmer lief leise der Fernseher. Ich wartete eine Minute oder vielleicht auch zwei, dabei blickte ich immerzu auf die Fußmatte vor meinen Füßen. Schließlich kam Großmutter aus dem Wohnzimmer. Sie verlor kein Wort über Vaters Abwesenheit, stattdessen hielt sie eine Tüte mit Bonbons in der Hand. Ich hatte bisher zweimal im Krankenhaus gelegen: ein gebrochener Arm, da war ich acht, und eine gebrochene Kniescheibe, nur wenige Monate später. Jedes Mal, wenn Großmutter mich besuchen kam, legte sie mir eine große Tüte mit Bonbons auf das Beistelltischchen, zum Trost, wie sie sagte. Als ich sie nun sah, die Tüte in der Hand, mitleidig ihr Blick, da begriff ich, dass Vater nicht wiederkommen würde. Ich fing an zu weinen. Viel lieber wollte ich wütend sein, auf Vater, so wütend, wie ich es am Vormittag gewesen war. Aber das klappte nicht.
Erst Stunden später beruhigte ich mich etwas. Ich legte mich in Großmutters Bett, bekam eine Scheibe Brot und schließlich eine Handvoll Bonbons gereicht, dann kochte sie mir Tee, die Sorte, die sie trank, um besser schlafen zu können. Ich fragte sie, wo er sei und wann er wiederkomme. Sie sagte, er habe verreisen müssen, aber ganz bald komme er wieder. Sie sah an mir vorbei, als sie das sagte. Dass sie log, war nicht schwer zu erkennen. Aber ich erwiderte nichts, sondern trank meinen Tee und aß ein paar Bonbons, Großmutter zuliebe, denn sie schmeckten mir dieses Mal überhaupt nicht. Als ich einschlief, war es draußen noch hell.
2
Fortan wohnte ich bei meiner Großmutter. In den ersten Wochen nach Vaters Verschwinden stellte ich ihr immerzu dieselben Fragen: Warum kann ich nicht einfach nach Hause gehen, um dort auf ihn zu warten? Wann wird er mich wieder abholen?
Großmutter antwortete jedes Mal ausweichend. Ewig könne er ja nicht auf seiner Dienstreise bleiben, und sicher werde er bald anrufen. Dieses Wort fiel oft in jenen Wochen: Dienstreise. Immer dann, wenn ich mit Großmutter einkaufen ging und wir Nachbarn oder Bekannte von ihr trafen, oder wenn ich abends im Bett lag und weinte, was oft vorkam in dieser Zeit, und Großmutter mich trösten wollte. Aber ich wusste so gut wie sie, dass Vater nicht auf Dienstreise war. Er arbeitete für eine Firma, die Lacke vertrieb, und tatsächlich war er hin und wieder für eine Woche nach Frankreich oder Belgien gefahren. Ich blieb dann allein in unserer Wohnung und kurz bevor er ging, sagte er jedes Mal, ich solle aufpassen, dass niemand einbricht. Sicher hatte er nicht die geringste Ahnung, welche Angst er mir damit machte. Als er das erste Mal fuhr, im Oktober 1991, war ich zehn und eine Woche lang auf mich allein gestellt – obwohl Großmutter eifrig protestiert hatte, ich könne doch bei ihr übernachten. Tatsächlich schlief ich in diesen Nächten kaum und wenn doch, wachte ich immer wieder auf und fühlte nichts als schiere Angst, jemand könnte es auf unsere Wohnung abgesehen haben. Jedes Geräusch aus dem Treppenhaus schreckte mich auf, das Brummen des Fahrstuhls, schwerfällige Schritte, die an unserer Tür vorbeigingen, die tiefen Echos mir unbekannter Männerstimmen …
Vater hatte solche Dienstreisen jedes Mal schon Wochen vorher angekündigt und Unmengen Tiefgefrorenes und Mikrowellenessen gekauft, viel zu viel, um es in einer Woche aufzubrauchen. Er hatte mir Wäsche bereitgelegt, für gutes und für schlechtes Wetter, und Listen angefertigt mit den merkwürdigsten Telefonnummern, wie die des Giftnotrufs oder eine, mit der man seine EC-Karte sperren lassen konnte. Dabei hatte ich natürlich gar keine, ich bekam nicht einmal regelmäßig Taschengeld. Diese Liste hatte ich zunächst für einen Witz gehalten, aber Vaters Blick gab mir zu verstehen, dass er das ernst meinte.
Je mehr ich über meinen Vater nachdachte, desto überzeugter wurde ich, dass etwas ganz Grundlegendes mit ihm nicht stimmte, als wäre irgendetwas an ihm in Unordnung geraten und nie wieder zurechtgerückt worden. Zu dieser Zeit wusste ich noch nicht, warum Mutter wirklich starb, warum Vater zwar immer wieder vom Schreiben sprach, ich ihn aber nie schreiben sah, und erst recht wusste ich nichts von einem Bruder und all den anderen Dingen, von denen ich erst viel später erfuhr.
Darüber, dass etwas nicht mit ihm stimmte, hatte ich schon des Öfteren nachgedacht, mich aber jedes Mal geschämt, denn ich fühlte mich dann wie ein Verräter, schließlich ging es ja nicht um einen unliebsamen Nachbarn, den man einfach ignorieren konnte, sondern um meinen Vater.
Großmutter war eine kleine Frau. Ich war dreizehn, als Vater verschwand, überragte sie aber schon lange. Das wohl charakteristischste Merkmal an Großmutter jedoch war ihre Gutmütigkeit. Was ich in den kommenden Jahren auch anstellen sollte, sie verlor selten ein Wort darüber.
Ich hatte es mir zur Angewohnheit gemacht, Großmutters Kommoden und Schränke zu öffnen, um mir anzuschauen, was sich darin befand. Das waren zumeist Versicherungsunterlagen, Rechnungen oder auch Briefe ihrer Freundinnen, die zu lesen ich schon bald aufgab, weil sie mich langweilten. Ich suchte nie etwas Bestimmtes, wusste aber, dass es verboten war und ich in einen Bereich Großmutters eindrang, der mich nichts anging. Und gerade das sorgte dafür, dass ich eine diebische Freude empfand, wenn ich die Schubladen oder Schranktüren öffnete, um mir einen neuen Ordner vorzunehmen. Eines Tages fand ich in Großmutters Abwesenheit ein Foto in ihren Unterlagen, das Mutter in einem Hochzeitskleid und Vater im Anzug zeigte. Ich war mir sicher, dass Großmutter dieses Foto vor mir versteckt gehalten hatte, denn ich hatte es noch nie zuvor gesehen.
Ich hatte plötzlich keine Lust mehr, in ihren Unterlagen herumzusuchen, und ich gab mir dieses Mal auch keine Mühe, alles wieder so zu arrangieren, wie es vorher gewesen war, damit sie nicht merkte, was ich in ihrer Abwesenheit tat. Also ließ ich den geöffneten Ordner auf dem Teppich liegen. Ich hoffte, dass es sie verletzen würde und ich mich auf diese Weise rächen könnte. Dann zog ich mich an und verließ die Wohnung, auch wenn ich mich mit niemandem verabredet hatte und zunächst nicht wusste, was ich draußen machen sollte. Ich lief in die Stadt, was sicher anderthalb Stunden dauerte, ging in ein paar Geschäfte, sah mir Bücher und Zeitschriften an und lief irgendwann wieder zurück. Ich hätte zum Abendessen zu Hause sein müssen, kam aber erst gegen einundzwanzig Uhr. Anstatt mich zu bestrafen, sagte Großmutter bloß, dass ich das nächste Mal nicht so spät kommen solle.
Eine Woche später zerbrach ich ein Glas ihrer Vitrine im Wohnzimmer. Ich hatte herausfinden wollen, wie viel Kraft man benötigte, um diese Scheiben zu zerbrechen, denn sie waren ungeheuer dick. Das betrachtete ich als Herausforderung. Als sie mir danach einen Verband an der linken Hand anlegte und versuchte, das Blut aus dem Teppich zu entfernen, was sehr aufwendig war, und auch als Tage darauf jemand kam, um eine neue Scheibe einzusetzen, und sie anschließend die Rechnung unterschreiben musste – immer verhielt sie sich mir gegenüber, als wäre nichts weiter passiert. Ich wusste ja, dass ich Dummheiten beging, warum um Himmels willen bestrafte sie mich nicht dafür?
Monate später hielt ein Transporter vor Großmutters Haus. Sie hatte eine Firma damit beauftragt, meine Möbel aus dem Kinderzimmer zu holen. Damit war die Sache besiegelt, und ich kann mich nicht erinnern, das Wort Dienstreise jemals wieder aus ihrem Mund gehört zu haben. Bis zu diesem Tag, als zwei Spediteure alles vorbeibrachten, was sie in meinem Kinderzimmer finden konnten, hatten wir jeden Abend auf dem Sofa gelegen und ferngeschaut. Das Telefon hatte sie aus dem Flur geholt und auf einen Glastisch neben den Fernseher gestellt. Ich wusste genau, dass wir nur deshalb stundenlang fernsahen, um in unmittelbarer Nähe des Telefons bleiben zu können. Aber er rief nicht an.
Was mit seinen Sachen passiert ist, weiß ich nicht, jedenfalls habe ich sie nie wieder gesehen. Eine Zeit lang war ich wütend auf Großmutter, denn es gab einiges, das ich gerne behalten hätte. So hatte Vater sich wenige Monate vor seinem Verschwinden einen teuren Plattenspieler gekauft, außerdem eine Menge Platten, die ich zu meiner und Vaters Überraschung fast alle mochte. Ein paar Abende lang hatten wir sogar zusammen im Wohnzimmer gesessen, was wir sonst nie machten, und The Doors, Velvet Underground und Curtis Mayfield aufgelegt. Ich verstand kein Wort, aber mir gefiel, was ich hörte. Bei L. A. Woman fing ich an zu tanzen, was meinen Vater amüsierte, er rieb sich den Bart und lachte. Ich konnte machen, was ich wollte – jede Bewegung passte zur Musik, und ich bekam wie er einen Lachkrampf während ich tanzte, zuckend und überdreht. Kurz bevor das Lied zu Ende war, fing auch mein Vater an zu tanzen, und das erste Mal in meinem Leben hatte ich wirklich Spaß mit ihm, und er sicher auch mit mir. Das wiederholten wir ein paar Abende lang, bis er von einem Tag auf den anderen keine Lust mehr darauf hatte. Von da an saß er abends wieder in der Küche, die Zeitung vor sich, die er sicher längst schon ausgelesen hatte, und ich schlug die Zeit bis zum Schlafengehen wieder in meinem Zimmer tot, verunsichert und beschämt, denn ich hatte das Gefühl, etwas falsch gemacht zu haben, und war mir sicher, dass Vater nun doch gemerkt hatte, dass es einfach keine gute Idee war, sich mit mir abzugeben.
Ich wohnte schon anderthalb Jahre bei Großmutter und war der Meinung, dass wir uns gut arrangiert hatten. Nach Vater fragte ich schon lange nicht mehr. Dann kam die Müdigkeit, später die Schmerzen:
Ich sollte eine Tüte voll Herbstlaub für den Biologieunterricht sammeln und kniete auf der Wiese vor unserem Haus, zwischen den Wäschestangen und den großen knorrigen Eichen, klaubte die feuerroten Blätter zusammen und schaute jedes eine Weile an, denn mir gefiel, dass kein Blatt dem anderen glich. Ich hätte diesen Moment vermutlich längst vergessen, wäre da nicht plötzlich dieses unbedingte Verlangen nach einer Pause in mir aufgestiegen, eine wattige, diffuse Müdigkeit, die ich bis heute nicht losgeworden bin. Ich spreche nicht von der sanften Schwere, wie man sie nach einem harten Tag mit viel körperlicher Arbeit empfindet, denn zu diesem Gefühl gehört immer auch ein Stück Genugtuung, etwas geschafft, produziert oder hinter sich gebracht zu haben. Es war später Sonntagnachmittag, und ich hatte bis dahin nichts weiter gemacht, als in der Badewanne zu liegen, fernzusehen und in meinem Bett Comics zu lesen. Es gab also keinen Grund für diese Müdigkeit.