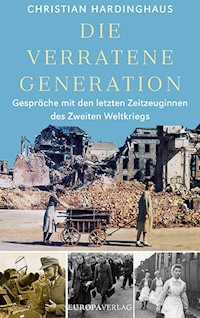
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Europa Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
14 Millionen Deutsche wurden gegen Ende des Zweiten Weltkriegs mit Gewalt aus ihrer Heimat vertrieben, über 2 Millionen von ihnen ermordet, mindestens 2 Millionen Frauen und Mädchen unter ihnen vergewaltigt. Die Thematisierung der Vertreibungsverbrechen gilt gesellschaftlich als Tabuthema – ebenso wie die Diskussion darüber, ob die alliierten Flächenbombardements mit 600000 Todesopfern Kriegsverbrechen waren. Der Großteil der zivilen Opfer war weiblich. Vergleichsweise wenig ist in der Wissenschaft über die Rolle der Frau im Nationalsozialismus geschrieben worden, so gut wie gar nichts über ihren Einsatz im Krieg. Dabei zwangen die Nazis, obwohl dies im Widerspruch zu ihrer eigenen Ideologie stand, beinahe jede deutsche Frau in den Kriegsdienst. Viele Millionen etwa schufteten als Rüstungsarbeiterinnen, 1,5 Millionen standen als Wehrmachtshelferin, Kriegshilfsdienstmaid oder Lazarettschwester mitten im Kriegsgeschehen. Frauen zitterten Nacht für Nacht in Luftschutzkellern um ihr Leben, wurden ausgebombt und verletzt, trauerten um ihre gefallenen Ehemänner. Sie waren auch die ersten Opfer der einrückenden Sowjetarmee, die keine Gnade mit ihnen kannte. Wenn sie das alles überlebt hatten, krochen sie am Ende auf Trümmern und räumten auf. Bis heute leiden diese Frauen an unverarbeiteten Kriegstraumata, für die sich zu wenige ihrer Nachkommen interessierten. Nach dem Erfolg seines Buches Die verdammte Generation über die Stigmata, denen die letzten Soldaten des Zweiten Weltkrieges ausgesetzt waren, lässt Historiker Christian Hardinghaus nun 13 der letzten Zeitzeuginnen einer verratenen Generation sprechen, die erst von den Nazis, dann von alliierten Soldaten missbraucht worden sind und bis heute gesellschaftlich als vermeintliche Mittäterinnen eines Verbrecherregimes gebrandmarkt werden. In historisch umfassenden und mutigen Einleitungen widerlegt er Vorurteile und appelliert an ein Überdenken unserer Erinnerungskultur.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 408
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
CHRISTIAN HARDINGHAUS
DIE VERRATENE GENERATION
Gespräche mit den letzten Zeitzeuginnendes Zweiten Weltkriegs
1. eBook-Ausgabe 2020
© 2020 Europa Verlag Zürich
Umschlaggestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich,
unter Verwendung von Fotos von © Galerie Bilderwelt / Tarker / Bridgeman Images,
© dpa / picture alliance, © ullstein bild – Backstein
Bildnachweis: Australian armed forces / Public domain S. 261; Bundesarchiv,
B 285 Bild-S00-00326 / Unbekannt / CC-BY-SA 3.0 S. 158, Bundesarchiv,
Bild 101I-668-7168-05A / Zoll / CC-BY-SA 3.0 / CC BY-SA 3.0 DE S. 245,
Bundesarchiv, Bild 146-1976-072-09 / CC-BY-SA 3.0 S. 160, Bundesarchiv, Bild 146-2003-0039 / CC-BY-SA 3.0 S. 137, Bundesarchiv, Bild 146-941 / U.S. Signal Corps / CC-BY-SA / Public domain S. 213, Bundesarchiv, Bild 183-Z0309-310 / G. Beyer / CC-BY-SA 3.0 / CC BY-SA 3.0 DE S. 297; Dowd J (Fg Off), Royal Air Force official photographer / Public domain S. 250; Fotoarchiv Städtisches Museum Göttingen, S. 236; https://www.facebook.com/761224653982196/photos/gubinchengubinek-kn%C3%BCppelbr%C3%BCcke/802354759869185/S. 122; Ivanovski Stevanus Napitupulu S. 96; Jean-Pierre Dalbéra from Paris, France / CC BY S. 319; Margaret Bourke-White (USAAF) / Public domain S. 286; Museum Kostrzyn S. 106; No 5 Army Film & Photographic Unit, Wilkes A (Sergeant) Public domain S. 315; Royal Air Force official photographer S. 267; Trolley Mission S. 190; Wikimdedia Commons / SchiDD / CC BY-SA S. 146; Wikimedia Commons S. 81, 124, – Authority/Forrás: Sudetendeutsche Stiftung/CC BY-SA S. 143, – Annemarie Schwarzenbach S. 227; alle anderen: privat
Redaktion: Franz Leipold
Layout & Satz: Robert Gigler, München
Gesetzt aus der Simoncini Garamond
Konvertierung: Bookwire
ePub-ISBN: 978-3-95890-333-3
Das eBook einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Alle Rechte vorbehalten.
www.europa-verlag.com
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Ansprechpartner für ProduktsicherheitEuropa Verlage GmbHMonika RoleffJohannisplatz 1581667 Mü[email protected]+49 89 18 94 [email protected]
INHALT
1.DIE DEUTSCHE ANGST VOR DER ERINNERUNG
Annäherung an die verratene Generation – und an uns selbst
2.FRAUEN IM ZWEITEN WELTKRIEG: VERFÜHRT, VERBRAUCHT, VERRATEN UND VERTRIEBEN
Stigma Mittäterin – Lücken in der Historisierung, Fehler in der Frauenforschung
Vom Herd an die Flak: Der Weg der Frau in den Kriegsdienst
3.FLUCHT UND VERTREIBUNG AUS DEN DEUTSCHEN OSTGEBIETEN
Einleitung – Eine historische Analyse der Vertreibungsverbrechen gegen die deutsche Bevölkerung
Gisela und die Schüsse auf der Westerplatte
Jutta und die Odyssee durch Schlesien
Ursula und die blutenden Panjepferdchen
Herta und die Wasserleichen der Sudeten
Inge und der Treck übers eisige Haff
4.BOMBENKRIEG GEGEN DEUTSCHLAND
Einleitung – Eine historische Bilanz »legaler« Kriegsverbrechen
Lore Josepha und der brennende Bahnhof
Marta und die mörderischen Tiefflieger
Erdmuthe und die Stiefel der Franzosen
Lore und Annelene – Hamburg und Gomorrha
Margarete im Bunker für Schwangere
Marianne in den Trümmern von Dresden
Helga und die Granaten im Tiergarten
Nachwort und Danksagung
Anmerkungen
Register
1. DIE DEUTSCHE ANGST VOR DER ERINNERUNG
ANNÄHERUNG AN DIE VERRATENE GENERATION – UND AN UNS SELBST
1945 haben Millionen Frauen aus den deutschen Ostgebieten wenn nicht ihr Leben, so doch ihre Heimat verloren, oft nachdem sie auf brutalste Art und Weise verprügelt, vergewaltigt und vertrieben worden sind. Auch im Westen haben Millionen ihren gesamten Besitz eingebüßt, ihre Wohnungen und Häuser wurden ausgebombt. Sie trauerten um ihre gefallenen Söhne, Väter oder Brüder oder warteten – oft vergeblich – auf die Rückkehr ihrer Männer aus der Kriegsgefangenschaft. Sie litten Hunger, froren, versorgten ihre Kinder, hielten den Rest der Familie zusammen. Sie blickten zurück auf sechs Jahre des schlimmsten Krieges der Weltgeschichte, in denen sie Nacht für Nacht in Luftschutzkellern und Bunkern um ihr Leben gezittert hatten und Tag für Tag dazu verpflichtet wurden, in Munitions- und Rüstungsfabriken Schwerstarbeit zu leisten.
Ob Vertriebene aus dem Osten, Flüchtlinge oder Opfer des alliierten Bombenkrieges, sie alle schauten aber auch nach vorne, um sich eine neue Heimat aufzubauen. Sie schufteten, rackerten sich ab und trugen wesentlich dazu bei, eine Zukunft für sich selbst und ihre Nachkommen – für uns – entstehen zu lassen. Als ihre Kinder erwachsen wurden, konnten sie in Frieden und relativem Wohlstand leben und wollten vom Anteil ihrer Mütter daran oder von ihren Erlebnissen aus dem Krieg oft nichts mehr hören. Die meisten Frauen dieser Kriegsgeneration haben das Geheimnis ihres persönlichen Schicksals mit ins Grab genommen. Einige der wenigen, die heute noch leben, wundern sich, ja ärgern sich, dass – bei all dem, was sie durchgemacht und worüber sie nicht sprechen konnten – ihre Enkel und Urenkel hauptsächlich wissen wollen, warum sie Hitler gewählt, nichts gegen die Nazis unternommen und den Mord an Millionen Juden und anderen unschuldigen Menschen einfach geschehen lassen hätten. Das sind genau die Fragen, die ihnen auch die Gesellschaft direkt oder – in den meisten Fällen – indirekt über Jahrzehnte gestellt hat. Man hat sie nicht gefragt, was sie gewusst haben, sondern hat ihnen von vornherein unterstellt, alles gewusst zu haben. In Zeitungsartikeln, Radiosendungen, Talkshows und im Internet erlebten sie, wie die Generationen ihrer Söhne und Töchter sowie ihrer Enkel und Urenkel schwere Vorwürfe gegen sie erhoben: »Ihr habt keinen Widerstand geleistet, ihr habt eure jüdischen Nachbarn nicht geschützt, ihr habt nicht sabotiert, ihr habt eure Männer einen Vernichtungskrieg führen lassen, ihr habt das alles erst möglich gemacht.«
Manche fragten zurück: »Was hätten wir denn tun sollen?« Oder sie nahmen eine Schutzhaltung ein: »Was hättet ihr denn getan?« Fragen, auf die es keine Antworten gab. Die letzten Zeitzeuginnen des Zweiten Weltkriegs haben nicht nur geschwiegen, weil man sie schon vorher mit Vorurteilen überschüttet hatte, sondern auch, um überhaupt wieder ins Leben zu finden. Sie taten das, weil sie selbst ihre Traumata vergessen und verdrängen wollten und für eine gewisse Zeit auch mussten.
In meinem vorangegangenen Buch Die verdammte Generation habe ich die Stigmata untersucht, denen sich die letzten Soldaten des Zweiten Weltkriegs ausgesetzt sahen. Als vermeintliche Täter vorverurteilt und an ihren eigenen Traumata durch Krieg und Gefangenschaft leidend, hatten diese Männer ähnliche Gründe, nicht über ihr Erlebtes zu sprechen. Durch die vielen Interviews, die ich für dieses Buch mit verschiedenen Frauen geführt habe, kamen noch andere Gründe für ihr Schweigen an die Oberfläche. Die meisten Frauen dieser Generation mussten oder müssen sich eingestehen, dass sie sich vor dem Krieg von der nationalsozialistischen Bewegung haben mitreißen lassen, ja dass sie teilweise davon begeistert waren. Nicht von ihren politischen Inhalten, nicht von ihrem Rassedenken und ihrem Antisemitismus, aber von ihrer Dekoration und einer bunten Fassade, die sie nicht – oder erst viel zu spät – durchschauen konnten.
Die Mehrheit der Mädchen nahm an den gemeinsamen Fahrten, Zeltlagern, Liederabenden und Sportfesten des Bundes Deutscher Mädel (BDM) mit Begeisterung teil. Sie haben die Kameradschaft genossen, während ihres Pflichtjahres oder Landjahres Abenteuer erlebt und geglaubt, ein bedeutender Teil eines blühenden, neuen großen Deutschlands zu sein. Sie haben mit Hakenkreuzfähnchen in der Hand den Besuch des Führers in ihrer Stadt sehnlichst erwartet und ihm gemeinsam zugejubelt. Wie erklärt man das denen, die sich das nicht vorstellen können? Die glauben, sie hätten hinter den Vorhang schauen können, die Pläne der Nazis durchschauen müssen? Die Frauen hatten Zweifel, dass ihre Kinder und Enkel ihnen den Sinneswandel, den die allermeisten mit Beginn des Krieges durchmachten, abnehmen würden. Viele haben das Unrecht gesehen, Frauen haben im Gesamten vermutlich mehr von der Ausgrenzung von Juden und anderen Minderheiten und von ihrer Verfolgung durch den NS-Staat mitbekommen als ihre Männer im Krieg. Nur da war es zu spät. Wie erklärt man den Kindern und Enkeln, was in einem totalitären Terrorregime für den Einzelnen möglich ist? Können sie sich bei all den Freiheiten, die für sie heute selbstverständlich sind, überhaupt noch vorstellen, was es bedeutet, in einer Diktatur zu leben? Das Kommunikationsproblem, das die Zeitzeuginnen mit ihren Kindern der ersten Nachkriegsgeneration hatten, ist verständlich. Auf beiden Seiten stand die Angst. Die einen fragten nicht, weil sie sich Sorgen machten, ihre Mütter könnten zu viel gewusst und nichts dagegen getan oder sogar begeistert mitgemacht haben. Die anderen erzählten nichts aus Sorge, man würde ihnen nicht glauben oder ihr persönliches Leid als unangebracht empfinden hinsichtlich der furchtbaren Gräuel, die von den Nazis begangen wurden und über die man die Gesellschaft recht schnell aufgeklärt hatte. Durch das Schweigen, das zwischen diesen Generationen herrschte, hat sich jedoch zu viel Unausgesprochenes weitergetragen. Vorurteile und Stereotypen haben in der dritten und vierten Nachkriegsgeneration weiter Bestand. Das Verdrängte, Unbesprochene und Falschverstandene führten dazu, dass unsere Gesellschaft heute in eine große Gefahr schlittert, eigentlich schon mitten drin ist, denn nicht weniger als unsere gesamte Erinnerungskultur steht aktuell auf dem Prüfstand und auf der Kippe. Auch wenn wir selbst das noch gar nicht umfassend überblicken können, so treten die Folgen der undifferenzierten Betrachtung unserer Vergangenheit doch mit jeder Krise, der wir aktuell ausgesetzt sind, immer deutlicher hervor.
Bevor ich also die verratene Generation bespreche und danach die letzten Vertreterinnen selbst sprechen lasse, möchte ich auf die Folgen des Verrats an uns selbst, im Hier und Jetzt, eingehen. Ein Beispiel aus dem letzten Sommer soll helfen, die Problematik zu verdeutlichen:
Am Sonntag, den 7. Juli 2019 kommt ein ICE der Deutschen Bahn vor Frankfurt am Main zum Stehen. Eine Passagierin wird in diesem Moment Zeuge, wie der Zugführer bekannt gibt: »Liebe Fahrgäste. Unser Zug hat wegen der Entschärfung einer Bombe, die die Westalliierten auf die unschuldige Bevölkerung Frankfurts abgeworfen haben, zurzeit 45 Minuten Verspätung.«1
Die Bahnfahrerin ist perplex, geschockt, verlangt beim Zugbegleiter auf der Stelle, den Zugführer sprechen zu dürfen, was ihr aus datenschutzrechtlichen Gründen verwehrt wird. Damit kann sie sich nicht abfinden, macht von ihrem Beschwerderecht Gebrauch und lässt ihrem Ärger auf der Facebook-Service-Seite der Deutschen Bahn freien Lauf. Innerhalb von Minuten erscheinen unter ihrem Beitrag Hunderte Kommentare von Bahnkunden, die sich darüber streiten, ob der Zugführer ein Nazi ist oder nicht. Da das Social Media Team der Bahn nicht reagiert, unterrichtet die Kundin selbst verschiedene Medien über den Vorfall. Schließlich berichtet Stern Online2. Darauf muss das unter Druck gesetzte Unternehmen reagieren und lässt einen Sprecher zum Facebook-Beitrag der Kundin einen offiziellen Kommentar abgeben: »Hallo (…), was Sie da erlebt haben, tut mir sehr leid. Kulturelle Vielfalt, Offenheit, Toleranz und Respekt sind Grundwerte der Deutschen Bahn. Rassistische und fremdenfeindliche Äußerungen widersprechen diesen Unternehmenswerten.«3
Ich kann diesen Mist nicht mehr lesen, kommentiert ein User darunter. Immer die gleichen Phrasen parat. Die weitere Diskussion dreht sich darum, wer im vorliegenden Fall denn eigentlich rassistisch beleidigt worden ist. Die Kundin ohne Migrationshintergrund, die unschuldig ausgebombten Zivilisten im Zweiten Weltkrieg oder tote Nazis? Einige Kommentatoren schießen deutlich über das Ziel hinaus und feinden die Passagierin an, der aber auch die Entschuldigung der Bahn nicht reicht. Das, was ihr widerfahren ist, sei einfach zu schlimm, um Ruhe geben zu können. Sie denkt dabei weniger an sich selbst als an die Schäden, die die potenziell mitreisenden und somit mithörenden Kinder und Jugendlichen durch die Ansage des Zugführers erlitten haben könnten.4 Sie insistiert weiter in den Medien, sodass die Bahn schließlich bekannt gibt, den Zugführer entlassen zu haben. Danach wird der inzwischen auf Tausende von Kommentaren angewachsene Thread gelöscht. Von wem, das bleibt unbekannt. Die Bahn will es nicht gewesen sein. Die Kundin fühlt sich in ihrer Aufklärungsarbeit nun erst recht behindert. Ein nach dessen eigener Aussage mit ihr befreundeter Journalist bietet ihr an, einen ausführlichen Bericht über den Skandal zu schreiben. Am 11.7.2019 veröffentlicht so Gerrit Wustmann einen ausdrücklich nicht als Kommentar und damit nicht als Meinungsäußerung gekennzeichneten Artikel im Netzmagazin des Heise-Verlags Telepolis. Rechter Shitstorm nach Nazi-Durchsage im ICE nennt er den Beitrag und mahnt darin an, »dass die alliierten Bomben im Jahr 1945 eine Nation aus Mitläufern und Mittätern, die das Naziregime erst ermöglichten, dorthin befördert haben, wo sie hingehört – und bleiben wird.«5
Wustmann zieht ein beachtliches gesellschaftliches Fazit und scheut nicht mal davor zurück, dafür den damals aktuellen rechtsradikalen Mord an einem Politiker zu instrumentalisieren:
Sie [die Nazis] arbeiten bei der Bahn, stehen morgens beim Bäcker vor uns in der Schlange (…). Und sie sitzen, wie wir wissen, in der Polizei, der Bundeswehr, dem Verfassungsschutz und anderswo. […] Man darf, man muss es mit Walter Lübcke sagen: Es steht ihnen frei, das Land zu verlassen, dessen Werte ihnen so zuwider sind. Deutschland braucht sie nicht. Doch solange sie hier sind und Menschen beschimpfen, bedrohen und im Extremfall sogar ermorden, ist es Aufgabe von uns allen, ihnen Gegenwind zu bieten und sie nicht durchkommen zu lassen. Und das heißt auch: Keineswegs zu schweigen, wenn so etwas geschieht wie im ICE von München nach Frankfurt vor wenigen Tagen.6
Der Artikel erreicht innerhalb kürzester Zeit eine Rekordanzahl an Kommentaren in der Internetgeschichte des Magazins Telepolis. Die meisten User fühlen sich verletzt, andere feiern die deutliche »Ansage gegen Nazis«. Die Diskussion dreht sich vor allem um die Fragen, ob es sich bei dem Gefälligkeitsartikel für seine Freundin – eben jene Bahnreisende vom 7. Juli 2019 – um eine Meinungsäußerung oder um Volksverhetzung handelt und warum ausgerechnet dieser Beitrag nicht als Kommentar gekennzeichnet ist, wie sonst auf dem Portal üblich.
Diese wahre Geschichte aus dem Jahr 2019 sagt viel über den derzeitigen katastrophalen Zustand unserer Erinnerungskultur aus. Zunächst einmal: Die Durchsage des Zugführers war absolut fehl am Platz. Sein Job ist es, einen Zug sicher in den Bahnhof zu bewegen. Die Fahrgäste bezahlen ihn nicht dafür, dass er sie in Geschichte unterrichtet, und dafür ist er auch nicht ausgebildet. Darüber können sich Bahnkunden ärgern, und deswegen kann man sich beschweren. Das, was allerdings die verärgerte Zugreisende und der geschichtsvergessene Reporter im Nachgang veranstalteten, ist nicht nur übertrieben, sondern hysterisch und gefährlich. Auch Wustmann kommt nämlich seiner Pflicht als Journalist nicht nach. Seine Meinung kann er privat äußern oder als journalistischen Kommentar ausweisen. Ansonsten könnten Leser seine Ansichten für ausgewiesene Fakten halten. Rein inhaltlich gesehen, ist jedoch das, was der Zugführer gesagt hat, nicht falsch. Vermutlich hat Wustmann jedoch nicht recherchiert, dass die 26 000 Tonnen Bomben, die während des Zweiten Weltkriegs auf Frankfurt abgeworfen wurden, fast 6000 Menschen getötet haben. Der Großteil der Toten waren – wie im gesamten Bombenkrieg gegen Deutschland – Kinder und Frauen, die als wehrlose Zivilisten zu Opfern des Krieges gezählt werden, und nicht zu Tätern oder Mitläufern, die nichts anderes verdient hätten. Auch die über 1000 Zwangsarbeiter und Kriegsgefangenen, die durch die Bombardements auf Frankfurt umkamen – und an die Herr Wustmann und seine Freundin vermutlich ebenfalls nicht gedacht haben –, sind keine Täter sowie auch nicht Dutzende Juden, die Frankfurter Bürger in ihren durch Bombentreffer eingestürzten Kellern versteckt haben.
Wustmann rechtfertigt die massiven Flächenbombardements auf Deutschland, die nach heutigen Maßstäben völkerrechtlich als Kriegsverbrechen gewertet werden müssen und die bereits im Zweiten Weltkrieg heftig verurteilt worden sind. So haben auch die United States Army Air Forces (USAAF) von vornherein die Strategie des verantwortlichen britischen Premierministers Winston Churchill nicht mitgetragen, durch Bomben so viele Zivilisten wie möglich zu töten. Dem dafür beauftragten Bomberkommando der Royal Air Force (RAF) unter Führung von Luftmarschall Arthur Harris ging es bei diesen massiven Flächenbombardements nicht um militärische Ziele, sondern das sogenannte Moral Bombing sollte durch das Töten von Zivilisten und Zerstörung von Lebensraum die Moral der Deutschen brechen. Am Ende des Krieges musste sich die Führung der RAF eingestehen, dass die Strategie nicht aufgegangen war, so wie auch die Amerikaner analysierten, dass ihre »Präzisionsangriffe« auf industrielle und militärische Ziele den Kriegsverlauf nicht wesentlich beeinflusst hatten. Noch weilen viele Tausend Menschen unter uns, die sich an die grausamen Bombennächte erinnern, die insgesamt 600 000 Zivilisten das Leben kosteten. Sie haben nicht nur ihr Hab und Gut verloren, sondern auch ihre Kinder, Geschwister und Eltern zu Grabe getragen, falls das Feuer noch etwas von ihnen übriggelassen hat. Dass allein die Erwähnung des Umstandes, dass die alliierten Bomben unschuldige Menschen töteten, heute zu einem derartigen Skandal führt, dass jemand, der sich in entsprechender Weise äußert, wie selbstverständlich in der Presse als »Nazi« bezeichnet und mit rechtsextremistischen Mördern gleichgesetzt wird, ist sehr bedenklich – genauso wie die im Artikel geäußerte, historisch aber untragbare Kollektivschuldthese, nach der ein ganzes Volk Schuld am Krieg trüge.
Über dieses Beispiel sollte deshalb gesprochen werden, weil es kein Einzelfall ist, sondern ein strukturelles Problem unserer Gesellschaft widerspiegelt, in der eine Erinnerung an die Toten des alliierten Bombenkrieges so gut wie keine Rolle mehr spielt. Sobald jemand der Opfer gedenken möchte, wird er als vermeintlicher Nazi entlarvt, und sogenannte Antideutsche machen sich bereit, um in sozialen Netzwerken Verbrechen gegen Deutsche zu feiern. Bomber Harris do it again ist dann eine beliebte Parole, die sich zum Beispiel in Hashtags, nicht selten auf T-Shirts oder sogar auf entblößten Oberkörpern junger Politikerinnen aus dem linksextremistischen Spektrum wiederfindet. Das Feiern von bei lebendigem Leib verbrannten unschuldigen Flüchtlingen, Frauen und Kindern kann allerdings nicht antifaschistisch sein, sondern muss dem Hass auf ein Volk, auf einen Staat geschuldet sein.
Schon Zeitgenossen gaben dem Organisator des Aerial Bombings den Spitznamen Butcher Harris (Harris, der Schlächter). Nicht die Deutschen taten das, sondern die britische Gesellschaft, denn sein Bombenkrieg kostete über 55 000 RAF-Soldaten, die während der Bombardements abgeschossen wurden, das Leben. Auch sie sind sinnlos geopfert worden. Ihnen hat es keinen Spaß gemacht, Bomben über den Städten abzuladen. Das alles weiß aber ein beträchtlicher Teil unserer Gesellschaft heute nicht, weil öffentlich nicht darüber gesprochen wird. Allein die Thematisierung von deutschem Leid im Zweiten Weltkrieg kann nämlich dazu führen, dass jemand seinen Job verliert. Der Zugführer ist nur eines von vielen aktuellen Beispielen unserer an manchen Stellen bereits sogenannten »Cancel-Culture«.
Und heute, ein Jahr nach dem »ICE-Vorfall«, hat sich daran etwas verändert? Immerhin liegen der drittheißeste und bedenklichste Sommer aller Zeiten und die Corona-Pandemie dazwischen. Aber weil wir unsere Vergangenheit nicht verstehen, wird auch die Bekämpfung von realen und drängenden Problemen immer mehr zu einer ideologischen Schlacht. Kritiker der Fridays-for-Future-Bewegung werden umgehend zu »Klimaleugnern« gemacht, Skeptiker der staatlich beschlossenen Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie zu »Coronaleugnern«. Die gewollte sprachliche Gleichsetzung zu Holocaustleugnern ist offensichtlich, denn um Haltungen, die nicht der Mehrheitsmeinung entsprechen, im Keim zu ersticken, werden Kritiker pauschal mit Verschwörungstheoretikern und Nazis gleichgesetzt. Menschen, die einen SUV fahren, sind »Klimanazis«, Bürger, die andere auf das Tragen von Masken hinweisen, »Coronazis«. Es geht in diesem Land augenscheinlich nichts mehr ohne Nazi-Vergleiche. Auch Politiker und Medien bedienen sich dieser geschichtsrelativierenden Sprache: So erregte ein für den WDR tätiger Journalist Ende des vergangenen Jahres große mediale Aufmerksamkeit, nachdem er über Twitter pauschal deutsche Omas als »Nazisäue« bezeichnet hatte.7
Und damit sind wir wieder angelangt bei der verpatzten Erinnerungskultur, in deren Zentrum hierzulande eigentlich die Erinnerung an Holocaust und Judenverfolgung durch die Nazis steht. Nur kann man sich nicht aufrichtig erinnern, wenn die Verbrechen des Dritten Reiches verharmlost werden. Und das werden sie durch das pauschale Darstellen legitimer Meinungen, beispielsweise zum Klima oder zu Corona, als nationalsozialistisch. Diese sprachliche Diskreditierung ist eine Gefahr für das kollektive Gedächtnis, und wir müssen gemeinsam innerhalb unserer Gesellschaft analysieren, wie es zu diesen Entgleisungen kommt und was wir dagegen tun können. Wir leben heute in dem historisch einzigartigen Luxus, dass wir den kleinsten Moment – zu jeder Zeit in beliebiger Art und Weise – in Wort und Bild für die Ewigkeit festhalten können. In einer Welt, in der wir uns auf digitale Medien verlassen, die uns an alles erinnern, haben wir jedoch scheinbar selbst vergessen, wie das funktioniert. Angehörige junger Generationen schaffen es nicht mehr, sich in ihre Vorfahren hineinzuversetzen, die sich ohne Internet erinnern mussten. Die Methoden, wie sie die berühmten Personen und Ereignisse ihrer Zeit festhielten, gefallen ihnen nicht, weil man sie nicht einfach per Klick löschen kann. Im Jahr 2020 leben zunehmend Menschen in Deutschland, die Angst vor Namen, Bildern und Statuen haben. Am Bismarck-Denkmal im Park um die Ecke bleibt man besser nicht stehen, denn der war kein Demokrat. Eine traditionsreiche westfälische Universität soll den Namen eines deutschen Kaisers nicht mehr tragen, denn der besaß Kolonien. Literarische Klassiker werden umgeschrieben und dem aktuellen Zeitgeist angepasst. Alles Vergangene gerät in Verdacht, derzeit vorgelebte Moralvorstellungen zu gefährden, an die sich verängstigte Menschen klammern, um in einer scheinbar grenzenlos gewordenen Welt Halt zu finden. Die deutsche Sprache wird aus Angst bis zur Unkenntlichkeit zersetzt. Moderatoren im Fernsehen verhaspeln sich oder stottern freiwillig, um ja allen möglichen Geschlechteransprachen gerecht zu werden. Markus Lanz stellte in seiner Sendung zu Recht klar:
Die Lage einer verfolgten Minderheit in China wird keinen Deut besser, wenn man von Uigurinnen und Uiguren redet und sich dabei die Zunge verrenkt. Denn dann achten die Zuschauer nur noch auf den Versprecher und kriegen gar nicht mehr mit, worum es eigentlich geht.8
Die Angst davor, Stellung beziehen zu müssen und Dinge differenziert zu betrachten, führt zu immer radikaleren Formen gesellschaftlicher Umgestaltung, die längst nicht mehr progressiver, sondern erpresserischer und spießiger Natur sind. Schulen und Universitäten werden unter Druck gesetzt, sich neue Namen auszudenken, wenn der Namenspatron in irgendeinem Kontext in seiner Zeit ein für heutige Ohren falsch klingendes Wort ausgesprochen hat. Und wenn der letzte Betreiber einer Mohrenapotheke moralisch dazu genötigt wurde, diese umzubenennen, weil die Menschen lieber daran glauben wollen, dass die Apotheker des Mittelalters mit Schimpfwörtern ihre Kundschaft angelockt haben statt mit Ehrungen, werden die Protestler dennoch nicht zufrieden sein. Vielleicht stehen dann als Nächstes die zahlreichen Paracelsus-Apotheken auf dem Prüfstand, denn ihr Namenspatron hat zu seiner Zeit doch bestimmt irgendwas gesagt, was man aber heute so nicht mehr äußern würde.
Doch all das ändert nichts, denn wir sind in Wahrheit unzufrieden mit uns und verlagern die eigenen und aktuellen Probleme nur auf Persönlichkeiten der Vergangenheit. Menschen versinken in Schuld und Scham vor sich selbst und versuchen, ihre Vorfahren dafür verantwortlich zu sprechen. So etwas hat es in der Form noch nie gegeben, und das wird die Wissenschaftler der Zukunft vor das ein oder andere Rätsel stellen. Was ist unsere Erinnerungskultur wert, wenn wir gar nicht mehr den Versuch wagen, die Vergangenheit zu verstehen?
Als Historiker fallen mir mit zunehmender Sorge Kommentare unter Artikeln in sozialen Netzwerken auf, die an Judenverfolgung, Reichspogromnacht oder die Befreiung von Auschwitz erinnern. Erstaunlich wenig wird dabei diskutiert. Die meisten User hinterlassen einen traurigen oder einen wütenden Smiley. Für viele ist das Maximum, was sie dazu äußern, eine Phrase wie: »Schrecklich, das darf sich nie wiederholen!« Wie aber wollen wir eigentlich verhindern, dass etwas nicht noch mal passiert, wenn wir nicht verstehen, was das überhaupt ist, das nicht wieder geschehen soll? Zu viele junge Menschen können sich den Holocaust einfach nicht mehr vorstellen. Was ist es, dieses »das«, das sich nie wiederholen darf?
»Alle haben es gewusst!«, »Keiner hat etwas dagegen getan!« – das sind weitere Klassiker digitaler Erinnerungskommentare, wenn es um den Holocaust geht. Hat denn jemand mal nach dem »es« gefragt? Was ist es, das »es«, das alle gewusst haben? Dass Nazis Juden diskriminiert, diffamiert, weggesperrt und vertrieben haben? Dann lautet die Antwort ja, das haben wahrscheinlich alle gewusst, die in der Zeit des Dritten Reiches gelebt haben und sehen, hören oder lesen konnten.
Ist das »es«, dass sie Millionen Juden in Vernichtungslagern durch Vergasung, Massenerschießung und Folter systematisch ermordeten? Nein, das hat wahrscheinlich niemand gewusst, der nicht unmittelbar mit dieser auch für damalige Verhältnisse unvorstellbaren Perversion betraut gewesen ist. Gerade durch strengste Geheimhaltung und Verschleierung wurde der Genozid erst möglich. Nur wir, die wir im Zeitalter unbegrenzter Information leben, können oder wollen nicht reflektieren, dass etwas geheim gehalten werden konnte, von dem wir selbst doch täglich lesen und hören. Die meisten Deutschen heute scheinen überhaupt keine Vorstellung mehr davon zu haben, was eine Diktatur ist und wie eingeschränkt darin Wahrheitsfindung und Handlungsspielräume für den Einzelnen noch sind – und das, obwohl das Dritte Reich erst vor 75 Jahren untergegangen ist. Werden wir, sofern sie einst hoffentlich den Tag der Freiheit erleben dürfen, den Nordkoreanern auch vorwerfen, sie hätten alles gewusst und keiner hätte etwas gegen die Kim-Dynastie unternommen?
Was wollen wir den zukünftigen Generationen hinterlassen? Möchten wir, dass sie noch an den Holocaust erinnern? Dann sollten wir selbst nicht vergessen, wie dieses Verbrechen möglich wurde und wer es zu verantworten hat, und nicht platte und falsche Erklärungsmodelle unreflektiert nachplappern. Wir müssen deutlich zwischen Opfern und Tätern dieser Zeit unterscheiden. Dafür ist eine multiperspektivische Erinnerungskultur unerlässlich. Die Geschichten, die wir über den schlimmsten Krieg der Menschheitsgeschichte erfahren, sind weitestgehend auf entweder eine Täter- oder eine Opferperspektive beschränkt. Das Erleben des Krieges aus der Perspektive der überwältigenden Mehrheit – der einfachen Leute, Soldaten wie Zivilisten –, die weder das eine noch das andere waren, klammern wir aus, denn wir bekommen immer dann Probleme, wenn es darum geht, Grautöne zuzulassen.
Dass heute jeder in Verdacht gerät, ein Nazi gewesen zu sein, wenn er sich nicht offensichtlich und am besten von Anfang an im Widerstand betätigt hat, ist ein trauriges Ergebnis undifferenzierter Bewertungen unserer Vergangenheit. Wir streichen einfach bedeutende Teile der eigenen Geschichte aus und verleugnen uns damit selbst. Die Bürde, die wir uns auferlegt haben, ist der Vergleich mit dem Holocaust. Dieses grausamste Verbrechen der Menschheitsgeschichte steht in unserem kollektiven Gedächtnis über allem, sodass Historiker, Journalisten oder Literaten sich kaum trauen, von den vielen Gräueln zu erzählen, die auch am deutschen Volk begangen wurden. Sie haben Angst, dadurch die Verbrechen der Nazis zu verharmlosen, nicht politisch korrekt zu sprechen oder in die rechte Ecke gestellt zu werden. Es ist eine selbstauferlegte Belastung, niemand verlangt das von Deutschland. Nicht unsere ehemaligen Kriegsgegner und nicht die Opfer des Holocausts. Inzwischen ist das Gegenteil der Fall. Während sich in anderen am Zweiten Weltkrieg beteiligten Ländern längst das Bedürfnis zu einer differenzierten Aufarbeitung der Geschehnisse durchgesetzt hat, stellen wir uns dieser Herausforderung nicht, beteiligen sich unsere Politiker immer noch nicht an gemeinsamen Veranstaltungen zum Kriegsgedenken mit anderen Nationen, solange nicht der Holocaust im Fokus steht. Die deutsche Gesellschaft sucht sich einmal mehr eine gefährliche Sonderrolle aus. Es ist die Opferrolle des Täters oder vermeintlichen Täters, aus der wir uns nicht befreien können oder wollen. Damit versetzen wir uns allerdings auch nicht in die Lage, angemessen auf die wichtigen Probleme dieser Zeit zu reagieren, die nach Entscheidungen, Kompromissen und Einigung verlangen, und wir sind – zumindest kulturhistorisch – kein besonders interessanter Partner für europäische Nachbarländer. Unser kränkster Patient bleibt die eigene Vergangenheit.
Das zunehmende Schwarz-Weiß-Denken nimmt uns die Möglichkeit zu erinnern. Es gab aber keine besseren Täter oder schlechteren Opfer. Ja, auch wenn das Nazi-Regime die mit Abstand schlimmsten Verbrechen begangenen hat, so bleibt ein Unrecht ein Unrecht, ganz gleich, in welchem Ausmaß es geschehen ist. Ja, im Nationalsozialismus und im Zweiten Weltkrieg hat es deutsche Opfer gegeben, viele Millionen. Nein, nicht nur durch Nationalsozialisten selbst. Unschuldige Deutsche wurden zu Leidtragendenden von Verbrechen anderer am Krieg beteiligter Nationen. Und davon waren nicht nur die Zivilisten betroffen, die den Bombenkrieg durchlitten haben; Unrecht ist auch vielen Millionen deutscher Flüchtlinge widerfahren, die gegen Kriegsende Opfer von sowjetischen, polnischen oder tschechischen Vertreibungsverbrechen geworden sind. Auch hier sperren wir uns gegen Erinnerung und Aufarbeitung. Für viele ist eine Diskussion darüber mit dem Satz »Wer Wind säht, wird Sturm ernten« beendet. Differenzierung ausgeschlossen! Mit einer solchen Einstellung wird man nicht in der Lage sein, zukünftige Kriegsverbrechen erkennen und verurteilen zu können. Der britische Historiker R. M. Douglas schreibt 2012 in einem bemerkenswert ehrlichen Buch, die Vertreibungsverbrechen an Deutschen seien das bestgehütete Geheimnis des Zweiten Weltkriegs.9 Das Ganze erscheint umso paradoxer, wenn einem gewahr wird, dass diese zu den am besten dokumentierten Massenverbrechen der Geschichte zählen. Doch die Dokumente wurden verschlossen. Man hatte Angst, dass der Frieden mit anderen Ländern in Europa in Gefahr geraten oder der Holocaust relativiert werden könnte, wenn den Deutschen Ausmaß und Bilanz der Grausamkeiten bekannt würden. Erst 1981 hat die Bundesregierung auf massiven Druck von Vertriebenenverbänden die Archive zu den Dokumenten der Vertreibungsverbrechen geöffnet. Doch geändert hat das bis heute kaum etwas. Viel zu wenige wollen darüber sprechen, und den meisten ist der Grund dafür nicht bewusst: Es liegt daran, dass eine Auseinandersetzung mit dem Thema sie zu sehr schmerzen würde, und genau deshalb winken sie ab. Margarete Mitscherlich hat schon früh erkannt, dass sich die Deutschen als unfähig erweisen, zu trauern. Deswegen schieben sie beiseite, erinnern nicht, verdrängen, sehen weg.
Wir sollten uns der Aufarbeitung der Vergangenheit endlich mit Vernunft stellen. Schweigen wir weiter über die unangenehmen Themen, überlassen wir Extremisten die Erzählung, die ihrerseits kein Interesse daran haben, die Erinnerung an den Holocaust korrekt weiterzugeben. Dafür ist es notwendig, da hinzuschauen, wo es besonders wehtut und auch Tränen kostet. Wir sollten das tun, weil unsere Erinnerungskultur aus den Fugen geraten ist. Wir sollten das tun, wenn wir wollen, dass unsere Nachfahren das eigenständige Erinnern nicht verlernen, dass sie in der Lage sein werden, nicht wegzusehen, wenn sich Spielarten des schon einmal Dagewesenen wiederholen, wenn wir hoffen, dass sie auch um uns und unsere Hinterlassenschaften trauern. Das Trauern gehört zu den essenziellen Bedürfnissen eines Menschen, gleichzeitig aber zu seinen größten Herausforderungen. Erledigen wir die historische Trauerarbeit nicht, dann verraten wir unsere eigene Geschichte – und damit verraten wir letztendlich uns selbst.
In diesem Buch präsentiere ich die Zeitzeugenberichte in zwei Teilen: Vertreibungsverbrechen und Bombenkrieg. Die Bilanz des Bombenkrieges und die Ausmaße der Vertreibungsverbrechen dürften den wenigsten bewusst sein. Sie sind aber von großer Bedeutung, um den Geschichten der Zeitzeuginnen bestmöglich folgen zu können. Diese Themen indes sind so essenziell für die Erlebnisse der zu beschreibenden verratenen Generation, dass ich zu beiden eine historische Hintergrundanalyse vorangestellt habe; sie leitet jeweils den entsprechenden Teil ein, unter dem dann die einzelnen Episoden der Zeitzeuginnen folgen. Die Schwerpunkte sowohl für die Berichte von Flucht und Vertreibung als auch für den Bombenkrieg fallen auf den letzten Abschnitt des Krieges. Ich habe mich aus Gründen der Chronologie der vorhandenen Geschichten dafür entschieden, die Vertreibungsverbrechen zuerst zu behandeln. Dabei setzt der Bericht der ersten Zeitzeugin, die eine Fluchtgeschichte erzählt, einen weiteren Schwerpunkt auf den Beginn des Krieges, während der letzte, der eine Bombenkriegsgeschichte wiedergibt, den Fokus auf die allerletzten Tage des Dritten Reiches legt. Auch wenn die Schwerpunkte aller Geschichten das Kriegsgeschehen betreffen, so ist doch jede Zeitzeugin in ihrer gesamten Vita beschrieben. Bedeutende Rollen spielen dabei natürlich einerseits die jeweiligen Vorprägungen im Dritten Reich, andererseits auch die ersten Monate der Nachkriegszeit, die die Protagonistinnen als Mädchen beziehungsweise junge Frauen schildern. Zu Beginn und am Ende der einzelnen Episoden werfe ich einen Blick auf die Zeitzeugin in ihrem heutigen Alter und nehme retroperspektivische Ansichten auf die Zeit des Nationalsozialismus mit auf.
Insgesamt habe ich 23 professionelle Vollinterviews mit einzelnen Zeitzeuginnen geführt, die teilweise persönliche Treffen an mehreren Tagen erforderten. Mindestens ein Dutzend weitere Interviews oder Vorgespräche habe ich telefonisch abgehalten. In diesen Fällen ist es nicht zu einem Treffen gekommen, entweder weil das Erlebte einer bereits für das Buch eingeplanten Geschichte zu sehr ähnelte oder an gleichem Ort spielte, oder es war mir durch die Bestimmungen der Corona-Krise nicht möglich, diese Frauen zu treffen. Das war für mich, besonders aber für die Damen, die sich gerne persönlich verabredet hätten, mehr als ärgerlich. Teilweise waren Interviews in Seniorenresidenzen bereits vorbereitet und konnten dann aufgrund der fortschreitenden Pandemie und der erteilten Besuchsverbote nicht realisiert werden. Die Frauen, die ich für dieses Buch persönlich treffen konnte, lebten alle allein oder zusammen mit Angehörigen. Infolge der Krise waren teilweise lange Vorbereitungen und verlässliche Absprachen mit den jeweiligen Familienangehörigen notwendig, um Abstands- und Sicherheitsregeln garantieren zu können. Unter den 23 Vollinterviews, die ich mit Zeitzeuginnen des Zweiten Weltkriegs geführt habe, sind einige, die Jahre zurückreichen. Von den 13 Frauengeschichten, für die ich mich letztendlich entscheiden musste, stammt aber lediglich eine aus meinem Zeitzeugenarchiv von 2016. Die anderen 12 Zeitzeuginnen habe ich erst dieses Jahr kennengelernt beziehungsweise interviewt.
Noch nie habe ich in einem so kurzen Zeitraum ein ganzes Buchprojekt realisiert. Möglich war dies durch den Corona-bedingten Ausfall sämtlicher Lesungen, Veranstaltungen und Messen; außerdem habe ich andere Projekte zurückgestellt. Dies hielt ich für wichtig, denn die Zeit drängte. Ich wollte dieses Mal auch, dass möglichst alle interviewten Frauen das fertige Buch noch in den Händen halten und lesen können. Während der etwa drei Jahre, die ich an meinem Zeitzeugenband über die letzten Soldaten des Zweiten Weltkriegs gearbeitet habe, sind sechs von dreizehn Männern verstorben. Mit Stand der Manuskriptabgabe werden elf der hier dargestellten Zeitzeuginnen die Veröffentlichung erleben, zwei sind gestorben. Elf der Frauen, die ich hier porträtiere, waren am Ende des Krieges zwischen 17 und 25 Jahre alt, sozusagen erwachsen. Sie entstammen den Jahrgängen 1920 bis 1928. Jeweils eine Protagonistin aus jedem Teil ist jünger, weil ich auch eine Perspektive des Krieges aus der Sicht von Heranwachsenden suchte. Diese beiden Frauen sind in den Jahren 1931 und 1933 geboren. Alle Porträtierten sind demnach zwischen 87 und 100 Jahre alt.
Der Grundgedanke der Methode Oral History ist es, die Zeitzeugen frei erzählen zu lassen und möglichst nicht zu unterbrechen. Damit soll ein starrer Interviewcharakter vermieden werden. Ich halte ein Gespräch, in dem sich die Schwerpunkte von selbst ergeben, für die beste Zugangsweise. Dahingehend habe ich meinen Zeitzeuginnen freie Hand gelassen, aber durchaus nachgehakt, wenn mich ein Aspekt besonders interessierte. Das gemeinsame Anschauen von Fotoalben beispielsweise ist eine gute Möglichkeit, um aufziehende Emotionen einfangen zu können. Durch eine lebendige, auf einen Dialog auf Augenhöhe aufbauende Erinnerungsarbeit ergeben sich die authentischsten Erzählstränge. Von entscheidender Bedeutung ist es, zunächst eine Vertrauensbasis herzustellen und dann auf die Spontaneität der aufkommenden Erinnerungen zu setzen. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit habe bei der Übertragung ins Schriftliche Dialekte, Füllwörter und Wortfindungsstörungen nicht berücksichtigt, Halbsätze logisch geschlossen oder an einigen Stellen das erzählende Perfekt ins Präteritum gesetzt. Längere, nicht tiefer erörterte Lebensabschnitte habe ich hin und wieder durch eine wahrheitsgetreue, dem Charakter des Gesprächs angemessene Nacherzählung zusammengefasst. Daneben ordne ich die Geschichten in den zeitlichen Kontext ein und liefere die zum Verständnis des Erzählten notwendigen historischen Fakten.
Für mich als männlicher Historiker waren die Gespräche mit den älteren Damen eine besonders spannende Herausforderung. Dabei zeigte sich, dass Männer und Frauen der Kriegsgeneration sich in Inhalten und Gesprächsführung stark voneinander unterschieden. Während männliche Zeitzeugen in der Regel darauf bestanden, allein mit mir zu reden, war es bei den Frauen genau umgekehrt. Hier gab es immer eine – meistens ebenfalls weibliche – Begleitperson, eine Tochter, eine Cousine, eine Freundin, zumindest in den ersten Stunden des ersten Treffens. Möglicherweise wurde es dadurch für mich im Vergleich etwas leichter, Vertrauen zu den Zeitzeuginnen aufzubauen. Bei der Befragung der Soldaten drehten sich die Gespräche – durchaus aber nicht weniger emotional – fast ausschließlich um Erfahrungen aus dem brutalen Kriegsalltag, um Verwundungen, um militärisches Taktieren, Nahkämpfe, Beschreibung des Feindes, Einsatz von Waffen und Technik. Die Frauen hingegen legten ihren Fokus neben den für sie prägenden traumatischen Erlebnissen aus Bombenkrieg und Vertreibung besonders auch auf ihr Verhältnis zu Eltern und Geschwistern oder Lehrern. Sie erzählten von der ersten großen Liebe, von Schwärmereien, von Freundschaften, Essenszubereitung, Schwangerschaft, Mode und Veränderungen und davon, wie sie den Alltag gemeistert haben. So hörte ich unverhofft auch spannende und dramatische Familien- oder Liebesgeschichten, von denen ich hier ebenfalls erzählen will. Fast unwirklich kam es mir manchmal vor, wenn mir die Frauen lustige, romantische oder idyllische Fotos von Festen, dem Besuch von Badeanstalten oder aus dem Urlaub zeigten und ich mir ausrechnete, was um die jeweilige Zeit gerade an der Ostfront passierte. Bis Mitte 1944 war es vielen möglich – sieht man von den Einschränkungen ab, die die Diktatur mit sich brachte, von Lebensmittelrationierung, Verdunklungspflicht oder harter Arbeit in der Industrie –, in der Freizeit ein Alltagsleben fernab vom Kriegsgeschehen zu führen, vor allem in den Ostgebieten. Viele haben bis zum Schluss der NS-Propaganda vertraut, dass ihnen nichts geschehen würde. Sie alle kamen dann jedoch an einen Punkt, der alles veränderte, nämlich als sie den Krieg so hautnah erlebten wie kaum ein Frontsoldat. Sie unterschied grundsätzlich von den Männern, dass sie weder bei Bomben- oder Tieffliegerangriffen noch bei Misshandlungen und Vergewaltigungen die Chance hatten, sich zu wehren. Der Soldat an der Front behielt selbst während heftigster Kämpfe oftmals das Gefühl der Kontrolle, weil ein Rückzug möglich war, eine Änderung der Strategie oder das Abwehren von Angriffen mit der eigenen Waffe. Dieses Sicherheitsgefühl hatten Frauen nicht. Sie waren in jedem Fall der Willkür des Feindfeuers oder der einmarschierenden Soldaten schutzlos ausgeliefert. Sie erlebten einen gänzlich anderen Krieg als ihre Männer an der Front. Nicht selten bemerkten sie das im Rahmen der Heimaturlaube ihrer Väter, Brüder oder Freunde, die schon bei leichten Bombenangriffen in Luftschutzkellern in Panik gerieten, während sie selbst in Fliegeralarmroutine weiter strickten oder in ihren Büchern lasen.
Den Berichten der Zeitzeuginnen ist neben den beiden Teileinleitungen ein weiteres gesamteinleitendes Kapitel vorangestellt, das auch eine Übersicht über den aktuellen Forschungsstand zum Thema liefert. Die Literaturrecherchen haben mich erstaunt und oft kopfschüttelnd zurückgelassen. Deutsche Frauen im Zweiten Weltkrieg, das ist im Jahr 2020 ein weitestgehend unerforschtes Feld. Bisher hat man es sich offenbar leisten können, diesen Teil unserer Geschichte ohne eine umfassende weibliche Sicht auf den Krieg zu erklären. So gut wie kein männlicher Historiker interessiert sich für diese Perspektive. Die bisherige Forschung wurde und wird von Frauen selbst betrieben, darunter weniger von Historikerinnen als vielmehr von Sozialwissenschaftlerinnen im Rahmen der Geschlechter- und Frauenforschung, die sich allerdings nahezu ausschließlich auf die Täterinnenperspektive konzentriert und hier nicht bestrebt ist, zu differenzieren, sondern immer mehr auch unverdächtige Frauengruppen in den Kreis der Täter oder Mittäter stellt. Da ist es umso tragischer, dass die betroffenen Frauen zu selten persönlich in die Debatte einbezogen wurden. Es fehlt an vernünftigen Oral-History-Projekten, die man zuhauf hätte realisieren können. Und man muss, was schon bei der männlichen Kriegsgeneration mehr schlecht als recht funktionierte, auch die Frauenperspektive auf den Krieg als desaströs ansehen. In der einschlägigen Literatur wird über sie gesprochen, nicht mit ihnen. Eine der ganz großen Ausnahmen bilden die Arbeiten von Margarete Dörr; sie hat 2007/2008 in drei Bänden über 500 Berichte von Frauenerleben im Zweiten Weltkrieg herausgebracht, die auf Oral-History-Interviews und Auswertungen von Briefen beruhen.10 Allerdings entstammt die Historikerin selbst der Frauenkriegsgeneration und hatte so vermutlich das nötige Einfühlungsvermögen, das späteren von jüngeren Historikerinnen angestrebten Oral-History-Projekten wie beispielsweise eines über Wehrmachtshelferinnen von Franka Maubach11gänzlich fehlte.
Im zweiten Teil der allgemeinen Einleitung stelle ich die wichtigen Frauenorganisationen vor, von denen die Zeitzeuginnen in ihren Geschichten berichten beziehungsweise bei denen sie Mitglied waren. Von der Jungmädelschaft über den BDM, das Werk Glaube und Schönheit bis zum Pflichtjahr und dem Reichsarbeitsdienst der weiblichen Jugend (RADjW). Ein Schwerpunkt liegt hier bereits auf dem Kriegseinsatz, also auf den sogenannten Kriegshilfsdienstmaiden des Reichsarbeitsdienstes (RAD), den Wehrmachtshelferinnen, den notdienstverpflichteten Rüstungsarbeiterinnen und den vielen Alternativtätigkeiten, die die Nazis erfanden, um die Frau in den Kriegsdienst einzubinden beziehungsweise hineinzuzwingen.
2. FRAUENIM ZWEITENWELTKRIEG: VERFUHRT, VERBRAUCHT, VERRATEN UND VERTRIEBEN
STIGMA MITTÄTERIN – LÜCKEN IN DER HISTORISIERUNG, FEHLER IN DER FRAUENFORSCHUNG
Zigtausende Sachbücher und Romane, Kinofilme und Dokumentationen sowie andere Medienbeiträge sind in den letzten 75 Jahren über den Zweiten Weltkrieg erschienen. Auffällig daran ist nicht nur, dass der überwältigende Teil dieser Produktionen von männlichen Autoren erstellt worden ist, sondern auch, dass die vermittelte Sicht des Krieges im Wesentlichen eine maskuline ist. In unseren Köpfen waren und sind bewaffnete Kampfhandlungen Männersache. Dabei haben kaum weniger Frauen als Männer den Zweiten Weltkrieg erlebt, in ihm gewirkt und ihn durchlitten. Über die grausamen Erfahrungen deutscher Frauen während Flucht und Vertreibung einerseits und in den Bombennächten andererseits lernen wir größtenteils aus Frauenbiografien, von denen viele sehr erfolgreich waren und sind und es durchaus schaffen, neben der eigenen Geschichte die generelle Lebenswelt von Frauen im Zweiten Weltkrieg oder im Dritten Reich darzustellen. Beeindruckende Beispiele stammen hier von Melita Maschmann12, Margarete Hannsmann13 oder ganz besonders von Eva-Sternheim Peters14. Diese autobiografischen Werke werden aber in der Regel von keinem Wissenschaftler bewertet und einsortiert, und somit besteht hier thematisch eine Forschungslücke.
Statistisch gesehen und sowohl soziologisch als auch biologisch erklärbar, sind Frauen ungleich häufiger Opfer von modernen Kriegen als Männer. Das können wir mit Sicherheit für den Zweiten Weltkrieg annehmen. Bis Ende der 1960er-Jahre blieb die große Pauschalisierung der Männergeneration als Täter aus. Die deutsche Zivilgesellschaft wusste zu unterscheiden zwischen NS-Funktionären oder freiwilligen KZ-Wächtern einerseits und den einfachen Soldaten andererseits, die in der absoluten Mehrheit weder Kriegsverbrechen begangen noch sich am Holocaust beteiligt haben. Die durch radikale Vertreter der 68er-Bewegung entstandene Kollektivtäterthese deutscher Männer des Zweiten Weltkriegs gipfelte Mitte der 1990er-Jahre in einer manipulativen und unwissenschaftlichen Wehrmachtsausstellung, die genau diese untermauern wollte und so prägend war, dass bei vielen das Bild des bösen deutschen Soldaten heute noch Gültigkeit hat.
Die deutschen Frauen des Zweiten Weltkriegs hingegen waren sogar von Anfang an einer Pauschalisierung unterworfen, man konnte sie nie korrekt einordnen. Nur hat sich bei der Bewertung ihrer Rolle das Bild einmal um 180 Grad gedreht – vom Opfer zur Täterin. Umso bedauerlicher ist es, dass sich dabei wieder der unbefriedigende Forschungsstand bemerkbar macht. Während es Dutzende Arbeiten über Männer gibt, muss die Militärgeschichte, die sich mit weiblichen Lebensläufen befasst, bis heute mit einem einzigen Standardwerk auskommen. In ihrem 1969 erschienenen Buch Frauen im Kriegsdienst15 stellt Ursula von Gersdorff wertfrei und umfassend die Situation von Wehrmachtshelferinnen und Frauen im Kriegshilfsdienst dar. Ein weiteres umfangreiches Buch, das sich explizit mit der weiblichen Gefolgschaft im Dienst der Wehrmacht beschäftigt, erschien von Franz Seidler 1979 unter dem Titel Blitzmädchen.16 Die übrige, ebenfalls überschaubare wissenschaftliche Literatur thematisiert fast ausschließlich die Rolle der Frau innerhalb der nationalsozialistischen Ideologie.
Die Forschung über die Frau im NS-System begann erst spät und kam weitestgehend ohne Beteiligung männlicher Historiker aus. Geführt wurden die Debatten zur Rolle der Frau im Dritten Reich seit Ende der 1970er-Jahre von der feministischen Frauenforschung, die von der neuen Frauenbewegung ausgegangen ist. Bis Mitte der 1980er-Jahre wurde die Frau im Nationalsozialismus fast nur in einer Opferrolle beschrieben. Das ist im Wesentlichen der Frauenbewegung geschuldet, die gegen die männlich dominierte Wissenschaft rebellierte. Allerdings betrachteten die Autorinnen ihre Müttergeneration darin nicht etwa als Opfer des Bombenkrieges oder als Vertreibungsopfer durch die einrückende Sowjetarmee, sondern schlicht als Geschädigte eines patriarchalen NS-Systems. Vorgelegt hatte die Psychoanalytikerin Margarete Mitscherlich in ihrem Buch Die friedfertige Frau17. Darin diskutiert sie Antisemitismus vornehmlich als eine »Männerkrankheit«, die Frauen der NS-Zeit als Opfer ihrer eigenen Männer und als Folge ihrer Angst vor Liebesverlust angenommen hätten:
Frauen neigen natürlich, wie alle Schwachen und Unterdrückten einer Gesellschaft, dazu, sich mit dem Aggressor zu identifizieren, sich seiner Meinung zu unterwerfen und sie zu teilen, auch – oder gerade – wenn sie dadurch selbst entwertet werden.18
Mitscherlich beschreibt die Frau im Dritten Reich psychoanalytisch als schwaches Wesen ohne eigenen durchsetzbaren Willen. Sie habe einfach alles akzeptiert, was ihr der von Männern gemachte Nationalsozialismus diktiert habe, sei dadurch Opfer und nicht Täterin geworden und könne sich selbst antisemitische Vorurteile höchstens über den Mann gebildet haben:
Ihre Überich-Strukturen prädestinieren die Frau nicht zum Antisemitismus. Ihre Abhängigkeit von der Anerkennung ihrer Umwelt, von den herrschenden männlichen Wertorientierungen, kann sie allerdings dazu veranlassen, gängige Vorurteile zu übernehmen.19
Während selbstverständlich heute die These, eine Frau könne nicht selbst antisemitisch sein, gänzlich absurd erscheint, begann die Frauenforschung erst Mitte der 1980er-Jahre, sich für die Rolle der Frau als Unterstützerin von NS-Verbrechen zu interessieren. Zunächst in abgeschwächter Form. Christina Thürmer-Rohr entwarf das Mittäterinnenkonzept, nach dem die Frau im Nationalsozialismus ihre Rolle selbst gewählt und gewollt und somit das Patriarchat unterstützt habe.20 Die amerikanische Historikerin Claudia Koonz pflichtete ihr 1986 bei und bezichtigte Frauen im Dritten Reich, die nationalsozialistische Ideologie selbst überzeugt vorangetrieben zu haben, nicht unbedingt inhaltlich, sondern weil sie sich dadurch einen gewissen Freiraum in der Entfaltung einer eigenständigen Weiblichkeit in einem von Männern dominierten NS-Staat erhofft hätten.21
Die sozialwissenschaftliche Frauenforschung radikalisierte sich in den 1990er-Jahren fortlaufend. Man thematisierte nun gar nicht weiter Frauen als Opfer und zunehmend auch nicht mehr als Mittäterinnen, sondern forderte die Anerkennung der Frau als »gleichberechtigte Täterin«. Auf dem Symposium Beteiligung und Widerstand. Thematisierungen des Nationalsozialismus in der Neueren Frauenforschung, das mit etwa 60 Diskutantinnen vom 5. bis 7. Januar 1990 in Würzburg stattfand, versicherte die Soziologin Lerke Gravenhorst, der Kampf gegen das Patriarchat werde selbstverständlich im Interesse aller weitergeführt, allerdings stehe die Anerkennung der Mittäterschaft der Frauen im Dritten Reich ab sofort über jedem Streit des patriarchal organisierten Schuldunterschiedes.22 Die Soziologin Dagmar Reese erinnerte an die helle Begeisterung, mit der so viele Mädchen dem BDM beigetreten waren23, die Psychotherapeutin Ruth Waldeck erkannte in bedeutender Frauenliteratur der Kriegszeit ein kollektives Muster deutscher Schuldbewältigung auf Kosten »realer Opfer« der NS-Zeit24, und die Sozialwissenschaftlerin Karin Windhaus-Walser verlangte abschließend eine Radikalisierung der Begrifflichkeit von der Mittäterin hin zur Täterin. Die Verbrechen des Nationalsozialismus seien Ergebnis eines gemeinsamen Interaktionsprozesses beider Geschlechter gewesen, und historisch gesehen habe es keine Situation gegeben, in der Männer unbeeinflusst von Frauen hätten agieren können.25
Nach der tendenziösen Wehrmachtsausstellung und den wirren, von Historikern zu Recht heftig kritisierten Tätervolk- und Zustimmungsthesen des amerikanischen Erfolgsautors Daniel Goldhagen26 (Goldhagen-Debatte) schwappte die Lust an der kollektiven Verurteilung auch auf die Frauenforschung über. Kathrin Kompisch beklagt sich 2008 in ihrem Buch Täterinnen. Frauen im Nationalsozialismus27, dass zu wenig Frauen – und wenn überhaupt, dann nur Extremtäterinnen – verurteilt worden sind. Man habe vergessen, die vielen Wehrmachtshelferinnen und Behördenmitarbeiterinnen unter die Lupe zu nehmen. Die Historikerzunft habe die weibliche Schuld bedauerlicherweise einfach nicht beachtet.28 Kompisch bedauert, dass es für die Anwendung von echten juristischen Urteilen eben zu spät sei, aber an Ideen für eine moralische Verurteilung in der »Rückschau« mangelt es ihr dennoch nicht. So nennt sie als weitverbreitete Straftatbestände der deutschen Frauen im Dritten Reich etwa Unterlassene Hilfeleistung durch das Wegsehen und nicht Einschreiten bei der Deportation von Juden und Beihilfe zum Mord wegen des Scheidenlassens von jüdischen Ehepartnern.29Als »Totschlagargument« wirft sie dann dem Leser doch tatsächlich die Frage hin: »Oder trägt etwa niemand außer Hitler Verantwortung?«30
2009 stellen die Kunstwissenschaftlerin Elke Frietsch und die Soziologin Christina Herkommer fest, »[…] dass diese Frauen nicht ausschließlich Opfer einer patriarchalen Politik bzw. Gesellschaft waren, sondern in weiten Teilen das mörderische System des Nationalsozialismus gestützt haben.«31
2011 versucht die Historikerin Franka Maubach, die Täterinnen-Thesen der Frauenforschung auf die Beurteilung der Wehrmachtshelferinnen zu übertragen, denn weibliche Kriegshilfe hätte ihrer Ansicht nach nur erfolgreich sein können, wenn diese nationalsozialistisch durchformt und effektiviert gewesen wäre.32 Maubach erkennt zwar richtig, dass die Forschung über die »ganz normale Frau« im Zweiten Weltkrieg fehlt, missinterpretiert aber schon im Vorfeld die Rolle des »ganz normalen Mannes« im Zweiten Weltkrieg, den sie zum Beispiel in der Wehrmachtsausstellung oder in einer nicht auf die Allgemeinheit übertragbaren Einzelgruppenuntersuchung von Christopher Browning33 als gut dargestellt ansieht.34 Eine schlechte Ausgangslage für die Untersuchung der Frauen dieser Zeit. Leider geht die Autorin zudem bereits mit Vorurteilen an die Befragung ihrer ehemaligen Wehrmachtshelferinnen heran, denn ihr Buch vermittelt den Eindruck, als wolle sie vor allem Täterinnen darstellen. Doch dafür scheinen sich die Zeitzeuginnen, die sie findet, nicht so recht zu eignen, auch wenn sie fast alle zum Führungspersonal der Wehrmachtshelferinnen gehören. Die Historikerin traut ihren Zeitzeuginnen nicht und wittert kameradschaftliche Netzwerke, die sie nach eigener Aussage erst mal kappen und im Kleinen zerschneiden musste35. Da sich auch auf Zeitungsannoncen kaum jemand Geeignetes meldet, findet Maubach schließlich einen Teil ihres »Samples« von 15 interviewten Wehrmachtshelferinnen durch Vermittlung von Bekannten aus ihren »universitären Zusammenhängen«36. In einem Interview mit dem Deutschlandfunk spricht Maubach über ihre Ergebnisse, in dem sie zum Beispiel erklärt, was eine Flakhelferin tat:
Das waren diejenigen Frauen, die die Scheinwerfer ausrichteten, um die Flugzeuge der alliierten Bomber anzustrahlen, damit sie abgeschossen werden konnten. Das kann man ganz klar als Tötungsassistenz beschreiben, auch wenn sie im Nachhinein sagen, wir haben nur geleuchtet. […] Hier haben sie ganz klar eine Tötungsassistenz geleistet und sie wurden auch mit Pistolen und Granatwerfern ausgestattet, um die Stellung und sich selbst verteidigen zu können.37
Am Ende ist es kein Wunder, dass Maubachs Vorurteil, mit dem sie an ihre Studie herangegangen ist, sich in ihrem Urteil widerspiegelt, in dem sie mit pauschalen Vertuschungsversuchen argumentiert:
Das fing schon 1945 an, dass die Frauen oder die Helferinnen die Möglichkeit hatten, ihre Geschichte vergessen zu machen. Sie konnten ihre Uniform ausziehen oder die militärischen Insignien ablegen, ein Kleidchen anziehen und dann waren sie wieder Zivilistinnen und hatten so eine Unschuldsvermutung auf ihrer Seite. Und auch danach wurden sie mehr oder weniger in Ruhe gelassen.38
Maubachs Buch hätte eine interessante Studie über Wehrmachtshelferinnen werden können, die sicherlich spannend aus ihrer Zeit berichtet haben. Bedauerlicherweise transkribiert die Historikerin aus ihren Interviews nur wenige, aus dem Zusammenhang gerissene O-Töne, meist von sich und ihren Interviewpartnerinnen, in denen durch die gestellten Suggestivfragen häufig deutlich wird, wohin sie ihre Zeitzeugen lenken möchte.
Mit Leonie Treber versucht sich eine weitere Historikerin an der Revision der Leistungen derjenigen Frauen, die man im Nachkriegsdeutschland geehrt hat: den sogenannten Trümmerfrauen. An ihnen arbeiten sich immer wieder Aktivisten und Politiker ab, um einer vermeintlichen Heroisierung dieser Frauen entgegenzuwirken. Treber lieferte, und es wundert nicht, dass ihre 2014 veröffentlichte Dissertation39





























