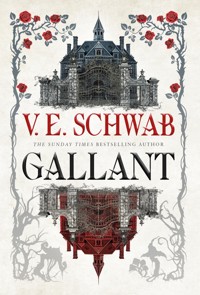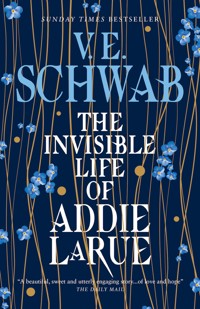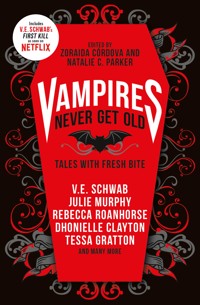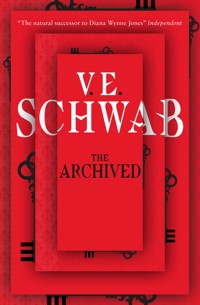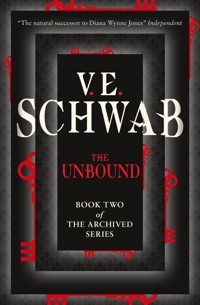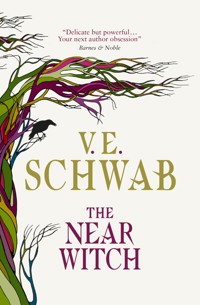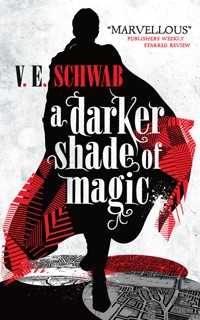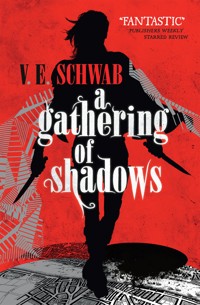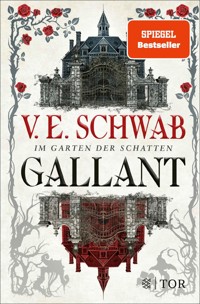9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Tor
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Weltenwanderer
- Sprache: Deutsch
»Die Verzauberung der Schatten« ist der zweite Band der Weltenwanderer-Trilogie von V. E. Schwab rund um den Antari Kell und Trickbetrügerin Delilah Bard. Eine Geschichte voller Magie, Abenteuer – und Piraten. Die Stadt London gibt es vier Mal – im grauen wohnt die Langeweile, im weißen der Hass und im schwarzen das Nichts. Doch im Roten London, da wohnt die Magie … Vier Monate ist es her, dass Kell gegen die dunkelste Form der Magie gekämpft hat. Noch immer leidet der Antari unter Albträumen, und die gewiefte Taschendiebin Delilah Bard, kurz Lila, geht ihm einfach nicht aus dem Kopf. Sie hat sich inzwischen jedoch einen Traum erfüllt: Sie segelt mit dem Nachtfalken über die Meere der Welt. Das Rote London steht ganz im Taumel des Spiels der Elemente, einem Turnier, bei dem Magier aus aller Welt ihre Kräfte messen. Auch Kell will antreten. Während zahlreiche Gäste, darunter der berüchtigte Pirat Alucard Emery, in die Stadt kommen, bemerkt jedoch niemand, wie ein anderes London aus seinem düsteren Schlaf erwacht und diejenigen wiederkehren, die als für immer verloren galten. Ein Abenteuer mit liebenswerten Figuren, düsteren Überraschungen und jeder Menge Wortwitz in der atemberaubenden Welt der vier London. »Fantasy, wie sie sein muss.« Publishers Weekly
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 768
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
V. E. Schwab
Die Verzauberung der Schatten
Roman
Über dieses Buch
Vier Monate ist es her, seit Kell gegen die dunkelste Form der Magie gekämpft hat. Noch immer leidet der Antari unter Albträumen, und die gewiefte Taschendiebin Delilah Bard geht ihm einfach nicht aus dem Kopf. Sie hat sich inzwischen jedoch einen Traum erfüllt und segelt mit dem Nachtfalken über die Meere der Welt.
Das Rote London steht ganz im Taumel des Spiels der Elemente, einem Turnier, bei dem Magier aus aller Welt ihre Kräfte messen. Auch Kell wird antreten. Während zahlreiche Gäste, darunter auch der berüchtigte Pirat Alucard Emery, in die Stadt kommen, bemerkt jedoch niemand, wie ein anderes London aus seinem düsteren Schlaf erwacht und diejenigen wiederkehren, die für immer verloren galten.
Nach »Vier Farben der Magie« der zweite Band der Weltenwanderer-Trilogie
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Frankfurt am Main, Dezember 2017
Die Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel »A Gathering of Shadows« bei Tor Books, New York.
Copyright © Victoria Schwab 2016
Published in agreement with the author, c/o Baror International, Inc. Armonk, U.S.A.
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2017 Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Nele Schütz Design, München, unter Verwendung mehrerer Bilder von Shutterstock
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490169-5
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Widmung
Motto
Eins Diebin auf hoher See
I
II
III
IV
V
Zwei Der Prinz auf Abwegen
I
II
III
IV
V
Drei Die Gezeitenwandlerin
I
II
III
IV
V
VI
Vier London ruft
I
II
III
IV
V
Fünf Ein königliches Willkommen
I
II
III
IV
V
VI
VII
Sechs Maskenspiele
I
II
III
IV
V
Sieben Irrungen und Wirrungen
I
II
III
IV
V
Acht Das Spiel der Elemente
I
II
III
IV
V
VI
VII
Neun Mit unlauteren Mitteln
I
II
III
IV
V
VI
Zehn Die Katastrophe
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
Danksagung
Leseprobe aus V. E. Schwab, Die Beschwörung des Lichts
Motto
Eins
I
II
III
IV
Aus dem Amerikanischen von [...]
Für all jene, die sich ihren Weg erkämpfen müssen.
Magie und Magier müssen im Gleichgewicht sein.
Magie an sich ist Chaos.
Der Magier muss eins mit sich sein.
Ein gebrochenes Selbst ist ein schwaches Gefäß der Macht, denn diese wird seinen Rissen ohne Maß und Ziel entströmen.
Thieren Serense, Hohepriester des Londoner Heiligtums
EinsDiebin auf hoher See
I
Das arnesische Meer
Delilah Bard besaß ein Talent dafür, sich in Schwierigkeiten zu bringen.
Sie hatte stets geglaubt, dass das allemal besser war, als darauf zu warten, dass die Schwierigkeiten zu ihr kamen. Doch hier, auf hoher See in einer winzigen Jolle ohne Ruder, fernab vom Festland und ohne offensichtliche Hilfsmittel – außer dem Seil, mit dem ihre Handgelenke gefesselt waren –, kamen ihr plötzlich Zweifel an diesem Grundsatz.
Über ihr wölbte sich die mondlose Nacht, und zu allen Seiten erstreckte sich die sternenübersäte Dunkelheit des Himmels, die vom Wasser reflektiert wurde; nur das Wellengekräusel, das das Boot zum Schaukeln brachte, ließ Lila die Grenze zwischen oben und unten erahnen. Für gewöhnlich gab ihr diese unendliche Spiegelung das Gefühl, sich im Zentrum des Universums zu befinden.
Heute aber, allein auf hoher See, hätte sie am liebsten laut geschrien.
Stattdessen starrte sie mit zusammengekniffenen Augen den in der Ferne entschwindenden funkelnden Lichtern nach; einzig aufgrund des rötlichen Schimmers war es ihr möglich, die Schiffslaterne von den Sternen zu unterscheiden. Lila musste zusehen, wie das Schiff – ihr Schiff –, langsam, aber sicher in die Ferne driftete.
Panik schlug ihre Klauen in Lilas Kehle, doch sie kämpfte erfolgreich dagegen an.
Ich bin Delilah Bard, dachte sie, während die Seile ihr ins Fleisch schnitten – Diebin, Piratin und Reisende. Ich habe drei verschiedene Welten besucht und überlebt. Habe das Blut von Herrschern vergossen und Magie in den Händen gehalten. Ein ganzes Schiff voller Seeleute wäre nicht zu dem fähig, was ich allein zu bewegen vermag. Ihr könnt mir alle gestohlen bleiben.
Ich bin, verdammt nochmal, einzigartig.
Als sie sich genug Mut zugesprochen hatte, wandte sie ihrem eigentlichen Schiff den Rücken zu und starrte hinaus in die unendliche Dunkelheit, die sich vor ihren Augen erstreckte.
Es könnte schlimmer sein, redete sie sich gut zu, doch schon im nächsten Moment spürte sie, wie kaltes Wasser ihre Stiefel umspülte. Ein Blick nach unten zeigte ihr, dass die Jolle ein Leck hatte. Gewiss, dieses war nicht besonders groß – aber das machte die Sache auch nicht besser; denn auch ein winziges Loch konnte ein Boot zum Sinken bringen, auch wenn es dann ein wenig länger dauerte.
Lila stöhnte und musterte das grobe Seil, das ihre Hände fest umwand, und war nun doppelt erleichtert, dass die Mistkerle ihre Beine nicht gefesselt hatten, wenn sie schon in diesem widerlichen Kleid steckte: einem fadenscheinigen Teil mit einem weiten Rock, einer Unmenge Tüll und einer Korsage, die ihr die Luft abschnürte. Warum in Gottes Namen taten sich Frauen so etwas nur an?
Während das Wasser im Boot stetig stieg, riss Lila sich zusammen und dachte nach. Sie atmete so tief ein, wie es in dem Kleid nur möglich war, und ging im Geiste ihre wenigen, zunehmend durchnässten Habseligkeiten durch: ein Fass Ale (ein Abschiedsgeschenk), drei Messer (alle bestens versteckt), ein halbes Dutzend Leuchtfackeln (als Dreingabe von den Kerlen, die sie ausgesetzt hatten), das soeben erwähnte Kleid (zum Teufel damit) sowie alles, was sie in dessen Falten und Taschen verborgen trug (im Falle ihres Überlebens natürlich unentbehrlich).
Lila ergriff eine der Leuchtfackeln; diese ähnelten einem Feuerwerkskörper und verbreiteten, schlug man sie gegen eine beliebige harte Oberfläche, ein farbiges Licht – keinen grellen Blitz, sondern einen steten, die Dunkelheit wie ein Messer durchschneidenden Strahl. Jede dieser Fackeln brannte ungefähr eine Viertelstunde, und die verschiedenen Farben besaßen auf hoher See jeweils ihre ganz eigene Bedeutung: Gelb stand für ein sinkendes Schiff, Grün für eine an Bord grassierende Krankheit, Weiß für eine unbestimmte Bedrängnis und Rot für die Bedrohung durch Piraten.
Diese vier Möglichkeiten standen ihr zur Verfügung, und sie ließ ihre Finger über die Enden der Stangen gleiten, während sie überlegte, für welche sie sich entscheiden sollte. Nach einem Blick auf das stetig steigende Wasser fiel ihre Wahl auf die gelbe Leuchtfackel. Sie packte diese mit beiden Händen und entzündete sie am Rand des kleinen Boots.
Jäh durchschnitt ein greller Lichtstrahl die Nacht. Er schien die Welt zu zerteilen – in das wilde gelbweiße Gleißen und das dichte schwarze Nichts ringsherum. Lila brauchte eine halbe Minute, um die Tränen, die ihr die Helligkeit in die Augen getrieben hatte, laut fluchend zurückzublinzeln, während sie die Leuchtfackel möglichst weit weg von ihrem Gesicht hielt. Dann begann sie zu zählen. Als ihre Augen sich endlich an die blendende Helle gewöhnten, verlor das Signal an Stärke, flackerte noch einmal auf, um dann zu verlöschen. Lila suchte den Horizont vergeblich nach einem Schiff ab, während das Wasser langsam, aber sicher weiter anstieg und inzwischen an ihren Waden in den Lederstiefeln leckte. Sie nahm die zweite Leuchtfackel – diesmal die weiße für die nicht näher bestimmte Bedrängnis – und entzündete sie am Bootsrand, während sie versuchte, ihre Augen abzuschirmen. Lila zählte die verrinnenden Minuten und durchforschte die das Boot umgebende Schwärze nach irgendeinem Lebenszeichen.
»Komm schon«, flüsterte sie. »Komm schon, komm schon …« Das Zischen der verlöschenden Leuchtfackel übertönte ihre Worte. Wieder war sie von tiefer Dunkelheit umhüllt.
Lila knirschte mit den Zähnen.
Dem Wasserstand in dem Boot nach zu urteilen, hatte sie nur noch eine Viertelstunde – eine Leuchtfackel lang – Zeit, bevor sie wirklich und wahrhaftig untergehen würde.
Dann merkte sie plötzlich, wie sich etwas an der hölzernen Bootswand entlangschlängelte. Und dieses Etwas hatte Zähne.
Wenn es einen Gott gibt, dachte sie, ein himmlisches Wesen, irgendeine überirdische Macht, oder auch nur irgendjemanden dort oben oder von mir aus auch da unten, der mich noch einen weiteren Tag unter den Lebenden sehen möchte, ob nun aus Mitleid oder um ein wenig Spaß zu haben, der sollte besser hier und jetzt eingreifen.
Und mit diesem Stoßgebet packte sie die rote Leuchtfackel (die Warnung vor Piraten) und entzündete sie; sofort erhellte ein gespenstisches Licht die Nacht. Einen Augenblick lang fühlte sie sich an die Isle erinnert. Nicht an den Fluss in ihrem London – falls diese trostlose Stadt jemals die ihre gewesen war – und auch nicht an den in der schrecklichen, bleichen Stadt, in der Athos und Astrid Dane gemeinsam mit Holland ihr Unwesen getrieben hatten. Nein, sie musste an sein London denken. An Kells.
Sie sah ihn wie eine flammende Vision vor sich, das rotbraune Haar und die ewige Falte zwischen den verschiedenfarbigen Augen, dem blauen und dem schwarzen. Den Antari, Zauberknaben und Prinzen.
Lila starrte, ohne zu blinzeln, in das rote Licht der Leuchtfackel, bis Kells Bild ausgemerzt war. Sie hatte jetzt wahrlich drängendere Sorgen. Das Wasser stieg und stieg; und das Signal drohte wieder zu erlöschen. Mehr und mehr Schatten schlängelten sich um das Boot.
Doch in dem Moment, als das rote Licht zu einem schwachen Glimmen herabgebrannt war, erweckte etwas ihre Aufmerksamkeit.
Zunächst war es nicht mehr als eine Nebelsträhne auf der Meeresoberfläche, die sich jedoch bald zu einem geisterhaften Schiff formte. Der glänzende schwarze Rumpf und die schwarzschimmernden Segel waren wie ein Widerschein der Nacht, die sich zu allen Seiten erstreckte. Das Licht der kleinen Bordlaternen glomm so bleich, dass man sie für Sterne hätte halten können. Erst als das Phantom so nah herangekommen war, dass sich das rote Licht der verlöschenden Leuchtkerze in seinen glänzenden Oberflächen spiegelte, konnte Lila es deutlich erkennen. Und da befand sie sich fast schon unter seinem Bug.
Im unruhigen Schein der verlöschenden Leuchtfackel gelang es Lila, den Namenszug zu entziffern, der in glänzenden Buchstaben auf dem Rumpf prangte. Is Ranes Gast.
Die Kupferdiebin.
Lila riss die Augen verblüfft und erleichtert auf. Ein kleines, gedankenverlorenes Lächeln umspielte ihre Lippen, das sie jedoch sogleich hinter einer passenderen Miene verbarg – einer Mischung aus Dankbarkeit und Flehen, gewürzt mit einer Prise zaghafter Hoffnung.
Das Licht flackerte noch einmal auf, um dann endgültig zu verlöschen; doch das Schiff lag bereits längsseits, so nah, dass sie die Gesichter der über die Reling gebeugten Männer erkennen konnte.
»Tosa!«, rief sie auf Arnesisch, als sie aufstand, sorgfältig darauf bedacht, das kleine, dem Untergang geweihte Boot nicht zum Schaukeln zu bringen.
Hilfe. Es war ihr noch nie leichtgefallen, Verletzlichkeit vorzutäuschen; doch sie gab sich alle Mühe, während die Männer auf sie hinunterblickten, wie sie mit gebundenen Handgelenken und in einem triefnassen grünen Kleid in einem sinkenden Boot stand. Sie kam sich lächerlich vor.
»Kers la?«, fragte einer der Seeleute, mehr an seine Kumpane als an Lila gewandt. Was ist das?
»Ein Geschenk?«, meinte ein anderer.
»Das müsstest du dann aber teilen«, murmelte ein Dritter.
Als ein paar der anderen Männer noch derbere Bemerkungen fallenließen, versteifte sich Lila. Sie war froh, dass sie nicht alles verstehen konnte, da der Akzent der Seeleute wild und schroff wie die Brandung war; doch sie konnte ungefähr erahnen, worum es ging.
»Was tust du da unten?«, fragte einer der Piraten, dessen Haut so dunkel war, dass er mit der Nacht zu verschmelzen schien.
Lilas Arnesisch ließ noch immer stark zu wünschen übrig, doch nach vier Monaten auf hoher See, in der Gesellschaft von Männern, die kein Wort Englisch sprachen, hatte sie einige Fortschritte gemacht.
»Sensan«, antwortete Lila, Ich gehe unter, woraufhin die an der Reling versammelten Seeleute laut auflachten. Noch immer machten sie keinerlei Anstalten, sie an Bord zu holen. Lila hob die Hände, so dass sie ihre Fesseln sehen konnten. »Ich könnte Hilfe gebrauchen«, sprach sie langsam die Worte, die sie geübt hatte.
»Das sehe ich«, antwortete der Pirat.
»Wer setzt so ein hübsches Ding aus?«, rief ein anderer.
»Vielleicht ist ja nicht mehr viel übrig von ihr?«
»Sieht nicht so aus.«
»He, Mädchen, ist noch alles an dir dran?«
»Lass uns doch mal nachsehen.«
»Was soll das Gebrüll?«, ertönte eine laute Stimme; und einen Augenblick später trat ein spindeldürrer Mann mit tiefliegenden Augen, Stirnglatze und schwarzem Haar an die Reling. Die anderen Männer wichen ehrfürchtig zurück, als der Neuankömmling die Hände auf das hölzerne Geländer legte und auf Lila hinuntersah. Er musterte ihr Kleid, die gefesselten Hände, das Fass und das Boot mit bohrendem Blick.
Jede Wette, dass das der Kapitän ist, schoss es ihr durch den Kopf.
»Ihr scheint in Schwierigkeiten zu stecken«, rief er zu ihr hinunter. Sie konnte seine Stimme mit dem leicht abgehackten arnesischen Akzent deutlich hören, obwohl er nicht laut sprach.
»Gut erkannt«, rief Lila ihrerseits, bevor sie sich zurückhalten konnte. Eine solche Dreistigkeit war natürlich gewagt, doch egal, in welcher Situation sie sich auch befand – sie war stets in der Lage, ihr Gegenüber richtig einzuschätzen. Und tatsächlich lächelte der knochendürre Pirat.
»Mein Schiff wurde gekapert«, fuhr sie fort. »Und das Boot hier ist, wie Ihr sehen könnt, dabei unterzugehen …«
Er unterbrach sie. »Vielleicht lässt es sich hier an Deck leichter sprechen?«
Lila nickte mit einem Hauch von Erleichterung. Sie hatte schon befürchtet, dass die Kerle weitersegeln und sie jämmerlich ertrinken lassen würden. Was allerdings angesichts der anzüglichen Bemerkungen und der lüsternen Blicke der Besatzung vielleicht sogar die bessere Alternative gewesen wäre. Doch hier unten war ihr der Tod gewiss, während sie oben auf dem Schiff zumindest eine Chance zu überleben hatte.
Die Piraten warfen ihr ein Seil hinunter, dessen beschwertes Ende im stetig steigenden Wasser vor ihren Füßen landete. Sie packte es und bugsierte mit seiner Hilfe das Boot an die Flanke des Schiffes, wo man bereits eine Leiter für sie heruntergelassen hatte. Aber bevor sie Anstalten machen konnte hinaufzuklettern, standen schon zwei Männer in ihrer Nussschale, die nun erst recht zu sinken drohte. Doch keiner der Seeleute schien sich die geringsten Gedanken zu machen. Der eine hievte das Fass mit Ale nach oben, während der andere Lila selbst zu ihrem Entsetzen packte, sich über die Schulter warf und mit ihr an der Schiffswand emporkletterte. Sie brauchte jedes bisschen ihrer – ohnehin verschwindend geringen – Selbstbeherrschung, um ihm nicht ein Messer in den Rücken zu bohren, ganz besonders, als seine Hände an ihrem Rock hinaufglitten.
Sie bohrte ihre Fingernägel in die Handflächen, und als der Mann sie endlich an Deck neben dem dort bereits wartenden Alefass absetzte (»Die ist schwerer, als sie aussieht«, murmelte er, »und nur halb so gut gepolstert …«), verunzierten acht kleine, halbmondförmige Abdrücke ihre Haut.
»Mistkerl«, knurrte Lila leise auf Englisch. Der Seemann zwinkerte ihr zu und raunte, dass sie an den richtigen Stellen gepolstert sei, woraufhin Lila sich schwor, ihn ins Jenseits zu befördern; und zwar so langsam wie möglich.
Dann richtete sie sich auf und fand sich von einem Dutzend Seeleuten umringt.
Besser gesagt von Piraten.
Schmutzig, salzverkrustet und sonnenverblichen, mit dunkler Haut und verschossener Kleidung. Jeder Einzelne von ihnen hatte ein Messer auf den Hals tätowiert, das Zeichen der Piraten der Kupferdiebin. Sieben Männer standen um sie herum, fünf weitere hantierten an Takelage und Segeln herum, und eine Handvoll mochte sich noch unter Deck befinden. Achtzehn. Zwanzig, um ganz sicher zu sein.
Der spindeldürre Mann trat aus dem Kreis heraus.
»Solase«, meinte er und breitete die Arme aus. »Meine Männer haben dicke Eier, aber schlechte Manieren.« Er legte seine Hände auf ihre von dem grünen Kleid umhüllten Schultern. Lila sah Blut unter seinen Fingernägeln. »Ihr zittert ja.«
»Ich hab eine harte Nacht hinter mir«, erwiderte Lila. Während sie den Blick über das raue Piratengesindel gleiten ließ, hoffte sie, dass es nicht noch schlimmer kommen würde.
Der Dürre lächelte, wobei er zu ihrer Überraschung zwei beinahe makellose Zahnreihen entblößte. »Anesh«, sagte er. »Jetzt seid Ihr in besseren Händen.«
Lila hatte genug über die Besatzung der Kupferdiebin gehört, um zu wissen, dass das eine Lüge war; doch sie stellte sich ahnungslos. »Darf ich fragen, wen ich vor mir habe?«, fragte sie, während der knochendürre Pirat ihre Hand ergriff und an seine aufgesprungenen Lippen führte, ohne das Seil zu beachten, mit dem ihre Hände nach wie vor gefesselt waren. »Baliz Kasnov«, antwortete er. »Hochberühmter Kapitän der Kupferdiebin.«
Ausgezeichnet! Kasnov war eine Legende auf dem Arnesischen Meer. Seine Mannschaft war klein, aber überaus geschickt; sie pflegten Schiffe in der undurchdringlichen Dunkelheit vor dem Morgengrauen zu kapern und allen, die ihnen in die Hände gerieten, die Kehle durchzuschneiden. Dann überließen sie die Leichen der Verwesung, während sie sich mit ihrer Beute davonstahlen. So ausgemergelt der Kapitän auch aussehen mochte, er war bekanntermaßen unersättlich, wenn es um das Anhäufen von Schätzen ging. Dabei hatte er eine Vorliebe für alles Ess- oder Trinkbare, und Lila wusste, dass die Kupferdiebin die Segel in Richtung der Nordküste der Stadt Sol gesetzt hatte, um dort den Besitzern einer besonders großen Lieferung feinster Spirituosen aufzulauern. »Baliz Kasnov«, wiederholte sie den Namen, als hätte sie noch nie von ihm gehört.
»Und mit wem habe ich die Ehre?«, fragte der Pirat seinerseits.
»Delilah Bard«, antwortete Lila. »Ehedem Eigentümerin des Goldenen Fischs.«
»Ehedem?«, fragte Kasnov ermunternd, während seine Männer – offensichtlich gelangweilt, weil Lila noch immer bekleidet war – sich an dem Fass zu schaffen machten. »Nun, Miss Bard«, sagte er und hakte sich verschwörerisch bei ihr unter. »Wollt Ihr mir nicht verraten, wie Ihr in das winzige Boot geraten seid? Eine hübsche junge Dame wie Ihr hat doch allein auf hoher See nichts zu suchen.«
»Vaskens«, sagte sie – Piraten –, als hätte sie nicht die leiseste Ahnung, wen sie vor sich hatte. »Sie stahlen mein Schiff – ein Hochzeitsgeschenk meines Vaters. Wir hatten Kurs auf Faro gesetzt – zwei Nächte vorher waren wir in See gestochen –, als die Schurken wie aus dem Nichts auftauchten und mein Schiff enterten …« Sie hatte jedes einzelne Wort einschließlich der Pausen vorher genau geübt. »Sie … meuchelten meinen Mann sowie den Kapitän; und fast die gesamte Besatzung …« Lila wechselte bewusst ins Englische. »Es ging alles so schnell …« Sie unterbrach sich, als sei dies ein Versehen gewesen.
Der Piratenkapitän hing bereits an ihren Lippen wie ein Fisch am Angelhaken. »Woher kommt Ihr?«, fragte er.
»Aus London«, antwortete Lila, ohne ihre perfekte Aussprache länger zu verbergen. Ein Raunen ging durch die Besatzung. Rasch fuhr sie fort, um ihre Erzählung möglichst schnell zu beenden.
»Mein Schiff war nur klein«, sagte sie, »aber beladen mit Kostbarkeiten. Vorräte für einen ganzen Monat – Essen, Trinken, Geld. Wie schon gesagt – es war ein Geschenk. Und nun ist alles verloren.«
Doch das stimmte nicht – noch nicht. Sie sah über die Reling. Ihr Schiff war nur noch ein heller Schimmer am Rande des Horizonts. Aber es bewegte sich nicht mehr und schien auf sie zu warten. Die Piraten folgten ihrem Blick mit gierigen Augen.
»Wie groß ist die Besatzung?«, fragte Kasnov.
»Groß genug«, antwortete Lila. »Sieben, acht Mann?«
Die Piraten grinsten lüstern, und Lila konnte ihre Gedanken lesen. Sie waren mehr als doppelt so viele, und zudem hatten sie ein Schiff, das sich unauffällig wie ein Schatten durch die Nacht bewegte. Und könnten sie den Goldenen Fisch mit seiner fetten Beute einholen … Lila spürte, wie Baliz Kasnov sie mit seinen tiefliegenden Augen musterte. Sie erwiderte seinen Blick und fragte sich gedankenverloren, ob er wohl über magische Kräfte verfügen mochte. Die meisten Schiffe waren durch den einen oder anderen Zauber geschützt, um das Leben angenehmer und sicherer zu gestalten. Allerdings hatte sie zu ihrer Überraschung erfahren, dass kaum ein Seemann an elementarer Magie interessiert war. Kapitän Emery hatte ihr erzählt, dass die magischen Künste zwar geschätzt wurden und dass sich fast jeder, der sie beherrschte, einer einträglichen Stellung an Land sicher sein konnte. Die Magier auf See konzentrierten sich jedoch vorwiegend auf die für sie entscheidenden Elemente Wasser und Wind; kaum einer unter ihnen verstand es hingegen, die Gezeiten umzukehren, und letztlich bevorzugten nahezu alle Seeleute den guten alten Stahl. Wofür Lila natürlich jede Menge Verständnis hatte, da sie derzeit mehrere solcher Waffen an ihrem Körper verborgen trug.
»Warum haben sie Euch verschont?«, fragte Kasnov.
»Haben sie das?«, fragte Lila herausfordernd.
Der Kapitän fuhr sich mit der Zunge über die Lippen.
Was das Schiff anging, war seine Entscheidung offensichtlich bereits gefallen. Und jetzt überlegte er, was er mit Lila tun sollte. Und die Kupferdiebe waren nicht gerade für ihre Barmherzigkeit bekannt.
»Baliz …«, warf einer der Piraten ein, dessen Haut noch dunkler war als die seiner Kumpane. Er packte den Kapitän an der Schulter und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Lila konnte nur ein paar Worte aufschnappen. Aus London. Reich. Und: Lösegeld.
Langsam kräuselten sich die Lippen des Kapitäns zu einem Lächeln. »Anesh«, nickte er. An die Besatzung gewandt, rief er: »Setzt die Segel! Kurs Süd bei West! Schnappt euch den Goldfisch!«
Die Piraten knurrten zustimmend.
»Mylady«, sagte Kasnov und führte Lila zur Treppe. »Ihr habt eine harte Nacht hinter Euch. Darf ich Euch zu meiner Kajüte führen, dort könnt Ihr es euch bequem machen.«
Lila hörte, wie die Seeleute hinter ihr das Fass öffneten und sich Ale eingossen. Auch noch während der Kapitän sie unter Deck führte, lag ein Grinsen auf seinem Gesicht.
Zum Glück blieb Kasnov nicht lange.
Sobald er Lila in seine Kajüte gebracht hatte, ließ er sie dort zurück, ohne die Fesseln von ihren Händen zu lösen, und sperrte die Tür hinter sich zu. Zu ihrer Erleichterung hatte sie unter Deck nur drei Piraten entdecken können. Das machte insgesamt fünfzehn Mann Besatzung auf der Kupferdiebin.
Lila setzte sich auf die Bettkante und zählte langsam bis zehn, dann bis zwanzig und schließlich bis dreißig, während sie Fußgetrappel über sich hörte und das Schiff rasch beidrehte, um die Verfolgung des Goldenen Fischs aufzunehmen. Die Piraten hatten sich nicht einmal die Mühe gemacht, sie nach Waffen zu durchsuchen; was nun wirklich ein wenig überheblich war, dachte Lila, als sie ein Messer aus ihrem Stiefel zog, es mit einer geübten Bewegung zwischen den gefesselten Händen herumdrehte und die Seile durchschnitt. Die Stränge fielen zu Boden, während sie sich die Handgelenke rieb. Dabei summte sie ein Seemannslied über den sogenannten Sarows vor sich hin, einen Geist, der der Legende nach des Nachts verirrte Schiffe heimsuchte.
Wie weiß ein Seemann, ob der Sarows sich anschleicht?
(Wie er kommt, sich anschleicht, klammheimlich, des Nachts?)
Lila ergriff die Taille ihres Kleides mit beiden Händen und riss den Rock ab. Nun trug sie nur noch enganliegende schwarze Hosen und ihre Lederstiefel sowie zwei Messer, die in Scheiden an ihren Oberschenkeln steckten. Dann durchtrennte sie die Schnüre ihrer Korsage am Rücken, so dass sie wieder frei atmen konnte.
Wenn der Wind nicht mehr pfeift, doch in den Ohr’n noch dröhnt.
(Den Ohr’n, dem Kopf, dem Blut, dem Mark.)
Sie warf den grünen Rock auf das Bett und schlitzte ihn vom Saum bis zum Bund auf. Zwischen dem vielen Tüll hatte sie ein halbes Dutzend dünner Stangen versteckt, die man für gewöhnliche Fischbeinstäbe oder einfache Leuchtfackeln hätte halten können. Doch weit gefehlt! Lila steckte die Klinge zurück in ihren Stiefel und zog die Stäbe aus dem Stoff.
Wenn die Strömung verebbt, doch das Schiff, es treibt weiter,
(Treibt weiter, treibt davon, ganz allein.)
Dann hörte sie, wie über ihr etwas Schweres auf das Deck plumpste. Ein Pirat nach dem anderen sank zu Boden, als das Ale zu wirken begann. Sie nahm ein schwarzes Tuch, bestrich es auf einer Seite mit Holzkohle, um es sich dann vor Mund und Nase zu binden.
Wenn der Mond sich versteckt vor dem Dunkel der Nacht,
(Denn im Dunkel, ja im Dunkel, da lauert etwas.)
(Denn im Dunkel, da lauert etwas.)
Schließlich zog sie ihre Maske aus den grünen Falten des Rocks. Diese war schwarz und schlicht, nur an den Seiten wanden sich Hörner ebenso elegant wie bedrohlich empor. Lila zog sich die Larve vors Gesicht und band sie fest.
Wie weiß ein Seemann, ob der Sarows sich anschleicht?
(Wie er kommt, sich anschleicht, klammheimlich, des Nachts?)
Ein halbblinder, silbrig schimmernder Spiegel stand in einer Ecke der Kapitänskajüte, und während sie Fußtritte auf der Treppe hörte, erhaschte Lila einen Blick auf ihr Konterfei.
Denn niemals wirst du hörn, wirst du sehn, wie er kommt.
(Wirst nicht sehn, wie er kommt, wie er schleicht, klammheimlich, des Nachts.)
Lila lächelte hinter der Maske. Dann drehte sie sich um und drückte sich mit dem Rücken gegen die Wand. Sie entzündete eine der Stangen an den Holzplanken wie vorher die Leuchtfackeln am Bootsrand; doch statt gleißendem Licht quollen nur dichte Wolken bleichen Rauchs hervor.
Bereits im nächsten Augenblick wurde die Tür zur Kajüte aufgeworfen – doch zu spät. Lila warf die Nebelkerze in den Raum; dann hörte sie Stolpern und Husten. Und schon sackten die Piraten, vom Rauch betäubt, zu Boden.
Minus zwei, dachte Lila, als sie über die leblosen Körper stieg. Rest dreizehn.
II
Niemand stand am Ruder des Schiffs.
Die Kupferdiebin war ein Spielball der Wellen, die das Schiff nunmehr mit voller Wucht von der Seite trafen, so dass das Deck unangenehm unter Lilas Füßen schlingerte …
Sie war auf dem Weg zur Treppe, als sich der erste der Piraten, ein wuchtiger Kerl, auf sie stürzte. Aufgrund des Betäubungsmittels, das Lila dem Ale beigemischt hatte, waren seine Bewegungen langsam und unbeholfen. Lila entwand sich seinem Griff und trat ihm mit dem Stiefel so fest gegen die Brust, dass er rücklings gegen die Wand prallte. Knochen splitterten, dann brach er stöhnend auf den Holzplanken zusammen. Ein Fluch erstarb auf seinen Lippen, als Lilas Stiefelspitze ihn am Kiefer traf. Der Kopf des Piraten flog zur Seite, um dann auf seine Brust zu sacken.
Zwölf.
Sie konnte Fußgetrappel an Deck hören. Lila zündete eine weitere Nebelkerze und warf sie die Treppe hinauf, drei Männern entgegen, die die Stufen hinunterdrängten. Der erste der Kerle sah die Rauchwolke und wollte umkehren, doch der Ansturm der beiden anderen versperrte ihm den Rückweg. Und schon brachen alle drei hustend und keuchend auf den hölzernen Stufen zusammen.
Neun.
Lila stupste einen der Männer, der zu ihren Füßen lag, mit der Stiefelspitze an; dann stieg sie über ihn hinweg und erklomm die Stufen. Oben angekommen, blieb sie im Schatten der Treppe stehen und hielt nach Anzeichen von Bewegung an Deck Ausschau. Doch alles war ruhig. Sie zog sich das mit Kohle beschmierte Tuch vom Gesicht und sog die kühle Winterluft tief in ihre Lungen. Dann trat sie hinaus in die Dunkelheit der Nacht.
Die Planken waren mit leblosen Körpern übersät. Lila schritt über das Deck und ging im Geiste durch, wie viele der Kerle noch übrig waren.
Acht.
Sieben.
Sechs.
Fünf
Vier.
Drei.
Zwei.
Lila hielt inne, den Blick weiterhin auf die betäubten Piraten gerichtet. Plötzlich regte sich etwas an der Reling. Lila zückte eines der Messer, die sie an ihren Oberschenkeln trug – die massive Klinge mit den schützenden Messingknöcheln hatte es ihr besonders angetan –, und bewegte sich auf das Geräusch zu. Dabei summte sie vor sich hin.
Wie weiß ein Seemann, ob der Sarows sich anschleicht?
(Wie er kommt, sich anschleicht, klammheimlich, des Nachts?)
Der Mann kroch auf allen vieren über das Deck. Sein Gesicht war von dem Betäubungsmittel so stark aufgequollen, dass Lila ihn zunächst fast nicht erkannt hätte. Doch als er den Kopf hob, merkte sie, dass es der Kerl war, der sie an Bord getragen hatte; der seine Hände nicht im Griff gehabt und behauptet hatte, dass sie an den richtigen Stellen gepolstert war.
»Verdammtes Miststück«, murmelte er auf Arnesisch. Er röchelte so stark, dass Lila ihn kaum verstand. Das Mittel, das sie dem Ale beigemischt hatte, war, zumindest in geringen Dosen, nicht tödlich (wobei sie bestimmt nicht übermäßig vorsichtig gewesen war), doch es ließ die Adern und Atemwege anschwellen, wodurch dem Körper der Sauerstoff entzogen wurde, bis der Betroffene das Bewusstsein verlor.
Als Lila nun auf den Piraten hinunterblickte, auf sein aufgequollenes Gesicht, die blauen Lippen, aus denen der Atem stoßweise entwich, kam ihr der Gedanke, dass sie das Gift wohl ein wenig zu großzügig dosiert hatte. Der Mann versuchte gerade, allerdings vergeblich, auf die Beine zu kommen. Lila packte ihn mit der freien Hand am Hemdkragen und hievte ihn auf die Beine.
»Wie hast du mich gerade genannt?«, fragte sie.
»Verdammtes … Miststück«, röchelte er, »so hab ich … dich genannt. Dafür wirst du … bezahlen. Ich werd dich …«
Er kam nicht dazu, den Satz zu beenden. Lila versetzte ihm einen heftigen Stoß, so dass er rückwärts über die Reling fiel.
»So redet man nicht mit dem Sarows«, murmelte sie, während sie zusah, wie der Mann kurz mit den Armen ruderte, um dann von den Wogen geschluckt zu werden.
Rest eins.
Als Lila die Planken des Decks plötzlich hinter sich knarzen hörte, schaffte sie es gerade noch, das Messer hochzureißen, als sich schon ein Seil um ihren Hals schlang. Der raue Strang schürfte ihren Hals auf, bevor es ihr gelang, ihn durchzuschneiden. Sie stolperte ein paar Schritte nach vorn, dann wirbelte sie herum und sah sich Baliz Kasnov, dem Kapitän der Kupferdiebin, gegenüber. Er stand sicher auf den Beinen, und sein Blick war fest.
Im Gegensatz zu seiner Besatzung, hatte er sich ganz offensichtlich keinen Schluck des Ales gegönnt.
Kasnov warf das durchtrennte Seil beiseite, während Lila das Heft des Messers fester packte und sich kampfbereit machte. Doch anstatt eine Waffe zu ziehen, hob der Kapitän die geöffneten Hände.
Lila legte den Kopf schief, so dass sich die Hörner der Maske in seine Richtung neigten. »Heißt das, Ihr ergebt Euch?«
Die dunklen Augen des Kapitäns blitzten, und sein Mund zuckte. Im Licht der Schiffslaternen schien das Messer auf seiner Kehle zu glitzern.
»Niemand kapert mein Schiff«, sagte er.
Kasnov bewegte die Lippen und spreizte die Finger, während Flammen an seinen Händen aufzüngelten. Lila senkte den Blick und sah die verwischten Symbole zu seinen Füßen. Nun wusste sie, was er vorhatte. Die meisten Schiffe waren mit einem Zauber gegen Feuer geschützt, aber Kasnov hatte ihn offenbar aufgehoben. Während der Kapitän auf das nächste Segel zuhechtete, ließ Lila das Messer in ihrer Hand herumwirbeln und schleuderte es ihm nach. Statt seines Kopfes traf die aufgrund des Messinggriffs schwerfällige Klinge allerdings nur seinen Hals. Kasnov fiel nach vorne und streckte die Hände aus, um sich aufzufangen, woraufhin das magische Feuer anstelle der Segel ein zusammengerolltes Tau in Brand setzte.
Doch Kasnovs lebloser Körper erstickte einen Großteil der Flammen im Fall, das aus der Wunde an seinem Hals strömende Blut tat ein Übriges. Nur ein paar hartnäckige züngelten noch an dem Seil empor. Lila streckte die Hand in Richtung des Feuers aus, und als sie die Finger zur Faust ballte, erstarb auch die letzte Glut.
Mit einem Lächeln zog sie ihr Lieblingsmesser aus der Kehle des toten Kapitäns und wischte das Blut an seinen Kleidern ab. Während sie die Klinge zurück in die Scheide steckte, hörte sie ein Pfeifen. Als sie aufblickte, sah sie ihr Schiff, den Nachtfalken, das gerade längsseits mit der Kupferdiebin ging.
Die Besatzung hatte sich an der Reling versammelt, und Lila schob die Maske hoch, während sie über das Deck ging, um sie zu begrüßen. Die meisten der Seeleute hatten die Stirn gerunzelt, doch mitten unter ihnen stand ein hochgewachsener Mann mit einer schwarzen Schärpe und aus der Stirn gestrichenem, goldbraunem Haar. An seiner Augenbraue funkelte ein Saphir, und seine Lippen umspielte ein amüsiertes Lächeln. Alucard Emery. Ihr Kapitän.
»Mas aven«, knurrte Stross, der Erste Offizier, ungläubig. »Das is’ verdammt nochmal unmöglich«, rief Olo, der Koch, und ließ den Blick über die leblosen Körper wandern, die auf dem Deck der Kupferdiebin verstreut lagen.
Der hübsche Vasry und Tavestronask, den alle einfach nur Tav nannten, applaudierten; Kobis starrte Lila mit verschränkten Armen an, und Lenos glotzte wie ein Fisch.
Lila genoss die Mischung aus Schock und Zustimmung, die ihr entgegenschlug, während sie mit ausgebreiteten Armen an die Reling trat. »Kapitän«, rief sie fröhlich. »Ich glaub, ich hab ein Schiff für Euch.«
Emery lächelte. »Mir scheint, das habt Ihr.«
Die Seeleute legten eine Planke von Schiff zu Schiff, über die Lila gewandt schritt, ohne auch nur einmal nach unten zu blicken. Sie sprang auf das Deck des Nachtfalken und wandte sich an einen schlaksigen jungen Mann, der so tiefe Schatten unter den Augen trug, als habe er unzählige durchwachte Nächte hinter sich. »Her mit dem Zaster, Lenos.«
Der Angesprochene legte die Stirn in Falten. »Käpt’n«, flehte er und lachte nervös.
Alucard zuckte mit den Achseln. »Schließlich hast du gewettet«, sagte er. »Du und Stross«, fügte er hinzu und nickte dem Ersten Offizier zu, einem grobschlächtigen, bärtigen Kerl. »Es waren eure Idee und euer Geld.«
Das war nicht von der Hand zu weisen. Zwar hatte Lila damit geprahlt, dass sie die Kupferdiebin im Alleingang kapern könnte; aber Lenos und Stross hatten dagegengewettet. Es hatte Lila fast einen Monat gekostet, um nach und nach, Landgang für Landgang, eine ausreichende Menge des Betäubungsmittels für die Nebelkerzen und das Ale zu erstehen. Doch es war die Sache wert gewesen.
»Sie hat uns reingelegt!«, rief Lenos entrüstet.
»Ihr Holzköpfe«, schimpfte Olo mit leiser, grollender Stimme.
»Sie hatte das Ganze geplant«, murrte Stross.
»Genau«, rief Lenos. »Wie hätten wir denn ahnen sollen, dass sie das alles genau geplant hatte?«
»Ihr hättet euch gar nicht erst auf eine Wette mit Bard einlassen dürfen.« Emery traf Lilas Blick und zwinkerte ihr zu. »Es gibt nun einmal Regeln, und wenn ihr nicht mit den Kupfertölpeln auf dem Schiff bleiben wollt, sobald wir hier fertig sind, dann solltet ihr lieber eure Schulden bei meiner Meisterdiebin begleichen.«
Stross zog eine Geldbörse aus der Tasche. »Wie hast du das angestellt?«, fragte er und drückte sie Lila in die Hand.
»Das kann dir egal sein«, meinte Lila und nahm das Geld. »Was zählt, ist, dass ich es geschafft habe.«
Als Lenos ihr seinerseits seinen Geldbeutel aushändigen wollte, schüttelte Lila den Kopf. »Du weißt genau, dass wir um etwas anderes gewettet haben.« Lenos sank noch weiter in sich zusammen, während er die Klinge von seinem Unterarm löste. »Hast du nicht schon genug Messer?«, murrte er und zog eine Schnute.
Lilas Lächeln wurde schärfer. »Davon kann man nie genug haben«, erwiderte sie und nahm die Klinge entgegen. Außerdem, dachte sie, ist das ein Prachtstück. Sie hatte ein Auge darauf geworfen, seitdem sie Lenos in Korma das erste Mal damit kämpfen gesehen hatte.
»Das hol’ ich mir zurück«, murmelte er.
Lila klopfte ihm auf die Schulter. »Du kannst es ja versuchen.«
»Anesh!«, rief Alucard laut und ließ seine Faust auf die Planke niedersausen. »Genug gefaulenzt, Falken, wir haben ein Schiff zu plündern. Nehmt alles mit, was nicht niet- und nagelfest ist. Ich möchte, dass diesen Hurensöhnen nichts bleibt als die Wanzen in ihren Kojen.«
Die Mannschaft jubelte, und Lila konnte sich ein Lachen nicht verkneifen. Sie hatte noch nie jemanden getroffen, der seiner Aufgabe mit einer solchen Leidenschaft nachging wie Alucard Emery. Er war begeistert wie ein Kind beim Spiel oder ein Schauspieler auf der Bühne, der sich entzückt und hingebungsvoll in seine Figur versenkt. Alles, was Emery tat, hatte etwas Theatralisches. Lila fragte sich, wie viele andere Rollen er wohl beherrschen mochte und ob zumindest eine davon sein wahres Ich verriet.
In der Dunkelheit trafen sich ihre Blicke. Seine Augen waren blaugrau wie die sturmgepeitschte See, leuchteten manchmal hell, um dann wieder dunkel wie die Nacht zu werden. Er deutete wortlos mit dem Kopf in Richtung seines Quartiers, und Lila folgte ihm.
Emerys Kajüte roch wie stets nach Sommerwein, sauberer Seide und verlöschender Glut. Ganz offensichtlich liebte er es, sich mit schönen Dingen zu umgeben. Doch anders als so mancher prahlsüchtige Sammler, der seine Schätze nur zur Schau stellt, damit alle Welt ihn darum beneidet, zeigten die Besitztümer des Kapitäns deutliche Gebrauchsspuren.
»Nun, Bard«, sagte er und wechselte ins Englische, sobald sie miteinander allein waren. »Wollt Ihr mir nicht verraten, wie Ihr es angestellt habt?«
»Die Wahrheit ist langweilig«, sagte sie herausfordernd und ließ sich auf einen der hochlehnigen Stühle fallen, die neben dem Kamin standen. Dort brannte wie eh und je ein bleiches Feuer, und auf dem Tisch warteten zwei niedrige Gläser darauf, befüllt zu werden. »Geheimnisse sind viel aufregender.«
Alucard trat zum Tisch und nahm eine Flasche, während seine weiße Katze Esa wie aus dem Nichts auftauchte und um Lilas Stiefel strich. »Mir will scheinen, dass Ihr ausschließlich aus Geheimnissen besteht.«
»Haben die Männer gewettet?«, fragte sie, ihm und der Katze keinerlei Beachtung schenkend.
»Natürlich«, antwortete Alucard und entkorkte die Flasche. »Es gab jede Menge kleiner Wetten – ob Ihr ertrinken würdet, Euch die Kupferdiebin tatsächlich an Bord nähme und wenn ja, ob dann noch etwas von Euch übrig bliebe …« Er goss eine bernsteinfarbene Flüssigkeit in die beiden Gläser und bot Lila eines davon an. Während sie das Getränk entgegennahm, zog er ihr die gehörnte Maske vom Gesicht und warf sie auf den Tisch zwischen ihnen. »Das war ein beeindruckender Auftritt«, sagte Alucard und ließ sich auf seinen Stuhl sinken. »Diejenigen meiner Männer, die Euch bisher noch nicht gefürchtet haben, werden sich das jetzt noch einmal überlegen.«
Lila starrte in ihr Glas wie in die Flammen eines Kamins. »Gab es denn tatsächlich jemanden hier, der keine Angst vor mir hatte?«, fragte sie.
»Hinter Eurem Rücken«, fuhr Alucard fort, »nennen Euch manche noch immer den Sarows. Sie flüstern dabei, als könntet Ihr sie immer und überall hören.«
»Vielleicht kann ich das ja.« Lila drehte das Glas in den Händen.
Alucard schien keine kluge Antwort einzufallen; und als Lila den Blick von ihrem Glas hob, sah sie, dass der Kapitän sie mit dem ihr bereits vertrauten, forschenden Blick ansah, wie ein Dieb, der auf der Suche nach Beute eine Tasche durchstöbert.
»Nun«, sagte er schließlich und hob sein Glas. »Worauf wollen wir trinken? Auf den Sarows? Auf Baliz Kasnov und seine Kupfertölpel? Oder auf gutaussehende Kapitäne und elegante Schiffe?«
Doch Lila schüttelte den Kopf. »Nein«, antwortete sie und hob ihr Glas mit einem messerscharfen Lächeln. »Auf die beste Diebin.«
Alucard lachte leise in sich hinein. »Auf die beste Diebin«, wiederholte er.
Dann prostete er ihr zu, und sie tranken.
III
Vor vier Monaten. Rotes London.
Ihn zu verlassen war ihr leichtgefallen.
Sich nicht umzusehen, war viel schwerer gewesen.
Lila hatte gespürt, wie Kells Blick ihr gefolgt war, und sie war erst stehen geblieben, als er sie nicht mehr sehen konnte. Nun war sie wieder allein, frei zu gehen, wohin es ihr gefiel; frei zu sein, wer immer sie sein wollte. Doch je dunkler es wurde, desto mehr schwand ihr der Mut. Die Nacht legte sich wie ein schwarzes Tuch auf die Stadt; sie fühlte sich allmählich nicht mehr wie ein Eroberer, sondern nur noch wie ein Mädchen, das sich allein in einer fremden Welt befand, deren Sprache es nicht verstand, und das nichts in den Taschen trug als Kells Abschiedsgeschenk (ein Spiel der Elemente), eine silberne Uhr sowie eine Handvoll Münzen (die Lila einem Wachsoldaten geklaut hatte, bevor sie den Palast verließ).
Gewiss, sie hatte schon weniger besessen; aber auch schon bedeutend mehr.
Und sie wusste, dass sie ohne ein Schiff nicht weit kommen würde.
Sie ließ die Taschenuhr auf- und zuschnappen und betrachtete die Silhouetten der Schiffe, die auf dem Fluss schaukelten, dessen roter Schimmer in der wachsenden Dunkelheit immer deutlicher hervortrat. Eines davon hatte es ihr besonders angetan, und sie hatte den ganzen Tag über kaum den Blick davon wenden können. Es handelte sich um ein wahres Prachtstück; Rumpf und Masten waren aus dunklem Holz gezimmert und mit Silber verziert; seine Segel schimmerten je nach Lichteinfall mitternachtsblau oder schwarz. Auf dem Rumpf prangte der Namenszug Saren Noche, was, wie Lila später erfuhr, Nachtfalke bedeutete. In diesem Moment wusste sie nur, dass sie es unbedingt haben wollte. Doch sie konnte nicht einfach auf ein vollbemanntes Schiff stürmen und es in Besitz nehmen. Zwar war sie eine Meisterdiebin, doch das brächte nicht einmal sie fertig. Außerdem kam sie nicht um die unbequeme Tatsache herum, dass sie keine Ahnung hatte, wie man ein Schiff navigiert. Also lehnte sich Lila an eine glatte Steinmauer, mit deren Schatten sie in ihrer dunklen Kleidung verschmolz, und betrachtete das Schiff, bis dessen sanftes Schaukeln und die Geräusche des Nachtmarkts weiter oben am Fluss sie in eine Art Trance versetzten.
Sie schreckte auf, als eine Handvoll Männer mit schweren Stiefeln über das Deck und die Planke gepoltert kamen. Münzen klirrten in ihren Taschen, und raues Gelächter drang aus ihren Kehlen. Nachdem sie das Schiff den ganzen Tag lang seeklar gemacht hatten, brannte nun die Besatzung regelrecht darauf, die letzte Nacht an Land in vollen Zügen zu genießen. Einer der Seeleute stimmte ein Lied an, und seine Kumpane fielen ein. Die Männer strebten, das Lied auf den Lippen, auf die Schenken des Hafens zu.
Lila ließ den Deckel der Taschenuhr zuschnappen, stieß sich von der Wand ab und heftete sich ihnen an die Fersen.
Sah man von der Männerkleidung ab, die sie umhüllte, trug sie keine Tarnung. Das kurze Haar, das ihr ins Gesicht fiel, verlieh ihrem Gesicht einen kantigen Ausdruck, und wenn sie ihre Stimme senkte, würde man sie hoffentlich für einen schlanken jungen Mann halten. Denn Masken waren zwar wie gemacht für dunkle Gassen und Kostümbälle, doch in einer Schenke würde sie damit nur unnötiges Aufsehen erregen.
Die Männer vor ihr verschwanden in einer Hafenschenke, deren Namen Lila nirgends entziffern konnte. Doch das Metallschild über der Tür war in Form eines silbernen Kompasses gestaltet, um den sich schimmernde Kupferwellen kräuselten. Sie strich den Mantel glatt, klappte den Kragen hoch und trat ein.
Sofort schlug ihr ein eigentümlicher Geruch entgegen.
Dieser war nicht faulig oder abgestanden wie in den Hafenkneipen ihrer Stadt oder blumig wie im Roten Palast. Vielmehr lag ein warmer, einfacher, satter Duft in der Luft: eine Mischung aus frischem Eintopf, zartem Tabakdunst und dem fernen, salzigen Geschmack des Meeres.
In jeder Ecke flackerte ein Kaminfeuer; und die Bar befand sich nicht an der Wand, sondern in der Mitte des Schankraums. Ein aus reinem Silber getriebenes Meisterwerk der Handwerkskunst, war sie wie das Schild vor der Tür in Form einer Kompassrose gestaltet, deren Spitzen sich bis zu den Eckkaminen zogen.
Diese Hafenschenke war ganz anders als alle, die sie bisher kannte; auf dem Boden befanden sich kaum Blutspritzer oder andere Spuren von den üblichen Schlägereien, die sich irgendwann in die Straßen verlagerten. Im Raue Gezeiten in ihrem London – das längst nicht mehr das ihre war – hatte sich ein viel derberes Publikum herumgetrieben als hier, wo die Hälfte der Gäste die königlichen Farben trug und sich dadurch als Diener der Krone auswies. Der Rest war ein buntes Völkchen, aber keines der Gesichter zeigte den ausgezehrten, gierigen Blick, der der Verzweiflung entspringt. Viele der Anwesenden waren – wie die Männer, denen sie hierher gefolgt war – sonnengebräunt und wettergegerbt, doch sogar ihre Stiefel und Waffen waren blitzblank geputzt.
Lila strich sich eine Haarsträhne vor ihr Glasauge und trat, selbstbewusste Arroganz ausstrahlend, an die Theke.
»Avan«, begrüßte sie der Wirt, ein schlanker Mann mit freundlichem Blick. Plötzlich kam ihr Barron, der Besitzer des Steinwurfs, in den Sinn, seine gütige Strenge und stoische Ruhe, obwohl sie versuchte, jeden Gedanken an ihn zu unterdrücken, um sich vor dem Ansturm der Erinnerung zu schützen. Sie setzte sich auf einen Hocker, woraufhin der Wirt ihr eine Frage stellte. Obwohl sie kein Wort verstand, erriet sie, was er gesagt hatte. Sie klopfte mit dem Finger auf ein fast leeres Glas auf der Theke, woraufhin sich der Mann abwandte und schon einen Augenblick später ein Glas goldgelbes Ale mit einer wunderbaren Schaumkrone vor sie hinstellte. Lila nahm einen tiefen, beruhigenden Schluck.
Einen Viertelkreis von ihr entfernt an der Bar saß ein Mann, der gedankenverloren mit ein paar Münzen spielte. Lila brauchte einen Moment, bis sie begriff, dass er diese nicht berührte. Vielmehr bewegten sich die Metallscheiben um seine Finger und Handflächen, als sei Magie im Spiel. Und genauso war es natürlich! Ein anderer Gast, der ihr gegenüber saß, schnippte mit den Fingern und entzündete seine Pfeife an dem Flämmchen, das aus seinem Daumen züngelte. Wie kam es nur, fragte sich Lila, dass sie all das ohne eine Spur von Überraschung wahrnahm? Obwohl sie erst seit einer Woche in der Roten Stadt war, fühlte sie sich hier bereits heimischer, als sie es im Grauen London jemals getan hatte.
Lila drehte sich auf dem Barhocker herum und versuchte, die Besatzungsmitglieder des Saren Noche ausfindig zu machen, die sich inzwischen auf die ganze Schänke verteilt hatten. Zwei unterhielten sich vor einem der Kamine, ein anderer ließ sich im nächsten Schatten von einer üppigen Dame umgarnen, und drei weitere hatten sich gerade mit ein paar Seeleuten in den königlichen Farben an einen Kartentisch gesetzt. Vor allem einer des Trios zog Lilas Aufmerksamkeit auf sich, nicht etwa, weil er besonders gut aussah – ganz im Gegenteil, er war ausgesprochen hässlich, soweit sie das unter dem dichten Bartwuchs erkennen konnte –, sondern vielmehr da er betrog.
Zumindest glaubte sie, dass er das tat. Sie konnte sich nicht ganz sicher sein, da das Spiel verdächtig wenige Regeln hatte; doch sie hatte gesehen, wie er eine Karte eingesteckt und durch eine andere ersetzt hatte. Was ihr trotz seiner beeindruckenden Fingerfertigkeit nicht entgangen war. Ihre Nerven vibrierten erregt, während ihr Blick von seinen Fingern zu dem niedrigen, hölzernen Hocker glitt, auf dem er saß. Dort lag seine prall gefüllte Geldbörse, die mit einem Lederriemen an seinem Gürtel befestigt war. Lila griff langsam nach dem kurzen, scharfen Messer an ihrer Hüfte und zog es aus der Scheide.
Wie leichtsinnig!, flüsterte eine innere Stimme, und Lila stellte verstört fest, dass es nicht wie früher Barron war, der zu ihr sprach, sondern Kell. Sie schob diesen Gedanken beiseite, während ihr Blut im Vorgefühl der Gefahr schneller kreiste; doch dann stockte es in ihren Adern, als der Seemann sie unvermittelt ansah. Aber nein, seine Augen waren nicht auf sie gerichtet, sondern auf den Wirt, der direkt hinter ihr stand! Dann deutete der Falschspieler mit einer allgemeingültigen Geste auf den Tisch, um eine weitere Runde zu bestellen.
Lila trank aus und ließ ein paar Münzen auf die Theke fallen. Sie beobachtete, wie der Wirt die Getränke auf ein Tablett stellte, das ein Bediensteter zu dem Tisch mit den Kartenspielern trug.
Lila sah ihre Chance gekommen und sprang auf die Beine.
Der Raum begann sich um sie zu drehen, da das hiesige Ale stärker war als das, was sie gewohnt war; doch sie fand ihr Gleichgewicht schnell wieder. Dann folgte sie dem Mann mit dem Tablett und hielt den Blick unverwandt auf die Tür gerichtet, während sie ihm beiläufig ein Bein stellte. Er geriet ins Taumeln, schaffte es aber, sich auf den Beinen zu halten. Die Gläser samt ihrem Inhalt stürzten allerdings auf den Tisch, so dass die Hälfte der Karten von einem Schwall Ale weggeschwemmt wurden. Die Spieler sprangen lauthals fluchend auf und versuchten, ihre Münzen und Kleidung in Sicherheit zu bringen. Und als sich der bedauernswerte Mann umwandte, um herauszufinden, wer ihm ein Bein gestellt hatte, sah er nur noch den Saum von Lilas schwarzem Umhang im Türrahmen verschwinden.
Lila spazierte die Straße hinunter, und die Geldbörse des Spielers baumelte in ihrer Hand. Eine gute Diebin zeichnete sich nicht nur durch ihre Fingerfertigkeit aus, sondern auch das Wissen darum, wie man jede Situation für sich ausnutzen konnte. Sie wog die pralle Börse in der Hand und lächelte zufrieden. Das Blut strömte triumphierend durch ihre Adern.
Doch dann hörte sie jemanden hinter ihr her rufen.
Als sie sich umwandte, sah sie sich dem bärtigen Kerl gegenüber, den sie gerade beklaut hatte. Sie versuchte gar nicht erst, ihre Tat zu leugnen – zum einen reichte ihr Arnesisch dazu nicht aus, zum anderen hielt sie seine Geldbörse noch immer in der Hand. Stattdessen verstaute sie ihre Beute so schnell wie möglich und machte sich auf einen Kampf gefasst. Der Mann war doppelt so breit und einen ganzen Fuß größer als sie. Plötzlich, in weniger als dem Augenblick zwischen zwei Schritten, hielt er eine geschwungene Klinge, die wie eine kleine Sense aussah, in der Hand. Der Bärtige knurrte einen leisen, unverständlichen Befehl. Vielleicht wollte er sie laufenlassen, wenn sie zurückgab, was ihm gehörte. Doch Lila bezweifelte, dass sein verletzter Stolz das zulassen würde. Und selbst wenn – sie brauchte das Geld so dringend, dass sie bereit war, es mit ihm aufzunehmen. Vorsicht sicherte das Überleben, doch nur Frechheit brachte einen weiter.
»Was man findet, darf man behalten«, sagte sie und sah, wie im Gesicht ihres Gegenübers Überraschung aufleuchtete. Verdammt nochmal. Kell hatte sie gewarnt, dass das Englische in der Roten Welt einen bestimmten Zweck und Platz hatte. Es war die Sprache der Könige, nicht der Piraten. Wenn sie auf See überleben wollte, musste sie lernen, ihre Zunge zu zügeln, bis sie der gemeinen Sprache mächtig war.
Der Bärtige murmelte erneut etwas Unverständliches und strich mit der Hand über die gebogene Klinge, die verflixt scharf aussah.
Lila seufzte und zückte das gezackte Messer mit den Messingknöcheln, die ihre Finger schützend umschlossen. Nach einem erneuten Blick auf ihren Gegner zog sie eine zweite Klinge – das kurze, scharfe Messer, mit dem sie den Lederriemen der Geldbörse durchtrennt hatte.
»He du«, sagte sie auf Englisch, da niemand anders in Sichtweite war. »Du kannst es dir immer noch überlegen.«
Der Bärtige schleuderte ihr einen Satz entgegen. Das letzte Wort, pilse, war eines der wenigen arnesischen Wörter, die Lila kannte, und sie wusste, dass es sich um ein Schimpfwort handelte. Sie war noch damit beschäftigt, die Beleidigung zu verdauen, als der Mann auf sie zusprang. Lila wich hastig zurück und fing die gebogene Klinge mit ihren beiden Messern ab. Metall traf klirrend auf Metall, so dass ihr schrilles Echo durch die Gasse hallte, die Brandung und den Lärm der Schenken übertönend. Gewiss würden sie bald Gesellschaft bekommen!
Sie drückte die Klinge mit aller Kraft von sich weg, wobei sie fast das Gleichgewicht verloren hätte. Wieder wich sie abrupt zurück, als der Mann erneut angriff und ihre Kehle nur um Haaresbreite verfehlte.
Lila duckte sich, wirbelte herum und schnellte nach oben, um einen erneuten Stoß mit dem Messer abzufangen. Die Waffen glitten aneinander herab, bis die Klinge des Bärtigen am Heft ihres Dolches hängen blieb. Mit einer Drehung des Handgelenks befreite Lila ihr Messer und hieb dem Mann, über dessen Klinge hinweg, die mit den Messingknöcheln bewehrte Faust ins Gesicht. Und bevor dieser sich besinnen konnte, stieß sie ihm das andere Messer tief zwischen die Rippen. Er hustete Blut, das zwischen seinen Barthaaren versickerte, setzte sich mit seinen verbliebenen Kräften jedoch weiterhin zur Wehr. Lila aber zog die Klinge mit aller Kraft nach oben, gegen den Widerstand von Knochen und Muskeln. Jetzt, endlich, ließ ihr Gegner die Waffe fallen, während sein Körper erschlaffte.
Einen kurzen Moment lang blitzte der Gedanke an einen anderen Tod in ihr auf, an einen anderen Körper, den ihre Klinge durchbohrt hatte – den des jungen Beloc in der trostlosen Burg der Weißen Könige. Der Soldat war nicht der Erste, der von ihrer Hand gestorben war, aber der Erste, der ihr im Gedächtnis haften geblieben ist und dessen Tod sie bedauerte. Als die Erinnerung erlosch, wurde sie sich ihrer Umgebung wieder bewusst, und ihre Schuldgefühle erstarben wie die Lebensflamme des Mannes, der reglos vor ihr lag.
Lila zog das Messer heraus, so dass der Leichnam zu Boden sank. Noch immer konnte sie das Klirren der Waffen, die aufeinanderschlugen, hören und die Erregung des Kampfes spüren. Sie atmete ein paarmal tief durch, dann drehte sie sich um und wollte sich aus dem Staub machen. Doch plötzlich sah sie sich den fünf Kumpanen ihres Opfers gegenüber.
Die Männer murmelten bedrohlich und zogen ihre Waffen.
Lila fluchte leise, und ihre Augen schnellten zum Palast, der hinter den Seeleuten die Isle überspannte. Dabei blitzte der feige Gedanke in ihr auf, dass sie dort hätte bleiben sollen, ja müssen, wo sie in Sicherheit gewesen wäre, doch sie unterdrückte diese Regung und packte ihre Messer fester.
Sie war Delilah Bard und würde leben und sterben, wie es ihr verdammt nochmal …
Ein Fausthieb in den Magen ließ ihre Gedanken in alle Richtungen zerstieben. Ein zweiter Schlag krachte gegen ihren Kiefer, so dass sie abrupt zu Boden ging. Sternchen tanzten vor ihren Augen, und klirrend glitt ihr eines der Messer aus der Hand. Sie kämpfte sich auf alle viere, das zweite fest umklammernd, als ein Stiefel sie hart am Handgelenk traf, gefolgt von einem Tritt in die Rippen. Dann krachte etwas gegen ihren Kopf, und ihr Blick verschwamm für einige Augenblicke, die ihr wie Stunden vorkamen. Erst als kräftige Hände sie auf die Beine hievten, nahm die Welt wieder Gestalt an. Lila spürte ein Schwert an der Kehle und dachte, ihr letztes Stündchen hätte geschlagen. Doch der Tod sollte sie nicht hier, nicht durch diese Klinge ereilen.
Stattdessen umschlang jemand ihre Handgelenke fest mit einem Lederriemen – ähnlich dem, der zuvor die Geldbörse gehalten hatte –, dann zerrte man sie die Hafenstraße hinunter.
Die Stimmen der Männer drangen als unverständliches Kauderwelsch an ihr Ohr, wobei ein Wort wieder und wieder erklang.
Casero. Was das wohl bedeuten mochte?
Sie schmeckte Blut, doch ob nun aus Nase, Mund oder Kehle, wusste sie nicht zu sagen. Es spielte ohnehin keine Rolle, wenn sie vorhatten, ihre Leiche in der Isle zu entsorgen. Oder galt das hier als Frevel? Lila fragte sich, was die Bewohner der Roten Welt üblicherweise mit ihren Toten zu tun pflegten. Nach einer kurzen, hitzigen Diskussion zerrte man sie über die Planke auf das Schiff, das sie den ganzen Nachmittag über beobachtet hatte. Als sie ein dumpfes Geräusch hinter sich hörte, wandte sie sich um und sah, dass einer der Seeleute den Leichnam des Bärtigen auf die Planke gelegt hatte. Wie interessant, dachte sie dumpf. Sie bringen ihn nicht an Bord.
Lila hatte die ganze Zeit über kein Wort gesagt, und ihr Schweigen schien die Besatzung aus der Fassung zu bringen. Sie riefen wild durcheinander und blafften Lila an. Immer mehr Männer scharten sich um sie, immer öfter erklang der Ruf »casero«. Wenn sie doch mehr als nur ein paar Tage Zeit gehabt hätte, um Arnesisch zu lernen. Was casero wohl bedeuten mochte? Gerichtsverfahren? Todesurteil? Mord?
Dann sah sie einen Mann über das Deck auf sich zukommen. Er trug eine schwarze Schärpe, einen eleganten Hut und ein schimmerndes Schwert; seine Lippen umspielte ein gefährliches Lächeln. Sofort hörten die Männer auf zu schreien; und Lila begriff.
Casero, das hieß »Kapitän«.
Der Kapitän des Schiffs war verdammt gutaussehend und verblüffend jung. Er hatte sonnengebräunte, dabei glatte Haut; eine elegante Spange hielt sein seidig braunes, von messingfarbenen Strähnen durchzogenes Haar zurück. Der Blick seiner Augen – sie waren von einem so dunklen Blau, dass sie fast schwarz wirkten – glitt von dem Leichnam auf der Planke zu den versammelten Männern und dann zu Lila. In seiner linken Braue glitzerte ein Saphir.
»Kers la?«, fragte er.
Die fünf Kerle, die Lila an Bord geschleppt hatten, begannen gleichzeitig zu sprechen. Lila versuchte gar nicht erst, irgendetwas von dem wilden Geschimpfe zu verstehen. Stattdessen heftete sie den Blick auf den Kapitän. Dieser sah sie seinerseits unverwandt an, während er den Klagen seiner Männer lauschte. Als sie endlich verstummten, begann der Kapitän, Lila zu befragen – oder zumindest auf sie einzureden. Er wirkte nicht besonders zornig, sondern nur missmutig, zwickte sich in den Nasenrücken und sprach rasend schnell, ohne zu ahnen, dass sie nur ein paar Brocken Arnesisch verstand. Lila wartete, bis bei ihm der Groschen fallen würde. Und tatsächlich hielt er nach einer Weile inne, als er ihren verständnislosen Blick bemerkte.
»Shast«, murmelte er, dann wandte er sich erneut langsam und deutlich an Lila, in verschiedenen Sprachen, die entweder kehliger oder fließender als das Arnesische klangen, wohl in der Hoffnung, Verständnis in ihren Augen aufglimmen zu sehen. Doch Lila schüttelte nur den Kopf. Sie konnte ein paar Wörter Französisch, doch in dieser Welt, in der Frankreich überhaupt nicht existierte, würde ihr das wohl kaum etwas nützen.
»Anesh«, schloss der Kapitän mit einem Wort, das, so viel wusste Lila bereits, allgemeine Zustimmung bedeutete. »Ta …« – er deutete auf sie – »… vasar …« – er zog den Finger über die Kehle – »… eran gast.« Mit diesen Worten deutete er auf den Mann, den Lila getötet hatte.
Gast. Dieses Wort kannte Lila schon. Es bedeutete »Dieb«. »Tu vasar mas eram gast« hieß also: »Du hast meinen besten Dieb getötet.«
Lila lächelte unwillkürlich und fügte die neuen Begriffe ihrem mageren Wortschatz hinzu.
»Vasar es«, rief einer der Seeleute und zeigte auf Lila. »Töte sie«. Oder vielleicht auch »töte ihn« – denn die Kerle hatten bestimmt noch nicht gemerkt, dass sie ein Mädchen vor sich hatten. Und Lila hatte nicht die geringste Absicht, es ihnen auf die Nase zu binden. Sie mochte sich zwar in einer anderen Welt befinden, aber manche Dinge änderten sich nie. Sie würde ein Mann bleiben, selbst wenn sie das mit dem Leben bezahlen sollte. Und darauf schien alles hinauszulaufen, denn sie sah, wie ein zustimmendes Murmeln, durchbrochen von einem gelegentlichen »vasar«, durch die Reihe der Seeleute lief.
Der Kapitän strich sich über das Haar, während er wohl überlegte, was er mit ihr anfangen sollte. Er hob eine Braue und sah Lila an, als fragte er sie: Nun, was schlägst du vor?
Plötzlich hatte Lila eine Idee. Zugegebenermaßen war diese ziemlich dumm, was aber, zumindest theoretisch, besser war, als gar keinen Einfall zu haben. Also suchte sie mühsam die Worte zusammen, um dann langsam und mit ihrem frechsten Lächeln zu sagen: »Nas. An to eran gast.«
Nein. Ich bin Euer bester Dieb.
Dabei sah sie dem Kapitän mit stolz erhobenem Kopf in die Augen. Die Mannschaft murrte unzufrieden, doch Lila schenkte ihnen keinerlei Beachtung. Denn in diesem Moment gab es nur noch sie und den Kapitän.
Ein kaum merkliches Lächeln umspielte die Lippen ihres Gegenübers.
Seine Männer waren hingegen weit weniger amüsiert über Lilas Unverfrorenheit. Zwei der Seeleute gingen bedrohlich auf sie zu, und noch während sie einen Schritt zurückwich, zückte sie kampfbereit ihr Messer. Was angesichts der Tatsache, dass ihre Handgelenke nach wie vor mit dem Lederriemen gefesselt waren, gar nicht so einfach war. Der Kapitän ließ einen Pfiff ertönen; ob nun als Befehl an seine Männer oder als Zeichen der Zustimmung, wusste Lila nicht zu sagen. Es spielte ohnehin keine Rolle. Denn schon traf sie ein Fausthieb im Rücken, der sie auf den Kapitän zutaumeln ließ. Er packte ihre Handgelenke so fest, dass sich ihre Knochen anfühlten, als zersplitterten sie. Scharfer Schmerz durchfuhr ihre Arme, und ihr Messer klirrte zu Boden. Sie funkelte ihn wütend an, während er – sein Gesicht nur wenige Zentimeter von dem ihren entfernt – ihr scharf und forschend in die Augen sah.
»Eran gast?«, fragte er. »Anesh.« Und dann ließ er sie zu ihrer Überraschung los. Er klopfte mit der Hand auf seine Brust. »Casero Alucard Emery«, sagte er, langsam und gedehnt. Anschließend deutete er auf sie und sah sie mit fragendem Blick an.
»Bard«, antwortete Lila.