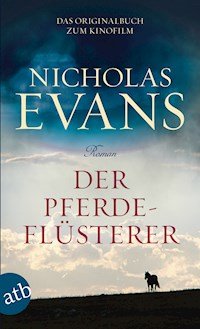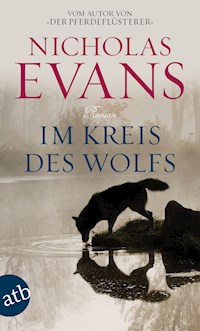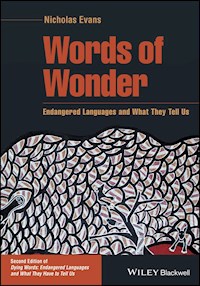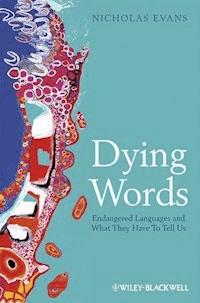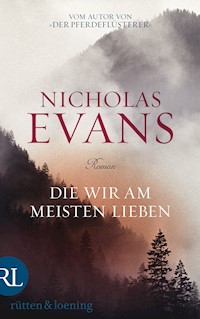
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Autor vom „Pferdeflüsterer“ ist zurück!
England 1959: Es gibt wenig Liebe im Leben des achtjährigen Tommy; seine Helden sind die Cowboys in den Westernserien, doch er selbst ist ein schüchterner Junge. Sein einziger Lichtblick ist seine Schwester Diane, die versucht, in Hollywood ihr Glück als Schauspielerin zu machen. Als Tommy in ein Internat kommt, in dem die Devise herrscht „immer tapfer sein“, wird er von allen anderen gehänselt und gequält. Diane rettet ihn und nimmt ihn mit nach Hollywood – doch dann kommt es zu einer Katastrophe, die Tommys Leben für immer verändert.
Vierzig Jahre später ist Tom ein anerkannter Journalist und Dokumentarfilmer. Das Geheimnis seiner Vergangenheit trägt er immer noch mit sich herum. Bis plötzlich sein Sohn, den er kaum kennt, in Schwierigkeiten gerät. Man wirft Danny vor, im Irak an einem Massaker an Zivilisten beteiligt zu sein. Tom begreift, dass er eine Familie hat – und dass er eine alte Schuld begleichen muss ...
Ein Roman über Liebe, Schuld und die Erkenntnis, dass man die Vergangenheit manchmal doch ändern kann ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 475
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Nicholas Evans
DIE WIR AM MEISTEN LIEBEN
Roman
Aus dem Englischen von Susanne Schädlich
Impressum
Die Originalausgabe mit dem Titel
The Brave
erschien 2010 bei Little Brown, New York.
ISBN E-Pub 978-3-8412-0367-0
ISBN PDF 978-3-8412-2367-8
ISBN Printausgabe 978-3-352-00815-3
Aufbau Digital,
veröffentlicht im Aufbau Verlag, Berlin, November 2011
© Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Berlin
Die deutsche Erstausgabe erschien 2011 bei Rütten & Loening,
einer Marke der Aufbau Verlag GmbH & Co. KG
Copyright © 2010 by Nicholas Evans
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung und Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlages zulässig. Das gilt insbesondere für Übersetzungen, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen sowie für das öffentliche Zugänglichmachen z.B. über dasInternet.
Schutzumschlaggestaltung Mediabureau Di Stefano, Berlin
unter Verwendung eines Fotos von plainpicture / Arcangel
Konvertierung Koch, Neff & Volckmar GmbH,
KN digital - die digitale Verlagsauslieferung, Stuttgart
www.aufbau-verlag.de
Menü
Buch lesen
Innentitel
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Informationen zum Autor
Impressum
Inhaltsübersicht
SEMPER FORTIS
EINS
ZWEI
DREI
VIER
FÜNF
SECHS
SIEBEN
ACHT
NEUN
ZEHN
ELF
ZWÖLF
DREIZEHN
VIERZEHN
FÜNFZEHN
SECHZEHN
SIEBZEHN
ACHTZEHN
NEUNZEHN
ZWANZIG
EINUNDZWANZIG
ZWEIUNDZWANZIG
DREIUNDZWANZIG
VIERUNDZWANZIG
FÜNFUNDZWANZIG
SECHSUNDZWANZIG
SIEBENUNDZWANZIG
ACHTUNDZWANZIG
NEUNUNDZWANZIG
DREISSIG
EINUNDDREISSIG
DANKSAGUNG
|5|Für meine Schwester Susan Britton
|6|The free have lost what matters
The brave stay home in bed.
The white hat now bespattered
With the blood of needless dead.
Out heroes all are banished.
We rode them out of town,
The valiant who vanished
When the sun was going down.
Shane van Clois
›Men in white hats‹
|7|SEMPER FORTIS
Der Junge folgte dem Wärter den Gang entlang, betrachtete den dicken, sich wiegenden Hintern, den Gürtel mit den Handschellen und dem Schlagstock und dem großen Schlüsselbund, das bei jedem Schritt rasselte.
Der blaue Hemdrücken des Mannes war verschwitzt, er wischte sich fortwährend mit der flachen Hand den Schweiß aus dem Nacken. In diesem Teil des Gefängnisses war der Junge noch nie gewesen. Die Wände waren nackt und weißgetüncht, es gab keine Fenster, nur fluoreszierende weiße Kästen an der Decke, die von innen mit toten Käfern gesprenkelt waren. Die Luft stand heiß, es roch nach Kohl. Er hörte entfernte Stimmen, jemand schrie, jemand lachte, das Klappern und Echo von metallenen Türen. Irgendwo im Radio liefen die Beatles, die neue Nummer eins, »A Hard Day’s Night«.
Normalerweise fanden die wöchentlichen Besuche in dem langen Saal neben dem Warteraum statt. Fast immer war er das einzige Kind dort. Die Wärter kannten ihn mittlerweile und plauderten mit ihm, während sie ihn zu einer Kabine führten. Dann musste er dasitzen, durch das Trennglas starren und darauf warten, dass sie seine Mutter durch die Stahltür in der hinteren Wand einließen. Immer waren zwei Wärter mit Gewehren da. Er konnte den Schrecken nicht vergessen, als er sie das erste Mal in dem hässlichen braunen Gefängniskleid und mit den Handschellen und Fußfesseln gesehen hatte, das Haar geschoren. Er hatte diesen Stich in der Brust verspürt, als würde sein Herz aufgebrochen, wie eine Muschel. Sobald sie eintrat, suchte ihr Blick seine Kabine, und sie lächelte, als sie ihn sah. Der Wärter |8|brachte sie herüber, setzte sie vor ihn hin und nahm ihr die Handschellen ab, und sie küsste ihre Handfläche und legte sie an die Glasscheibe, und er machte es auch so.
An diesem Tag jedoch war alles anders. Sie durften sich in einem separaten Raum treffen, nur sie beide, kein Trennglas. Sie würden sich berühren können, das erste Mal seit bald einem Jahr. Und zum allerletzten Mal.
Wo auch immer ihn der Wärter hinführte – es war ein langer Weg durch das Gefängnis. Ein Labyrinth von Betonkorridoren mit einem Dutzend oder mehr vergitterten und doppelt verriegelten Türen. Endlich aber standen sie vor einer Stahltür mit einem kleinen Drahtglasfenster. Der Wärter drückte einen Knopf in der Wand, und das Gesicht einer Frau erschien im Fenster. Der Türöffner summte, und die Tür sprang auf. Die Frau hatte schweißglänzende Pausbacken. Sie lächelte.
»Du musst Tommy sein.«
Er nickte.
»Folge mir, Tommy. Es ist gleich hier.«
Sie lief vor ihm her.
»Deine Mama hat uns viel von dir erzählt. Junge, ist sie stolz auf dich. Du bist dreizehn, stimmt’s?«
»Ja.«
»Ein Teenager. Wow! Mein Sohn ist auch dreizehn. Nicht ganz einfach.«
»Ist das hier der Todestrakt?«
Sie lächelte.
»Nein, Tommy.«
»Wo dann?«
»Denk jetzt nicht daran.«
Auf der einen Seite des Ganges befanden sich Stahltüren mit roten und grünen Lampen darüber. Vor der letzten Tür blieb die Frau stehen. Sie blickte durch den Spion, schloss auf und machte einen Schritt zur Seite, damit er eintreten konnte.
|9|»Geh nur, Tommy.«
Die Wände in dem Raum waren weiß, es gab einen Metalltisch, zwei Metallstühle und ein einziges Fenster, durch das die Sonne fiel und ein Quadratgitter auf den Zementboden malte. Seine Mutter stand in der Mitte, ziemlich still, schützte die Augen mit der Hand vor dem Sonnenlicht und lächelte ihn an. Statt der Gefängnisuniform trug sie eine weiße Bluse und eine Hose. Keine Handschellen oder Fußfesseln. Sie sah aus wie ein Engel. Als sei sie schon im Himmel.
Sie breitete die Arme aus und drückte ihn an sich. Es dauerte, bis einer von beiden in der Lage war, zu sprechen. Er hatte sich geschworen, nicht zu weinen. Endlich schob sie ihn von sich, betrachtete ihn, lächelte dann und strich ihm durchs Haar.
»Du musst zum Friseur, junger Mann.«
»Alle haben jetzt lange Haare.«
Sie lachte.
»Komm! Wir haben nicht viel Zeit.«
Sie setzten sich an den Tisch, und seine Mutter stellte ihm die üblichen Fragen: Wie war es in der Schule, wie lief die Mathearbeit in der letzten Woche, war das Essen in der Cafeteria jetzt besser? Er versuchte nicht nur einsilbige Antworten zu geben, zu klingen, als sei alles in Ordnung. Er verriet ihr nie, wie es wirklich war. Nichts von den Prügeleien in der Umkleidekabine, nichts darüber, wie die älteren Kinder ihn verhöhnten, weil er eine Mörderin zur Mutter hatte.
Als ihr keine Fragen mehr einfielen, saß sie nur da und sah ihn an. Sie nahm seine Hände und hielt den Blick lange gesenkt. Er sah sich im Raum um. Er war nicht so furchterregend, wie er ihn sich vorgestellt hatte. Er fragte sich, wo die Gasrohre und Ventile waren.
»Ist es hier?«
»Was denn, Liebling?«
»Du weißt schon. Ist das hier die Gaskammer?«
|10|Sie lächelte und schüttelte den Kopf.
»Nein.«
»Wo dann?«
»Ich weiß es nicht. Irgendwo da hinten.«
»Oh.«
»Tommy, ich wollte dir so vieles sagen … Ich hatte eine ganze Rede vorbereitet.«
Ihr kurzes Lachen war unecht. Sie lehnte den Kopf zurück, und eine Zeitlang schien es, als könnte sie nicht weitersprechen. Er wusste nicht, warum, aber es machte ihn wütend.
»Aber … ich habe alles vergessen«, fuhr sie fort.
Sie wischte sich die Tränen von den Wangen und schniefte, dann nahm sie wieder seine Hand.
»Ist das nicht komisch?«
»Du wolltest mir wahrscheinlich sagen, mich für den Rest meines Lebens zu benehmen. Gut zu sein, das Richtige zu tun und immer die Wahrheit zu sagen.«
Er zog seine Hand weg.
»Tommy, bitte –«
»Ich meine, was weißt du schon davon?«
Sie biss sich auf die Lippe und starrte auf ihre Hände.
»Du hättest ihnen von Anfang an die Wahrheit sagen sollen.«
Sie nickte, versuchte sich zu fassen.
»Vielleicht.«
»Natürlich hättest du das tun sollen!«
»Ich weiß. Du hast ja recht. Verzeih mir.«
Eine ganze Weile schwiegen sie beide.
Der Sonnenstrahl war an den Rand des Raumes gewandert. Goldene Staubkörner schwebten im Licht.
»Du wirst ein gutes Leben haben.«
Er lachte bitter.
»Doch, Tommy. Ich weiß es. Du wirst von Menschen umgeben sein, die dich lieben und die sich um dich kümmern –«
|11|»Hör auf damit.«
»Wie bitte?«
»Hör auf, mir ein gutes Gefühl geben zu wollen.«
»Es tut mir leid.«
Er würde es für immer bereuen, dass er an diesem Tag nicht liebevoller zu ihr gewesen war. Er hatte gehofft, dass sie es verstehen würde. Dass er nicht auf sie wütend war, sondern auf sich. Auf seine eigene Ohnmacht. Wütend darauf, dass er sie verlor und nicht mit ihr sterben konnte. Es war nicht fair.
Er hatte keine Ahnung, wie lange sie so saßen. Lange genug, dass die Sonne am Fenster vorübergezogen und der Raum schattiger geworden war. Schließlich öffnete sich die Tür. Die pausbackige Wärterin lächelte traurig und ein wenig nervös.
Seine Mutter presste die Handflächen zusammen.
»Nun«, sagte sie lächelnd. »Die Zeit ist um.«
Beide standen sie auf. Seine Mutter hielt ihn so fest an sich gedrückt, dass er kaum atmen konnte. Er spürte ihr Zittern. Sie nahm sein Gesicht in ihre Hände und küsste ihn auf die Stirn. Er aber konnte ihr noch immer nicht in die Augen sehen. Dann ließ sie ihn los, und er ging zur Tür.
»Tommy?«
Er drehte sich um.
»Ich liebe dich.«
Er nickte und wandte sich ab und ging.
|12|EINS
Sie entdeckten die Spuren im Morgengrauen im feuchten Sand am Fluss, etwa eine Meile flussabwärts von der Stelle, wo die Planwagen für die Nacht eine Wagenburg gebildet hatten. Flint stieg vom Pferd, dem ulkigen, das vorne schwarz war und hinten weiß, als hätte jemand es mit Farbe besprüht und es sich dann anders überlegt. Flint kniete nieder, um sich die Spuren genauer anzusehen. Bill Hawks blieb auf seinem Pferd sitzen, beobachtete ihn und blickte sich hin und wieder zu dem mit Buschwerk bewachsenen steilen Hang hinter ihnen um. Sie waren sich sicher, dass die Indianer, die das Mädchen entführt hatten, sie beobachteten. Er zog seinen Colt, prüfte, ob er geladen war, und steckte ihn wieder in das Holster.
»Was glaubst du?«
Flint antwortete nicht. Für jeden anderen, auch für Bill Hawks, sahen die Spuren einfach nur aus wie Löcher im Sand. Aber Flint McCullough erzählten sie eine ganze Geschichte.
»Sie müssen im Wasser flussabwärts geritten sein, damit sie keine Spuren am Lager hinterlassen«, sagte Bill. »Hier sind sie rausgekommen – das sieht man.«
Flint sah ihn immer noch nicht an.
»Ja, zumindest wollen sie, dass wir das denken.«
Er schwang sich wieder in den Sattel und lenkte das Pferd ins Wasser.
»Was meinst du damit?«
Wieder antwortete Flint nicht. Er ritt durch die seichte Stelle zur anderen Uferseite und etwa dreißig Meter weiter flussabwärts. Dabei suchte er jeden Stein und jedes Grasbüschel |13|mit den Augen ab. Schließlich fand er, wonach er gesucht hatte.
»Flint? Hättest du was dagegen, mir zu sagen, was los ist?«
»Komm und sieh es dir selber an.«
Bill ritt hinüber. Flint war wieder abgestiegen, er hockte am Ufer und starrte auf den Boden.
»Verdammt, Flint, sag endlich, was du vorhast? Worauf warten wir noch? Holen wir sie uns.«
»Siehst du, hier, zwischen den Steinen? Noch mehr Hufspuren. Tiefere. Die auf der anderen Seite sind deutlich schwächer. Keine Reiter. Ein alter Shoshonentrick. Sie lassen ein paar Pferde laufen, sitzen zu zweit auf und schicken dich auf die falsche Fährte. So haben sie es hier gemacht.«
Bill Hawks schüttelte den Kopf, beeindruckt und ein wenig irritiert von Flints Scharfsinn.
»Wie viel Vorsprung haben sie?«
Flint blinzelte in die Sonne.
»Drei Stunden, vielleicht dreieinhalb.«
»Wie viele sind es?«
»Drei Pferde, fünf oder sechs Männer. Und das Mädchen.«
»Auf geht’s.«
Flint stieg wieder auf sein Pferd, und die beiden ritten am Flussufer entlang.
»Tommy! Schlafenszeit!«
Seine Mutter rief aus der Küche. Sie kam immer zur falschen Zeit. Tommy tat so, als hätte er sie nicht gehört.
»Tommy?«
Sie erschien in der Tür, wischte sich die Hände an der Schürze ab.
»Es ist halb neun. Ins Bett mit dir.«
»Mom, das ist Wagon Train. Die Folge dauert eine Stunde.«
Sie blickte verwirrt. Der vertraute Geruch von Gin und Zigaretten wehte ins Wohnzimmer. Tommy lächelte sie engelhaft an.
|14|»Es ist doch meine Lieblingsserie. Bitte.«
»Also gut, kleiner Racker. Ich bring dir deine Milch.«
»Danke, Mom.«
Flint hatte das kleine weiße Mädchen ein paar Tage zuvor entdeckt. Sie war allein durch die Wildnis gestreift. Ihr Kleid war zerrissen und blutbefleckt, und ihre Augen waren vor Angst weit aufgerissen. Der Major fragte sie vorsichtig, was passiert sei, aber ihr hatte es offenbar die Sprache verschlagen. Flint sagte, sie müsse mit einem anderen Treck unterwegs gewesen sein, der auf eine Gruppe Shoshonen gestoßen war. Sie müsse irgendwie entkommen sein. Dann, letzte Nacht, hatten sich die Indianer ins Lager geschlichen und sie aus ihrem Bett geholt.
Aber Flint McCullough, zweifellos der tapferste und klügste Mann der Welt, würde sie finden, die Indianer töten und sie retten.
In dieser Episode trug Flint seine enge Wildlederjacke mit den Fransen an den Schultern. Tommy hatte natürlich die gleiche an. Nun ja, fast. Seine Mutter hatte ihm seine aus den beigefarbenen Stoffresten von den neuen Vorhängen im Schlafzimmer genäht, aber sie war viel zu groß, und, um ehrlich zu sein, Nylon-Velour sah ganz und gar nicht aus wie Wildleder. Immer noch besser als gar nichts. Und er hatte einen Hut und einen Waffengürtel mit Lederschnüren am Holster, die ein bisschen so aussahen wie Flints. Die schwarze sechsschüssige Peacemaker mit dem weißen Griff, die ihm seine Schwester Diane zum Geburtstag geschenkt hatte, sah so echt aus, dass Tommy dachte, er könnte damit eine Bank überfallen. Für dieses abendliche Abenteuer hatte er sie mit einer neuen Rolle Platzpatronen geladen, den hellblauen aus der weißen Dose, die viel lauter knallten als die aus der roten von Woolworth.
Es war Anfang September, die Tage wurden kürzer. Die Luft, die durch das große Erkerfenster zog, war kühl und roch nach regennassem Staub und Äpfeln, die auf der Wiese verfaulten. |15|Eine Amsel sang laut im alten Kirschbaum. Auf der Weide jenseits des Gartens rief eine Kuh nach ihrem Kalb. Tommy saß an einem Ende des riesigen neuen Sofas. Es hatte ein rot-grünes Blumenmuster, von dem einem schwindelig wurde, wenn man es zu lange anstarrte. Zum Sofa gehörten zwei passende Sessel, die so viel Platz einnahmen, dass man sich seitlich an ihnen vorbeizwängen musste, um zum Fernseher in der Ecke des Zimmers zu gelangen, der in einem Schrank mit Mahagonifurnier stand.
Das Haus war früher das Cottage eines Landarbeiters gewesen. Seine Eltern hatten einen hässlichen Anbau errichten lassen, aber trotz des einheitsstiftenden weißen Anstrichs schien der Ort mit sich uneins zu sein. Das Haus befand sich auf einem halben Hektar großen Grundstück auf einem sanften bewaldeten Hügel, von dem aus man das stetige Vordringen der Stadt beobachten konnte, denn die Farmer verkauften nach und nach ihre Äcker an Bauherren. Eine gewaltige vierspurige Schnellstraße von Birmingham nach Bristol war in Bau. Tommys Vater klagte oft darüber, dass die Gegend gar nicht mehr ländlich war.
Aber Tommy gefiel das Haus. Er hatte sein ganzes Leben hier gewohnt. Der Vorgarten bedeutete ihm nicht sonderlich viel. Er war zu klein und zu zivilisiert. Aber wenn man durch den Hintergarten hinausging, den verfallenen roten Steinpfad entlang, am alten Treibhaus und an den Himbeerbüschen vorbei, die mit löchrigen Vogelschutznetzen überzogen waren, fand man sich in einer weit weniger gezähmten Welt wieder. Und genau hier, wo das Heilkraut, die Nesseln und das Brombeergestrüpp zügellos wucherten und sich niemals jemand außer ihm hin verirrte, verbrachte Tommy die meisten seiner wachen Stunden. Das war seine Stadt, der heimliche Wilde Westen. Indianerland.
Er hatte ein paar Freunde an der kleinen Schule gefunden, |16|die er seit drei Jahren besuchte, und manchmal ging er zum Spielen zu ihnen. Aber seine Mutter erlaubte es ihm nur selten, sie zu sich einzuladen. Tommy machte sich nicht viel daraus. Er wusste, die anderen Jungen fanden ihn ein wenig sonderbar und dachten, er habe nur Western im Kopf. Sie spielten lieber Räuber und Gendarm, und selbst wenn er sie dazu überredete, Wagon Train mit ihm zu spielen, gab es immer Streit, wer Flint McCullough sein durfte. Darum spielte Tommy lieber alleine. Außerdem, die besten Cowboys waren Einzelgänger.
Flints Gang hatte er bis zur Perfektion geübt. Er konnte auch nachahmen, wie der den Kopf neigte und eine Braue hochzog, wenn er nachdachte oder sich hinkauerte, um ein paar Fährten zu lesen, oder in der Glut eines Feuers stocherte, um herauszufinden, wie alt sie war. Am verwilderten Ende des Gartens, auf der kleinen Lichtung, wo er das Brombeergestrüpp abgehauen hatte, besaß Tommy sogar ein eigenes Pferd; einen abgebrochenen Ast eines alten Ahorn mit Zweigen genau da, wo die Steigbügel sein müssen. Eine braune Strippe, die an anderen Zweigen befestigt war, diente als Zügel. Tommy schwang sich in den Sattel genau wie Flint, spielend oder ernst, je nach der Geschichte, die er im Kopf hatte.
Verborgene Dinge mussten auch nachgeahmt werden, Dinge, die für einen Achtjährigen nicht ganz leicht zu verstehen waren. Das waren die Dinge, die im Inneren vor sich gingen. Flint konnte den Charakter eines Mannes so scharfsichtig deuten wie Hufspuren im Staub. Er behielt seine Gedanken meistens für sich, lächelte selten und redete nur, wenn er etwas Wichtiges zu sagen hatte. Auf seinen einsamen Abenteuern übernahm Tommy diese männlichen Eigenschaften, während er die Titelmelodie summte oder die dramatischere Musik, wenn Indianer auf der Bildfläche auftauchten. Und wenn es die Handlung erforderte, redete er (laut, aber nicht so laut, dass ihn jemand, der die Straße hinter der Hecke entlanglief, hören konnte) in Flints gedehnter Sprache.
|17|Nicht immer spielte er Wagon Train. Er war auch gerne Red McGraw aus Sliprock, der am schnellsten von allen ziehen konnte. Er stand wie Red bedrohlich vor dem Spiegel in seinem Zimmer, die Hand knapp über dem Colt, und sagte den Vorspann der Sendung auswendig auf:
In der Stadt Sliprock, dem gesetzlosen Herz des alten Westens, wo viele in Angst vor wenigen leben, kämpft ein Mann allein gegen die Ungerechtigkeit. Sein Name ist Red McGraw.
Manchmal, zur Abwechslung, war er Rowdy Yates aus Rawhide oder Cheyenne Body oder Matt Dillon. Maverick war auch in Ordnung, allerdings saß der zu oft in Saloons herum und trug komische Stadtkleidung. Tommy mochte lieber die in Wildleder, die durch die Steppe ritten, mit Indianern kämpften und Viehdiebe und Gesetzlose jagten. Ganz sicher spielte er niemals, nicht einmal als Leiche, einen dieser albernen, verweichlichten Cowboys, die zwei silberglänzende Colts und Pistolenholster ohne Beinriemen hatten wie Hopalong Cassidy oder The Lone Ranger. Wer nahm schon einen Revolverhelden ohne Beinriemen ernst? Am schlimmsten aber waren die singenden Cowboys wie Gene Autry oder der lächerliche Roy Rogers.
Seine Mutter kam zurück, ein Glas Milch in der einen Hand, einen Teller mit einem Stück Apfelkuchen in der anderen, eine neue Zigarette zwischen den Lippen. Ohne den Blick vom Bildschirm abzuwenden, nahm Tommy ihr die Milch und den Kuchen ab.
Flint und Bill versteckten sich hinter ein paar Felsen und beobachteten das Lager der Indianer. Die Nacht war hereingebrochen, die Indianer waren am Feuer eingeschlafen, außer einem, der das kleine Mädchen bewachte, und sogar der sah aus, als ob er gleich einnicken würde. Das Mädchen war an einen Baumstamm gefesselt und sah ziemlich unglücklich aus.
»Vorsicht. Verschütte bitte nichts.«
Seine Mutter zog an ihrer Zigarette, blies den Rauch in Richtung |18|Decke, blieb mit verschränkten Armen stehen und guckte eine Weile mit.
»Oh, das ist doch der Mann, der mir so gefällt, oder? Wie heißt er gleich?«
»Flint McCullough.«
»Nein, der Schauspieler, meine ich.«
»Mom, weiß ich doch nicht.«
»Robert irgendwas. Der sieht so gut aus.«
»Mom, bitte!«
In dem Moment, als Flint und Bill ihre Rettungsaktion starten wollten, setzte die Werbung ein. Tommys Mutter stöhnte und ging aus dem Zimmer. Werbung hielten seine Eltern für »gewöhnlich«. Achtbare Familien sahen nur BBC, den Sender, der so viel Geschmack bewies, keine Werbung zu senden. Tommy verstand das Problem nicht. Eigentlich war die Werbung oft besser als das, was davor oder danach kam. Tommy kannte die Spots fast alle auswendig. Wie Diane war er immer schon ein guter Mime gewesen, und manchmal, wenn seine Eltern Besuch hatten, bat ihn seine Mutter, den Strand-Zigarettenmann zu spielen. Unter Protest und vorgetäuschtem Widerwillen verließ Tommy das Zimmer. Wenig später schlenderte er wieder herein, trug den alten Filzhut seines Vaters und den Regenmantel, an dem er den Kragen hochgeschlagen hatte, und paffte schlechtgelaunt eine unangezündete Zigarette, die er aus dem Silberetui auf dem Kaffeetisch im Foyer genommen hatte. Dann sagte er: Your’re never alone with a Strand. Er erntete stets Gelächter und manchmal auch Applaus. Als Zugabe – er hatte die Verkleidung noch an – bat seine Mutter ihn, Sergeant Joe Friday aus Dragnet nachzumachen.
O Mom, stöhnte er dann in gespielter Verlegenheit, woraufhin selbstverständlich ein bittender Chor ein Ach, mach schon, Tommy, bitte! anstimmte. Also setzte er ordnungsgemäß seine ernsteste, männlichste Miene auf und verkündete in Sergeant |19|Fridays ausdrucksloser Art, dass die Geschichte, die sie gleich zu sehen bekämen, wahr sei, nur die Namen geändert wurden, um Unschuldige zu schützen. The facts, ma’am, just the facts.
Als Tommy den Kuchen aufgegessen hatte, hatten Flint und Bill die Sache so gut wie erledigt. Die Indianer wurden allesamt erschossen oder flohen, das kleine Mädchen wurde gerettet, und als sie zur Wagenburg zurückkehrten, war ihr Daddy aufgetaucht. Er hatte einen Verband am Kopf, war aber sonst unversehrt. Vater und Tochter umarmten sich unter Tränen und setzten sich anschließend mit allen ans Feuer zum Abendessen. Es gab Bohnen und Speck, das Einzige, was Koch Charlie zuzubereiten in der Lage war.
Genau wie Flint angenommen hatte, war die Wagenburg von einem Trupp kriegerischer Shoshonen angegriffen worden, die das Mädchen als Squaw mitgenommen hatten. Aber Tommy war sich nicht sicher, was das genau zu bedeuten hatte. Wie dem auch sei, sie hatte ihre Sprache wieder gefunden, und alles endete mehr oder weniger glücklich, wie fast immer.
Tommy setzte seinen Cowboyhut ab, zupfte an der Krempe und starrte weiter wie gebannt auf den Bildschirm, bis die Titelmelodie und der Abspann vorbei waren.
»Tommy, komm jetzt«, rief seine Mutter aus der Küche. »Mach schon! Dein Vater kommt jede Minute nach Hause.«
»Komme.«
Er trug das leere Glas und den Teller in die Küche, die erst vor kurzem renoviert worden war. Alle Flächen waren jetzt mit hellblauem Resopal überzogen. Seine Mutter stand am Herd, rührte in einer Pfanne und sah gelangweilt aus. Im Radio verkündete der BBC-Nachrichtensprecher, dass die Russen eine unbemannte Rakete zum Mond schicken wollten.
Seine Mutter hieß eigentlich Daphne, aber sie hasste den Namen, darum nannten sie alle Joan. Sie war eine kleine, korpulente Frau mit molligen Armen und heller Haut, die sich rot |20|färbte, wenn sie wütend war. Das geschah häufiger. Genau genommen sah ihr rotbraunes Haar immer wütend aus, besonders an Freitagen, wenn sie es hatte färben und in enganliegende, drahtige Locken legen lassen.
Tommy wusch sein Glas und den Teller in der Spüle ab und stellte beides auf das Abtropfbrett, wo die Zigarette seiner Mutter in einem Aschenbecher vor sich hinqualmte. Daneben stand ein Glas mit Gin Tonic. Sie schenkte sich immer genau dann den ersten ein, wenn im Radio Big Ben sechs Uhr schlug. Dieser Drink war wahrscheinlich ihr dritter.
»Wann kommt Diane nach Hause?«
»Spät. Sie nimmt den letzten Zug.«
»Darf ich aufbleiben?«
»Nein, das darfst du nicht! Du siehst sie am Morgen. Los jetzt, ab mit dir.«
Diane war vierundzwanzig und lebte in London, in der Nähe der Paddington Station, wo sie sich das oberste Stockwerk eines großen alten Hauses mit drei anderen Mädchen teilte. Tommy war nur ein einziges Mal dort gewesen, als seine Mutter mit ihm zu einem Arzt in der Harley Street nach London gefahren war. Diane kam fast jedes Wochenende nach Hause, und sobald sie auftauchte, war das Haus voller Sonnenschein und Freude. Sie hatte immer ein Geschenk für ihn dabei, irgendetwas Lustiges oder Außergewöhnliches und oft, jedenfalls nach Ansicht seiner Mutter, für einen achtjährigen Jungen völlig Unpassendes. Sie brachte die neuesten Schallplatten, nach denen jeder in London tanzte, oder den Soundtrack eines neuen Musicals, das sie gesehen hatte. Bei ihrem letzten Besuch war es West Side Story gewesen. Diane und er hatten die Platte wieder und wieder aufgelegt und so lange mitgesungen, bis sie jede Nummer auswendig konnten. Seither sang Tommy I like to be an American.
Diane war lustiger als irgendjemand auf der ganzen Welt. Sie spielte Leuten Streiche, auch vollkommen fremden. So rief sie |21|an und tat so, als sei sie jemand anderer, und sie machte ungezogene Sachen, solche, die man als Erwachsene nicht mehr tat, wie zum Beispiel Salz und Zucker vertauschen oder einen Becher Wasser auf die Kante der Badezimmertür stellen, damit derjenige, der ins Bad ging, vollkommen nass wurde. Ihre Mutter bekam Wutanfälle (genau das wollte Diane erreichen), und ihr Vater senkte seine Zeitung, seufzte und sagte: Diane, bitte. Soll das ein Vorbild für den Jungen sein? Können wir nicht versuchen, ein bisschen mehr Verantwortung zu zeigen? Diane sagte dann: Ja, Vater, entschuldige Vater, doch hinter seinem Rücken zog sie eine Grimasse, imitierte ihn oder steckte ihre Daumen in die Ohren und streckte die Zunge raus und schielte. Tommy versuchte dann, sich das Lachen zu verkneifen, was ihm jedoch nie gelang.
Diane war Schauspielerin. Sie war noch nicht berühmt, aber jeder war der Meinung, dass sie es bald sein würde. Da es eine ältere Schauspielerin namens Diana Bedford gab, benutzte sie den Mädchennamen ihrer Mutter und spielte unter dem Namen Diane Reed. Tommy war unwahrscheinlich stolz auf sie. Er besaß Fotos von ihr und Zeitungsartikel. Riesige Plakate von den Stücken, in denen sie mitgewirkt hatte, hingen an den Wänden seines Zimmers neben all den Westernpostern und Bildern.
Sein Lieblingsfoto stammte aus einem Hochglanzmagazin. Diane trug ein schwarzes Satinabendkleid, große glitzernde Ohrringe und eine weiße Pelzstola um die Schultern. Sie stand vor dem Café Royal, einem berühmten Londoner Restaurant, in das alle Stars gingen; es war Nacht, und ihr Kopf war nach hinten geneigt, und sie lachte, als hätte gerade jemand einen Witz zum Besten gegeben. Die Schlagzeile lautete: EIN AUFSTEIGENDER STERN, und darunter: Diane Reed – Das Gesicht der Sechziger.
Seine Mutter, die immer ihren Spott und Hohn ausgießen musste, bemerkte, dass so eine Aussage wohl ein wenig voreilig sei, immerhin schreibe man erst das Jahr 1959.
|22|Tommy lag in der Badewanne und hatte wieder dieses sonderbare Gefühl in seinem Magen. Es war ein Knäuel, das größer und größer wurde, wie die Stapel merkwürdiger neuer Anziehsachen auf dem Bett im Gästezimmer. Zwei graue Flanellshorts, zwei graue Pullover, vier graue Oberhemden, sechs Paar graue Kniestrümpfe, vier Unterhosen und eine Weste, Sporthosen und Hemden (einmal weiß, einmal grün), ein Dutzend weißer Baumwolltaschentücher, eine grüngelbgestreifte Krawatte und der dunkelgrüne Blazer und die Kappe, beides versehen mit einem gelben Emblem – zwei gekreuzte Schwerter und ein Schild mit dem Leitspruch der Schule: Semper Fortis. Tommys Vater erklärte, es bedeute, man müsse immer tapfer sein. Es sei Latein, eine Sprache, die Tommy bald lernen werde, obwohl sie »tot« war und niemand sie mehr sprach.
Auf jedes Kleidungsstück hatte seine Mutter ein Schildchen genäht, auf dem BEDFORD, T. stand. Tommy hatte seinen Namen so noch nie geschrieben gesehen. Genauso stand es auch auf dem großen schwarzen Koffer und der Holzkiste auf dem Boden neben dem Bett, die sich langsam füllten. Er fand es seltsam, an einem Ort leben zu müssen, an dem niemand daran interessiert war, wie man mit Vornamen hieß. Aber in nur zwei Tagen würde er dort sein.
Warum ihn seine Eltern auf ein Internat schickten, konnte er nicht begreifen. Als sie ihm die Neuigkeit mitgeteilt hatten, dachte Tommy erst, er habe etwas falsch gemacht und dass sie ihn nicht länger bei sich haben wollten. Diane war dagegen, dass er auf ein Internat ging. Eines Abends im letzten Winter, nachdem er ins Bett gegangen war, hatte er gehört, wie sie mit ihren Eltern unten darüber gestritten hatte. Sie war selbst mit elf an einen düsteren Ort namens Elmhurst in Malvern Hills geschickt worden und hatte es so gehasst, dass sie dreimal ausgerissen war. Das letzte Mal etwa ein Jahr vor Tommys Geburt. Sie soll in einem Polizeiwagen nach Hause gebracht worden |23|sein. Wenn sie also wussten, wie schrecklich es war, warum würden seine Eltern ihm das antun wollen?
Diane hielt niemals an sich, wenn es Streit gab; es dauerte nicht lange, und sie fing an zu schreien. Wenn es so weit war, stürmte ihre Mutter aus dem Zimmer, schlug die Tür hinter sich zu, während sein Vater sich die Pfeife in den Mund steckte, die Zeitung hochnahm und so tat, als ob er nichts hörte. Dieses Verhalten machte Diane noch wütender. Aus seinen gemurmelten Antworten auf ihre Attacken in jener Nacht konnte Tommy Satzfetzen heraushören wie Tut dem Jungen gut, stählt ihn ein bisschen, macht einen Mann aus ihm. Tommy hatte schon immer schnell erwachsen werden wollen, dennoch, acht schien ein wenig zu früh für das Mannesalter.
Er hatte sich nie getraut, seinen Vater zu fragen, was alles damit verbunden war, aber seine Mutter hatte ihm versichert, dass Jungs aus angesehenen Familien nun einmal ein Internat besuchten. Er sollte sich glücklich schätzen, hatte sie gesagt, denn manche Kinder würden schon mit sechs weggeschickt. Zudem, hatte Tommy sie gegenüber Tante Vera sagen hören (und jedem, der zuzuhören bereit war), galt die Ashlawn Preparatory School für Jungen als eine der besten in Worcestershire. Auf die Liste der berühmten Ehemaligen gehörte einer, der für England Rugby gespielt hatte, einer hatte am Design des Mini Cooper mitgearbeitet, und einem Major war das Victoria Cross für seinen Einsatz im Krieg gegen die Japaner verliehen worden.
»Was hat er gemacht?«
»Habe ich vergessen, aber er war sehr tapfer.«
»Tapferer als Dad?«
»Natürlich. Der hat sich doch im Krieg nur anschießen lassen.«
Sein Vater hatte gegen die Deutschen gekämpft und eine Kugel ins Bein bekommen. Darum hinkte er immer noch ein wenig. Er war sogar eine Weile Kriegsgefangener gewesen, aber leider |24|war er nicht ausgebrochen, wie sie es immer in Filmen taten. Tommy begeisterte sich für Tapferkeit genauso wie für Männlichkeit. Beides gehörte zusammen. All die Stunden, die er damit verbracht hatte, Western zu sehen, waren nicht umsonst gewesen. Neuerdings fragte er sich, wie Flint McCullough reagieren würde, wenn man ihn in ein Internat schickte. Keine Tränen, so viel war sicher. Das Kinn zur Brust ziehen. Ein männliches Nicken. Tommy versuchte es, aber das Knäuel in seinem Magen bewegte sich nicht.
Der Kern des Problems, das alle – nun ja, seine Eltern und eine lange Reihe von Ärzten – versucht hatten zu lösen, solange er denken konnte, war die große Schande in ihrem Leben und wahrscheinlich auch der Grund, warum sie ihn nicht länger bei sich behalten wollten.
Es passierte nicht jede Nacht. Er schaffte es zwei oder manchmal auch drei Nächte hintereinander, dann brach seine Mutter in Begeisterungsstürme aus.
»Gut gemacht, Tommy. Das ist es! Du hast es geschafft! Guter Junge!«
Dann, in der nächsten Nacht, als spielte ein boshafter Kobold in seinem Innern ihnen allen einen Streich, geschah es wieder: Er wachte in den frühen Morgenstunden auf – im Haus war es totenstill – und spürte zwischen seinen Beinen das vertraute warme Nass. Er lag einfach da, verfluchte und hasste sich und weinte leise vor Wut und Selbstmitleid.
Keiner wusste mit Gewissheit, warum er ins Bett machte. Seine Mutter behauptete, es seien die Nachwehen einer schlimmen Mumpserkrankung im Alter von drei Jahren. Das, so sagte sie, hätte sein Blasensystem geschwächt. Ein Arzt, den Diane den Seelenklempner nannte, sagte, Tommy mache das absichtlich, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Er verschrieb ein Programm aus Zuckerbrot und Peitsche, das sie fast einen Monat lang befolgt hatten. Eine trockene Nacht, und Tommy durfte |25|eine halbe Stunde länger aufbleiben. Eine nasse, und er bekam Fernsehverbot oder kein Eis oder keine Schokolade. Bald war klar, das Programm hatte nur eines zur Folge: Allen wurde das Leben vermiest, und jeder war übelgelaunt. Und wie alle früheren Versuche wurde auch dieser sein gelassen, und sie suchten einen neuen Arzt auf und dann noch einen …
Der Arzt, den sie auf der Harley Street besuchten, gab ihnen eine spezielle Gummiunterlage. Diese Unterlage habe sich schon in Amerika bewährt, sagte er. Die Matte war mit Sensoren und einem langen Kabel ausgestattet, das man in die Steckdose stecken musste. Beim ersten Anzeichen von Nässe verabreichte die Unterlage elektrische Schläge – nichts Ernstes, versicherte der Arzt Tommys Mutter, genug eben, um den Jungen aufzuwecken – und löste eine Alarmglocke aus. Tommy hatte keinen Schimmer, wie viel das Ganze kostete, aber dem Gesichtsausdruck seiner Mutter nach zu urteilen, als sie die Rechnung sah, musste es viel gewesen sein.
In den frühen Stunden der ersten Nacht kam es zum Test. Es gab einen blauen Blitz und einen lauten Knall, und Tommy wurde aus dem Bett geschleudert. Er landete auf dem Fußboden mit Verbrennungen am Po, die erst nach zwei Wochen verheilt waren.
In den letzten Monaten, da der Tag näher rückte, an dem er in die tapfere und männliche Welt von Ashlawn Preparatory abreisen würde, wurde die Jagd nach Heilung zu einem Rausch. Und je mehr sie darüber sprachen, desto weniger Kontrolle schien er über seine Blase zu haben.
Den ganzen Sommer über hatte er eine kleine gelbe Pille schlucken müssen. Angeblich sollte er dadurch nur in einen leichten Schlaf fallen und aufwachen, wenn er musste. Er wachte nicht auf, und tagsüber fühlte er sich, als sei er ein anderer, wie eine durchgeknallte Comicfigur. Er hatte noch nie so viel Energie gehabt, konnte nicht stillsitzen, nicht einmal eine |26|Minute lang, und war so laut und hektisch, dass seine Mutter es nicht länger ausgehalten und die letzten Pillen in der Toilette hinuntergespült hatte.
Der neueste Versuch, das Bettnässen zu stoppen, sah so aus: Das Fußende seines Bettes wurde auf zwei Holzklötze gestellt. Seine Mutter hatte davon in einer Zeitschrift gelesen. Auf diese Weise sollte der Druck auf die Blase durch Ausnutzung der Erdanziehungskraft verringert werden, erklärte sie. Tommy schlief also in einem Winkel von etwa dreißig Grad zum Boden. Bisher hatte er jede Nacht ins Bett gemacht und war am nächsten Morgen gegen die Wand gedrückt und mit einem steifen Nacken aufgewacht.
Als sein Vater nach Hause kam, lag Tommy im Bett und versuchte die Gedanken ans Internat durch die Lektüre von Custer’s Last Stand zu verscheuchen. Custer war einer von Tommys Helden aus dem wirklichen Leben. Es gab ein ganzseitiges Foto von ihm in seinem Wildlederanzug, umzingelt von blutrünstigen Wilden, ein rauchender Colt in der Hand, sein langes blondes Haar flatternd im Wind.
Arthur Bedford war Buchhalter und arbeitete für eine Firma, die Teile für Autos in Birmingham herstellte. Tommy wusste nicht genau, was alles damit zusammenhing, außer dass er sich um Geld kümmern und gut in Mathematik sein musste, mit Abstand das schrecklichste Fach der Welt. Allein das Wort Division ließ Tommy erschauern. So verwunderte es auch nicht, dass sein Vater nach der Arbeit erschöpft und elend aussah. Wenn er es genau bedachte, sah sein Vater fast immer so aus. Das hatte wohl auch damit zu tun, dass er von Tommys Mutter ohne Unterlass kritisiert oder angekeift wurde. Egal, was der arme Mann tat, es schien sie zu irritieren oder zu stören.
Sein Vater sah eigentlich nur glücklich aus, wenn er im Treibhaus seine Tomaten pflegte oder in der kleinen Werkstatt im hinteren Teil der Garage saß, wo er stundenlang mit einer Lupe |27|und einer kleinen Kopflampe winzige Porzellanscherben zusammenfügte. Menschen schickten ihm ihre zerbrochenen Vasen und Teller zur Reparatur. Er war wirklich gut. Wenn er etwas zusammengeklebt hatte, konnte man nicht einmal mehr erahnen, dass es je kaputt gewesen war.
Das Spannendste, wenn auch etwas mysteriös, aber war – sein Vater gehörte einem Club an, der so geheim war, dass man ihn nichts darüber fragen durfte, geschweige denn erwähnen, dass man davon wusste. Die Leute nannten sich Freimaurer und hielten einmal im Monat donnerstagabends an einem Ort namens The Lodge Geheimtreffen ab. Sie hatten einen speziellen Handschlag, an dem sie sofort erkennen konnten, ob jemand ein echtes Mitglied war oder ein Spion, der sich einzuschleichen versuchte. Tommys Vater bewahrte all seine geheimen Freimaurerutensilien in einem schmalen braunen Lederkoffer auf dem Kleiderschrank in seinem Schlafzimmer auf. Einmal hatte Tommy einen Blick hineingeworfen und erwartet, eine tödliche Waffe zu entdecken, so etwas wie eine Laserwaffe, aber er fand nur eine kleine blauweiße Satinschürze, ein paar seltsam aussehende Medaillen und Abzeichen und eine Zeitschrift, die Health & Efficiency hieß und in der nackte Frauen abgebildet waren. Er hatte niemandem davon erzählt, nicht einmal Diane. Sie wusste anscheinend auch nicht mehr über Freimaurer als er. Nur, dass bei den Treffen im Lodge alle ihre Hosenbeine hochkrempelten und einen Galgenstrick um den Hals legten. Sie sagte, das hätte wahrscheinlich etwas mit Golf zu tun, denn viele der Männer von Vaters Golfclub waren auch Freimaurer.
Tommy hörte den Wagen seines Vaters über die Einfahrt in die Garage knirschen. Es war ein Rover 105S in zwei Grüntönen mit beigefarbenen Ledersitzen und einem Armaturenbrett aus Walnussholz. Sein Vater behandelte das Auto, als sei es für ihn persönlich von Gott gebaut worden. Die Wagentür wurde geschlossen, und Tommy hatte seinen Vater vor Augen, wie er |28|langsam um das Auto herumlief und den Lack nach winzigen Kratzern absuchte. Das machte er nach jeder Fahrt, egal wie kurz sie gewesen sein mochte. Mit einem weichen Tuch und Alkohol aus einer Flasche entfernte er dann die toten Insekten von den Scheinwerfern und dem Kühlergitter.
Arthur Bedford reagierte auf die Bettnässerei seines Sohnes ähnlich wie auf fast alles, was Tommy anging. Er blieb müde distanziert. Saubermachen, die Laken wechseln, Wäsche waschen, war genau wie fast alles, was mit Kindern zu tun hatte, Frauensache. Tommy wusste jedoch, dass sein Vater das Problem für eine generell weibliche Schwäche hielt.
Erst vor kurzem war Tommy aufgefallen, dass seine Eltern sehr viel älter waren als die der anderen Kinder in seinem Alter. Seine Mutter war beinahe fünfzig und sein Vater fast sechzig. Oft dachten die Leute, sie seien seine Großeltern. Einmal hatte ihm seine Mutter erklärt, dass sie sich viele Jahre um ein Brüderchen oder Schwesterchen für Diane bemüht hätten, aber Gott hätte es nicht gewollt. Dann, endlich, sei Tommy gekommen. Es sei ein Segen gewesen, sagte sie. Aus welchem Grund Gott seine Meinung geändert hatte, wusste Tommy nicht. Und was den Segen anging, war er sich auch nicht so sicher, denn einmal hatte er Tante Vera von ihm als einem Unfall sprechen hören.
»Gott im Himmel. Wir sind noch wach?«
Sein Vater spähte vom Treppenabsatz in Tommys Zimmer, seine kalte Pfeife steckte im Mundwinkel wie bei Popeye. Darum sprach er mit zusammengebissenen Zähnen und klang wie die Puppe eines Bauchredners. Sein Vater war in jeder Hinsicht das Gegenteil von seiner Mutter. Er war groß und schlank mit vielen knochigen Kanten. Seine Kleidung schien immer Platz für zwei zu haben. Sein Haar war voll und silbrig, nur vorn war es vom Pfeifenqualm gelb verfärbt.
»Wagon Train«, erklärte Tommy.
»Ah.«
|29|Sein Vater stand vor der Zimmertür, als könnte er sich nicht entscheiden, ob er hereinkommen oder ob er von dort, wo er war, gute Nacht sagen sollte. Er streckte ein wenig sein Kinn vor.
»Der alte Kerl wird dich vermissen.«
Tommy wusste nicht, wen er meinte. Er senkte Cluster’s Last Stand und sah zu, wie sein Vater vorsichtig über die Spielzeugcowboys und Indianer stieg, die auf dem Teppich einen Dauerkrieg gegeneinander führten. Er machte Anstalten, sich aufs Bett zu setzen, bemerkte dann aber den seltsamen Winkel und die Klötze und beschloss, es sei sicherer, zu stehen. Im Schein der Nachttischlampe leuchtete seine weite Wollhose, sein Oberkörper blieb im Dunkel. Er pflückte den Teddybären vom Kissen, und Tommy wurde klar, das war der alte Kerl, von dem sein Vater gesprochen hatte.
»Hmm. Der alte Bursche sieht ein bisschen mitgenommen aus.«
Old Ted hatte kahle Stellen und Narben von häufiger Flickerei. Früher hatte er Diane gehört und war das Opfer zahlloser Missgeschicke geworden. Er war gefoltert und aufgehängt, am Marterpfahl verbrannt, aus dem Fenster geworfen worden und hatte sich ausgedehnten Operationen unterziehen müssen.
»Kann ich ihn mitnehmen?«
Sein Vater lachte.
»Teddybären im Internat? Um Himmels willen, nein! Was würden die denken?«
»Was würde wer denken?«
»Die Lehrer, die anderen Jungen, alle.«
»Hat nicht jeder einen Teddybären?«
»Nur, wenn man klein ist.«
Er fuhr Tommy durchs Haar.
»Keine Sorge, wir passen auf ihn auf.«
Er steckte den Bäreb wieder ins Bett.
|30|»Nun, mal sehen, was das alte Mädchen mit meinem Abendessen gemacht hat. Licht aus jetzt.«
Er beugte sich hinab, und einen Moment lang dachte Tommy, dass sein Vater ihm einen Kuss geben würde. Das hatte er schon Jahre nicht mehr getan. Aber er suchte nur den Lichtschalter. Sein Tweedjackett roch nach Rauch und er nach Whiskey, den er im Golfclub getrunken hatte.
»Haben wir die Kielräume geleert?«
»Ja.«
»Mal sehen, ob wir eine trockene Nacht haben werden, hm?«
»Ich werd’s versuchen.«
»So ist es recht. Nacht, alter Bursche.«
»Nacht.«
Tommy lag auf dem Rücken, starrte auf den schmalen Lichtstreifen an der Decke, während er sein nächtliches Ritual praktizierte. Einhundert Mal flüsterte er: Ich werde nicht ins Bett machen, ich werde nicht ins Bett machen, ich werde nicht ins Bett …
Seine Eltern sahen im Wohnzimmer die Nachrichten. Ein Mann sagte, Präsident Eisenhower kehre von Schottland nach London zurück, wo er die Königin besuche. Sein Name war Dwight, aber alle nannten ihn Ike. Er schien ein netter alter Mann zu sein. Tommy hatte ein Foto von ihm, auf dem er John Wayne die Hand schüttelte.
Seine Gedanken wanderten wieder zu Flint und mit welcher Raffinesse der die Hufspuren am Fluss gefunden hatte. Er fragte sich, was dem Mädchen zugestoßen wäre, hätte er sie nicht vor den Indianern gerettet. Bestimmt Schlimmeres als ein Internat. Noch zwei Tage zu Hause, dann war es so weit. Im Frühjahr, als seine Mutter und sein Vater mit ihm dorthin gefahren waren, hatte der Ort freundlich ausgesehen. Ausgedehnte hügelige Wiesen und viele Bäume. Fußballfelder. Eine Turnhalle mit Seilen zum Klettern. Vielleicht war es ja gar nicht so schlecht.
Tommy musste eingeschlafen sein, denn bevor er sich versah, |31|war das Haus still und das Licht am Treppenabsatz ausgeschaltet. Jemand streichelte seine Stirn.
»Diane?«
»Hallo, mein Liebling«, flüsterte sie.
Sie kniete neben seinem Bett. Er hatte den Eindruck, dass sie schon eine Weile da war. Sie beugte sich zu ihm und küsste ihn auf die Wange. Sie hatte noch den Regenmantel an. Ihr Haar duftete nach Blumen.
»Bist du eben erst angekommen?«
»Ja.«
Sie streichelte weiter seine Stirn. Ihre Hand fühlte sich weich und kühl an. In der Dunkelheit konnte er ihr Gesicht nicht deutlich sehen, aber ihr Lächeln wirkte traurig, und irgendwie wusste er, dass sie geweint hatte.
»Was ist denn?«
Sie legte einen Finger an ihre Lippen.
»Schsch. Du weckst sie auf. Nichts ist los. Ich bin nur glücklich, dich zu sehen.«
Jetzt füllten sich seine Augen mit Tränen.
»Diane?«
»Was, mein Liebling? Was ist?«
»Ich will nicht in das Internat.«
Er fing an zu weinen, und sie fing auch wieder an. Sie nahm ihn in die Arme, und er vergrub sein Gesicht an ihrem warmen weichen Hals. Sie klammerten sich aneinander und weinten.
|32|ZWEI
Die Ashlawn Preparatory School für Jungen war ein beeindruckendes Herrenhaus in Backsteingotik mit Befestigungsmauern, verzierten Türmen und mehreren vermeintlichen Geistern. Das Gebäude stand auf einem Hügel in einer etwa acht Hektar großen Parklandschaft mit Eichen und Zedern, umgeben von einer drei Meter hohen Mauer mit Stacheldraht. Das Herrenhaus war von einem viktorianischen Industriellen erbaut worden. Er war aus den Slums in Birmingham aufgestiegen und hatte ein Vermögen in den Kolonien gemacht, ein Vermögen, das er jedoch sofort wieder verloren hatte. Das Gebäude, ein Monument für seinen gehobenen Gesellschaftsstatus, wurde für die nächsten zwanzig Jahre als Heim für geistig Behinderte genutzt.
Im Ersten Weltkrieg wurde die Klientel um einhundertundzwanzig Soldaten erweitert, die an einer Kriegsneurose litten. Erst als der letzte entlassen oder gestorben war, wurden die verfallenen Flure und Schlafräume dürftig zu einer Schule umfunktioniert. Es gab elegantere, teurere Internate im Lande, auf die man die Söhne der etablierten Ober- und Mittelschicht schickte. Ashlawn war für die, die sich in die eine oder andere Richtung dazwischen bewegten und deren soziale Ansprüche oder Ambitionen ihre Mittel überstiegen.
Im Interesse der Schulgeld zahlenden Eltern wurde das imposante schmiedeeiserne Tor, das mit dem Schulwappen und dem Motto Semper Fortis geschmückt war, regelmäßig gestrichen und die sich eine halbe Meile schlängelnde Auffahrt akribisch von Unkraut befreit. In den dunkleren, weiter abgelegenen Teilen des Herrenhauses, wohin sich Eltern nicht verirrten, hatte |33|sich in den letzten fünfzig Jahren wenig verändert. Die abblätternde Farbe in den institutionstypischen Tönen Braun und Blassgrün blieb unberührt; in den alten Rohrleitungen unter den holzstichigen Dielen rauschte und rumpelte es; an den schwarzen Eisenbetten befanden sich noch die Schlitze für die Schlingen, mit denen einst die Unbändigen gefesselt worden waren; und die Holzbänke in dem nasskalten und übelriechenden Umkleideraum trugen noch die eingeritzten Initialen der Wahnsinnigen und Verzweifelten.
Für die Neuankömmlinge oder Neulinge, wie sie weniger liebevoll bezeichnet wurden, jugendlich frisch und in den viel zu großen Uniformen, war der Umkleideraum Ashlawns der furchtbarste Ort. In diese Kammer, das lernten sie zuerst, befahl sie nach Ausschalten des Lichts irgendein Lehrer und verabreichte ihnen die offizielle Tracht Prügel. Von den vielen Schlägern auf dem Schulhof konnten sie dort jedoch zu jeder Tages- oder Nachtzeit weniger offiziell, dafür aber umso erfinderischer drangsaliert werden. Die Wände über den Bänken waren mit Namensschildern und Gitterdrahtschränken versehen. Darin bewahrten die Knaben ihre Sportkleidung auf. In der Luft hing der Geruch von feuchten Socken. Abgesehen von der schmutzigen Dachluke im Duschraum spendete nur eine einzelne nackte Birne Licht, die an einem ausgefransten Kabel von der Decke hing.
Im Umkleideraum versuchte Tommy Bedford drei wundersam trockene Tage und Nächte nach seiner Ankunft in seinen weiten knielangen Rugbyshorts und einem makellos weißen Hemd die Schnürsenkel seiner Rugbystiefel aufzubinden. Sie waren fest und umständlich an den Draht des Schranks geknotet. Mit seinen abgenagten Fingernägeln bekam er sie nicht auf. Seine Mannschaft wurde von dem Hauslehrer Mr Brent beaufsichtigt, der, wie Tommy bereits wusste, der strengste und gemeinste Lehrer war. Seine Mitschüler waren schon auf dem |34|Weg zum Spielfeld, und je leiser das Echo der Stimmen im Korridor wurde, desto größer wurde die Angst in seiner Brust.
»Nichtsnutziger Neuling. Wir kommen wohl zu spät zum Spiel, nicht wahr?«
Tommy kannte noch nicht viele von den älteren Jungen, aber er kannte diesen. Jeder machte um Critchley einen weiten Bogen. Und um den Henker Judd, dessen Gesicht jetzt hinter dem anderen auftauchte. Sie waren elf Jahre alt und aus Remove B, bekannt auch unter dem Namen Deppen, der Klasse, in die man gesteckt wurde, wenn man blöd oder faul oder beides war.
»Oje. Haben wohl die Schnürsenkel durcheinandergebracht, was?«, sagte Judd.
»Ja.«
»Wie heißt du, Neuling?«
»Bedford.«
»Ach, du bist der Klotzjunge, oder nicht?«, sagte Critchley.
Er war groß und sehnig, hatte flachsblondes Haar, das ihm in die Stirn fiel. Judd war untersetzt und hatte das fleischige Gesicht eines Metzgerjungen. Tommy machte sich an den Schuhbändern zu schaffen und tat so, als habe er sie nicht gehört. Er sah die beiden auch nicht an. Das Erste, was Neulinge lernten, war, sich nicht dabei erwischen zu lassen, die Älteren anzustarren. Tat man es doch, sagten sie Showdown und boxten oder nahmen einen in den Schwitzkasten. Aus dem Augenwinkel sah er die zwei heranschlendern.
»Bist du taub und dämlich, Klotzjunge?«
»Nein, Sir – ich meine, nein, Critchley.«
»Ich sagte, du bist der Klotzjunge, oder nicht?«
»Wozu sind die denn?«, sagte Judd.
»Wozu ist was?« Tommys Stimme klang dünn, gequetscht.
»Die Klötze, du schleimige kleine Kröte.«
Die Hausmutter wusste von Tommys Bettnässerei, aber sonst |35|bisher niemand. Er war schon wegen der Klötze aufgezogen worden und hatte Dianes Rat folgend jedem, der fragte, gesagt, dass er unter Durchblutungsstörungen leide und es für seinen Blutfluss besser sei, wenn er in diesem Winkel schlief. Er setzte zu einer Erklärung an, kam aber nicht weit. Critchley packte ihn am Ohr und drehte es um.
»Lass das!«
Tommy schlug die Hand fort. Seine Knie zitterten, und er merkte, dass seine Blase nachgeben wollte.
»Sieh an.« Crichtley grinste boshaft. »Der Klotzjunge hat Temperament.«
Tommy starrte sie an, sein Herz schlug ihm bis zum Hals.
»Showdown«, rief Critchley.
Tommy sah zu Boden. Im selben Moment trat Judd hinter ihn und drehte ihm den Arm auf den Rücken. Critchley packte ihn an den Ohren und drehte sie so, dass Tommy dachte, er risse sie ab. Tränen rannen ihm übers Gesicht, und, schlimmer als das, ein warmes Rinnsal lief an seinen Innenschenkeln hinab. Critchley musste es gerochen haben, denn er ließ Tommys Ohren los und trat zurück.
»Ach du liebe Güte, was haben wir denn da?«
Tommys lange grüne Wollsocken saugten sich voll, und schon bald stand er in einer kleinen Pfütze. Judd ließ seinen Arm los und postierte sich neben Critchley, ihre beiden Gesichter leuchteten vor Entzücken und Ekel.
»Igitt!«
»Ist ja widerlich. Klotzjunge, du bist widerlich. Was bist du?«
Tommy antwortete nicht. Judd packte ihn am Ohr.
»Was bist du?«
»Widerlich«, sagte Tommy leise und versuchte, nicht zu wimmern.
»Richtig. Widerlich.«
Schritte kamen den Korridor entlang. Dem gewichtigen |36|Klang des Metalls am Absatz nach zu urteilen, war es ein Lehrer.
»Ein Wort, dass wir hier sind, Klotzjunge, und du bist tot. Klar?«
Tommy nickte, und die beiden Jungen schossen an ihm vorbei und verschwanden im Duschraum nebenan.
Tommy blieb stehen. Die Schritte kamen näher und hielten inne. Das freundliche und rötliche Gesicht von Mr. Laurence, der Englisch und Latein unterrichtete, erschien in der offenen Tür.
»Hallo, wen haben wir denn hier?«
»Bedford, Sir.«
»Bedford.«
»Ja, Sir.«
Mr. Lawrence blickte auf die Pfütze zu Tommys Füßen.
»Hm. Dumm gelaufen, alter Junge. Machen wir dich sauber, ja?«
Fünfzehn Minuten später begleitete Mr. Lawrence Tommy, der jetzt in einer riesigen ausgeliehenen Shorts steckte, auf das matschige Spielfeld. Es fing an zu regnen. Mr. Lawrence unterhielt sich kurz mit Mr. Brent. Der nickte und schnauzte Tommy an, nicht wieder zu spät zu kommen. Dann nahm er sich einen anderen Jungen vor, der sein Hemd nicht ordentlich in die Hose gesteckt hatte. Tommy musste zu Tode erschrocken ausgesehen haben, denn Mr. Lawrence legte ihm die Hand auf die Schulter und zwinkerte.
»Semper fortis, Bedford«, sagte er leise. »Semper fortis.«
»Sir.«
Mr. Brent blies in seine Trillerpfeife. Die nächsten neunzig Minuten lang mussten Tommy und ein Dutzend anderer Achtjähriger im eisigen Wind über das schlammige Spielfeld laufen und wurden von Mr. Brent tyrannisiert.
|37|Zehn Jahre schienen vergangen zu sein, seit Tommy auf dem Vorplatz seinen Eltern und Diane zum Abschied gewinkt hatte. Er hatte noch immer das verzweifelte Gesicht seiner Schwester vor Augen, die durch die Heckscheibe aus dem sich entfernenden Rover zurückgeblickt hatte. Das alles hatte sie mehr mitgenommen als ihre Eltern und Tommy. Die neuen Jungen hatten sich eine Stunde vor den älteren bei der Schule melden müssen. Tommy hatte zusammen mit seinem Vater und Diane den schweren Koffer in die Halle geschleppt, wo Mr. und Mrs. Rawlston, der Direktor und seine Frau, mit den Eltern plauderten. Als sie an die Reihe kamen, gab sein Vater ihnen seinen festen Händedruck (vielleicht einen freimaurerischen), und Tommy bemerkte, dass Mrs. Rawlston ein wenig zusammenzuckte. Diane gab niemandem die Hand. Sie weinte zu sehr.
»Also gut, Tommy«, sagte sein Vater. »Wir gehen jetzt.«
Er streckte Tommy die Hand entgegen, und Tommy machte sich auf den Händedruck gefasst. »Viel Glück, alter Junge.«
Dann hatte seine Mutter Tränen in den Augen. Noch nie zuvor hatte er sie weinen sehen. Sie gab ihm einen Kuss auf die Wange. Tommy biss sich auf die Lippe. Sein Vater hatte ihm mehrmals gesagt, flennen sei keine gute Idee.
»Die Hausmutter hat die Klötze«, flüsterte seine Mutter. »Pass auf, dass sie sie nicht vergisst.«
»Mach ich.«
Erst als Diane ihn in den Arm nahm, verlor er die Fassung und brach in Tränen aus. Sie schluchzte, ihr Gesicht war verschmiert von verlaufener Wimperntusche.
»Komm schon, alter Junge«, sagte sein Vater und blickte sich um. »Hören wir auf damit.«
Als alle Eltern fort waren, wurden die Neulinge wie eine Herde Schafe in den Speisesaal getrieben. Tee mit der Hausmutter. Ungefähr zwanzig Knaben. Manche schnieften noch, andere hatten vor Furcht große Augen. Sie sollten sich alle um |38|einen langen Tisch stellen, auf dem Teller mit Sandwiches und entsetzlich gelbem Obstkuchen standen. Miss Davis, die Hausmutter, war klein und drall und trug eine blaue Uniform und eine runde Brille, durch deren dicke Gläser ihre Augen riesig und grimmig wirkten. Damit und mit den gestärkten Flügeln ihrer Haube sah sie aus wie ein übergewichtiger Raubvogel, kurz bevor er auf seine Beute niederstürzt. Sie nahm an der Stirnseite des Tisches Platz, senkte den Kopf und faltete die Hände. Tommy konnte an ihrem Kinn lange Haare erkennen.
»Möge Gott uns mit wahrem Dank erfüllen«, sagte sie in breitem Walisisch. »Amen.«
Ein oder zwei murmelten Amen. Aber das reichte der Hausmutter nicht. Alle mussten es wiederholen.
»Und zwar so, als ob ihr es auch meint.«
Danach durften sie sich setzen.
»Langt zu, Jungs.«
Es gab Wasser, Milch oder Tee aus einer riesigen Kanne zur Auswahl. Tommy entschied sich für Milch.
Zwanzig Minuten lang gab keiner ein Wort von sich. Nicht einmal die Hausmutter. Sie blickte immer wieder auf ihre kleine Uhr, die an ihrem Busen steckte. Vom Korridor her konnten sie die Stimmen der älteren Knaben hören. Sie klangen glücklich, wieder da zu sein. Das fand Tommy erstaunlich und auch ermutigend. Er musterte die anderen Neulinge. Keiner von ihnen schien hungrig zu sein. Die meisten starrten nur auf ihre Teller. Der Junge neben ihm weinte weiter. Er hatte ein rundliches rosiges Gesicht, dunkle Locken und eine Brille mit einem rosa Rahmen. Das linke Glas war mattiert, so dass man das Auge nicht sehen konnte. Auf dem durchweichten Taschentuch stand sein Name, WADLOW, P. Sein Schluchzen war laut und heftig, und bald hatte er die ganze Aufmerksamkeit auf sich gelenkt.
»Still jetzt, Junge«, schalt die Hausmutter ihn sanft. »Es reicht. Iss dein Sandwich.«
|39|Wadlow gehorchte, weinte aber weiter, nur etwas leiser. Der Junge, der Tommy gegenübersaß, grinste. Er hatte Sommersprossen und rotes Haar und war offensichtlich der Einzige am Tisch, der seinen Spaß hatte. Er aß schon sein viertes Sandwich, zwinkerte Tommy zu, und Tommy, der diese Kunst nicht beherrschte, lächelte gezwungen. Gerade, als er dachte, er habe vielleicht einen Freund gefunden, gab Wadlow plötzlich ein gurgelndes Geräusch von sich, lehnte sich vor und erbrach sich spektakulär auf den Tisch. Ein Dutzend andere Jungen fing im selben Moment erneut zu weinen an.
Der Rothaarige hieß Dickie Jessop. Er und Tommy waren im selben Schlafsaal untergebracht und besuchten dieselbe Klasse. Tommy war froh darüber. In den nächsten zwei Tagen wurden die beiden Freunde. Dickies Eltern lebten in Hongkong, er sah sie nur einmal im Jahr, wenn er im Sommer zu ihnen flog. Seit seinem fünften Lebensjahr hatte er die verschiedensten Internate von innen gesehen, und nach einem Tag sagte er Tommy, dass Ashlawn nur halb so schlimm war wie andere. Dickie war lustig, er erzählte immerzu Witze und hatte offenbar vor niemandem Angst. Manchen Lehrern und älteren Jungen gegenüber war er vorlaut, hatte aber so viel Charme, dass sie darüber hinwegsahen. Das Beste allerdings war: Er begeisterte sich für Western und kannte sich fast so gut aus wie Tommy. Tommy fragte ihn, wer sein Lieblingscowboy sei, und ohne Zögern antwortete Dickie: Flint McCullough aus Wagon Train. Darauf schlugen sie ein.
Am dritten Tag zur Teestunde nach dem Rugby erzählte Tommy ihm leise von seiner Begegnung mit Critchley und Judd in der Umkleidekabine. Dass er sich in die Hose gemacht hatte, verschwieg er. Stattdessen gab er vor, mutiger gehandelt zu haben, als er es in Wirklichkeit getan hatte.
Dickie hörte ihm zu und nickte dann ernst.
»Die holen wir uns«, sagte er.
|40|»Das ist keine so gute Idee, glaube ich.«
»Keine Sorge. Du musst es nicht tun. Ich werde es tun.«
Tommy blieb in jener Nacht trocken. Das war die vierte. Noch nie hatte er es so lange geschafft, und er war vorsichtig optimistisch. Sein nächtliches Stoßgebet Ich werde nicht einpinkeln hatte er auf zweihundert erhöht. Es schien zu funktionieren. Nach dem Frühstück, als er sich im Zimmer der Hausmutter seine tägliche Portion Lebertran abholte, lächelte sie ihn beinahe an.
»Gut gemacht, Junge«, sagte sie. »Weiter so.«
Eine Woche … Wenn er es eine Woche schaffte, dann vielleicht für immer. Eine Nacht nach der anderen, sagte er sich.
Einige Jungen aus seinem Schlafsaal machten Bemerkungen über die Holzklötze. Pettifer, der anscheinend eifersüchtig auf seine Freundschaft mit Dickie war, hatte sich den Namen Klotzjunge ausgedacht. Dickie sprang ihm an die Kehle, drückte ihn an die Wand und drohte ihm grauenerregende Konsequenzen an, wenn er das noch einmal sagte.
Der Schlafsaal war lang und eng mit sechzehn Eisenbetten, acht auf jeder Seite, alle mit den gleichen roten Wolldecken. Jeder besaß einen Haken für den Morgenmantel und einen Metallstuhl, auf dem die Kleidung ordentlich zusammengefaltet zu liegen hatte. Tommys Bett befand sich gleich an der Tür, und darum oblag es ihm, Schmiere zu stehen und Alarm zu schlagen, sobald sich die Hausmutter oder »Whippet« oder »Windhund« Brent näherte.
Alle Lehrer hatten Spitznamen: Mr. Rawlston, der Schulleiter, war Charlie Chin, weil er kein Kinn hatte; die Hausmutter, weil sie walisisch war und böse, der »Drachen«, und Mr. Lawrence war Ducky oder die »Ente«. Tommy hatte noch nicht herausgefunden, warum. Niemand brauchte jedoch eine Erklärung für den Spitznamen von Mr. Brent. Seine hündischen Gesichtszüge und sein Ruf, die schlimmsten Prügel auszuteilen, sprachen |41|