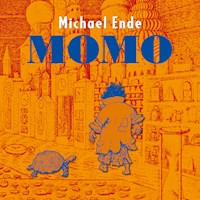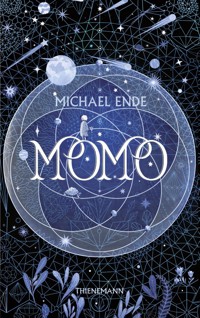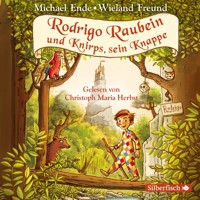11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Thienemann Verlag in der Thienemann-Esslinger Verlag GmbH
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Eine fantastische Geschichtensammlung von Bestseller Autor Michael Ende für Kinder ab 10 Jahren. In diesem Sammelband trifft man sie alle: den weisen Elefanten Filemon Faltenreich, die hartnäckige Schildkröte Tranquilla Trampeltreu, das hilfreiche Traumfresserchen, den liebenswerten Teddy Washable und das kleine Lumpenkasperle. Aber auch viele weitere meisterhafte Geschichten, Märchen und Fabeln für Kinder und Erwachsene gibt es neu zu entdecken. All diese Geschichten laden ein zu einer Reise in eine Welt, die in der Hektik des Alltags mehr und mehr in Vergessenheit zu geraten droht: unsere eigene Innenwelt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Das Buch
In diesem fantastischen Band sind sie alle versammelt: der weise Elefant Filemon Faltenreich, die hartnäckige Schildkröte Tranquilla Trampeltreu, das hilfreiche Traumfresserchen, der liebenswerte Teddy Washable und das kleine Lumpenkasperle. Aber auch viele weitere meisterhafte Geschichten für Kinder und Erwachsene gibt es neu zu entdecken.
Sämtliche Märchen und Geschichten von Michael Ende in einem Band – eine Reise in eine Welt voller Rätsel und Geheimnisse
Der Autor
© Caio Garrubba
Michael Ende, 1929–1995, zählt zu den bekanntesten deutschen Schriftstellern und ist gleichzeitig einer der vielseitigsten. In einer nüchternen, seelenlosen Zeit hat er die fast verloren gegangenen Reiche des Fantastischen und der Träume zurückgewonnen. Neben Kinder- und Jugendbüchern schrieb er poetische Bilderbuchtexte und Bücher für Erwachsene, Theaterstücke und Gedichte. Viele seiner Bücher wurden verfilmt oder für Funk und Fernsehen bearbeitet. Für sein literarisches Werk erhielt er zahlreiche deutsche und internationale Preise. Seine Bücher wurden in mehr als vierzig Sprachen übersetzt und haben eine Gesamtauflage von weltweit über 27 Millionen Exemplaren erreicht.
Mehr über Michael Ende: www.michaelende.de
Die Illustratorin
© Anja Jung
Regina Kehn, 1962 geboren, begann nach dem Studium der Illustration an der HAW Hamburg, als freie Illustratorin zu arbeiten und wurde seither vielfach ausgezeichnet. Unter anderem erhielt sie 2016 für ihre Illustrationen in dem Kinderbuch „Freunde der Nacht“ den Rattenfänger-Literaturpreis.
Mehr über Regina Kehn: illustration.reginakehn.de
Der Verlag
Du liebst Geschichten? Wir bei Thienemann auch!Wir wählen unsere Geschichten sorgfältig aus, überarbeiten sie gründlich mit Autor:innen und Übersetzer:innen, gestalten sie gemeinsam mit Illustrator:innen und produzieren sie als Bücher in bester Qualität für euch.
Deshalb sind alle Inhalte dieses E-Books urheberrechtlich geschützt. Du als Käufer erwirbst eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf deinen Lesegeräten. Unsere E-Books haben eine nicht direkt sichtbare technische Markierung, die die Bestellnummer enthält (digitales Wasserzeichen). Im Falle einer illegalen Verwendung kann diese zurückverfolgt werden.
Mehr über unsere Bücher, Autor:innen und Illustrator:innen:www.thienemann.de
Thienemann auf Instagram:https://www.instagram.com/thienemann_kinderbuch
Viel Spaß beim Lesen!
Michael Ende
Die Zauberschule und andere Geschichten
Mit Bildern von Regina Kehn
Thienemann
Anstelle eines Vorworts: Genau genommen
In unserer Familie haben alle Mitglieder, vom ältesten bis zum jüngsten, dieselbe kleine Schwäche: das Lesen. Kaum einer von uns ist je dazu zu bewegen, sein Buch aus irgendeinem Grunde für einen Augenblick beiseitezulegen, um etwas anderes Dringendes oder Unaufschiebbares zu erledigen. Das soll nicht heißen, dass dieses Dringende oder Unaufschiebbare überhaupt nicht getan wird. Wir finden nur, dass es durchaus nicht nötig ist, deshalb auf das Lesen zu verzichten. Man kann doch sehr gut das eine tun und das andere dabei nicht lassen, nicht wahr? Ich gebe zu, dass dadurch mitunter dieses oder jenes kleine Missgeschick vorkommt – aber was macht das schon?
Der Großvater sitzt, sagen wir mal, in einem bequemen Ohrenbackensessel, raucht seine Pfeife und hat ein Buch in der Hand. Er liest. Nach einer Weile klopft er seine Pfeife in den Aschenbecher aus, der vor ihm auf dem Tischchen steht. Das heißt, genau genommen ist es eigentlich nicht sein richtiger Aschenbecher, sondern eher eine Blumenvase. Durch den Klang erinnert sich der Großvater dunkel daran, dass er schon längst seine Hustenmedizin hätte nehmen müssen. Also greift er nach der Blumenvase und trinkt sie aus. »Hm, hm«, brummt er, »der Kaffee ist heute aber besonders schwarz – nur leider kalt.«
Die Großmutter sitzt, sagen wir mal, in der anderen Zimmerecke auf dem Sofa. Sie hat eine Brille auf der Nase und klappert mit ihren Stricknadeln. Auf ihrem Schoß liegt ein dickes Buch, darin liest sie. Sie strickt und strickt – was strickt sie wohl? Einen Strumpf natürlich. Das heißt, genau genommen ist es eigentlich kein ganz richtiger Strumpf, sondern eher eine Art wollene Riesenschlange, die sich schon über den Boden quer durch das ganze Zimmer ringelt. Während die Großmutter umblättert, wirft sie einen kurzen Blick über den Rand der Brille hinweg auf das Ungetüm und murmelt: »Da hat es, scheint mir, schon wieder mal bei uns gebrannt. Aber die Feuerwehr sollte trotzdem nicht einfach ihren Schlauch bei uns herumliegen lassen.«
Der Vater ist Porträtmaler. Er steht, sagen wir mal, in seinem Atelier vor einer Leinwand und malt das Bildnis einer vornehmen, reichen Dame. Diese Dame sitzt vor ihm auf einem Postament, trägt ein entzückendes Blumenhütchen auf dem Kopf und hat ihren Mops auf dem Schoß. Der Vater malt mit einer Hand, denn in der anderen hält er ein Buch, in dem er liest. Als das Bildnis schließlich fertig ist, erhebt sich die vornehme, reiche Dame und tritt gespannt näher, um ihr eigenes Konterfei zu bewundern. Es ist ein sehr schönes Bild geworden. Das heißt, genau genommen ist es vielleicht ein bisschen merkwürdig, denn der Vater hat der Dame mit dem Blumenhütchen das Gesicht des Mopses gemalt und dem Mops auf ihrem Schoß das Antlitz der Dame. Deshalb geht nun die Dame ziemlich ungnädig fort, ohne das schöne Porträt zu kaufen. »Na ja«, sagt der Vater betrübt, »geschmeichelt ist es vielleicht nicht gerade – aber sehr ähnlich.«
Die Mutter steht, sagen wir mal, in der Küche und kocht das Mittagessen. Glücklicherweise hat sie vergessen, die Gasflamme unter dem Töpfchen anzudrehen, sonst wäre das Essen möglicherweise schon ein ganz klein wenig schwärzlich. In der Hand hält sie nämlich ein Buch, in dem sie liest. In der anderen Hand hält sie einen Kochlöffel, mit dem sie rührt und rührt. Das heißt, genau genommen ist es eigentlich nicht so sehr ein richtiger Kochlöffel, sondern eher ein Fieberthermometer. Nach einer Weile hält sie es sich ans Ohr und sagt kopfschüttelnd: »Es geht schon wieder eine Stunde nach. So werde ich natürlich nie rechtzeitig fertig.«
Die große Schwester (sie ist vierzehn) sitzt, sagen wir mal, draußen auf dem Flur beim Telefon und drückt gespannt den Hörer ans Ohr. Telefone sind ja bekanntlich eigens für vierzehnjährige Schwestern erfunden, denn ohne den Hörer am Ohr müssten alle vierzehnjährigen Schwestern der Welt so gewiss an Nachrichtenmangel sterben wie Taucher ohne Atemgerät an Luftmangel. Aber unsere vierzehnjährige Schwester hat obendrein noch ein Buch in der Hand, in dem sie liest. Trotzdem hört sie natürlich sehr gut, was ihre Freundin ihr alles Aufregendes zu erzählen hat. Das heißt, genau genommen hört sie es vielleicht doch nicht so besonders gut, weil sie nämlich überhaupt keine Nummer gewählt hat. So ungefähr nach zwei Stunden fragt sie schließlich ganz nebenbei: »Sag mal, wer ist eigentlich dieser Tüt-tüt, von dem du die ganze Zeit redest?«
Der kleine Bruder (er ist zehn) befindet sich, sagen wir mal, auf dem Weg in die Schule. Natürlich hat auch er ein Buch in der Hand und liest, denn was könnte er während der langen Straßenbahnfahrt Besseres tun? Die Straßenbahn wackelt und rumpelt und fährt hi-nauf und hinunter und kommt wieder mal gar nicht recht vom Fleck. Das heißt, genau genommen ist es eigentlich nicht die ganz richtige Straßenbahn, sondern eher der Lift unseres Hauses, aus dem der kleine Bruder auszusteigen vergessen hat. Als er nach einigen Stunden noch immer nicht an der Haltestelle vor der Schule angekommen ist, murmelt er sorgenvoll: »Sicher wird mir der Lehrer wieder nicht glauben, dass es nicht meine Schuld ist, wenn ich immer zu spät komme.«
Das jüngste Mitglied unserer Familie, das Baby, liegt, sagen wir mal, in seinem Körbchen. Natürlich liest in unserer Familie auch schon das Baby. Es hat wie alle anderen ein Buch in der Hand, nur dass es kleiner und leichter ist als die Bücher der älteren, ein Babybuch eben. Im anderen Arm hält es sein Fläschchen, denn seine Aufgabe, die es sehr ernst nimmt, besteht darin, sich gut zu ernähren, damit es groß und stark wird und bald größere und schwerere Bücher lesen kann. Aber genau genommen ist es eigentlich nicht sein richtiges Fläschchen, was es da im Arm hält, sondern eher ein großes Tintenfass. Und es trinkt auch nicht daraus, sondern schüttet sich ab und zu einen Schluck daraus über das Köpfchen. Das macht ihm weiter nichts aus, nur als schließlich ein dicker Tintenklecks auf die Seite tropft, wo es gerade liest, beginnt es plötzlich zu schreien, und es ruft (und ich hoffe, dass niemand bezweifeln wird, dass unser lesendes Baby selbstverständlich auch schon tadellos sprechen kann): »Mach doch mal einer das Licht an, es wird ja alles so dunkel!«
Unsere Katze hat, wie die meisten Katzen, die Aufgabe, Mäuse zu fangen. Ihr Beruf ist ihr ein und alles, deshalb sitzt sie so oft stundenlang, sagen wir mal, vor einem Mauseloch links hinten im Zimmer neben dem Kleiderschrank. Selbstverständlich hat auch sie ein kleines Buch in den Pfoten, denn was sollte sie wohl während der langen Zeit des Lauerns Besseres tun als lesen. (Und wer glaubt, dass eine Katze lesen kann, sollte sich nicht wundern, dass sie auch spricht.) Sie sitzt also, wie gesagt, vor dem Mauseloch. Das heißt, genau genommen ist es eigentlich kein ganz richtiges Mauseloch. Während sie liest, haben die Mäuse sie nämlich einfach herumgedreht und ein Stückchen weitergeschoben, und nun sitzt sie vor der Steckdose. Nach einer Weile fasst sie mal mit den Krallen hinein, und die Funken sprühen ihr aus dem Schwanz. »Aua!«, maunzt sie erschrocken. »Dieses Buch ist aber wirklich voller Hochspannung!«
Unser Laubfrosch sitzt, sagen wir mal, in seinem Laubfroschglas. Er hat ein wichtiges Amt, er soll nämlich das Wetter vorhersagen, indem er auf seiner Leiter hinauf- oder hinunterklettert. Er erfüllt seine Pflicht sehr gewissenhaft, sofern er nicht gerade liest, denn es versteht sich mittlerweile wohl schon von selbst, dass bei uns auch der Laubfrosch ein eigenes briefmarkengroßes und wasserfestes Laubfroschbuch besitzt. (Darüber, dass ein Frosch, der liest, auch spricht, verlieren wir jetzt schon kein einziges Wort mehr.) Nun ist die Sache nur leider die, dass er eigentlich immerfort liest und insofern seinem Hauptberuf nicht die nötige Aufmerksamkeit widmet. Aber manchmal überwältigt ihn plötzlich sein schlechtes Gewissen, und er erinnert sich an seine Pflicht. Um seinen guten Willen zu beweisen, rennt er dann plötzlich los und hastet, immer mit dem Buch in seiner feuchten Hand, die Leiter hinauf. Oder er steigt sie ebenso eilig und grundlos herab. Das heißt, genau genommen steigt er sie nicht richtig Sprosse für Sprosse abwärts, sondern er tritt ins Leere und purzelt die ganze Stiege mit ziemlichem Getöse herunter. »Wenn ich mich selbst richtig verstehe«, quakt er dann und reibt sich sein grünes Schienbein, »gibt es wohl bald einen Wettersturz.«
Der Einzige in unserer Familie, der nicht liest, ist ausgerechnet der Bücherwurm, der, sagen wir mal, im achten Band des großen Brockhaus-Lexikons wohnt. Nein, er liest nicht. Er betrachtet die Bücher ausschließlich vom Gesichtspunkt der Essbarkeit aus. Deshalb hat sein Urteil über »guten« und »schlechten Geschmack« zumindest in dieser Hinsicht nur sehr begrenzten Wert, und wir anderen betrachten ihn auch nicht als vollgültiges Familienmitglied.
Vielleicht fragt nun jemand, in welcher verwandtschaftlichen Beziehung ich selbst eigentlich zu den übrigen Familienmitgliedern stehe. Ich muss zugeben, dass ich mir darüber nicht ganz klar bin. Das heißt, genau genommen kenne ich die Leute überhaupt nicht, und, unter uns gesagt, ich glaube kaum, dass es sie wirklich gibt. Möglicherweise ist diese ganze Geschichte, die ich hier erzählt habe, nur deshalb so geworden, wie sie nun mal geworden ist, weil ich während des Niederschreibens gleichzeitig ein Buch vor mir liegen habe, in dem ich lese.
Und nun kann ich euch nur noch raten, dasselbe zu tun. Das heißt, genau genommen tut ihr es ja schon, denn sonst hättet ihr dies alles hier gar nicht gelesen. Also, gebt Ruhe und lasst auch mich weiterlesen!
Die Zauberschule
Da ich sicher bin, dass meine jungen Leser sich brennend für alles interessieren, was mit Schule zusammenhängt (oder etwa nicht?), will ich jetzt einmal erzählen, wie der Unterricht in Wünschelreich vonstattengeht.
Wünschelreich ist jenes Land, von dem es in manchen Märchen und Geschichten heißt, dass dort »das Wünschen noch etwas hilft«. Es liegt übrigens gar nicht so schrecklich weit von unserer Alltagswelt entfernt, wie die meisten Leute glauben, trotzdem ist es ziemlich schwierig zu erreichen. Man kann nämlich nur hinkommen, wenn man persönlich eingeladen wird, denn die Bewohner von Wünschelreich wollen ganz und gar keinen Massentourismus bei sich haben. Das mag manch einer bedauerlich finden, aber im Grunde ist es ganz gut so – wie jeder bald einsehen wird, der meinen Bericht hier gelesen hat.
Die meisten Zauberer früherer Zeiten stammten aus diesem Land. Heutzutage bleiben sie lieber zu Hause, von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen. Man kann sogar sagen, dass in Wünschelreich jeder ein klein bisschen zaubern kann. Aber um es richtig und fachgerecht zu erlernen, muss man eben auf eine Schule gehen.
Das ist nun schon viele Jahre her – länger, als die meisten von euch auf der Welt sind –, da hatte mich eine meiner vielen großen Reisen in jenes sagenumwobene Land geführt (wie gesagt, mit einer offiziellen Einladung, das versteht sich). Um die Sitten und Gebräuche seiner Bewohner gründlich zu studieren, hielt ich mich dort für einige Zeit auf und lernte bei dieser Gelegenheit zwei Kinder kennen, mit denen ich mich anfreundete. Sie waren Zwillinge, ein Junge namens Mug und ein Mädchen namens Amalaswintha, der Einfachheit halber Mali gerufen. Beide waren etwa neun Jahre alt, blauäugig und schwarzhaarig, er mit Bürstenfrisur, sie mit Ponyfransen. Es handelte sich um den Sohn und die Tochter der Wirtsleute, bei denen ich ein Zimmer gemietet hatte, eine ausgesprochen freundliche Familie, und auch die Kinder waren richtig nett und halfen mir bei meinen Studien, so gut sie konnten. So kam es, dass ich hin und wieder bei ihrem Schulunterricht dabei sein durfte. Meistens saß ich ganz hinten in der letzten Bank und hörte nur still zu, denn ich wollte ja nicht stören.
Übrigens kann nicht jeder einfach auf eine solche Schule gehen, sondern nur Kinder, die besonders begabt sind, das heißt, die über eine außergewöhnlich starke Wunschkraft verfügen. Normalerweise sind ja alle Kinder fähig, sich heftig dies oder das zu wünschen, aber bei den meisten dauert das nur kurze Zeit, und die Sache ist schon wieder vergessen. Um auf die Zauberschule zu kommen, muss man sich mit großer Ausdauer und geradezu glühend etwas wünschen können. Darin wird man vorher geprüft.
Die Klasse, die ich kennenlernte, bestand aus sieben Schülern, doch will ich die anderen fünf jetzt nicht einzeln vorstellen, das würde zu weit führen. Wie ich übrigens später erfuhr, musste es immer eine ungerade Zahl unter zehn sein, also mindestens drei und höchstens neun. Waren mehr als neun Kinder zum Unterricht angemeldet, dann wurde eine eigene Klasse gebildet, und war die Zahl gerade, dann mussten sie eben warten, bis noch eines dazukam. Warum das so war, habe ich nicht erforschen können, aber so war es.
Der Lehrer hieß Rosamarino Silber und war ein rundlicher Herr ungewissen Alters, der eine kleine Brille auf der Nase und einen himmelblauen Zylinder auf dem Kopf trug. Er lächelte oft verschmitzt und sah überhaupt so aus, als ob ihn nicht leicht etwas aus der Ruhe bringen könnte.
Als er am ersten Tag ins Klassenzimmer kam, saßen schon alle Schüler (ich, wie gesagt, ganz hinten) auf ihren Plätzen und blickten ihm erwartungsvoll entgegen. Er stellte sich ihnen vor und begrüßte sie und fragte jeden nach seinem Namen, so wie es ja auch bei uns üblich ist. Als das vorüber war, setzte er sich in einen Ohrenbackensessel neben der Wandtafel, faltete seine Hände über dem Bauch, schloss die Augen und schwieg.
»Bitte, Herr Silber«, sagte Mug, der schon ganz ungeduldig war, etwas vorlaut, »wann fangen wir denn mit dem Zaubern an?«
Da der Lehrer weiterhin schwieg, wiederholte er seine Frage noch lauter. Herr Silber öffnete die Augen und blickte ihn durch seine kleine Brille nachdenklich an. Dann schmunzelte er und antwortete: »Du brauchst nicht zu schreien, mein Junge, ich bin nicht schwerhörig. Habt etwas Geduld, denn ich muss euch zunächst eine wichtige Sache erklären und überlege gerade, wie.«
Nachdem er abermals eine Weile geschwiegen hatte, fragte er: »Ihr seid also alle hier, weil ihr zaubern lernen wollt. Erzählt mir doch mal, wie ihr euch das so vorgestellt habt.«
Mali meldete sich. »Ich hab mir gedacht, dass ich vielleicht allerhand Sprüche und Formeln auswendig lernen muss, vielleicht auch irgendwelche Gebärden und Zeichen, die man mit den Händen macht.«
»Wahrscheinlich«, sagte ein anderer Junge, »gehört auch eine Menge Geräte und Apparate dazu, mit denen man klarkommen muss, chemische Retorten, oder wie das heißt, und besondere Einmachgläser ...«
»Und allerhand Kräuter und Pulver und Mittel«, rief ein Mädchen.
»Ein Zauberstab!«, schlug ein anderes vor.
»Oder Bücher in Geheimschrift«, meinte ein Junge, »die man nur entziffern kann, wenn man den Trick kennt.«
»Ein magisches Schwert!«, rief Mug begeistert.
»Und vielleicht ein schöner langer Mantel«, sagte Mali träumerisch, »aus blauem Samt mit Sternbildern drauf, und eine hohe, spitze Mütze ...«
»Das alles«, unterbrach sie Herr Silber, »sind aber nur äußere Hilfsmittel, die für manche wichtig sind, für manche nicht. Was wirklich nötig ist, das ist viel einfacher und viel schwieriger zugleich. Es steckt in euch selbst.«
Alle schwiegen ratlos.
»Nun, es ist die Wunschkraft«, fuhr Herr Silber fort. »Wer zaubern will, der muss seine Wunschkraft beherrschen und einsetzen können. Aber dazu muss er erst einmal seine wahren Wünsche kennen- und mit ihnen umgehen lernen.«
Wieder machte er eine Pause, ehe er fortfuhr: »Eigentlich muss man sie nur wirklich kennenlernen, ganz offen und ehrlich, alles andere ergibt sich dann sozusagen von selbst. Aber es ist gar nicht so einfach herauszufinden, was die eigenen wahren Wünsche sind.«
»Was gibt’s denn da herauszufinden?«, wollte Mug wissen. »Wenn ich mir was wünsche, dann wünsche ich mir’s eben. Und wie! Nur kann ich deswegen noch lange nicht zaubern.«
»Darum habe ich ja auch von den wahren Wünschen gesprochen«, erklärte Herr Silber. »Die findet man nämlich nur, wenn man seine eigene Geschichte erlebt.«
»Seine eigene Geschichte?«, fragte Mali. »Hat denn jeder eine?«
»Nein, nicht jeder, durchaus nicht jeder« – der Lehrer seufzte – »obwohl wir bei uns in Wünschelreich noch verhältnismäßig gut dran sind. Aber draußen in der Alltagswelt erleben die meisten Menschen niemals ihre eigene Geschichte. Sie legen auch gar keinen Wert darauf. Was sie tun und was ihnen widerfährt, das könnte ebenso gut irgendein anderer tun oder einem anderen widerfahren. Ist es nicht so?«
Damit richtete er seinen Blick auf mich in der letzten Bank. Alle Kinder drehten sich nach mir um. Ich nickte verlegen und wurde ein wenig rot.
»Und deswegen«, nahm Herr Silber seine Rede wieder auf, »kommen sie niemals dazu, ihre wahren Wünsche zu entdecken. Die meisten Leute meinen nur, sie wüssten, was sie sich wünschen. Der eine meint zum Beispiel, er wäre gern ein berühmter Arzt oder Professor oder Minister, aber sein wahrer Wunsch, den er selbst gar nicht kennt, ist es, ein einfacher, guter Gärtner zu sein. Ein anderer meint, er wäre gern reich oder mächtig, aber sein wahrer Wunsch ist, Zirkusclown zu sein. Viele Leute meinen auch, sie wünschten sich ernstlich, dass es allen Menschen auf der Welt gut geht, dass alle glücklich und zufrieden leben können, dass jeder zu jedem nett ist, dass die Wahrheit siegt und der Friede herrscht. Solche Leute würden sich oft wundern, wenn sie ihre wahren Wünsche kennenlernten. Sie meinen nur, sich das alles zu wünschen, weil sie sich selbst gern als tugendhafte oder gute Menschen sehen möchten. Aber möchten heißt eben nicht wahrhaft wünschen. Ihre tatsächlichen Wünsche richten sich oft auf etwas ganz anderes, mitunter sogar geradezu auf das Gegenteil. Deshalb sind sie niemals wirklich ganz und gar einig mit sich selbst. Und weil es fremde Wünsche aus einer fremden Geschichte sind, erleben sie niemals ihre eigene Geschichte. Und deshalb können sie natürlich auch nicht zaubern.«
»Heißt das«, fragte Mali ungläubig, »wer einig mit sich selbst ist und seine wahren Wünsche kennt, der kann schon zaubern?«
Herr Silber nickte. »Manchmal braucht er noch nicht mal etwas zu tun, damit sein Wunsch in Erfüllung geht. Alles fügt sich dann scheinbar wie von selbst.«
Die Kinder dachten einige Zeit nach, dann fragte Mug: »Können Sie denn überhaupt richtig zaubern?«
»Natürlich«, antwortete Herr Silber würdevoll, »sonst wäre ich ja nicht euer Lehrer. Ich werde euch alles beibringen, weil es eben mein Wunsch ist.«
»Könnten Sie«, wollte Mali wissen, »uns dann vielleicht mal was vorzaubern? Nur so zum Spaß, meine ich.«
»Alles zu seiner Zeit«, sagte Herr Silber. »Das kommt schon noch. Im Augenblick habe ich nicht den Wunsch.«
Die Kinder blickten etwas enttäuscht drein.
»Haben Sie denn schon mal richtig gezaubert?«, erkundigte sich Mug in der Hoffnung, wenigstens eine Geschichte zu hören.
»Selbstverständlich«, erwiderte Herr Silber, »ich habe mir zum Beispiel gewünscht, dass ihr alle zu mir in die Schule kommt, und nun seid ihr da.«
»Ach so –«, sagte Mug gedehnt und wechselte einen raschen Blick mit seiner Schwester, »aber wenn wir nun nicht gekommen wären?«
Herr Silber schüttelte lächelnd den Kopf. »Ihr seid eben gekommen.«
»Das haben wir doch freiwillig getan!«, riefen nun alle Kinder durcheinander.
»Ruhe bitte! Nur immer mit der Ruhe!«, beschwichtigte Herr Silber die Klasse. »Gewiss seid ihr freiwillig hier. Denn ein guter Zauberer respektiert immer den freien Willen anderer Menschen. Er zwingt niemanden. Eure Wünsche und meine haben sich eben ergänzt. Das ist das Geheimnis.«
»Aber gibt es denn nicht auch böse Wünsche«, fragte Mali besorgt, »und böse Zauberer?«
Herrn Silbers Gesicht wurde ernst. »Das ist eine sehr wichtige Frage, liebe Mali. Du hast ganz recht, es gibt auch böse Zauberer – aber sehr selten. Denn so einer muss ja ebenfalls mit sich selbst ganz und gar einig sein, nur eben in der Bosheit. Und das bringt fast niemand fertig. Man darf nämlich dazu nichts und niemanden liebhaben, im Grunde noch nicht einmal sich selbst. Und außerdem, so einer hat nur Macht über diejenigen, die ihre eigenen wahren Wünsche nicht kennen und deshalb mit sich selbst uneins sind. Deshalb ist es so wichtig, dass ihr euch Mühe gebt und fleißig lernt, denn zaubern ist eine ernste Sache – auch wenn man es nur tut, um anderen damit Spaß zu machen. Ich hoffe, ihr alle habt das jetzt verstanden.«
Die Kinder schwiegen und machten nachdenkliche Gesichter.
»Und jetzt«, fuhr Herr Silber fort, »werde ich euch die erste und wichtigste Regel der Wunschkraft beibringen.« Er stand auf und schrieb an die Wandtafel:
1. Du kannst nur wirklich wünschen, was du für möglich hältst.
2. Du kannst nur das für möglich halten, was zu deiner Geschichte gehört.
3. Nur das gehört zu deiner Geschichte, was du in Wahrheit wünschst.
»Diese Regel«, sagte Herr Silber und unterstrich die Zeilen noch einmal, »solltet ihr euch gut einprägen und darüber nachdenken. Auch wenn ihr sie jetzt vielleicht noch nicht ganz versteht, nach und nach wird sie euch schon klar werden.«
»Heißt das«, fragte Mug aufgeregt, »wenn ich es für möglich halte, dass ich fliegen kann, dann kann ich fliegen – einfach so?«
Herr Silber nickte. »Ja, dann kannst du’s.«
Mug sprang auf. »Das werde ich sofort ausprobieren! Ich klettere jetzt aufs Dach vom Schulhaus und fliege los.«
Er rannte zur Tür, und Herr Silber machte keine Anstalten, ihn zurückzuhalten. Mug zögerte und drehte sich nach ihm um. »Und wenn ich aber runterfalle?«
Herr Silber nahm seine Brille ab und putzte sie. »Bist du denn nicht sicher, dass es zu deiner wahren Geschichte gehört?«, fragte er und guckte prüfend durch die Gläser.
»Keine Ahnung«, gab Mug kleinlaut zu.
»Du hältst es also nicht ohne jeden Zweifel für möglich?«, fuhr Herr Silber fort.
»Na ja –«, sagte Mug und zuckte die Achseln.
»Dann bist du vielleicht mit dir selbst überhaupt nicht einig?«, erkundigte sich Herr Silber. »Vielleicht hast du in Wahrheit ganz andere Wünsche?«
»Kann sein«, antwortete Mug.
»Na, dann wirst du eine böse Überraschung erleben, mein lieber Mug. Du wirst natürlich nicht fliegen, sondern herunterfallen und dir ein Bein brechen. So einfach ist das eben nicht mit dem Zaubern, sonst wäre diese Schule ja ganz überflüssig, und später das Zaubergymnasium, und schließlich die Zauberuniversität. Aber vielleicht weißt du es besser und willst es trotzdem versuchen?«
»Lieber nicht«, murmelte Mug und setzte sich wieder auf seinen Platz. »Es ist viel schwerer, als ich dachte.«
»Gut, dass du das einsiehst«, sagte Herr Silber und setzte seine Brille wieder auf. »Und damit ist der Unterricht für heute zu Ende. Auf Wiedersehen, bis morgen.«
Ich ging mit Mug und Mali zusammen nach Hause. Sie waren beide in Gedanken versunken und ich wollte sie nicht stören.
Die nächsten drei Wochen war ich anderweitig beschäftigt. Ich war nämlich von Wünschelreichs Minister für Fabeln und Märchen zu einer Besichtigungsreise des Landes eingeladen worden, bei der ich viel außerordentlich Interessantes zu sehen bekam. Aber davon will ich jetzt nicht sprechen. Sowie ich zurückgekehrt war, begab ich mich natürlich spornstreichs zur Zauberschule, um zu erfahren, was die Kinder – vor allem meine Freunde Mug und Mali – inzwischen schon gelernt hatten.
Die Klasse war gerade eifrig dabei, die allererste Lektion zu üben, die darin bestand, irgendwelche Sachen dazu zu bringen, sich zu bewegen, und zwar ohne sie zu berühren, nur durch die eigene Wunschkraft. Mug hatte ein Streichholz vor sich liegen und Mali ein Federchen, die anderen Kinder versuchten es mit Nähnadeln, Bleistiften oder Zahnstochern.
Herr Silber machte es seinen Schülern immer wieder vor, indem er zum Beispiel seinen Zylinder zum Kleiderhaken schweben ließ und wieder auf seinen Kopf zurückholte oder indem er ein Stück Kreide dazu brachte, wie von selbst etwas an die Wandtafel zu schreiben.
Die Kinder saßen da und strengten sich gewaltig an, bis sie ganz rote Köpfe bekamen, aber es wollte ihnen nicht glücken.
»Vielleicht findet ihr zu den Sachen, die ihr gewählt habt, keinen rechten Kontakt«, schlug der Lehrer vor. »Nehmt doch mal etwas anderes.«
Die Kinder tauschten also die Gegenstände aus und versuchten es jetzt mit ihren Radiergummis, Mützen oder Taschenmessern. Mali hatte einen Tischtennisball vor sich hingelegt und Mug versuchte, eine kleine Gießkanne dazu zu bringen, ei-nen Blumentopf auf dem Fensterbrett zu begießen. Aber vergeblich.
»Ihr müsst euch ganz fest vorstellen«, erklärte Herr Silber, »dass die Sache zu euch gehört wie eure Arme und Beine. Bei denen wisst ihr ja auch nicht, wieso ihr sie bewegen könnt – ihr tut es einfach, weil ihr drinsteckt. Genauso müsst ihr mit eurer Vorstellung in euren Gegenstand hinein-schlüpfen, bis ihr ihn von innen fühlt, so als ob er euer Finger oder eure Nase wäre. Na, nun macht schon, es ist doch ganz einfach!«
Und wie zum Beweis ließ er ein Schulheft durchs Zimmer fliegen, als wäre es ein großer Schmetterling. Es flatterte um Mugs Kopf herum und gab ihm ein paar Klapse, dann segelte es zu Herrn Silber zurück. In diesem Augenblick sprang die Gießkanne plötzlich in die Höhe, flog aber nicht zum Blumentopf hin, sondern über Herrn Silber, wo sie sich umkehrte und all ihr Wasser auf ihn ausschüttete. Danach fiel sie scheppernd zu Boden.
»Hoppla!«, stammelte Mug erschrocken. »Entschuldigen Sie bitte, Herr Lehrer, das hab ich nicht gewollt.«
Die ganze Klasse lachte. Herr Silber trocknete sich mit einem großen blauen Taschentuch das Gesicht, schmunzelte und sagte: »Natürlich hast du’s gewollt, mein lieber Mug, sonst wäre es ja nicht passiert. Du weißt nur selbst nicht, dass es dein Wunsch war. Es macht mir auch nichts aus, ich bin ja nicht aus Zucker, aber ich freue mich, dass du endlich den allerersten Anfang geschafft hast. Da seht ihr nun alle, dass man gar nicht achtsam genug sein kann, wenn es ums Zaubern geht.«
Ich weiß nicht, wie es zu erklären ist, aber durch Mugs Anfangserfolg schienen nun auch alle anderen Kinder, eins nach dem anderen, dahinterzukommen, wie sie es anstellen mussten. Nach kurzer Zeit schon schwirrten im Klassenzimmer alle möglichen Sachen herum.
Eine Woche später konnte ich mich überzeugen, dass alle Kinder imstande waren, durch einen leichten Wink mit der Hand oder sogar nur durch die Kraft ihres Blickes, nicht bloß kleine Gegenstände wie Bleistifte oder Pingpong-Bälle zu bewegen, sondern sie konnten sogar Tische und Stühle herumwandern oder einen Schrank an die Zimmerdecke schweben lassen. Denn mit dem Gewicht, so erklärten sie mir, habe das gar nichts zu tun.
Mug und Mali benützten ihre neuerworbene Fähigkeit übrigens oft zur Freude ihrer Eltern, indem sie – sozusagen als Hausaufgabe – sich darin übten, durch Wunschkraft den Tisch zu decken und nach den Mahlzeiten das Geschirr abzuräumen. Messer, Gabeln, Löffel und Teller marschierten wie von selbst in Reih und Glied ins Esszimmer oder entfernten sich wieder, um sich gleich darauf in der Küche selbst zu spülen und abzutrocknen. Das war für die Eltern natürlich äußerst praktisch und sie waren sehr stolz auf ihre begabten Zwillinge.
Die zweite Lektion war schon wesentlich schwieriger, und manche Kinder brauchten einen ganzen Monat dazu, ehe ihre Bemühungen von Erfolg gekrönt waren. Die Aufgabe bestand darin, Gegenstände, die man nicht vor Augen hatte, sondern die mehr oder weniger weit entfernt waren, herbeizurufen und plötzlich erscheinen zu lassen.
Herr Silber hatte einen Magneten mitgebracht und eine kleine Tüte voller ganz feiner Eisenfeilspäne. Er schüttete sie vorsichtig auf ein Stück Papier.
»Hier seht ihr«, erklärte er, »einfach ein Häufchen gefeiltes Eisen. Es hat keine Ordnung in sich. Aber jetzt passt mal auf!«
Er hielt den Magneten unter das Papier, und sofort bildeten die Eisenspäne ein ganz bestimmtes Muster.
»Seht ihr«, sagte er, »bisher war der Gegenstand, den ihr vor euch hattet, sozusagen der Magnet, der eure Wunschkraft in eine ganz bestimmte Richtung gelenkt hat. Aber jetzt, wo der Gegenstand anderswo ist, müsst ihr das aus eigener Kraft fertigbringen.«
Dazu war es erforderlich, sich die jeweilige Sache so deutlich vorzustellen, als ob man sie vor sich hätte. Man durfte sich dabei durch nichts ablenken lassen und an nichts anderes denken. Jede kleinste Einzelheit war dabei wichtig, sonst gelang das Experiment nicht. Oder es konnte einem passieren, dass man aus Versehen etwas ganz anderes herbeizauberte, wie zum Beispiel Mali, die während der Stunde einmal Appetit bekam und anstelle ihrer Sandalen, die sie eigentlich hätte herbeirufen sollen, plötzlich ihre Pausenbrote unter den Sohlen kleben hatte.
Zuerst mussten die Kinder mit Dingen üben, die sie gut kannten, Sachen aus ihrem täglichen Gebrauch wie Kämme oder Gürtel oder Mützen. Anfangs trugen sie diese Gegenstände nur ins Nebenzimmer, später dann vor das Schulhaus hinaus und zuletzt immer weiter weg. Danach kehrten sie ins Klassenzimmer zurück und wünschten sie herbei.
Als endlich alle diese Aufgaben bewältigten, ging Herr Silber dazu über, sie etwas herbeirufen zu lassen, was sie noch nicht kannten und von dem sie noch nicht einmal wussten, wo es sich befand. Dazu brauchten sie ein Bild, das sie sich genau einprägen mussten, oder, was noch schwieriger war, nur eine Beschreibung. Es handelte sich da beispielsweise um eine ganz bestimmte Blume, die auf dem oder jenem Berggipfel wuchs, oder einen bestimmten Stein auf dem Grunde eines Sees oder zuletzt sogar um einen kostbaren Ring aus einem vergrabenen Schatz. Das Allerschwierigste aber war dabei, diese Dinge zuletzt wieder dorthin zu wünschen, von wo sie gekommen waren. Darauf legte Herr Silber, der sonst eher geduldig und heiter war, sehr ernsthaften Wert und duldete keine Schlamperei. »Nur Nichtskönner und unehrliche Leute«, pflegte er immer wieder zu sagen, »nehmen, was sie nicht wirklich brauchen, und bringen die Welt in Unordnung.«
Wer gegen diese Regel verstoße, erklärte er, der könne niemals weiterkommen und müsse deshalb aus dem Unterricht ausscheiden. Das wollte natürlich keines der Kinder, und so bemühten sich alle nach besten Kräften, es richtig zu machen.
Wie schon gesagt, konnten die Schüler bei diesen Übungen nicht fortwährend im Schulhaus bleiben, sondern entfernten sich oft sehr weit von ihm.
Auf manchen dieser Ausflüge begleitete ich sie und lernte dabei die schönsten Gegenden von Wünschelreich kennen. Aber oft hatte ich meine eigenen Pflichten zu erfüllen, und darum kann ich nicht aus eigener Anschauung bestätigen, dass es den Schülern tatsächlich immer gelang, alles dorthin zurückzuzaubern, von wo es stammte. Da aber Herr Silber mit den Leistungen zufrieden schien, nehme ich es an.
Inzwischen war der Herbst in Wünschelreich eingezogen, ein stürmischer Wind wehte und es regnete an den meisten Tagen. Da ich dazu neige, mich leicht zu erkälten, blieb ich lieber zu Hause. Außerdem hatte ich vom Direktor der königlichen Bibliothek den Auftrag bekommen, einen ausführlichen Bericht über Wunschträume in der Alltagswelt zu verfassen. Obgleich mir diese melancholische Arbeit nicht gerade angenehm war, konnte ich mich als Gast des Landes dieser Aufforderung nicht widersetzen. Die nächste Lektion kenne ich also selbst nur aus den Erzählungen von Mug und Mali, die mich jeden Abend nach des Tages Arbeit besuchten und mir von ihren Fortschritten in der Zauberschule berichteten.
Herr Silber hatte mit der nächsten Lektion begonnen. Dabei ging es um die Kunst, ein Ding in ein anderes zu verwandeln. Soweit ich meine beiden jungen Freunde verstand, handelte es sich dabei um die Aufgabe, eine jeweilige »Zauberbrücke« zu bauen. Das bedeutete herauszufinden, was das eine Ding mit dem anderen gemeinsam hatte, was beide miteinander verwandt sein ließ. Über diese sogenannte Brücke musste durch Wunschkraft die Verwandlung bewerkstelligt werden.
Bei einem Apfel, der zu einem Ball werden sollte, war die Sache ja noch vergleichsweise einfach. Jedermann sieht sofort, dass beide kugelförmige Gestalt haben und ihre innere Verwandtschaft sozusagen von selbst zeigen. Schwieriger war es schon, zum Beispiel eine Gabel in einen Apfel zu verwandeln. Da musste man folgendermaßen vorgehen: Eine Gabel – so musste man denken – bleibt immer eine Gabel, gleich, ob sie groß oder klein ist. Wenn eine Gabel groß ist, dann ist es wieder gleich, ob sie aus Eisen oder Holz besteht. Nun kommen hölzerne Gabeln jeder Größe in jedem Baumgeäst vor, ja, man kann sagen, ein Baum ist im Grunde überhaupt nichts anderes als eine große, vielzinkige Gabel. Das trifft natürlich auch auf einen Apfelbaum zu. Seine Frucht, der einzelne Apfel, ist scheinbar nur ein kleiner Teil eines Apfelbaumes, in Wahrheit steckt aber in jedem Apfelkernchen wieder ein ganzer Apfelbaum. Man darf also mit Recht behaupten: Ein Apfel ist eine Gabel. Und wenn das so ist, dann stimmt auch das Umgekehrte: Eine Gabel ist ein Apfel. Und wenn man nun die richtige Zauber-Wunschkraft einsetzt, dann kann man über diese Brücke das eine in das andere verwandeln.