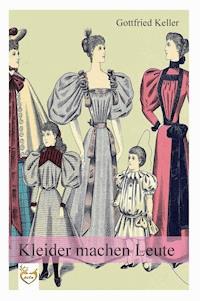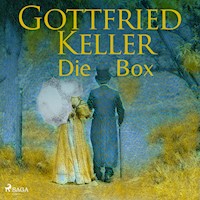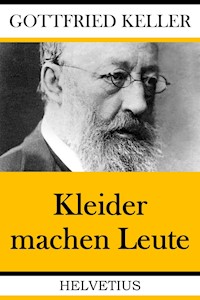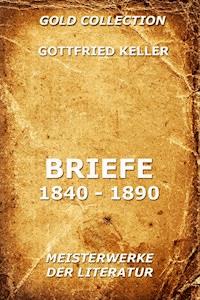Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Klassiker bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Neue Deutsche Rechtschreibung Gottfried Keller (19.07.1819–15.07.1890) war ein Schweizer Dichter und Staatsbeamter. Man kann ohne Zweifel sagen, dass Gottfried Keller der wichtigste Autor der Schweiz im 19. Jahrhundert war. Wegen eines Dummejungenstreiches von einer höheren Schulbindung oder gar einem Studium ausgeschlossen, fand der Halbwaise über den Umweg der Lehre zum Landschaftsmaler doch noch zur Literatur. Er hinterlässt ein großes Werk an Gedichten, Dramen, Novellen und Romanen. Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 100
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gottfried Keller
Dietegen
Novelle
Gottfried Keller
Dietegen
Novelle
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] 2. Auflage, ISBN 978-3-962812-90-4
null-papier.de/newsletter
Inhaltsverzeichnis
Dietegen
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Klassiker bei Null Papier
Alice im Wunderland
Anna Karenina
Der Graf von Monte Christo
Die Schatzinsel
Ivanhoe
Oliver Twist oder Der Weg eines Fürsorgezöglings
Robinson Crusoe
Das Gotteslehen
Meisternovellen
Eine Weihnachtsgeschichte
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Dietegen
An den Nordabhängen jener Hügel und Wälder, an welchen südlich Seldwyla liegt, florierte noch gegen das Ende des fünfzehnten Jahrhunderts die Stadt Ruechenstein im kühlen Schatten. Grau und finster war das gedrängte Korpus ihrer Mauern und Türme, schlecht und recht die Rät und Bürger der Stadt, aber streng und mürrisch, und ihre Nationalbeschäftigung bestand in Ausübung der obrigkeitlichen Autorität, in Handhabung von Recht und Gesetz, Mandat und Verordnung, in Erlass und Vollzug. Ihr höchster Stolz war der Besitz eines eigenen Blutbannes, groß und dick, den sie im Verlauf der Zeiten aus verschiedenen zerstreuten Blutgerichten von Kaiser und Reich so eifrig und opferfreudig an sich gebracht und abgerundet hatten, wie andere Städte ihre Seelenfreiheit und irdisches Gut. Auf den Felsvorsprüngen rings um die Stadt ragten Galgen, Räder und Richtstätten mannigfacher Art, das Rathaus hing voll eiserner Ketten mit Halsringen, eiserne Käfige hingen auf den Türmen, und hölzerne Drehmaschinen, worin die Weiber gedrillt wurden, gab es an allen Straßenecken. Selbst an dem dunkelblauen Flusse, der die Stadt bespülte, waren verschiedene Stationen errichtet, wo die Übeltäter ertränkt oder geschwemmt wurden, mit zusammengebundenen Füßen oder in Säcken, je nach der feineren Unterscheidung des Urteils.
Die Ruechensteiner waren nun nicht etwa eiserne, robuste und schreckhafte Gestalten, wie man aus ihren Neigungen hätte schließen können; sondern es war ein Schlag Leute von ganz gewöhnlichem, philisterhaftem Aussehen, mit runden Bäuchen und dünnen Beinen, nur dass sie durchweg lange gelbe Nasen zeigten, eben dieselben, mit denen sie sich gegenseitig das Jahr hindurch beschnarchten und anherrschten. Niemand hätte ihrem kümmelspalterischen Leiblichen, wie es erschien, so derbe Nerven zugetraut, als zum Anschaun der unaufhörlichen Hochnotpeinlichkeit erforderlich waren. Allein sie hatten’s in sich verborgen.
So hielten sie ihre Gerichtsbarkeit über ihrem Weichbilde ausgespannt gleich einem Netz, immer auf einen Fang begierig; und in der Tat gab es nirgends so originelle und seltsame Verbrechen zu strafen wie zu Ruechenstein. Ihre unerschöpfliche Erfindungsgabe in neuen Strafen schien diejenige der Sünder ordentlich zu reizen und zum Wetteifer anzuspornen; aber wenn dennoch ein Mangel an Übeltätern eintrat, so waren sie darum nicht verlegen, sondern fingen und bestraften die Schelmen anderer Städte; und es musste einer ein gutes Gewissen haben, wenn er über ihr Gebiet gehen wollte. Denn sobald sie von irgendeinem Verbrechen, in weiter Ferne begangen, hörten, so fingen sie den ersten besten Landläufer und spannten ihn auf die Folter, bis er bekannte oder bis es sich zufällig erwies, dass jenes Verbrechen gar nicht verübt worden. Sie lagen wegen ihren Kompetenzkonflikten auch immer im Streit mit dem Bunde und den Orten und mussten öfter zurechtgewiesen werden.
Zu ihren Hinrichtungen, Verbrennungen und Schwemmungen liebten sie ein windstilles, freundliches Wetter, daher an recht schönen Sommertagen immer etwas vorging. Der Wanderer im fernen Felde sah dann in dem grauen Felsennest nicht selten das Aufblitzen eines Richtschwertes, die Rauchsäule eines Scheiterhaufens, oder im Flusse wie das glänzende Springen eines Fisches, wenn etwa eine geschwemmte Hexe sich emporschnellte. Das Wort Gottes hätte ihnen übel geschmeckt ohne mindestens ein Liebespärchen mit Strohkränzen vor dem Altar und ohne Verlesen geschärfter Sittenmandate. Sonstige Freuden, Festlichkeiten und Aufzüge gab es nicht, denn alles war verboten in unzähligen Mandaten.
Man kann sich leicht denken, dass diese Stadt keine widerwärtigeren Nachbaren haben konnte als die Leute von Seldwyla; auch saßen sie diesen hinter dem Walde im Nacken wie das böse Gewissen. Jeder Seldwyler, der sich auf Ruechensteiner Boden betreten ließ, wurde gefangen und auf den zuletzt gerade vorgefallenen Frevel inquiriert. Dafür packten die Seldwyler jeden Ruechensteiner, der sich bei ihnen erwischen ließ, und gaben ihm auf dem Markt ohne weitere Untersuchung, bloß weil er ein Ruechensteiner war, sechs Rutenstreiche auf den Hintern. Dies war das einzige Birkenreis, was sie gebrauchten, da sie sich selbst untereinander nicht weh zu tun liebten. Dann färbten sie ihm mit einer höllischen Farbe die lange Nase schwarz und ließen ihn unter schallendem Jubelgelächter nach Hause laufen. Deshalb sah man zu Ruechenstein immer einige besonders mürrische Leute mit geschwärzten, nur langsam verbleichenden Nasen herumgehen, welche wortkarg nach Armensünderblut schnupperten.
Die Seldwyler aber hielten jene Farbtunke stets bereit in einem eisernen Topfe, auf welchen das Ruechensteiner Stadtwappen gemalt war und welchen sie den »freundlichen Nachbar« benannten und samt dem Pinsel im Bogen des nach Ruechenstein führenden Tores aufhängen. War die Beize aufgetrocknet oder verbraucht, so wurde sie unter närrischem Aufzug und Gelage erneuert zum Schabernack der armen Nachbaren. Hierüber wurden diese einmal so ergrimmt, dass sie mit dem Banner auszogen, die Seldwyler zu züchtigen. Diese, noch rechtzeitig unterrichtet, zogen ihnen entgegen und griffen sie unerschrocken an. Allein die Ruechensteiner hatten ein Dutzend graubärtige verwitterte Stadtknechte, welche neue Stricke an den Schwertgehängen trugen, ins Vordertreffen gestellt, worüber die Seldwyler eine solche Scheu ergriff, dass sie zurückwichen und fast verloren waren, wenn nicht ein guter Einfall sie gerettet hätte; denn sie führten spaßeshalber den »freundlichen Nachbar« mit sich und statt des Banners einen langen ungeheuren Pinsel. Diesen tauchte der Träger voll Geistesgegenwart in die schwarze Wichse, sprang mutig den vordersten Feinden entgegen und bestrich blitzschnell ihre Gesichter, alsodass alle, die zunächst von der verabscheuten Schwärze bedroht waren, Reißaus nahmen und keiner mehr der vorderste sein wollte. Darüber geriet ihre Schar ins Schwanken; ein unbestimmter Schreck ergriff die hinteren, während die Seldwyler ermutigt wieder vordrangen unter wildem Gelächter und die Ruechensteiner gegen ihre Stadt zurückdrängten. Wo diese sich zur Wehr setzten, rückte der gefürchtete Pinsel herbei an seinem langen Stiele, wobei es keineswegs ohne ernsthaften Heldenmut zuging; schon zweimal waren die verwegenen Pinselträger von Pfeilen durchbohrt gefallen, und jedes Mal hatte ein anderer die seltsame Waffe ergriffen und von neuem in den Feind getragen.
Am Ende aber wurden die Ruechensteiner gänzlich zurückgeschlagen und flohen mit ihrem Banner in hellem Haufen durch den Wald zurück, die Seldwyler auf den Fersen. Sie konnten sich mit Not in die Stadt retten und das Tor schließen, welches ihre Verfolger samt der Zugbrücke so lange mit dem verwünschten Pinsel schwarz beklecksten, bis jene sich etwas gesammelt und die lärmenden Maler mit Kalktöpfen bewarfen.
Weil nun einige angesehene Seldwyler in der Hitze des Andranges in die Stadt geraten und dort abgeschlossen, dafür aber auch ein Dutzend Ruechensteiner von den Siegern gefangen worden waren, so verglich man sich nach einigen Tagen zur Auswechslung dieser Gefangenen, und hieraus entstand ein förmlicher Friedensschluss, so gut es gehen wollte. Man hatte sich beiderseitig etwas ausgetobt und empfand ein Bedürfnis ruhiger Nachbarschaft. So wurde ein freundnachbarliches Benehmen verheißen; zum Beginn desselben versprachen die Seldwyler den eisernen Topf auszuliefern und für immer abzuschaffen, und die Ruechensteiner sollten dagegen auf jedes eigenmächtige Strafverfahren gegen spazierende Seldwyler feierlich Verzicht leisten sowie die diesfälligen Rechte überhaupt sorgfältig ausgeschieden werden.
Zur Bestätigung solchen Übereinkommens wurde ein Tag angesetzt und die Berglichtung zur Zusammenkunft gewählt, auf welcher das Haupttreffen stattgefunden hatte. Von Ruechenstein fanden sich einige jüngere Ratsherren ein; denn die Alten brachten es nicht über sich, in Minne mit den Leuten von Seldwyla zu verkehren. Diese erschienen auch wirklich in zahlreicher Abordnung, brachten den »freundlichen Nachbar« mit lustigem Aufwand und führten ein Fässchen ihres ältesten Stadtweines mit, nebst einigen schönen silbernen und vergoldeten Ehrengeschirren. Damit betörten sie denn die jungen Ruechensteiner Herren, denen ein ungewohnter Sonnenblick aufging, so glücklich, dass sie sich verleiten ließen, statt unverweilt heimzukehren, mit den Verführern nach Seldwyla zu gehen. Dort wurden sie auf das Rathaus geleitet, wo ein gehöriger Schmaus bereit war; schöne Frauen und Jungfrauen fanden sich ein, immer mehrere Stäuffe, Köpfe, Schalen und Becher wurden aufgesetzt, sodass über all dem Glänzen der feurigen Augen und des edlen Metalles die armen Ruechensteiner sich selbst vergaßen und ganz guter Dinge wurden. Sie sangen, da sie nichts anderes konnten, einen lateinischen Psalm um den andern zwischen die Zechlieder der Seldwyler und endeten höchst leichtsinnig damit, dass sie diese dringend einluden, ihrer Stadt mit ihren Frauen und Töchtern einen Gegenbesuch zu machen, und ihnen den freundlichsten Empfang versprachen. Hierauf erfolgte die einmütige Zusage, hierauf neuer Jubel, kurz, die Geschäftsherren von Ruechenstein verabschiedeten sich in vollständiger Seligkeit und hielten sich, Schnippchen schlagend, dazu noch für glückliche Eroberer, als die lachenden Damen ihnen bis zum Tore das Geleit gaben.
Freilich verzog sich das liebliche Antlitz der Sache, als die fröhlichen Herren am andern Tage in ihrer finsteren Stadt erwachten und nun Bericht erstatten mussten über den ganzen Hergang. Wenig fehlte, als sie zum Punkte der Einladung gediehen, dass sie nicht als Behexte inhaftiert und untersucht wurden. Indessen fühlten sie auch obrigkeitliches Blut in ihren Adern, und obgleich sie das Ding selbst schon gereute, so blieben sie doch fest bei der Stange, ihr gegebenes Wort zu lösen, und stellten den Alten vor, wie die Ehre der Stadt es schlechterdings erfordere, die Seldwyler gut zu empfangen. Sie gewannen einen Anhang unter der Bürgerschaft, vorzüglich durch ihre Beschreibung des reichen Stadtgerätes, womit die Seldwyler so herausfordernd geprahlt hätten, sowie durch das Herausstreichen ihrer Frauen und deren zierlicher Kleidung. Die Männer fanden, das dürfe man sich nicht bieten lassen, man müsse den eigenen Reichtum dagegen auftischen, der in den eisernen Schränken funkle, und die Frauen juckte es, die strengen Kleidermandate zu umgehen und unter dem Deckmantel der Politik sich einmal tüchtig zu schmücken und zu putzen. Denn das Zeug dazu hatten sie alle in den Truhen liegen, sonst wären ihnen die strengen Verordnungen längst unerträglich gewesen und durch ihre Macht gestürzt worden.
Der Empfang der neuen Freunde und alten Widersacher ward also durchgesetzt, zum großen Verdruss der Bejahrteren. Auch beschlossen diese sogleich, den ärgerlichen Tag durch eine vorzunehmende Hinrichtung zu feiern und damit eine zu lebhafte Fröhlichkeit heilsam und würdig zu dämpfen. Während die jüngeren Herren mit den Zurichtungen zum Feste betätigt waren, trafen jene in aller Stille ihre Anstalten und nahmen einen ganz jungen, unmündigen armen Sünder beim Kragen, der gerade im Netze zappelte. Es war ein bildschöner Knabe von eilf Jahren, dessen Eltern in kriegerischen Zeitläuften verschollen waren und der von der Stadt erzogen wurde. Das heißt, er war einem niederträchtigen und bösen Bettelvogt in die Kost gegeben, welcher das schlanke, wohlgebildete und kraftvolle Kind fast wie ein Haustier hielt und dabei an seiner Frau eine wackere Helferin fand. Der Knabe wurde Dietegen genannt, und dieser Taufname war sein ganzes Hab und Gut, sein Morgen- und Abendsegen und sein Reisegeld in die Zukunft. Er war erbärmlich gekleidet, hatte nie ein Sonntagsgewand besessen und würde an den Feiertagen, wo alles besser gekleidet ging, in seinem Jammerhabitchen wie eine Vogelscheuche ausgesehen haben, wenn er nicht so schön gewesen wäre. Er musste scheuern und fegen und lauter solche Mägdearbeit verrichten, und wenn die Bettelvögtin nichts Schnödes für ihn zu tun hatte, so lieh sie ihn den Nachbarsweibern aus gegen Mietsgeld, um ihnen alle Lumpereien zu tun, die sie begehrten. Sie hielten ihn trotz seiner Anstelligkeit für einen dummen Kerl, weil er sich stillschweigend allem unterzog und nie Widerstand leistete; und dennoch vermochten sie nicht lang ihm in die feurigen Augen zu blicken, wenn er in unbewusster Kühnheit blitzend umhersah.