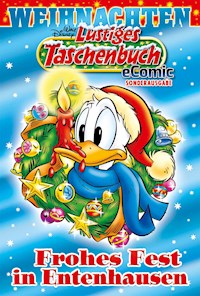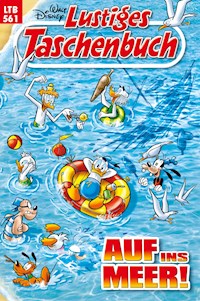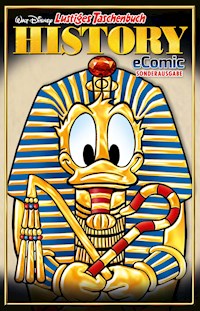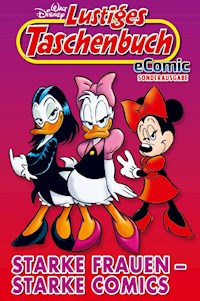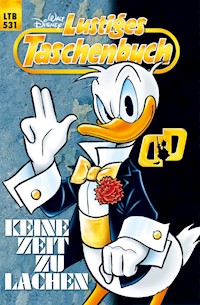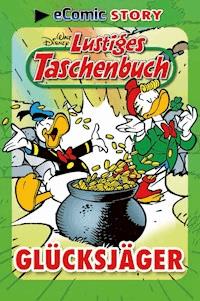4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Belle lüftet ein Familiengeheimnis und muss sich zwischen Gut und Böse entscheiden Als Belle im Schloss des Biestes die verzauberte Rose berührt, löst das eine Flut unbekannter Erinnerungen in ihr aus. Erinnerungen an ihre Mutter, die Belle nie wiederzusehen geglaubt hatte. Und zu diesem Schock gesellt sich noch ein weiterer: Denn Belle erfährt, dass niemand anderes als ihre Mutter das Schloss und all seine Bewohner verzaubert hat. Um den Zauber zu lösen, muss sie zusammen mit dem Biest ein dunkles Geheimnis entwirren, in das beide Familien verstrickt sind. In der Reihe 'Twisted Tales' werden die beliebtesten Disney-Klassiker aus einer vollkommen anderen Perspektive erzählt. Sie präsentieren sowohl die Held*innen als auch die Bösewichte in einem völlig neuen Licht. Ein vielschichtiges Fantasy-Abenteuer voller neuer Blickwinkel, dunklerer Welten, überraschenden Twists und düsteren Geheimnissen. Moderne Märchen-Adaption mit einer starken Heldin in einem düsteren Fantasy-Setting: Ein packender Coming-of-Age-Roman für alle Disney-Fans
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Für Scott, meinen Ehemann. Ohne deine Liebe und Unterstützung wären diese Bücher – und manche Tage, die auf g enden – viel mühsamer gewesen.
Und ein riesiges, begeistertes DANKESCHÖN an meine Lektorin Brittany, dank deren Humor und Kreativität ich diese Tausend-Seiten-Strecke in Windeseile geschafft habe.
Teil 1
Es war einmal
Es war einmal in einem fernen Land, da lebte ein junger Prinz in einem wunderschönen Schloss. Doch obwohl er alles besaß, was sein Herz begehrte, war er unzufrieden, selbstsüchtig und benahm sich ungehörig.
Bis in einer kalten Winternacht eine alte Bettlerin im Schloss erschien und ihm eine blutrote Rose zum Dank für den Schutz vor der bitteren Kälte anbot. Der Prinz war angewidert von ihrer hässlichen Erscheinung, lachte über das in Aussicht gestellte Geschenk und schickte die Frau fort – obwohl sie ihn davor gewarnt hatte, er solle sich nicht von ihrem Aussehen täuschen lassen, denn wahre Schönheit sei im Inneren zu finden. Als er sie dennoch abwies, verwandelte sich die hässliche Alte in eine wunderschöne junge Zauberin.
Der Prinz wollte sich entschuldigen, aber es war zu spät, denn sie hatte längst bemerkt, dass in seinem Herzen keine Liebe lebte. Zur Strafe verwandelte sie ihn in eine hässliche Bestie und belegte das Schloss und alle, die darin lebten, mit einem machtvollen Zauberbann.
„Ich gebe dir Zeit bis zum Tag deines einundzwanzigsten Geburtstags, um innerlich so schön zu werden, wie du es äußerlich warst. Wenn du bis dahin nicht gelernt hast, einen anderen Menschen zu lieben – und im Gegenzug geliebt zu werden –, werden in dem Moment, in dem das letzte Blütenblatt dieser Rose fällt, dein Schloss und alle, die darin leben, für immer der Vergessenheit anheimfallen.“
Beschämt von seinem hässlichen Erscheinungsbild verbarg sich der in ein Biest verwandelte Prinz fortan in seinem Schloss. Ein verzauberter Spiegel war sein einziges Fenster zur Außenwelt.
Die Jahre vergingen, und der verzauberte Prinz wurde immer verzweifelter. Denn wer würde es jemals übers Herz bringen, die hässliche Bestie zu lieben, die er war?
Das war eine sehr schöne Geschichte.
Die Frau, die in dem dunklen Zimmer auf einem harten kalten Bett lag, erinnerte sich gern daran. Seit vielen Jahren schon ergötzte sie sich daran, und hin und wieder veränderte sie einige Details: Manchmal war die Rose nicht rot, sondern rosa wie ein Sonnenaufgang am Meer. Aber das klang nicht so gut wie „blutrot“.
Auch den Schluss – an dem die Zauberin in eine schwarze Kutsche stieg und in die Nacht verschwand – fand sie nicht so großartig. Weshalb sie diesen Teil immer wegließ.
Die meisten würden an diesem Punkt nicht weiterwissen. Die meisten würden sie so lange in einen Kerker sperren, bis sie selbst vergessen hatte, wer sie war.
Einige ihrer Gedanken wirbelten wild in ihrem Kopf herum. Es konnte gefährlich werden, wenn ihr Verstand Risse bekam und die Gedanken nach draußen flohen. Aber das wäre ein Schritt hin zum Wahnsinn gewesen, und so weit war sie noch nicht.
Inzwischen waren zehn Jahre vergangen, und sie konnte sich kaum noch an sich selbst erinnern.
Sie hörte Schritte im Korridor und schloss die Augen so fest wie nur möglich, um sich gegen fremde Gedanken zu wappnen.
Stimmen. Noch mehr Schritte im Flur. Ein Putzlumpen wurde über den schmutzigen Boden gezogen. Das Klimpern von Schlüsseln.
„Da drinnen müssen wir nicht putzen, das ist leer.“
„Aber es ist doch abgeschlossen. Warum ist abgeschlossen, wenn niemand drin ist?“
Sie wollte schreien, um sich schlagen, sich selbst zerstören – alles, um diesen Dialog zu verhindern, den sie sich seit viertausend Tagen jeden Tag wieder anhören musste.
„Oh, diese Zelle ist abgeschlossen. Kannst du irgendetwas da drinnen hören?“
„Die Tür ist zu. Meinst du, sie ist verschlossen?“
„Ja, aber ich kann mich nicht erinnern, dass jemand hineingebracht wurde.“
Der Schlüssel drehte sich im Schloss.
Die Tür ging knirschend auf.
Ein widerliches Gesicht erschien, dann der ewig gleiche überraschte Ausdruck. Die Person hielt ein Tablett in der Hand. Hinter ihr im Flur stand die Frau mit dem Putzlappen. Und dahinter wiederum stand ein schweigender Mann, bereit, jeden Gefangenen zu überwältigen, der nicht angekettet war.
Die Gefangene schlug die Augen auf, denn noch war ihre Neugier nicht versiegt. Heute standen vier Schalen mit Suppe auf dem Tablett. Manchmal waren es fünf, manchmal drei, manchmal nur eine.
„Du hast Glück, dass noch was übrig ist“, sagte die Frau mit dem Tablett, als sie sich bückte, um ihr die Suppe einzuflößen. Ihre Röcke und Schürzen waren schmutzig.
Dieser eine Satz änderte sich nie.
Die Gefangene konnte sich nicht mehr beherrschen. Sie schrie. Denn jeden Tag wartete sie auf diesen einen schrecklichen Moment, wenn ihr diese ekelhafte Brühe vorgesetzt wurde.
Die Frau mit dem Lappen brabbelte empört vor sich hin: „Ich hab nix von einem Neuzugang gehört. Aber ich find’s gut, dass sie die Welt von so’m Abschaum befrei’n.“
„Tja, da is’ aber jetzt eine, wie du siehst. Los, geh wieder an deine Arbeit.“
Das sagte die Frau jedes Mal mit der gleichen scheinheiligen Sanftmütigkeit. Sie setzte die Schale an ihren Mund, und schon ergoss sich die Brühe über ihren Hals. Sie wollte sich beherrschen, konnte aber nicht anders, als sich gegen die Ketten zu stemmen, um noch den letzten Tropfen zu erhaschen, bevor die Schale wieder weggenommen wurde.
„Die hier ist alt genug, um als Frau durchzugehen“, sagte die grausame Frau ohne jede Spur von Mitleid. „Stell dir bloß vor, die würden Kinder kriegen und sie aufziehen.“
„Die sind wie Tiere, allesamt. Ich frag mich, warum man die nicht einfach tötet. Dann wär endlich Ruhe.“
„Ach, das kommt schon noch, keine Sorge“, sagte die alte Vettel mit der Suppe und stand auf. „Die bleiben nie lang hier.“
Außer, jemand hält zehn Jahre lang durch.
Die Vettel verzichtete darauf, weitere Plattheiten von sich zu geben, und ging. Kaum hatte sich die Tür geschlossen, vergaßen die drei die Existenz dieser Gefangenen wieder.
Morgen würden die grässlichen Frauen dann wieder so tun, als wäre sie völlig unerwartet auf der Bildfläche erschienen … und am nächsten Tag wieder … und am übernächsten …
Die Gefangene schrie ein letztes Mal laut auf, dann brach die Dunkelheit über sie herein.
Sie musste ihre Geschichte von Neuem beginnen. Wenn sie erst einmal den Anfang hatte, würde sie sie bis zum Ende durchspielen, und dann wäre alles in Ordnung.
Es war einmal in einem fernen Land, da lebte ein junger Prinz in einem wunderschönen Schloss …
Bevor alles begann
Es geschah lange vor unserer Zeit in einem Königreich, dessen Name und Existenz in Vergessenheit geraten sind. Damals, als die anderen Länder um neue Gebiete in Übersee konkurrierten und immer tödlichere Waffen erfanden, um ihre Religion anderen Völkern aufzuzwingen, war dieses Königreich mit sich selbst zufrieden.
Es besaß fruchtbares Ackerland, Wälder mit zahlreichen Tierarten, einen zauberhaften kleinen Weiler und ein hübsches Schloss.
Dank seiner Lage in einem abgelegenen Tal zog dieses Reich jede Menge Künstler und Sonderlinge an, die hier „die Charmantes“ genannt wurden. Sie waren vor der modernen Welt geflohen, die das alte Europa eroberte. Das kleine Königreich hatte das triste Mittelalter und die überschäumende Renaissance friedlich und ereignislos überstanden, und erst seit Kurzem breiteten sich hier typische Zivilisationskrankheiten aus.
Hier gab es noch Wahrsagerinnen, die wirklich die Zukunft vorhersagen konnten. Bauern, die in Dürrezeiten Wasser aus Steinen gewannen, und Zauberkünstler, die Menschen in Tauben verwandeln konnten. Und manchmal auch wieder zurück.
Das Königreich zog Menschen an, die über ungewöhnliche Talente verfügten oder merkwürdige Eigenheiten besaßen und sich unter ihresgleichen wohlfühlten. Außenseiter und Träumer. Dichter und Musiker. Nette Taugenichtse, die niemand haben wollte und die hier Unterschlupf fanden.
Einer von ihnen war ein junger Mann namens Maurice, Sohn eines reisenden Kesselflickers, der keine Lust hatte, ein Leben als fahrender Geselle zu führen, um kaputte Dinge auszubessern. Im Gegensatz zu seinem Vater hatte er bemerkt, dass das alte Europa sich wandelte. Wunderbare Veränderungen kündigten sich an: Bald würden Windmühlen mit Dampf betrieben und Ballons die Menschen in weit entfernte Regionen transportieren. Und es würde Öfen geben, die das Essen ganz allein zubereiteten.
Maurice wollte die Welt zum Besseren verändern. Seine Sehnsucht danach war so groß, dass er sich allerlei Gerätschaften besorgte und Berichte über wissenschaftliche Experimente studierte.
Mit der Zeit stellte er fest, dass das ewige Herumreisen ihn nicht zum Ziel führte. Er brauchte einen Ort, wo er in aller Ruhe nachdenken und basteln konnte – an Maschinen, zu deren Herstellung Feuer und geschmolzene Erze nötig waren. Einen Ort, wo er all die Dinge unterbringen konnte, die er für seine Versuche benötigte.
Kurz gesagt, er brauchte ein Zuhause.
Auf gut Glück zog er los, folgte Hinweisen und Gerüchten und landete schließlich in einer Ecke von Europa, die mit dem Rest der Welt nicht mehr im Einklang stand.
Zuerst machte er halt in einem kleinen Städtchen an einem Fluss, dessen Strömung perfekt zum Antrieb von Wasserrädern geeignet war. Aber nachdem er das provinzielle Dasein der Bewohner eine Weile beobachtet und ihre abweisenden Blicke erduldet hatte, als sie seinen Karren mit den vielen Gerätschaften und Büchern bemerkten, erkannte er, dass dies nicht der rechte Ort für ihn war.
Er überquerte den Fluss, marschierte durch einen Wald und erreichte das vergessene Königreich. Dort störte sich niemand daran, wenn jemand einer schwarzen Katze etwas zuflüsterte – und die Katze zurückflüsterte. Dort durfte man ins Wirtshaus gehen, ohne sich vorher die schmutzige Arbeitskluft auszuziehen und die Schweißbrille abzunehmen. Es war ein Ort, der zu ihm passte.
Maurice freundete sich rasch mit ein paar Bewohnern des Städtchens an und kam bei einem von ihnen unter. Alaric, ein Stallmeister, der sich besser mit Tieren als mit Maschinen auskannte, überließ ihm günstig einen Raum im hinteren Bereich seines Stalls.
Dieser Unterschlupf war zwar eng und roch nach Pferden, aber es gab einen großen Hof. Maurice begann sofort damit, eine Schmiede mit einem Schmelzofen einzurichten.
Mit großer Hingabe widmete er sich seinen schweißtreibenden Arbeiten und grübelte dabei über die Bruchwiderstände verschiedener Metalle nach, über mögliche Legierungen und wie man eine perfekte zylindrische Form herstellen könnte.
„Der gute Maurice ist mit seinen Gedanken immer hoch oben in den Wolken“, sagten seine Freunde über ihn und klopften ihm auf die Schultern. Aber das sagten sie stets mit einem Lächeln und großem Respekt, genauso wie sie Josepha, die Kellnerin in der Taverne, als „Schwarze Hexe“ bezeichneten. Wenn es nötig war, konnte sie zuschlagen oder einen aufmüpfigen Gast mit einem Fingerschnippen zur Ruhe bringen.
Am Ende des Sommers arbeiteten alle gesunden jungen Männer auf den Feldern – sogar Alaric, der sich lieber mit Pferden als mit Hafer beschäftigte. Sonnenverbrannt und mit schmerzenden Rücken stolperten sie jeden Abend zurück ins Städtchen, mit ausgedörrten Kehlen, aber immer noch singend. Und natürlich gingen sie direkt in Josephas Wirtshaus.
Eines Abends, als seine Freunde zur Taverne drängten, blieb Maurice etwas zurück, um sich den Staub abzuklopfen, und bemerkte eine Menschenansammlung vor dem Lokal. Dort stand ein kräftiger Mann mit gespreizten Beinen und blickte angriffslustig drein. Das war zwar interessant, aber nicht so eigenartig wie das, was dort noch zu sehen war.
Vor dem Mann stand die schönste Frau, die Maurice jemals gesehen hatte. Sie hatte die Haltung einer Tänzerin und den Körper eine Göttin. Ihr Haar schimmerte golden im Sonnenlicht. Ihre hübschen Wangen waren vor Zorn gerötet, und ihre grünen Augen leuchteten empört. Sie fuchtelte mit einem dünnen Stab aus Erlenholz vor seinem Gesicht herum.
„Wir sind kein bisschen unnatürlich!“, rief sie aufgebracht. „Alles, was Gott erschaffen hat, ist natürlich. Und wir alle sind Kinder Gottes!“
„Ihr seid Kinder des Teufels“, sagte der Mann ruhig mit müder Stimme. Wie jemand, der weiß, dass er die Oberhand behält. „Ihr seid hier als eine Prüfung. Und müsst von der Erde gefegt werden wie in der Vergangenheit die bösen Drachen. Wenn ihr euch nicht reinigt.“
„Reinigen? Ich wurde von einem Priester getauft – und damit ganz bestimmt einmal mehr gebadet als du, du dreckiges Schwein!“
Der Mann machte eine Bewegung, nur ganz leicht, zur Hüfte hin. Maurice wusste, was das bedeutete: ein Messer, eine Pistole, ein Schlag ins Gesicht. Eine Gewalttat. Ohne zu zögern, schaltete er sich ein, um der Frau zu helfen.
Aber es war vorbei, bevor er den ersten Schritt getan hatte. Etwas leuchtete grell auf und blendete ihn, viel stärker noch als ein Blitz.
Als er wieder etwas erkennen konnte, rannte das Mädchen wütend davon, aber der Mann stand immer noch da. Er hielt eine Pistole in der Hand und hatte sie wohl auch benutzen wollen. Jetzt hing sie seitlich herab, er hatte sie vergessen. Denn etwas anderes machte ihm Sorgen: Anstelle einer Nase hatte er nun einen rosigen kurzen Rüssel.
„Du dreckiges Schwein …“, wiederholte Maurice und musste grinsen. „Ein Schwein.“
Er lachte vor sich hin und betrat das Wirtshaus.
Dort traf er auf Alaric und seine Freunde und einen Mann, den er nicht kannte. Einen dünnen, erschöpft wirkenden jungen Mann, der sich nach vorn beugte und dabei seinen Körper merkwürdig faltete wie ein Insekt. Seine Kleider waren dunkel und sein Gesichtsausdruck nervös und mürrisch – ganz das Gegenteil des blonden, fröhlichen Alaric.
Maurice trat zu ihnen, in Gedanken immer noch bei dem Vorfall, der sich draußen ereignet hatte. Aber nicht die Auseinandersetzung oder der Schweinerüssel waren ihm im Gedächtnis geblieben, sondern die Art und Weise, wie die Sonne das glänzende Haar des Mädchens zum Leuchten gebracht hatte.
Alaric drückte ihn ungeduldig auf die Bank zwischen sich und den schlecht gelaunten Kerl.
„Na los, setz dich doch! Kennst du unseren Doktor schon? Ich glaube nicht. Frédéric, Maurice. Maurice, Frédéric.“
Maurice nickte gedankenverloren. Ohne auf eine Bestellung zu warten, stellte Josepha einen Krug mit Cidre vor ihn hin.
„Angenehm“, sagte Frédéric zurückhaltend. „Aber ich bin kein Arzt, das habe ich schon oft gesagt. Ich sollte mal einer werden …“
„Was ist denn dazwischengekommen?“, fragte Maurice ein bisschen zu neugierig. Frédéric, das fiel ihm jetzt auf, hatte ein kleines Glas mit teurem Cognac vor sich stehen.
„Meine Eltern schickten mich fort, bevor ich mein Studium beenden konnte. Ich sollte hierhergehen, an diesen … hübschen Ort. Sie gaben mir sogar Geld, um mich loszuwerden.“
„Frédéric hat eine besondere Begabung“, warf Alaric mit bedeutungsvollem Unterton ein und zupfte an seiner Kappe. „Er kann die Zukunft vorhersehen.“
„Oh, tatsächlich?“ Maurice war beeindruckt.
„Nicht richtig und auch nicht immer, sondern bloß ein bisschen“, widersprach Frédéric und schüttelte den Kopf. „Aber meine Familie war der Ansicht, ich sollte besser mit ‚meinesgleichen‘ zusammen sein. Mit Leuten, die mich ‚verstehen‘ oder die mir diese magische Fähigkeit austreiben. Ich war auf der Universität. Ich sollte bei einem berühmten Chirurgen in die Lehre gehen. Ich hätte ein Arzt werden können.“
Alaric bemerkte, wie Maurice ihm über Frédérics Kopf hinweg einen fragenden Blick zuwarf.
„Ich wollte ihn überreden, bei uns einzuziehen“, erklärte er, nahm einen Schluck von seinem Bier und wischte sich den Schaum vom Mund.
„Das ist nicht nötig“, wehrte Frédéric wenig überzeugend ab. „Ich habe genug Geld und möchte nicht mit Tieren unter einem Dach leben, vielen Dank. Außerdem verdiene ich ein bisschen Geld. Der König und die Königin haben mich verpflichtet, mich um ihren Nachwuchs zu kümmern. Nichts von Bedeutung“, fügte er hastig hinzu. „Mit dem Jungen ist alles in Ordnung, jedenfalls hat er nichts, was ich – oder ein normaler Arzt – kurieren könnte. Ignoranten! Jedenfalls haben sie mich als Hausarzt engagiert. Ich brauche also keine Almosen, vielen Dank.“
„Ach, komm schon! Möchtest du dich nicht mit ein paar Gleichaltrigen zusammentun, die dir erklären, wie es hier zugeht? Das ist doch netter, als allein in einem zugigen Zimmer unterm Dach zu hocken.“
„Ich danke euch für eure Anteilnahme“, sagte Frédéric freundlich. Offenbar konnte er nicht anders, als immer höflich zu sein. Aber es war nicht ganz einfach, sich mit ihm zu unterhalten.
„Sag mal, Alaric, dieses Mädchen …“, begann Maurice. „Da draußen vor dem Wirtshaus war eben gerade ein wunderschönes Mädchen mit goldenen Haaren und hat einem Mann einen Schweinerüssel ins Gesicht gezaubert.“
„Oh, du meinst bestimmt Rosalind! Das ist schon eine Nummer!“, sagte Alaric lachend.
„Sie muss immer übertreiben“, sagte Frédéric und verzog das Gesicht. „Das ist das Problem mit Hexen.“
„Er war ziemlich beleidigend“, sagte Maurice und merkte, dass er ein Mädchen verteidigte, deren Namen er bis eben noch nicht gekannt hatte. „Er beschuldigte sie, unnatürlich zu sein, und behauptete, Zauberei wäre etwas Unsauberes.“
Alaric schnalzte mit der Zunge. „Das kommt in letzter Zeit leider öfter vor. Bevor du hier ankamst, gab es heftige Auseinandersetzungen. Zwei Jungen, ein Charmante und ein Normaler – so wie wir–, stritten sich wegen eines Mädchens. Es wurde ein handfester Streit, und der Normale kam dabei ums Leben, wobei auch Magie im Spiel war. Die Palastwache rückte aus, um die Lage zu beruhigen, und es kam beinahe zu einem Aufstand, als die Schuldzuweisungen auf beiden Seiten sich hochschaukelten. Einige der Wachleute gerieten zwischen die Fronten und trugen üblere Blessuren davon als nur Schweinerüssel, Was dieses Missgeschick betrifft, wird Rosalind es sicherlich beheben, wenn sie den Mann das nächste Mal sieht.“
„Das kann man wohl kaum denen zum Vorwurf machen, die normal sind –, so wie ihr“, sagte Frédéric mit bitterem Unterton. „Die Charmantes verfügen über besondere Kräfte und können Dinge tun, die euch verwehrt sind. Ihr Verhalten kann nicht kontrolliert werden. Niemand kann etwas dagegen tun. Sie – wir, sollte ich wohl sagen – müssen aber kontrolliert werden. Oder zumindest in ihrer Gefährlichkeit für andere eingeschränkt werden.“
„Das war doch bloß eine Auseinandersetzung zwischen zwei Jungs wegen eines Mädchens“, widersprach Alaric geduldig. „So was passiert ständig. Wegen so etwas stirbt sonst einer in einem Duell. Hier war halt Zauberei im Spiel. Du solltest dich da nicht hineinsteigern.“
„Trotzdem, wenn solche … unnatürlichen Dinge schon existieren, sollten die Betreffenden sie eher verstecken als hervorkehren. Es ist nämlich so, dass Zauberei immer wieder auf sich selbst zurückfällt. Das weiß jeder. Und sie sollte das auch wissen. Ich meine Rosalind.“
„Rosalind“, wiederholte Maurice, und ließ sich den Namen auf der Zunge zergehen.
„Oh, nein!“ Alaric verdrehte theatralisch die Augen. „Maurice! Sag, dass es nicht wahr ist! Nicht schon so früh in unserer Beziehung!“
„Ihr Haar hat genau die gleiche Farbe wie das Innere meines Schmelzofens, wenn er heiß genug ist, um Eisen zu schmelzen.“
„Na gut, dann ist ja alles in Ordnung“, seufzte Alaric erleichtert und legte Frédéric kameradschaftlich einen Arm um die Schultern. „Bei solchen Sätzen müssen wir keine Angst davor haben, dass wir uns bald einen anderen Platz zum Schlafen suchen müssen.“
„Ich habe doch gesagt, ich ziehe nicht bei euch ein“, wiederholte Frédéric höflich.
Aber Maurice hörte gar nicht mehr zu.
Ein seltsames Mädchen – keine Frage
Belle vergaß immer wieder, den geheimen Pfad zu Lévis Buchladen einzuschlagen. Weil sie las oder vor sich hin träumte, ein Lied sang oder die Welt betrachtete, landete sie ungewollt auf der Straße, die quer durchs Dorf führte. Und schon wurde sie angesprochen – oder man sprach über sie.
Beinahe tat sie das mit Absicht, denn zu Hause auf ihrem kleinen Hof war es zwar nett, aber auch langweilig. Belle unterhielt sich gern mit Leuten, war aber enttäuscht darüber, dass es immer auf die gleiche Art endete.
„Das ist schön, Belle.“
„Möchtest du ein Brötchen, Belle?“
„Meinst du, es wird regnen?“
„Hör doch mal auf, ständig zu lesen, und kümmere dich um deine Frisur.“
„Ist das nicht ein hübsches, Baby, Belle? Genau wie die anderen sechs …“
„Hast du Gaston schon erhört?“
Es wäre schön gewesen, wenn sie sich jemand für die gleichen Dinge interessiert hätte wie sie. Aber das war in diesem kleinen Dorf mit rund hundert Einwohnern nicht möglich.
Heute jedoch wirkten alle kleinlaut und standen nicht wie sonst zusammen und tratschten. Vielleicht hatte jemand sein Fass mit Cidre angezapft oder eine Kuh hatte ein Kalb mit zwei Schwänzen geboren.
Nein, so etwas würde hier nicht weiter auffallen.
Sie seufzte und trat in den Buchladen.
„Guten Morgen, Monsieur Lévi.“
„Guten Morgen, Belle!“, begrüßte sie der alte Mann freundlich. Er lächelte immer, wenn sie kam. „Wie geht’s deinem Vater?“
„Oh, er ist fast fertig mit seiner dampfgetriebenen Sägemaschine. Er will sie auf dem Jahrmarkt präsentieren“, sagte sie und reckte sich, um die oberen Regale abzusuchen. Ihr brauner Pferdeschwanz wippte hin und her.
„Sehr schön“, befand Lévi mit breitem Lächeln. „Er hat wirklich einen Preis dafür verdient. Oder zumindest eine gewisse Wertschätzung.“
„Sie sind der Einzige, der so denkt“, sagte Belle traurig. „Jeder sonst hält ihn für verrückt und seine Arbeit für Zeitverschwendung.“
„Die haben mich auch für verrückt gehalten, als ich hier im Dorf einen Buchladen eröffnete“, sagte Lévi und schaute sie über seine Brillengläser hinweg an. „Hier ist es schön ruhig, weil nur wenige Menschen sich für Bücher interessieren. Also kann ich selbst viel lesen.“
Belle lächelte ihn an, ein klein wenig sarkastisch, wofür sie berüchtigt war. „Wo wir gerade vom Lesen sprechen …“
„Ich habe noch nichts Neues hereinbekommen“, sagte er bedauernd. „Es sei denn, du möchtest eins der religiösen Pamphlete lesen, die Madame de Fanatique bestellt hat.“
„Geht’s darin um Philosophie? Eine Antwort auf Voltaire oder Diderot? Es ist immer interessant, den anderen Standpunkt kennenzulernen.“
„Äh, nein, eher nicht. Und es sind auch keine Lieder oder Hymnen darin. Total langweilig. Sonst habe ich nur noch ein paar … eher morbide … Abhandlungen für Monsieur D’Arque aus der, äh, Anstalt.“ Er verzog angewidert das Gesicht. „Aber ich fürchte, die sind ein bisschen speziell.“
Belle seufzte. „Na gut, darf ich mir dann eins von den alten ausleihen?“
„Nur zu.“ Lévi deutete in seinen Laden. „Nimm, was du möchtest.“
Sie brauchte ein richtig gutes Buch. Denn wenn ihr Vater fort war, wurde es zu Hause noch langweiliger. Ihr standen einige kalte, einsame Herbsttage bevor, mit keiner anderen Abwechslung als dem Füttern der Tiere und einem gelegentlichen Spaziergang durchs Dorf. Belle sehnte sich nach einer richtig aufregenden Lektüre, mit der sie sich bis zur Rückkehr ihres Vaters die Zeit vertreiben konnte – oder danach, dass ihr eigenes Leben endlich ein Abenteuer wurde.
Glücklich bis ans Lebensende
Ob es nun Zufall war oder nicht, Maurice sah das hübsche Mädchen mit den blonden Haaren ständig überall. Sei es nun, dass sie magische Reparaturen von Werkzeugen für Bauern oder Ladenbesitzer vornahm, verzauberte Rosen, mit denen man diese oder jene Beschwerden kurieren konnte, verteilte, mit Freundinnen scherzte oder im Wirtshaus ein Schwätzchen mit Josepha hielt oder, was meistens der Fall war, ein Buch las.
Er entdeckte sie immer zwischen all den anderen, obwohl ihre Haare nicht unbedingt blond waren.
Oder ihre Augen grün.
Oder ihre Haut dieselbe Farbe hatte.
Oder sie gleich groß war.
Sie war bezaubernd.
Aber noch viel aufregender war die Art, wie sie mit anderen jungen Männern sprach – und sich dann abwandte. Maurice wunderte sich sehr, dass sie nicht hinter ihr herliefen.
Seine Freunde nannten ihn einen Traumtänzer. Frédéric drängte ihn, sich eine andere, normale Freundin zu suchen. Eine, die nicht über so viel Macht verfügte. Alaric wiederum ermutigte ihn, er solle sie doch endlich ansprechen. Sich vorstellen. Damit sie seine Existenz zur Kenntnis nahm.
Aber das war gar nicht nötig.
Eines Tages ging er früher als sonst ins Wirtshaus und hatte einige Metallteile dabei, die er bearbeiten wollte. Auf den ersten Blick sah es aus, als wollte er ein Puzzle daraus zusammensetzen – zum Zeitvertreib, während er etwas trank. Aber die Teile wirkten doch etwas seltsam. Es handelte sich um ein kleines, stumpf glänzendes Kupferrohrstück und eine Art Tropfen aus Metall, den Maurice darin befestigen wollte.
Er schaute sich gerade das untere, schmale Ende des Tropfens nachdenklich an, als sich jemand auf den Stuhl neben ihm setzte und sich die bauschenden Röcke zurechtzupfte.
„Sie müssen mit dem Metall sprechen.“
Er sah auf und zuckte zusammen.
Das Mädchen mit den grünen Augen blickte ihn freundlich lächelnd an. In der Hand hielt sie ein halb geschlossenes Buch.
Normalerweise wäre es jetzt angebracht gewesen, ihr etwas zu trinken zu spendieren oder ihr zu sagen, dass er sie schon einmal gesehen hatte, oder ihr verlegen zu gestehen, wie schön er sie fand. Oder sie zu fragen, warum sie sich ausgerechnet neben ihn gesetzt hatte.
Aber sie schien sich vor allem für das Metall zu interessieren.
„Damit sprechen?“, fragte er. „Wie meinst du das?“
„Es fragen, was es braucht. Anstatt ihm vorzuschreiben, was es tun soll. Jedenfalls ist das die Ansicht einer Freundin von mir, die sich mit solchen Dingen auskennt.“
„Na schön, alles andere habe ich ja schon versucht“, erwiderte er seufzend. Er hob die beiden hässlichen Metallteile hoch und räusperte sich. „HALLO METALL. WAS BRAUCHST DU, UM RICHTIG ZU FUNKTIONIEREN?“
Die junge Frau lachte, aber es klang kein bisschen boshaft. Maurice musste ebenfalls kichern, und sogar der miesepetrige Kellner rang sich ein Lächeln ab.
Das Mädchen schob sich eine blonde Strähne aus dem Gesicht, klappte das Buch zu und legte es neben sich.
„Nein, so wird das, glaube ich, nichts. Jedenfalls nicht, wenn Sie Ihre Sprache benutzen. Sie müssen die Sprache des Metalls sprechen. Ich bin übrigens Rosalind.“ Sie hielt ihm die Hand hin.
„Enchanté“, sagte Maurice und bemühte sich gar nicht erst, so zu tun, als wüsste er das nicht schon längst. Er gab ihr einen Handkuss. „Ich bin Maurice.“
„Ich habe Sie schon bemerkt“, sagte sie und deutete mit dem Erlenstab nach draußen. „Egal was Sie tun – ob Sie Rüben ernten, Steine verlegen oder ein Loch graben –, Sie denken immer über etwas anderes nach. Ihr Metall. Sie tragen immer ein Stück davon bei sich. Und Sie sind immer mit Ruß bedeckt wie ein Schmied. Womit beschäftigen Sie sich die ganze Zeit?“
„Ich versuche, eine funktionstüchtige Dampfmaschine zu bauen“, sagte er und legte die Metallteile auf dem Tresen ab. „Im Augenblick quäle ich mich mit der Konstruktion von Ventilen herum, die die Wasserzufuhr regeln sollen. Mit solchen Konstruktionen wird in England und Schottland die Entwässerung von Minen durchgeführt. Aber man kann mit ihnen viel mehr anfangen. Man könnte zum Beispiel die Bewegung von Kolben damit regulieren, aber dazu müssen die Teile … irgendwie …“
„Ganz genau“, meinte sie lächelnd. „Sie müssen … irgendwie.“
Maurice schaute sie kurz an und fragte sich, ob sie sich über ihn lustig machte. Dann lachte er und gab selbstkritisch zu: „Ich kann nicht immer in Worte fassen, was mir durch den Kopf geht. Es ist auch ein bisschen kompliziert. Aber es könnte die Welt verändern.“
„Ah“, sagte sie. „So wie das Schießpulver.“
„Nein, nicht so. Hier geht es darum, etwas zu bauen, mit dem man Dinge herstellen kann, und nicht ums Zerstören.“
„Schießpulver ist ja nicht nur zum Zerstören da. Ein Freund von mir macht Feuerwerke daraus. Er verbringt viel Zeit damit, sie zu verbessern, damit sie noch höher in die Luft steigen. Und er benutzt ein Gerät dafür, das wie eine Kanone aussieht.“
„Sie kennen ja interessante Leute. Die würde ich gern mal kennenlernen.“
„Ich weiß nicht, ob mir das gefallen würde“, erwiderte sie nachdenklich. „Wenn ich Sie meinen Freunden vorstelle, dann unterhalten Sie sich wahrscheinlich die ganze Zeit mit denen und nicht mit mir.“
Maurice schaute sie an und fragte sich, ob sie damit das gemeint hatte, was er sich erhoffte.
So wie sie ihn anlächelte, war das offensichtlich der Fall.
Mit einem Gefühl, als könne das alles gar nicht wahr sein, begann Maurice, Rosalind zu umwerben. Aber vielleicht war es auch andersherum. Es spielte keine Rolle und war ihm egal.
Er ging mit ihr zum Tanzen und schenkte ihr eine kleine Rose, die er aus Metall gefertigt hatte. Sie heftete sie wie eine Brosche an den Ausschnitt ihres Kleids, der von dem Gewicht unanständig weit nach unten gezogen wurde.
Rosalind wiederum zeigte ihm ihren Rosengarten, den sie dank ihrer magischen Kräfte in einem kleinen Park versteckt hatte. Dort gab es perfekt aussehende Rosen in allen roten und rosa Schattierungen.
Weil ihr Aussehen sie sehr schnell langweilte, veränderte sie es oft. Wenn sie zum Beispiel Maurice in seiner Schmiede zur Hand ging, verschwanden anschließend die Schürze und die alten Kleider, die sie eben noch getragen hatte, kaum dass sie sich auf den Weg in die Stadt gemacht hatten. Und schon trug sie ein modisches Kleid im neuesten Stil wie eine Dame aus Paris – eine Dame mit purpurfarbener Haut allerdings.
Maurice sah nie, wie die Veränderung ablief. Wenn er sie bemerkte, war alles schon geschehen.
Ihre magischen Kräfte beschränkten sich nicht auf Rosen, Kleider oder Schweineschnauzen. Als im Spätsommer ein Brunnen am Stadtrand austrocknete, kam eine Bürgerdelegation zu ihr, um sie zu bitten, die Sache in Ordnung zu bringen.
So wie Maurice sich Tag und Nacht mit den Werkzeugen und Metallen in seiner Schmiede beschäftigte, so befasste Rosalind sich ständig mit alten Texten, die sie vor sich hin murmelte und dabei auf eine bestimmte Art mit dem Stab wedelte. Und so wie Maurice Briefe an berühmte Wissenschaftler schrieb, sprach sie mit scheuen Geschöpfen, die aussahen, als wären sie aus Wasser gemacht, oder besuchte alte Frauen, die sie um Rat fragte.
All dies gipfelte schließlich darin, dass sie ein paar knappe Zaubersprüche murmelte und den Brunnen so wieder nutzbar machte. Alle brachen in Jubel aus, aber die wenigsten ahnten, wie viel Vorarbeit dafür nötig gewesen war.
Aber Maurice beschäftigte sich nicht nur mit Arbeit und Erfindungen. An manchen Abenden ging er mit Alaric und Frédéric ins Wirtshaus, und Rosalind kam mit Adelise und Bernard dazu. Dann spielten Wissenschaft und Magie keine Rolle, denn es wurde getrunken und gelacht.
Die beiden Liebenden verbrachten ihre Nachmittage gemeinsam oder gingen ihren jeweiligen Beschäftigungen nach. Abends gingen sie Arm in Arm spazieren, umhüllt vom schweren Duft des Rosenparfüms.
Dann kam der Tag, als Maurice bemerkte, wie zwei Männer einen Jungen in eine Gasse zerrten. Das geschah in einem abgelegenen Winkel des Ortes, und die Männer bemühten sich, möglichst wenig Lärm zu machen. Der Junge aber schrie und trat um sich.
„Stopp! Sofort aufhören! Lasst ihn los!“, schaltete Maurice sich ein. „Was soll das denn hier?“
„Muss dich nicht weiter kümmern“, fuhr ihn der eine an. „Ist besser für dich, wenn du so tust, als hättest du nichts bemerkt.“
„Das ist einer von den Charmantes“, sagte der andere Mann, als wäre mit dieser Bezeichnung alles gesagt.
„So? Und seit wann ist das ein Verbrechen?“, fragte Maurice zornig.
„Es war schon immer ein Verbrechen gegen die Natur, was du wissen würdest, wenn du … selbst natürlich wärst … und nicht vom Bösen besessen.“
Maurice legte die Deichsel seines Karrens auf den Boden, um zu zeigen, dass er bereit war zu kämpfen. Seine Kleidung war zwar schmutzig, aber darunter zeichnete sich sein muskulöser Körper ab.
Außerdem trug er ein langes Messer an seinem Gürtel wie alle Arbeiter. Breitbeinig stellte er sich vor sie hin.
Die beiden Männer starrten ihn trotzig an, waren aber verunsichert.
„Macht euch davon!“, rief Maurice. „Los, los! Sonst rufe ich die Wachen – oder erledige es selbst.“
„Wer mit dem Teufel gemeinsame Sache macht, ist selbst des Teufels“, stieß einer der beiden hervor. „Du wirst es noch bereuen!“ Damit rannten sie davon.
Maurice seufzte erleichtert auf. Dann wandte er sich an den Jungen: „Alles in Ordnung?“
„Im Moment schon.“ Es klang nicht unfreundlich, eher ironisch. Als der Junge sich streckte und seine Verletzungen begutachtete, bemerkte Maurice, dass er ungewöhnlich helle Haut und besonders feine Gesichtszüge hatte. Etwas an ihm wirkte besonders. „Sie werden mich wieder schnappen, wenn keiner in der Nähe ist. Ich schätze, ich sollte besser … weglaufen.“
„Und die Palastwache schaut tatenlos zu?“
Der Junge reckte den Kopf und deutete in eine dunkle Ecke, wo zwei Wachleute herumlungerten, die alles mit angesehen hatten. Sie warfen ihm angewiderte Blicke zu.
„Das darf doch nicht wahr sein“, sagte Maurice und wandte sich wieder dem Jungen zu.
Aber der war schon verschwunden.
Stattdessen rannte Rosalind auf ihn zu und schlang die Arme um ihn.
„Ich habe alles beobachtet. Heirate mich“, sagte sie.
„Wie bitte? Was? Ja!“
„Du bist der wunderbarste, tapferste und netteste Mensch, den ich je getroffen habe. Ich möchte sichergehen, dass du mich nie mehr verlässt. Du sollst es mir schwören.“
„Ja, natürlich. Ehrlich gesagt hatte ich sowieso vor, dich zu …“
Sie erstickte seine Worte mit einem leidenschaftlichen Kuss.
Er schob sie von sich und stellte ihr die Frage, die ihm mit einem Mal in den Sinn gekommen war. „Aber der Junge eben, das warst nicht du, oder? Du hast mich nicht etwa testen wollen?“
„Was ist denn das für eine absurde Frage? Ich habe dich gesucht und den Zauberspruch benutzt, der hilft, einen Freund zu finden. Ich brauche dich und deinen Karren, um ein paar große Pakete zu transportieren.“
„Oh.“
„Abgesehen davon hätte ich diese beiden Hooligans in blinde Fische ohne Flossen verwandelt, wenn sie mich angefasst hätten. Und jetzt sei still und gib mir einen Kuss!“
Und so heirateten die beiden. Zwar fand die Trauung im Verborgenen statt, an einem geheimen Ort, der von Zauberformeln geschützt wurde; zwar waren die Gäste zum großen Teil sehr eigenartig – kleine Männer, die Maurice jede Menge Tipps bezüglich der Verarbeitung von Metall gaben, Mädchen mit langen Ohren und Hufen statt Füßen, die ungeduldig aufstampften, als der Priester kein Ende fand, brillentragende Buchhändler und Studenten und die dem Alkohol zugeneigten jungen Männer, mit denen Maurice gern im Wirtshaus saß –, aber die anschließende Feier war so lebhaft, wie sie nur sein konnte.
Nur Frédéric blickte den ganzen Abend lang miesepetrig drein, weil für seine Begriffe einfach zu viele Charmantes anwesend waren.
Abgesehen von diesem schlecht gelaunten Gast gab es in jener Nacht nur ein einziges Missgeschick: ein Wildschwein, das angelockt vom Essensgeruch in den Rosengarten eindrang und einiges Unheil anrichtete, bevor die Gäste es einfangen konnten.
„Das ist ja ein merkwürdiger Zwischenfall“, sagte Maurice.
„Zauberei fällt immer wieder auf sich selbst zurück“, erwiderte ein beschwipster Faun.
Maurice erinnerte sich an den Mann, dem Rosalind einen Schweinsrüssel an die Stelle seiner Nase gezaubert hatte. Seine frisch gebackene Ehefrau schimpfte zwar lautstark über das Schwein in ihrem Garten, verzichtete aber darauf, es mit Zauberei zu verscheuchen. Das fiel ihm sehr wohl auf.
„Hör mal, das ist doch nicht etwa der Mann?“, fragte er alarmiert.
„Nein!“, kicherte sie betrunken. „Ein Schwein! Aber das ist egal. Alles fällt auf sich selbst zurück. So sieht’s aus.“
„Das klingt sehr vernünftig“, murmelte Maurice und merkte, wie betrunken er war.
Was für ein wunderbarer Ort dies doch ist und was für eine großartige Frau ich geheiratet habe, dachte er. Und was für eine zauberhafte Hochzeit. Sogar ein Schwein ist gekommen.
Immer die Brautjungfer
Belle stapfte den Berg hinunter. Am liebsten wäre sie gerannt, aber sie wollte ihre Würde behalten. Sie lief weg und hätte gern so getan, als ob es ihr egal wäre, was aber leider nicht stimmte.
Denn hinter ihr auf der Wiese neben dem Haus sollte eine Hochzeitsfeier stattfinden.
Ihre Hochzeitsfeier.
Ein wunderbares Fest, das musste sie zugeben.
Ein wunderbarer Baldachin mit duftenden Blumen war aufgespannt worden. Papierglöckchen und rosa Bänder hingen unter dem hohen Dach. Die Tische waren blütenweiß eingedeckt und mit rosa Wimpeln verziert. Darauf lagen auserlesene Köstlichkeiten. In silbernen Bottichen standen eisgekühlte Flaschen mit Champagner, die mit feinen schimmernden Tautropfen benetzt waren. Alles sah aus wie gemalt.
Eine Kapelle spielte mehr schlecht als recht, aber mit großer Begeisterung.
Außerdem gab es eine wundervolle Hochzeitstorte – das Einzige, was sie nicht gern hinter sich ließ. Sie bestand aus drei Schichten und war mit weißem und rosafarbenem Zuckerguss überzogen, was trefflich zur sonstigen Dekoration passte. Auf der Spitze stand ein kleines Brautpaar, das sie wahrscheinlich achtlos zur Seite geworfen hätte, um möglichst schnell an den süßen Teig zu kommen. Monsieur Boulanger war zwar grundsätzlich schlecht gelaunt, aber für diesen Tag hatte er seine ganzen Künste als Zuckerbäcker aufgeboten.
Und dann lag da noch ein enttäuschter Möchtegern-Bräutigam in einer Schlammpfütze und streckte alle viere von sich.
Sie hatte ihn gar nicht halb bewusstlos schlagen wollen. Aber jetzt, nachdem es nun mal passiert war, war sie ganz zufrieden mit dem Ergebnis.
Der Lärm hinter ihr war grauenhaft: die blonden Drillinge, das Quäken der Tuba und des Akkordeons, das nun überflüssig war, die gedämpften Ermahnungen, die LeFou Gaston zuraunte, das zustimmende Kichern des Pfarrers.
Der Pfarrer.
Aus irgendeinem Grund hatte seine Anwesenheit sie am meisten aufgebracht.
Auf die grässliche Kapelle, die Torte, den hübsch dekorierten Tisch und die ganzen anderen Liebesbeweise dieses Verrückten hätte sie gern verzichten können – aber die Anwesenheit des Pfarrers bedeutete, dass Gaston es bitterernst meinte. Er hatte die Sache ernsthaft durchziehen wollen, „bis dass der Tod euch scheidet“.
„Die Liebe siegt nicht immer, du ignoranter Kerl“, hatte sie gemurmelt. „Jedenfalls nicht, wenn die Auserwählte dich nicht leiden kann!“
Damit war sie hastig zur Seite gesprungen, um sich hinter einem Busch zu verstecken. Vorsichtig lugte sie dahinter hervor. Ihr Herz wurde immer schwerer. Abgesehen von den geladenen Gästen sah es so aus, als wären alle Bewohner der kleinen Stadt gekommen, um Zeugen von Gastons Triumph zu werden. Monsieur LeClerc, der Goldschmied, war gekommen, ebenso Monsieur Hebert, der Perückenmacher und Kurzwarenhändler, Madame Baudette, die Schneiderin … der Schlachter, der Bäcker und alle anderen.
Alle bis auf Monsieur Lévi.
Ebenfalls abwesend war ihr Vater, der auf dem Weg zum Jahrmarkt war. Und ihre Mutter – aber die hatte sie zuletzt als kleines Mädchen gesehen, das war also nicht überraschend.
Der Wind wehte Gesprächsfetzen zu ihr hinüber.
„Schrecklich, nicht? Aber ist es wirklich so verwunderlich? Dieses Mädchen ist doch nicht ganz richtig im Kopf …“
„Sie hat Gaston abgewiesen? Den hübschesten und begehrtesten Junggesellen der Stadt?“
„So ein Flittchen. Ich würde mir den kleinen Finger abschneiden, um ihn zu kriegen.“
„Wer glaubt die eigentlich, wer sie ist?“
„Denkt die etwa, sie könnte was Besseres kriegen?“
„Vielleicht sollte sie es mal mit dem Sohn von Dupuis versuchen. Du weißt schon, der den ganzen Tag Kieselsteine zählt. Der ist wohl eher nach ihrem Geschmack.“
Belle ballte die Fäuste. Niemand von denen dachte, sie wäre gut genug für Gaston, den hübschen Jungen mit den blauen Augen, der darüber hinaus auch noch der beste Schütze der Gegend war.
Niemand fragte danach, ob er gut genug für sie war.
Aber so waren die Leute hier nun einmal.
Andererseits hatten sie die ganze Zeit nichts Besseres zu tun gehabt, als sich den Mund über sie und ihren Vater zu zerreißen. Wie seltsam sie waren. Wie seltsam sie war. Weil sie immer nur las. Und keine Freunde hatte. Keine Verehrer.
Dass Maurice nur selten ins Wirtshaus kam und keinem ehrlichen Beruf nachging. Dass seine Frau verschwunden war.
Manche behaupteten hinter vorgehaltener Hand, er habe sich dem Teufel verschrieben und gehe in seinem Keller dunklen Machenschaften nach.
Ihr Vater hatte diesem Gerücht ein Ende bereitet, indem er ein paar Leute in sein Haus eingeladen hatte, die überprüfen sollten, ob dort irgendwelche Dämonen am Werk waren. Er hatte sie sorgfältig ausgesucht: Monsieur LeClerc, der sich ein wenig mit Technik und Metallen auskannte, und Madame Bussard, die Klatschtante des Ortes, die garantiert sofort überall herumerzählen würde, was sie gesehen hat. Er führte ihnen die halbfertige Apparatur, eine Art Motor, vor, die ihrer Ansicht nach nur ein Verrückter gebaut haben konnte. Später fragte Belle sich, was schlimmer war: die Angst der Bürger vor dem Experiment oder das Mitleid und die Blamage danach.
Auf der anderen Seite war da noch Gaston, der sie trotz allem umwarb, unermüdlich wie ein eifriger Jagdhund, der vergeblich einem Wild hinterherrennt. Die Außenseiterposition von Belle und ihrem Vater schien für ihn keine Rolle zu spielen, da sie nun mal das hübscheste Mädchen im Dorf war.
Abgesehen davon war er überzeugt, sie wieder auf den rechten Weg bringen zu können. Seine überwältigende Männlichkeit würde ihre Begeisterung für Bücher bremsen und sie wieder normal machen, stellte er sich vor.
Gab es denn wirklich nichts, was sie reizen könnte, die Aufmerksamkeit eines hübschen jungen Mannes auf sich zu ziehen?
Doch, schon.
Diese Torte, die Boulanger in tagelanger Arbeit komponiert hatte.
Aber die würde Belle sofort eintauschen gegen die Möglichkeit, allein sein zu dürfen … dagegen, dass Gaston sie endlich genauso behandelte wie alle anderen.
Belle trat hinter dem Baum hervor und sah zu, wie die Hochzeitsfeier zu Ende ging. In dem eigenartigen honigfarbenen Licht des späten Nachmittags wirkte diese Szene sehr prägnant und gleichzeitig unwirklich – wie ein Miniaturgemälde. Sie hob den Daumen und versuchte, die Personen zu verdecken, sodass nur noch die Landschaft zu sehen war.
So machte sie es immer, wenn sie las.
Wenn sie ein Buch aufschlug, verschwand die kleine Stadt. Übrig blieb eine Art Landkarte, die gleichermaßen real wie ausgedacht war.
Die Menschen dort unten, die die gescheiterte Hochzeitsfeier verließen und nun hinter ihrem Daumen verschwanden, bildeten sich ein, hinter der nächsten Biegung des Flusses gäbe es nichts zu entdecken. Sie waren nicht neugierig auf neue Länder jenseits des Ozeans oder auf uralte Zivilisationen im fernen Osten. Sie hatten kein Interesse an wissenschaftlichen Erkenntnissen, am Weltall, wo es noch andere Planeten gab, die Monde hatten – so wie den, der nachts auf sie herabschaute.
Belle wollte mehr. Sie wollte mehr sehen, mehr erleben. Sie wollte in die Länder reisen, von denen sie gelesen hatte, wo die Menschen mit Stäbchen statt Gabeln aßen.
Zumindest wollte sie in ihrer Fantasie dorthin reisen.
Sie senkte den Daumen, und die Stadtbewohner waren wieder da.
Enttäuscht ließ sie sich ins Gras fallen.
Die Wahrheit war, dass ihr das Lesen nicht mehr genügte. Sie wollte nicht mehr nur einen Hauch dieser fernen Länder erhaschen oder sie durch das kleine Fenster der Buchseiten betrachten. Sie wollte hineingehen, die gelben Fluten des Yangtse spüren, die himmlische Musik fremder Instrumente hören, seltsame Speisen kosten und Gegenden besuchen, von denen es hieß: „Hier leben Tiger!“
Sie schaute nach Westen, wo der Nachmittag in den Abend umschlug, und sah dort keine Spur der endlosen Weite, von der sie immer träumte.
Stattdessen sah sie, wie schwarze Wolken sich näherten, angetrieben von einem stürmischen Wind und von Blitzen durchzuckt. Wunderbar. Das passte zu ihrem Gemütszustand. Unwillkürlich ballte sie die Fäuste und wünschte, sie könnte bewirken, dass der Sturm schneller über sie hereinbrach, wie es die Zauberer oder Hexen in ihren Büchern taten. Sie wünschte, sie könnte auf dem Gipfel eines Bergs stehen, inmitten von Sturm und Donner, unberührt, allein, während alle Hochzeitsgäste ängstlich nach Hause rannten
Dann erinnerte sie sich an ihren Vater, der irgendwo dort draußen auf der Straße unterwegs zum Jahrmarkt war.
Sie drehte sich auf den Bauch und schaute zur Straße. Aber entweder war er schon im Wald verschwunden oder der vom Sturmwind aufgewirbelte Staub verdeckte die Sicht auf ihn, sein Pferd Philippe und den Wagen.
Geistesabwesend und mit einem Seufzer pflückte Belle eine Pusteblume. Unter der schützenden Plane des Wagens lag das Meisterstück ihres Vaters, seine größte Erfindung. Wenn sie gut geölt war und reibungslos funktionierte, konnte sie Baumstämme in der Hälfte der Zeit zerteilen, die zwei Arbeiter dafür brauchten. Es war eine großartige Erfindung, und er würde bestimmt einen Preis dafür bekommen.
Belle blies gegen die Pusteblume.
Entweder man zählte die verbliebenen Samenstängel und tat dann so, als wäre das die aktuelle Uhrzeit, oder man durfte sich etwas wünschen.
Sie entschied sich für Letzteres.
Falls Maurice den Preis gewinnen sollte und falls es ein großer Preis war, wollte sie ihn überreden, in eine größere Stadt zu ziehen. Vielleicht wieder dorthin, wo sie gelebt hatten, als sie noch ein Baby gewesen war. Dort könnte ihr Vater ausschließlich als Erfinder arbeiten – und müsste nicht mühsam seinen Lebensunterhalt unter diesen Provinzmenschen verdienen, die ihn für verrückt hielten.
Und Belle würde alle Bücher lesen, die sie sich wünschte. Niemand würde sie für seltsam halten, nicht in einer großen Stadt, wo es viele seltsame Menschen gab.
Oder ein wohlhabender Adeliger würde das Geniale an Maurice’ Erfindung erkennen, ihn unterstützen und ihn und Belle in die Welt der Akademiker und Wissenschaftler einführen. Dann wären sie Teil des Fortschritts, weit weg von der Enge der Provinz und nichtigen Feiern wie dieser Hochzeit.
Sie war froh, dass ihr Vater nicht da war, um das mit ansehen zu müssen. Er wäre bestimmt zornig geworden, wahrscheinlich auch sehr verwirrt. Damit wäre rein gar nichts gewonnen.
Sie legte den Kopf auf ihre Hände und schaute zu, wie die Hochzeitsgäste auseinanderliefen, als der Wind sich erhob. LeFou versuchte, eine Girlande zu bändigen, die sich um Zweige und Stühle gewunden hatte wie ein Aal. In wenigen Minuten wären alle verschwunden, aber sie wäre gern schon früher nach unten gegangen, um sich an ihnen vorbei nach Hause zu schleichen, bevor der Sturm losbrach. Vielleicht konnte sie durch den Rosengarten nach Hause gehen.
Sie schaute dorthin, wo die rosa und weißen Blüten aufleuchteten. Sie waren der hauptsächliche Grund, warum ihr Vater die Stadt nicht verlassen wollte. Er hoffte immer noch, seine Frau könnte eines Tages zurückkommen zu ihren Rosen, ihrem Ehemann und ihrer Tochter. Deshalb kümmerte er sich hingebungsvoll um die Blumen und sorgte dafür, dass sie gesund blieben und schön anzusehen waren.
Wenn sie fortgingen, wie sollte sie sie dann finden?
Aber trotz der automatischen Wasserzufuhr, die Maurice konstruiert hatte, begannen die Rosen, die sogar im tiefsten Winter blühten, allmählich zu vertrocknen.
An ihre Mutter konnte Belle sich kaum erinnern. Aber sie hatte ja den besten Vater der Welt. Mehr brauchte sie nicht.
Sie warf einen letzten kurzen Blick zum Horizont und bemerkte eine merkwürdige Bewegung auf der Straße.
Es war Philippe, der mitsamt dem Wagen im wilden Galopp auf ihr Haus zuraste.
Aber ihr Vater war nicht zu sehen.