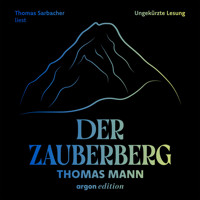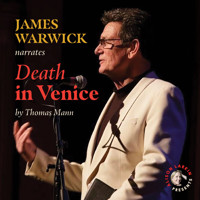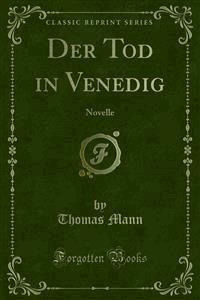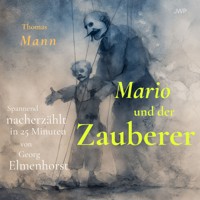16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Thomas Manns großer Musik- und Deutschlandroman Auf der Grundlage des Faust-Stoffes erzählt Thomas Mann in seinem 1947 erschienenen Roman vom nationalsozialistischen Zivilisationsbruch. So wie sich der Komponist Adrian Leverkühn für seine große Kunst dem Teufel verschreibt, so verstrickt sich das von Thomas Mann meisterhaft porträtierte Bildungsbürgertum in die Katastrophe des Nationalsozialismus. Kein anderer Roman dieses Autors ist dermaßen kontrovers und erhitzt diskutiert worden – noch Jahrzehnte nach seinem Erscheinen. Ein schonungsloses, radikales Spätwerk von großer Aktualität. Mit einem Nachwort von Michael Lentz
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1072
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Thomas Mann
Doktor Faustus
Das Leben des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn, erzählt von einem Freunde
Über dieses Buch
Auf der Grundlage des Faust-Stoffes erzählt Thomas Mann in seinem 1947 erschienenen Roman vom nationalsozialistischen Zivilisationsbruch. So wie sich der Komponist Adrian Leverkühn für seine große Kunst dem Teufel verschreibt, so verstrickt sich das von Thomas Mann meisterhaft porträtierte Bildungsbürgertum in die Katastrophe des Nationalsozialismus. Kein anderer Roman dieses Autors ist dermaßen kontrovers und erhitzt diskutiert worden – noch Jahrzehnte nach seinem Erscheinen. Ein schonungsloses, radikales Spätwerk von großer Aktualität.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Thomas Mann, 1875–1955, zählt zu den bedeutendsten Schriftstellern des 20. Jahrhunderts. Mit ihm erreichte der moderne deutsche Roman den Anschluss an die Weltliteratur. Manns vielschichtiges Werk hat eine weltweit kaum zu übertreffende positive Resonanz gefunden. Ab 1933 lebte er im Exil, zuerst in der Schweiz, dann in den USA. Erst 1952 kehrte Mann nach Europa zurück, wo er 1955 in Zürich verstarb.
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Für diese Ausgabe:
© 2007/2025 S. Fischer Verlag GmbH,
Hedderichstr. 114, 60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Kosmos Design, Münster
Coverabbildung: Kosmos Design, Münster, unter Verwendung einer KI-generierten Abbildung
ISBN 978-3-10-492290-4
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Motto]
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV
XXXIV
XXXIV
XXXV
XXXVI
XXXVII
XXXVIII
XXXIX
XL
XLI
XLII
XLIII
XLIV
XLV
XLVI
XLVII
Nachschrift
Editorische Notiz
Daten zu Leben und Werk
Nachwort
Lo giorno se n’andava e l’aer bruno
toglieva gli animai che sono in terra
dalle fatiche loro, ed io sol uno
m’apparecchiava a sostener la guerra
sì del cammino e sì della pietate,
che ritrarrà la mente che non erra.
O Muse, o alto ingegno, or m’aiutate,
o mente che scrivesti ciò ch’io vidi,
qui si parrà la tua nobilitate.
QUI SI PARRÀ LA TUA NOBILITATE.
I
Mit aller Bestimmtheit will ich versichern, dass es keineswegs aus dem Wunsche geschieht, meine Person in den Vordergrund zu schieben, wenn ich diesen Mitteilungen über das Leben des verewigten Adrian Leverkühn, dieser ersten und gewiss sehr vorläufigen Biographie des teuren, vom Schicksal so furchtbar heimgesuchten, erhobenen und gestürzten Mannes und genialen Musikers einige Worte über mich selbst und meine Bewandtnisse vorausschicke. Einzig die Annahme bestimmt mich dazu, dass der Leser – ich sage besser: der zukünftige Leser; denn für den Augenblick besteht ja noch nicht die geringste Aussicht, dass meine Schrift das Licht der Öffentlichkeit erblicken könnte – es sei denn, dass sie durch ein Wunder unsere umdrohte Festung Europa zu verlassen und denen draußen einen Hauch von den Geheimnissen unserer Einsamkeit zu bringen vermöchte; – ich bitte wieder ansetzen zu dürfen: Nur weil ich damit rechne, dass man wünschen wird, über das Wer und Was des Schreibenden beiläufig unterrichtet zu sein, schicke ich diesen Eröffnungen einige wenige Notizen über mein eigenes Individuum voraus – nicht ohne die Gewärtigung freilich, gerade dadurch dem Leser Zweifel zu erwecken, ob er sich auch in den rechten Händen befindet, will sagen: ob ich meiner ganzen Existenz nach der rechte Mann für eine Aufgabe bin, zu der vielleicht mehr das Herz als irgendwelche berechtigende Wesensverwandtschaft mich zieht.
Ich überlese die vorstehenden Zeilen und kann nicht umhin, ihnen eine gewisse Unruhe und Beschwertheit des Atemzuges anzumerken, die nur zu kennzeichnend ist für den Gemütszustand, in dem ich mich heute, den 27. Mai 1943, drei Jahre nach Leverkühns Tode, will sagen: drei Jahre nachdem er aus tiefer Nacht in die tiefste gegangen, in meinem langjährigen kleinen Studierzimmer zu Freising an der Isar niedersetze, um mit der Lebensbeschreibung meines in Gott ruhenden – o möge es so sein! – in Gott ruhenden unglücklichen Freundes den Anfang zu machen – kennzeichnend, sage ich, für einen Gemütszustand, worin herzpochendes Mitteilungsbedürfnis und tiefe Scheu vor dem Unzukömmlichen sich auf die bedrängendste Weise vermischen. Ich bin eine durchaus gemäßigte und, ich darf wohl sagen, gesunde, human temperierte, auf das Harmonische und Vernünftige gerichtete Natur, ein Gelehrter und conjuratus des »Lateinischen Heeres«, nicht ohne Beziehung zu den Schönen Künsten (ich spiele die Viola d’amore), aber ein Musensohn im akademischen Sinne des Wortes, welcher sich gern als Nachfahre der deutschen Humanisten aus der Zeit der »Briefe der Dunkelmänner«, eines Reuchlin, Crotus von Dornheim, Mutianus und Eoban Hesse betrachtet. Das Dämonische, so wenig ich mir herausnehme, seinen Einfluss auf das Menschenleben zu leugnen, habe ich jederzeit als entschieden wesensfremd empfunden, es instinktiv aus meinem Weltbilde ausgeschaltet und niemals die leiseste Neigung verspürt, mich mit den unteren Mächten verwegen einzulassen, sie gar im Übermut zu mir heraufzufordern, oder ihnen, wenn sie von sich aus versuchend an mich herantraten, auch nur den kleinen Finger zu reichen. Dieser Gesinnung habe ich Opfer gebracht, ideelle und solche des äußeren Wohlseins, indem ich ohne Zögern meinen mir lieben Lehr-Beruf vor der Zeit aufgab, als sich erwies, dass sie sich mit dem Geiste und den Ansprüchen unserer geschichtlichen Entwicklungen nicht vereinbaren ließ. In dieser Beziehung bin ich mit mir zufrieden. Aber in meinem Zweifel, ob ich mich zu der hier in Angriff genommenen Aufgabe eigentlich berufen fühlen darf, kann mich diese Entschiedenheit oder, wenn man will, Beschränktheit meiner moralischen Person nur bestärken.
Ich hatte soeben kaum die Feder angesetzt, als ihr ein Wort entfloss, das mich heimlich bereits in gewisse Verlegenheit versetzte: das Wort »genial«; ich sprach von dem musikalischen Genius meines verewigten Freundes. Nun ist dieses Wort, »Genie«, wenn auch über-mäßigen, so doch gewiss edlen, harmonischen und human-gesunden Klanges und Charakters, und meinesgleichen, so weit er von dem Anspruch entfernt ist, mit dem eigenen Wesen an diesem hohen Bezirke teilzuhaben und je mit divinis influxibus ex alto begnadet gewesen zu sein, sollte keinen vernünftigen Grund sehen, davor zurückzubangen, keinen Grund, nicht mit freudigem Aufblick und ehrerbietiger Vertraulichkeit davon zu sprechen und zu handeln. So scheint es. Und doch ist nicht zu leugnen und ist nie geleugnet worden, dass an dieser strahlenden Sphäre das Dämonische und Widervernünftige einen beunruhigenden Anteil hat, dass immer eine leises Grauen erweckende Verbindung besteht zwischen ihr und dem unteren Reich, und dass eben darum die versichernden Epitheta, die ich ihr beizulegen versuchte, »edel«, »human-gesund« und »harmonisch«, nicht recht darauf passen wollen – selbst dann nicht – mit einer Art schmerzlichen Entschlusses stelle ich diesen Unterschied auf – selbst dann nicht, wenn es sich um lauteres und genuines, von Gott geschenktes oder auch verhängtes Genie handelt und nicht um ein akquiriertes und verderbliches, um den sünd- und krankhaften Brand natürlicher Gaben, die Ausübung eines grässlichen Kaufvertrages …
Hier breche ich ab, mit dem beschämenden Gefühl artistischer Verfehlung und Unbeherrschtheit. Adrian selbst hätte wohl kaum, nehmen wir an: in einer Symphonie, ein solches Thema so vorzeitig auftreten – hätte es höchstens auf eine fein versteckte und kaum schon greifbare Art von ferne sich anmelden lassen. Übrigens mag, was mir entschlüpfte, auch den Leser nur wie eine dunkle, fragwürdige Andeutung berühren und nur mir selber als Indiskretion und plumpes Mit-der-Tür-ins-Haus-fallen erscheinen. Für einen Menschen wie mich ist es sehr schwer und mutet ihn fast wie Frivolität an, zu einem Gegenstand, der ihm lebensteuer ist und ihm auf den Nägeln brennt, wie dieser, den Standpunkt des komponierenden Künstlers einzunehmen und ihn mit der spielenden Besonnenheit eines solchen zu bewirtschaften. Daher mein voreiliges Eingehen auf den Unterschied von lauterem und unlauterem Genie, einen Unterschied, dessen Bestehen ich anerkenne, nur um mich gleich darauf zu fragen, ob er zu Recht besteht. Tatsächlich hat das Erlebnis mich gezwungen, über dieses Problem so angestrengt, so inständig nachzudenken, dass es mir schreckhafterweise zuweilen schien, als würde ich damit über die mir eigentlich bestimmte und zukömmliche Gedankenebene hinausgetrieben und erführe selbst eine »unlautere« Steigerung meiner natürlichen Gaben …
Ich breche aufs Neue ab, indem ich mich daran erinnere, dass ich auf das Genie und seine jedenfalls dämonisch beeinflusste Natur nur zu sprechen kam, um meinen Zweifel zu erläutern, ob ich zu meiner Aufgabe die nötige Affinität besitze. Möge denn nun gegen den Gewissensskrupel geltend gemacht sein, was immer ich dagegen ins Feld zu führen habe. Es war mir beschieden, viele Jahre meines Lebens in der vertrauten Nähe eines genialen Menschen, des Helden dieser Blätter, zu verbringen, ihn seit Kinderzeiten zu kennen, Zeuge seines Werdens, seines Schicksals zu sein und an seinem Schaffen in bescheidener Helfersrolle teilzuhaben. Die librettistische Bearbeitung von Shakespeares Komödie »Verlorene Liebesmüh«, Leverkühns mutwilligem Jugendwerk, stammt von mir, und auch auf die textliche Zubereitung der grotesken Opernsuite »Gesta Romanorum« sowie des Oratoriums »Offenbarung S. Johannis des Theologen« durfte ich Einfluss nehmen. Das ist das eine, oder es ist bereits das eine und andere. Ich bin aber ferner im Besitz von Papieren, unschätzbaren Aufzeichnungen, die der Heimgegangene mir und keinem anderen in gesunden Tagen oder, wenn ich so nicht sagen darf, in vergleichsweise und legaliter gesunden Tagen letztwillig vermacht hat, und auf die ich mich bei meiner Darstellung stützen werde, ja, aus denen ich mit gebotener Auswahl einiges direkt in dieselbe einzuschalten gedenke. Letztens und erstens aber – und diese Rechtfertigung war noch immer die gültigste, wenn nicht vor den Menschen, so doch vor Gott: Ich habe ihn geliebt – mit Entsetzen und Zärtlichkeit, mit Erbarmen und hingebender Bewunderung – und wenig dabei gefragt, ob er im mindesten mir das Gefühl zurückgäbe.
Das hat er nicht getan, o nein. In der Verschreibung der nachgelassenen Kompositionsskizzen und Tagebuchblätter drückt sich ein freundlich-sachliches, fast möchte ich sagen: gnädiges und sicherlich mich ehrendes Vertrauen in meine Gewissenhaftigkeit, Pietät und Korrektheit aus. Aber lieben? Wen hätte dieser Mann geliebt? Einst eine Frau – vielleicht. Ein Kind zuletzt – es mag sein. Einen leichtwiegenden, jeden gewinnenden Fant und Mann aller Stunden, den er dann, wahrscheinlich eben weil er ihm geneigt war, von sich schickte – und zwar in den Tod. Wem hätte er sein Herz eröffnet, wen jemals in sein Leben eingelassen? Das gab es bei Adrian nicht. Menschliche Ergebenheit nahm er hin – ich möchte schwören: oft ohne sie auch nur zu bemerken. Seine Gleichgültigkeit war so groß, dass er kaum jemals gewahr wurde, was um ihn her vorging, in welcher Gesellschaft er sich befand, und die Tatsache, dass er sehr selten einen Gesprächspartner mit Namen anredete, lässt mich vermuten, dass er den Namen nicht wusste, während doch der andere ein gutes Recht zur Annahme des Gegenteils hatte. Ich möchte seine Einsamkeit einem Abgrund vergleichen, in welchem Gefühle, die man ihm entgegenbrachte, lautlos und spurlos untergingen. Um ihn war Kälte – und wie wird mir zumute, indem ich dies Wort gebrauche, das auch er in einem ungeheuerlichen Zusammenhange einst niederschrieb! Einzelnen Vokabeln können Leben und Erfahrung einen Akzent verleihen, der sie ihrem alltäglichen Sinn völlig entfremdet und ihnen einen Schreckensnimbus verleiht, den niemand versteht, der sie nicht in ihrer fürchterlichsten Bedeutung kennengelernt hat.
II
Mein Name ist Dr. phil. Serenus Zeitblom. Ich selbst beanstande die sonderbare Verzögerung dieser Kartenabgabe, aber, wie es sich trifft und fügt, der literarische Gang meiner Mitteilungen wollte mich bis zu diesem Augenblick immer nicht dazu kommen lassen. Mein Alter ist 60 Jahre, denn A.D. 1883 wurde ich, als ältestes von vier Geschwistern, zu Kaisersaschern an der Saale, Regierungsbezirk Merseburg, geboren, derselben Stadt, in der auch Leverkühn seine gesamte Schülerzeit verbrachte, weshalb ich ihre nähere Kennzeichnung vertagen kann, bis ich zu deren Beschreibung komme. Da überhaupt mein persönlicher Lebensgang sich mit dem des Meisters vielfach verschränkt, so wird es gut sein, von beiden im Zusammenhang zu berichten, um nicht dem Fehler des Vorgreifens zu verfallen, zu welchem man, wenn das Herz voll ist, ohnedies immer neigt.
Nur soviel sei hier angegeben, dass es die mäßige Höhe eines halbgelehrten Mittelstandes war, auf der ich zur Welt kam, denn mein Vater, Wolgemut Zeitblom, war Apotheker – übrigens der bedeutendste am Platze: Es gab noch ein zweites pharmazeutisches Geschäft in Kaisersaschern, das sich aber niemals des gleichen öffentlichen Vertrauens erfreute wie die Zeitblomsche Apotheke »Zu den Seligen Boten« und jederzeit einen schweren Stand gegen sie hatte. Unsere Familie zählte zu der kleinen katholischen Gemeinde der Stadt, deren Bevölkerungsmehrheit natürlich dem lutherischen Bekenntnis angehörte, und namentlich meine Mutter war eine fromme Tochter der Kirche, die ihren religiösen Pflichten gewissenhaft nachkam, während mein Vater, wahrscheinlich schon aus Zeitmangel, sich darin laxer zeigte, ohne deshalb die Gruppen-Solidarität mit seinen Kultgenossen, die ja auch ihre politische Tragweite hatte, im geringsten zu verleugnen. Bemerkenswert war, dass neben unserem Pfarrer, Geistl. Rat Zwilling, auch der Rabbiner der Stadt, Dr. Carlebach mit Namen, in unseren über dem Laboratorium und der Apotheke gelegenen Gasträumen verkehrte, was in protestantischen Häusern nicht leicht möglich gewesen wäre. Das bessere Aussehen war auf seiten des Mannes der römischen Kirche. Aber mein Eindruck, der hauptsächlich auf Äußerungen meines Vaters beruhen mag, ist der geblieben, dass der kleine und langbärtige, mit einem Käppchen geschmückte Talmudist seinen andersgläubigen Amtsbruder an Gelehrsamkeit und religiösem Scharfsinn weit übertraf. Es mag mit an dieser Jugenderfahrung liegen, aber auch an der spürsinnigen Aufgeschlossenheit jüdischer Kreise für das Schaffen Leverkühns, dass ich gerade in der Judenfrage und ihrer Behandlung unserem Führer und seinen Paladinen niemals voll habe zustimmen können, was nicht ohne Einfluss auf meine Resignation vom Lehramte war. Freilich haben auch Exemplare jenes Geblütes meinen Weg gekreuzt – ich brauche nur an den Privatgelehrten Breisacher in München zu denken –, auf deren verwirrend antipathisches Gepräge ich an gehörigem Ort einiges Licht zu werfen mir vornehme.
Was nun meine katholische Herkunft angeht, so hat sie selbstverständlich meinen inneren Menschen gemodelt und beeinflusst, jedoch ohne dass sich aus dieser Lebenstönung je ein Widerspruch zu meiner humanistischen Weltanschauung, meiner Liebe zu den »besten Künsten und Wissenschaften«, wie man einstmals sagte, ergeben hätte. Zwischen diesen beiden Persönlichkeitselementen herrschte stets voller Einklang, wie er denn wohl ohne Schwierigkeit zu bewahren ist, wenn man, wie ich, in einer alt-städtischen Umgebung aufwuchs, deren Erinnerungen und Baudenkmale weit in vorschismatische Zeiten, in eine christliche Einheitswelt zurückreichen. Zwar liegt Kaisersaschern recht mitten im Heimatsbezirk der Reformation, im Herzen der Luther-Gegend, welche die Städtenamen Eisleben, Wittenberg, Quedlinburg, auch Grimma, Wolfenbüttel und Eisenach umschreiben – was nun wieder aufschlussreich für das Innenleben Leverkühns, des Lutheraners, ist und mit seiner ursprünglichen Studienrichtung, der theologischen, zusammenhängt. Aber die Reformation möchte ich einer Brücke vergleichen, die nicht nur aus scholastischen Zeiten herüber in unsere Welt freien Denkens, sondern ebenso wohl auch zurück ins Mittelalter führt – und zwar vielleicht tiefer zurück als eine von der Kirchenspaltung unberührt gebliebene christ-katholische Überlieferung heiterer Bildungsliebe. Meinesteils fühle ich mich recht eigentlich in der goldenen Sphäre beheimatet, in der man die Heilige Jungfrau »Iovis alma parens« nannte.
Um noch ferner das Notwendigste über meine vita niederzulegen, so vergönnten meine Eltern mir den Besuch unseres Gymnasiums, derselben Schule, in der, zwei Klassen unter mir, auch Adrian seinen Unterricht empfing, und die, in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts gegründet, noch bis vor kurzem den Namen »Schule der Brüder vom gemeinen Leben« geführt hatte. Nur aus einer gewissen Verlegenheit vor dem überhistorischen und für das neuzeitliche Ohr leicht komischen Klange dieses Namens hatte sie ihn abgelegt und nannte sich nach der benachbarten Kirche Bonifatius-Gymnasium. Als ich sie zu Anfang des laufenden Jahrhunderts verließ, wandte ich mich ohne Schwanken dem Studium der klassischen Sprachen zu, in denen schon der Schüler sich in gewissem Grade hervorgetan, und oblag demselben auf den Universitäten Gießen, Jena, Leipzig und, von 1903 bis 1905, zu Halle, um dieselbe Zeit also, und nicht zufällig um dieselbe, als auch Leverkühn dort studierte.
Hier kann ich, wie so oft, nicht umhin, mich im Vorübergehen an dem inneren und fast geheimnisvollen Zusammenhang des altphilologischen Interesses mit einem lebendig-liebevollen Sinn für die Schönheit und Vernunftwürde des Menschen zu weiden – diesem Zusammenhang, der sich schon darin kundgibt, dass man die Studienwelt der antiken Sprachen als die »Humanioren« bezeichnet, sodann aber darin, dass die seelische Zusammenordnung von sprachlicher und humaner Passion durch die Idee der Erziehung gekrönt wird und die Bestimmung zum Jugendbildner sich aus derjenigen zum Sprachgelehrten fast selbstverständlich ergibt. Der Mann der naturwissenschaftlichen Realien kann wohl ein Lehrer, aber niemals in dem Sinn und Grade ein Erzieher sein wie der Jünger der bonae litterae. Auch jene andere, vielleicht innigere, aber wundersam unartikulierte Sprache, diejenige der Töne (wenn man die Musik so bezeichnen darf), scheint mir nicht in die pädagogisch-humane Sphäre eingeschlossen, obgleich ich wohl weiß, dass sie in der griechischen Erziehung und überhaupt im öffentlichen Leben der Polis eine dienende Rolle gespielt hat. Vielmehr scheint sie mir, bei aller logisch-moralischen Strenge, wovon sie sich wohl die Miene geben mag, einer Geisterwelt anzugehören, für deren unbedingte Zuverlässigkeit in Dingen der Vernunft und Menschenwürde ich nicht eben meine Hand ins Feuer legen möchte. Dass ich ihr trotzdem persönlich von Herzen zugetan bin, gehört zu jenen Widersprüchen, die, ob man es nun bedauere oder seine Freude daran habe, von der Menschennatur unabtrennbar sind.
Dies außerhalb des Gegenstandes. Und auch wieder nicht, da die Frage, ob zwischen der edel-pädagogischen Welt des Geistes und jener Geisterwelt, der man sich nur unter Gefahren naht, eine klare und sichere Grenze zu ziehen ist, sehr wohl und nur zu sehr zu meinem Gegenstande gehört. Welcher Bereich des Menschlichen, und sei es der lauterste, würdig wohlwollendste, wäre wohl ganz unzugänglich dem Einfluss der unteren Gewalten, ja, man muss hinzusetzen, ganz unbedürftig der befruchtenden Berührung mit ihnen? Dieser Gedanke, nicht ungeziemend selbst für den, dessen persönlichem Wesen alles Dämonische durchaus fernliegt, ist mir zurückgeblieben von gewissen Augenblicken der fast anderthalbjährigen Studienreise nach Italien und Griechenland, die meine guten Eltern mir nach Ablegung meines Staatsexamens ermöglichten: als ich von der Akropolis zu der Heiligen Straße hinausblickte, auf der die Mysten, geschmückt mit der Safranbinde und den Namen des Iacchus auf den Lippen, dahinzogen, und dann, als ich an der Stätte der Einweihung selbst, im Bezirke des Eubuleus am Rande der vom Felsen überhangenen plutonischen Spalte stand. Da erfuhr ich ahnend die Fülle des Lebensgefühls, welche in der initiatorischen Andacht des olympischen Griechentums vor den Gottheiten der Tiefe sich ausdrückt, und oft habe ich später meinen Primanern vom Katheder herab erklärt, dass Kultur recht eigentlich die fromme und ordnende, ich möchte sagen, begütigende Einbeziehung des Nächtig-Ungeheueren in den Kultus der Götter ist.
Von jener Reise zurückgekehrt, fand der Fünfundzwanzigjährige Anstellung an dem Gymnasium seiner Heimatstadt, derselben Schule, in der ich wissenschaftlich aufgebracht worden war, und wo ich nun einige Jahre lang auf bescheidenen Stufen den Unterricht im Lateinischen, Griechischen und auch in Geschichte versah, bevor ich nämlich, im 12. Jahr des Jahrhunderts, in den bayerischen Schuldienst überging und fortan zu Freising, dem Orte, der mein Wohnsitz geblieben ist, als Gymnasialprofessor, aber auch als Dozent an der theologischen Hochschule, in den genannten Fächern mehr als zwei Jahrzehnte lang mich einer befriedigenden Tätigkeit erfreute.
Frühzeitig, bald schon nach meiner Bestallung in Kaisersaschern, habe ich mich vermählt – Ordnungsbedürfnis und der Wunsch nach sittlicher Einfügung ins Menschenleben leiteten mich bei diesem Schritt. Helene, geb. Ölhafen, mein treffliches Weib, das noch heute meine sich neigenden Jahre betreut, war die Tochter eines älteren Fakultäts- und Amtskollegen zu Zwickau im Königreich Sachsen, und auf die Gefahr hin, das Lächeln des Lesers hervorzurufen, will ich nur gestehen, dass der Vorname des frischen Kindes, Helene, dieser teuere Laut, bei meiner Wahl nicht die letzte Rolle spielte. Ein solcher Name bedeutet eine Weihe, deren reinem Zauber man nicht seine Wirkung verwehrt, sollte auch das Äußere der Trägerin seine hohen Ansprüche nur in bürgerlich bescheidenem Maß, und auch dies nur vorübergehend, vermöge rasch entweichenden Jugendreizes erfüllen. Auch unsere Tochter, die sich längst einem braven Manne, Prokuristen an der Filiale der Bayerischen Effektenbank in Regensburg, verbunden hat, haben wir Helene genannt. Außer ihr schenkte meine liebe Frau mir noch zwei Söhne, so dass ich die Freuden und Sorgen der Vaterschaft nach Menschengebühr, wenn auch in nüchternen Grenzen erfahren habe. Etwas Berückendes, das will ich nur zugeben, war zu keiner Zeit an keinem meiner Kinder. Mit einer Kinderschönheit wie dem kleinen Nepomuk Schneidewein, Adrians Neffen und seiner späten Augenweide, konnten sie es nicht aufnehmen – ich selbst bin der letzte, es zu behaupten. – Meine beiden Söhne dienen heute, der eine auf zivilem Posten, der andere in der bewaffneten Macht, ihrem Führer, und wie überhaupt meine befremdete Stellung zu den vaterländischen Gewalten eine gewisse Leere um mich geschaffen hat, so ist auch der Zusammenhang dieser jungen Männer mit dem stillen Elternheim nur locker zu nennen.
III
Die Leverkühns waren ein Geschlecht von gehobenen Handwerkern und Landwirten, das teils im Schmalkaldischen, teils in der Provinz Sachsen, am Lauf der Saale blühte. Adrians engere Familie saß seit mehreren Generationen auf dem zur Dorfgemeinde Oberweiler gehörigen Hofe Buchel, nahe Weißenfels, von dieser Station, wohin man von Kaisersaschern in dreiviertelstündiger Bahnfahrt gelangte, nur mit entgegengesandtem Fuhrwerk zu erreichen. Buchel war ein Bauerngut des Umfanges, der dem Besitzer den Rang eines Vollspänners oder Vollhöfners verleiht, mit etlichen fünfzig Morgen Äckern und Wiesen, einem genossenschaftlich bewirtschafteten Zubehör von Gemischtwald und einem sehr behäbigen Wohnhause aus Holz- und Fachwerk, aber steinernen Unterbaues. Es bildete mit den Scheunen und Viehställen ein offenes Viereck, in dessen Mitte, mir unvergesslich, eine mächtige, zur Junizeit mit herrlich duftenden Blüten bedeckte, von einer grünen Bank umlaufene alte Linde stand. Dem Fuhrverkehr auf dem Hofe mochte der schöne Baum ein wenig im Wege sein, und ich hörte, dass stets der Erbsohn in jungen Jahren seine Beseitigung aus praktischen Gründen gegen den Vater verfocht, um ihn eines Tages, als Herr des Hofes, gegen das Ansinnen des eigenen Sohnes in Schutz zu nehmen.
Wie oft mag der Lindenbaum den frühkindlichen Tagesschlummer und die Spiele des kleinen Adrian beschattet haben, der, als im Jahre 1885 Blütezeit war, im Oberstock des Buchelhauses als zweiter Sohn des Ehepaars Jonathan und Elsbeth Leverkühn geboren wurde. Der Bruder, Georg, jetzt längst der Wirt dort oben, stand ihm um fünf Jahre voran. Eine Schwester, Ursel, folgte in dem gleichen Abstande nach. Da zu der Freund- und Bekanntschaft, die Leverkühns in Kaisersaschern besaßen, auch meine Eltern gehörten, ja, zwischen unseren Häusern seit alters ein besonders herzliches Vernehmen bestand, so verbrachten wir in der guten Jahreszeit manchen Sonntagnachmittag auf dem Vorwerk, wo denn die Städter sich der herzhaften Gaben des Landes, mit denen Frau Leverkühn sie regalierte, des kernigen Graubrotes mit süßer Butter, des goldenen Scheibenhonigs, der köstlichen Erdbeeren in Rahm, der in blauen Satten gestockten, mit Schwarzbrot und Zucker bestreuten Milch, dankbar erfreuten. Zur Zeit von Adrians, oder Adri’s, wie er genannt wurde, erster Kinderzeit, saßen seine Großeltern dort noch auf dem Altenteil, während die Wirtschaft schon ganz in den Händen des jüngeren Geschlechtes lag und der Alte, übrigens ehrerbietig angehört, sich nur noch am Abendtisch zahnlosen Mundes räsonierend in sie einmischte. Von dem Bilde dieser Vorgänger, die bald fast gleichzeitig wegstarben, ist mir wenig geblieben. Desto deutlicher steht mir dasjenige ihrer Kinder Jonathan und Elsbeth Leverkühn vor Augen, obgleich es ein Wandelbild ist und im Verlauf meiner Knaben- und Schüler-, meiner Studentenjahre mit jener wirksamen Unmerklichkeit, auf welche die Zeit sich versteht, aus dem Jugendlichen in müdere Phasen hinüberglitt.
Jonathan Leverkühn war ein Mann besten deutschen Schlages, ein Typ wie er in unseren Städten kaum noch begegnet und gewiss nicht unter denen zu finden ist, die heute unser Menschentum mit oft denn doch beklemmendem Ungestüm gegen die Welt vertreten – eine Physiognomie, wie geprägt von vergangenen Zeiten, gleichsam ländlich aufgespart und herübergebracht aus deutschen Tagen von vor dem Dreißigjährigen Kriege. Das war mein Gedanke, wenn ich ihn, heranwachsend, mit schon halbwegs zum Sehen gebildetem Auge betrachtete. Wenig geordnetes aschblondes Haar fiel in eine gewölbte, stark zweigeteilte Stirn mit vortretenden Schläfenadern, hing unmodisch lang und dick aufliegend in den Nacken und ging am wohlgebildeten, kleinen Ohr in den gekrausten Bart über, der blond die Kinnbacken, das Kinn und die Vertiefung unter der Lippe bewuchs. Diese, die Unterlippe, trat ziemlich stark und geründet unter dem kurzen, leicht abwärts hängenden Schnurrbart hervor, mit einem Lächeln, das außerordentlich anziehend mit dem etwas angestrengten, aber ebenfalls halb lächelnden, in leichter Scheuheit vertieften Blick der blauen Augen übereinstimmte. Die Nase war dünnrückig und fein gebogen, die unbebartete Wangenpartie unter den Backenknochen schattig vertieft und selbst etwas hager. Den sehnigen Hals trug er meist offen und liebte nicht städtische Allerweltskleidung, die auch seiner Erscheinung nicht wohltat, besonders nicht zu seinen Händen passte, dieser kräftigen, gebräunten und trockenen, leicht sommersprossigen Hand, mit der er die Stockkrücke umfasste, wenn er ins Dorf zum Gemeinderat ging.
Ein Physikus hätte einer gewissen verschleierten Bemühtheit dieses Blickes, einer gewissen Sensitivität dieser Schläfen vielleicht eine Neigung zur Migräne angemerkt, der Jonathan allerdings unterlag, aber nur in mäßigem Grade, nicht öfter als einmal im Monat für einen Tag und fast ohne Berufsstörung. Er liebte die Pfeife, eine halblange, porzellanene Deckelpfeife, deren eigentümliches Knaster-Arom, weit angenehmer als stehengebliebener Zigarren- und Zigarettendunst, die Atmosphäre der unteren Räume bestimmte. Er liebte dazu als Schlaftrunk einen guten Krug Merseburger Bieres. An Winterabenden, wenn draußen sein Erb und Eigen verschneit ruhte, sah man ihn lesen, vornehmlich in einer umfangreichen, in gepresstes Schweinsleder gebundenen und mit ledernen Spangen zu verschließenden Erb-Bibel, die um 1700 mit herzoglicher Befreiung zu Braunschweig gedruckt worden war und nicht nur die »Geist-reichen« Vorreden und Randglossen D. Martin Luthers, sondern auch allerlei Summarien, locos parallelos und jedes Kapitel erläuternde historisch-moralische Verse eines Herrn David von Schweinitz mit einschloss. Von dem Buch ging die Sage, oder vielmehr die bestimmte Nachricht war davon überliefert, es sei das Eigentum jener Prinzess von Braunschweig-Wolfenbüttel gewesen, welche den Sohn Peters des Großen geheiratet hatte. Danach jedoch habe sie ihren Tod fingiert, so dass ihr Leichenbegängnis stattgefunden habe, während sie nach Martinique entwichen und dort mit einem Franzosen die Ehe eingegangen sei. Wie oft hat Adrian, der für das Komische einen durstigen Sinn hatte, später noch mit mir über diese Geschichte gelacht, die sein Vater, den Kopf vom Buche erhebend, mit sanftem Tiefblick erzählte, worauf er sich, offenbar ungestört durch die ein wenig skandalöse Provenienz des heiligen Druckwerkes, den Verskommentaren des Herrn von Schweinitz oder der »Weisheit Salomonis an die Tyrannen« wieder zuwandte.
Neben der geistlichen Tendenz seiner Lektüre lief jedoch eine andere, die von gewissen Zeiten dahin charakterisiert worden wäre, er habe wollen »die Elementa spekulieren«. Das heißt, er trieb, in bescheidenem Maßstab und mit bescheidenen Mitteln, naturwissenschaftliche, biologische, auch wohl chemisch-physikalische Studien, bei denen mein Vater ihm gelegentlich mit Stoffen aus seinem Laboratorium zur Hand ging. Jene verschollene und nicht vorwurfsfreie Bezeichnung für solche Bestrebungen aber wählte ich, weil ein gewisser mystischer Einschlag darin merklich war, der ehemals wohl als Hang zur Zauberei verdächtigt worden wäre. Übrigens will ich hinzufügen, dass ich dieses Misstrauen einer religiös-spiritualistischen Epoche gegen die aufkommende Leidenschaft, die Geheimnisse der Natur zu erforschen, immer vollkommen verstanden habe. Die Gottesfurcht musste ein libertinistisches Sich-einlassen mit dem Verbotenen darin sehen, ungeachtet des Widerspruches, den man darin finden mag, die Schöpfung Gottes, Natur und Leben, als moralisch anrüchiges Gebiet zu betrachten. Die Natur selbst ist zu voll von vexatorisch ins Zauberische spielenden Hervorbringungen, zweideutigen Launen, halbverhüllten und sonderbar ins Ungewisse weisenden Allusionen, dass nicht die züchtig sich beschränkende Frömmigkeit eine gewagte Überschreitung darin hätte sehen sollen, sich mit ihr abzugeben.
Wenn Adrians Vater am Abend seine farbig illustrierten Bücher über exotische Falter und Meergetier aufschlug, so blickten wir, seine Söhne und ich, auch wohl Frau Leverkühn, manches Mal über die gelederte, mit Ohrenklappen versehene Rückenlehne seines Stuhles mit hinein, und er wies uns mit dem Zeigefinger die dort abgebildeten Herrlichkeiten und Exzentrizitäten: diese in allen Farben der Palette, nächtigen und strahlenden, sich dahinschaukelnden, mit dem erlesensten kunstgewerblichen Geschmack gemusterten und ausgeformten Papilios und Morphos der Tropen – Insekten, die in phantastisch übertriebener Schönheit ein ephemeres Leben fristen, und von denen einige den Eingeborenen als böse Geister gelten, die die Malaria bringen. Die herrlichste Farbe, die sie zur Schau tragen, ein traumschönes Azurblau, sei, so belehrte uns Jonathan, gar keine echte und wirkliche Farbe, sondern werde durch feine Rillen und andere Oberflächengestaltungen der Schüppchen auf ihren Flügeln hervorgerufen, eine Kleinstruktur, die es durch künstlichste Brechung der Lichtstrahlen und Ausschaltung der meisten besorge, dass allein das leuchtendste Blaulicht in unser Auge gelange.
»Sieh an«, höre ich noch Frau Leverkühn sagen, »es ist also Trug?«
»Nennst du das Himmelsblau Trug?«, erwiderte ihr Mann, indem er rückwärts zu ihr aufblickte. »Den Farbstoff kannst du mir auch nicht nennen, von dem es kommt.«
Tatsächlich ist mir, indem ich schreibe, als stünde ich noch mit Frau Elsbeth, Georg und Adrian hinter des Vaters Stuhl und folgte seinem Finger durch diese Gesichte. Es waren da Glasflügler abgeschildert, die gar keine Schuppen auf ihren Schwingen führen, so dass diese zart gläsern und nur vom Netz der dunkleren Adern durchzogen erscheinen. Ein solcher Schmetterling, in durchsichtiger Nacktheit den dämmernden Laubschatten liebend, hieß Hetaera esmeralda. Nur einen dunklen Farbfleck in Violett und Rosa hatte Hetaera auf ihren Flügeln, der sie, da man sonst nichts von ihr sieht, im Flug einem windgeführten Blütenblatt gleichen lässt. – Es war da sodann der Blattschmetterling, dessen Flügel, oben in volltönendem Farbendreiklang prangend, auf ihrer Unterseite mit toller Genauigkeit einem Blatte glichen, nicht nur nach Form und Geäder, sondern dazu noch durch die minutiöse Wiedergabe kleiner Unreinigkeiten, nachgeahmter Wassertropfen, warziger Pilzbildungen und dergleichen mehr. Ließ dies geriebene Wesen sich mit hochgefalteten Flügeln im Laube nieder, so verschwand es durch Angleichung so völlig in seiner Umgebung, dass auch der gierigste Feind es nicht darin ausmachen konnte.
Nicht ohne Erfolg suchte Jonathan uns seine Ergriffenheit von dieser raffiniert ins Mangelhaft-Einzelne gehenden Schutz-Nachahmung mitzuteilen. »Wie hat das Tier das gemacht?«, fragte er wohl. »Wie macht es die Natur durch das Tier? Denn dessen eigener Beobachtung und Berechnung kann man den Trick unmöglich zuschreiben. Ja, ja, die Natur kennt ihr Laubblatt genau, nicht nur in seiner Vollkommenheit, sondern mit seinen kleinen alltäglichen Fehlern und Verunstaltungen, und aus schalkhafter Freundlichkeit wiederholt sie sein äußeres Ansehen in anderem Bereich, auf der Unterseite der Flügel dieses ihres Schmetterlings, zur Verblendung anderer ihrer Geschöpfe. Warum aber hat gerade dieser den listigen Vorzug? Und wenn es freilich zweckmäßig ist für ihn, dass er in Ruhestellung aufs Haar einem Blatte gleicht – wo bleibt die Zweckmäßigkeit, von seinen hungrigen Verfolgern aus gesehen, den Eidechsen, Vögeln und Spinnen, denen er doch zur Nahrung bestimmt ist, die ihn aber, sobald er will, mit allem Scharfblick nicht ausfindig machen können? Ich frage das euch, damit nicht gar ihr mich danach fragt.«
Konnte nun dieser Falter zu seinem Schutze sich unsichtbar machen, so brauchte man in dem Buche nur weiter zu blättern, um die Bekanntschaft solcher zu machen, die durch augenfälligste, ja aufdringliche, weithin reichende Sichtbarkeit denselben Zweck erreichten. Sie waren nicht nur besonders groß, sondern auch ausnehmend prunkvoll gefärbt und gemustert, und, wie Vater Leverkühn hinzusetzte, flogen in diesem scheinbar herausfordernden Kleide mit ostentativer Gemächlichkeit, die aber niemand frech nennen möge, sondern der eher etwas Schwermütiges anhaftete, ihres Weges dahin, ohne sich je zu verstecken und ohne doch, dass je ein Tier, weder Affe, noch Vogel, noch Echse, ihnen auch nur nachgeblickt hätte. Warum? Weil sie ein Ekel waren. Und weil sie durch ihre auffallende Schönheit, dazu durch die Langsamkeit ihres Fluges, eben dies zu verstehen gaben. Ihr Saft war von so scheußlichem Geruch und Geschmack, dass, wenn einmal ein Missverständnis, ein Fehlgriff vorkam, derjenige, der sich an einem von ihnen gütlich zu tun gedachte, den Bissen mit allen Anzeichen der Übelkeit wieder von sich spie. Ihre Ungenießbarkeit ist aber in der ganzen Natur bekannt, und sie sind sicher – traurig sicher. Wir wenigstens, hinter Jonathans Stuhl, fragten uns, ob dieser Sicherheit nicht eher etwas Entehrendes zukomme, als dass sie heiter zu nennen gewesen wäre. Was aber war die Folge? Dass andere Arten von Schmetterlingen sich trickweise in denselben Warnungsprunk kleideten und denn also auch in langsamem Unberührbarkeitsfluge melancholisch-sicher dahinzogen, obgleich sie durchaus genießbar waren.
Angesteckt von Adrians Erheiterung durch diese Nachrichten, einem Gelächter, das ihn förmlich schüttelte und ihm Tränen erpresste, musste auch ich recht herzlich lachen. Aber Vater Leverkühn verwies es uns mit einem »Pst!«, denn er wollte all diese Dinge mit scheuer Andacht betrachtet wissen – derselben geheimnisvollen Andacht, mit der er etwa die unzugängliche Zeichenschrift auf den Schalen gewisser Muscheln betrachtete, indem er auch wohl seine große, viereckige Lupe dabei zu Hilfe nahm und sie auch uns zur Verfügung stellte. Gewiss, der Anblick dieser Geschöpfe, der Schnecken und Muscheln des Meeres also, war ebenfalls hoch bedeutend, wenigstens wenn man unter Jonathans Führung durch ihre Abbildungen ging. Dass alle diese mit herrlicher Sicherheit und so kühnem wie delikatem Formgeschmack ausgeführten Gewinde und Gewölbe mit ihren rosigen Eingängen und der irisierenden Fayencepracht ihrer vielgestaltigen Wandungen das Eigenwerk ihrer gallerthaften Bewohner waren – wenigstens wenn man an der Vorstellung festhielt, dass die Natur sich selber macht, und nicht den Schöpfer heranzog, den als phantasievollen Kunstgewerbler und ehrgeizigen Künstler der Glasurtöpferei zu imaginieren, denn doch sein Seltsames hat, so dass nirgends die Versuchung näher liegt, als hier, einen werkmeisterlichen Zwischengott, den Demiurgos, einzuschalten – ich wollte sagen: dass diese köstlichen Gehäuse das Produkt der Weichwesen selbst waren, die sie beschützten, das war dabei der erstaunlichste Gedanke.
»Ihr«, sagte Jonathan zu uns, »habt, wie ihr leicht feststellen könnt, wenn ihr eure Ellbogen, eure Rippen befühlt, als ihr wurdet, in euerm Inneren ein festes Gestell, ein Skelett ausgebildet, das eurem Fleisch, eueren Muskeln Halt gewährt, und das ihr in euch herumtragt, wenn es nicht besser ist, zu sagen: Es trägt euch herum. Hier nun ist es umgekehrt. Diese Geschöpfe haben ihre Festigkeit nach außen geschlagen, nicht als Gerüst, sondern als Haus, und eben dass sie ein Außen ist und kein Innen, muss der Grund ihrer Schönheit sein.«
Wir Knaben, Adrian und ich, sahen uns wohl mit halbem und verdutztem Lächeln an bei solchen Bemerkungen des Vaters, wie dieser über die Eitelkeit des Sichtbaren.
Zuweilen war sie tückisch, diese Außenästhetik; denn gewisse Kegelschnecken, reizend asymmetrische, in ein geädertes Blassrosa oder weiß geflecktes Honigbraun getauchte Erscheinungen, waren wegen ihres Giftbisses berüchtigt – und überhaupt war, wenn man den Herrn des Buchelhauses hörte, eine gewisse Anrüchigkeit oder phantastische Zweideutigkeit von dieser ganzen wunderlichen Sektion des Lebens nicht fernzuhalten. Eine sonderbare Ambivalenz der Anschauung hatte sich immer in dem sehr verschiedenartigen Gebrauche kund gegeben, den man von den Prunkgehäusen machte. Sie hatten im Mittelalter zum stehenden Inventar der Hexenküchen und Alchimisten-Gewölbe gehört und waren als die passenden Gefäße für Gifte und Liebestränke befunden worden. Andererseits und zugleich aber hatten sie beim Gottesdienst zu Muschelschreinen für Hostien und Reliquien und sogar als Abendmahlskelche gedient. Wie vieles berührte sich hier – Gift und Schönheit, Gift und Zauberei, aber auch Zauberei und Liturgie. Wenn wir es nicht dachten, so gaben Jonathan Leverkühns Kommentare es uns doch unbestimmt zu empfinden.
Was nun jene Zeichenschrift betrifft, über die er sich gar niemals beruhigen konnte, so fand sie sich auf der Schale einer Neu-Kaledonischen Muschel von mäßiger Größe und war auf weißlichem Grunde in leicht rötlich-brauner Farbe ausgeführt. Die Charaktere, wie mit dem Pinsel gezogen, gingen gegen den Rand hin in reine Strich-Ornamentik über, hatten aber auf dem größeren Teil der gewölbten Fläche in ihrer sorgfältigen Kompliziertheit das entschiedenste Ansehen von Verständigungsmalen. Meiner Erinnerung nach zeigten sie starke Ähnlichkeit mit früh-orientalischen Schriftarten, etwa dem alt-aramäischen Duktus, und tatsächlich musste mein Vater seinem Freunde aus der gar nicht übel versehenen Stadtbibliothek von Kaisersaschern archäologische Bücher mitbringen, die die Möglichkeit der Nachforschung, des Vergleiches boten. Selbstverständlich führten diese Studien zu keinem Ergebnis oder doch nur zu so wirren und widersinnigen, dass sie auf nichts hinausliefen. Mit einer gewissen Melancholie gab Jonathan dies auch zu, wenn er uns die rätselhafte Abbildung zeigte. »Es hat sich«, sagte er, »die Unmöglichkeit erwiesen, dem Sinn dieser Zeichen auf den Grund zu kommen. Leider, meine Lieben, ist dem so. Sie entziehen sich unserem Verständnis, und es wird schmerzlicherweise dabei wohl bleiben. Wenn ich aber sage sie ›entziehen sich‹, so ist das eben nur das Gegenteil von ›sich erschließen‹, und dass die Natur diese Chiffern, zu denen uns der Schlüssel fehlt, der bloßen Zier wegen auf die Schale ihres Geschöpfes gemalt haben sollte, redet mir niemand ein. Zier und Bedeutung liefen stets nebeneinander her, auch die alten Schriften dienten dem Schmuck und zugleich der Mitteilung. Sage mir keiner, hier werde nicht etwas mitgeteilt! Dass es eine unzugängliche Mitteilung ist, in diesen Widerspruch sich zu versenken, ist auch ein Genuss.«
Bedachte er, dass, wenn es sich wirklich hier um eine Geheimschrift hätte handeln sollen, die Natur über eine eigene, aus ihr selbst geborene, organisierte Sprache verfügen müsste? Denn welche vom Menschen erfundene sollte sie wählen, um sich auszudrücken? Schon damals aber, als Knabe, begriff ich sehr deutlich, dass die außerhumane Natur von Grund aus illiterat ist, was in meinen Augen eben gerade ihre Unheimlichkeit ausmacht.
Ja, Vater Leverkühn war ein Spekulierer und Sinnierer, und ich sagte schon, dass sein Forscherhang – wenn man von Forschung sprechen kann, wo es sich eigentlich nur um träumerische Kontemplation handelte – sich immer in eine bestimmte Richtung neigte, nämlich die mystische oder eine ahnungsvoll halb-mystische, in die, wie mir scheint, der dem Natürlichen nachgehende menschliche Gedanke fast mit Notwendigkeit gelenkt wird. Dass nun gar das Unterfangen, mit der Natur zu laborieren, sie zu Phänomenen zu reizen, sie zu »versuchen«, indem man ihr Wirken durch Experimente bloßstellt – dass das alles ganz nahe mit Hexerei zu tun habe, ja schon in ihr Bereich falle und selbst ein Werk des »Versuchers« sei, war die Überzeugung früherer Epochen: eine respektable Überzeugung, wenn man mich fragt. Ich möchte wissen, mit welchen Augen man damals den Mann aus Wittenberg angesehen hätte, der, wie wir von Jonathan hörten, vor hundert und einigen Jahren das Experiment der sichtbaren Musik erfunden hatte, das wir zuweilen zu sehen bekamen. Zu den wenigen physikalischen Apparaten, über die Adrians Vater verfügte, gehörte eine runde und frei schwebende, nur in der Mitte auf einem Zapfen ruhende Glasplatte, auf der dieses Wunder sich abspielte. Die Platte war nämlich mit feinem Sande bestreut, und vermittelst eines alten Cellobogens, mit dem er von oben nach unten an ihrem Rande hinstrich, versetzte er sie in Schwingungen, nach welchen der erregte Sand sich zu erstaunlich präzisen und mannigfachen Figuren und Arabesken verschob und ordnete. Diese Gesichtsakustik, worin Klarheit und Geheimnis, das Gesetzliche und Wunderliche reizvoll genug zusammentraten, gefiel uns Knaben sehr; aber nicht zuletzt um dem Experimentator eine Freude zu machen, baten wir ihn öfters, sie uns vorzuführen.
Ein verwandtes Gefallen fand er an Eisblumen und halbe Stunden lang konnte er sich an Wintertagen, wenn diese kristallischen Niederschläge die bäuerlich kleinen Fenster des Buchelhauses bedeckten, mit bloßem Auge und durch sein Vergrößerungsglas, in ihre Struktur vertiefen. Ich möchte sagen: Alles wäre gut gewesen und man hätte darüber zur Tagesordnung übergehen können, wenn die Erzeugnisse sich, wie es ihnen zukam, im Symmetrisch-Figürlichen, streng Mathematischen und Regelmäßigen gehalten hätten. Aber dass sie mit einer gewissen gaukelnden Unverschämtheit Pflanzliches nachahmten, aufs wunderhübscheste Farnwedel, Gräser, die Becher und Sterne von Blüten vortäuschten, dass sie mit ihren eisigen Mitteln im Organischen dilettierten, das war es, worüber Jonathan nicht hinwegkam, und worüber seines gewissermaßen missbilligenden, aber auch bewunderungsvollen Kopfschüttelns kein Ende war. Bildeten, so lautete seine Frage, diese Phantasmagorien die Formen des Vegetativen vor, oder bildeten sie sie nach? Keines von beidem, antwortete er wohl sich selbst; es waren Parallelbildungen. Die schöpferisch träumende Natur träumte hier und dort dasselbe, und durfte von Nachahmung die Rede sein, so gewiss nur von wechselseitiger. Sollte man die wirklichen Kinder der Flur als die Vorbilder hinstellen, weil sie organische Tiefenwirklichkeit besaßen, die Eisblumen aber bloße Erscheinungen waren? Aber ihre Erscheinung war das Ergebnis keiner geringeren Kompliziertheit stofflichen Zusammenspiels, als diejenige der Pflanzen. Verstand ich unseren Gastfreund recht, so war, was ihn beschäftigte, die Einheit der belebten und der sogenannten unbelebten Natur, es war der Gedanke, dass wir uns an dieser versündigen, wenn wir die Grenze zwischen beiden Gebieten allzu scharf ziehen, da sie doch in Wirklichkeit durchlässig ist und es eigentlich keine elementare Fähigkeit gibt, die durchaus den Lebewesen vorbehalten wäre, und die nicht der Biologe auch am unbelebten Modell studieren könnte.
Auf eine wie verwirrende Art in der Tat die Reiche ineinander geistern, lehrte uns der »Fressende Tropfen«, dem Vater Leverkühn mehr als einmal vor unseren Augen seine Mahlzeit verabreichte. Ein Tropfen, bestehe er nun aus was immer, aus Paraffin, aus ätherischem Öl – ich erinnere mich nicht mit Bestimmtheit, woraus dieser bestand, ich glaube, es war Chloroform –, ein Tropfen, sage ich, ist kein Tier, auch kein primitivstes, nicht einmal eine Amöbe, man nimmt nicht an, dass er Appetit verspürt, Nahrung zu ergreifen, das Bekömmliche zu behalten, das Unbekömmliche abzulehnen weiß. Ebendies aber tat unser Tropfen. Er hing abgesondert in einem Glase Wasser, worin Jonathan ihn, vermutlich mit einer feinen Spritze, untergebracht hatte. Was er nun tat, war Folgendes. Er nahm ein winziges Glasstäbchen, eigentlich nur ein Fädchen von Glas, das er mit Schellack bestrichen hatte, zwischen die Spitzen einer Pinzette und führte es in die Nähe des Tropfens. Nur das war es, was jener tat, das übrige tat der Tropfen. Er warf an seiner Oberfläche eine kleine Erhöhung, etwas wie einen Empfängnishügel auf, durch den er das Stäbchen der Länge nach in sich aufnahm. Dabei zog er sich selbst in die Länge, nahm Birnengestalt an, damit er seine Beute ganz einschließe und diese nicht an den Enden über ihn hinausrage, und begann, ich gebe jedermann mein Wort darauf, indem er allmählich sich wieder rundete, zunächst eine Ei-Form annahm, den Schellackaufstrich des Glasstäbchens abzuspeisen und in seinem Körperchen zu verteilen. Dies vollendet, beförderte er, zur Kugelgestalt zurückkehrend, das saubergeschleckte Darreichungsgerät querhin an seine Peripherie und wieder ins umgebende Wasser hinaus.
Ich kann nicht behaupten, dass ich das gerne sah, aber ich gebe zu, dass ich gebannt davon war, und das war wohl auch Adrian, obgleich er immer bei solchen Vorführungen sehr stark zum Lachen versucht war und es allein aus Rücksicht auf den väterlichen Ernst unterdrückte. Allenfalls konnte man den fressenden Tropfen komisch finden; aber keineswegs war dies für mein Empfinden der Fall bei gewissen unglaublichen und geisterhaften Naturerzeugnissen, die dem Vater in sonderbarster Kultur zu züchten gelungen war, und die er uns ebenfalls zu betrachten gestattete. Ich werde den Anblick niemals vergessen. Das Kristallisationsgefäß, in dem er sich darbot, war zu Dreivierteln mit leicht schleimigem Wasser, nämlich verdünntem Wasserglas gefüllt, und aus sandigem Grunde strebte darin eine groteske kleine Landschaft verschieden gefärbter Gewächse empor, eine konfuse Vegetation blauer, grüner und brauner Sprießereien, die an Algen, Pilze, festsitzende Polypen, auch an Moose, dann an Muscheln, Fruchtkolben, Bäumchen oder Äste von Bäumchen, da und dort geradezu an Gliedmaßen erinnerten – das Merkwürdigste, was mir je vor Augen gekommen: merkwürdig, nicht so sehr um seines allerdings sehr wunderlichen und verwirrenden Ansehens willen, als wegen seiner tief melancholischen Natur. Denn wenn Vater Leverkühn uns fragte, was wir davon hielten, und wir ihm zaghaft antworteten, es möchten Pflanzen sein – »nein«, erwiderte er, »es sind keine, sie tun nur so. Aber achtet sie darum nicht geringer! Eben dass sie so tun und sich aufs beste darum bemühen, ist jeglicher Achtung würdig.«
Es stellte sich heraus, dass diese Gewächse durchaus unorganischen Ursprungs waren, mit Hilfe von Stoffen zustandegekommen, die aus der Apotheke »Zu den Seligen Boten« stammten. Den Sand am Boden des Gefäßes hatte Jonathan, bevor er die Wasserglaslösung nachgoss, mit verschiedenen Kristallen, es waren, wenn ich nicht irre, solche von chromsaurem Kali und Kupfersulfat, bestreut, und aus dieser Saat hatte sich als Werk eines physikalischen Vorgangs, den man als »osmotischen Druck« bezeichnet, die bemitleidenswerte Zucht entwickelt, für die ihr Betreuer unsere Sympathie sogleich noch dringlicher in Anspruch nahm. Er zeigte uns nämlich, dass diese kummervollen Imitatoren des Lebens lichtbegierig, »heliotropisch« waren, wie die Wissenschaft vom Leben es nennt. Er setzte für uns das Aquarium dem Sonnenlicht aus, indem er drei seiner Seiten gegen dasselbe zu verschatten wusste, und siehe, nach derjenigen Scheibe des Glasgefäßes, durch die das Licht einfiel, neigte sich binnen kurzem die ganze fragwürdige Sippschaft, Pilze, phallische Polypenstengel, Bäumchen und Algengräser nebst halbgeformten Gliedmaßen, und zwar mit so sehnsüchtigem Drängen nach Wärme und Freude, dass sie sich förmlich an die Scheibe klammerten und daran festklebten.
»Und dabei sind sie tot«, sagte Jonathan und bekam Tränen in die Augen, während Adrian, wie ich wohl sah, von unterdrücktem Lachen geschüttelt wurde.
Für mein Teil muss ich anheimstellen, ob dergleichen zum Lachen oder zum Weinen ist. Das eine nur sage ich: Gespenstereien wie diese sind ausschließlich Sache der Natur, und zwar besonders der vom Menschen mutwillig versuchten Natur. Im würdigen Reiche der Humaniora ist man sicher vor solchem Spuk.
IV
Da der vorige Abschnitt ohnedies über Gebühr angeschwollen ist, tue ich gut, einen neuen zu eröffnen, um doch auch mit einigen Worten dem Bilde der Buchel-Wirtin, Adrians lieber Mutter, zu huldigen. Möge es immer sein, dass die Dankbarkeit, die man für seine Kindheit empfindet, dazu die schmackhaften Imbisse, die sie uns auftischte, dieses Bild verklären – ich sage doch, dass mir in meinem Leben keine anziehendere Frau vorgekommen ist als Elsbeth Leverkühn, und ich spreche von ihrer schlichten, intellektuell durchaus anspruchslosen Person mit der Ehrerbietung, die die Überzeugung mir einflößt, dass das Genie des Sohnes der vitalen Wohlschaffenheit dieser Mutter viel zu danken hatte.
Wenn es mir Freude machte, den schönen altdeutschen Kopf ihres Gatten zu betrachten – auf ihrer so ganz und gar angenehmen, eigentümlich bestimmten und klar proportionierten Erscheinung verweilten meine Augen nicht weniger gern. Aus der Gegend von Apolda gebürtig, war sie so brünetten Typs, wie es in deutschen Landen zuweilen vorkommt, ohne dass die erfassbare Genealogie eine Handhabe zur Annahme römischen Bluteinschlages böte. Der Dunkelheit ihres Teints, der Schwärze ihres Scheitels und ihrer still und freundlich blickenden Augen nach hätte man sie für eine Welsche halten können, wenn nicht doch eine gewisse germanische Derbheit der Gesichtsbildung dem widersprochen hätte. Es bildete ein ziemlich kurzes Oval, dieses Gesicht, mit eher spitz zulaufendem Kinn, einer nicht eben regelmäßigen, leicht eingedrückten, vorn etwas aufgehobenen Nase und einem geruhigen, ohne Üppigkeit noch Schärfe geschnittenen Mund. Der die Ohren zur Hälfte bedeckende Scheitel, von dem ich sprach, und der sich, während ich heranwuchs, langsam versilberte, war sehr straff gezogen, so dass er spiegelte, und die Teilungslinie über der Stirn die weiße Kopfhaut bloßlegte. Trotzdem hing – nicht immer und also wohl nicht absichtlich – einiges loses Haar vor den Ohren sehr anmutig davon herunter. Der in unseren Kindertagen noch massige Zopf war nach bäuerlicher Art um den Hinterkopf geschlungen und an Festtagen wohl von einem farbig gestickten Bande durchzogen.
Städtische Kleidung war so wenig ihre wie ihres Mannes Sache; das Damenhafte stand ihr nicht an, ausgezeichnet dagegen die ländlich-halbkostümliche Tracht, in der wir sie kannten, der feste, wie wir sagten: eigengemachte Rock, eine Art von bordiertem Mieder dazu, dessen eckiger Ausschnitt den einigermaßen gedrungenen Hals und den oberen Teil der Brust frei ließ, auf dem wohl ein einfacher, leichter Goldschmuck lag. Die bräunlichen, an Tätigkeit gewöhnten, aber so wenig groben wie überpflegten Hände, mit dem Ehereif an der Rechten, hatten, ich möchte sagen: etwas so menschlich Richtiges und Zuverlässiges, dass man ihnen mit Vergnügen zusah, ebenso wie den bestimmt auftretenden, nicht großen und nicht zu kleinen, rechtschaffenen Füßen in den bequemen Schuhen mit flachen Absätzen und den grünen oder grauen Wollstrümpfen, die die wohlgebildeten Knöchel umspannten. Dies alles war angenehm. Das Schönste an ihr aber war ihre Stimme, der Lage nach ein warmer Mezzo-Sopran und in der Sprachbehandlung, bei leicht thüringisch gefärbter Lautbildung, ganz außerordentlich gewinnend. Ich sage nicht: »einschmeichelnd«, weil darin etwas von Absicht und Bewusstheit läge. Dieser Stimmreiz kam aus einer inneren Musikalität, die im übrigen latent blieb, da Elsbeth sich um Musik nicht kümmerte, sich sozusagen nicht zu ihr bekannte. Es kam vor, dass sie, ganz nebenbei, auf der alten Gitarre, die einen Wandschmuck des Wohnzimmers bildete, einige Akkorde griff und auch wohl eine oder die andere abgerissene Strophe eines Liedes dazu summte; aber auf eigentliches Singen ließ sie sich nicht ein, wiewohl ich wetten möchte, dass hier das trefflichste Material zu entwickeln gewesen wäre.
Auf jeden Fall habe ich niemals lieblicher sprechen hören, obgleich, was sie sagte, stets nur das Einfachste und Sachlichste war; und meiner Meinung nach will es etwas heißen, dass dieser natürliche und von instinktivem Geschmack bestimmte Wohllaut von der ersten Stunde an mütterlich Adrians Ohr berührt hat. Für mich trägt es zur Erklärung des unglaublichen Klangsinnes bei, der sich in seinem Werk manifestiert, wenn auch der Einwand nahe liegt, dass sein Bruder Georg desselben Vorzugs genoss, ohne dass es irgendwelchen Einfluss auf die Gestaltung seines Lebens geübt hätte. Er sah übrigens dem Vater ähnlicher, während Adrians Physis viel mehr von der Mutter hatte – wozu es nun wieder nicht stimmen will, dass es Adrian war, der die Neigung zur Migräne vom Vater geerbt hatte, und nicht Georg. Aber der Gesamthabitus des teuren Toten nebst vielen Einzelheiten: der brünette Teint, der Augenschnitt, die Mund- und Kinnbildung, alles kam von Mutters Seite, besonders deutlich, solange er glattrasiert ging, also bevor er sich den stark verfremdenden Knebelbart wachsen ließ, was ja erst in späteren Jahren geschah. Das Pechschwarz der mütterlichen und der Azur der väterlichen Iris hatte sich in seinen Augen zu einem schattigen Blau-Grau-Grün vermischt, das kleine metallische Einsprengsel, dazu einen rostfarbenen Ring um die Pupillen zeigte; und immer war es mir eine seelische Gewissheit, dass es der Gegensatz zwischen den elterlichen Augen und die Mischung war, die ihre Farbe in den seinen eingegangen, was sein Schönheitsurteil in dieser Beziehung schwankend machte und ihn sein Leben lang nicht zur Entscheidung darüber kommen ließ, welchen Augen, den schwarzen oder blauen, er bei anderen den Vorzug gäbe. Immer aber war es das Extrem, der Teerglanz zwischen den Lidern oder das Lichtblau, was ihn bestach. –
Der Einfluss Frau Elsbeths auf das Hofgesinde von Buchel, das in wirtschaftlich ruhigen Jahreszeiten nicht eben zahlreich war und nur zur Erntezeit aus der umwohnenden Landbevölkerung vermehrt wurde, war der allerbeste und, wenn ich recht gesehen habe, ihre Autorität bei diesen Leuten sogar größer als die ihres Gatten. Das Bild einiger von ihnen schwebt mir noch vor: die Figur des Pferdeknechtes Thomas zum Beispiel, desselben, der uns vom Bahnhof Weißenfels abzuholen und wieder dorthin zu bringen pflegte, eines einäugigen, ausnehmend knochigen und langen, dabei aber, hoch oben, mit einem Höcker behafteten Menschen, auf dem er den kleinen Adrian öfters herumreiten ließ: Es sei, hat mir der Meister später noch oft versichert, ein sehr praktischer und bequemer Sitz gewesen. Ferner gedenke ich einer Stallmagd namens Hanne, einer Person mit Schlotterbusen und nackten, ewig mistigen Füßen, mit der der Knabe Adrian aus noch näher zu bezeichnendem Grunde ebenfalls eine nähere Freundschaft unterhielt, und der Verwalterin des Molkereiwesens, Frau Luder, einer haubentragenden Witwe, deren ungewöhnlich würdevoller Gesichtsausdruck zu einem Teil wohl der Verwahrung gegen ihren Namen galt, daneben aber auf die Tatsache zurückzuführen war, dass sie sich auf die Herstellung anerkannt vorzüglicher Kümmelkäse verstand. Sie war es, wenn nicht die Hausfrau selbst, die uns im Kuhstall bewirtete, diesem gütevollen Aufenthalt, wo unter den Strichen der auf dem Melkschemel kauernden Magd, die laue und schäumende, nach dem nutzbaren Tiere duftende Milch für uns in die Gläser rann.
Ich würde mich in Einzelerinnerungen an diese ländliche Kinderwelt nebst der umliegenden einfachen Szenerie von Feld und Wald, Teich und Hügel gewiss nicht verlieren, wenn es nicht eben die Früh-Umwelt Adrians bis zu seinem zehnten Jahre, sein Elternhaus, seine Ursprungslandschaft gewesen wäre, die mich so häufig mit ihm zusammen einschloss. Es war die Zeit, in der unser »du« wurzelte, und in der auch er mich mit Vornamen genannt haben muss – ich höre es nicht mehr, aber es ist undenkbar, dass der Sechs- und Achtjährige nicht ebenso gut »Serenus«, oder einfach »Seren« zu mir gesagt haben sollte, wie ich zu ihm »Adri«. Der Zeitpunkt lässt sich nicht feststellen, aber er muss schon in unsere frühe Schülerzeit gefallen sein, wo er aufhörte, mir dies zu gewähren und mich, wenn überhaupt, so nur noch mit Nachnamen anredete, während es mir vollkommen harsch und unmöglich erschienen wäre, ihm mit Gleichem zu erwidern. So war es – und es fehlte nur, dass es aussähe, als wollte ich mich beklagen. Nur eben erwähnenswert schien es mir, dass ich ihn »Adrian«, er dagegen mich, wenn er nicht überhaupt einer Namensverwendung auswich, »Zeitblom« nannte. – Lassen wir denn das kuriose Faktum, an das ich mich durchaus gewöhnt hatte, und kehren wir nach Buchel zurück!
Sein Freund, und auch meiner, war der Hofhund Suso – er führte sonderbarerweise diesen Namen –, eine etwas schäbige Bracke, die, wenn man ihr die Mahlzeit brachte, breit über das ganze Gesicht zu lachen pflegte, aber für Fremde keineswegs ungefährlich war und das eigentümliche Leben des tagsüber an seine Hütte zu seinen Schüsseln gebannten Kettenhundes führte, der nur in stiller Nacht frei auf dem Hofe umherschweift. Zusammen blickten wir in das sudelige Gedränge des Schweinekobens, wohl eingedenk alter Magdgeschichten, dass diese unreinlichen Pfleglinge mit den listigen, blondbewimperten Blauäuglein und den menschenfarbenen Speckleibern gelegentlich kleine Kinder fräßen, zwangen unsere Kehlen, das untergründige Nuck-Nuck ihrer Sprache nachzuahmen und betrachteten das rosige Gewuzel des Ferkelwurfes an den Zitzen der Muttersau. Zusammen belustigten wir uns an dem pedantischen, von würdig-gemäßigten Lauten begleiteten und nur zuweilen ins Hysterische ausbrechenden Leben und Treiben des Hühnervolkes hinter seinem Drahtgitter und statteten den Bienenwohnungen hinterm Hause zurückhaltende Besuche ab, bekannt mit dem nicht unerträglichen, aber dröhnenden Schmerz, den es verursachte, wenn eine dieser Sammlerinnen sich dir auf die Nase verirrte und zum Stiche sich unklug bemüßigt fand.
Ich gedenke der Johannisbeeren des Nutzgartens, deren Fruchtstengel wir durch die Lippen zogen, des Sauerampfers der Wiese, den wir kosteten, gewisser Blüten, aus deren Hals wir ein Spürchen feinen Nektars zu saugen wussten, der Eicheln, die wir im Wald, auf dem Rücken liegend, kauten, der purpurnen, sonnerwärmten Brombeeren, die wir am Weg von den Büschen lasen, und deren herber Saft unseren Kinderdurst stillte. Wir waren Kinder – nicht aus Eigenempfindsamkeit, sondern um seinetwillen, beim Gedanken an sein Geschick, an den ihm bestimmten Aufstieg aus dem Tale der Unschuld in unwirtliche, ja schauerliche Höhen, bewegt mich der Rückblick. Es war ein Künstlerleben; und weil mir, dem schlichten Manne, beschieden war, es aus solcher Nähe zu sehen, hat sich alles Gefühl meiner Seele für Menschenleben und -los auf diese Sonderform menschlichen Daseins versammelt. Sie gilt mir, dank meiner Freundschaft mit Adrian, als das Paradigma aller Schicksals-Gestaltung, als der klassische Anlass zur Ergriffenheit von dem, was wir Werden, Entwicklung, Bestimmung nennen – und das mag sie denn wirklich wohl sein. Denn obwohl der Künstler seiner Kindheit zeitlebens näher, um nicht zu sagen: treuer bleiben mag, als der im Praktisch-Wirklichen spezialisierte Mann; obgleich man sagen kann, dass er, ungleich diesem, in dem träumerisch-reinmenschlichen und spielenden Zustand des Kindes dauernd verharrt, so ist doch sein Weg aus unberührter Frühzeit bis zu den späten, ungeahnten Stadien seines Werdens unendlich weiter, abenteuerlicher, für den Betrachter erschütternder, als der des bürgerlichen Menschen, und nicht halb so tränenvoll ist bei diesem der Gedanke, dass auch er einmal ein Kind gewesen.
Dringend bitte ich übrigens den Leser, was ich da mit Gefühl gesagt habe, durchaus auf meine, des Schreibenden, Rechnung zu setzen und nicht etwa zu glauben, es sei in Leverkühns Sinne gesprochen. Ich bin ein altmodischer Mensch, stehen geblieben bei gewissen, mir lieben romantischen Anschauungen, zu denen auch der pathetisierende Gegensatz von Künstlertum und Bürgerlichkeit gehört. Adrian hätte einer Äußerung, wie der vorstehenden, kühl widersprochen – wenn er es überhaupt der Mühe wert gefunden hätte, ihr zu widersprechen. Denn er hatte über Kunst und Künstlertum äußerst nüchterne, ja, reaktiverweise, schneidende Meinungen und war dem »romantischen Brimborium«, das damit anzustellen der Welt eine Zeitlang beliebt habe, so abhold, dass er sogar die Wörter »Kunst« und »Künstler« nicht gerne hörte, wie man deutlich seinem Gesichte ansah, wenn sie fielen. Ebenso war es mit dem Worte »Inspiration«, das man in seiner Gesellschaft durchaus zu vermeiden und allenfalls durch »Einfall« zu ersetzen hatte. Er hasste und verspottete jenes Wort – und ich kann nicht umhin, die Hand von dem meiner Schrift vorgelagerten Löschblatt zu erheben und damit die Augen zu bedecken, da ich dieses Hasses und Spottes gedenke. Ach, sie waren zu gequält, um nur das unpersönliche Ergebnis geistig-zeitlicher Veränderungen zu sein. Diese allerdings waren wirksam darin, und ich erinnere mich, dass er schon als Student einmal zu mir sagte, das neunzehnte Jahrhundert müsse ein ungemein gemütliches Zeitalter gewesen sein, da es niemals einer Menschheit saurer geworden sei, sich von den Anschauungen und Gewohnheiten der vorigen Epoche zu trennen, als dem jetzt lebenden Geschlechte.
Des Teiches, der, weidenumstanden, nur zehn Minuten Weges vom Buchel-Hause entfernt lag, gedachte ich schon flüchtig. Er hieß die »Kuhmulde«, wohl wegen seiner oblongen Gestalt und weil gern die Kühe an sein Ufer zur Tränke schritten, und hatte, ich weiß nicht warum, auffallend kaltes Wasser, so dass wir nur, wenn die Sonne sehr lange darauf gestanden, zu Nachmittagsstunden, darin baden durften. Den Hügel angehend, so war es bis zu ihm schon ein – gern unternommener – Spaziergang von einer halben Stunde. Die Anhöhe hieß, gewiss seit sehr alten Tagen, aber ganz unangemessenerweise, der »Zionsberg« und war zur Winterszeit, die mich aber selten dort draußen sah, zum Rodeln gut. Im Sommer bot sie, mit dem Kranze schattender Ahorne auf ihrem »Gipfel« und der dort auf Gemeindekosten errichteten Ruhebank einen luftigen, übersichtlichen Aufenthalt, dessen ich mich an Sonntag-Nachmittagen, vor der Abendmahlzeit, zusammen mit der Leverkühnschen Familie oft erfreute.
Nun stehe ich aber unter dem Zwange, das Folgende anzumerken. Der landschaftlich-häusliche Rahmen, in den Adrian später, als reifer Mann, sein Leben stellte, nämlich als er zu Pfeiffering bei Waldshut in Oberbayern im Hause der Schweigestills sein Dauerquartier hatte, stand zu demjenigen seiner Kindheit in der seltsamsten Ähnlichkeits- und Wiederholungsbeziehung, anders gesagt: der Schauplatz seiner späteren Tage war eine kuriose Nachahmung desjenigen seiner Frühzeit. Nicht genug, dass die Gegend von Pfeiffering (oder Pfeffering, die Schreibweise stand nicht ganz fest) einen mit einer Gemeindebank geschmückten Hügel aufwies, der allerdings nicht »Zionsberg«, sondern »der Rohmbühel« hieß; nicht genug, dass auch, und zwar in ziemlich gleicher Entfernung vom Wirtshofe, wie die »Kuhmulde«, ein Teich vorhanden war, hier der »Klammerweiher« geheißen und ebenfalls sehr kalten Wassers. Nein, auch Haus, Hof und Familienverhältnisse korrespondierten schlagend mit denen von Buchel. Auf dem Hof wuchs ein Baum, auch etwas hinderlich und auch aus Gemütsgründen bewahrt – es war keine Linde, es war eine Ulme. Zugegeben, dass charakteristische Unterschiede zwischen der Bauart des Hauses Schweigestill und derjenigen von Adrians Elternhaus bestanden, da jenes ein altes Klostergebäude mit dicken Mauern, tiefen, gewölbten Fensternischen und etwas moderigen Korridorgängen war. Aber die Knasterwürze der Pfeife des Hauswirtes schwängerte hier wie dort die Atmosphäre der unteren Räume, und dieser Hauswirt und seine Wirtin, Frau Schweigestill, waren »Eltern«, das heißt: sie waren ein langgesichtiger, eher wortkarger, sinnig-geruhiger Ackerbürger und eine auch schon zu Jahren gekommene, allenfalls etwas überstattliche, aber reinproportionierte, geweckte, energisch zugreifende Frau mit straff angezogenem Scheitel und wohlgebildeten Händen und Füßen – die übrigens einen erwachsenen Erbsohn hatten, Gereon (nicht Georg) mit Namen, einen in Dingen der Wirtschaft sehr fortschrittlich gesinnten, auf neue Maschinen bedachten jungen Mann, und eine nachgeborene Tochter, Clementine genannt. Der Hofhund in Pfeiffering konnte ebenfalls lachen, wenn er auch nicht Suso, sondern Kaschperl hieß, wenigstens ursprünglich so geheißen hatte. Über dieses »ursprünglich« hatte nämlich der Mietgast des Hauses seine eigenen Ansichten, und ich war Zeuge des Vorganges, dass unter seinem Einfluss der Name Kaschperl allmählich zur bloßen Erinnerung wurde und der Hund selber schließlich lieber auf »Suso« hörte. – Ein zweiter Sohn war nicht vorhanden, was aber die Repetition eher bekräftigte, als dass es sie abgeschwächt hätte; denn wer hätte dieser zweite Sohn sein sollen?