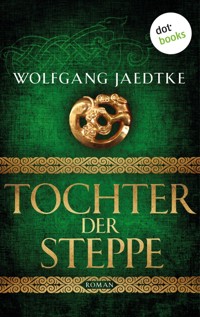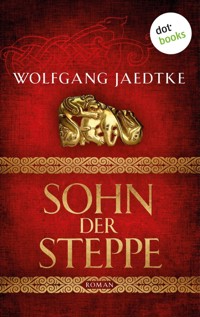6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper Schicksalsvoll
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Von der Geburt an aus der eigenen Familie verstoßen, wurde sie von Fremden aufgenommen und geliebt. Der neue große historische Roman vom Autor der erfolgreichen »Steppenwind«–Trilogie »So ist es also beschlossen: Das Dasein des unglücklichen Geschöpfs soll unser Geheimnis bleiben. Wenn es eine Chance hat, in die menschliche Gesellschaft zurückzukehren, dann liegt diese Chance bei uns. Was mich betrifft, so werde ich alles an Liebe und Güte geben, was eine dreifache Mutter aufbringen kann, wenn ihr das Schicksal unversehens ein viertes Kind zuführt.« Sachsen 1824: Die Freude ist groß, als ein unverhofftes Testament der armen Familie Haiden gestattet, einen fürstlichen Landsitz im Erzgebirge zu bewohnen. Als die fünfköpfige Familie dort einzieht, geschehen seltsame Dinge. Der Ort birgt ein dunkles Geheimnis, ein Mädchen wird immer wieder gesehen, es spricht nicht und verschwindet ins Nichts. Dem 17jährigen Sohn des Arztes gelingt es, mit dem scheuen Geschöpf Kontakt aufzunehmen, das sich als vollkommen verwildertes halbwüchsiges Mädchen herausstellt. Gelingt es der Familie, das Geheimnis um ihre Herkunft zu lüften?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher: www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Dornblüte« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2023
© by Wolfgang Jaedtke 2022
Redaktion: Sandra Lode
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: Giessel Design
Covermotiv: Bilder unter Lizenzierung von Shutterstock.com genutzt
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Erstes Kapitel: Das Vermächtnis
Zweites Kapitel: Eine Verschwörung
Drittes Kapitel: Der Prozess
Viertes Kapitel: Die Reise
Fünftes Kapitel: Johannas Tagebuch
Sechstes Kapitel: Jaspers Winter
Siebtes Kapitel: Josephines Frühling
Achtes Kapitel: Jaspers Entdeckungen
Neuntes Kapitel: Johannas Tagebuch
Zehntes Kapitel: Katzenwäsche
Elftes Kapitel: Carl Haidens Aufzeichnungen
Zwölftes Kapitel: Das Tagebuch des Barons
Dreizehntes Kapitel: Erinnerungen
Vierzehntes Kapitel: Johannas Tagebuch
Fünfzehntes Kapitel: Der Salonabend
Sechzehntes Kapitel: Die Entführung
Siebzehntes Kapitel: Der Kerker
Achtzehntes Kapitel: Die Anhörung
Neunzehntes Kapitel: Die Abwesenheit
Zwanzigstes Kapitel: Johannas Tagebuch
Einundzwanzigstes Kapitel: Im Keller
Zweiundzwanzigstes Kapitel: Josephines Herbst
Dreiundzwanzigstes Kapitel: Rosenfrühling
Nachweise von Zitaten und verwendeter Literatur
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Erstes Kapitel: Das Vermächtnis
Als Carl Haiden an einem trüben Septembertag des Jahres 1824 die Gohlitzer Straße hinabschritt, mit einer Hand die Krempe seines Zylinders gegen den Wind festhaltend, ahnte er nichts Böses. Ein abergläubischerer Mensch als er hätte vielleicht an Vorzeichen geglaubt, denn es schien, als hätten sich alle Mächte der Natur zum Hinweis auf bevorstehendes Unglück verschworen: Der Himmel über Leipzig war grau wie Blei, es nieselte, und der Wind trieb tote Platanenblätter über das Pflaster. Doch Carl war nicht abergläubisch. Er war Arzt und ein Mann der Wissenschaft.
Sein Ziel war ein vornehmes, mehrstöckiges Haus am Ende der Straße. Es hatte elf Zimmer, Fenster mit Seidengardinen und eine Fassade mit Zinnen. Der herrschaftliche Bau wurde nur von zwei Personen bewohnt: der alten Baronin von Siebenfels und ihrem Enkel. Carls Blick wanderte hinauf zum Fenster der Bibliothek, wo sich der junge Baron gewöhnlich aufzuhalten pflegte, wenn er seinen Arzt empfing. Der Vorhang war zugezogen, was am Tage ungewöhnlich war.
Carl stieg die Freitreppe hinauf, ergriff den schweren bronzenen Klopfer und lauschte dem dumpfen Hall der Eichentür. Er brauchte nicht lange zu warten. Das Dienstmädchen empfing den Besucher mit nervös gerötetem Gesicht.
»Gott sei gedankt, dass Sie da sind, Herr Doktor!«, sagte Marie, während sie seinen Hut entgegennahm. »Der junge Herr ist heute nicht zum Frühstück erschienen. Er hat sich in der Bibliothek eingeschlossen.«
Carl sah sie erstaunt an. »Haben Sie geklopft?«
»Natürlich, aber er gibt keine Antwort. Die gnädige Frau macht sich Sorgen.«
Nun war auch Carl ein wenig beunruhigt. Er folgte dem Mädchen die Treppe hinauf. Vor der Tür zur Bibliothek blieb sie stehen, um ihm den Vortritt zu lassen.
»Herr Baron?« Carl klopfte, wartete und rief erneut. Keine Antwort.
»Er muss dort drin sein«, sagte das Dienstmädchen beklommen. »Sein Bett ist leer, und seit gestern hat niemand mehr das Haus verlassen. Ich habe alle Räume abgesucht.«
In Carls Innerem begann es zu rumoren. Nun war es da: ein Vorgefühl drohenden Unheils.
»Marie, bitte bringen Sie mir irgendetwas, womit wir die Tür aufstemmen können. Ein Schürhaken wird genügen.«
Das Mädchen nickte und verschwand wieder im Erdgeschoss. Carl wartete mit klopfendem Herzen auf ihre Rückkehr. Er nahm den Schürhaken in Empfang, keilte das Ende zwischen Schloss und Rahmen und stemmte sich mit seinem ganzen Gewicht dagegen. Schneller als erwartet gab das Schloss nach. Die Tür flog nach innen auf und gab den Blick auf die Bibliothek frei, die Carl schon viele Male gesehen hatte: schwere Regale an sämtlichen Wänden, ein klauenfüßiger Tisch, ein altmodischer Sekretär. Auf dem Stuhl davor saß Baron Ferdinand mit dem Rücken zur Tür. Sein Körper war halb von der Sitzfläche gerutscht, ein Arm baumelte an der rechten Seite, und der Kopf ruhte nicht an der Lehne, sondern war ihm auf die Brust gesunken.
Das Dienstmädchen schlug beide Hände vor den Mund und wich zurück. Carl war nicht weniger entsetzt, doch für den Augenblick verdrängte der Instinkt des Arztes seinen Schrecken. Er eilte auf den Sitzenden zu. Das junge Gesicht des Barons wirkte friedlich und entspannt. Aus einem Mundwinkel war etwas Speichel geronnen und zeigte an, dass er schon lange nicht mehr bei Bewusstsein war. Carl tat, was er tun musste, vorläufig ohne Gefühle zuzulassen. Er sprach den Leblosen an, rüttelte ihn, fühlte den Puls zunächst am Arm, dann an der Halsschlagader. Doch es gab keinen Zweifel: Ferdinand von Siebenfels war tot.
»Marie.« Carl wandte sich zu dem Mädchen um. »Benachrichtigen Sie die Gendarmen! Wenn Sie keinen auf der Straße finden, laufen Sie direkt zur Amtsmannschaft. Wissen Sie, wo das ist?«
Die junge Frau nahm langsam die Hände vom Mund. Sie war kalkweiß und zitterte, nickte aber. Offenbar gehörte sie zu jenen robusten Naturen, die selbst im Angesicht des Schreckens noch die Kraft fanden, das Notwendige zu tun. Sie fuhr herum und eilte mit gerafftem Rock davon.
Erst als Carl die Haustür zufallen hörte, traf ihn ein verspäteter Schock. Er fühlte seine Beine schwach werden, zog rasch einen Stuhl heran und ließ sich darauf sinken. Nun saß er neben dem jungen Baron, als studierte er zusammen mit diesem irgendein Schriftstück, das vor ihnen auf der Schreibplatte des Sekretärs lag. Carls Blick glitt dorthin – und er bemerkte ein einzelnes, eng beschriebenes Blatt, beschwert von einem Tintenfass. Es lag auf einem geschlossenen Quartheft, wie es viele Leute als Notizbuch verwendeten.
Carl erkannte die Überschrift: »Mein Letzter Wille«. Nie wäre er auf den Gedanken gekommen, das Dokument zu lesen, er sah es nur mit den Augen des Diagnostikers. Es verriet ebenso viel wie die leere Flasche aus bräunlichem Glas, die auf der seitlichen Ablagefläche des Sekretärs stand. Carl brauchte nicht einmal daran zu riechen, denn das Etikett war ihm zugewandt: Tinctura Opii. Laudanum.
Carl schloss die Augen und verschränkte die Hände. Er betete nicht, es war nur eine Geste der Trauer, denn in den allmächtigen Weltenlenker besaß er wenig Vertrauen. Er war vierzig Jahre alt und hatte zu viel Leid und Grauen gesehen, erst als junger Sanitätsarzt im Krieg, später an unzähligen Krankenbetten. Sein Glaube war ihm darüber schon früh abhandengekommen. Wie viele Wochen und Monate hatte er sich um den jungen Baron bemüht, wie sehr gehofft, dass er das Nervenleiden des armen Mannes lindern könnte. Doch kein Gott hatte eingegriffen, um diese bedauernswerte Seele vor dem Selbstmord zu retten. Wenn Gott existierte, hatte er es Carl überlassen – einem schwachen, fehlbaren Menschen, der nun für immer mit dem Bewusstsein seiner eigenen Unzulänglichkeit belastet war.
Furcht mischte sich in Carls Trauer. Er ahnte, dass es seine Aufgabe sein würde, der alten Baronin die Nachricht vom Tod ihres Enkels zu überbringen. Wahrscheinlich saß sie im Erdgeschoss auf dem Sofa des Salons und fragte sich, was der Aufruhr zu bedeuten hatte – das Krachen der Tür, die eiligen Schritte, das Verschwinden des Dienstmädchens. Sie würde sich gewiss nicht die Treppe heraufbemühen, sondern auf Nachricht warten. So schwer es ihm auch fiel, Carl musste die alte Frau vorwarnen, bevor die Gendarmen ins Haus kamen.
Er gab sich noch einige Minuten, um bei seinem Patienten zu bleiben und dessen kalte Hand in seiner zu halten. Armer Baron Ferdinand … er war erst einundzwanzig Jahre alt gewesen, in der Blüte seiner Jugend, Erbe eines stattlichen Vermögens und bis an ein fernes Lebensende versorgt, das nun nicht mehr kommen würde. Seine zarte Natur hatte ihn davon abgehalten, in die Armee einzutreten und eine Offizierslaufbahn einzuschlagen, wie es viele junge Männer seines Standes taten. Eher war er zum Gelehrten, vielleicht gar zum Künstler bestimmt gewesen. Er hatte Kohlezeichnungen und Aquarelle angefertigt, die durchaus Talent erkennen ließen. Frauen gegenüber war er scheu gewesen und hatte nie eine ernsthafte Absicht erkennen lassen, sich zu verloben oder gar zu heiraten. Ein wertvoller Mensch, dachte Carl: empfindsam, gebildet, von Wohlwollen gegenüber seinen Mitmenschen erfüllt. Warum nur hatte er geglaubt, sterben zu müssen? Und warum hatte Carl, sein Arzt, es weder kommen sehen noch verhindern können?
Carl gestattete sich keine Tränen, um nicht derangiert zu wirken, wenn er den pflichtgemäßen Gang ins Erdgeschoss antrat. Er tat es schließlich schweren Herzens. Am Fuß der Treppe angekommen, wandte er sich dem Durchgang zum Salon zu. Eigentlich hätte er sich anmelden müssen, aber das Mädchen war fort, und er hielt vergeblich Ausschau nach anderen Dienstboten. Doch seine Schritte waren bereits gehört worden, denn ein energischer Ruf ertönte.
»Marie?«
Es war die Baronin, er erkannte ihre Stimme. Carl fasste sich und klopfte an.
»Frau Baronin? Ich bin es, Doktor Haiden.«
Er vernahm keine Aufforderung zum Eintreten. Einen Augenblick verharrte er unschlüssig, dann öffnete er die Tür.
Der Salon war ein üppig ausgestattetes Zimmer mit hoher Decke. Weißer Stuck bedeckte alle freien Wandflächen. Es gab einen mächtigen Kamin mit gemeißelten Figuren, zahlreiche Schränke und Kommoden aus Mahagoni sowie eine Reihe behaglich gepolsterter Stühle. Zwischen zwei Fenstern, die sich zum rückwärtigen Garten öffneten, thronte ein großes Sofa mit Samtbezug, und darauf die alte Dame.
Auguste von Siebenfels, die Großmutter des Verstorbenen, war eine Frau in den Siebzigern, der das Alter vielleicht manches von ihrer einstigen Schönheit, nichts jedoch von ihrer Würde oder ihrem Stolz geraubt hatte. Selbst im Sitzen stützte sie sich auf ihren geschnitzten Stock, sodass sie trotz ihrer leicht zurückgelehnten Haltung immer noch aufrecht und spannkräftig wirkte. Dass sie sich selten anderswo als auf diesem Sofa aufhielt, war keinem Gebrechen geschuldet, sondern allein ihrer Überzeugung, dass Rang und Alter ihr einen solchen Lebensstil gestatteten. Sie trug ein gebauschtes Kleid aus schillerndem rotem Samt, dessen gestärkte Ärmel ihre Schultern imposant und kräftig wirken ließen, während ihr Gesicht mit den blitzenden blauen Augen von einem Kragen aus durchsichtiger Spitze eingefasst war. Das weiße Haar war mit mehreren Schleifen geschmückt und zu einem Turm aufgesteckt, der einer Festung als Bergfried zur Zierde gereicht hätte.
Carl trat ins Zimmer und verbeugte sich tief. Da stand er fast wie ein Dienstbote, der weder mit einer Begrüßung rechnete noch gar mit der Aufforderung, sich zu setzen.
»Was war das für ein Lärm?«, verlangte die Baronin zu wissen. »Wer hat sich da vorhin erlaubt, die Treppe hinabzupoltern wie ein Stallknecht?«
»Frau Baronin …« Carl suchte nach den richtigen Worten. »Bitte verzeihen Sie. Ich musste das Mädchen fortschicken, um die Gendarmerie zu benachrichtigen.«
»Die Gendarmerie?« Die alte Frau brachte es fertig, nicht im Mindesten erschrocken zu wirken. Nicht einmal ihre steife Haltung veränderte sich. »Wollen Sie sagen, dass in diesem Haus ein Verbrechen geschehen ist?«
»Kein Verbrechen, gnädige Frau. Ihr Enkel, der junge Herr Baron … er hat offenbar in der Nacht eine große Menge Laudanum zu sich genommen. Eine zu große Menge, selbst für seinen jungen Körper.«
Die eisblauen Augen der Baronin bohrten sich in seine.
»Ist er tot?«
Carl senkte den Blick, verharrte einen Moment und nickte schließlich. Er hatte schon manchen Müttern den Tod eines Kindes vermelden müssen, und nie war es eine leichte Aufgabe gewesen. Zumeist jedoch hatte die Schwierigkeit darin bestanden, dass er – als Arzt – naturgemäß den geringeren Schmerz empfand und sich bemühen musste, den ungleich schlimmeren der Angehörigen zu mildern. Diesmal schienen die Rollen auf eigentümliche Weise vertauscht. Während Carl nur mit Mühe die Tränen zurückhalten konnte, zeigte die Baronin keine sichtbare Regung. Nur ihr Atem ging etwas schneller und wurde als angespanntes Schnaufen durch die Nase hörbar.
»Und es besteht kein Zweifel?«, fragte sie mit energisch gebändigter Stimme.
Carl schüttelte den Kopf. »Marie sagte mir, dass er schon seit Stunden weder die Tür öffnete noch auf Rufe antwortete. Als wir mangels anderer Möglichkeiten das Schloss aufbrachen, saß er in seinem Sessel am Sekretär. Sein Puls war nicht mehr vorhanden, der Körper bereits ausgekühlt. Auf dem Pult stand eine leere Flasche Laudanum. Ich vermute, dass Sie wissen, was es mit diesem Mittel auf sich hat.«
»Selbstverständlich«, versetzte die Baronin. »Mein eigener Arzt verschreibt es mir als Schlafmittel.«
So also war das, dachte Carl. Er hatte sich bereits gefragt, wie der junge Baron zu der Droge gekommen war. Offenbar hatte sich Ferdinand an den Vorräten seiner Großmutter bedient. Carl hatte Laudanum stets nur zur Stillung von Schmerzen verabreicht, denn er wusste, dass viele Patienten davon abhängig wurden – und bei der Krankheit des Barons wäre er nie auf die Idee verfallen, ein solches Mittel zur Anwendung zu bringen.
»Das also«, sagte die Baronin kalt, »ist der Erfolg Ihrer Behandlung!«
Das war ein unverhohlener Vorwurf und traf Carl umso härter, als er selbst sich bittere Vorwürfe machte. Dennoch spürte er einen Anflug von Ärger angesichts der Gefühllosigkeit seines Gegenübers. Er hatte Trauer erwartet, vielleicht gar verzweifeltes Aufbegehren. Doch die Baronin schien den Tod ihres Enkels eher wie eine Art Unfall anzusehen, für den es einen Schuldigen zu finden galt. Carl wusste, dass dies keine gänzlich unnatürliche Reaktion war. Viele Hinterbliebene verarbeiteten ihren Verlust, indem sie ihre Klage zur Anklage steigerten, sei es gegen das Schicksal, gegen Gott oder auch gegen den Arzt. Noch nie jedoch war ihm ein Mensch begegnet, dessen Schmerz sich derart ausschließlich als Härte äußerte. Er fragte sich, ob diese Frau je in ihrem langen Leben eine Träne vergossen hatte. Was sollte er erwidern? Es schien ihm sinnlos, sich zu rechtfertigen, und offenbar wurde dies auch nicht von ihm erwartet. Stattdessen beschloss er, seine Schuld zu bekennen.
»Ich kann nicht in Worte fassen, wie sehr ich diesen Schlag bedaure, der nicht allein Ihnen, sondern auch mir die ganze Vergeblichkeit menschlichen Helfens und Hoffens vor Augen führt. Es gibt Krankheiten, gegen die Gott kein Heilmittel geschaffen hat, und denen auch die erfahrensten Ärzte nicht beizukommen wissen. Doch ich will mich der Verantwortung nicht entledigen, indem ich sie höheren Mächten zuweise. Ich tat, was ich für das Beste hielt, und es wird mir schwer genug fallen, mit dem Bewusstsein meiner Unzulänglichkeit zu leben.«
Er rechnete damit – hoffte beinahe darauf – hinausgewiesen und aus dieser schrecklichen Situation befreit zu werden. Doch es war die Türglocke, die ihn erlöste. Da keine Bediensteten zugegen waren, verbeugte er sich und eilte in die Eingangshalle, um eigenhändig zu öffnen. Das Dienstmädchen stand vor der Tür, mit roten Wangen und schwer atmend, begleitet von zwei Männern in der Uniform der königlichen Gendarmerie.
»Sind Sie Doktor Haiden?«, fragte einer der beiden.
Carl bejahte und wandte sich an Marie. »Bitte kümmern Sie sich um die gnädige Frau. Ich führe die Herrschaften nach oben.«
Zwei Stunden später saß Carl Haiden im Geschäftszimmer des Amtshauptmanns Heinrich Göppel. Er wusste kaum, wie er dorthin gekommen war. Die Untersuchung des Tatorts hatte nur wenige Minuten in Anspruch genommen, doch als die Gendarmen das auf dem Schreibpult liegende Testament in Augenschein genommen hatten, war einige Aufregung entstanden. Die Männer hatten einander vielsagende Blicke zugeworfen, und während der eine sich zum Gehen gewandt hatte, war der andere geblieben und hatte Carl zu verstehen gegeben, dass er den Raum nicht verlassen dürfe.
Einige Zeit später waren weitere Gendarmen sowie ein Assessor der königlichen Gerichtsbarkeit erschienen. Letzterer war vor Ort geblieben, während die Gendarmen Carl in knappen Worten eröffnet hatten, dass er zu einem sofortigen Verhör geladen sei. Sie hatten ihn hinausgeführt und in die Mitte genommen wie einen Verbrecher, um ihn auf geradem Weg zur Amtsmannschaft zu eskortieren. Dort hatte man ihn in ein kleines Zimmer gewiesen, wo er eine ganze Stunde gewartet hatte, allein auf einem unbequemen Stuhl und mit einer tickenden Wanduhr. Schließlich hatte ein Diener ihn in die Stube des Amtshauptmanns geführt.
Göppel, ein beleibter Mann um die sechzig, saß hinter einem schweren Mahagoni-Schreibtisch. Er erhob sich, als Carl eintrat, und nötigte den Gast, Platz zu nehmen. Er selbst blieb stehen und begann, hinter seinem Schreibtisch auf und ab zu gehen, die Hände auf dem Rücken verschränkt. Carl hatte den seltsamen Eindruck, als säße er im Publikum einer Theateraufführung und sähe einem Schauspieler zu, der sich zu einem Monolog anschickte.
»Ihr Name und Stand?«, verlangte Göppel zu wissen.
»Carl Friedrich Haiden, geboren am 17. Januar 1784 in Chemnitz. Ich bin Arzt.«
»Medicus oder Chirurg?«, fragte Göppel, während er seinen unruhigen Gang fortsetzte.
»Beides. Ich bin Absolvent der Königlichen Medizinakademie. Aber nach der großen Schlacht von 1813 waren so viele Verwundete in den Lazaretten, dass auch akademische Ärzte den Feldschern zur Hand gehen mussten. Dabei habe ich viele Dinge gelernt, die normalerweise nur Wundärzten obliegen, von der Einrichtung komplizierter Brüche bis zur Amputation. Bald darauf brach die große Typhus-Epidemie aus, an die Sie sich sicher erinnern werden. Man suchte händeringend Ärzte, und so wechselte ich in den städtischen Medizinaldienst – freilich nur für kurze Zeit, denn ich erkrankte selbst. Durch Glück oder Gottes Hilfe genas ich. Seit 1817 bin ich niedergelassener Arzt.«
»Ein bewegtes Leben«, urteilte der Amtshauptmann. Er blickte Carl offen an, und dieser hatte erstmals den Eindruck, dass der Beamte weniger streng als aufrichtig interessiert wirkte. Sein fleischiges Gesicht strahlte sogar eine Art verhaltener Vertraulichkeit aus. »Auch ich war beim großen Krieg dabei – Stabsoffizier.« Göppel tippte sich ans linke Ohr. »Noch heute höre ich auf dieser Seite schlecht. Kanoneneinschlag, direkt neben mir. Die Kameraden hat es bei lebendigem Leib zerrissen. Ich kam mit dem Schrecken davon. Haben Sie Familie?«
»Meine Frau Johanna, meine Tochter Josephine und meine Söhne Jasper und Nepomuk«, zählte Carl auf. »Der jüngste ist gerade sieben.«
Göppel hielt inne und setzte sich – endlich – auf seinen Stuhl. Die Geste schien zu besagen, dass es an der Zeit war, zur Sache zu kommen. »Sie waren der Arzt des jungen Barons?«
»Das war ich«, bestätigte Carl.
Göppel seufzte und sah nun endgültig nicht mehr wie ein strenger Inquisitor aus, sondern eher wie ein Mann, der sich einer unangenehmen Pflicht entledigen musste. Er schob einige Papiere auf seinem Schreibtisch hin und her und überflog offenbar einen Bericht, der ihm erst wenige Minuten vor Carls Eintritt vorgelegt worden war.
»Der Baron starb also durch eigene Hand … Ich muss Sie um genauere Auskunft über die Umstände bitten. Natürlich weiß ich, dass Ärzte gewöhnlich über die Leiden ihrer Patienten schweigen, doch in einem Fall wie diesem ist Ihre Aussage erforderlich.«
»Selbstverständlich«, stimmte Carl zu. »Baron Ferdinand handelte unter dem Einfluss einer schweren nervlichen Zerrüttung. Ich behandelte ihn deswegen schon seit Langem.«
»Eine Gemütskrankheit also?«
»So nennen wir es, weil bislang kein treffenderer Begriff für diese Art von Leiden existiert.«
»Wie kam es dazu, dass Sie ihn behandelten?«
»Seine Großmutter wandte sich an Johann Clarus, den berühmten Arzt an der Königlichen Medizinakademie. Ich darf sagen, dass ich mit Professor Clarus persönlich bekannt bin und viel von ihm gelernt habe. Daher empfahl er mich.«
»Auf welche Weise haben Sie den Baron behandelt?«
»Ich verordnete ihm ausgedehnte Spaziergänge und begleitete ihn dabei. Wir gingen stets bei hellem Tageslicht hinaus, da Sonnenschein belebend auf das Gemüt von Melancholikern wirkt. Zudem wollte ich erreichen, dass der Baron die Vereinsamung durchbrach, die ihn in sein Zimmer bannte und vom gesellschaftlichen Leben fernhielt.«
»Weiter haben Sie nichts getan? Sie sind nur mit ihm spazieren gegangen?«
Carl räusperte sich verlegen. »Ich weiß, dass meine Behandlungsmethoden als ungewöhnlich gelten. Zu meiner Rechtfertigung kann ich nur anführen, dass sie sich in zahlreichen Fällen von nervöser Zerrüttung als heilsam erwiesen haben.«
»Interessant«, meinte Göppel. »Im Fall des Barons jedoch waren Ihre Bemühungen offenbar nicht von Erfolg gekrönt.«
Carl seufzte. »Leider nicht. Anfangs besserte sich sein Befinden, und er versicherte mir oft, wie gut es ihm tue, mit mir zu wandern und zu sprechen. Auch wollte er die Behandlung unter allen Umständen fortsetzen und erhöhte sogar mein Honorar.«
»Hat er jemals die Absicht geäußert, sein Leben von eigener Hand zu beenden?«
»Niemals«, versicherte Carl. »In den vergangenen Wochen schien er mir sogar gelöster und ruhiger. Das mag aber darauf zurückzuführen sein, dass er ohne mein Wissen begonnen hatte, sich mit Laudanum zu betäuben.«
Göppel erhob sich und nahm seinen unsteten Rundgang wieder auf. Offenbar waren in seinen Augen noch keineswegs alle offenen Fragen beantwortet. »Der Baron hinterließ ein Testament. Es lag auf seinem Schreibpult.«
Carl nickte. »Ich habe die Überschrift gesehen.«
»Gelesen haben Sie es nicht?«
»Nein, das wäre mir nicht im Traum eingefallen.«
»Dann wissen Sie also nicht, dass der Baron Ihnen ein lebenslanges Wohnrecht auf seinem Landsitz zugesprochen hat?«
Carl klappte der Mund auf, ohne dass er es verhindern konnte. Für einen Moment war ihm, als berührten seine Füße den Boden nicht mehr. Göppel maß ihn mit einem forschenden Blick, als wolle er sehr genau die Reaktion seines Gegenübers prüfen. Was immer er für Schlüsse zog, er sprach sie nicht aus, sondern setzte seinen Gang fort.
»Ich … kann es nicht glauben«, stammelte Carl betroffen.
»Es ist so«, versetzte Göppel trocken. »Das Testament lag offen auf dem Schreibpult, und Herr Assessor Strehl, der den Tatort in Augenschein nahm, hat mir einen Bericht geschickt. Demnach hat der Baron verfügt, dass Sie auf Lebenszeit seinen Landsitz bewohnen dürfen. Er spricht ihnen außerdem eine Leibrente von zweihundertfünfzig Konventionstalern im Jahr zu. Das ist nicht viel mehr als der Lohn eines Fabrikarbeiters, und bei der bekannten Größe des Siebenfels’schen Vermögens dürfte es nur ein geringer Abschlag auf die Zinsen sein. Das Wohnrecht allerdings ist ein sehr bedeutendes Testat, denn das Landgut befindet sich seit Jahrhunderten im Besitz der Familie. Darf ich fragen, wie sich Ihre Wohnumstände hier in Leipzig gestalten?«
Carl schluckte. »Wir wohnen zur Miete. Drei Zimmer in der Schützenstraße.«
»Für fünf Personen? Das stelle ich mir recht beengt vor.«
»Es ist der Not geschuldet. Das Einkommen eines Arztes ist nicht hoch.«
Carl verstummte, denn endlich begriff er den Sinn der Frage. Er war allzu sehr damit beschäftigt gewesen, die unglaubliche Neuigkeit in ihrer ganzen Bedeutung aufzunehmen. Nun erst wurde ihm klar, worauf der Amtshauptmann hinauswollte.
»Wusste der Baron, dass Sie in so ärmlichen Verhältnissen leben?«, fragte Göppel.
»Ich habe das sicher einmal erwähnt«, erwiderte Carl beklommen.
Erneut hielt Göppel in seinem Gang inne und stützte sich auf die Tischplatte. Er beobachtete Carl aufmerksam, und erstmals war deutlich zu spüren, dass dieser freundliche Beamte bei aller Umgänglichkeit die königliche Justiz repräsentierte. »Sie werden verstehen, dass dieser Punkt von einiger Bedeutung ist. Da Sie dem Patienten als sein Arzt sehr nahestanden, ist Ihnen vielleicht der Verdacht begreiflich, Sie hätten den jungen Mann in ungebührlicher Weise beeinflusst.«
»Da sei Gott vor!«, beteuerte Carl. »Ich versichere Ihnen, dass ich meine Stellung nie in solcher Absicht missbraucht, nicht einmal an eine derartige Möglichkeit gedacht habe.«
»Die Baronin ist sehr ungehalten über dieses Testament«, fuhr Göppel fort. »Sicherlich wird sie es anfechten. Immerhin befand sich ihr Enkel in einem Zustand geistiger Verwirrung, da er sich gleich nach der Abfassung dieses Schriftstücks das Leben nahm.«
Carl ließ die Schultern hängen. »Nur zu begreiflich. Vermutlich wäre es das Beste, einem Rechtsstreit aus dem Weg zu gehen, indem ich freiwillig auf die testierten Rechte verzichte. Würde dies das Problem lösen?«
Der Amtmann zog erstaunt die Augenbrauen hoch. »Sie würden freiwilligen Verzicht leisten?«
»Das würde ich«, bestätigte Carl schweren Herzens. »Mir wäre keineswegs wohl dabei, ein Landgut in einem entlegenen Gebirgstal zu beziehen, so weit von all meinen Patienten entfernt. Wahrscheinlich hätte ich auch gar nicht die Mittel, für die erforderliche Haushaltung zu sorgen. Meine Frau und meine Kinder werden enttäuscht sein – sei’s drum.«
Göppel musterte ihn noch immer wie ein Forscher, der einen Schmetterling seziert. Dann aber setzte er sich überraschend, und jegliches Misstrauen verschwand aus seinem Blick.
»Ich glaube Ihnen«, sagte er unvermutet. »Sie sind ein rechtschaffener Mann, Doktor Haiden, das sehe ich Ihrem Gesicht an. Ich bin vielleicht kein Gelehrter, doch in den Mienen der Menschen zu lesen, ist mir zur zweiten Natur geworden.«
»Ich danke Ihnen für die schmeichelhafte Einschätzung«, gab Carl ernst zurück. »Und sie entspricht der Wahrheit. Ich habe nie danach getrachtet, mich durch Listen oder Winkelzüge zu bereichern – schon gar nicht im Fall dieses Patienten, dessen Tod mich in tiefe Gewissenskonflikte stürzt.«
»Davon bin ich überzeugt, und das werde ich auch dem Justizrat Seiner Majestät mitteilen. Man wird keine Anklage gegen Sie erheben. Im Übrigen sollten Sie sich reiflich überlegen …« Und nun klang der Beamte beinahe vertraulich. »… ob Sie tatsächlich zur Gänze auf das Vermächtnis verzichten wollen. Sie könnten eine außergerichtliche Einigung anstreben, indem Sie beispielsweise auf das Wohnrecht verzichten, aber die Rente annehmen. Es ist denkbar, dass die Baronin darüber mit sich reden lässt.«
»Meinen Sie?«, fragte Carl – und bereute diese Worte sofort, denn er wollte den guten Eindruck nicht gefährden, den Göppel von ihm gewonnen hatte. Doch der Amtshauptmann machte nur eine unbestimmte Handbewegung.
»Ich kenne die Baronin nicht persönlich. Als der Herr Assessor mit ihr sprach, war sie sehr aufgebracht, doch das war gewiss zu einem guten Teil dem schrecklichen Tod ihres Enkels geschuldet. Die arme Frau steht nun ganz allein in der Welt, denn offenbar gibt es keine Verwandten mehr.«
Carl nickte. »Ferdinands Vater fiel im Krieg, und seine Mutter starb im Kindbett.«
»Sie dagegen haben eine junge Familie«, gab Göppel zu bedenken. »Und da ich von Ihrer Unschuld ebenso wie von Ihrer Anständigkeit überzeugt bin, will ich Ihnen einen Rat geben: Entscheiden Sie nicht sofort! Schon morgen könnte es Ihnen leidtun, wenn Sie die Sache mit einer vorauseilenden Verzichtserklärung abgetan hätten. Gehen Sie in sich, und beraten Sie sich mit Gott und den Ihren.«
»Das sollte ich vielleicht wirklich tun. Ich … danke Ihnen«, brachte Carl betreten hervor.
»Alsdenn.« Göppel ergriff eine Feder und tunkte sie ins Tintenfass. »Ich denke, ich habe alle nötigen Informationen für mein Protokoll. Sicher wollen Sie jetzt nach Hause.«
»Ich bin entlassen?« Carl konnte es noch nicht so recht glauben.
»Gewiss. Ach, und sagen Sie bitte dem Diener draußen, er möge mir eine Tasse Kaffee bringen.«
Mit diesen Worten beugte sich der Amtshauptmann über ein Blatt Papier und begann zu schreiben. Carl ergriff seinen Hut und wankte auf schwachen Beinen zur Tür.
Die Sonne ging bereits unter, als er sich seinem Heim näherte, einem städtischen Mietshaus in der Schützenstraße. Auf eine Droschke hatte er verzichtet – einerseits des Geldes wegen, zum anderen, weil er den Fußweg brauchte, um seine Gedanken zu ordnen und einigermaßen sein inneres Gleichgewicht wiederzufinden.
Das Haus hatte schon bessere Zeiten gesehen und war recht heruntergekommen. Carl stieg die enge, schmutzige Treppe hinauf, vorbei an den Türen der anderen Mieter. Im Erdgeschoss wohnte eine Krämerfamilie, im ersten Stock ein lediger Anwalt, den Carl bereits flüchtig kennengelernt hatte. Der junge Mann nutzte jede Gelegenheit für ein Gespräch, vor allem, wenn Carl von seiner Familie begleitet wurde – wobei er sich nicht schämte, Carls Tochter Josephine schöne Augen zu machen.
Carl erreichte die Dachwohnung und wollte eben anklopfen, wie er es gewöhnlich tat, um der Familie seine Rückkehr anzuzeigen. Doch seine Schritte waren bereits gehört worden. Die Tür flog auf, Johanna stürmte auf ihn zu und schlang die Arme um seinen Hals.
»Carl! Wo bist du gewesen? Du wolltest doch nur den Baron besuchen.«
Carl hielt seine Frau für einige Augenblicke fest und genoss die Linderung, die ihre Nähe seinen aufgewühlten Nerven verschaffte. Sie standen noch in der offenen Tür, als Jasper und Josephine herbeieilten.
»Papa!« Josephine umschlang ihn mangels Platz von der Seite. »Wir dachten schon, du wärst unter eine Droschke geraten.«
»Ich erkläre euch alles«, versicherte Carl. »Lasst mich nur erst einmal zu Atem kommen.«
Johanna führte ihn in die Küche, wobei sie ihm Hut und Mantel abnahm. Dort sank er in einen Stuhl, und die Familie scharte sich rings um den Tisch. Die Küche diente als Wohn- und Esszimmer zugleich, denn die Wohnung war für fünf Personen viel zu klein. Die drei Kinder schliefen notgedrungen im selben Zimmer, das zweite war den Eltern vorbehalten, das dritte kaum mehr als ein dunkles Gelass unter einer Dachschräge.
»Nun erzähl schon!«, drängte Johanna. Sie wirkte besorgt, und ihr Haar war in Unordnung. »Was ist geschehen?«
Carl seufzte. »Einer meiner Patienten ist heute gestorben. Aber das ist keine Geschichte für Kinder, fürchte ich. Jasper? Josie? Ihr solltet auf eure Zimmer gehen.«
»Ich bin achtzehn, Papa!«, empörte sich Josephine. »Wovor glaubst du mich beschützen zu müssen? Ich habe genug Geschichten über gebrochene Knochen und zerfetztes Fleisch gehört.«
»Josephine!«, tadelte Johanna. »Über so etwas spricht eine junge Dame nicht.«
»Es ist Papas Beruf, sich um solche Dinge zu kümmern«, rechtfertigte sich das Mädchen. »Sag schon! War es ein Todkranker – oder ein Unfall?«
»Weder noch«, erwiderte Carl müde. »Ich komme von der Amtsmannschaft.«
Josephines Augen wurden groß wie Murmeln. »Ein Mord?«
Carl schüttelte den Kopf und begann zu erzählen. Johanna drückte unwillkürlich seinen Arm, als er vom Tod des jungen Barons berichtete. Josephine schlug eine Hand vor den Mund, und selbst auf Jaspers Gesicht bildete sich eine Sorgenfalte. Es war nicht nur der Schrecken angesichts eines verstörenden Todesfalls. Alle wussten, dass Baron Ferdinand Carls hauptsächliche Einnahmequelle gewesen war, denn die meisten anderen Patienten waren einfache Leute und konnten sich nur bescheidene Honorare leisten.
»Er hat eine ganze Flasche Laudanum ausgetrunken?«, fragte Josephine schaudernd. »Ist das ein schlimmer Tod?«
»Ich glaube nicht«, sagte Carl. »Soweit ich weiß, fällt man in einen tiefen Schlaf, und irgendwann versagt die Atmung. Wahrscheinlich gleitet man recht sanft hinüber. Zumindest hoffe ich, dass es so war.«
Das Gespräch mit dem Amtshauptmann gab Carl nur in groben Zügen wieder. Die Pointe hob er sich bis zum Schluss auf, denn sie war ihm unangenehm. Nur mit wenigen Worten gab er den Inhalt des Testaments wieder.
»Ich habe freiwilligen Verzicht angeboten«, fügte er hinzu. »Die Baronin will das Testament ohnehin anfechten, und ihre Verbindungen bei Hofe werden dafür sorgen, dass man in ihrem Sinne entscheidet. Ich glaube nicht, dass es vernünftig wäre, sich auf einen Rechtsstreit einzulassen.«
Dem folgte Schweigen. Josephine biss sich auf die Unterlippe, was sie stets tat, wenn sie sich mühsam einen Widerspruch verbat. Jasper starrte ins Leere, ohne dass eine Regung seine Gefühle verriet. Einzig Johanna sah Carl forschend ins Gesicht.
»Was hat denn der Amtshauptmann dazu gesagt?«, fragte sie mit neutraler Stimme.
»Er meinte, ich solle darüber nachdenken und mich nicht zu rasch entscheiden.«
»Er hat recht«, urteilte Johanna. »Lass uns morgen darüber reden. Erst einmal musst du dich ausruhen, etwas essen und schlafen.«
»Schlafen …« Carl seufzte. »Nichts lieber als das. Es war ein furchtbarer Tag.«
Doch später im Bett konnte Carl noch lange nicht schlafen. Unruhig lag er auf dem Rücken und starrte zur Decke hinauf. Er sah nicht einmal hin, als Johanna hereinkam und aus ihrem weißem Empire-Kleid stieg, das sie sorgfältig auf einen Bügel hängte, bevor sie sich das Nachthemd überstreifte.
Normalerweise hätte er diesen Anblick mit einem bewundernden Lächeln gewürdigt, denn Johanna Haiden, siebenunddreißig Jahre alt und Mutter von drei Kindern, war immer noch eine schöne Frau. Zudem war sie sehr unbefangen und wenig schamhaft, was nicht zuletzt in ihrem außergewöhnlichen Modegeschmack zum Ausdruck kam. Der Empire-Stil war in ihrer Jugend modern gewesen, und sie konnte seine Bequemlichkeit nicht genug loben: schlichte Kleider aus weichem Musselin mit weitem Ausschnitt, den Togas der Antike nachgebildet. Heute, zehn Jahre nach dem Fall Napoleons, galt dieser Kleidungsstil beinahe als frivol, denn man brachte ihn mit der Revolutionsepoche, mit Umsturz und Freigeisterei in Verbindung.
Johanna machte das nichts aus. Sie konnte hervorragend nähen, trug ihre luftigen Kleider mit großem Selbstbewusstsein und blickte mitleidig auf ihre Geschlechtsgenossinnen, die sich in Reifröcke und Korsetts zwängten.
Als sie zu Carl ins Bett stieg, legte sie sich auf die Seite und stützte den Kopf in eine Hand, um ihm ins Gesicht zu sehen. Sie kannte ihn gut genug, um zu ahnen, was ihn beschäftigte.
»Es war nicht deine Schuld«, erriet sie seine Gedanken. »Du hast getan, was du konntest.«
»Und dennoch hat es nicht genügt«, murmelte Carl, den Blick zur Decke gewandt.
»Es ist die Bürde des Arztes, sich mit dem Tod zu messen. Und manchmal zu verlieren.«
»Das ist es nicht, was mich quält. Ich habe an vielen Totenbetten gestanden, und nicht wenige Menschen starben unter meinen Händen. Damals im Lazarett habe ich furchtbare Dinge erlebt … Dinge, die ich dir nicht zu beschreiben wage. Doch nichts davon hat mich jemals so berührt wie der Tod des Barons, obwohl es ein sanfter Tod gewesen sein mag. Ich weiß so viel über den Körper des Menschen, doch die Krankheiten der Seele sind mir immer noch ein Rätsel. Ich wünschte so sehr, ich verstünde mehr davon.«
»Du verstehst mehr davon als viele andere«, tröstete Johanna. »Doch das bedeutet nicht, dass du jeden Patienten retten kannst. Vielleicht ist es überhaupt vermessen, etwas so Geheimnisvolles wie die Seele mit den Mitteln der Wissenschaft ergründen zu wollen. Ich war schon immer der Ansicht, dass die Dichter und Künstler mehr davon verstehen.«
»Du glaubst, Novalis oder Schiller wären die besseren Seelenärzte?«
»Wer weiß! Jedenfalls haben sie tiefer ins Innere des Menschen geblickt, als jedes Skalpell reicht. Ich las erst kürzlich eine Novelle von Eichendorff, aus der man viel darüber lernen kann, warum ein Mensch seinen Verstand verliert. Eines Tages werde ich dir davon erzählen – aber nicht heute; du bist zu müde.«
Carl schwieg und drückte sie an sich. Ein Schauer von Liebe hatte ihn ergriffen für diese Frau, die seit nunmehr zwanzig Jahren mit ihm lebte. Sie war so klug, so einfühlsam und zugleich so stark. Im Unterschied zu ihm hatte sie sich ihre ganze Bildung selbst angeeignet. Ihre vornehmen Eltern hatten sie zwar in einem Pensionat erziehen lassen, doch dort hatte sie wenig gelernt außer Liedern und Gebeten. Dafür aber hatte sie auf eigene Faust die Bibliothek ihres Vaters geplündert und sich einen Grad des Wissens angeeignet, über den die wenigsten Frauen verfügten.
Sie schrieb leidenschaftlich gern Briefe, vor allem an Schriftsteller, deren Werke sie gelesen hatte. Auch Musiker zählten zu ihren Brieffreunden, denn sie war hoch musikalisch und bedauerte nichts mehr, als dass die winzige Wohnung und das knappe Geld den Erwerb eines Pianos ausschlossen. Wenn sie nicht mit Näharbeiten beschäftigt war, deren Verkauf zum Unterhalt der Familie beitrug, übte sie das Klavierspiel regelmäßig bei einer Bekannten.
Carl bedauerte, sie nie spielen zu hören. Auch war er ein wenig eifersüchtig auf all die berühmten Männer, mit denen sie Briefe wechselte, während er selbst – wie er fand – im Grunde eher ein durchschnittlicher Mann und weder ein Genie noch künstlerisch begabt war. Oft fragte er sich, womit er Johanna verdient hatte. Allein die Aufmerksamkeit und Zärtlichkeit, die sie ihm nach so langer Zeit noch immer entgegenbrachte, waren ein durch keinen Reichtum aufzuwiegender Schatz.
»Um zu verstehen, was ich für dich fühle, brauche ich jedenfalls keinen Dichter«, murmelte er. »Auch wenn ein Dichter es vermutlich in schönere Worte fassen könnte.«
Sie schmiegte sich an ihn, und er spürte ihr Lächeln an seinem Hals.
»Du bist ein guter Mann, Carl … und ein guter Arzt. Versuch jetzt zu schlafen! Und was das Testament des Barons betrifft: Denk nicht darüber nach, ehe ein neuer Tag angebrochen ist.«
Er stutzte. »Warum?«
»Weil du erst einmal zu dir kommen und alles verarbeiten musst. Morgen wirst du klarer sehen.«
»Eigentlich ist meine Entscheidung längst gefallen. Oder hieltest du es etwa für richtig, diese Erbschaft anzunehmen?«
»Nicht heute, Carl«, flüsterte sie und küsste seine Wange. »Schlaf jetzt.«
Und so unglaublich es schien: Tatsächlich gelang es Carl nun, innerhalb weniger Minuten einzuschlafen.
Zweites Kapitel: Eine Verschwörung
Johanna Haiden weckte ihren Mann am folgenden Morgen erst gegen neun Uhr. Sie wusste, dass der erste Patient des Tages ihn nicht vor dem Mittag erwartete, und wollte ihn ausschlafen lassen. Erwartungsgemäß klagte er über die vorgerückte Stunde, im Grunde aber war er ihr dankbar, das spürte sie. Sie bemühte sich, seine gedrückte Stimmung zu heben, indem sie ihm ein üppiges Frühstück bereitete und ihm beim Essen Gesellschaft leistete, obwohl sie selbst bereits mit den Kindern gefrühstückt hatte. Die Geschehnisse des gestrigen Tages erwähnte sie mit keinem Wort. Als er schließlich seine Tasche packte und aufbrach, wirkte er einigermaßen gelöst, lächelte sogar und erwiderte ihren Kuss.
Für Johanna schien es zunächst ein normaler Tag zu werden: Sie tat, was sie gewöhnlich tat, wenn sie allein in der Wohnung war. Ihre Söhne waren in der Schule und würden nicht vor dem Nachmittag heimkehren, und Josephine war zum Einkaufen auf dem Markt. Johanna warf sich einen Mantel über, griff nach dem Wassereimer und ging auf die Straße hinaus, um an der öffentlichen Pumpe Wasser zu schöpfen. Dann spülte sie das Geschirr, wusch die Wäsche und hängte sie in dem winzigen unbewohnten Dachzimmer zum Trocknen auf. Schließlich nahm sie sich eine ihrer Näharbeiten vor, eine Auftragsarbeit für eine Ratsherrengattin, die anderthalb Taler einbringen sollte.
Wie üblich nähte sie in der Küche, denn nur dort gab es einen Tisch, auf dem man die Stoffe und das Handwerkszeug ausbreiten konnte. Innerlich seufzte sie, denn es war abzusehen, dass sie weder heute noch in den nächsten Tagen Zeit für ihre Lieblingsbeschäftigungen finden würde. Frühestens am Samstag würde sie wieder Gelegenheit haben, jene Bekannte zu besuchen, bei der sie Klavier übte – und im Schlafzimmer warteten mehrere halb gelesene Bücher nebst einem Stapel angefangener Briefe.
Das Lesen war, neben dem Klavierspiel, Johannas Leidenschaft. Begonnen hatte sie einst mit Romanen, ihren Horizont aber rasch um wissenschaftliche Schriften über Literatur, Geschichte und sogar Philosophie erweitert. Ihr Traum bestand darin, eine Literaturzeitschrift zu abonnieren, doch das erlaubten die begrenzten Geldmittel der Familie nicht. So bediente sie sich in öffentlichen Bibliotheken und stöberte nach gebrauchten Büchern in Antiquariaten. Irgendwann hatte sie begonnen, Briefe an diejenigen Schriftsteller zu schreiben, deren Werke sie besonders faszinierten, stets zu Händen des jeweiligen Verlegers. Zu ihrer großen Freude waren einige dieser Briefe weitergeleitet und sogar beantwortet worden.
Anfangs hatte Johanna nicht recht gewusst, ob diese Retouren bloßer Höflichkeit zu verdanken waren, mittlerweile aber konnte sie nicht mehr zweifeln, dass sie tatsächlich das Interesse der Adressaten erregt hatte. Sie schrieb stets angemessen ehrerbietig, ließ aber auch ihre Sachkenntnis einfließen, stellte Bezüge her, formulierte Fragen und wagte sogar die eine oder andere bescheidene Kritik. Mit der Zeit hatten sich daraus umfangreiche Briefwechsel und sogar regelrechte Diskussionen entwickelt, die von wechselseitiger Achtung und aufrichtiger Anteilnahme geprägt waren.
Auch Musiker gehörten zu Johannas Briefpartnern. Wann immer ein Musikwerk sie begeisterte und sie Näheres über die Absichten und Gedanken des Komponisten wissen wollte, griff sie zu Feder und Briefpapier. Zu ihren Lieblingen gehörte ein noch junger Komponist namens Franz Schubert, um dessen Bekanntschaft sie so hartnäckig geworben hatte, dass er ihr mittlerweile Noten seiner Werke schickte. Ihre bedeutendste Errungenschaft jedoch war ein weithin berühmter Meister, den sie schon seit ihrer Jugend verehrte: Beethoven. Jahre waren vergangen, bis sie den Mut gefunden hatte, ihm zu schreiben.
Anlass war ihre Beschäftigung mit der geheimnisvollen Klaviersonate Nr. 32 gewesen, die sie eine Zeit lang wie besessen geübt hatte. Am Ende hatte sie sich nicht davon abhalten können, in aller Unschuld jene Frage zu stellen, die sie anhaltend bewegte: Warum der Meister zu diesem Stück, dessen zwei Sätze scheinbar überhaupt nicht zusammenpassten, keinen dritten geschrieben habe. Zu ihrem größten Erstaunen war nach mehreren Wochen eine eigenhändige Antwort des Komponisten eingegangen: »Verehrte Frau Haiden, für einen dritten Satz hatte ich keine Zeit.«
Ungläubig hatte Johanna auf diese Zeilen gestarrt und nicht begriffen, ob es sich um eine rüde Abkanzelung oder eher um jene Art von derbem Humor handelte, für den der Komponist bekannt war. Mittlerweile neigte sie der letzteren Interpretation zu und hütete den Brief wie einen kostbaren Schatz, auch wenn er das Geheimnis der Sonate nicht aufklärte, sondern hinter augenzwinkernder Ironie verbarg. »Finden Sie selbst heraus, was ich gemeint habe«, schien die Antwort zu besagen.
Gegen ein Uhr kehrte Josephine vom Markt zurück.
»Ich bin wieder da!«, rief sie wie üblich, obwohl das Klappen der Wohnungstür weithin zu hören war. Sie kam in die Küche, küsste ihre Mutter auf die Wange und stellte den Einkaufskorb ab, um ihre Erwerbungen zu zeigen. Wie üblich hatte sie aus dem wenigen Geld, das Johanna ihr mitgeben konnte, mit Klugheit und Umsicht das Beste gemacht: Kartoffeln, Rüben und Salat sahen gut aus und würden für einige Zeit reichen. Johanna lobte ihre Tochter und bewunderte nebenbei, wie oft in letzter Zeit, ihre Erscheinung.
Josephine – Josie, wie sie meist genannt wurde – war mit Sorgfalt gekleidet, hielt sich aufrecht und hatte eine durchaus elegante Art, ihren weizenfarbenen Schutenhut ein wenig schräg zu drapieren. Sie hatte die ansprechende Figur ihrer Mutter, dazu ein hübsches, rosiges Gesicht und eine Fülle blonder Locken, von denen einige unter dem Hut hervorquollen und sich über ihre Wangen ringelten. Nicht zum ersten Mal wurde Johanna bewusst, dass ihre Tochter eine schöne Frau geworden war.
»Setz dich doch!«, bat sie. »Nähen ist langweilig, wenn man niemandem zum Plaudern hat.«
Nichts tat Josie lieber. Sie ließ sich am Tisch nieder und begann sofort zu erzählen, welche Bekannten sie auf dem Markt getroffen hatte und was der neueste Klatsch war.
»Alle reden immer noch von der Hinrichtung«, berichtete sie, »obwohl es inzwischen schon zwei Wochen her ist. Auf dem Marktplatz sind immer noch die Abdrücke der Pfosten zu erkennen, wo das Blutgerüst gestanden hat. Ich mochte kaum daran vorbeigehen.«
Johanna wusste, wovon die Rede war, denn der Fall des Mörders Johann Woyzeck war seit Wochen Stadtgespräch. Selbst Carl hatte einigen Anteil daran genommen, zum einen, weil er ein entschiedener Gegner der Todesstrafe war, und zum anderen, weil der Fall sein medizinisches Interesse erregt hatte. Der Delinquent, ein entlassener Soldat, hatte aus Eifersucht seine Geliebte erstochen. Viele hielten den Mann für geistesgestört. Dennoch hatte das Gericht die Todesstrafe verhängt, nachdem der Täter psychiatrisch begutachtet worden war, und zwar von niemand anderem als Professor Clarus, Carls einstigem Lehrer. Der Fall hatte Carl sehr beschäftigt, denn er selbst hätte um keinen Preis in Clarus’ Lage sein wollen. Ein Gutachten abgeben zu müssen, das einen Menschen dem Henker auslieferte, wäre für ihn die schlimmste Pflicht gewesen, die der Beruf eines Arztes mit sich bringen konnte. Ein Mediziner, hatte er gesagt, sollte Leben retten, nicht Leben vernichten helfen.
»Die Geißlers waren da und haben es mit angesehen«, fuhr Josie fort. »Sie sagen, dass der Mann ganz gefasst war. Er kniete sich hin und betete lange, dann stieg er unaufgefordert das Podest hinauf und legte den Kopf auf den Richtblock. Ach, ich mag gar nicht daran denken … Er hat ja gewiss etwas sehr Böses getan, aber wenn ich mir den Henker mit seinem fürchterlichen Schwert vorstelle, weiß ich gar nicht, wer mir mehr leidtut: dieser Woyzeck oder die arme Frau, die er erstochen hat. Papa sagt doch immer, dass kein Mensch böse geboren wird, oder?«
Johanna nickte, ohne von der Nähnadel aufzusehen.
»Ich bin froh, dass wir nicht hingegangen sind«, sagte Josie ehrlich. Zwar stellte sie gern eine gewisse Abgebrühtheit zur Schau und hatte sogar ein Faible für dramatische Geschichten, doch bevorzugte sie es, wenn Mord und Totschlag nur in Erzählungen und nicht in der Wirklichkeit vorkamen. »Ich verstehe auch nicht, warum die Schulen an solchen Tagen eigens schließen, damit die Kinder zuschauen können. Ob Jaspers Klassenkameraden dort waren?«
»Ich habe ihn nicht danach gefragt«, sagte Johanna. »Und von sich aus redet dein Bruder nie besonders viel, wie du weißt.«
»Nein. Außer Lesen und Lernen tut er kaum etwas«, bemerkte Josie ein wenig spitz. »Wahrscheinlich wird aus ihm noch ein Gelehrter.«
Darüber musste Johanna schmunzeln, denn sie wusste, dass sich hinter Josies Worten kein Neid verbarg, allenfalls gutmütiger Spott. Während Jasper das evangelische Kreuz-Gymnasium besuchte, war Josephine nach acht Jahren Volksschule vom Unterricht erlöst worden, und dass es für Mädchen keine höhere Schule gab, bedauerte sie nicht im Mindesten. Selbst ihre Privatstunden liebte sie nicht, obwohl Carl eigens ein Arrangement mit einer verwitweten Lehrerin in der Nachbarschaft getroffen hatte: Er betreute die alte Dame als Arzt, im Gegenzug gab sie seiner Tochter Privatunterricht.
Josephine unterzog sich dieser Pflichtübung ohne große Begeisterung, denn ihr stand der Sinn eher nach praktischen Dingen. Dabei war sie alles andere als einfältig oder gar ungebildet, denn sie verschlang einen Roman nach dem anderen, hatte einen wachen Verstand und eine Menschenkenntnis, in der sie beide Eltern übertraf. Es war ihr lediglich nicht wichtig, Dinge zu erlernen, die im täglichen Leben keine Bedeutung hatten.
Eine Pause war entstanden, und die Art, wie Josie konzentriert auf die Nadel in den Händen ihrer Mutter blickte, kündigte einen Themenwechsel an. Offenbar ging es um etwas Bedeutsames, das nicht gänzlich unumwunden ausgesprochen werden durfte.
»Mama?«, fragte sie schließlich in verändertem Tonfall. »Wie denkst du über die Sache mit dem Baron?«
»Ach, Josie …« Johanna lächelte. »Ich dachte mir schon, dass dich das beschäftigt.«
»Dich etwa nicht?«
»Doch«, gab Johanna zu. »Aber in erster Linie sorge ich mich um deinen Vater. Der Tod des jungen Barons hat ihn schwer getroffen, und ich kann verstehen, warum er es für besser hält, die Erbschaft auszuschlagen. Die Baronin erkennt das Testament ohnehin nicht an, und Carl will keinen Prozess gegen die arme Frau führen, die nun ganz allein in der Welt steht.«
»So denkt er doch nur, weil er sich schuldig fühlt«, hakte Josephine ein. »Er glaubt, er hätte diesen Selbstmord verhindern können. Aber vielleicht konnte er das gar nicht! Er hat viel für den Baron getan – immerhin war er seit fast einem Jahr zweimal in der Woche bei ihm. Und als Erstes hat Papa doch an uns zu denken: an seine Familie. Meinst du nicht, er könnte es sich noch einmal überlegen?«
Sie sprach in beinahe verschwörerischem Ton, und Johanna glaubte zu erraten, woran sie dachte. Es war keine Pietätlosigkeit dabei. Für Josie war Baron Ferdinand bloß ein Patient ihres Vaters gewesen – und zwar ein Patient, der über Reichtum und Grundbesitz verfügte. Der Gedanke an die Leibrente, der Carl vordinglich beschäftigte, schien in ihrem jugendlichen Gemüt keine große Rolle zu spielen. Eher dachte sie wohl an das Landgut und stellte es sich wahrscheinlich wie ein Märchenschloss vor.
»Es wäre doch wundervoll«, sagte sie und bestätigte damit Johannas Verdacht. »Stell dir vor: Wir hätten ein großes Haus und mehr Platz, als wir jemals brauchen. Wahrscheinlich gäbe es sogar einen Garten. Du könntest Gemüse anpflanzen, und Nepomuk könnte im Freien spielen, ohne dass man Angst vor Fuhrwerken haben müsste. Wir könnten Gesellschaften geben! Vielleicht gibt es einen schönen Salon mit samtbezogenen Stühlen und vielleicht sogar ein Klavier für dich.«
»Na, das hast du dir aber schön ausgemalt.« Johanna lachte gutmütig. »Und ich gebe gern zu, dass ich solche Gedanken auch schon hatte. Aber soweit ich Carl verstanden habe, handelt es sich um ein altes Rittergut irgendwo im Gebirge, das seit Jahren unbewohnt ist. Wahrscheinlich ähnelt es eher einem verfallenen Bauernhof mit Spinnweben vor den Fenstern. Im Übrigen ist die Sache wohl undenkbar.« Sie seufzte. »Die Baronin – die Großmutter des Verstorbenen – wird gewiss nicht den Stammsitz ihrer Familie hergeben. Deswegen will sie das Testament ja auch für ungültig erklären lassen.«
»Warum sollte es ungültig sein?«
»Weil der Baron sehr krank war«, erklärte Johanna geduldig. »Dein Vater darf uns nichts Genaueres darüber sagen, denn ein Arzt muss über solche Dinge schweigen.«
»Ach, ich kann es mir schon denken«, meinte Josephine altklug. »Er hat sich umgebracht, also ist entweder etwas geschehen, das seine Ehre befleckt hat, oder er war melancholisch. So etwas kommt vor, auch bei jungen Leuten. In der Geschichte vom Werther erschießt sich der Held, weil seine Liebe nicht erwidert wird.«
»Du hast Goethes ‚Werther’ gelesen?«, fragte Johanna ein wenig erschrocken.
»Mama, ich bin erwachsen!«, beharrte Josie augenrollend. »Das Buch lag bei dir herum, und ich habe es mir ausgeborgt. Ist das schlimm?«
»Nein«, lenkte Johanna ein. »Verzeih mir, manchmal vergesse ich, wie alt du inzwischen bist. Und wie hübsch«, fügte sie versöhnlich hinzu. »Kein Wunder, dass unser Nachbar dich immer mit leuchtenden Augen ansieht, wenn er uns im Treppenhaus begegnet.«
Sie ahnte nicht, dass sie das entscheidende Stichwort getroffen hatte, bis sie Josies Reaktion bemerkte. Ihre Tochter war errötet und sank ein wenig in sich zusammen.
»Josie!« Erstaunt ließ Johanna die Nähnadel sinken. »Was ist los?«
»Er hat mich angesprochen«, gestand Josephine. »Vorhin, als ich vom Markt zurückkam. Ich bin ihm an der Haustür begegnet. Nein, bitte denk nichts Falsches von mir, und auch nicht von ihm! Er war sehr höflich und korrekt.«
»Und was wollte er?«
»Er meinte, ich sähe bedrückt aus, und fragte, ob wir Sorgen hätten …« Josie biss sich auf die Unterlippe, wie sie es oft tat, wenn sie sich ein wenig schämte. »Da er sich so freundlich erkundigt hat, deutete ich an, wir hätten Verdruss wegen einer Erbschaft. Und da hat er sofort angeboten, dass Papa mit ihm sprechen kann. Du weißt ja, er ist Anwalt und kennt sich mit solchen Dingen aus.«
»Das wird deinem Vater gar nicht gefallen«, fürchtete Johanna. »Wie viel hast du ihm verraten?«
»Nur, dass es um ein Testament geht«, beteuerte Josephine, mied jedoch Johannas Blick, als sei dies nicht die ganze Wahrheit. »Mama, meinst du nicht, wir sollten ihn einmal mit Papa zusammenbringen? Er sagt, dass er nichts dafür haben will. Es wäre nur ein nachbarschaftlicher Besuch.«
Johanna dachte nach. Bisher kannte sie ihren Nachbarn, den etwa dreißigjährigen und etwas korpulenten Christian Beckmann, nur flüchtig. Bei zufälligen Treffen grüßte er stets ehrerbietig, sogar ein wenig affektiert – vor allem, wenn Josephine dabei war. Carl mochte den Mann nicht, obwohl er eigentlich nichts Konkretes gegen ihn vorbringen konnte, zumal er allem Anschein nach recht tüchtig war und einen achtbaren Beruf ausübte. In der gegenwärtigen Lage jedenfalls war es nicht ausgeschlossen, dass er tatsächlich wertvollen Rat geben konnte.
»Vielleicht hast du recht«, sagte Johanna schließlich, wenn auch mit ungutem Gefühl. Sie würde einige Überredungskraft aufbieten müssen, um Carl zu einer solchen Konsultation zu bewegen. »Ich werde es deinem Vater vorschlagen … auch wenn ich ein wenig Sorge habe, dass es diesem Beckmann weniger um unser Wohl geht als um deine schönen Augen, Josie.«
Zu ihrer Erleichterung lachte Josephine. »Da mach dir nur keine Sorgen, Mama! Ich passe schon auf mich auf. Und im Übrigen bin ich nicht sehr eingenommen von Männern, die schon mit dreißig eine Glatze bekommen.«
Unterdessen eilte Carl durch die Straßen der Stadt, um seine heutigen Patienten aufzusuchen. Es kam nur selten vor, dass man ihn zu Hause konsultierte, denn seine beengten Wohnverhältnisse erlaubten keine aufwendigen Untersuchungen und Behandlungen. Stattdessen machte Carl Hausbesuche. Er hatte nur wenige Patienten, diese aber kannte er gut, und die meisten hatten dauerhafte oder wiederkehrende Leiden, sodass er sie für lange Zeit betreute. Sein Ruf verbreitete sich durch private Empfehlungen. Wenn einmal kein Krankenbesuch anstand, ging er in die Armenviertel, denn dort fand sich stets genug Arbeit. Man brauchte nur die Straßen entlangzuwandern und die Augen offenzuhalten.
Zwar war Leipzig noch immer eine recht beschauliche Stadt, während sich andernorts im Königreich Sachsen die Industrie mit ihren Manufakturen und Eisenhütten ausbreitete, doch auch hier hatte das Elend Einzug gehalten, denn es gab Druckereien, Spinnereien und Zigarrendrehereien mit einem ständig wachsenden Bedarf an Arbeitskräften. Der Lohn dieser Menschen reichte kaum zum Leben, und die wenigsten konnten den Arzt bezahlen. Oft leistete Carl Hilfe, ohne mehr dafür zu bekommen als einen Groschen oder ein paar Äpfel, und manches Mal schwor er sich, nicht wiederzukommen, weil diese Dienste mehr Zeit kosteten, als sie ihm Einnahmen brachten. Doch er konnte es einfach nicht mit ansehen, wenn ihm zufällig ein Junge mit verrenkter Schulter oder eine alte Frau mit Furunkeln im Gesicht begegnete.
An diesem Tag allerdings ging er nicht in die Armenviertel, denn sein Terminplan war bereits voll. Er hatte drei Besuche vor sich, und die Wege, die er stets zu Fuß zurücklegte, führten ihn kreuz und quer durch die Stadt. Sein erster Patient war ein Händler, dem die Hufe eines durchgegangenen Pferdes den Knöchel zerschmettert hatten. Carl war zufällig in die Sache verwickelt worden, als herbeieilende Passanten nach einem Arzt gerufen hatten. Noch vor Ort hatte er den Bruch gerichtet und geschient, seitdem besuchte er den Patienten regelmäßig, um den Heilungsfortschritt zu prüfen. Der Mann erholte sich gut, wie Carl bei seinem heutigen Besuch feststellen konnte. Zudem war er ein angenehmer Patient, bot dem Arzt Cognac an und bezahlte großzügig, obwohl Carl wenig mehr tat, als das Bein ausgiebig zu befühlen und Umschläge mit Arnikablüten aufzulegen.
Der nächste Patient war der sechsjährige Sohn eines Schusters, der bereits zwei Kinder durch die Pocken und seine Frau bei der Geburt des dritten Kindes verloren hatte. Der Junge, letzter Halt des unglücklichen Vaters, litt seit Wochen an einem dick geschwollenen Hals, Fieber und bellendem Husten. Carl hatte einen Aufguss aus Salbeiblättern gegen die Entzündung sowie Chinin gegen das Fieber verordnet und von ganzem Herzen gehofft, dass es sich nicht um die gefürchtete Halsbräune handelte, die gerade bei Kindern nicht selten zum Tod führte. Bei seinem heutigen Besuch jedoch fand er den Jungen in besserer Verfassung vor. Die Schwellung war zurückgegangen, und ein Blick in den Hals zeigte eine deutliche Abnahme des dunklen Belags. Der Kleine lächelte sogar, und sein Vater drückte Carl mit Tränen der Dankbarkeit die Hände.
Schwerer war der letzte Besuch des Tages. Es handelte sich um ein Ladenmädchen, das Johanna beim Kauf von Wollstoffen kennengelernt und sofort gemocht hatte. Auch diese junge Frau hustete häufig, und irgendwann hatte Johanna ihr versprochen, dass Carl einmal vorbeikommen würde. Inzwischen arbeitete das Mädchen nicht mehr im Laden, sondern lag die meiste Zeit im Bett, und ihr Ehegatte, ein Mietkutscher, machte sich ernste Sorgen.
Er führte den Arzt sogleich in das ärmliche Zimmer, wo die Kranke auf ihrer Bettstatt lag. Carl wurde das Herz schwer, denn obwohl er die Patientin zum ersten Mal sah, registrierte er sofort untrügliche Anzeichen: Sie hustete nur noch schwach und kraftlos, war aber stark abgemagert und hatte eingefallene Wangen. Carl sprach ihr gut zu, fühlte den Puls, hörte die Lunge ab und vernahm ein unheilvolles Rasseln. Dann zog er sich auf den Flur zurück, wo er sich in gedämpftem Ton mit dem Ehemann besprach.
»Sagen Sie schon, Doktor«, verlangte dieser zu wissen, »ist es die Schwindsucht?«
»Ich fürchte ja«, bestätigte Carl. »Bei den jetzigen Krankheitszeichen scheint es mir untrüglich.«
Der junge Kutscher lehnte sich an die Wand und seufzte zittrig. Carl wusste, dass die beiden erst letztes Jahr geheiratet hatten und noch kinderlos waren. Ihm war beinahe übel vor Mitgefühl. Diese prächtigen jungen Leute würden, kaum dass ihr Erwachsenenleben richtig begonnen hatte, die volle Härte eines unbarmherzigen Schicksals zu ertragen haben – sie durch einen langsamen Tod, er durch jahrelange Trauer.
»Wie viel Zeit hat sie noch?«, fragte der Mann.
Carl brachte sich mühsam dazu, wieder als Arzt zu denken. »Das ist schwer zu sagen. Es können Tage kommen, an denen sie leichter atmet und sogar aufstehen kann, doch auf lange Sicht wird ihre Schwäche zunehmen. Es kann sich noch ein ganzes Jahr hinziehen oder in drei Monaten zu Ende sein.«
»Und es gibt kein Mittel dagegen, nicht wahr?«
»Die höhergestellten Herrschaften versuchen es mit Luftkuren im Gebirge. Aber auch das kann die Krankheit nicht heilen, sondern nur ihr Fortschreiten verzögern.«
Das Gesicht des jungen Mannes verdüsterte sich. »Wie kann Gott das nur zulassen?«, sinnierte er. »Meine Lene ist doch ein gutes Mädchen und hat niemandem etwas getan. Ist es eine Strafe?«
»Glauben Sie das nicht!«, sagte Carl mit Überzeugung. »Wir verstehen immer noch wenig von der Natur der Krankheiten, doch was immer sie sein mögen, sie sind keine Strafen Gottes. Lassen Sie sich nicht abhalten, Ihre junge Frau zu lieben wie bisher. Sorgen Sie für frische Luft im Zimmer und richten Sie ihren Oberkörper auf, wenn ihr das Atmen Schwierigkeiten bereitet. Geben Sie ihr gut und viel zu essen, wann immer sie noch Appetit hat. Im Übrigen kann ich ein Mittel verschreiben, das den Husten dämpft und Schmerzen mildert. Ich werde zweimal in der Woche wiederkommen, um mich zu vergewissern, dass es wirkt.«
Der junge Mann hatte für einige Momente ausgesehen, als kämpfte er mit den Tränen. Nun aber erschien ein entschlossener Glanz auf seinem Gesicht.
»Bemühen Sie sich nicht, Herr Doktor. Wenn es ohnehin keine Hoffnung mehr gibt, werde ich meine Lene nicht in diesem Bett sterben lassen. Wozu soll ich weiter meinen Kutschdienst versehen und Groschen zurücklegen für Kinder, die niemals kommen werden? Ich habe einen Onkel auf dem Lande, der einen kleinen Bauernhof führt. Ich werde meine Arbeit aufgeben und bei ihm um Obdach bitten. Es kann nicht ärmlicher sein als hier. Wenigstens hat Lene dann frische Landluft, und ich kann Tag und Nacht bei ihr sein. Außerdem liebt sie Tiere, und auf dem Hof gibt es Hühner und Ziegen. Wenn der Onkel uns aufnimmt, wird sie dort getrösteter sterben als hier.«
»Sind Sie sicher?«, fragte Carl. »Sie selbst werden weiterleben, und wenn Sie Ihre Stelle gekündigt haben, mag es schwer werden, eine neue Arbeit zu finden. «
»Das soll mich nicht kümmern. Uns einfachen Leuten gibt das Leben selten eine Chance auf etwas Glück. Wenn es nun einmal so ist, dass meiner Lene nur noch Monate bleiben, dann will ich bei ihr sein – selbst wenn unsere einzigen Gefährten ein alter Mann und seine Hühner sind.«
Carl bedachte dies für einen Moment, dann nickte er. »Ich schreibe Ihnen noch ein Rezept, das Sie unbedingt einlösen sollten. Man wird Ihnen eine Tinktur aushändigen. Nehmen Sie sie mit, wenn Sie die Reise aufs Land antreten.«
Der Mann bedankte sich ernst. Er drängte Carl sogar eine Bezahlung auf, die dieser angesichts der hoffnungslosen Lage am liebsten zurückgewiesen hätte. Carl wünschte ihm von Herzen alles Gute und verabschiedete sich in gedrückter Stimmung.
Als er an diesem Nachmittag nach Hause ging, rumorten die Gedanken in seinem Kopf. Am meisten grübelte er über den letzten Krankenbesuch und konnte sich nicht darüber klar werden, ob er den Entschluss des jungen Mannes für unvernünftig oder für bewundernswert hielt. Zweifellos liebte er seine Frau und haderte zu recht mit einem Schicksal, das ihm dieses Glück gleich wieder fortnahm, indem es ihre Frische und Schönheit und zuletzt ihr Leben vernichtete. Wenn sie in seinen Armen starb, würde er ein junger Witwer sein und womöglich als Landarbeiter enden. Dafür jedoch würde er mehr Zeit mit seiner Geliebten verbracht haben, als wenn er weiter seinen Kutschdienst versehen hätte, und er würde sich lebenslang an diese traurige, doch ebenso bewegende Zeit erinnern.
Carl war bereits in der Schützenstraße angekommen, als er begriff, warum ihn diese Gedanken so sehr umtrieben. Die Worte des Mannes – »Uns einfachen Leuten gibt das Leben selten eine Chance« – erinnerten ihn an seine eigene Lage. Galt es nicht, das Glück zu ergreifen, wenn es sich bot, ob es sich nun um einen Bauernhof auf dem Land handelte oder … um ein Landgut in den Bergen?
Nein, dachte Carl und riss sich zusammen. Gemessen an dem Leid, das er heute gesehen hatte, musste er dankbar sein. Er hatte eine Familie und weder Frau noch Kinder an die Pocken oder den Typhus verloren. Was konnte er sich mehr wünschen als seinen Beruf, seine geliebte Johanna und seine drei prächtigen Kinder?
An der Tür kam ihm Johanna entgegen. Sie trug ein himmelblaues Kleid mit gebauschten Ärmeln, das sie gewöhnlich nur anlegte, wenn Besuch zu erwarten war. Carl staunte, sagte jedoch nichts, als sie ihn umarmte und in die Küche führte. Es roch appetitlich nach gedünstetem Weißkohl. Der Tisch war fertig gedeckt, und darauf stand eine entkorkte Flasche Wein, das Geschenk eines früheren Patienten.
»Was ist los?«, fragte Carl. »Gibt es einen besonderen Anlass, deinen Ehemann derart zu verwöhnen?«
»Ich möchte, dass du dich entspannst und auf andere Gedanken kommst«, sagte Johanna, die ihm einschenkte und sich ihm gegenübersetzte. »Du hast unruhig geschlafen … und die Arbeit scheint auch nicht angenehm gewesen zu sein.«
Carl aß, trank einen Schluck Wein und blickte schließlich erneut seine Frau an. »Ist das irgendein Komplott?«, fragte er geradeheraus.
»Iss erst einmal auf, Carl.«
»Ich bin satt.« Er schob demonstrativ das Besteck von sich. »Nun sag mir doch, was los ist! Angesichts deiner Kleidung – in der du übrigens wundervoll aussiehst – könnte man glauben, dass wir noch Besuch erwarten.«
Sie griff über den Tisch und nahm seine Hand. »Sei mir nicht böse, Carl, und auch Josephine nicht! In der Tat haben wir jemanden gebeten, dich zu besuchen. Wir glauben, dass du Rat brauchst. Besseren Rat, als wir unwissenden Frauen ihn dir geben können.«
»Wer kommt?«
»Beckmann, unser Nachbar. Ich hoffe, es ist dir recht.«
»Beckmann?« Carl fuhr auf.