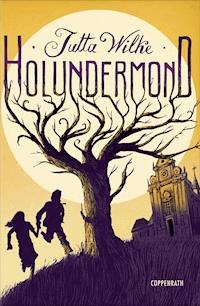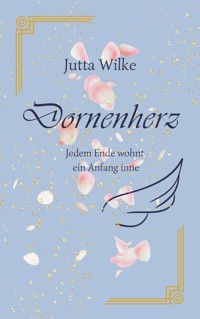
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Heute vor einem Jahr habe ich gelernt, dass man sterben kann, ohne tot zu sein. Obwohl ich in sicherer Entfernung stand, das offene Grab nur von Weitem sah, fühlte ich, wie die feuchte Erde mich einhüllte. Wie ich nach und nach unter ihr verschwand und mit mir meine Träume, meine Sehnsüchte, meine Wünsche. Seit dem Unfalltod ihrer Schwester kämpft Anna mit ihren Schuldgefühlen und dem verzweifelten Versuch, ihren Eltern die tote Tochter zu ersetzen. Erst als sie wieder anfängt zu zeichnen, findet sie zurück in ihr eigenes Leben. Aber ist es wirklich ihr Leben, das mit jedem Bleistiftstrich realer zu werden scheint? Ausgerechnet auf einem Friedhof wächst in Anna der Mut, sich dieser Frage zu stellen. Eine Katze führt sie zu einem Grabmal in Form eines Engels umgeben von einem Meer aus weißen Rosen. Erstaunt stellt Anna fest, dass der Engel ihr Gesicht trägt. Etwas, das auch dem jungen Friedhofsgärtner Phil nicht entgangen ist. Schon bald entwickelt sich zwischen Anna und Phil eine tiefe Beziehung. Aber darf Anna überhaupt ihre Liebe leben, während der Freund ihrer Schwester an deren Tod zerbricht? Wie soll sie glücklich sein, wenn ihre Eltern in Kälte und stummem Schweigen erstarrt sind? Und was hat das alles mit dem Schicksal der Menschen zu tun, die Ende des 19. Jahrhunderts nach Amerika auswandern wollten, aber nie dort angekommen sind? Obwohl es ein extrem heißer Sommer ist, hat Anna immer öfter das Gefühl, selbst in dem eisigen Wasser, das sie umgibt, zu ertrinken.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 215
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Textbeginn
Schraubendampfschiff „Cimbria"
Port of Dreams – BallinStadt
Quellenverzeichnis
Die beiden Kinder hatten einander so lieb,
daß sie sich immer an den Händen faßten,
so oft sie zusammen ausgingen;
und wenn Schneeweißchen sagte:
»Wir wollen uns nicht verlassen«,
so antwortete Rosenrot:
»Solange wir leben, nicht«,
und die Mutter setzte hinzu:
»Was das eine hat,
soll’s mit dem andern teilen.«
(Schneeweißchen und Rosenrot, Brüder Grimm)
Heute vor einem Jahr habe ich gelernt, dass man sterben kann, ohne tot zu sein.
Obwohl ich in sicherer Entfernung stand, das offene Grab nur von Weitem sah, fühlte ich, wie die feuchte Erde mich nach und nach einhüllte. Wie ich nach und nach unter ihr verschwand und mit mir meine Träume, meine Sehnsüchte, meine Wünsche.
Heute vor einem Jahr haben sie meine Schwester begraben. Und mich gleich dazu.
Warum blühst du so traurig
im Garten allein?
Sollst im Tod mit den Schwestern
vereinigt sein.
Drum pflück ich, o Rose,
vom Stamme dich ab.
Sollst ruhen mir am Herzen
und mit mir im Grab.
(Friedrich Wilhelm Riese, 1805-1879)
Ich starre in den Spiegel.
Ich sehe ein Gesicht, sehe Augen, eine Nase, einen Mund.
Ich sehe schulterlanges Haar, nehme eine Strähne, ziehe sie vom Kopf weg.
Die Schere in meiner Hand zittert.
Als ich schneide, wundere ich mich, dass ich nichts spüre. Die Haare fallen lautlos auf den Boden und ich greife die nächste Strähne. Jetzt fühle ich mich schon sicherer.
Die Schere liegt ruhig in meiner Hand.
Strähne für Strähne schneide ich ab, ganz langsam, und mit jedem Schnitt verblasse ich mehr. Mit jedem Haar, das hinunterfällt, existiere ich weniger.
Ich merke, wie die Angst wieder von mir Besitz ergreifen will, wie sie aufsteigt wie ein Schatten, der alles verschlingt, der mich ins Dunkel stürzt, der mich gefangen hält, mir die Luft abschnürt, bis ich nichts mehr sehen, nichts mehr hören, nichts mehr fühlen kann. Nichts außer dieser dunklen schwarzen Leere.
Bis ich mich nicht mehr fühlen kann.
Ich schneide schneller, schneide an gegen die Angst, will fertig sein, bevor ihre Schatten mich wieder eingeholt haben, diesmal sollen sie mich nicht kriegen.
»Anna, warum hast du denn abgeschlossen?!«
Ich fahre zusammen.
Fast hätte die Schere mich verletzt.
Meine Mutter rüttelt an der Türklinke.
»Bist du fertig? Wir müssen los.«
Ich blicke in den Spiegel und sehe Augen, eine Nase, einen Mund. Die Haare stehen kurz und zerzaust in alle Richtungen.
Ich sehe das Gesicht meiner Schwester.
Langsam schüttele ich den Kopf. Ich will nicht. Ich will das alles nicht mehr.
»Anna?«
Ich erwache aus meiner Starre. Bücke mich, schiebe hektisch die Haarbüschel zusammen, sammele sie auf und stopfe sie in den Papierkorb.
»Ja doch, ich komm gleich! Zwei Minuten! «
Ich bürste mir noch mal durch die Haare, schnappe die Bluse, die auf dem Kleiderbügel am Schrank hängt, und schlüpfe hinein. Ein letzter Blick in den Spiegel und der Versuch eines Lächelns. Dann öffne ich die Tür.
»Anna, was soll der Unsinn? Warum schließt du denn ...«
Meine Mutter verstummt, starrt mich an. Dann presst sie eine Hand auf den Mund, erstickt einen Schrei. Ich versuche, ihrem Blick standzuhalten und mich an ihr vorbeizuschieben.
»Wo sind die anderen?«, frage ich, nur um irgendetwas zu sagen.
»Warum hast du das getan?«
»Mir war zu warm mit den langen Haaren.« Ich bemühe mich, gleichgültig zu klingen, und weiß, dass es mir nicht gelingt.
»Zu warm?«
Ich ignoriere den Schmerz in ihrer Stimme, laufe durch den Flur. Mein Vater kommt aus dem Bad, der Duft seines Rasierwassers schlägt mir entgegen. Fast wäre ich in ihn hineingerannt.
Als Kind habe ich es geliebt, mich in seine Arme zu schmiegen, meinen Kopf in seine Halsbeuge zu drücken und an seinem frisch rasierten Kinn zu schnuppern. Aber ich bin kein Kind mehr. Vor allem bin ich nicht mehr sein Kind. Etwas hat sich verändert.
Alles hat sich verändert, seit Ruth tot ist, höhnt die Stimme in mir.
»Hallo, Papa«, flüstere ich.
Er sieht mich an, runzelt die Stirn, sieht weg.
»Wir müssen los«, sagt er nur und dreht sich zur Tür. Sein schwarzer Anzug ist die Mauer, die ihn umgibt.
Ich atme aus.
Was hast du erwartet? Hast du wirklich geglaubt, ein paar Haare mehr oder weniger könnten etwas ändern?
Ich trete hinter meinen Eltern aus dem Haus und schließe geblendet die Augen. Strahlender Sonnenschein empfängt mich. Natürlich. Auch vor einem Jahr schien die Sonne. Ich weiß noch, wie sehr mich das irritiert hat. Sollte es auf Beerdigungen nicht immer regnen?
Meine Schwester begruben wir am heißesten Tag, den der Sommer im letzten Jahr zu bieten hatte. Es war, als ob die Sonne sich über mich lustig machen wollte. Über das Frieren, das mich in der Nacht gepackt hatte, als ich von Ruths Tod erfuhr, und das mich seitdem nie wieder losgelassen hat.
Wenn dir kalt ist, liegt es nicht an mir, lacht die Sonne vom Himmel. Sondern nur an dir.
Alles liegt an dir.
Leon kommt durch den Vorgarten auf mich zu. Er sieht gut aus. Seine blonden Haare trägt er kurz, sein Gesicht ist gebräunt von der Sonne. Ich wünschte, er wäre aus einem anderen Grund gekommen. Ich wünschte, wir könnten jetzt einfach auf seinen Roller steigen und irgendwohin fahren, wo wir allein sind. Ich sehe ihm an, dass auch er keine Lust auf Friedhof hat. In seiner rechten Hand hält er drei langstielige rote Rosen. Mir fällt ein, dass ich keine Blumen für meine Schwester habe. Ich habe gar nichts für sie. Ich habe überhaupt nicht daran gedacht, dass ich ihr etwas mitbringen könnte.
Leon bleibt vor mir stehen, hebt langsam die freie Hand und streicht mir mit den Fingern durchs Haar.
»Du siehst wunderschön aus«, flüstert er.
Ich halte die Luft an und bemerke sein Zögern, bevor er sich zu mir beugt und seine Lippen zart meine Wange berühren.
»Du wirst ihr von Tag zu Tag ähnlicher«, flüstert er mir ins Ohr.
Ich zucke zurück. Der Zauber des Augenblicks ist verschwunden. Warum sagt er so was?
Weil du es doch genau darauf anlegst. Ich beiße mir auf die Lippen, um nicht zu schreien. So ist es nicht. So ist es überhaupt nicht. Und plötzlich weiß ich, dass ich es nicht schaffe.
»Wir müssen los.« Leon greift nach meiner Hand.
»Ich ... ich kann nicht.«
»Anna, komm, deine Eltern warten.«
»Ich will nicht!« Ich schiebe seine Hand weg. »Bitte. Ich will nicht mitkommen!«
»Anna, ich will auch nicht zum Friedhof. Aber wir müssen doch. Ich meine, ich muss ... ach verdammt, Anna. Tu es für Ruth.«
Leon greift wieder nach meiner Hand und zieht an mir wie an einem störrischen Kleinkind.
»Anna?!«
Meine Mutter kommt auf uns zu. Ich erwarte nicht, dass sie mich versteht.
»Ich komme nicht mit. Fahrt allein. Bitte«, füge ich leise hinzu, als ich die Enttäuschung in ihren Augen sehe.
Dann nickt sie und fasst Leon am Arm. Sie wenden sich ab und lassen mich stehen.
Ich sehe ihnen nach. Leon dreht sich nicht mehr zu mir um. Erst jetzt merke ich, dass ich die ganze Zeit die Luft angehalten habe.
Ich renne zurück ins Haus, Tränen laufen mir über das Gesicht, ich will in mein Zimmer, will nur noch allein sein. Mir ist kalt, so entsetzlich kalt.
Ich schließe die Tür, schaue mich in meinem Zimmer um, suche nach irgendetwas, an dem ich mich festhalten kann, bevor ich erfriere. Da fällt mein Blick auf den Skizzenblock. Die Ledermappe mit den Stiften liegt daneben. Ich gehe zum Schreibtisch, streiche zärtlich über das Leder.
Mein Vater hat mir die Sachen geschenkt. In einer anderen Zeit, in einem anderen Leben.
Seit einem Jahr habe ich nicht mehr gezeichnet. Trotzdem habe ich es nicht übers Herz gebracht, die Sachen in die Schublade zu räumen.
Behutsam öffne ich den Block und blättere durch die Seiten. Ich sehe Skizzen von Blumen, von Bäumen, vereinzelt auch Gesichter. Aber hauptsächlich habe ich Pflanzen gezeichnet.
Tränen tropfen auf das Papier, schnell wische ich mir mit dem Ärmel übers Gesicht. Ich klappe den Block wieder zu und schiebe ihn von mir weg. Und mit ihm die Bilder aus meinem alten Leben.
Ich lege mich auf mein Bett und schließe die Augen.
Ich versuche mich zu erinnern.
Heute vor einem Jahr.
Die Party war gar nicht so toll. Es gab eigentlich gar keinen Grund, länger zu bleiben.
Doch, den gab es, wispert es in meinem Kopf. Nico. Nico war der Grund, warum du den Bus verpasst hast. Nico. Ich schluchze auf. Befehle der Stimme in mir, endlich still zu sein. Nico ist kein guter Grund.
Ja, ich war verliebt in ihn. Das schon. Ich war stolz darauf, mit ihm zusammen zu sein. Es war, als ob ich erst an seiner Seite wirklich wahrgenommen wurde. Vorher war ich irgendjemand, jetzt war ich Nicos Freundin. Das war neu für mich.
Ich hatte mich lange auf die Party gefreut, hatte mir extra viel Mühe gegeben, mich hübsch zu machen, wollte, dass dieser Abend für uns etwas ganz Besonderes wird. Anfangs lief auch alles gut. Nico und ich tanzten ein paarmal, dann gingen wir zu den anderen in die Küche, um eine Kleinigkeit zu essen und uns etwas zu trinken zu holen. Irgendwann musste ich aufs Klo, und als ich in die Küche zurückkam, war Nico spurlos verschwunden. Ich suchte ihn eine ganze Weile, fragte ein paar Leute, aber niemand wusste, wo er abgeblieben war.
Und dann sah ich ihn mit Lynn.
Lynn war betrunken und Nico auch. Ich schlich hinter den beiden her in den Garten und beobachtete, wie sie sich küssten. Ich dachte, der Boden würde sich unter mir auftun und mich einfach verschlingen. Aber das geschah nicht. Stattdessen entdeckte Nico mich. Ich wollte etwas sagen, aber ich stammelte nur hilfloses Zeug. Und Nico? Der sah kein bisschen schuldbewusst aus. Eher verächtlich. Als ich endlich ein »Warum« herausbrachte, zuckte er nur mit den Schultern.
»Stell dich nicht so an«, sagte er. »War doch klar, dass das mit uns nichts Ernstes ist.« Dann lachte er laut und schob seine Hand in Lynns Ausschnitt. Lynn kicherte hysterisch. Und ich lief davon. Verkroch mich irgendwo im Haus, wollte niemanden sehen und niemanden hören. Stell dich nicht so an! Nichts Ernstes!
Und dann habe ich den Bus verpasst.
Ruth seufzte am Telefon, als ich sie anrief. »Bleib, wo du bist. Ich hol dich!« Es war doch Ruth? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich erinnere mich an Nico, an seine Verachtung und daran, dass ich den Bus verpasst habe. Ruth wollte mich holen.
Eine halbe Stunde später war sie tot.
Es war nicht Nico!, fauche ich die Stimme in mir an. Ein betrunkener Junge, der seine Hände einem fremden Mädchen in den Ausschnitt steckt, konnte unmöglich der Grund für den Tod meiner Schwester sein.
Ich versuche, hinter geschlossenen Lidern ihr Gesicht zu sehen. Ruths Gesicht, so wie es früher war. Ruth, wie sie lachte, wenn sie einen Witz aus der Schule erzählte, Ruth, deren Augen zornig blitzten, wenn sie irgendwo Unrecht witterte.
Aber es gelingt mir nicht.
Alles, was ich sehe in meiner Dunkelheit, sind ihre geschlossenen Augen. Ihr blasses Gesicht, fast durchsichtig.
Seit einem Jahr suche ich in meinem Kopf nach Bildern von meiner Schwester, und alles, was ich finde, ist immer wieder nur dieses eine Bild von ihr. Ruth, wie sie da liegt, in dem offenen Sarg.
Sie war so fremd, so anders.
Sie hatten sie geschminkt, hatten versucht, den tiefroten Streifen, der irgendwo auf ihrer Stirn begann und erst am Hals endete, abzudecken. Es war ihnen nicht gelungen. Die rote Spur führte über das ganze Gesicht.
Ich kneife die Augen noch fester zu, aber ich sehe immer nur Ruths schlecht geschminktes Gesicht, umrahmt von ihren kurzen dunklen Haaren.
Und dann schlossen sie den Sarg, und meine Mutter neben mir fiel lautlos zu Boden, und rückblickend denke ich, dass sie in diesem Moment ebenfalls aufhörte zu leben und anfing, nur noch zu existieren.
Als ich die Augen wieder öffne, wundere ich mich, wie hell es in meinem Zimmer ist. Ich brauche eine Weile, um in Raum und Zeit zurückzufinden.
Im Bestattungsinstitut war es nicht hell. Dort war es schummrig. Kerzen brannten, aus einer Wasserschale strömte blumiger Duft und aus einer Ecke tönte leise Musik.
Im Bestattungsinstitut hörte meine Welt auf, sich zu drehen, und die Blumen verdorrten.
Mein Blick fällt wieder auf den Skizzenblock. Ich denke an all das Leben, das ich darin festgehalten habe. In einer Zeit, in der ich selbst noch lebendig war.
Ob ich es noch kann?
Du wirst es nur herausfinden, wenn du es ausprobierst, flüstert die Stimme in mir.
Ich lausche. Seit Ruths Tod ist es so schrecklich still geworden in diesem Haus. Mir fehlt ihre Musik, ihr lautes Lachen, mir fehlen die Stimmen ihrer Freunde, die hier ein und aus gingen.
Mir fehlen die Gespräche mit ihr und meiner Mutter, mir fehlen die Witze meines Vaters. Mir fehlen die endlosen Diskussionen, die er mit Ruth über Physik führen konnte. Ruth war ganz vernarrt in alles, was mit Zahlen zu tun hatte, und mein Vater hat sie dafür geliebt. Ich kann mit Zahlen nichts anfangen. Und seit Ruth tot ist, kann mein Vater mit mir nichts mehr anfangen.
Mir fehlt die Unordnung, die sie immer im Bad hinterlassen hat, mir fehlt sogar ihre Angewohnheit, mich regelmäßig um Geld anzupumpen.
Ich schiebe die Bettdecke zur Seite und stehe auf. Wie in Zeitlupe bewege ich mich auf meinen Schreibtisch zu. Ich kann mit Zahlen nichts anfangen, aber ich konnte einmal zeichnen.
Du konntest sogar mal ziemlich gut zeichnen.
Ich greife nach dem Skizzenblock und öffne ihn langsam. Dann nehme ich einen Bleistift vom Tisch.
Plötzlich bin ich ganz aufgeregt. Wie von selbst gleitet meine Hand über das Papier, wenige Striche nur, ein paar Schattierungen. Mein Herz schlägt schneller. Ich fühle fast so etwas wie Freude. Und das ist ziemlich viel für jemanden, der vor einem Jahr aufgehört hat, überhaupt noch irgendetwas zu fühlen. Zumindest irgendetwas anderes als Angst.
Für einen Moment halte ich inne und frage mich, was ich da eigentlich tue. Ein Gesicht starrt mir von dem weißen Blatt entgegen. Mein Gesicht? Da fällt mein Blick auf den Papierkorb, in den ich die abgeschnittenen Haare geworfen habe, und ich muss wieder an Leon denken und daran, wie er mich angesehen hat, als er meine Wange berührte, und da weiß ich, ich muss es einfach ausprobieren. Ich muss wissen, ob ich es wirklich noch kann. Ich muss wissen, wie viel von mir noch übrig ist, nachdem ich seit einem Jahr damit beschäftigt bin, mich verschwinden zu lassen. Und ich weiß auch schon, wo ich es herausfinden will. Es gibt einen Ort in dieser Stadt, an dem ich das Zeichnen erst richtig gelernt habe. Einen Platz, an dem ich alles finde, was ich für meinen Versuch brauche.
Ich hole mir in der Küche eine Flasche Wasser und verstaue sie in meinem Rucksack. Einen Zettel, wohin ich fahre, schreibe ich meinen Eltern nicht, sie würden es ohnehin nicht verstehen. Das müssen sie auch nicht. Es reicht, dass ich mir meiner Sache auf einmal ganz sicher bin. Ich nehme den Skizzenblock und die Mappe mit den Stiften vom Schreibtisch und packe sie ebenfalls ein.
Ein Blatt fällt dabei zu Boden. Ich mache einen Schritt zur Seite und lasse es einfach liegen.
Schraubendampfschiff „Cimbria"
Technische Daten:
Stapellauf:
21.01.1867
Indienststellung:
29.03.1867
Länge:
100,93 m
Breite:
12,10 m
Tiefgang:
6,00 m
NRT:
2167
Kohlenvorrat:
700 t
PS-Maschinenleistung: 500
Höchstgeschwindigkeit:
12 Knoten
Besatzung:
98
Passagiere
1.
Klasse:
58
Passagiere
2.
Klasse:
120
Passagiere
3.
Klasse:
500
10 Rettungsboote mit einer Aufnahmekapazität von 370 Personen
Bauwerft: Caird und Co. in Greenock,
Schottland
Reederei: HAPAG - Hamburg
Laderaum: für 1.200 t Ladung
»Johanna, träumst du wieder?«
Meine Mutter.
Erschrocken schlug ich die nächsten Töne an.
Meine Finger stolperten über die Tasten wie Fremde, die einander zum ersten Mal trafen. Nur die glänzenden Stellen auf dem sonst glatten Elfenbein verrieten die beinahe tägliche Begegnung. Jetzt verirrten sie sich unter all den Noten, fanden ihren Takt nicht zwischen der Zeit, die heute so quälend langsam verstrich, und meinem Herzen, das viel zu schnell klopfte.
Sehnsüchtig schielte ich auf die Uhr über dem Kamin. Endlich. Endlich schlug sie fünfmal und erlöste mich.
Ich ließ den Deckel krachend zuschlagen und sprang auf.
»Johanna!«, rief Mama empört, aber da war ich schon auf dem Weg in mein Zimmer. Ich zerrte die Schleifen aus meinem Haar und fing an, die Zöpfe zu lösen. Meine Hände zitterten. Ich atmete tief durch. Zwang mich zur Ruhe.
Er ist nichts weiter als ein guter Freund aus Kindertagen, ermahnte ich mich selbst, aber mein Herz ließ sich nicht überlisten.
Ich bürstete meine Haare so kräftig, dass es ziepte.
»Deine Haare sind so weich wie das Fell einer Katze«, sagte Papa oft, wenn er mir über den Kopf strich. Heute sollten sie nicht nur so weich sein, sondern auch glänzen wie das Fell einer Katze.
Papa würde das gefallen. Und ich hoffte, dass es Leonard auch gefiel.
Meine Wangen glühten vor Eifer. Als ich einen Blick in den Spiegel warf, konnte ich sehen, dass meine Augen leuchteten.
Rose,
oh reiner
Widerspruch,
Lust,
Niemandes
Schlaf
zu sein
unter soviel
Lidern.
(Rainer Maria Rilke, 1875-1926)
Ich war lange nicht mehr hier.
Ich konnte nicht.
Auch wenn es nicht der Friedhof ist, auf dem sie Ruth beerdigt haben, ist es eben doch ein Friedhof.
Und ein riesiger Park. Ein Park voller Bäume, Blumen, alter Grabsteine und verschlungener Wege.
Früher war ich oft hier, um zeichnen zu üben.
Früher ...
Ich kette mein Fahrrad an einen Laternenpfahl und schnappe meinen Rucksack. Die Luft über dem Asphalt flimmert in der Hitze. Die Bilder verschwimmen vor meinen Augen. Für einen Moment sehe ich wieder das offene Grab, fühle das Beben meiner Mutter an meiner Seite. Mein Vater steht neben ihr, seine Schultern zucken. Leon hat die Fäuste in seinen Taschen vergraben, meine Hände öffnen und schließen sich. Immer wieder. So als ob sie Halt suchen, den sie nicht finden. Fast glaube ich, die Stimme des Pfarrers zu vernehmen, gleichmäßiges eintöniges Gemurmel, dem ich nicht zuhören kann, weil nichts von dem, was er sagt, irgendetwas mit meiner Schwester zu tun hat ...
Plötzlich rast ein Auto an mir vorbei, ich springe zur Seite, fluche leise und die Welt dreht sich wieder.
Was mache ich hier? Warum musste ich ausgerechnet zu einem Friedhof fahren?
Weil du eigentlich hierher gehörst, flüstert die Stimme in mir.
Ich beeile mich, von der Straße runterzukommen, und biege in einen der Kieswege ab, die tief ins Innere des Parks führen.
Die Grabsteine rechts und links ignoriere ich heute. Ich will keine Gräber zeichnen, sondern Blumen. Pflanzen, Bäume vielleicht. Etwas, das lebt.
Der Kies knirscht unter meinen Füßen, und das Geräusch lässt mich frieren. Ich sehe den Sarg, sehe die weißen Rosen, die auf seinem Deckel liegen, und unter dem Deckel liegt Ruth, meine Schwester, und schläft, während wir hinter ihr her über den Kies gehen, der sich anfühlt wie dünnes Eis, das jederzeit brechen kann.
Ich laufe schneller, will diesem Geräusch entkommen, will den Kies unter meinen Füßen nicht mehr hören. Weiter hinten enden die Wege, dort, wo der ganz alte Teil des Friedhofs liegt, wo die Gräber nicht mehr gepflegt und die Pflanzen sich selbst überlassen sind.
Erleichtert atme ich auf, als ich weiches Moos unter meinen Füßen spüre. Die Bäume hier sind alt, sie sind so hoch, dass ich den Kopf in den Nacken legen muss, um den Himmel zu sehen. Es ist kühler hier, dunkler, die Bäume spenden Schatten in der Mittagshitze.
Erst jetzt merke ich, wie durstig ich bin. Ich hole die Wasserflasche aus meinem Rucksack, trinke einen großen Schluck, fahre mir mit der Hand über das Gesicht und über die Haare. Für einen Moment stutze ich, dass sie so kurz sind, dann fällt es mir wieder ein. Ich weiß nicht, ob es Tränen oder Schweißtropfen sind, die mir über das Gesicht laufen. Ich wische sie weg und schaue mich suchend um. Was soll ich zeichnen? Womit fange ich an?
Ich streiche sacht über die Rinde eines Baumes und vor meinem inneren Auge entsteht ein Bild aus rauen Stämmen, knorrigen Ästen. Dieser Baum ist noch zu glatt, ich lasse meine Hand sinken und gehe langsam weiter, auf der Suche nach etwas anderem.
Im Schatten der dichten Baumkronen wachsen kaum Blumen, dafür rankt Efeu über die verwitterten, umgestürzten Grabsteine.
Der Rhododendron ist bereits verblüht, die wenigen hohen Gräser sind vertrocknet, es hat seit Tagen nicht mehr geregnet. Irgendwo zwitschern ein paar Vögel, die in den Bäumen völlig ungestört ihre Nester bauen.
Ich frage mich, warum ich nicht schon früher hergekommen bin. Es fühlt sich an, als hätte dieser Ort die ganze Zeit nur auf mich gewartet und als raunte er mir nun zu: Da bist du ja endlich.
Ein Schauer läuft mir über den Rücken. Ich öffne meinen Rucksack, ziehe den Skizzenblock und die Ledermappe heraus und sehe mich nach einem geeigneten Sitzplatz um. Weiter hinten entdecke ich einen Baumstumpf, ich lege meinen Rucksack daneben, setze mich darauf, den Block auf den Knien, suche einen passenden Stift aus und hebe den Blick.
Ich drehe den Stift zwischen meinen Fingern. Er fühlt sich fremd an, ungewohnt. Es ist, als ob ich vergessen hätte, wie man ihn richtig hält. Meine Hände schwitzen, in meinem Kopf arbeitet es fieberhaft. Verzweifelt versuche ich, meine Aufmerksamkeit auf das zu richten, was ich vor mir sehe. Nun mach schon. Und wenn ich es nicht mehr kann? Meine Hand zittert, als ich damit beginne, den Baum neben mir zu skizzieren.
In der Ferne höre ich den Motor eines Autos, etwas raschelt im Gras und lenkt mich ab. Zu meinen Füßen huscht eine Maus davon. Rasch verschwindet sie unter welkem Laub und zuerst bin ich traurig, dass sie so schnell weggelaufen ist.
Aber dann sehe ich die Katze. Sie liegt auf einem umgestürzten Grabstein und beobachtet mich. Ihr langer Schwanz schlägt dabei sanft hin und her.
Fast wie von selbst setzt meine Hand jetzt den Stift auf das Papier. Die Umrisse des Steins sind schnell skizziert, schon nach wenigen Strichen spüre ich, wie meine Hand lockerer wird, ich bemerke den Stift in ihr gar nicht mehr. Ich zeichne. Ich zeichne.
Ich schaue hoch, um mir die Katze einzuprägen. Ganz schwarz ist sie. Nur die linke Vorderpfote und die Schwanzspitze sind weiß. Da steht sie auf, streckt sich und springt von dem Stein herunter. Enttäuscht lasse ich den Stift sinken. Die Katze läuft ein paar Schritte; dann dreht sie sich um und schaut mich an. Ich sehe in ihre grünen Augen, die auch im gedämpften Licht der Bäume hell leuchten.
Ich wende mich wieder meinem Skizzenblock zu, suche nach einem anderen Motiv vor meinen Füßen; doch da höre ich ein leises Miauen. Erstaunt sehe ich auf. Die Katze schaut mich immer noch an.
Ich seufze. »Na gut, wie du willst.«
Ich packe meine Sachen zusammen und stehe auf. Sie dreht sich um und verschwindet zwischen den Bäumen. Ich laufe hinter ihr her. Die Luft ist schwül und nimmt mir den Atem.
Die Katze scheint es nicht eilig zu haben, sie wartet wieder kurz, bis ich näher komme, dann erst läuft sie weiter. Ich darf sie nicht aus den Augen verlieren.
Plötzlich versperren mir Äste den Weg. Als ich sie auseinanderbiege, zerkratzen Dornen meinen Arm. Ich beiße die Zähne zusammen und schlüpfe durch das Gestrüpp, frage mich, warum ich das eigentlich mache – warum ich hinter einer fremden Katze herlaufe, mir die Arme zerkratze, mich durch einen Urwald kämpfe.
Sie läuft jetzt schneller, ich muss mich beeilen, damit sie mir nicht entwischt.
Ich bin mir sicher, dass ich in diesem Winkel des Friedhofs noch nie gewesen bin, und doch habe ich das Gefühl, jeden Baum, jeden Grashalm zu kennen.
Und dann stehe ich auf einer Lichtung. Die Sonne taucht alles in sanfte Farben, lässt das Gras unter meinen Füßen leuchten, spielt mit den Blättern der Birken, die hier vereinzelt stehen. Bunte Wildblumen wachsen ihr entgegen.
Einen Kiesweg gibt es nicht.
Trotzdem ist deutlich ein Weg zu erkennen. Ein Weg aus grünem Moos. Alte Gräber säumen ihn. Ich suche zwischen den Grabsteinen die Katze.
Da vorne ist sie. Sie wartet wieder auf mich, schaut zu mir zurück, die weiße Schwanzspitze erhoben, dann springt sie davon.
Ich versuche erst gar nicht, ihr hinterherzulaufen. Stattdessen wende ich mich nach links und betrachte die Grabsteine genauer. Die Namen der Verstorbenen sind kaum noch zu entziffern. Nur einzelne Buchstaben und ein paar Zahlen kann ich erkennen. Ich drehe mich um, will die Lichtung mit einem Blick erfassen. Etwas ist anders und es ist nicht nur das Licht. Mein Herz schlägt schneller und ich brauche einen Moment, bis ich begreife, was es ist. Sämtliche Geräusche sind plötzlich verstummt. Ich höre keine Autos mehr, aber auch die Vögel haben aufgehört zu singen. Es ist, als ob die Welt den Atem anhalten würde.
Das Einzige, was noch zu hören ist, ist mein eigener Atem, der lauter wird, je länger ich hier stehe.
Ich merke, wie die Kälte zurückkommt, sie kriecht mir unter die Haut und lässt mich frösteln. Ich fühle mich beobachtet, drehe mich nach allen Seiten um, aber da ist niemand. Erst glaube ich, Stimmen zu hören, Rufe, Schreie, aber dann ist da nur die Stille und in sie hinein mischt sich das Klopfen meines Herzens.
Ich habe nicht gewusst, dass auch die Stille laut sein kann.
Reiß dich zusammen, Anna, wer soll denn hier sein?
Ich schüttele den Kopf und gehe langsam weiter, betrachte jetzt die Grabsteine zu meiner Rechten.
Auch hier wieder nur verwitterte Inschriften, die Namen kaum noch zu entziffern, die Zahlen noch eher, achtzehnhundert lese ich, danach verschwinden die Ziffern unter dem Efeu.
Und dann entdecke ich die Katze wieder. Sie sitzt vor einem Beet aus schneeweißen Rosen. Und während ich mich noch darüber wundere, warum hier Rosen blühen, sehe ich plötzlich Ruth in ihrer Mitte. Ruth, wie sie dasteht und auf mich wartet. Ruth, die den Kopf schieflegt und mir entgegenlacht.