
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Coppenrath Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Emil steckt so richtig in der Klemme! Erst nimmt ihm seine Lehrerin, die fiese Bertram, sein Notizbuch weg und jetzt verschwindet auch noch Karl auf geheimnisvolle Weise. Dabei ist er nicht nur der einzige Erwachsene, der Zeit für Emil hat, sondern auch Emils größter Fan. Emil ist nämlich Krimiautor. Aber dieser Fall ist für ihn allein zu knifflig. Zum Glück gibt es Finja! Die ist eine richtige Detektivin wie Sherlock Holmes und hat sogar einen Watson (ihren Hund). Ob sie gemeinsam das Rätsel lösen können?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 273
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Für Emil.
Der mir seinen Namen geliehen hat.
Und für Rüdiger.
Der ganz zufällig auch Bertram heißt, aber kein bisschen fies ist, sondern ein richtig toller Kinderbuchautor.
Die Arbeit an diesem Buch wurde mit einem Stipendium des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst gefördert.
eISBN 978-3-649-64088-2
© 2021 Coppenrath Verlag GmbH & Co. KG,Hafenweg 30, 48155 Münster
Alle Rechte vorbehalten, auch auszugsweise
Vermittelt von: Literatur Agentur Hanauer
Text: Jutta Wilke
Illustrationen und Umschlaggestaltung: Ulf K.
Lektorat: Anja Fislage
Satz: Sabine Conrad, Bad Nauheim
www.coppenrath.de
Die Print-Ausgabe erscheint unter der ISBN: 978-3-649-61511-8.
Jutta Wilke
Das Karlgeheimnis
Ein Fall für die Detektivin und mich
Mit Illustrationen von Ulf K.
Inhalt
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
Epilog
Das total geheime
Notizbuch
von
Emil K.
Karl
Alter:
Weiß ich nicht so genau. Auf jeden Fall älter als Frau Wischnewski.
Frisur:
Keine. Also keine Haare. Fast keine. Nur über den Ohren und hinten ein paar weiße Haare, die immer zu schnell wachsen. Dann kommt Silke und schneidet die Haare wieder ab. Damit es ordentlich aussieht, sagt Karl.
Im Sommer hat Karl einen Strohhut auf dem Kopf, dann sieht man nicht, dass er fast keine Haare mehr hat.
Kleidung:
Eine Brille mit runden Gläsern. Ein T-Shirt, meistens orange.
Mit Werbeaufdruck. Im Winter so eine geriffelte Jacke drüber.
Mama sagt, der geriffelte Stoff heißt Cord. Die Hose ist auch aus dem geriffelten Cord.
Merkmale:
Karl gehört das Büdchen unten an der Ecke.
Da verkauft er Kaffee, Zigaretten, Zeitungen und Bier.
Eis und Cola gibt’s auch. Und Lollis.
Kommt aus Prag. Das ist die Hauptstadt der Tschechischen Republik.
1. Kapitel
In dem ein abgerissener Finger noch nicht gefunden wird, Frau Wischnewski Paul mit Hundekuchen füttert und der andere Paul schon tot ist …
Erst als die Frau den Knopf für dieses Rückholdings drückte, flutschte der Hund langsam aus dem Gestrüp. Er zappelte und röchelte, weil die Leine so an ihm zerrte und …
Ich höre kurz auf zu lesen und werfe Karl und Frau Wischnewski einen schnellen Blick zu. Gleich kommt die Stelle mit dem abgerissenen Finger. Ich habe schon eine Gänsehaut, wenn ich nur daran denke. Die Stelle ist nämlich richtig gut geworden.
Okay, das mit dem Finger war nicht wirklich meine Idee. Ich habe das mal in einem Film gesehen. In einem Krimi. Den Krimi habe ich heimlich geguckt, als Mama abends nicht zu Hause war und ich eigentlich schlafen sollte. Mit dem Schlafen wurde es danach nix mehr, weil ich Angst hatte, dass unter meinem Bett eine Hand liegen könnte. In dem Film fand nämlich ein Jäger eine abgerissene Hand im Wald. Sonst nichts. Nur die Hand. Und dann hat der Kommissar mit seinen Leuten während des ganzen Films den restlichen Körper gesucht, der zu der Hand gehörte.
Ich verrate euch jetzt nicht, wo sie den Typ gefunden haben. Vielleicht kann ich das später noch für meine Geschichte gebrauchen. Ich muss das dann nur ein bisschen abändern, damit mein Buch nicht genauso wird wie der Film. Das wäre sonst nämlich geklaut und ist natürlich nicht erlaubt. Auch wenn es nur eine erfundene Story ist.
Deshalb liegt da in meinem Krimi auch keine abgerissene Hand, sondern nur ein Finger im Gebüsch. Und der wird auch nicht von einem Jäger gefunden, sondern von einem Hund. Die Stelle, wie der Hund mit dem Finger im Maul zu seinem Frauchen zurückkommt und dabei mit dem Schwanz wedelt, ist die beste Stelle im ganzen Buch. Also bisher jedenfalls. Ein richtiger Schocker. Dabei weiß ich noch gar nicht, wem dieser Finger eigentlich gehört. Das muss ich mir erst noch ausdenken.
Nur ganz langsam blättere ich um und lasse meine Worte noch ein bisschen in der Luft nachklingen. Gleichzeitig versuche ich, mich so hinzusetzen, dass Karl mir nicht länger über die Schulter gucken und mitlesen kann. Ich bin nämlich nicht so gut im Vorlesen, wenn mir einer dabei zuguckt.
»Ich wette, da liegt ein Jogger im Gebüsch.«
»Was?« Vor Schreck lasse ich fast mein Notizbuch fallen. Vor mir stehen zwei rot-weiß geringelte Beine auf einem Skateboard. Keine Ahnung, wo die auf einmal herkommen. Genau genommen stehen ein Paar blaue Sneakers auf einem Skateboard, in denen diese geringelten Beine stecken. Jetzt springen die Sneakers auf den Asphalt und einer von ihnen tippt das Board so an, dass es nach oben wippt und von einer Hand aufgefangen wird.
»Oder ein Teil von einem Jogger. Ein Turnschuh oder so.«
Ich lasse meinen Blick langsam nach oben wandern. Das Mädchen, zu dem die geringelten Beine und das Skateboard gehören, setzt sich einfach neben mich auf die Treppenstufen.
»Rück mal ein Stück. Und? Hab ich recht?« Sie versucht, einen Blick in mein Notizbuch zu werfen, aber ich klappe es schnell zu. Wäre ja noch schöner.
»Ähm, nein.«
»Klar, dass du noch nichts verraten willst.« Sie zuckt mit den Schultern. »Aber es ist bestimmt ein Jogger. Es ist fast immer ein Jogger«, fügt sie hinzu und guckt zu Frau Wischnewski und Karl hoch. Ich suche die ganze Zeit in meinem Kopf, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das Mädchen hier noch nie gesehen habe. Sie ist ungefähr so groß wie ich, hat kurze blonde stoppelige Haare, die in alle Richtungen abstehen, und jede Menge Sommersprossen.
»Ich weiß nicht …«, fängt Karl an und legt den Kopf schief, als ob er erst darüber nachdenken müsste. »Aber wenn Finja das sagt …«
Finja also. Ich kenne sie trotzdem nicht.
»Schön, dass du wieder da bist«, sagt Karl da. »Wie geht es Watson? Hat er sich von dem Schreck erholt? Wo ist er überhaupt?«
»Watson ist zu Hause. Er darf noch nicht so viel laufen.«
Finja. Watson. Komische Namen haben die.
»Du bist neu hier«, stellt Finja fest und mustert mich von oben bis unten.
Von wegen neu. Wenn hier einer neu ist, dann sind es ganz eindeutig diese Finja und Watson, der sich von irgendeinem Schreck erholen muss. Keine Ahnung, wieso ich diese Finja noch nie vorher hier gesehen habe, Karl sie aber kennt. Eigentlich ist mir das auch egal. Ich will endlich weiterlesen.
»Finja ist nämlich eine richtige Detektivin«, erklärt Karl da. Eine Detektivin? Jetzt werde ich doch ein bisschen neugierig. Schließlich schreibe ich gerade einen Krimi. Dann fällt mir ein, dass diese Finja höchstens so alt ist wie ich und deshalb unmöglich schon Detektivin sein kann. Also keine richtige jedenfalls.
»Trotzdem ist es kein Jogger«, sage ich deshalb nur und notiere mir irgendwo im Hinterkopf, dass mir dringend etwas anderes einfallen muss. Ein Jogger wäre ja wirklich zu einfach, da hat sie leider recht.
Aber jetzt will ich endlich die Stelle mit dem Finger vorlesen. Und für den Finger ist es vollkommen egal, ob er zu einem Jogger oder einer alten Frau oder einem einsamen Wanderer gehört hat. Der Finger ist sowieso ab. Und das kommt doch jetzt erst.
Ich blättere in meinem Notizbuch zu der Seite, an der ich aufgehört habe zu lesen. Dann fange ich noch mal an.
Erst als die Frau den Knopf für dieses Rückholdings drückte, flutschte der Hund langsam aus dem Gestrüp. Er zappelte und röchelte, weil die …
»Gestrüpp schreibt man mit zwei p«, sagt Finja. Na toll! Schnell klappe ich meine Notizen wieder zu. Ich werfe dieser Finja einen finsteren Blick zu. Erst rollert sie mit ihrem Skateboard einfach mitten in meine Lesung und dann kann sie nicht mal die Klappe halten. Außerdem ist es für die Spannung völlig unwichtig, wie viele p so ein Gestrüpp hat.
Karl räuspert sich. »Ich will jetzt aber auch wissen, was da in der Gegend rumliegt.«
Karl gehört das Büdchen, vor dem wir sitzen. Manche sagen auch Trinkhalle oder Kiosk. Aber Mama sagt immer Büdchen. Als wir hierhergezogen sind, hat sie mir irgendwann 50 Cent rübergeschoben und gesagt: »Geh mal runter zum Büdchen und hol dir einen Lolli!«
So habe ich Karl kennengelernt. Und beim vierten oder fünften Mal, als ich zum Büdchen kam, um einen Lolli zu kaufen, hat Karl mir das 50-Cent-Stück zurück über den Tresen geschoben und gesagt: »Lass mal stecken!«
Den Lolli habe ich trotzdem gekriegt und die 50 Cent kamen in meine Spardose.
»Kannst mir ja dafür mal was vorlesen«, hat Karl noch gesagt. »Ich hör so gerne Geschichten.«
So fing das an mit Karl und mir. Mama weiß nichts davon. Sie gibt mir immer noch ab und zu 50 Cent für einen Lolli, und ich freue mich jedes Mal darüber, weil ich das Geld in die Spardose werfen kann. Wenn ich die Dose schüttele, klimpert es schon ganz ordentlich.
Alles soll besser werden, dafür will ich sorgen. Natürlich nicht nur mit dem Geld von Mama, das wäre ja keine wirkliche Hilfe. Aber es ist ein Anfang, bis mir etwas anderes einfällt. So lange gehe ich jeden Nachmittag zu Karl ans Büdchen und lese ihm was vor. Sozusagen als Bezahlung für den Lolli. Für Karl ist das praktisch, weil er dabei weiterarbeiten kann und nicht selbst lesen muss. Ich setze mich dann mit der Zeitung oder einer Illustrierten und manchmal auch mit meinem Deutschbuch auf die Stufen vor seinem Büdchen. Karl lässt die Tür offen und räumt drinnen Sachen ein, kocht Kaffee oder sortiert die neuen Zigaretten ins Regal und hört mir dabei zu.
Irgendwann hat Karl zwischen meinen Schulbüchern mein eigentlich total geheimes Notizbuch gesehen und mich gefragt, was ich darin aufschreiben würde. Da habe ich ihm von meinem Krimi erzählt, den ich angefangen habe. Als Karl gehört hat, dass ich mal ein richtiger Schriftsteller werden will, ist er total ausgeflippt vor Begeisterung und hat gemeint, dass ich ihm unbedingt mal was aus meinem eigenen Buch vorlesen müsse.
Deshalb sitze ich jetzt hier bei ihm auf der Treppe, und weil heute nicht viel los ist, hat Karl sich einen Kaffee gekocht und sitzt ausnahmsweise auf der Stufe über mir und guckt mir über die Schulter. Was blöd ist, weil ich besser lesen kann, wenn Karl weiter in seinem Büdchen räumt und nicht dauernd mitliest. Aber wenigstens unterbricht er mich nicht immer wegen so Kleinigkeiten wie einem p zu viel oder zu wenig.
Trotzdem soll Karl nicht schon vorher wissen, wie die Geschichte weitergeht. Das nennt man Spannungsbogen. Schlimm genug, dass diese Finja einfach in meine Notizen geguckt hat. Bei Frau Wischnewski funktioniert das mit der Spannung nämlich schon ganz gut.
Frau Wischnewski ist zufällig vorbeigekommen, weil sie sich die neue Fernsehzeitung kaufen wollte, und dann ist sie einfach dageblieben und hat auch zugehört.
»Der arme Hund«, flüstert sie jetzt und schnappt selbst ein bisschen nach Luft. Sie beugt sich zu Paul runter und gibt ihm einen Hundekuchen, den sie vorher aus ihrer Kittelschürze gekramt hat. »Du musst keine Angst haben, das ist nur eine Geschichte, bestimmt geht alles gut aus«, flüstert sie und tätschelt seinen Kopf. Paul ist der Dackel von Frau Wischnewski, und sein Schmatzen verrät, dass er überhaupt keine Angst hat, sondern einfach noch mehr von diesem leckeren Hundeknabberzeug will.
Karl hat mir erzählt, dass Paul eigentlich einmal der Name von Frau Wischnewskis Mann war. Paul Wischnewski. Mit dem war Frau Wischnewski verheiratet, seit sie ein junges Mädchen gewesen war. Sie hat für ihn gekocht und die Wohnung geputzt und mit ihm abends zusammen Fernsehen geguckt, wenn er müde von der Arbeit nach Hause kam. Aber der richtige Paul Wischnewski ist vor drei Jahren ganz plötzlich gestorben. Erst habe ich gedacht, ich könnte seinen Tod vielleicht in meinem Krimi verarbeiten. Ein guter Krimi braucht eine Leiche, und da wäre es praktisch gewesen, jemanden zu verwenden, der sowieso schon tot ist. Aber Karl wusste, dass dieser Paul nur an Herzversagen gestorben war. Ganz ohne Grund. Also er wurde nicht einmal besonders erschreckt oder so und es hat ihn auch niemand vergiftet. Er hat einfach in seinem Sessel vor dem Fernseher gesessen und irgendeine langweilige Musiksendung geguckt, als sein Herz plötzlich aufgehört hat zu schlagen. Vielleicht war dem Herz die Musik auch zu langweilig gewesen. Vielleicht war es auch einfach nur müde vom vielen Arbeiten. Das kann ich für meinen Krimi nicht gebrauchen. Deshalb kommt Paul Wischnewski darin gar nicht vor. Außerdem hätte es mir auch leidgetan, wenn Paul Wischnewski ermordet worden wäre, denn dann hätte ich Frau Wischnewski zu einer Verdächtigen machen müssen. Und dafür ist sie eigentlich viel zu nett.
Weil aber die nette Frau Wischnewski keine Lust hatte, immer nur für sich alleine zu kochen, und auch abends nicht immer alleine Fernsehen gucken wollte, hat sie sich Paul aus dem Tierheim geholt. Also den anderen Paul. Den Dackel. Und der schmatzt und kaut jetzt an seinem Hundekuchen herum.
»Psst!«, zischt Karl und rückt wieder dichter an mich heran.
»’tschuldigung.« Frau Wischnewski steckt Paul schnell noch einen Krümel aus ihrer Schürzentasche zu. »Aber das ist doch wirklich gemein, so an dem armen Hund zu zerren.«
»Darum geht es aber doch gar nicht.« Karl verdreht die Augen.
»Darum geht es nicht?« Frau Wischnewski schnauft. »Aber natürlich geht es darum. Emil hat das doch eben selbst vorgelesen: Der Hund zappelte und röchelte.«
Ich hole tief Luft. So macht das alles überhaupt keinen Spaß. Die spannende Stelle mit dem Finger kommt schließlich erst noch. Karl holt auch tief Luft. Dann stellt er seine Kaffeetasse so heftig auf den Boden, dass sie klirrt und ein Schluck Kaffee auf die Treppenstufe schwappt. »Es geht doch darum, WARUM der blöde Hund so störrisch ist und unbedingt in diesem Gebüsch bleiben will. Bestimmt hat er irgendwas gefunden, das da nicht hingehört.«
Frau Wischnewski zuckt zusammen. Ihr Gesicht ist jetzt kalkweiß. Paul fiept. Frau Wischnewski fummelt noch einen Hundekuchen aus ihrer Tasche.
»Er hat es nicht so gemeint«, murmelt sie.
»Was habe ich nicht so gemeint?« Verwirrt guckt Karl von Paul zu mir, dann zu Finja und dann wieder zu mir.
»Blöder Hund«, sagt Finja. »Du hast blöder Hund gesagt.«
Frau Wischnewski stößt einen Schluchzer aus.
Ich seufze. Und lege vorsichtshalber meinen Zeigefinger auf die Stelle, an der ich aufgehört habe zu lesen.
Frau Wischnewski zieht geräuschvoll die Nase hoch. »Mein Paul ist nicht blöd. Er ist sogar ein ausgesprochen kluger Hund. Gell, Paul, das müssen wir uns nicht gefallen lassen?« Sie kramt wieder in ihrer Schürze. Diesmal zieht sie ein Taschentuch hervor, mit dem sie sich Tränen aus den Augen wischt. Dann schnäuzt sie sich so laut, dass Paul erschrocken den Kopf einzieht.
»Autsch.« Finja hat mir ihren Ellenbogen in die Seite gestoßen. »Los, lies weiter!«, zischt sie. »Schnell!«
Das ist gar nicht so einfach. Schließlich ist das meine erste öffentliche Lesung aus meinem Kriminalroman. Also eigentlich ist der Roman noch lange nicht fertig, es ist also meine erste öffentliche Lesung aus meinem noch nicht fertigen Roman, und weil ich die ganze Geschichte mit einem Bleistift in mein Notizbuch geschrieben habe, muss ich mich beim Vorlesen sehr konzentrieren, denn manchmal kann ich meine eigene Schrift nicht richtig entziffern. Das liegt daran, dass ich oft nur heimlich unter der Bettdecke schreiben kann, wenn ich eigentlich schlafen soll. Oder in der Schule unter dem Tisch, wenn die fiese Bertram mal nicht so genau hinguckt.
Die fiese Bertram ist meine neue Lehrerin. Mama mag es nicht, wenn ich sie so nenne, deshalb sage ich zu Hause immer nur »Frau Bertram«, aber verglichen mit meiner alten Lehrerin ist sie wirklich richtig fies. Meine alte Lehrerin hieß Frau Sonntag, und die war tatsächlich immer wie ein sonniger sommerwarmer Sonntag. Sie las uns jeden Freitag spannende Geschichten vor, brachte uns manchmal Eis mit oder Kuchen, hatte Heimwehbonbons und Trostpflaster in ihrer Schublade und für besonders tolle Hausaufgaben bekam man einen witzigen Sticker für das Sammelalbum. Bei Frau Sonntag machte die Schule fast immer Spaß. Aber blöderweise mussten Mama und ich umziehen, weil Mama ihren Job verloren hatte und in ihrem neuen Job nicht mehr genug verdiente, um unsere Wohnung bezahlen zu können. Und weil Papa nicht mehr da war und ihr nicht mehr helfen konnte, die Wohnung zu bezahlen. Klingt alles ein bisschen kompliziert, und irgendwann schreibe ich die ganze Geschichte auch mal auf, damit man sie besser versteht, aber das wird ein ziemlich trauriges Buch, und damit kann man nicht so viel Geld verdienen. Deshalb habe ich beschlossen, zuerst einen Krimi zu schreiben. Mit Krimis kann man nämlich ziemlich reich werden. Oder mit Science-Fiction. Aber mit Aliens und solchen Sachen kenne ich mich nicht so gut aus. Karl hat gesagt, als Science-Fiction-Autor muss man ganze Welten ganz neu erfinden. Mit allen Ländern und Flüssen, allen Orten und Pflanzen und Außerirdischen und Weltraumtechnik und allem Pipapo. Das stelle ich mir ziemlich anstrengend vor. Mir reicht es ja schon, dass wir in einen anderen Stadtteil umgezogen sind und ich deshalb auch die Schule wechseln musste. Das ist mir genug neue Welt.
Es gab in der alten Klasse eine Abschiedsparty für mich, und dann schenkte mir Frau Sonntag ein geniales Notizbuch, weil jetzt so viel Neues in meinem Leben passiert. »Damit du alles aufschreiben kannst«, sagte sie. »Bestimmt wird aus dir mal ein richtiger Schriftsteller.«
Und jetzt sitze ich auf den Treppenstufen neben Karls Büdchen und lese den Anfang meines ersten richtigen Romans vor. Das heißt, ich hätte gerne vorgelesen, wenn ich nicht dauernd dabei gestört worden wäre.
»Kannst du jetzt bitte weiterlesen?« Karl gibt mir einen Schubs. »Ich will echt wissen, was der Hund in dem Gebüsch zu suchen hatte.«
»Bestimmt einen Jogger«, murmelt Finja.
Ich gucke zu Frau Wischnewski rüber. Sie hat ihr Taschentuch wieder eingesteckt und zuppelt die ganze Zeit an ihrem Kopftuch rum.
»Soll ich?«, frage ich vorsichtshalber. Frau Wischnewski wirft Karl noch einen vernichtenden Blick zu, dann verschränkt sie ihre Arme und nickt. Die Lockenwickler auf ihrem Kopf rascheln leise.
»Okay.« Ich nicke auch. Ich blättere eine Seite zurück und wiederhole den letzten Absatz:
… erst als die Frau den Knopf für dieses Rückholdings drückte, flutschte der Hund langsam aus dem Gestrüpp. Er zappelte und …
»He, Karl, bist du da?« Eine Klingel scheppert durchs Büdchen und Karl zuckt bedauernd mit den Schultern. »Kundschaft«, sagt er und steht auf. »Da muss ich wohl.« Auch Frau Wischnewski erhebt sich mühsam von den Treppenstufen. »Das ist der Alte aus der Dreizehn«, raunt sie mir zu. »Das kann dauern.«
Ich seufze und klappe mein Notizbuch zu. Das war es dann wohl für heute mit der Lesung.
»Komm, Paulchen, das Abendessen ruft.« Frau Wischnewski bückt sich und wuchtet Paul auf ihren Arm.
Wenn er immer nur getragen wird, stirbt der Köter eines Tages noch an Herzverfettung, sagt Karl immer. Er sagt das aber nur, wenn Frau Wischnewski und ihr Dackel das nicht hören können. Ich überlege, ob der echte Paul vielleicht auch an Herzverfettung gestorben ist, aber den hat Frau Wischnewski ja ganz bestimmt nicht getragen.
»Jetzt kannst du es mir doch verraten!« Finja springt auf die Füße und lässt ihr Skateboard auf den Asphalt knallen. »Was?« Irritiert gucke ich zu ihr hoch.
»Na, das mit dem Jogger.«
Ich gebe keine Antwort. Stattdessen klappe ich das Notizbuch endgültig zu und stopfe es zurück in meine Schultasche zu den anderen Sachen. Finja starrt noch eine Weile auf mich herunter, was mich irgendwie nervös macht. Ich ziehe die Nase hoch und krame in meiner Tasche herum, als ob ich etwas suchen würde. Aus den Augenwinkeln beobachte ich die rot-weiß geringelten Beine, die immer noch vor mir stehen. Langsam weiß ich nicht mehr, was ich in meinem Ranzen noch suchen soll, ich habe jetzt bestimmt schon jedes Heft und jedes Buch dreimal in der Hand gehabt.
»Okay«, sagt Finja da. »Ich muss jetzt nach Hause.«
»Ich auch«, murmele ich, ohne hochzugucken. Ich will nicht, dass sie mir meine Erleichterung ansieht. Schnell klappe ich den Deckel runter und lasse das Schloss einschnappen. Dabei versuche ich, so viel wie möglich von meinem Ranzen mit meinen Armen zu verdecken. Es ist mir peinlich, dass lauter kleine glitzerige Planeten und Raketen über seinen Deckel flitzen.
Als ich vor fünf Jahren in die Schule gekommen war, fand ich das Muster total cool, und ich weiß noch, wie Papa mir den neuen Ranzen am ersten Schultag auf den Rücken gesetzt hat. Dann hat er mir seinen Motorradhelm über den Kopf gestülpt und angefangen, mich zu fotografieren.
»Wie ein echter Astronaut«, hat er gesagt und ist mit seiner Kamera immer um mich herumgesprungen.
Die Fotos von mir mit dem riesigen Helm auf dem Kopf und dem Weltraum-Schulranzen auf dem Rücken hängen jetzt bei uns im Flur, und Mama sagt immer, das seien die coolsten Erster-Schultag-Fotos überhaupt.
Trotzdem hätte ich gerne einen anderen Ranzen. Raketen und Planeten passen einfach nicht zu einem Schriftsteller. Höchstens zu einem, der Science-Fiction schreibt. Star Wars oder so Sachen. Aber das mit dem Ranzen kann ich Mama nicht sagen, weil so ein Ding wahnsinnig teuer ist und sie sonst wieder traurig werden würde. Und Mama ist schon viel zu oft traurig in letzter Zeit.
Frau Wischnewski
Vorname: Gerda
Alter:
59 Jahre (hat Karl mir verraten)
Frisur:
Blonde Locken.
Silke sagt, das Blond ist nicht echt, aber Frau Wischnewski soll nicht wissen, dass Silke das sagt. Außerdem hat sie sowieso meistens Lockenwickler auf dem Kopf (also Frau Wischnewski), da sieht man die Haarfarbe gar nicht.
Kleidung:
Kittelschürze mit Sonnenblumen drauf, manchmal auch mit Streifen (wenn die andere in der Wäsche ist). Pantoffeln, weil sie immer nur kurz mit dem Hund rausgeht.
Merkmale:
Ein Dackel mit so einer Zurückholleine.
Der Dackel heißt Paul, weil Frau Wischnewskis Mann auch Paul hieß. Der Mann ist aber schon lange tot.
Zusatz:
Der Dackel ist ziemlich dick. Frau Wischnewski auch.
2. Kapitel
In dem ein wichtiger Brief kommt, es Nudeln und Kartoffelbrei gibt und ich mich lieber ins Badezimmer verziehe …
Als ich die Haustür aufschließe und ins Treppenhaus komme, weiß ich sofort, dass Mama noch nicht da ist. Das sehe ich daran, dass das ganze Werbezeugs oben aus unserem Briefkasten rausguckt. Mama hat also noch nicht unsere Post geholt. Das macht sie sonst immer als Erstes, wenn sie nach Hause kommt. Obwohl wir eigentlich nie richtige Post kriegen. Also jedenfalls keine schöne Post. Einmal haben wir eine Ansichtskarte mit einem blauen Meer und einem Segelboot darauf bekommen, aber als ich die Karte umgedreht habe, war es nur Werbung für ein neues Sonnenstudio. Mama sagt, sie würde sich niemals in so ein künstliches Sonnenlicht legen wegen der ungesunden Strahlungen und so, aber sie hat die Karte in der Küche an die Pinnwand gehängt. Mit der schönen Urlaubsseite nach vorne. Nicht, weil sie in das Sonnenstudio gehen wollte, aber sie hat gesagt, wir können ja so tun, als ob uns jemand eine richtige Postkarte aus einem fernen Land geschickt hat, und dann haben wir zusammen überlegt, welches Land das wohl sein könnte und wie weit die Karte jetzt gereist ist, bis sie zu uns kam. Und das Bild mit dem Segelboot ist wirklich hübsch. Sonst wirft Mama die ganzen Prospekte immer sofort ins Altpapier und schimpft, was für eine Verschwendung das jedes Mal sei und wie viele Bäume jetzt wieder sterben mussten, nur damit die Leute wissen, dass ein Kilo Hackfleisch in dieser Woche im Angebot ist oder dass nur das Waschmittel in der hellblauen Flasche die Wäsche besonders flauschig macht. Mama und ich essen sowieso kein Fleisch. Und das hat ausnahmsweise nichts mit dem Geld, sondern auch mit den Bäumen zu tun. Ich erkläre euch das später mal.
Jedenfalls habe ich sogar mal einen Werbung-Nein-Danke-Aufkleber an unserem Briefkasten angebracht, aber das hat leider nichts genützt. Die Werbung kriegen wir trotzdem. Und manchmal glaube ich sogar, dass Mama sich heimlich darüber freut, auch wenn sie das wegen der Umwelt und so nie zugeben würde. Aber ich habe mal gesehen, wie sie auf dem Sofa in einem dieser Kataloge geblättert und mit einem Stift lauter Sachen angekreuzt hat. Um ihn dann doch wieder ins Altpapier zu werfen. Also den Katalog, nicht den Stift.
Ich fummele den Briefkasten auf und hole die Prospekte raus. Einen Schlüssel brauche ich dafür nicht, weil das Schloss sowieso schon lange kaputt ist. Zwischen den bunten Werbezetteln steckt diesmal tatsächlich auch ein richtiger Brief. Er sieht wichtig aus und irgendwie bedrohlich. Meistens lässt Mama diese Art von Briefen direkt in der Schublade unter dem Küchentisch verschwinden. Ich stopfe das Zeug in meinen Ranzen und mache mich auf den Weg in unsere Wohnung.
Bestimmt muss Mama wieder länger arbeiten. In letzter Zeit ist sie oft erst spät von der Arbeit gekommen. »Sind so viele krank«, sagt sie dann meistens. Oder auch: »Es ist Urlaubszeit. Es fehlen so viele.« Ich glaube aber, dass das nicht stimmt. In Wirklichkeit macht Mama dauernd Überstunden, damit sie ein bisschen mehr Geld verdient. Ich kannte dieses Wort nicht, Überstunden, aber ich habe neulich gehört, wie sie am Telefon zu Tami gesagt hat, dass die Überstunden ihr helfen, über die Runden zu kommen. ›Über die Runden kommen‹ heißt, dass man gerade genug Geld verdient, um überleben zu können. Kein Wunder, dass das Überstunden heißt, bei so viel ›über‹.
Tami heißt eigentlich Tamara und ist Mamas beste Freundin. Leider wohnt sie ziemlich weit weg, sodass die beiden sich nur sehr selten sehen können. Dafür telefonieren sie fast jeden Tag.
Karl hat mir später erklärt, dass Überstunden einfach die Stunden sind, die man mehr arbeitet. Also über die eigentliche Arbeitszeit hinaus.
»Wie viele Schulstunden hast du in der Woche?«, hat Karl gefragt. Ich habe ihm meinen Stundenplan gezeigt und zusammen haben wir die ausgefüllten Kästchen gezählt. Achtundzwanzig.
»Wenn du jetzt statt achtundzwanzig Stunden in der Woche dreißig Stunden zur Schule gehen würdest, dann wären das zwei Überstunden«, hat Karl gesagt. Ganz bestimmt werde ich in der Schule keine Überstunden machen. Jedenfalls nicht, wenn ich nicht dafür bezahlt werde. So wie Mama. Die bekommt Geld, wenn sie länger im Laden bleibt.
Mama arbeitet nämlich jetzt in dem großen Supermarkt in unserem Viertel. Sie sitzt dort an der Kasse und schiebt die ganzen Sachen, die die Kunden auf das Band legen, über den Scanner, der piepst dann und rechnet aus, was die Leute bezahlen müssen. Abends ist Mama immer ganz müde von dem ganzen Gepiepse. Und als ich mir mal ein Meerschweinchen gewünscht habe, hat Mama gesagt, das ginge nicht, weil Meerschweinchen auch den ganzen Tag piepsen und sie dann automatisch von mir Geld verlangen müsste. Ich könnte deshalb nur ein Haustier haben, das gar keine Geräusche macht. Einen Fisch oder so. Einen Fisch kann man aber nicht mit ins Bett nehmen zum Kuscheln und auch sonst nicht viel mit ihm anfangen. Eine Zeit lang habe ich über eine Schildkröte nachgedacht, aber so richtig kuschelig ist eine Schildkröte auch nicht. Ein Hund wäre toll, aber ein Hund kann bellen und jaulen und außerdem sind Hunde in unserer Wohnung gar nicht erlaubt.
Trotzdem wäre es schön, einen zu haben. Der würde mich jetzt an der Wohnungstür begrüßen, an mir hochspringen, mir das Gesicht ablecken und mit dem Schwanz wedeln. Was Hunde halt so tun, wenn sie sich total freuen. Zumindest glaube ich das. Okay, der Dackel von Frau Wischnewski springt vielleicht nicht mehr ganz so hoch, aber dafür kann er ganz schön laut kläffen.
Als ich in unsere Wohnung komme, ist da nichts. Kein Bellen, kein Kläffen, kein bisschen Wedeln oder Hochspringen und auch sonst keine Freude. Einfach gar nichts. Ich schlüpfe aus meinen Turnschuhen und schiebe sie unter die Kommode im Flur. Oben drüber hängen die Fotos von meiner Einschulung. Ich strecke dem Jungen in Papas Motorradhelm (also mir selber) die Zunge raus und gehe in die Küche. Solange ich auf Mama warte, kann ich vielleicht ein bisschen an meinem Krimi weiterschreiben. Schließlich muss ich mir dringend noch überlegen, zu wem der einzelne Finger gehört, den der Hund da im Gebüsch findet. Jedenfalls nicht zu einem Jogger, so viel steht fest. Während ich mein Notizbuch aus dem Ranzen krame und es aufschlage, muss ich wieder an dieses Mädchen denken. Finja. Was für ein merkwürdiger Name. Ich wüsste zu gerne, warum ich diese Finja noch nie vorher getroffen habe. Und wer dieser Watson ist, wüsste ich auch gerne. Aber erst muss ich rausfinden, wer der Kerl ist, zu dem der Finger gehört. Ich versuche verzweifelt, nicht ständig an rot-weiß geringelte Beine zu denken, was mir irgendwie nicht gelingt. Wenn man nämlich die ganze Zeit krampfhaft versucht, an etwas nicht zu denken, dann denkt man genau daran. Die ganze Zeit. Und kriegt es nicht wieder aus seinem Kopf. Ich versuche zum Beispiel immer, nicht an Papa zu denken, weil er mir so schrecklich fehlt. Aber je mehr ich versuche, nicht an ihn zu denken, desto häufiger denke ich an ihn. Und dann fehlt er mir noch viel mehr. Es funktioniert einfach nicht. Denk mal nicht an einen rosa Elefanten! Siehst du?!
Ein Elefant kommt in meiner Geschichte bisher nicht vor, aber vielleicht kann ich ihn ja noch irgendwo einbauen. Ich blättere in meinem Notizbuch auf die letzte Seite, auf der ich alles sammele, das ich vielleicht noch für mein Buch gebrauchen kann. Da höre ich den Schlüssel im Schloss. Mama ist da. Endlich.
Sie zieht gar nicht erst ihre Jacke aus, sondern kommt gleich zu mir in die Küche.
»Hallo, Schatz«, sagt sie und wuschelt mir durch die Haare. »Tut mir leid, dass du ein bisschen warten musstest. Ist so viel los gerade.« Sie lässt ihre Tasche auf den freien Stuhl plumpsen. »Hunger?«
Ich nicke und packe mein Notizbuch zurück in den Ranzen. Wird ja heute doch nix mehr mit dem Schreiben. »Was gibt’s denn?«
Mama wühlt ein bisschen in ihrer Tasche und stellt dann vier Plastikschalen auf den Tisch. Fünf-Minuten-Terrinen. Das ist Essen in so kleinen praktischen Dosen, über das du nur noch heißes Wasser kippen musst, und zack ist alles fertig.
»Nudeln mit Rahmsoße, Nudeln mit Tomatensoße, Kartoffelbrei mit Erbsen, Kartoffelbrei mit Röstzwiebeln. Such dir was aus!« Mama füllt Wasser in den Wasserkocher und schaltet ihn ein.
»Ich nehme die Nudeln«, rufe ich schnell und fummele schon mal die Aludeckelchen von allen Verpackungen. Kartoffelbrei hatte ich gestern erst. Mama bringt oft was Schnelles aus dem Supermarkt mit. Sie schimpft zwar immer auf das Fertigessen und die vielen Plastikverpackungen, aber manchmal darf sie die umsonst mitnehmen oder ganz, ganz billig, weil das Datum darauf schon abgelaufen ist. Das mit dem abgelaufenen Datum macht nix aus, sagt Mama, das ist nur so ein Trick, damit man was wegwerfen darf, das eigentlich noch gut ist. So ganz kapiere ich nicht, warum jemand etwas wegwerfen will, das man noch gar nicht wegwerfen muss. Irgendwie habe ich wohl den Trick noch nicht so richtig verstanden, aber wenn man ihn komplett verstehen würde, wäre es ja auch kein Trick mehr.
Mama gießt das heiße Wasser bis zur geriffelten Markierung in meine beiden Nudelbecher und ich rühre kräftig um. Das muss man machen, damit man keinen großen matschigen Nudelklumpen kriegt, sondern leckere fluffige Nudeln. Dann stelle ich unsere Tomatenuhr. Eigentlich ist es eine Eieruhr, also so ein Ding, das man aufzieht, und wenn es klingelt, weiß man, dass die Eier gut sind. Unsere Eieruhr ist rot und hat die Form einer Tomate. Keine Ahnung, warum das so ist. Jedenfalls habe ich noch nie gehört, dass jemand wissen will, wann die Tomaten gut sind.
Mama stellt zwei Teller auf den Tisch, einen für meine Nudeln und einen für ihren Kartoffelbrei. Daneben stellt sie zwei Gläser mit Sprudelwasser und zündet eine Kerze an. Draußen wird es langsam dunkel und in der Küche ist es jetzt richtig gemütlich. Ich mag es, mit Mama in dieser Gemütlichkeit am Tisch zu sitzen und zu essen, und Mama mag das auch. Wenn wir mal Tiefkühlpizza essen, legt sie sogar extra eine karierte Tischdecke auf den Tisch. Dann stellen wir uns vor, dass wir die Pizza in Italien essen. Dazu deckt Mama dann zwei Weingläser und daraus gibt es roten Traubensaft. Den nennt Mama vino rosso und sie sagt buon appetito und singt O sole mio. Ich war noch nie in Italien, aber Mama war früher einmal da zusammen mit Papa, das war, bevor es mich gab. Und Mama sagt, dass dort auf allen Tischen karierte Tischdecken liegen und die Italiener beim Essen die ganze Zeit singen. Muss ein tolles Land sein, dieses Italien.
Ich kippe die beiden Nudelsorten auf meinen Teller und achte sehr darauf, dass sie nicht ineinanderlaufen. So habe ich zwei Geschmacksrichtungen. Tomatensoße und Rahmsoße. Und dazwischen verläuft eine ordentliche Linie mit Nichts.
Mama patscht ihre beiden Kartoffelbreitöpfchen einfach zusammen auf den Teller. »Sieht doch lustig aus«, sagt sie und kratzt noch ein paar Erbsen aus dem Becher. Dann sagen wir beide eine Weile lang nichts mehr, weil man mit vollem Mund nicht sprechen darf.
Ein bisschen beneide ich Mama jetzt um ihren Kartoffelbreiberg, weil man da mit dem Löffel richtige Höhlen und Gänge reingraben kann. Mit den Nudeln klappt das nicht so gut, aber dafür sind sie echt lecker.
»Was hast du heute so gemacht?«, fragt Mama und legt ihren Löffel zur Seite.
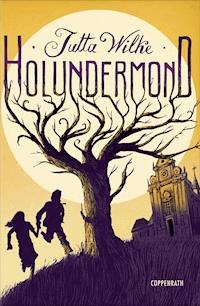


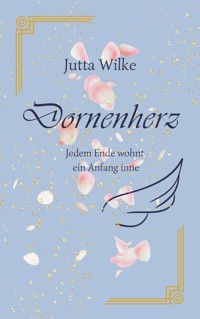














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)










