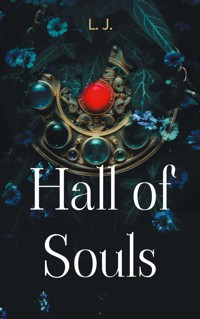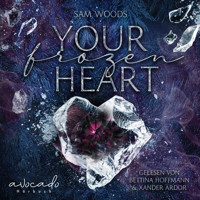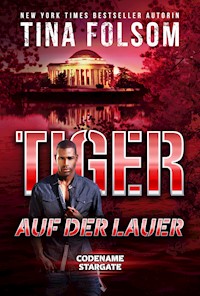Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: foliant Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Black Witch
- Sprache: Deutsch
Eine neue Schwarze Hexe wird sich erheben ... ihre Kräfte sind unvorstellbar. Elloren Gardner ist die Enkelin der letzten prophezeiten Schwarzen Hexe, Carnissa Gardner, die während des Reichskrieges die feindlichen Truppen zurückgeschlagen und das Volk der Gardnerier gerettet hat. Doch obwohl sie ihrer berühmten Großmutter wie aus dem Gesicht geschnitten ist, verfügt Elloren über keinerlei Macht in einer Gesellschaft, die magische Fähigkeiten über alles andere stellt. Als sie die Möglichkeit erhält, ihren Lebenstraum zu verwirklichen und Apothekerin zu werden, schließt sich Elloren ihren Brüdern an der angesehenen Universität von Verpax an, um ihr eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen, frei vom Schatten des Erbes ihrer Großmutter. Doch schon bald erkennt sie, dass die Universität, die alle erdenklichen Völker zulässt - darunter auch die feuerwerfenden, geflügelten Icarale, die Erzfeinde aller Gardnerier -, ein verräterischer Ort für die Enkelin der Schwarzen Hexe ist. Während das Böse am Horizont auftaucht und der Druck, ihrem Erbe gerecht zu werden, immer größer wird, stellt Elloren alles, was sie zu kennen glaubte, in Frage. Ihre größte Hoffnung liegt bei einer Gruppe von Außenseitern ... wenn sie nur den Mut aufbringen kann, denen zu vertrauen, die sie zu hassen und zu fürchten gelernt hat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 885
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
foliant Verlag1. Auflage: 2024
Die amerikanische Originalausgabe erschien unter dem TitelTHE BLACK WITCH by Laurie ForestCopyright © 2017 by Laurie ForestDie Rechte an der Nutzung der deutschen Übersetzung von Freya Rall liegen bei© Dragonfly in der Verlagsgruppe HarperCollinsDeutschland GmbH, Hamburg 2018
Alle Rechte vorbehalten, einschließlich des Rechts auf Vervielfältigung im Ganzen oder in Teilen jeglicher Form. Diese Ausgabe wird in Absprache mit Harlequin Enterprises ULC veröffentlicht.
Dies ist ein Werk der Fiktion. Namen, Personen, Orte und Begebenheiten sind entweder der Phantasie des Autors entsprungen oder werden fiktiv verwendet, und jede Ähnlichkeit mit realen lebenden oder toten Personen, Geschäftseinrichtungen Ereignissen oder Orten ist rein zufällig.
Umschlaggestaltung © HildenDesignIllustration: © HildenDesign, Veronika Wunderer
Übersetzung: Freya RallSatz: Kreativstudio foliant©foliant Verlag, Hegelstr.12, 74199 UntergruppenbacheBook AusgabeISBN 978-3-910522-51-0
www.foliantverlag.de
Für meine Mutter, Mary Jane Sexton,
Künstlerin, kreatives Genie, Intellektuelle
(1944–2015)
Inhalt
Karte
Erster Teil
Prolog
1. Halfix
2. Tante Vyvian
3. Abschied
4. Der Weißstab
5. Die Phoca
6. Valgard
7. Fallon Bane
8. Seidendamast
9. Die Schwarze Hexe
10. Die Prophezeiung
11. Aislinn Greer
12. Lukas Grey
13. Stabverwindung
14. Icarale
15. Verpatien
Zweiter Teil
Prolog
1. Die Universität von Verpax
2. Stabgeprüft
3. Einführung
4. Vizekanzlerin Quillen
5. Der Nordturm
6. Ariel
7. Wettkämpfe und Prüfungen
8. Waffen
9. Machtbalance
10. Konfrontation
11. Gardnerier
12. Metallurgie und Mathematik
13. Gardnerische Geschichte
14. Lykaner
15. Tierney Calix
16. Eisige Scherben
17. Violinenklang
18. Gnadenlos
19. Abwärtsspirale
20. Rache
21. Seelenverwandte
22. Poesie
23. Stockmagie
24. Diana Ulrich
25. Trystan
26. Geschichte
27. Damion Bane
Dritter Teil
Prolog
1. Anträge und Verfügungen des Hohen Rats
2. Randall Greyson
3. Elbenkunst
4. Lykaner-Augen
5. Wolfsgeheul
6. Jarod
7. Gefangen
8. Rettung
9. Zuflucht
10. Andras Volya
11. Sicherheit
12. Verbündete
13. Tarnung
14. Die Schlinge zieht sich zu
15. Militärdrachen
16. Elbenstahl
17. Naga
18. Yvan
19. Fae
20. Asrai-Fae
21. Eis
22. Käfigbrecher
23. Nachspiel
24. Revolutionärin
25. Zweihundertsechsundfünfzig
Laurie Forest
Erster Teil
Prolog
Es ist so schön im Wald.
Die Bäume sind meine Freunde, und ich fühle, wie sie auf mich herablächeln.
Fröhlich hüpfe ich dicht auf den Fersen meines geliebten Onkels dahin, fege trockene Kiefernnadeln mit den Füßen durch die Gegend und singe nur für mich. Dann und wann dreht Onkel Edwin sich zu mir um und winkt mir lächelnd, ihm zu folgen.
Ich bin drei Jahre alt.
So tief in den Wald sind wir noch nie gewandert, und mich erfüllt leuchtend ein Gefühl von Abenteuer. Eigentlich gehen wir überhaupt fast nie in den Wald. Und Onkel Edwin hat nur mich mitgenommen. Meine Brüder hat er zu Hause gelassen, weit hinter uns.
Ich habe Mühe, ihm hinterherzukommen, springe über aufragende Wurzeln und weiche niedrig hängenden Ästen aus.
Schließlich machen wir auf einer sonnigen Lichtung tief im Wald Halt.
»Hier, Elloren«, sagt mein Onkel. »Ich hab was für dich.« Er geht auf ein Knie, holt einen Stock aus seiner Manteltasche und drückt ihn mir in die kleine Hand.
Ein Geschenk!
Es ist ein ganz besonderer Stock – leicht und luftig. Ich schließe die Augen, und in mir steigt ein Bild von dem Baum auf, von dem der Stock stammt – ein hoher, weit verästelter Baum, sonnengetränkt und sandverwurzelt. Als ich die Augen wieder öffne, lasse ich den Stock in meiner Hand auf- und abwippen. Er ist leicht wie eine Feder.
Mein Onkel fischt einen Wachsstumpen aus der Hosentasche, steht auf, stellt die Kerze auf einen Baumstumpf in der Nähe und kommt zu mir.
»So hältst du den Stab, Elloren«, erklärt er freundlich, bückt sich und legt seine Hand um meine.
In mir regt sich leise Sorge, und ich schaue zu ihm auf.
Warum zittert seine Hand?
Ich umfasse den Stock fester, will mein Bestes geben und tun, was er von mir erwartet.
»Genau so, Elloren«, lobt er geduldig. »Und jetzt sage ich gleich ein paar komische Wörter und möchte, dass du sie mir nachsprichst. Schaffst du das?«
Eifrig nicke ich. Natürlich schaffe ich das. Für meinen Onkel Edwin würde ich alles tun.
Er spricht mir die Wörter vor. Es sind nur wenige, und erneut bin ich stolz und glücklich. Obwohl es eine fremde Sprache ist und es sich komisch anhört in meinen Ohren, sind sie ganz leicht auszusprechen. Ich werde das gut machen, und er wird mich umarmen und mir vielleicht sogar ein paar von den Sirupkeksen geben, die ich ihn habe einstecken sehen, bevor wir losgegangen sind.
Ich strecke den Arm aus, gerade und fest, und richte den Federstock auf die Kerze, genau, wie er es mir gesagt hat. Direkt hinter mir spüre ich ihn, wie er mich aufmerksam beobachtet und sehen will, wie gut ich aufgepasst habe.
Ich öffne den Mund und beginne, die fremdartige Wortfolge aufzusagen.
Während die Worte über meine Zunge rollen, steigt etwas Warmes, Rumorendes in meine Beine hinauf, geradewegs aus dem Boden unter meinen Füßen.
Etwas von den Bäumen.
Mächtige Energie strömt durch mich hindurch und in den Stock. Meine Hand ruckt heftig hoch, dann ist da ein gleißender Blitz. Eine Explosion. Feuer schießt aus der Spitze des Stocks. Plötzlich sind die Bäume um uns herum in Flammen gehüllt. Überall Feuer. Der Klang meiner eigenen Schreie. Das Kreischen der Bäume in meinem Kopf. Das entsetzliche Brüllen des Feuers. Hastig wird mir der Stock aus der Hand gerissen und weggeworfen. Mein Onkel packt mich, presst mich fest an seine Brust und flieht vor dem Feuer, während der Wald um uns tosend und krachend zerfällt.
Von da an ist alles anders für mich im Wald.
Ich spüre, wie die Bäume sich von mir zurückziehen, ein ungutes Gefühl. Und ich beginne, die verwilderten Stellen zu meiden.
Mit der Zeit wird die Kindheitserinnerung verwaschen.
»Es war nur ein Traum«, sagt mein Onkel, wenn er mich trösten muss, weil die Brandszene mich im Dunkel der Nacht heimgesucht hat. »Von damals, als du dich im Wald verirrt hast. Als dieses Gewitter war. Denk an was Schönes und schlaf weiter.«
Und so glaube ich ihm, denn er sorgt für mich und hat mir nie Anlass gegeben, ihm nicht zu glauben.
Selbst der Wald scheint seine Worte zu bekräftigen. Schlaf weiter, rascheln die Blätter im Wind. Und über die Jahre verblasst die Erinnerung wie ein Stein, der in einen tiefen, dunklen Brunnen fällt.
Ins Reich der Schatten und Albträume.
Vierzehn Jahre später …
1. Kapitel
Halfix
»Nimm das, du blöder Icaral!«
Amüsiert schaue ich auf die kleinen Nachbarsjungen hinunter, einen Korb mit frisch geerntetem Gemüse und Kräutern auf die Hüfte gestützt. Trotz der warmen Sonne schlängelt sich ein Hauch frühherbstlicher Kühle um meine Knöchel.
Emmet und Brennan Gaffney sind sechs Jahre alt. Die Zwillinge haben das schwarze Haar, die waldgrünen Augen und die helle, leicht grün überhauchte Haut, auf die mein Volk, die Magi von Gardnerien, so stolz sind.
Als sie mich bemerken, halten die zwei Jungen in ihrem lärmenden Spiel inne und schauen hoffnungsvoll zu mir auf. Sie sitzen im kühlen Gras in der Sonne, ihre Spielzeugfiguren liegen verstreut um sie herum.
Unter den in leuchtenden Farben bemalten Holzfiguren finden sich all die traditionellen Charaktere. Mit kühn erhobenem Schwert oder Zauberstab stehen die schwarzhaarigen gardnerischen Soldaten da, auf der Brust ihrer dunklen Tunika der vertraute, silbern glänzende Kreis, der für unseren Planeten Aerda steht. Die Zwillinge haben sie auf einem großen, flachen Stein in militärischer Formation aufgestellt.
Dazu gibt es die gewohnten Erzschufte – die bösen Icaral-Dämonen mit ihren glühenden Augen, die Gesichter zu einem breiten, heimtückischen Grinsen verzerrt, die schwarz gefiederten Flügel einschüchternd zu ihrer vollen Spannweite gereckt, Feuerbälle in ihren Fäusten. Diese Figuren haben die Jungen auf einem Holzscheit aufgereiht, und sie versuchen, sie aus der Richtung der Soldaten mithilfe eines selbst gebastelten Katapults aus Stöcken und Schnur mit Steinen abzuschießen.
Diverse Nebenfiguren stehen bereit: die schönen gardnerischen Jungfrauen mit ihrer zartgrünen Haut und dem wallenden schwarzen Haar; niederträchtige Lykaner – Gestaltwandler, die halb Wolf, halb Mensch sind; grüngeschuppte Schlangenelben; die mysteriösen Runenzauberinnen der Vu Trin. Sie alle sind Gestalten aus den Geschichten und Liedern meiner Kindheit, genauso vertraut wie die Patchwork-Decke, die auf meinem Bett liegt.
»Was macht ihr denn hier?«, frage ich die Jungen und schaue ins Tal hinunter, wo das Anwesen der Gaffneys sich inmitten ihrer ausgedehnten Plantage ausbreitet. Normalerweise hat Eliss Gaffney ein scharfes Auge darauf, dass die Jungs dicht beim Haus bleiben.
»Mama weint die ganze Zeit.« Mit finsterer Miene rammt Emmet eine der Wolfskreaturen mit dem Kopf voran in den Boden.
»Nicht sagen!«, fährt Brennan ihn mit schriller Stimme an. »Dafür kriegst du’s mit der Peitsche von Papa! Er hat gesagt, wir sollen das nicht rumerzählen!«
Brennans Angst überrascht mich nicht. Es ist wohlbekannt, dass Magus Warren Gaffney ein harter Mann ist, von seiner Anverwundenen ebenso gefürchtet wie von seinen Kindern. Und das unerwartete Verschwinden seiner neunzehnjährigen Tochter Sagellyn hat ihn noch härter gemacht.
Wieder blicke ich zu den Ländereien der Gaffneys hinüber und spüre die altbekannte Sorge in mir aufsteigen.
Wo bist du, Sage, frage ich mich unglücklich. Mittlerweile ist sie seit über einem Jahr spurlos verschwunden. Was kann dir nur passiert sein?
Bekümmert seufze ich auf und wende mich den Zwillingen zu. »Ist schon gut«, versuche ich sie zu beruhigen. »Ihr könnt gern noch eine Weile hierbleiben. Ihr dürft sogar mit uns zu Abend essen.«
Die Gesichter der Jungen hellen sich auf, sie wirken mehr als nur ein bisschen erleichtert.
»Komm und spiel mit uns, Elloren«, bettelt Brennan und hält mich am Saum meiner Tunika fest.
Leise lachend greife ich nach unten und wuschle dem Jungen durchs Haar. »Später vielleicht. Erst mal muss ich helfen, das Abendessen vorzubereiten, das wisst ihr doch.«
»Wir besiegen die Icarale!«, verkündet Emmet. Zur Demonstration wirft er einen Stein auf einen der Dämonen. Als er die kleine Figur trifft, fliegt sie ins hohe Gras. »Wollen wir gucken, ob wir die Flügel abschießen können?«
Ich nehme die Schnitzerei hoch und streiche mit dem Daumen über die unbemalte Standfläche. Tief atme ich ein, schließe die Augen und spüre, wie das Bild eines mächtigen Baums mit dichter Krone, ausladenden Ästen und zarten weißen Blüten meinen Geist erfüllt.
Bereifter Weißdorn. So ein elegantes Holz für ein Kinderspielzeug.
Ich verdränge das Bild und konzentriere mich wieder auf die orangefarbenen Augen des Spielzeugdämons. Bewusst unterdrücke ich den Drang, mir erneut den Baum zu vergegenwärtigen – ich werde mich hüten, dieser seltsamen Marotte von mir noch Nahrung zu geben.
Wenn ich ein Stück Holz in der Hand halte und die Augen schließe, kann ich oft den Baum erspüren, von dem es stammt, und zwar erstaunlich detailliert. Ich sehe den Geburtsort des Baums, rieche den satten, lehmigen Grund unter seinen Wurzeln, spüre die Sonnenstrahlen, die seine ausgebreiteten Blätter kitzeln.
Natürlich habe ich gelernt, diese albernen Vorstellungen für mich zu behalten.
Eine seltsame Naturfixierung wie diese riecht nach Fae-Blut, und Onkel Edwin hat mich gewarnt, niemals davon zu sprechen. Wir Gardnerier sind ein reinblütiges Volk, unbesudelt von den Heiden um uns herum. Und meine Familie hat das stärkste, reinste Magierblut von allen.
Aber oft mache ich mir Sorgen. Wenn das stimmt, warum sehe ich dann solche Dinge?
»Ihr solltet sorgsamer mit euren Spielsachen umgehen«, tadle ich die Jungen sanft, während ich das hartnäckig nachklingende Bild des Weißdorns endgültig abschüttle und die Figur wieder auf das Holzscheit stelle.
Das Getöse der heldenhaften Schlachten der Zwillinge bleibt hinter mir zurück, als ich mich dem kleinen Häuschen nähere, in dem ich mit Onkel Edwin und meinen beiden Brüdern wohne. Über die ausgedehnte Wiese schaue ich zu unserem Pferdestall hinüber und schrecke zusammen.
Vor dem Gebäude ist eine große, elegante Kutsche abgestellt. Kunstvoll ist das Wappen des Rats der Magi auf die Tür gemalt – ein goldenes M in anmutiger, verschnörkelter Kalligrafie. Der Rat der Magi ist Gardneriens höchste Regierungsinstanz.
Davor sitzen vier Wachleute vom Militär, lebendige Versionen von Emmets und Brennans Spielfiguren, und essen. Es sind kräftige in schwarze Tuniken mit einem silbernen Kreis auf der Brust gehüllte Soldaten mit Zauberstäben und Schwertern am Gürtel.
Es muss die Kutsche meiner Tante sein – jemand anders kann es gar nicht sein. Meine Tante ist Mitglied des regierenden Hohen Rats der Magi, deshalb reist sie immer mit einer bewaffneten Eskorte.
Aufregung durchrauscht mich, und ich beschleunige meine Schritte, während ich mich frage, was um alles auf Aerda meine mächtige Tante ausgerechnet ins abgelegene Halfix führen könnte.
Als ich sie das letzte Mal gesehen habe, war ich fünf Jahre alt.
Damals wohnten wir ganz in ihrer Nähe, in Valgard, Gardneriens geschäftiger Hafen- und Hauptstadt. Zu Gesicht bekamen wir sie aber kaum.
Eines Tages tauchte meine Tante aus heiterem Himmel im Verkaufsraum der Geigenbauwerkstatt meines Onkels auf.
»Hast du die Kinder schon stabprüfen lassen?«, erkundigte sie sich in lockerem Tonfall, doch ihr Blick war scharf wie Eis.
Ich weiß noch, wie ich versuchte, mich hinter Onkel Edwin zu verstecken, und mich völlig im Bann dieses eleganten Wesens vor mir an seine Tunika klammerte.
»Natürlich, Vyvian«, antwortete mein Onkel seiner Schwester stockend. »Sogar mehrfach.«
Verwirrt und überrascht schaute ich zu ihm auf. Ich konnte mich nicht erinnern, je stabgeprüft worden zu sein, obwohl ich wusste, dass alle gardnerischen Kinder irgendwann auf ihre magischen Fähigkeiten untersucht wurden.
»Und mit welchem Ergebnis?«, bohrte sie nach.
»Rafe und Elloren haben keinerlei nennenswerte Fähigkeiten«, sagte er ihr und verlagerte unmerklich das Gewicht, sodass ich Tante Vyvian nicht mehr sehen konnte und in seinem Schatten stand. »Aber Trystan. In dem Jungen steckt durchaus einige Magie.«
»Bist du dir sicher?«
»Ja, Vyvian, bin ich.«
Von diesem Tag an besuchte sie uns regelmäßig.
Bald darauf wurde mein Onkel das Leben in der Stadt unerwartet leid. Ohne Vorwarnung verfrachtete er meine Brüder und mich dorthin, wo wir heute leben. Ins winzige Halfix. Am äußersten nordöstlichen Rand von Gardnerien.
Mitten im Nirgendwo.
Als ich um die Ecke trete, höre ich aus dem Küchenfenster meinen Namen und bleibe abrupt stehen.
»Elloren ist kein Kind mehr, Edwin.«
Es ist die Stimme meiner Tante, die nach draußen weht. Ich stelle meinen Korb mit dem Gemüse und den Kräutern auf dem Boden ab und gehe in die Hocke.
»Sie ist zu jung für eine Verwindung.« Der Versuch meines Onkels, ihr die Stirn zu bieten, doch in seiner Stimme liegt ein nervöses Zittern.
Verwindung? Mein Herz schlägt schneller. Ich weiß, dass viele gardnerische Mädchen in meinem Alter längst verwunden sind – durch Magie lebenslang an einen jungen Mann gebunden. Aber wir sind so isoliert hier, umgeben von den Bergen. Das einzige verwundene Mädchen, das ich kenne, ist Sage, und die hat sich in Luft aufgelöst.
»Siebzehn ist das traditionelle Alter.« Meine Tante klingt leicht verärgert.
»Es ist mir egal, ob es das traditionelle Alter ist«, beharrt mein Onkel, sein Tonfall gewinnt an Sicherheit. »Es ist trotzdem zu jung. In diesem Alter kann sie unmöglich schon wissen, was sie will. Sie hat noch nichts von der Welt gesehen …«
»Weil du sie nichts hast sehen lassen.«
Von meinem Onkel kommt ein Protestlaut, doch sie fährt ihm über den Mund: »Nein, Edwin. Was mit Sagellyn Gaffney passiert ist, sollte für uns alle ein Weckruf sein. Lass mich Elloren unter meine Fittiche nehmen. Ich stelle sie nur den erstrebenswertesten jungen Männern vor. Und wenn sie erst sicher mit einem verwunden ist, kann sie ihre Ausbildung beim Hohen Rat beginnen. Du musst dich endlich ernsthaft mit ihrer Zukunft auseinandersetzen.«
»Ich nehme ihre Zukunft ernst, Vyvian, aber sie ist viel zu jung, als dass jemand anders für sie darüber entscheiden sollte.«
»Edwin.« Jetzt liegt in der seidigen Stimme meiner Tante ein Hauch von Schärfe. »So zwingst du mich, die Angelegenheit selbst in die Hand zu nehmen.«
»Du vergisst, Vyvian«, kontert mein Onkel, »dass ich immer noch das älteste männliche Familienmitglied bin und damit bei allem, was Elloren betrifft, das letzte Wort habe. Und wenn ich nicht mehr bin, dann wird es Rafe sein, der das letzte Wort hat, nicht du.«
Bei diesen Worten schießen meine Augenbrauen in die Höhe. Wenn mein Onkel auf dieses Argument zurückgreift, muss er sich auf dünnem Eis bewegen – ich weiß, dass er dieser Regelung äußerst kritisch gegenübersteht. Immer wieder beklagt er sich darüber, wie ungerecht die gardnerischen Machtstrukturen Frauen gegenüber sind, und er hat recht damit. Nur wenige gardnerische Frauen verfügen über Stabmagie, meine mächtige Großmutter war eine seltene Ausnahme. Fast alle unsere mächtigen Magier sind Männer – unsere Magie vererbt sich leichter über die männliche Linie. Das macht die Männer zu den Herrschern im Haus und über das Land.
Onkel Edwin ist jedoch der Meinung, dass unser Volk es damit zu weit treibt: Keine Zauberstäbe für Frauen, solange der Hohe Rat nicht zugestimmt hat; die ultimative Kontrolle über die Familie liegt grundsätzlich in der Hand des ältesten männlichen Mitglieds. Die höchste Regierungsposition, das Amt des Großmagus, kann nur von einem Mann eingenommen werden. Und dann ist da noch das bei Weitem größte Problem meines Onkels mit dieser Kultur – unsere Frauen werden in immer jüngeren Jahren verwunden.
»Du kannst sie nicht ewig vor allem abschirmen«, drängt meine Tante weiter. »Was ist, wenn du eines Tages nicht mehr da bist und sämtliche geeigneten Männer bereits verwunden sind?«
»Dann wird sie die Mittel haben, ihren eigenen Weg zu gehen, das ist.«
Darüber lacht meine Tante nur. Selbst ihr Lachen ist anmutig. Es beschwört bei mir das Bild eines hübschen Wasserfalls herauf. Ich wünschte, ich könnte so lachen.
»Und wie, bitte schön, soll sie ›ihren eigenen Weg gehen‹?«
»Ich habe beschlossen, sie zur Universität zu schicken.«
Unwillkürlich hole ich so tief Luft, wie es nur geht, und halte sie an, unfähig, weiterzuatmen, zu geschockt, um mich zu rühren. Die Gesprächspause im Haus lässt vermuten, dass meine Tante ungefähr genauso reagiert.
Die Universität von Verpax. Mit meinen Brüdern. In einem komplett anderen Land. Ein Traum, von dem ich niemals geglaubt habe, er könnte tatsächlich wahr werden.
»An die Universität? Wozu?«, fragt meine Tante entsetzt.
»Um das Apothekerhandwerk zu erlernen.«
Ich bin verblüfft. Schwindelerregende Freude wallt in mir auf. Seit Jahren bettle ich Onkel Edwin an, mich dorthin gehen zu lassen. Ich will mehr als unsere kleine Büchersammlung und die selbst angebauten Kräuter und bin erfüllt von brennendem Neid auf Trystan und Rafe, die dort studieren dürfen.
Die Universität von Verpax. In Verpatiens pulsierender Hauptstadt. Mit ihren Apotheker-Laboratorien und Gewächshäusern. Das sagenumwobene Gardnerische Athenaeum, das nur so überquillt vor Büchern. Apothekerbedarf, der auf der zentralen Handelsroute des Kontinents aus Ost und West auf Verpax’ Märkte strömt.
Mir schwirrt der Kopf angesichts all der aufregenden Möglichkeiten.
»Ach, komm schon, Vyvian«, beschwichtigt mein Onkel sie. »Jetzt schau nicht so finster drein. Das Apothekerfach ist ein respektables Handwerk für Frauen, und es passt viel besser zu Ellorens stiller Büchernatur, als es der Hohe Rat je könnte. Elloren liebt ihre Kräuterbeete, die Arzneiherstellung und das alles. Darin ist sie richtig gut.«
Es entsteht ein unbehagliches Schweigen.
»Du lässt mir keine andere Alternative, als mich in dieser Sache entschlossen gegen dich zu stellen«, erklärt meine Tante dann, jetzt ist ihre Stimme leise und hart. »Dir ist sicher klar, dass ich keinen einzigen Gulden in Ellorens universitäre Ausbildung stecken kann, solange sie unverwunden ist.«
»Mit so etwas in der Art habe ich gerechnet«, antwortet mein Onkel kühl. »Aus diesem Grund habe ich dafür gesorgt, dass Elloren ihren Zehnten in Form von Küchendienst ableisten kann.«
»Das hat es noch nie gegeben!«, bricht es aus meiner Tante heraus. Ihre Stimme ist scharf und wütend. »Du hast diese Kinder aufgezogen wie celtische Bauern«, fährt sie ihn an. »Und um es deutlich auszudrücken, Edwin, es ist eine Schande. Du hast vergessen, wer wir sind. Noch nie habe ich davon gehört, dass ein gardnerisches Mädchen, erst recht keines von Ellorens Stellung, in der Küche gearbeitet hätte. Das sind Aufgaben für Uriskinnen, für Celten, nicht für ein Mädchen wie Elloren. Ihre Mitstudenten werden schockiert sein.«
Erschrocken zucke ich zusammen, als mich etwas Großes von der Seite anrempelt. Als ich herumfahre, lässt mein älterer Bruder Rafe sich breit grinsend neben mir auf den Boden fallen.
»Na, hab ich dich erschreckt, Schwesterherz?«
Es ist mir unbegreiflich, wie ein so großer und muskulöser Mensch sich so katzenhaft leise bewegen kann. Ich nehme an, seine Leichtfüßigkeit liegt an all der Zeit, die er mit Wanderungen und Jagdausflügen in der Wildnis verbringt. Unübersehbar kommt er auch jetzt gerade von der Jagd zurück – um die eine Schulter hat er sich Bogen und Köcher geschlungen, über der anderen hängt kopfüber eine tote Gans.
Ich feuere einen strengen Blick auf ihn ab und hebe den Finger vor den Mund, damit er still ist. Tante Vyvian und Onkel Edwin streiten wieder über meine Stabverwindung.
Nach wie vor lächelnd hebt Rafe neugierig die Augenbrauen und neigt den Kopf zum Fenster. »Ah«, flüstert er und stößt mich kameradschaftlich mit der Schulter an. »Sie reden über deine eheliche Zukunft.«
»Das Beste hast du verpasst«, raune ich ihm zu. »Vorhin ging es darum, dass du mein Herr und Meister wirst, wenn Onkel Edwin mal nicht mehr da ist.«
Rafe lacht leise. »Ja, und die erste Amtshandlung meiner eisernen Herrschaft wird sein, dass du sämtliche Hausarbeiten für mich übernehmen musst. Vor allem den Abwasch.«
Darauf verdrehe ich nur die Augen.
»Und dann lasse ich dich mit Gareth verwinden«, triezt er mich weiter.
Verblüfft starre ich ihn mit offenem Mund an. Gareth, mit dem wir seit frühesten Kindertagen befreundet sind, ist wie ein Bruder für mich. Ich habe keinerlei romantisches Interesse an ihm, nicht im Geringsten.
»Was?«, fragt Rafe lachend. »Du könntest es weit schlimmer erwischen, nur dass du’s weißt.« Ihm fällt etwas hinter mir ins Auge, und sein Lächeln wird breiter. »Ach, guck mal, wer da ist. Hi, Gareth. Trystan.«
Soeben sind Trystan und Gareth um die Ecke gebogen und kommen auf uns zu. Als ich Gareths Blick auffange, läuft er puterrot an und schaut betroffen und verschämt weg.
Ich würde am liebsten im Boden versinken. Offensichtlich hat er Rafes Witzelei gehört.
Gareth ist mit seinen zwanzig ein paar Jahre älter als ich, breit und stabil gebaut, mit den gleichen dunkelgrünen Augen und schwarzen Haaren wie wir anderen auch. Doch einen Unterschied gibt es: In Gareths schwarzem Schopf liegt der Hauch eines silbrigen Schimmers – äußerst ungewöhnlich bei Gardneriern, und viele betrachten das als Zeichen unreinen Bluts. Schon sein Leben lang wird er deshalb gnadenlos gehänselt. »Promenadenmischung«, »Elbling« und »Fae-Blut« sind nur einige der Beleidigungen, die ihm von den anderen Kindern an den Kopf geworfen wurden. Kapitänssohn Gareth hat das alles stoisch über sich ergehen lassen, Trost gab es für ihn bei seinem Vater auf See – oder hier bei uns.
Mir steigt eine unangenehme Röte in die Wangen. Ich liebe Gareth wie einen Bruder, aber mit ihm verwunden werden will ich ganz bestimmt nicht.
»Was macht ihr da?«, fragt mein jüngerer Bruder Trystan verwirrt, als er uns unter dem Fenster hocken sieht.
»Wir lauschen«, flüstert Rafe fröhlich.
»Wieso?«
»Unsere Ren hier wird bald verwunden«, antwortet Rafe.
»Werde ich nicht.« Ich schneide Rafe eine Grimasse, bevor ich zu Trystan aufschaue. Wieder sprudelt diese schwindelerregende Freude in mir hoch. Ich kann ein Grinsen nicht unterdrücken. »Aber ich gehe zur Universität.«
Überrascht hebt Trystan eine Augenbraue. »Du machst Witze.«
»Nö«, erklärt Rafe gut gelaunt.
Wohlwollend mustert Trystan mich. Ich weiß, dass mein stiller, fleißiger kleiner Bruder die Universität liebt. Trystan ist der Einzige von uns, der magische Kräfte hat, und dazu ist er auch noch ein talentierter Bogenbauer und Pfeilmacher. Obwohl er erst sechzehn ist, wurde er bereits vorläufig in die gardnerische Waffengilde aufgenommen und macht seine Ausbildung beim Militär.
»Toll, Ren.« Trystan freut sich. »Dann können wir im Speisesaal zusammen essen.«
Mit einer gespielt strengen Geste bringt Rafe ihn zum Schweigen und deutet zum Fenster.
Uns zuliebe duckt sich mein drahtiger kleiner Bruder und geht neben uns in die Hocke. Gareth tut es ihm gleich, wirkt dabei aber, als fühle er sich ziemlich unbehaglich.
»Das ist falsch, Edwin. Du kannst sie unmöglich zur Universität schicken, ohne sie vorher mit jemandem zu verwinden.« Langsam wirkt der herrische Tonfall meiner Tante angegriffen.
»Wieso?«, entgegnet mein Onkel herausfordernd. »Ihre Brüder sind ebenfalls unverwunden, und Elloren ist nicht dumm.«
»Sagellyn Gaffney war auch nicht dumm«, warnt meine Tante in düsterem Ton. »Du weißt genauso gut wie ich, dass sie da alle möglichen unangebrachten Gestalten zulassen: Celten, Elbholle … Dieses Jahr sind sogar zwei Icarale dabei. Ja, Edwin, Icarale.«
Ungläubig reiße ich die Augen auf. Icarale! An der Universität? Wie soll das überhaupt möglich sein? Celtische Bauern und elbische Halbblüter sind das eine, aber Icarale?! Alarmiert schaue ich zu Rafe hinüber, der bloß die Achseln zuckt.
»Andererseits ist das auch kaum eine Überraschung«, bemerkt meine Tante angewidert. »Der Verpatische Rat ist voll von Halbblütern. Genau wie ein Großteil der universitären Strukturen. Da wird ein absurdes Ausmaß von Integration vertreten – deutlicher gesagt ist es schlicht gefährlich, was da stattfindet.« Sie stößt frustriert ein Schnauben aus. »Marcus Vogel wird diese Situation bereinigen, wenn er erst einmal zum Großmagus ernannt wird.«
»Falls, Vyvian«, kontert mein Onkel knapp. »Vielleicht gewinnt Vogel gar nicht.«
»Oh, und wie er gewinnen wird«, trumpft meine Tante auf. »Seine Anhängerschaft wächst.«
»Mir ist wirklich nicht klar, inwiefern das alles Elloren betrifft«, wirft Onkel Edwin ungewohnt scharf ein.
»Es betrifft Elloren, weil ein Potenzial besteht, dass sie in eine höchst unpassende romantische Verbindung hineingezogen wird, die ihre Zukunft ruinieren und die gesamte Familie in ein schlechtes Licht rücken würde. Wenn sie allerdings verwunden wäre, so wie fast alle gardnerischen Mädchen in ihrem Alter, könnte sie ohne Bedenken die Universität be…«
»Vyvian«, schneidet mein Onkel ihr das Wort ab. »Mein Entschluss steht fest. Das wird sich auch nicht ändern.«
Schweigen.
»Also gut.« Aus dem Seufzen meiner Tante klingt tiefes Missfallen. »Wie ich sehe, bist du im Augenblick fest entschlossen, aber lass sie wenigstens die nächsten ein, zwei Wochen mit mir verbringen. Valgard liegt auf dem Weg von hier zur Universität, da ist es nur sinnvoll, dass sie vor Semesterbeginn eine Weile bei mir bleibt.«
»In Ordnung«, gibt Onkel Edwin sich erschöpft geschlagen.
»Nun denn«, sagt sie und klingt schon deutlich fröhlicher. »Schön, dass wir das geklärt haben. Und wenn meine Nichte und meine Neffen nun freundlicherweise aufhören würden, unter dem Fenster herumzukriechen, und stattdessen zu uns hereinkämen, damit ich alle begrüßen kann – das wäre reizend.«
Ertappt zucken Gareth, Trystan und ich zusammen.
Rafe schaut zu mir, hebt die Augenbrauen und grinst.
2. Kapitel
Tante Vyvian
Als ich mich auf den Weg in die Küche mache, schwirren die Gaffney-Zwillinge an mir vorbei. Drinnen erwartet uns fröhliches, lärmendes Getümmel.
Meine Tante steht mit dem Rücken zu mir, als sie Rafe zur Begrüßung auf beide Wangen küsst. Daneben ist mein Onkel und schüttelt Gareth die Hand, während die Zwillinge praktisch an Trystan hängen, wobei sie ihm ihre Spielzeugfiguren zur Begutachtung unter die Nase halten.
Meine Tante lässt Rafe los, bewundert, wie groß er geworden ist, und wendet sich in einer fließenden, anmutigen Bewegung zu mir um.
Als ihr Blick auf mich fällt, erstarrt sie, und ihre Augen weiten sich, als sähe sie sich einem Geist gegenüber.
Es wird still im Raum, als alle anderen voller Neugier zu uns herüberschauen und sich fragen, was los ist. Nur mein Onkel wirkt nicht verwirrt – seine Miene ist unvermittelt seltsam düster und besorgt.
»Elloren«, haucht Tante Vyvian. »Du bist zum absoluten Ebenbild deiner Großmutter herangewachsen.«
Das ist ein riesiges Kompliment, und ich möchte es gern glauben. Meine Großmutter war nicht nur eine der mächtigsten Magi meines Volks, sondern galt auch als außergewöhnlich schön.
»Danke«, sage ich schüchtern.
Ihr Blick gleitet zu meiner schlichten, selbst gemachten Kleidung hinunter.
Wenn in unserer kleinen Küche jemals jemand fehl am Platz gewirkt hat, dann meine Tante, wie sie dasteht und mich mustert – zwischen abgestoßenen Holzmöbeln, Töpfen mit köchelnder Suppe auf dem Herd und Büscheln von Kräutern, die zum Trocknen von der Decke hängen.
Sie ist wie ein kunstvolles Gemälde, das jemand im Marktstand eines Bauern aufgehängt hat.
Zum ersten Mal nehme ich bewusst ihre eng anliegende schwarze Tunika wahr, die über einen langen, dunklen Rock drapiert ist. Auf die Seide sind zarte Ranken gestickt. Meine Tante verkörpert den Inbegriff dessen, was vom Äußeren einer gardnerischen Frau erwartet wird – hüftlanges schwarzes Haar, tiefgrüne Augen und schwarze Verwindungslinien, die sich um ihre Handgelenke schlängeln.
Unvermittelt wird mir meine eigene traurige Erscheinung unangenehm bewusst. Mit meinen siebzehn Jahren bin ich groß und schlank und habe die gleichen schwarzen Haare und waldgrünen Augen wie meine Tante, doch an dieser Stelle hören die Ähnlichkeiten auf. Was ich anhabe, ist eine formlose braune Wolltunika über einem Rock aus dem gleichen Material, ich trage keinerlei Make-up (ich besitze keins), mein Haar ist zu meinem üblichen unordentlichen Knoten zusammengefasst, und mein Gesicht besteht aus nichts als strengen Ecken und Kanten, kein Vergleich zu den hübschen, sanft geschwungenen Linien bei meiner Tante.
Schwungvoll schließt sie mich in die Arme, offensichtlich ist sie nicht so bestürzt über mein Erscheinungsbild wie ich.
Sie küsst mich auf beide Wangen und tritt zurück, hält jedoch noch immer meine Oberarme umfasst. »Ich kann einfach nicht glauben, wie ähnlich du ihr siehst«, schwärmt sie voller ehrfürchtiger Bewunderung. In ihren Blick tritt Wehmut. »Ich wünschte, du hättest sie kennenlernen können, Elloren.«
»Ich auch«, antworte ich, das Wohlwollen meiner Tante erfüllt mich mit Wärme.
Tante Vyvians Augen glänzen bewegt. »Sie war eine herausragende Magia. Die beste aller Zeiten. Das ist ein Erbe, auf das du stolz sein kannst.«
Inzwischen macht mein Onkel sich in der Küche zu schaffen, läuft hin und her, deckt Teetassen und Teller auf und knallt sie dabei etwas zu laut auf den Tisch. Während er so herumwuselt, schaut er mich nicht ein einziges Mal an, sein seltsames Verhalten verwirrt mich. Gareth steht wie angewurzelt neben dem Holzofen, hat die muskulösen Arme vor der Brust verschränkt und beobachtet meine Tante und mich aufmerksam.
»Du musst müde sein nach der weiten Reise«, sage ich zu ihr. Ich bin nervös und aufgeregt, mich in ihrer erhabenen Gegenwart zu befinden. »Setz dich doch und ruh dich aus. Ich hole uns ein paar Brötchen zum Tee heraus.«
Tante Vyvian setzt sich zu Rafe und Trystan an den Tisch, während ich etwas zu essen zusammensuche und Onkel Edwin den Tee einschenkt.
»Elloren.« Meine Tante macht eine kurze Pause, um an ihrem Tee zu nippen. »Ich weiß, dass du mein Gespräch mit deinem Onkel mitgehört hast, und ich bin sogar froh darüber. Was hältst du davon, dich verwinden zu lassen, bevor du an die Universität gehst?«
»Also Vyvian!« Mein Onkel geht dazwischen. Beinah wäre ihm die Teekanne aus der Hand gefallen. »Es hat keinen Sinn, das Thema anzuschneiden. Ich habe es dir gesagt, meine Entscheidung steht.«
»Ja, ja, Edwin, aber es kann doch nicht schaden, wenn wir uns mal anhören, was das Mädchen selbst dazu zu sagen hat, oder? Was meinst du, Elloren? Du weißt, dass die meisten jungen Mädchen in deinem Alter bereits verwunden sind oder kurz davorstehen.«
Meine Wangen werden warm. »Ich, äh … Wir haben nie groß darüber geredet.« Plötzlich beneide ich Rafe und Trystan, die mit den Zwillingen und deren Holzfiguren spielen. Warum dreht diese Diskussion sich nicht um Rafe? Der ist neunzehn!
»Nun …« Meine Tante feuert einen missbilligenden Blick auf meinen Onkel ab. »Dann wird es dringend Zeit, dass wir darüber reden. Wie du gehört hast, nehme ich dich mit, wenn ich morgen wieder abreise. Die nächsten ein, zwei Wochen werden wir zusammen verbringen, und ich werde dir alles erzählen, was ich über die Stabverwindung und die Universität weiß. Außerdem werden wir dir eine neue Garderobe anfertigen lassen, wenn du schon einmal in Valgard bist, und deine Brüder können auch für einen oder zwei Tage dazukommen. Was hältst du davon?«
Morgen schon abreisen. Nach Valgard und zur Universität! Beim Gedanken daran, das abgeschiedene Halfix zu verlassen, durchrieselt mich freudige Erregung. Ich schaue zu meinem Onkel hinüber, der unbehaglich die Lippen zusammenpresst.
»Das fände ich sehr schön, Tante Vyvian«, antworte ich höflich und bemühe mich, meine überwältigende Aufregung im Zaum zu halten.
Gareth wirft mir einen warnenden Blick zu, und fragend neige ich den Kopf zur Seite.
Mit leicht zusammengekniffenen Augen sieht ihn nun auch meine Tante an. »Gareth«, spricht sie ihn freundlich an, »ich hatte das Privileg, mit deinem Vater zusammenzuarbeiten, bevor er sich von seiner Position als Vorsitzender der Seefahrtsgilde zurückgezogen hat.«
»Er hat sich nicht zurückgezogen«, berichtigt Gareth sie steif, und es liegt eine deutliche Herausforderung in seinem Ton. »Er wurde zum Rücktritt gezwungen.«
In der Küche wird es still, selbst die Zwillinge scheinen die plötzliche Anspannung zu spüren. Mein Onkel fängt Gareths Blick auf und bewegt ganz leicht den Kopf hin und her, wie um ihn zu warnen.
»Nun«, erwidert meine Tante weiterhin lächelnd, »du nimmst offensichtlich kein Blatt vor den Mund. Vielleicht ist es besser, wenn Gespräche über Politik denen von uns überlassen bleiben, die ihre Ausbildung bereits abgeschlossen haben.«
»Ich muss los«, erklärt Gareth kurz angebunden. Er wendet sich an mich. »Ren, ich komme dich besuchen, wenn du in Valgard bist. Vielleicht können wir ja zusammen segeln gehen.«
Meine Tante beobachtet mich ganz genau. Als mir klar wird, was für Schlüsse sie gerade über die Beziehung zwischen Gareth und mir ziehen muss, werde ich rot. Um ihr nicht ein völlig falsches Bild zu vermitteln, will ich nicht zu enthusiastisch antworten, Gareths Gefühle will ich jedoch auch nicht verletzen.
»Alles klar, bis dann«, sage ich zu ihm. »Aber ich weiß noch nicht, ob ich Zeit zum Segeln haben werde.«
Gareth wirft meiner Tante einen letzten gereizten Blick zu. »Schon okay, Ren. Vielleicht kann ich dich wenigstens mit zu meiner Familie nehmen, damit du allen mal Hallo sagen kannst. Mein Vater würde sich riesig freuen, dich zu sehen.«
Unsicher spähe ich zu meiner Tante hinüber. Äußerlich ruhig trinkt sie ihren Tee, aber als Gareth seinen Vater erwähnt, zuckt ihre Oberlippe.
»Das wäre schön«, antworte ich vorsichtig. »Ich hab ihn schon so lange nicht mehr gesehen.«
»Na dann«, verabschiedet Gareth sich mit angespannter Miene. »Ich geh dann mal.«
Rafe steht auf, um ihn zur Tür zu begleiten, und als er seinen Stuhl zurückschiebt, quietschen die Füße auf dem hölzernen Boden.
Auch Trystan erhebt sich, gefolgt von meinem Onkel und den Zwillingen, damit verlassen sämtliche männlichen Gäste die Küche. Befangen setze ich mich hin.
Meine Tante und ich sind allein.
Seelenruhig nippt sie an ihrem Tee und mustert mich mit scharfen, intelligenten Augen.
»Gareth scheint ja sehr an dir interessiert zu sein, meine Liebe«, sagt sie nachdenklich.
Wieder wird mein Gesicht heiß. »Ach nein … So ist das nicht«, stammle ich. »Er ist nur ein Freund.«
Tante Vyvian lehnt sich zu mir und legt eine elegante Hand auf meine.
»Du bist kein Kind mehr, Elloren. Von jetzt an wird deine Zukunft mehr und mehr davon bestimmt werden, mit wem du dich umgibst.« Bedeutungsvoll sieht sie mich an, dann richtet sie sich auf, und ihre Miene hellt sich auf. »Ich bin so froh, dass dein Onkel endlich Vernunft angenommen hat und dich ein wenig Zeit mit mir verbringen lässt. Es gibt da eine ganze Reihe von jungen Männern, die ich dir unbedingt vorstellen möchte.«
Später, nachdem wir zu Abend gegessen haben, gehe ich nach draußen, um die Essensreste zu den paar Schweinen zu bringen, die wir noch halten. Die Tage werden kürzer, die Schatten länger, unaufhaltsam schleicht sich eine gewisse Kühle heran, der die Sonne immer weniger entgegenzusetzen hat.
Vorhin, im Licht des Tages, ist mir die Vorstellung, zur Universität zu gehen, wie ein spannendes Abenteuer erschienen. Doch als nun langsam die Nacht hereinbricht, macht sich leises Bangen bei mir bemerkbar.
So begierig ich auch darauf bin, mehr von der weiten Welt zu sehen, gibt es da doch einen Teil von mir, dem mein ruhiges Leben hier mit meinem Onkel gefällt. Die Beete und die Tiere pflegen, einfache Arzneien herstellen, Geigen bauen, lesen, nähen.
So ruhig. So sicher.
Ich schaue über den Garten hinweg in die Ferne, wo die Zwillinge spielen, hinweg über die Ländereien der Gaffneys, hinweg über die ausgedehnte Wildnis bis zu den Bergen dahinter – Berge, die weit weg von uns dräuen und alles in tiefe Schatten tauchen, während die Sonne hinter ihnen versinkt.
Und zum Wald – dem wilden Wald.
Mit verengten Augen starre ich hinaus und mache die ungewohnten Gestalten mehrerer großer weißer Vögel aus, die aus der Wildnis heranfliegen. Mit ihren riesigen, weit ausgebreiteten Schwingen sehen sie anders aus als jeder Vogel, den ich bisher gesehen habe. Ihr Gefieder ist so hell, dass es beinahe von innen heraus zu leuchten scheint.
Während ich ihren Flug verfolge, überkommt mich ein seltsames Gefühl dunkler Vorahnung, als würde die Erde sich unter meinen Füßen verschieben.
Für einen Moment vergesse ich den Korb mit dem Schweinefutter, den ich auf der Hüfte balanciere, und einige große Gemüsebrocken fallen dumpf polternd zu Boden. Ich schaue nach unten und bücke mich, um sie zurück in den Korb zu werfen.
Als ich mich wieder aufrichte und nach den seltsamen weißen Vögeln suche, sind sie verschwunden.
3. Kapitel
Abschied
Später am Abend bin ich in meiner stillen Kammer, die nur vom sanften Schein der Laterne auf meinem Schreibtisch erhellt wird. Beim Packen gleitet meine Hand durch einen Schatten, und ich halte inne, um sie zu betrachten.
Wie bei allen Gardneriern hat auch meine Haut im Dunkeln einen leichten Smaragdschimmer. Das ist das Merkmal der Ersten Kinder, mit dem uns der Urvater im Himmel bedacht hat, um uns als die rechtmäßigen Eigentümer unseres Planeten Aerda zu kennzeichnen.
Zumindest steht es so in der heiligen Schrift, dem Buch der Urahnen.
Die Reisetruhe, die Tante Vyvian für mich mitgebracht hat, liegt offen auf dem Bett. In diesem Moment trifft mich die Erkenntnis, dass ich noch nie länger als einen Tag von meinem Onkel getrennt war – nicht seit meine Brüder und ich bei ihm leben, nachdem unsere Eltern im Reichskrieg getötet wurden.
Es war ein blutiger Konflikt, der dreizehn lange Jahre wütete und mit dem Tod meiner Großmutter auf dem Schlachtfeld endete. Doch es war ein notwendiger Krieg, zu dessen Beginn mein belagertes Heimatland gnadenlos attackiert und geplündert worden war. Als der Krieg sein Ende fand, hatte Gardnerien einen Bund mit den Alfsigr-Elben geschlossen, war auf das Zehnfache seiner ursprünglichen Größe angewachsen und hatte sich als neue Großmacht der Region etabliert.
Alles dank meiner Großmutter, der Schwarzen Hexe.
Mein Vater Vale war ein hochrangiger gardnerischer Soldat, und meine Mutter Tessla besuchte ihn gerade, als die celtischen Streitkräfte zuschlugen. Die beiden starben gemeinsam, kurz danach nahm mein Onkel uns bei sich auf.
Meine kleine weiße Katze Isabel springt in die Truhe und versucht, einen Faden aus meiner alten Patchwork-Decke herauszuziehen. Diese Decke hat meine Mutter genäht, als sie mit mir schwanger war, und mit ihr ist die einzige klare Erinnerung an sie verknüpft, die ich habe. Wenn ich mich in diese Decke hülle, kann ich ganz leise die Stimme meiner Mutter hören, wie sie mich in den Schlaf singt, und beinahe spüre ich ihre Arme, die mich halten. Ganz egal, wie furchtbar mein Tag war, mich in diese Decke zu schmiegen tröstet mich wie nichts sonst auf Aerda.
Es ist, als hätte sie ihre Liebe geradewegs in den Stoff hineingenäht.
Bei der Truhe steht mein Apothekerkoffer mit ordentlich gestapelten Fläschchen, festgeschnürten Werkzeugen und fein säuberlich vorbereiteten Arzneien. Meine Affinität zu Arzneipflanzen und Kräutern habe ich von meiner Mutter geerbt. Sie war eine begabte Apothekerin, weithin bekannt für mehrere kreative Tonika und Elixiere, die sie entwickelt hat.
Neben meinem Apothekerzeug liegt meine Geige in ihrem geöffneten Koffer, das bernsteinfarben lasierte Holz schimmert im Licht der Laterne. Ich lasse die Finger über die glatte Oberfläche gleiten.
Dieses Instrument habe ich selbst gebaut, und nie und nimmer werde ich mich davon trennen. Eigentlich dürfte ich gar nicht wissen, wie man Geigen baut, denn Frauen sind in den Instrumentenbauergilden nicht zugelassen. Mein Onkel hat sehr gezögert, es mir beizubringen, doch je mehr Zeit verging, desto deutlicher kam mein Naturtalent zum Vorschein, und irgendwann hat er nachgegeben.
Ich liebe einfach alles am Geigenbauen. Meine Hände haben sich schon immer zu Holz hingezogen gefühlt, es als beruhigend empfunden. Allein durch bloße Berührung bin ich in der Lage, zu sagen, welche Sorte es ist, ob der Ursprungsbaum gesund war, welchen Klang es tragen wird. Stundenlang kann ich mich in diesem Handwerk verlieren; schnitzen, schleifen und dem rohen Holz mit geschickter Überredungskunst die anmutigen Formen von Geigenbauteilen entlocken.
Manchmal spielen wir zusammen, mein Onkel und ich, vor allem an den langen Winterabenden im Schein des Holzofens.
Ein höfliches Klopfen unterbricht meine Träumerei, und als ich mich umdrehe, sehe ich meinen Onkel im Türrahmen stehen.
»Störe ich dich?«
Im warmen, gedämpften Licht wirkt das Gesicht meines Onkels sanft und weicher als sonst. Doch in seinen Worten schwingt ein beunruhigender Unterton von Sorge mit.
»Nein«, antworte ich vorsichtig. »Ich packe nur gerade die letzten Sachen zusammen.«
»Darf ich reinkommen?«, fragt er zögerlich.
Ich nicke und setze mich auf mein Bett, das ohne die vertraute Patchwork-Decke fremd und verloren aussieht. Stumm lässt mein Onkel sich neben mir nieder.
»Ich nehme an, du bist ziemlich verwirrt«, sagt er. »Deine Tante hat bereits vor einigen Monaten eine Nachricht geschickt, dass sie uns eventuell demnächst einen Besuch abstatten will, um über deine Zukunft zu sprechen. Also habe ich angefangen, mich mit der Universität zu verständigen, um etwas für dich zu arrangieren. Nur für den Fall. Es hat immer die Möglichkeit bestanden, dass sie dich eines Tages holen kommt, das war mir bewusst, aber ich hatte gehofft, bis dahin hätten wir mindestens noch zwei, drei Jahre.«
»Warum?« Ich bin unglaublich neugierig, wieso Tante Vyvian sich plötzlich so für mich interessiert – und wieso das Onkel Edwin so aus der Bahn wirft.
Mein Onkel knetet seine ineinander verschränkten Finger. »Weil ich nicht glaube, dass das, was deine Tante für deine Zukunft will, notwendigerweise auch das Beste für dich ist.« Er hält inne und seufzt tief. »Du weißt, dass ich dich und deine Brüder liebe, als wärt ihr meine eigenen Kinder.«
Ich lehne mich hinüber, lege den Kopf an seine Schulter. Seine Wollweste ist kratzig. Als er den Arm um mich legt, kitzeln mich ein paar Härchen seines zotteligen Barts an der Schläfe.
»Ich habe versucht, dich von allem abzuschirmen, dich zu beschützen«, fährt er fort, »und ich hoffe, wenn deine Eltern noch da wären, würden sie verstehen, warum ich bestimmte Entscheidungen getroffen habe.«
»Ich hab dich auch lieb«, bringe ich heraus, doch meine Stimme bricht, und mir steigen Tränen in die Augen.
Schon so lange sehne ich mich danach, in die Welt hinauszugehen, doch plötzlich trifft es mich wie ein brutaler Schlag – ich werde meinen Onkel und mein liebendes Zuhause für lange Zeit nicht wiedersehen. Womöglich bis zum Frühling nicht.
»Na, na, was ist denn los?«, fragt er und streichelt mir tröstend die Schulter.
»Es geht einfach alles so schnell.« Ich schniefe die Tränen zurück. »Ich will ja an die Universität, aber … du wirst mir fehlen. Und Isabel auch.« Das Kätzchen spürt vielleicht mein Bedürfnis nach Trost, denn es springt mir auf den Schoß, schnurrt und knetet mit den Pfötchen.
Und ich will nicht, dass du dich allein fühlst, wenn ich nicht mehr hier bin.
»Ach, na komm«, sagt mein Onkel und drückt mich fester. »Nicht weinen. Ich kümmere mich schon um Isabel, und ihr seht euch ja bald wieder. Bevor du dich’s versiehst, bist du wieder da, mit lauter Geschichten von all deinen Abenteuern.«
Ich wische mir die Tränen weg und löse mich von ihm, um zu ihm aufzuschauen. Was ich nicht verstehe, ist, wieso das auf einmal so dringend ist. Bisher war er so zögerlich, mich überhaupt irgendwohin zu lassen, wollte immer, dass ich hier zu Hause bleibe. Weshalb hat er jetzt so Hals über Kopf beschlossen, mich doch gehen zu lassen?
Vielleicht sieht er mir die Frage an, denn mein Onkel seufzt tief.
»Solange Rafe und ich da sind, kann deine Tante deine Verwindung nicht erzwingen. Das Thema Ausbildung kann sie uns aber sehr wohl aufzwingen – es sei denn, ich treffe die Entscheidung vor ihr. Also habe ich das getan. Ich habe ein paar Kontakte in der Fakultät der Apotheker an der Universität, daher war es kein Problem, dir einen Studienplatz zu besorgen.«
»Wieso willst du nicht, dass ich meine Ausbildung im Hohen Rat bei Tante Vyvian mache?«
»Das würde nicht zu dir passen«, erklärt er kopfschüttelnd. »Ich wünsche mir für dich eine …« Er zögert einen Moment. »Eine friedlichere Berufswahl.«
Dabei sieht er mich eindringlich an, als wolle er mir eine geheime Hoffnung und vielleicht auch eine unausgesprochene Gefahr mitteilen, doch dann streckt er nur die Hand aus und streichelt Isabel. Zufrieden schnurrend reckt sie ihm den Kopf entgegen.
Verwirrt von seiner seltsamen Betonung starre ich ihn an.
»Falls du gefragt wirst«, spricht er weiter, ohne den Blick von der Katze zu wenden, »ich habe dich bereits stabgeprüft, und du besitzt keinerlei Magie.«
»Ich weiß, aber … daran erinnere ich mich nicht.«
»Das überrascht mich nicht«, murmelt er abwesend, während er weiter Isabel streichelt. »Du warst noch sehr klein, und sonderlich einprägsam war die Erfahrung auch nicht, da dir ja keine Magie innewohnt.«
Nur Trystan besitzt echte Magie, anders als die meisten anderen Gardnerier, die keine oder höchstens schwache magische Kräfte besitzen. Trystan dagegen wohnt eine Menge Macht inne. Und ausgebildet wird er in Waffenmagie, die besonders gefährlich ist. Aber da mein Onkel in seinem Haus weder Zauberstäbe noch Grimoires erlaubt, hat Trystan mir bisher nie zeigen können, wozu er fähig ist.
Onkel Edwin begegnet meinem Blick, und seine Miene verdüstert sich. »Ich möchte, dass du mir etwas versprichst, Elloren«, bittet er mich in ungewohnt dringlichem Ton. »Versprich mir, dass du nicht die Universität verlässt, um eine Ausbildung beim Hohen Rat anzufangen, ganz egal, wie sehr deine Tante dich unter Druck setzt.«
Ich verstehe nicht, warum das alles für ihn so todernst ist. Ich will Apothekerin werden wie meine Mutter, nicht bei unserer Regierung in die Lehre gehen. Also nicke ich zustimmend.
»Und wenn mir etwas zustößt, wartest du trotzdem, bevor du dich verwinden lässt. Vorher schließt du dein Studium ab.«
»Aber dir stößt doch nichts zu.«
»Nein, nein, natürlich nicht«, beruhigt er mich. »Versprich es mir dennoch.«
Eine altbekannte Sorge lodert in mir auf. Wir alle wissen, dass mein Onkel bereits seit einiger Zeit gesundheitliche Probleme hat, dass er schnell müde wird und seine Gelenke und die Lunge nicht mehr so können, wie er will. Meine Brüder und ich sprechen nur äußerst ungern darüber. Er ist uns schon so lange ein Vater – der einzige Vater, an den wir uns wirklich erinnern. Die Vorstellung, ihn zu verlieren, ist zu furchtbar, um auch nur daran zu denken.
»Okay«, antworte ich. »Ich verspreche es. Ich werde warten.«
Als er diese Worte hört, weicht ein wenig von der Anspannung aus der Miene meines Onkels. Wohlwollend drückt er mir die Schulter und steht mit knackenden Gelenken auf. Einen Moment hält er noch inne und legt mir voller Zuneigung die Hand auf den Kopf.
»Geh an die Universität«, sagt er. »Erlerne das Apothekerhandwerk. Und dann komm zurück nach Halfix und praktiziere deinen Beruf hier.«
Ein wenig ziehen die kalten Finger meiner schleichenden Sorge sich zurück.
Das klingt genau richtig für mich. Und vielleicht lerne ich ja einen jungen Mann kennen. Eines Tages möchte ich durchaus verwunden werden. Vielleicht könnten mein Anverwundener und ich uns nach der Zeremonie hier in Halfix niederlassen.
»Ist gut«, stimme ich zuversichtlich zu.
Das alles kommt sehr plötzlich und unerwartet, aber es ist genau das, was ich mir gewünscht habe. Es wird sich alles zum Besten wenden.
»Und nun schlaf«, rät mir Onkel Edwin. »Du hast eine lange Fahrt vor dir morgen.«
»Okay«, sage ich. »Wir sehen uns morgen früh.«
»Gute Nacht. Schlaf gut.«
Ich blicke ihm nach, sein scheues, freundliches Lächeln ist das Letzte, was ich sehe, bevor er sachte die Tür schließt.
4. Kapitel
Der Weißstab
Ein scharfes Klopfen an meiner Fensterscheibe reißt mich aus dem Schlaf. Abrupt fahre ich hoch, blicke hinüber und schrecke zusammen, als ich draußen auf einem Ast einen riesigen weißen Vogel sitzen sehe, der mich eindringlich anstarrt.
Einer der Vögel, die ich aus den Bergen habe heranfliegen sehen.
Im blauen Licht vor Anbruch der Dämmerung sind seine Flügel so weiß, dass sie wirken wie aus einer anderen Welt.
Vorsichtig schlüpfe ich aus dem Bett, um festzustellen, wie nah ich heran gelangen kann, ohne ihn zu verscheuchen, aber weit schaffe ich es nicht. Sobald ich das Bett nicht mehr berühre, breitet der Vogel seine enormen Flügel aus und fliegt außer Sichtweite. Fasziniert stürze ich ans Fenster.
Da ist er, ich sehe, wie er mich starr fixiert – als würde er darauf warten, dass ich ihm folge.
Er sitzt am anderen Ende der Wiese in der Nähe des langen Zauns, der unser Grundstück von den Ländereien der Gaffneys trennt.
Hastig werfe ich mir meine Kleider über und renne hinaus. Augenblicklich bin ich überwältigt vom seltsamen blauen Licht, das alles einhüllt und die vertraute Szenerie vor mir beinahe ätherisch wirken lässt.
Noch immer starrt der Vogel mich an.
Ich gehe auf ihn zu. In dieser fremdartig getönten Welt fühlt es sich an, als würde ich träumen.
Erst, als ich ziemlich nahe herangekommen bin, fliegt das Tier erneut auf und über die Beete hinweg, dahin, wo links von mir der Zaun für ein Stück zwischen dichtem Gebüsch und ein paar Bäumen verschwindet.
Aufgeregt folge ich ihm, und mich durchströmt ein Gefühl wie damals als Kind beim Versteckenspielen. Ich laufe um die Biegung und gelange auf eine kleine Lichtung, wo ich erschrocken zusammenzucke. Beinah stürze ich in die entgegengesetzte Richtung davon, als ich sehe, was mich dort erwartet.
Auf einem langen Ast sitzt der weiße Vogel, neben ihm zwei weitere von derselben Sorte. Direkt darunter wartet eine geisterhafte Gestalt in einem schwarzen Umhang, das Gesicht verborgen im Schatten einer tief herabgezogenen Kapuze.
»Elloren.« Die Stimme ist vertraut und lässt mich innehalten, sodass ich nicht losrenne.
Unvermittelt bricht die Erkenntnis über mich herein, wer da vor mir steht.
»Sage?« Ich bin erstaunt und verwirrt zugleich, und nach dem Schreck von eben rast mein Herz.
Ganz still steht sie da, gleich hinter dem Zaun. Sagellyn Gaffney, die älteste Tochter unserer Nachbarn.
Unsicher gehe ich auf ihre reglose Gestalt zu und bin mir dabei der aufmerksamen geflügelten Beobachter über unseren Köpfen sehr bewusst. Je näher ich komme, desto besser erkenne ich in dem blauen Licht Sages Gesichtszüge. Ihre verhärmte, zu Tode verängstigte Miene erschreckt mich. Ich kenne sie als freundliches, gesund aussehendes Mädchen, Universitätsstudentin und Tochter eines der reichsten Männer von Gardnerien. Schon mit dreizehn Jahren hat ihre zutiefst religiöse Familie sie mit Tobias Vasillis verwinden lassen, dem Sohn einer angesehenen gardnerischen Familie. Sage hatte alles, was ein gardnerisches Mädchen sich nur wünschen kann.
Doch dann, kaum dass sie ihr Studium begonnen hatte, ist sie verschwunden. Seit über einem Jahr sucht ihre Familie nun schon ohne jeden Erfolg nach ihr.
Und jetzt steht sie hier vor mir, wie von den Toten auferstanden.
»W…wo warst du?«, stammle ich. »Deine Eltern haben überall nach dir gesucht …«
»Sprich leise, Elloren«, unterbricht sie mich scharf, ihr angstvoller Blick huscht rastlos umher.
Sie wirkt fluchtbereit, als wollte sie jeden Moment mit ihrem großen Reisesack über der Schulter wieder verschwinden. Unter ihrem Umhang bewegt sich etwas. Etwas, das sie trägt.
»Was ist da unter deinem Umhang?«, frage ich sie entgeistert.
»Mein Sohn«, erklärt sie und hebt trotzig das Kinn.
»Du hast einen Sohn mit Tobias?«
»Nein«, korrigiert sie mich barsch, »er ist nicht von Tobias.«
Als sie den Namen ihres Anverwundenen ausspricht, liegt ein solcher Hass in ihrer Stimme, dass ich zusammenzucke. Das Kind hält sie weiter verborgen.
»Brauchst du Hilfe, Sage?« Diesmal spreche ich bewusst leise, um sie nicht noch mehr zu verängstigen, als sie es ohnehin schon ist.
»Ich muss dir etwas geben«, flüstert sie, dann greift sie mit zitternder Hand nach etwas unter ihrem Umhang. Was sie hervorholt, ist ein langer weißer Zauberstab, der aus einem kunstvoll geschnitzten Griffstück aufragt. Die Spitze ist so weiß, dass sie mich an die Flügel dieser Vögel erinnert. Doch rasch wird mein Blick vom Zauberstab fortgezogen auf ihre Hand.
Ihre Haut ist bedeckt mit tiefen, blutigen Platzwunden wie von Peitschenhieben, die sich bis über ihr Handgelenk ziehen und in ihrem Ärmel verschwinden.
Entsetzt keuche ich auf. »Heiliger Urvater, was ist passiert?«
Für eine Sekunde schimmert Verzweiflung in ihrem Blick auf, bevor er wieder abweisend wird. Um ihre Lippen spielt ein verbittertes Lächeln.
»Ich habe mich gegen meine Verwindung vergangen«, flüstert sie beißend.
Natürlich habe ich die Geschichten darüber gehört, welche harten Konsequenzen es hat, wenn eine Frau ihre Verwindung bricht, aber es tatsächlich vor mir zu sehen …
»Elloren«, fleht sie, und die Todesangst kehrt in ihr Gesicht zurück. Sie streckt mir den Zauberstab entgegen, als wolle sie mich mit reiner Eindringlichkeit dazu bewegen, ihn zu nehmen. »Bitte. Wir haben nicht viel Zeit! Ich soll ihn dir geben. Er will zu dir.«
»Was soll das heißen, er will zu mir?«, frage ich verwirrt. »Sage, wo hast du den her?«
»Nimm ihn einfach«, drängt sie. »Er ist unglaublich mächtig. Und du darfst nicht zulassen, dass sie ihn in die Finger kriegen!«
»Wer sind denn sie?«
»Die Gardnerier!«
Ungläubig stoße ich den Atem aus. »Sage, wir sind Gardnerier.«
»Bitte«, bettelt sie. »Bitte nimm ihn.«
»Ach Sage«, sage ich traurig und schüttle den Kopf. »Es gibt gar keinen Grund, dass ich einen Zauberstab besitzen sollte. Ich habe keinerlei magische Kräfte …«
»Das ist egal! Sie wollen, dass du ihn hast!« Sie gestikuliert mit dem Zauberstab zu den Ästen über uns.
»Die Vögel?«
»Das sind nicht einfach Vögel! Das sind Wächter. Sie erscheinen in Zeiten großer Finsternis.«
Nichts von alledem ergibt einen Sinn. »Sage, komm mit mir nach drinnen.« Ich bemühe mich, so besänftigend wie möglich zu klingen. »Dann reden wir mit meinem Onkel und …«
»Nein!«, faucht sie und zuckt vor mir zurück. »Ich hab dir doch gesagt, der Stab will nur dich!« Jetzt wird ihre Miene verzweifelt. »Es ist der Weißstab, Elloren.«
In mir wallt Mitleid auf. »Ach Sage, das ist doch nur ein Ammenmärchen.«
Es ist ein Mythos unserer Religion, der jedem gardnerischen Kind erzählt wird. Das Gute gegen das Böse – der Weißstab im Kampf mit dem Dunkelstab. Der Weißstab, eine reine Macht des Guten, die in den Schlachten grauer Vorzeit den Armen und Unterdrückten gegen dämonische Kräfte beistand. Gegen die Macht des Dunkelstabs.
»Es ist nicht bloß ein Märchen«, schleudert Sage mir durch zusammengebissene Zähne entgegen, in ihre Augen ist ein wilder Blick getreten. »Du musst mir glauben. Das hier ist der Weißstab.« Wieder hebt sie den Zauberstab und streckt ihn mir hin.
Sie ist verrückt. Komplett durchgedreht. Aber sie ist so aufgewühlt, und ich möchte ihre Ängste beschwichtigen. Also gebe ich nach und nehme den Zauberstab an mich.
Das helle Holz des Griffs ist glatt und fühlt sich kühl an, seltsamerweise fehlt jede Spur einer Wahrnehmung seines Ursprungsbaums. Ich lasse den Stab unter meinen Mantel und in eine tiefe Innentasche gleiten.
Augenblicklich wirkt Sage erleichtert, als wäre eine schwere Bürde von ihr abgefallen.
Mein Blick bleibt an einer Bewegung in der Ferne hängen, direkt am Rand der Wildnis. Zwei dunkle Gestalten zu Pferd tauchen auf und sind so schnell wieder verschwunden, dass ich mich frage, ob das Licht meinen Augen einen Streich gespielt hat. Um diese Zeit am frühen Morgen wimmelt es nur so vor fremdartigen, finsteren Schatten. Als ich den Blick hebe, um nach den Vögeln zu schauen, muss ich gleich zweimal hinsehen, um sicherzugehen, dass ich mir nichts einbilde.
Sie sind verschwunden. Ohne ein Geräusch. Ich wirble auf dem Absatz herum und suche alles nach ihnen ab. Nirgends eine Spur von ihnen.
»Sie sind weg, Elloren.«
Wieder sieht Sage sich angespannt um, als würde sie ein drohendes Verderben herannahen spüren. Drängend packt sie mich beim Arm, ihre Fingernägel bohren sich in meine Haut.
»Du musst ihn geheim halten, Elloren! Versprich es mir!«
»Okay«, stimme ich zu, um sie zu beruhigen. »Ich versprech’s.«
Mit einem tiefen Seufzen lässt sie mich los. »Danke.« Dann schaut sie in Richtung unseres Häuschens. »Ich muss gehen.«
»Warte«, flehe ich sie an. »Geh nicht. Was auch immer los ist … Ich will dir helfen.«
Voller Trauer betrachtet sie mich, als sei ich entmutigend naiv.
»Sie wollen mein Baby, Elloren«, erklärt sie mit brechender Stimme, eine Träne rollt ihr über die Wange.
Ihr Baby? »Wer will dein Baby?«
Sage wischt sich mit dem bebenden entstellten Handrücken die Augen und wirft einen schrägen Blick in Richtung unseres Häuschens. »Na die!« Dann schaut sie über ihre Schulter und betrachtet mit schmerzlicher Miene ihr eigenes Zuhause. »Ich wünschte … Ich wünschte, ich könnte meiner Familie erklären, was hier wirklich vor sich geht. Es ihnen begreiflich machen. Aber sie glauben.« Ihre Miene verfinstert sich weiter, hart ist ihr Blick auf mich gerichtet. »Der Rat will ihn holen, Elloren. Die halten ihn für böse. Deshalb ist deine Tante hier.«
»Nein, Sage«, versuche ich sie zu beschwichtigen. »Sie ist hier, um mit mir über meine Verwindung zu reden.«
Sage schüttelt vehement den Kopf. »Nein. Sie wollen mein Baby holen. Und ich muss hier weg, bevor sie mich finden.« Einen Moment lang wendet sie den Blick ab, als würde sie sich verzweifelt bemühen, sich zu sammeln. Ihre Hand verschwindet wieder unter dem Umhang und schmiegt sich um das kleine Bündel darunter. Ich frage mich, warum sie mich ihn nicht sehen lässt.
Beruhigend berühre ich sie am Arm. »Das bildest du dir alles nur ein, Sage. Es würde doch niemals irgendjemand deinem Baby etwas antun wollen.«
Wütend und frustriert funkelt sie mich an, dann schüttelt sie den Kopf, es wirkt wie eine Resignation vor diesem Irrsinn. »Mach’s gut, Elloren«, murmelt sie, als würde sie mich bemitleiden. »Viel Glück.«
»Warte …«, flehe ich sie an, als sie sich entlang des Zauns auf den Weg macht in Richtung der weiten Wildnis. Ich laufe ihr nach, greife über die Holzbarriere zwischen uns nach ihr, doch sie schert nach rechts aus, und ich sehe nur noch ihren Rücken, der langsam in der Ferne verschwindet – eine dunkle, geisterhafte Gestalt, die durch die letzten Fetzen des Morgennebels hetzt.
Die Bäume verschlucken sie in ihrem Dunkel, gerade als die Sonne aufgeht und die unheimliche blaue Traumlandschaft der Dämmerung in die helle, klare Welt des Morgens verwandelt.
Mit klammen Fingern taste ich unter meinem Umhang nach dem Zauberstab und rechne halb damit, dass er verschwunden ist. Dass ich schlafgewandelt bin und mir das alles nur eingebildet habe. Doch dann spüre ich ihn – glatt und gerade und äußerst real.
Ich haste zurück zum Haus, während die Sonnenstrahlen stetig an Kraft gewinnen.
Erschüttert will ich einfach nur mit Onkel Edwin reden. Er wird wissen, was zu tun ist.
Als ich die letzten Bäume hinter mir lasse, sehe ich zu meiner Überraschung jedoch Tante Vyvian in der Tür stehen. Mit undeutbarem Gesichtsausdruck beobachtet sie mich.
Bei ihrem Anblick wallt eine leichte Woge des Unbehagens in mir auf, und sofort verlangsame ich meine Schritte und bemühe mich um eine ausdruckslose Miene, als würde ich gerade von einem schlichten Morgenspaziergang ohne jegliche Zwischenfälle zurückkehren. Doch in meinem Kopf herrscht Chaos.
Diese Wunden an Sages Händen – das hat so schrecklich ausgesehen. Vielleicht hat Sage recht. Vielleicht will der Rat ihr wirklich ihr Baby wegnehmen …
Tante Vyvian neigt den Kopf zur Seite und mustert mich nachdenklich, während ich auf sie zugehe.
»Hast du fertig gepackt?«, fragt sie. »Wir sind abfahrbereit.«
Unbehaglich stehe ich vor ihr, denn solange sie die Tür nicht frei macht, kann ich nicht weitergehen. »Ja, ich bin fertig.« Bei diesem Austausch bin ich mir die ganze Zeit des Zauberstabs in meiner Tasche unangenehm bewusst, und es zieht meine Finger dorthin.
Der Blick meiner Tante flackert zum Hof der Gaffneys hinüber. »Hast du dich mit Sagellyn Gaffney getroffen?« Ihre Miene ist offen, lädt mich ein, mich ihr anzuvertrauen.
Mich durchfährt der pure Schock. Woher weiß sie, dass Sage hier ist?
Über die Schulter spähe ich zurück in die Wildnis, das Herz hämmert mir in der Brust.
Sage hatte recht. Tante Vyvian ist nicht nur meinetwegen hier, offensichtlich geht es auch um Sage. Aber meine Tante würde doch bestimmt niemals einem Baby etwas antun?