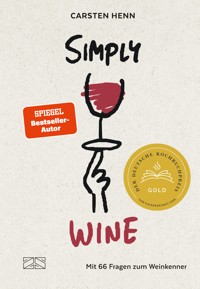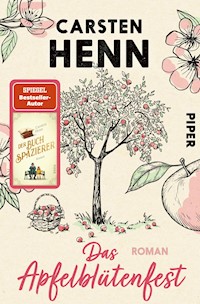11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Das geschriebene Wort wird immer bleiben, weil es Dinge gibt, die auf keine Art besser ausgedrückt werden können.« Mit »Der Buchspazierer« präsentiert der renommierte Autor Carsten Henn eine gefühlvolle Geschichte darüber, was Menschen verbindet und Bücher so wunderbar macht. Es sind besondere Kunden, denen der Buchhändler Carl Christian Kollhoff ihre bestellten Bücher nach Hause bringt, abends nach Geschäftsschluss, auf seinem Spaziergang durch die pittoresken Gassen der Stadt. Denn diese Menschen sind für ihn fast wie Freunde, und er ist ihre wichtigste Verbindung zur Welt. Als Kollhoff überraschend seine Anstellung verliert, bedarf es der Macht der Bücher und eines neunjährigen Mädchens, damit sie alle, auch Kollhoff selbst, den Mut finden, aufeinander zuzugehen … »Ein Buch zum Einkuscheln, ein Buch das wärmt und Zuversicht spendet. Genau das Richtige für alle, die wissen, wie wichtig ein gutes Buch sein kann.« BRIGITTE
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 249
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.pendo.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Der Buchspazierer« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Pendo Verlag in der Piper Verlag GmbH, München 2020
Covergestaltung: u1 berlin / Patrizia Di Stefano
Covermotiv: Patrizia Di Stefano unter Verwendung mehrerer Bildmotive von Getty Images
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Cover & Impressum
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Danksagungen
Für alle Buchhändlerinnen und Buchhändler. Selbst in Krisen versorgen sie uns mit einem ganz besonderen Lebensmittel.
»Ein Roman ist wie der Bogen einer Geige
und ihr Resonanzkörper
wie die Seele des Lesers.«
(Stendhal)
Kapitel 1
Sein eigener Herr
Es heißt, Bücher finden ihre Leser – aber manchmal brauchen sie jemanden, der ihnen den Weg weist. So war es auch an diesem Spätsommertag in der Buchhandlung, die sich Am Stadttor nannte, obwohl das Stadttor oder besser dessen Überreste, die die meisten Bürger für ein gewagtes Kunstwerk hielten, gute drei Kreuzungen entfernt lag.
Die Buchhandlung war sehr alt und über mehrere Epochen errichtet und erweitert worden. Mauerwerk mit Schnörkeln und Gipsstuck fand sich neben schmucklosen rechten Winkeln. Ein Nebeneinander von Alt und Neu, von verspielt und nüchtern bestimmte das Äußere des Gebäudes, fand sich aber auch im Inneren wieder. Rote Plastikständer mit DVDs und CDs standen neben mattierten Metallregalen mit Mangas, diese wiederum neben polierten Glasvitrinen, in denen Globen standen, oder eleganten Holzregalen mit Büchern. Angeboten wurden auch Gesellschaftsspiele, Papeterie, Tee und neuerdings sogar Schokolade. Den verwinkelten Raum beherrschte ein schwerer, dunkler Tresen, den die Mitarbeiter nur den Altar nannten. Er sah aus, als stammte er aus der Barockzeit. Mit Schnitzereien an der Front, die eine ländliche Szene darstellten, bei der eine Jagdgesellschaft auf prachtvollen Rössern, begleitet von einer Meute drahtiger Hunde, hinter einer Rotte Wildschweine herpreschte.
In dieser Buchhandlung wurde nun die Frage gestellt, für die Buchhandlungen existierten: »Können Sie mir ein gutes Buch empfehlen?« Die Fragestellerin, Ursel Schäfer, wusste genau, was ein gutes Buch ausmachte. Erstens unterhielt sie ein gutes Buch so sehr, dass sie im Bett so lange las, bis ihr die Augen zufielen. Zweitens ließ es sie an mindestens drei, besser vier Stellen weinen. Drittens hatte es nicht weniger als dreihundert Seiten, aber niemals mehr als dreihundertachtzig, und viertens war der Umschlag nicht grün. Büchern mit grünen Umschlägen war nicht zu trauen. Eine bittere Erfahrung, die sie mehrmals hatte machen müssen.
»Sehr gern«, antwortete Sabine Gruber, die seit drei Jahren die Buchhandlung am Stadttor leitete. »Was lesen Sie denn gern?«
Ursel Schäfer wollte das nicht sagen, sie wollte, dass Sabine Gruber es wusste, weil sie eine Buchhändlerin war und dadurch von Natur aus mit einer gewissen Portion an hellseherischen Fähigkeiten ausgestattet sein musste.
»Nennen Sie mir drei Begriffe, dann suche ich das Passende für Sie heraus. Liebe? Südengland? Ein richtiger Schmöker? Ja?«
»Ist Herr Kollhoff vielleicht da?«, fragte Ursel Schäfer, ihre Stimme leicht unruhig. »Er weiß immer, was mir gefällt. Er weiß immer, was allen gefällt.«
»Nein, er ist heute leider nicht da. Herr Kollhoff arbeitet nur noch ab und an für uns.«
»Wie schade.«
»So, da hätte ich etwas für Sie. Ein Familienroman, der in Cornwall spielt. Sehen Sie hier, auf dem Cover sind das bezaubernde Anwesen der Familie zu sehen und der große umliegende Park.«
»Es ist grün«, sagte Ursel Schäfer und blickte Sabine Gruber vorwurfsvoll an. »Sattgrün!«
»Weil das Buch größtenteils in dem wundervollen Park des Earl of Durnborough spielt. Die Bewertungen sind alle sehr gut!«
Die schwergängige Eingangstür öffnete sich, und das kleine kupferne Glöckchen darüber klingelte hell. Carl Kollhoff klappte seinen Regenschirm zusammen, schüttelte ihn routiniert aus und stellte ihn in den Ständer. Sein Blick glitt durch die Buchhandlung, die er seine Heimat nannte. Er hielt Ausschau nach frisch eingetroffenen Büchern, die zu seinen Kunden wollten. Er kam sich dabei vor wie ein Muschelsammler am Strand. Und er sah auf den ersten Blick etliche Funde, die nur darauf warteten, aufgehoben und vom körnigen Sand befreit zu werden. Aber als er Ursel Schäfer erblickte, waren sie mit einem Mal ganz unwichtig. Sie warf ihm ein warmherziges Lächeln zu, als wäre er ein Amalgam aus all den reizenden Männern, in die sie sich beim Lesen der Bücher verliebt hatte, die Carl ihr über die Jahre empfohlen hatte. Dabei glich Carl keinem von ihnen. Früher hatte Carl mal einen kleinen Bauch gehabt, aber der war mit den Jahren genauso geschwunden wie die Haare auf seinem Kopf, so, als hätten sie vereinbart, ihn gemeinsam zu verlassen. Heute, mit zweiundsiebzig Jahren, war er mager, trug aber immer noch seine viel zu große alte Kleidung. Sein ehemaliger Chef sagte, er sehe mittlerweile aus, als würde er sich nur noch von den Wörtern in seinen Büchern ernähren, und die hätten wenige Kohlenhydrate. Aber viel Substanz, erwiderte Carl daraufhin stets.
An den Füßen trug Carl immer klobige, schwere Schuhe. Mit so dickem schwarzem Leder und so festen Sohlen, dass sie für ein ganzes Menschenleben reichten. Und gute Socken, die waren wichtig. Darüber eine olivgrüne Latzhose und in derselben Farbe eine Jacke mit Kragen.
Immer trug er einen Schlapphut, eine Fischermütze mit schmaler Krempe, sodass die Augen vor Regen und grellen Sonnenstrahlen geschützt wurden. Auch in Innenräumen zog er ihn nicht ab, nur zum Schlafen. Ohne fühlte er sich nicht komplett bekleidet. Ebenso wenig sah man ihn ohne seine Brille, deren Gestell er vor Jahrzehnten in einem Antiquitätenladen gekauft hatte. Dahinter lagen Carls kluge Augen, die immer aussahen, als hätte er zu lange bei schlechtem Licht gelesen.
»Frau Schäfer, wie schön, Sie zu sehen«, sagte er und trat zu Ursel Schäfer, die ihrerseits zu ihm trat und damit fort von Sabine Gruber. »Darf ich Ihnen vielleicht ein Buch empfehlen, das sich wunderbar auf Ihrem Nachttisch machen würde?«
»Das letzte hat mir sehr gut gefallen, vor allem, dass sie sich zum Schluss in die Augen gesehen haben. Ein Kuss wäre noch schöner gewesen, um die Sache zu besiegeln. Aber in dem Fall gebe ich mich auch mit einem Blick zufrieden.«
»Er war ja fast noch intensiver als ein Kuss. Manche Blicke können das sein.«
»Nicht, wenn ich küsse!«, sagte Ursel Schäfer und kam sich in diesem Moment wunderbar verrucht vor, was ihr nur noch sehr selten passierte.
»Dieses Buch«, Carl griff eines aus dem Stapel neben der Kasse, »wartet, seit es ausgepackt wurde, auf Sie. Es spielt in der Provence, und jedes Wort duftet nach Lavendel.«
»Bordeauxrote Bücher sind die besten! Endet es mit einem Kuss?«
»Habe ich das je verraten?«
»Nein!« Sie sah ihn vorwurfsvoll an, nahm ihm aber das Buch aus der Hand.
Natürlich hätte Carl ihr nie einen Roman ohne Happy End empfohlen. Aber den kleinen Nervenkitzel, ob es diesmal anders wäre, wollte er Ursel Schäfer auf keinen Fall rauben.
»Ich bin so froh, dass es Bücher gibt«, sagte sie. »Hoffentlich ändert sich das nie! Es ändert sich ja so viel und so schnell. Alle zahlen jetzt nur noch mit Plastikgeld. Wenn ich an der Kasse die Münzen passend heraussuche, werde ich schon komisch angeguckt!«
»Das geschriebene Wort wird immer bleiben, Frau Schäfer. Weil es Dinge gibt, die auf keine Art besser ausgedrückt werden können. Und der Buchdruck ist die beste Konservierungsmethode für Gedanken und Geschichten. Darin können sie Jahrhunderte überdauern.«
Mit einem warmen Lächeln verabschiedete sich Carl Kollhoff von ihr und ging durch eine mit Werbeplakaten beklebte Tür in den Raum, der Lager und Büro der Buchhandlung in einem war. Der Schreibtisch war voller gestapelter Bücher, der Rand des alten Computerbildschirms voller gelber Zettel und der große Jahresplaner an der Wand voller Einträge in Rot.
Seine Bücher lagen wie immer in einer schwarzen Plastikkiste, die in der dunkelsten Ecke stand. Früher war ihr Platz auf dem Schreibtisch gewesen, doch seit Sabine die Buchhandlung von ihrem Vater übernommen hatte, war die Kiste jeden Tag ein wenig mehr in die am schwersten zugängliche Ecke gewandert. Parallel hatte die Kiste immer mehr an Inhalt verloren. Es gab nicht mehr viele Menschen, denen er Bücher bringen sollte. Jedes Jahr verschwanden mehr von ihnen.
»Moin, Herr Kollhoff! Und, was sagen Sie zu dem Spiel? Das war doch niemals ein Elfer! Ich ärgere mich immer noch über diesen Schiri.«
Leon, der neue Schülerpraktikant, war aus der kleinen Mitarbeitertoilette getreten – und mit ihm Zigarettenrauch. Jeder andere hätte gewusst, dass es völlig sinnlos war, Carl solch eine Frage zu stellen. Denn Carl sah keine Nachrichten, hörte kein Radio, las keine Zeitung. Er war der Welt, wie er sich manchmal eingestand, ein wenig abhandengekommen. Es war eine bewusste Entscheidung gewesen, als ihn all die Berichte über unfähige Staatenlenker, das Schmelzen der Polkappen und das Leid der Vertriebenen trauriger gemacht hatten als das tragischste Familiendrama in Buchform. Es war Selbstschutz gewesen, auch wenn seine Welt seitdem viel kleiner geworden war. Sie maß nur noch gut zwei mal zwei Kilometer, und er schritt an jedem Tag ihre Grenzen ab.
»Kennen Sie das wundervolle Fußballbuch von J. L. Carr?«, fragte Carl, statt sich in der Schiedsrichterfrage auf die Seite des Praktikanten zu stellen.
»Geht es da um unseren Club?«
»Nein, um die Steeple Sinderby Wanderers.«
»Kenn ich nicht. Aber ich lese sowieso keine Bücher. Nur wenn ich muss. Also in der Schule. Und selbst dann versuche ich lieber, nur den Film dazu zu gucken.« Er grinste, als würde er dadurch geschickt die Lehrer austricksen statt sich selbst.
»Warum absolvierst du dein Praktikum dann hier?«
»Hat meine Schwester vor drei Jahren auch gemacht, wir wohnen direkt um die Ecke, der Weg ist kurz.« Er verschwieg, dass alle, die keine Praktikumsstelle fanden, zwei Wochen in der Hausmeisterei aushelfen mussten. Der Hausmeister nutzte diese Zeit, um sich bei den Praktikanten – stellvertretend für die gesamte Schülerschaft – mittels demütigender Arbeiten für all die vollgekritzelten Wände, alten Kaugummis unter Tischplatten und Butterbrotreste in den Rabatten zu rächen.
»Liest deine Schwester denn?«
»Nachdem sie hier war, schon – aber das wird mir nicht passieren!«
Carl lächelte, denn er wusste, warum Leons Schwester angefangen hatte zu lesen. Sein ehemaliger Chef, Gustav Gruber, der nun in der Seniorenresidenz Münsterblick lebte, hatte genau gewusst, wie man mit solch leseunwilligen Fällen wie Leon und seiner Schwester umzugehen hatte. Er ließ sie die in die Plastik eingepackten Glückwunschkarten abwischen, jede einzeln. Dabei wurde es den Praktikanten so langweilig, dass sie aus lauter Verzweiflung zu einem Buch griffen, welches er strategisch klug in ihrer Nähe deponiert hatte. Gustav Gruber hatte sie alle bekehrt. Auch mit Kindern war Gustav Gruber klargekommen, Carl dagegen erschienen sie wie fremde Wesen. Das war schon so gewesen, als er selbst ein Kind gewesen war. Und je größer der Abstand zur Kindheit wurde, desto fremder und eigenartiger erschienen sie ihm.
Leons Schwester hatte der alte Gruber damals mit einem Roman gelockt, in dem sich ein junges Mädchen in einen Vampir verliebte. Leon, in dem augenscheinlich gerade die Pubertät wütete, hätte er ein Buch hingelegt, auf dessen Umschlag ein hübscher weiblicher Teenager abgebildet gewesen wäre – und bei dem die Seiten nicht zu dicht bedruckt waren. Der alte Gruber sagte immer: Es ist nicht wichtig, was man liest, sondern dass man liest. Carl konnte das nicht für alle Druckerzeugnisse unterschreiben, denn manche Gedanken, die sich zwischen Buchdeckeln fanden, waren wie Gift – aber viel häufiger steckte Heilung im Papier. Manchmal sogar für Dinge, bei denen man gar nicht gewusst hatte, dass sie der Heilung bedurften.
Vorsichtig nahm Carl die schwarze Plastikkiste aus der Ecke. Heute waren es nur drei Bücher, sie lagen ganz verloren darin. Dann suchte er braunes Packpapier und Kordel, um jedes einzeln einzupacken, als wäre es ein Geschenk. Sabine Gruber hatte ihm mehrfach gesagt, er solle das lassen und die Kosten einsparen, doch Carl bestand darauf, denn das würden seine Kunden erwarten. Carl merkte es nicht, aber er strich über jedes Buch, bevor er es in das dicke Papier einschlug.
Schließlich holte er seinen olivgrünen Bundeswehrrucksack, der von den Jahren gezeichnet war, doch dank Carls Sorgsamkeit und Liebe in sehr guter Verfassung. Noch war er leer, aber sein Faltenwurf zeigte, dass dies nicht seine natürliche Form war. Sanft ließ Carl die Bücher in den schweren Stoff des Rucksacks sinken, den er mit einer weichen Wolldecke ausgelegt hatte. So, als wären es kleine Hundewelpen, die er zu ihren neuen Besitzern tragen würde. Er ordnete die drei Bücher so in dem Rucksack an, dass sich das größte später nahe an seinem Rücken befinden würde und das kleinste am weitesten entfernt, weil es dort durch die Rundung des Rucksacks nicht beeinträchtigt werden würde.
Beim Herausgehen überlegte er kurz und wandte sich dann an Leon. »Wisch doch bitte die Grußkarten ab, das wird Frau Gruber sehr freuen. Am besten holst du sie rein, dann hast du hier deine Ruhe dabei. Ich habe es immer hier am Schreibtisch gemacht.« Schnell legte er Nick Hornbys Fever Pitch auf den Tisch, das er gerade in einem Regal erspäht hatte. Das Fußballfeld darauf sah verführerisch grün aus – weswegen Ursel Schäfer es sicher keines Blickes würdigen würde.
Carl nannte es seine Runde, dabei glich es einem Vieleck durch die Innenstadt, ohne rechten Winkel, ohne Symmetrie. Dort, wo die Reste der Stadtmauer verliefen wie die Zahnruinen eines Greises, endete seine Welt. Seit vierunddreißig Jahren hatte er sie nicht verlassen, denn in ihr befand sich alles, was er zum Leben brauchte.
Carl Kollhoff ging viel zu Fuß, und er dachte genauso viel, wie er ging. Manchmal kam es ihm vor, als könnte er nur richtig denken, wenn er ging. Als würden die Schritte auf dem Kopfsteinpflaster seine Gedanken erst in Bewegung bringen.
Wenn man durch die Stadt ging, fiel es einem nicht unbedingt auf, doch jede Ringeltaube und jeder Sperling wusste, dass die Stadt rund war. Alle alten Häuser und Gassen waren auf das Münster ausgerichtet, das sich imposant in der Mitte erhob. Wäre die Stadt Teil einer Modelleisenbahnstrecke, hätte man vermutet, dass das Münster im falschen Maßstab gebaut worden sei. Es stammte aus der kurzen Zeitspanne, als die Stadt sehr reich gewesen war. Doch bevor es vollendet werden konnte, hatte diese schon geendet, weswegen ein Turm nie fertiggestellt worden war.
Die Häuser standen ehrfurchtsvoll um das Münster. Einige der besonders alten neigten sogar leicht ihre Häupter. Vor dem Hauptportal hielten sie am meisten Abstand, wodurch hier der größte und schönste Platz der Stadt, der Münsterplatz, entstanden war.
Carl betrat ihn, und sofort war da wieder dieses Gefühl, beobachtet zu werden, wie ein Reh auf einer Lichtung, den Blicken und Gewehrläufen eines Jägers hilflos ausgeliefert – worüber Carl lächeln musste, weil er sich sonst nie wie ein Reh vorkam. Am Münsterplatz war der Geruch der Stadt am intensivsten. Im 17. Jahrhundert war sie belagert worden, und ein Bäcker hatte der Legende nach das Gepuderte Rad erfunden, ein Fettgebäck in Radform mit Speichen, gefüllt mit Schokoladencreme und bestreut mit Puderzucker. Er brachte es den Belagerern, um ihnen auf diese Weise den Wunsch der Stadtbevölkerung mitzuteilen, dass sie abreisen sollten. In Wirklichkeit war das hochkalorische Gebäck erst zweihundert Jahre später erfunden worden, was auch urkundlich belegt war, doch man verbreitete weiter die alte Geschichte, und die Besucher der Stadt glaubten sie gern.
Carls Schritte führten stets über dieselben Pflastersteine des Münsterplatzes, langsam und gleichmäßig. Stand jemand im Weg, wartete Carl und beschleunigte danach seinen Schritt, um die verlorene Zeit wiedergutzumachen. Die Strecke über den Platz war so von ihm angelegt, dass sie auch am Markttag ohne Hindernisse zurückgelegt werden konnte. Zudem führte sie möglichst weit an den vier Bäckereien des Platzes mit Gepuderten Rädern vorbei, denn er ertrug den Geruch des fettig-heißen Gebäcks nicht mehr.
Carl bog in die Beethovenstraße ein, die mehr eine Gasse war und dem großen Komponisten nicht gerecht wurde. Ein Mitarbeiter des Planungsamts hatte sich verwirklicht, indem er einen ganzen Straßenzug nach berühmten Komponisten benannt hatte. Seinem persönlichen Liebling Schubert hatte er die größte Straße gewidmet.
Carl Kollhoff wusste es nicht, doch er befand sich in diesem Moment genau im Mittelpunkt seiner Welt. An zwei Seiten wurde sie von Straßenbahnlinien, der 18 und der 57, begrenzt (obwohl die Stadt nur sieben Straßenbahnlinien besaß, aber so fühlte sie sich verkehrstechnisch wie eine Metropole), an einer Seite von der Schnellstraße in den Norden und an der vierten vom Fluss, der sich die meiste Zeit des Jahres damit begnügte, pittoresk zu plätschern, und nur an wenigen Tagen im Frühling auf ein wenig Hochwasser bestand. Wie ein junger Löwe, der ab und an brüllte, obwohl seine Stimmbänder es nicht hergaben.
Sein erster Abstecher führte ihn heute in die Saliergasse zu Christian von Hohenesch. Dessen aus dunklen Steinen errichtete Villa stand leicht nach hinten versetzt, sodass dem flüchtigen Passanten nicht auffiel, wie herrschaftlich sie war. Sie kauerte sich wie ein geduckter schwarzer Schwan, der nur darauf wartete, die prachtvollen Schwingen auszubreiten. Hinter ihr lag ein rechteckiger Park, gesäumt von riesigen Eichen. In diesem standen drei Bänke, die es Christian von Hohenesch ermöglichten, zu jeder Tageszeit Sonnenstrahlen auf die Seiten eines Buchs fallen zu lassen.
Carl wusste, dass Hohenesch großen Reichtum besaß, aber nicht, dass er der reichste Bürger der Stadt war. Niemand wusste es, selbst Hohenesch nicht, da er sich nicht mit anderen verglich. Seine Familie hatte vor Generationen mit dem Gerberhandwerk am Fluss ihr Vermögen gemacht und es geschafft, dieses in der Industrialisierung nicht zu verlieren. Christian von Hohenesch musste deshalb nicht arbeiten, er ließ arbeiten. Seine Aktien und Depots taten es für ihn. Er verwaltete nur die Verwalter seines Vermögens. Einmal am Tag kam eine Haushälterin, die kochte und die wenigen bewohnten Räume putzte, einmal in der Woche ein Gärtner, damit das Sonnenlicht auch weiterhin einen Weg zu den Buchseiten fand, und einmal im Monat ein Hausmeisterservice. Und von Montag bis Freitag kam Carl mit einem neuen Buch, das Christian von Hohenesch meist bis zum nächsten Tag gelesen hatte. Soweit Carl wusste, hatte Hohenesch die Grenzen seines Reichs seit Ewigkeiten nicht verlassen.
Carl läutete, indem er an einem kupfernen Stab zog, worauf eine tiefe Glocke im Inneren der Villa erklang. Wie immer dauerte es eine Zeit, bis der Hausbesitzer durch den langen, dunklen Flur kam, um die schwere, knarzende Holztür zu öffnen, aber nur einen Spaltbreit. Nie trat Christian von Hohenesch hinaus. Er war ein schöner dunkelhaariger Mann, groß gewachsen, edle Wangenknochen, markantes Kinn – und eine Traurigkeit, die über allem lag wie grauer Puder. Er trug wie stets einen dunkelblauen Zweireiher mit einer frischen weiße Orchideenblüte am Revers, und seine schwarzen Lederschuhe glänzten, als ginge er zu einem Opernball. Hohenesch war viel jünger, als seine Kleidung vermuten ließ. Gerade einmal siebenunddreißig Jahre alt. Doch seit frühester Jugend trug er Anzüge, sie fühlten sich für ihn so natürlich an wie Jeansstoff für andere.
»Herr Kollhoff, Sie sind zu spät. Wir hatten Viertel nach sieben vereinbart«, sagte Hohenesch zur Begrüßung.
Carl neigte wie selbstverständlich den Kopf. Dann zog er vorsichtig das bestellte Buch aus seinem Rucksack. »Hier, Ihr neuer Roman.« Er zog die Schleife der Kordel gerade, da sie beim Transport leicht verrückt war.
»Sie haben es mir empfohlen. Ich hoffe, zu Recht.« Hohenesch nahm das Buch, packte es aber nicht aus. Es war ein Roman über die Ausbildung Alexanders des Großen bei Aristoteles. Hohenesch las nur Philosophisches.
Er reichte Carl das Trinkgeld, welches an das Gewicht der Bücher angepasst war. Er hatte dieses zuvor recherchiert. »Beim nächsten Mal wieder pünktlich. Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige.«
»Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.«
»Ja, ich Ihnen selbstverständlich auch.«
Christian von Hohenesch schloss die schwere Tür. Und die Villa sah im selben Augenblick wie unbelebt aus.
Der Hausherr hätte gerne viele Worte über Bücher und Autoren mit Carl gewechselt, den er als gebildeten Mann mit guten Manieren kannte, als einen verwandten Geist. Aber ihm waren mit der Zeit die Worte für Einladungen abhandengekommen. Er musste sie irgendwo in den vielen Zimmern seiner großen Villa verloren haben.
Carl verließ Christian von Hohenesch – doch eigentlich verließ er jemand anderen. Denn Carl sah die Spiegelungen von Romanen in unserer realen Welt. Für ihn war die Stadt bevölkert von Personen aus Büchern, obwohl diese in ganz anderen Zeiten oder in fernen Ländern lebten. Christian von Hohenesch war für ihn seit dem Moment, als dieser erstmals die schwere Tür der Villa geöffnet hatte, dem großartigen Roman Stolz und Vorurteil von Jane Austen entsprungen. Carl hatte gerade die Villa Pemberley im Derbyshire des 18. Jahrhunderts verlassen und dessen Bewohner Fitzwilliam Darcy, einen reichen, intelligenten Gentleman, der trotz eigentlich tadelloser Manieren häufig ein wenig arrogant und harsch wirkte.
Der Grund für diese Eigenart von Carl lag darin, dass er sich nie gut hatte Namen merken können, es sei denn, sie gehörten Figuren in Romanen. Schon in der Schule war das so gewesen, als viele Lehrer Spitznamen erhalten hatten, meist wenig schmeichelhafte: Klobürste, Prinz Morphium, Spucki. Carl aber hatte ihnen andere verliehen: Odysseus, Tristan oder Gulliver. Nach dem Abitur hatte er im Gegensatz zu seinen Mitschülern nicht mit den Spitznamen aufgehört. So wurde der junge Punker mit der abgewetzten Uniform, dem er während seiner Ausbildung immer auf dem Weg zur Buchhandlung begegnete, zum braven Soldaten Schwejk. Die Obsthändlerin, bei der er seine Äpfel kaufte, zur Königin aus Schneewittchen – erfreulicherweise sah sie davon ab, ihr Obst zu vergiften. Irgendwann fiel Carl auf, dass seine Stadt voller literarischer Figuren war, ja dass sich für jeden Bewohner eine literarische Entsprechung finden ließ. In den nächsten Jahren durfte er Sherlock Holmes kennenlernen, der bei der städtischen Polizei das Morddezernat leitete, und sogar Lady Chatterley, die oft in einem dünnen Kimono die Tür öffnete und in die er sich als junger Mann ein wenig verguckte. Allerdings verließ sie dann mit Adson von Melk die Stadt. Kapitän Ahab war von einem riesigen Maulwurf in seinem Garten besessen, den er nicht zur Strecke bringen konnte. Walter Faber, einem schwer kranken Ingenieur, brachte Carl bis zu seinem Tod Bücher über Südamerika. Und der Graf von Monte Christo hatte in einem Haus mit vergitterten Fenstern gelebt, das früher ein Gefängnis gewesen war und seinen neuen Besitzer auf eine merkwürdige Art in den eigenen Mauern festgehalten hatte.
Fast immer fiel ihm ein passender literarischer Name ein, bevor es ihm gelang, sich den realen einzuprägen. So, als wollte sein Gedächtnis ihn davor schützen, sich mit Profanem zu belasten. Und ab dem Moment, in dem er einen Namen ausgewählt hatte, las er die realen gar nicht mehr. Auf dem Weg von der Netzhaut zu seinem Gehirn verwandelten sich zum Beispiel die Buchstaben eines Christian von Hohenesch wie durch ein Wunder in Mister Darcy, ohne dass es Carl auffiel. Nur in besonderen Situationen erbarmte sich sein Kopf dazu, einen weltlichen Namen herauszurücken.
Viele musste sein Gehirn sich ohnehin nicht mehr merken.
Carls Weg durch die verwinkelten Gassen führte ihn nun zu einer literarischen Figur, deren Schicksal weitaus düsterer war als das des schlussendlich glücklich verheirateten britischen Gentleman.
Seine Kundin wartete hinter der Tür und sah durch den Spion hinaus auf die Gasse, auf die wenigen Menschen, die vorbeigingen. Niemand flanierte hier, niemand bewunderte die Gebäude, denn die schönen lagen mehrere Querstraßen entfernt. In diesem Teil der Altstadt gingen die Menschen schnell, da sie die bedrückende Enge nicht ertragen konnten und es ihnen vorkam, als würden sich die Giebel der Häuser über ihnen schließen, um kein Tageslicht mehr einzulassen.
Die zierliche junge Frau hinter dem Spion wusste, in welchem Zeitraum Carl Kollhoff bei ihr eintreffen würde. Sie wusste zwar auch, dass es albern war, lange Minuten durch den Spion zu blicken, statt im Wohnzimmer auf das Klingeln zu warten, doch sie konnte nicht anders. Andrea Cremmen strich eine blonde Haarsträhne hinter ihr Ohr und zog ihr Kleid gerade. Vom Kindergarten an war sie immer die Schönste gewesen, was ihr Zuneigung, aber auch viel Neid eingebracht hatte. Und eine frühe Ehe mit einem erfolgreichen Mann aus der Versicherungsbranche namens Matthias, der auch abends und am Wochenende lange arbeitete, damit es ihnen gut ging. Andrea selbst war gelernte Krankenschwester, arbeitete jetzt aber halbtags als Sprechstundenhilfe in einer kleinen Hausarztpraxis, wo man sie an den Empfang gesetzt hatte, weil ihr Anblick die Patienten erfreute und beruhigte. Keiner hatte Andrea jemals sagen müssen, dass sie lächeln sollte, Andrea tat es einfach, es gehörte zum Hübschsein dazu. Wer hübsch ist und nicht lächelt, gilt als arrogant. Also lächelte sie den ganzen Tag.
Sie hatte sich niemals getraut, nicht perfekt auszusehen, denn was würde dann passieren? Was würden die anderen Menschen in ihr sehen, was wäre da überhaupt? Carl Kollhoff wirkte wie ein Mann, dem man sich ohne Lächeln zeigen konnte. Denn er würde die richtigen Worte wählen, um das zu beschreiben, was dann zutage trat. Andrea schien es, als wählte er seine Worte so genau aus wie ein Parfümeur die Ingredienzien für ein teures Parfüm. Sie hörte auf zu lächeln und holte die Strähne wieder zurück, erlaubte sich diese paar Haare Unordentlichkeit.
Doch als sie Carl Kollhoff in der Gasse entdeckte, strich sie diese schnell abermals hinter das Ohr.
Carl klingelte und wartete. Andrea Cremmen brauchte immer etwas Zeit, um zur Tür zu kommen, und war stets ein wenig atemlos. Trotzdem lächelte sie ihn jedes Mal freudig an.
Carl hörte, wie hektisch ein Schlüssel im Schloss umgedreht wurde, dann öffnete sich die Haustür.
»Herr Kollhoff, Sie sind aber früh heute! Ich hatte Sie noch gar nicht erwartet. Ich sehe sicher unmöglich aus.« Sie fuhr sich durch ihre wunderschön glänzende Frisur, die perfekt zu ihrem eleganten Kleid mit den roten Rosen passte.
Carl fand sie bezaubernd, und doch ließ ihn Andreas Anblick auch immer ein wenig traurig werden. Denn unter all der Schönheit lag etwas, das er nicht fassen konnte – und es hatte mit dem zu tun, was er jetzt aus seinem Rucksack holte. Eines der Bücher, die Andrea Cremmen so liebte. Mit dem Gewicht des Buchs war alles in Ordnung (Carl mochte es, wenn Bücher das richtige Gewicht hatten: nicht so leicht wie eine Tafel Schokolade, nicht so schwer wie ein Liter Milch), es war das Gewicht des Inhalts, das Carl besorgte.
»Ist es gut?«, fragte Andrea Cremmen ihn und zog die Schleife am Packpapier zurecht.
»Soweit ich gehört habe, steht Die Schattenrose den anderen Werken der Autorin in nichts nach.«
»Richtig schön dramatisch?«
Jetzt war es an Carl zu lächeln. Es gab ein stilles Einverständnis zwischen ihnen. Wenn er ihr ein Buch brachte, war es immer dramatisch und endete tragisch. In der Vergangenheit hatte er ihr manchmal auch Bücher mit Happy End empfohlen, aber die hatten ihr nie gefallen. Sie fand sie zu realitätsfern. Andrea Cremmen liebte Romane, in denen die weibliche Hauptperson litt und am Ende starb oder unglücklich und allein zurückblieb. Offene Enden waren nur dann in Ordnung, wenn sie entweder das eine oder das andere davon zuließen.
»Ich werde wie immer schweigen«, sagte Carl. »Wie hat Ihnen denn der letzte Roman gefallen?«
Andrea Cremmen atmete schwer ein und schüttelte dann den Kopf. »Der war so traurig! Sie ist zum Schluss ins Wasser gegangen … Warum haben Sie mich nicht gewarnt?« Sie zog spielerisch eine kleine Schnute.
»Das darf ich doch nicht.«
Früher hatte er ihre Bücher immer in buntes, fröhliches Geschenkpapier eingepackt. Aber es war ihm verlogen vorgekommen.
»Bringen Sie mir nächste Woche wieder eins? Ich habe von einem Roman gehört, die ganze Zeit ist darin Nacht, weil er während des Winters in Grönland spielt. Und die Hauptperson hat gerade ihr Kind verloren. Kennen Sie das? Ich fand, das klang richtig gut.«
Carl kannte das Buch. Er hatte gehofft, Andrea Cremmen würde nichts davon mitbekommen.
»Bringe ich Ihnen mit.« Carl sagte nicht, dass er es gerne mitbringe, denn das würde er nicht.
»Können Sie mir noch etwas ans Herz legen?«
»Es gibt jetzt ganz neu einen Kriminalroman, der in unserer Stadt spielt. Ich habe ihn noch nicht gelesen, aber er soll recht lustig sein.«
Andrea Cremmen winkte ab. »Meinen Sie, das Buch würde mir gefallen?«
Carl hatte es sich zur Aufgabe gemacht, nicht zu lügen. Wenn man einmal eine Lüge in die Welt setzte, bekam man sie nicht wieder eingefangen. »Nein.«
»Geht mir genauso.«
»Aber es könnte Sie zum Lachen bringen. Und Sie haben, ich hoffe, damit trete ich Ihnen nicht zu nahe, ein wirklich schönes Lachen. Sie wissen sicher, dass Charlie Chaplin gesagt hat: Jeder Tag ohne Lachen ist ein verlorener Tag. Und wir haben ohnehin zu wenige Tage auf dieser Welt, als dass wir einen verlieren dürften.« So etwas hatte er ihr noch nie gesagt. Vielleicht war die Traurigkeit in ihr an diesem Tag größer als sonst, und er hatte es gespürt? Carl wusste es nicht. Manchmal sagte sein Mund Dinge, die nicht mit seinem Kopf abgesprochen waren.
Andrea Cremmen lächelte nicht mehr, stattdessen zitterte ihre Unterlippe leicht. »Sie haben mir gerade den Tag gerettet. Danke dafür!« Und dann schloss sie rasch die Tür.
Ende der Leseprobe