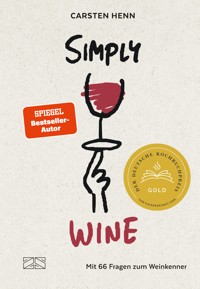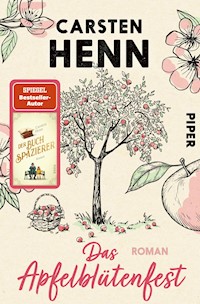16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie schon in »Der Buchspazierer« und »Der Geschichtenbäcker« präsentiert Carsten Henn auch in »Die Butterbrotbriefe« eine Geschichte, die Zuversicht schenkt und sich beim Lesen anfühlt wie eine Umarmung. Eingebettet in eine zarte Liebesgeschichte, geht »Die Butterbrotbriefe« der Frage nach, ob wir selbst unserem Leben seine Richtung geben oder andere über uns bestimmen, ob das Schicksal uns regiert, der Zufall oder unser freier Wille. Ein warmherziger und poetischer Roman über zwei Menschen wie Sonne und Mond, über den Konflikt von Liebe und Freiheit, von Unabhängigkeit und dem Wunsch nach Zugehörigkeit Wer schreibt heute noch Briefe? Richtige, auf Papier, mit der Hand? Kati Waldstein, die mit fast 40 ein neues Leben beginnen will und Abschiedsworte für alle verfasst, die sie geprägt haben – egal auf welche Art. Eine freundliche Supermarktkassiererin, eine strenge Mathelehrerin, ein gleichgültiger Ex-Mann. 37 Briefe insgesamt, geschrieben auf Butterbrotpapier, das ihr Vater über Jahrzehnte für sie gesammelt hat. Dann trifft sie auf Severin, der sein Leben als Klavierstimmer wegen eines von ihm verschuldeten Unglücks hinter sich lassen musste. Der aber fest glaubt, dass Kati und ihr Heimatort sein Schicksal sind. Die beiden scheinen füreinander bestimmt und finden dennoch nicht zueinander – bis Kati erkennt, dass sie sich von der Vergangenheit nicht verabschieden muss, um ihrer Zukunft zu begegnen, und Severin begreift, dass er nur eine Zukunft hat, wenn er lernt seine Vergangenheit anzunehmen. Denn das Schicksal bestimmt vielleicht, wer in unser Leben kommt, aber das Herz, wer darin bleibt. Humorvoll und klug, leicht und poetisch – die Bestsellerromane von Carsten Henn verzaubern, regen zum Nachdenken an und sind pures Leseglück! Wer eine warmherzige, inspirierende Lektüre sucht, einen Roman wie eine warme Decke, wird »Die Butterbrotbriefe« lieben. In dem für ihn so typischen lebensweisen und zugleich gefühlvollen Ton schreibt Carsten Henn über Heimat und Fremde, Weggehen und Ankommen, über Menschen und ihr Schicksal – oder ist es nur Zufall?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 269
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für alle, die ihren eigenen Weg nicht finden durften
© Piper Verlag GmbH, München 2023
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: FAVORITBUERO, München
Covermotiv: Westend61/ Getty Images und Shutterstock.com
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Zitat
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Epilog
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
»Auch nicht geschriebene Briefe kommen manchmal an.«
Marie von Ebner-Eschenbach
Kapitel 1
Die Landung des Kranichs
Meist verteilt das Schicksal Schläge.
Nur selten nimmt es einen in den Arm.
So wie die grauhaarige Frau mit den vielen Kummerfalten es jetzt tat, die Kati weinend so fest an sich drückte, als wollte sie nie mehr loslassen. Kati konnte die Tränen spüren, die Tropfen für Tropfen ihre Halsbeuge herunterliefen.
Die Frau hieß Gudrun Lupenau, und Kati hatte ihr gerade einen Brief vorgelesen. Es war die Nummer 31 gewesen. Nur sechs weitere würden noch folgen.
Als sie am Morgen dieses 7. Oktobers zur Zehnthofstraße aufgebrochen war, hatte Kati damit gerechnet, von Gudrun Lupenau angeschrien zu werden, sich vielleicht sogar eine Ohrfeige einzufangen, aber bestimmt nicht mit einer Umarmung.
Wann immer möglich, ging sie zu Fuß, um einen Brief auszuliefern. Das dauerte zwar länger, aber beruhigte sie mehr, als in ihrem Wagen zu sitzen und sich nicht bewegen zu können. Das Herz schlug trotzdem jedes Mal heftig in ihrer Brust.
Als Kati am Friedhof vorbeikam, sah sie das Holzkreuz auf dem Grab ihrer Mutter und musste an Brief Nummer 1 denken. Damals hatte sie noch nicht gewusst, dass so viele weitere geschrieben werden mussten.
Sie hatte ihn nach der Beerdigung verfasst, wegen der Trauerrede. Die war wie von der Stange im Textildiscounter gewesen. Einheitsgröße. Hätte man Namen, Geburts- und Sterbedatum geändert, die Trauerrede hätte zu jedem anderen genauso gut gepasst. Oder besser: genauso schlecht. Zur Traurigkeit über den Tod ihrer Mutter war die Wut über diese seelenlosen Worte hinzugekommen. Kati hatte sich so sehr vorgenommen, auf der Beerdigung nicht zu weinen, weil sie wusste, dass sie nicht mehr würde aufhören können, wenn sie einmal begann. Aber wegen dieser furchtbaren Rede ließen sich die Tränen nicht mehr zurückhalten. Sie rannen über den Kajal, sahen aus wie schwarze Tinte.
Wieder zu Hause, hatte Kati das Telefon schon in der Hand gehalten, um sich beim Priester zu beschweren, als sie Angst bekam, dass die Worte vor lauter Aufregung falsch aus ihr herauspurzeln würden. Das Gebäude, das sie dann ergäben, würde schon beim leichtesten Gegenwind einstürzen. Bei einem Brief konnte sie alle Formulierungen sorgfältig wählen. Deshalb hatte sie Blätter gesucht und sich an die Kiste mit dem Butterbrotpapier erinnert, das ihr Vater einst für sie gesammelt hatte.
»Das ist nur für dich«, hatte er gesagt, während er das Papier akribisch von Krümeln oder anderen Rückständen befreit hatte. »Damit kannst du später etwas Schönes machen.« Er hatte an Bastelarbeiten gedacht oder daran, die Blätter zum Durchpausen zu benutzen. Das dünne, knisternde Material war Kati immer magisch vorgekommen, als könnte man Zaubersprüche darauf verfassen. Es nahm die Farbe zwar nur widerwillig auf, und in der Schreibmaschine entstanden auf dem passend zugeschnittenen Papier immer wieder kleine Tintenwolken, aber der leichte Glanz verlieh den Buchstaben und Worten einen besonderen Schimmer.
Kati hatte dem Priester vorgeworfen, durch seine Worte sei die Beerdigung ihrer Mutter eigentlich anonym gewesen. Nur hohle Phrasen, die Herz und Seele der Hinterbliebenen nicht genährt hätten. Sie wählte andere Worte, verwendete viele Ausrufezeichen (es tat so gut, immer wieder fest auf die entsprechende Taste der Schreibmaschine zu drücken), verfluchte den Namen des Herrn, mehrfach (auch das hatte sich so gut angefühlt, dass sie es, wo immer möglich, eingebaut hatte), und sparte auch sonst nicht mit bildhafter Sprache (von der sie hoffte, dass sie den Priester ordentlich schockierte).
Der Brief war getippt, aber eigentlich war er geschrien.
Als sie fertig war und ihn in ein Kuvert steckte, fragte sich Kati, wie lange es her war, dass sie zuletzt einen Brief geschrieben hatte. Keine SMS, keine Mail, kein berufliches Schreiben, sondern einen Brief, von einem Menschen an einen anderen. Es musste in der Schule gewesen sein, an ihre damalige Brieffreundin, von der sie ein ganzer Ozean getrennt hatte. Das war sicher zwanzig Jahre her, denn jetzt war sie ja schon neununddreißig.
In der Schulzeit hatte es auch andere Briefe gegeben, lebenswichtige, so war es ihr zumindest damals vorgekommen: »Willst Du mit mir gehen? Bitte ankreuzen: Ja/Nein/Vielleicht.« Oder: »Treffen wir uns heute hinter der Sporthalle? Ich würde Dir gerne etwas sagen …« – mit einem blauen Herz in Pelikan-Tinte.
Die schönsten Briefe, die Kati je erhalten hatte, stammten allerdings von ihrer Großmutter Katharina. Sie war immer schon zu alt zum Reisen gewesen und hatte jedes Weihnachten einen Brief an Kati geschrieben. In den ersten Jahren war der beiliegende Geldschein bedeutender gewesen als die Worte, aber mit jedem Jahr änderte sich das mehr, und irgendwann hätte es des Geldes nicht mehr bedurft, um den Brief vor allen anderen Geschenken zu öffnen und zu lesen.
Ein Brief war Zeit und Mühe, war Denken an den anderen. Das wertvollste Geschenk. Darin glich er selbst gekochten Marmeladen, sogar wenn sie scheußlich schmeckten, selbst gestrickten Socken, auch wenn sie kratzten, und den ersten unidentifizierbaren Kritzeleien, die einem Kinder stolz übergaben. Alles so unendlich wertvoll, wenn man begriff, was einem eigentlich geschenkt wurde.
Falls jedoch der Brief an den Priester ein Geschenk war, dann eines, das dieser bestimmt nicht wollte.
Es fühlte sich trotzdem gut an, ihn einzuwerfen.
Als keine Antwort eintraf, auch nicht nach einer Woche, kamen Kati Zweifel, ob der Priester den Brief überhaupt gelesen oder ihn die Pfarrsekretärin im Mülleimer entsorgt hatte. Umgehend war da wieder diese Wut, wie ein frisch entfachtes Feuer. Kurzerhand schrieb sie einen neuen Brief (mit noch mehr Ausrufezeichen), ging zum Pfarrhaus, klingelte und las ihn dem perplexen Priester vor. Dieser stand mit durchgelaufenen Schlappen und Hausmantel in der Eingangstür des Pfarrhauses und knetete die ganze Zeit seine Hände, als könnte er dadurch ändern, was ihm gerade widerfuhr.
Das Vorlesen fiel Kati nicht leicht, kein bisschen. Sie schaffte es nicht, zum Priester aufzublicken, geschweige denn in seine Augen. Aber jedes Wort, das sie aussprach, ließ sie gerader stehen und ihre zuerst noch zittrige Stimme voller werden.
Als sie fertig war, drückte sie dem Priester den Brief in die durchgekneteten Hände und ging. Auf seine Rufe reagierte sie nicht.
»Leben Sie wohl«, waren die letzten Worte des Briefes, und damit schloss und verriegelte sie eine Tür hinter sich.
Die Schritte zurück nach Hause kamen Kati leichter vor. Sie spürte aber, wo noch Schwere war, wo Ungesagtes, das endlich ausgesprochen werden musste. Wo weitere Briefe notwendig waren, um ihre Fesseln zu durchtrennen. Papier konnte höllisch scharf sein und schneiden, seine Kanten wie Klingen.
Am wichtigsten waren die drei magischen Worte Leben Sie wohl. In ihnen lag das eigentliche Loslassen, wenn sie ehrlich gemeint waren. Mit ihnen ließ sie die ganze Wut los, den Hass, die eigene Enttäuschung.
Zuerst ging Kati chronologisch vor und fragte sich, wann ihr in der Kindheit Unrecht getan worden war, das sie nicht vergessen konnte. Auch wenn es nur ein kleines war. Reinen Tisch machen ließ keine Krümel zu. Also erhielt Petra Lobner einen Brief, das Nachbarsmädchen, welches ihr mit fünf Jahren keines ihrer Karnickel abgegeben hatte, obwohl diese sich vermehrten, nun ja, wie Karnickel es eben taten. Petra bekam ein Lebe wohl! Auch der Präsident des Fußballvereins bekam einen Brief, weil er es als Trainer nicht hatte zulassen wollen, dass Kati bei den Jungs mitspielte. Nicht, dass sie das Spiel gemocht hätte, aber ausgeschlossen zu werden, nur weil sie ein Mädchen war? Leben Sie wohl! Der unfreundliche Busfahrer, der sie nicht mitgenommen hatte, obwohl er – an der Ampel stehend – einfach die Türen hätte öffnen können, aber stattdessen zu ihr geschaut und vorwurfsvoll auf seine Armbanduhr getippt hatte. Leben Sie wohl! Oder der Junge – die Bezeichnung Ex-Freund war zu viel Ehre für ihn –, mit dem sie ihr erstes Mal erlebt hatte. Nach dem Weinfest. Sie hatte es gewollt, weil sie verliebt gewesen war. Aber nicht so. Und er hatte nur es gewollt. Alle hatten sie gewarnt. Leb, verdammt noch mal, wohl!
Mit jedem Brief sickerte die Erkenntnis tiefer in Kati ein, dass sie nicht nur dabei war, Abschied von ihrer Vergangenheit zu nehmen, sondern von ihrem Leben hier im Ort. Dass sie fortgehen würde, ja fortgehen musste. Weil sie hier in all den Jahren nicht ihren Platz gefunden hatte. Keinen Beruf, der sie erfüllte, keinen Mann, der sie wirklich liebte und den sie ohne Sicherheitsnetz lieben konnte, kein Kind, das daraus erwachsen war. Sie hatte keinen Baum gepflanzt, nicht mal eine Primel. Vielleicht fand sich all das ja woanders. Kati wollte endlich wissen, was sie alles mit diesem merkwürdigen Geschenk machen konnte, das man Leben nannte. Es fühlte sich an, als hätte sie es noch gar nicht richtig ausgepackt, aber sähe schon das Verfallsdatum.
Sie hatte bisher nicht fortgehen, ihre Mutter nach dem Tod des Vaters nicht allein lassen können. Obwohl der Wunsch immer da gewesen war, bis ans Ende des Regenbogens zu reisen und dort das Glück zu suchen, wie es die Heldinnen und Helden in alten Geschichten taten. Aber wer fortging, der nahm nicht nur Abschied von den Verletzungen und Enttäuschungen, der nahm ebenfalls Abschied von all den guten Erinnerungen.
Also schrieb Kati auch Briefe an die Menschen, denen sie etwas zu verdanken hatte. Diese Briefe schrieb sie mit der Hand, was ungewohnt war, da sie es seit Jahrzehnten nicht mehr getan hatte und sich erst wieder an ihre Schreibschrift erinnern musste.
Der Kfz-Mechaniker der ihr fünf Prozent Rabatt eingeräumt hatte, weil sie so eine nette Kundin war, erhielt einen Brief. Ihre erste Beste-Freundin-für-immer-und-ewig, die sie hatte ihr Tagebuch lesen lassen – als einzigen Menschen überhaupt. Die Nachbarin, die ihr immer den Rasenmäher auslieh, seit ihr eigener qualmend den Geist aufgegeben hatte. Dreißig Briefe, dreißigmal Herzklopfen bis zum Hals, dreißigmal Lebwohl.
Die Adressatin von Brief Nummer 31 würde keine handgeschriebenen Zeilen erhalten.
Gudrun Lupenau lebte in einem efeubewachsenen Bungalow. Als Kati den abgescheuerten kupfernen Klingelknopf drückte, öffnete niemand.
Kati würde warten. Bis zu einer Stunde. Das war eine der Regeln, die sie aufgestellt hatte. Eine andere war, direkt mit dem Lesen des Briefes zu beginnen, sobald die adressierte Person vor ihr stand, um sich vorher nicht in Small Talk zu verlieren (wie es bei dem getippten Brief für Marcus passiert war, ihrem ersten Kuss, und bei dem handgeschriebenen für Frank, ihrem ersten richtigen Kuss).
Nach dreiundvierzig Minuten parkte ein gelber Fiat 500 in der Einfahrt, und heraus stieg Gudrun Lupenau, die auch mit zweiundsiebzig Jahren nichts von ihrer Imposanz eingebüßt hatte. Groß gewachsen, mit einer beigefarbenen Strickjacke, die grauen Haare im praktischen Pagenschnitt. Ihre Augen funkelten freudig, als sie Kati durch ihre rot umrandete Brille erblickte.
»Mensch, die Kati! Was machst du denn hier? Wie schön, dich mal wieder zu sehen nach all den Jahren! Wie viele sind es jetzt eigentlich? Ach, ist ja auch egal. Ich habe dein Lachen immer so gemocht, du hast immer so schön gestrahlt!« Sie zog den Haustürschlüssel aus der Hosentasche. »Hätte ich gewusst, dass du heute deine alte Klassenlehrerin besuchst, wäre ich früher da gewesen. Ich komme gerade von der Bank am Fluss, kennst du die? Ist erst letztes Jahr von der Gemeinde aufgestellt worden. Du musst nur an dem alten Bauernhof vorbei, weißt du, der verlassene Hof, und dann ist es nicht mehr weit. Ich kann da immer so gut nachdenken und die Seele baumeln lassen.« Sie öffnete die Haustür. »Aber jetzt sag schon, was dich zu mir führt. Magst du etwas trinken? Ach, ich habe ja gar nichts da. Außer Kaffee, den immer!«
Kati hatte diese freundliche Stimme – der man bei jeder wohlartikulierten Silbe anmerkte, dass sie durchaus ins Tadelnde umschlagen konnte – Jahrzehnte nicht mehr gehört. Aber schon beim ersten Wort war sie wieder so nervös geworden wie mit sechs Jahren, wenn sie nach vorne an die Tafel gerufen worden war und vor der ganzen Klasse eine Matheaufgabe hatte lösen müssen. Kati kam sich vor wie ein Baum, der mit der Zeit zwar viele Jahresringe zulegte, doch im Inneren stets derselbe blieb.
Sie zog rasch den Brief aus dem Umschlag und faltete das Butterbrotpapier auseinander. Mit zittriger Stimme begann sie vorzulesen:
Frau Lupenau,
Sie haben mir den Glauben an mich selbst genommen, als es um die Empfehlung für die weiterführende Schule ging. Ich hatte so viel geübt und gebüffelt für die vierte Klasse und mich in allen Fächern verbessert. Sie haben mich in dem Schuljahr so oft gelobt und dann doch keine Empfehlung für das Gymnasium ausgesprochen. Ich konnte es einfach nicht fassen. Eine ganze Woche habe ich geweint und nicht gewusst, was ich falsch gemacht hatte. Und warum Sie mir die ganze Zeit etwas vorgespielt und mir das angetan haben.
Ich mochte Sie nämlich sehr. Damals wollte ich wegen Ihnen sogar Lehrerin werden.
Das machte Ihren Verrat für mich nur umso größer.
Andere hätten sich danach wieder aufgerappelt mit dem Wunsch, es der Welt zu zeigen. Aber ich war nur ein gebrochenes kleines Mädchen, das seitdem denkt, dass es nicht schlau genug ist für die Welt. Sobald ich weiß, dass jemand anderes Abitur hat, fühle ich mich wie ein Mensch zweiter Klasse.
Dabei weiß ich tief in mir, dass ich es auch geschafft hätte, wenn Sie mir damals eine Chance gegeben hätten, anstatt mein Selbstwertgefühl so mit Füßen zu treten.
Kati reichte Gudrun Lupenau den Brief. Die letzten drei Worte kannte sie längst auswendig. Wie immer war das Allerletzte das Schwerste. Wie immer musste sie davor tief Luft holen, um die Kraft in sich zu finden, es ernst zu meinen. Und wenn auch erst mal nur für diesen einen kurzen Moment.
Leben Sie wohl.
Kati drückte Gudrun Lupenau den Brief samt Umschlag in die Hand, dann wendete sie ihr den Rücken zu. Schnell fortgehen war wichtig, bevor das Gegenüber Zeit hatte zu reagieren. Aber ihre alte Klassenlehrerin reagierte sofort, war mit wenigen, hastigen Schritten bei ihr und schloss sie weinend in die Arme.
»Ach, Kati, meine Kati! Es tut mir so leid! Es tut mir so, so leid, so schrecklich leid!«
Kati umarmte nicht zurück; sie wollte keine Zuneigung von Gudrun Lupenau und ihr erst recht keine geben. Sie wollte nur weg.
»Ich habe es doch nur gut gemeint!«, brachte Gudrun Lupenau stockend hervor.
Ein Satz, den Kati noch nie gemocht hatte. Er war so selbstgerecht, er nahm nicht ernst.
»Nein, haben Sie nicht!«
Die alte Frau löste ihre Umarmung und wischte sich die Tränen mit dem Handrücken, so gut es ging, aus dem Gesicht. »Ich habe es doch nur gemacht, weil deine Mutter darauf bestanden hat.«
»Meine Mutter?«
»Ja, ich habe ihr damals beim Elternsprechtag freudestrahlend erzählt, wie fleißig du bist und dass ich dir die Empfehlung für das Gymnasium geben kann. Aber sie wollte das nicht.«
»Aber … das ergibt doch gar keinen Sinn.«
Gudrun Lupenau hielt den Brief in Händen, als wäre er klebrig und unangenehm wie ein Fliegenfänger. »Sie hat gemeint, du bräuchtest das, du seist der Typ Mädchen, der Widerstände überwinden müsse. Ich habe erwidert, dass sie dich trotz Empfehlung ja nicht aufs Gymnasium schicken muss, aber ich deine Leistung schriftlich honorieren möchte. Da hat sie mich angefleht, das nicht zu tun, weil es dadurch Streit geben würde zwischen euch, und das könne ich ja nicht wollen. Eine Tochter gegen ihre Mutter aufzubringen. Ich habe das alles nicht verstanden, es war so komplett gegen mein Bauchgefühl. Ich war mir sicher, dass du das Zeug hattest, das Abitur zu schaffen. Aber ich hatte eine weinende Mutter vor mir, die sagte, sie wolle nur das Beste für ihr Kind.« Gudrun Lupenau schluckte hart. »Ich war damals noch eine junge Lehrerin. Nur ein paar Jahre später hätte ich mich nicht beirren lassen, aber damals … Ich habe immer gehofft, dass es die richtige Entscheidung war. Aber jetzt … es tut mir so schrecklich leid! Das kann ich ja nie wiedergutmachen.« Sie schloss ihre kleine Schülerin wieder in die Arme.
Da begriff Kati, dass manchmal sogar eine Umarmung ein Schicksalsschlag sein konnte.
***
Kati brach ihre wichtigste Regel: Sie blieb nach dem Vorlesen des Briefs. Trank frisch aufgebrühten Filterkaffee mit Kondensmilch, obwohl sie eigentlich gar keinen wollte. Sie trocknete die Tränen in Gudrun Lupenaus Gesicht mit dem hellblauen Löschpapier, das auf dem Küchentisch lag, und schenkte ihrer alten Lehrerin Trost, obwohl sie ihn doch selbst viel nötiger hatte.
Erst gute zwei Stunden später sagte sie: »Leben Sie wohl«, und meinte es wirklich.
Danach ging sie zum Fluss, vorbei an etlichen Vorgärten bis zum Ortsrand, am verlassenen Bauernhof entlang, zu der Bank, wo man die Seele baumeln lassen konnte. Ihre Seele schien Kati gerade so schwer, dass sie sicher schon bis zum Boden hing.
Der kleine Fluss machte hier eine sanfte Biegung, an den Ufern fanden sich glatt gespülte Kiesel und herbstlich verfärbte Blätter. Kinder hatten aus Zweigen einen kleinen Damm gebaut, an dessen dünnen Streben der Fluss zog und dabei amüsiert gluckste.
Als sie jung gewesen war, hatte sie auch hier gespielt, aber irgendwann die Lust verloren. Denn der Fluss konnte den Ort verlassen, einfach so, niemand hielt ihn auf. Ganz anders als bei ihr, die nicht gehen konnte, wohin sie wollte, nicht machen, was sie wollte. All das bestimmte ihre Mutter. Die es ja nur gut mit ihr meinte.
Die Bank zum Seele-baumeln-Lassen war aus Edelstahl, Sitzfläche und Rückenlehne bestanden aus Gittern, die an eine Küchenreibe erinnerten. Unter ihr wuchs kein Gras mehr, vermutlich von den Schuhen der hier Sitzenden weggescheuert – vielleicht hatten es aber auch die Seelen weggebaumelt. Außer Kati war niemand am Fluss, nur der durch die Wipfel der Eichen, Linden und Kastanien rauschende Wind. Alles so schön hier draußen, dachte Kati, als sie sich setzte, und alles so unschön in ihr drin.
Sie wollte ihre Mutter fragen, warum sie damals so gehandelt hatte. Aber Tote konnten Fragen durch die viele Graberde nicht hören, egal, wie laut man sie stellte. Selbst wenn man schrie. So blieben Katis Schreie in ihr drin und konnten nicht heraus.
Ihre Mutter war das gewesen, was man einst als eine Dame bezeichnet hatte. Eine gut aussehende, schlanke Frau, immer perfekt gekleidet, mit französischem Chic, Manieren und Ausdrucksformen. Teil der besseren Gesellschaft im Ort. Und Chefsekretärin des Bürgermeisters, mit Betonung auf Chef.
Sie war keine Frau mit großer Herzenswärme, aber immer für Kati da und nahm großen Anteil an ihrem Leben. Sie war die Art Frau, die einem im Winter die Pudelmütze auf dem Kopf tiefer zog, die einem immer ein Brot zu viel in Butterbrotpapier einschlug und die dreimal sagte, dass man nicht über die Straße laufen, sondern den Zebrastreifen benutzen solle. Am liebsten hätte sie eine Glasglocke über Kati gestülpt. Das hörte auch nicht auf, als ihre Tochter längst erwachsen war. Kati hatte ein gutes Verhältnis zu ihr gehabt, aber es hatte sich immer mehr wie das zu einer Anstandsdame angefühlt als das zu einer Mutter. Sie hatte immer gehofft, dass es sich eines Tages ändern würde, eine richtige Mutter aus der Anstandsdame schlüpfte, wie ein Schmetterling aus dem Kokon. Aber sie hatte sich nie verpuppt.
Kati stand auf und trat zum Fluss, suchte eine Stelle, an der das Bett flach war und das Wasser langsam floss. Ihr Spiegelbild war zitternd, unscharf. Aber da waren sie, die Augen ihrer Mutter. Kati suchte in ihnen nach einer Antwort, die alles erklärte, alles entschuldigte und keine neuen Wunden aufriss.
»Warum?«, fragte sie, als müsste die Frage ausgesprochen werden, müsste hinaus in die Welt, um beantwortet werden zu können.
Plötzlich war da ein Rauschen, so als stöbe ein heftiger Wind durch einen Blätterhaufen.
Erst als es langsam abklang, erkannte Kati das Flattern großer Flügel.
Dann stand er vor ihr im Wasser und trank. Aufschauend stieß er einen kehligen Laut aus, der wie »gru, gru« klang. Über jedem seiner Augen, mit denen er Kati nun fixierte, hatte er einen leuchtend roten Punkt. Der Kranich maß über einen Meter, seine ausgestreckten Flügel bestimmt das Doppelte. Silbergrau war sein Gefieder, vom Halsansatz bis zum Kopf mit einem breiten schwarzen Streifen versehen. Schwarz auch die Flügelspitzen, als trüge er lange Glacéhandschuhe.
Kati stand ganz still.
Der Kranich stakste mit seinen langen Beinen näher und legte den Kopf mal zur einen, mal zur anderen Seite, das auf sie gerichtete Schwarz der Pupillen wie ein Tupfer im Gelb seiner Augen.
»Was machst du denn hier allein?«, flüsterte Kati.
Er zog ein Bein an und ließ es in seinem Gefieder verschwinden. Balance zu halten gelang ihm mühelos.
»Hast du dich verflogen?«
Über den Himmel schob sich ein dunkles Dreieck, das ebenfalls kehlige Laute ausstieß. Das Lied der Kraniche erzählte von der Sehnsucht nach Ferne, von einem warmen Land im Süden.
Kati war nie zuvor solch einem großen Vogel so nah gewesen. Es ließ sie für diesen Moment all ihre Wut und Enttäuschung vergessen. Dieser Moment war ein Geschenk.
Dann brach eine Männerstimme durch die Stille wie eine Axt.
»Bleiben Sie stehen! Genau so!«
Kati blickte ans andere Ufer, blickte in die Sonne und machte den Schemen eines Mannes aus, dessen Gesicht sie nicht erkennen konnte.
»Gehen Sie bloß nicht weg!«, rief er und kam näher. »Keinen einzigen Schritt! Bitte!«
Der Kranich sah erschrocken zu dem Mann, dann rannte er los, den Flusslauf entlang, wurde immer schneller, bis er seine Flügel ausbreitete und sich mit kraftvollen Schwüngen in den Himmel emporhob, zu den anderen Kranichen.
Der Mann kam noch näher. Er hatte es nicht mehr weit bis zum Flussbett.
Kati blickte dem Kranich nach, der diesen kurzen, perfekten Moment mit sich zu nehmen schien. Einen tiefen Seufzer ausstoßend, wandte sie sich vom Fluss ab.
»Nein!«, rief der Mann. »Es war gerade endlich perfekt!«
Kati spürte, wie die kalte, knochige Hand namens Angst ihr Herz umfasste. Sie wurde schneller, dann rannte sie, zum alten Bauernhof und daran vorbei, bis sie atemlos den Ort erreichte.
Der Mann war ihr nicht gefolgt.
Kati blieb stehen, stützte die Hände in die Hüften, kam langsam wieder zu Atem und blickte in den Himmel, ein hellblaues Blatt Papier, völlig unbeschrieben. Keine Kraniche mehr.
Die Vögel spürten, wann es Zeit war, einen Ort zu verlassen, sie spürten das Naturgesetz in ihren Knochen und Muskeln. Es war überlebenswichtig für sie, den richtigen Zeitpunkt nicht zu verpassen, denn falls sie zu lange warteten, konnten sie verenden.
Sie selbst hatte bisher nicht festgelegt, wann sie losziehen würde. Als sie jetzt in den leeren, weiten Himmel sah, wusste Kati es mit einem Mal. Der Entschluss fühlte sich an wie ein magnetischer Nordpol ihrer Welt, an dem sich nun alles ausrichtete: Wenn Ende Oktober der letzte Kranich seine Reise antrat, würde sie mit ihm ihre Heimat verlassen und sich eine neue suchen. Sie würde mit ihnen nach Süden fliegen und all die großen dunklen Wolken, die auf ihrem Weg lagen, beiseiteschieben.
***
Der Ort, in dem Kati lebte, konnte sich nicht entscheiden, ob er Dorf oder Stadt sein wollte. Er war umringt von Dörfern und lag in der Nähe einer Stadt, bei der niemand den Status anzweifelte. Wer in Katis Heimatort lebte, war weder Dörfler noch Städter. Die Einwohner hatten nicht das Beste, sondern das Schlechteste aus zwei Welten: Warenangebot und kulturelles Leben eines Dorfes, Anonymität und Wohnungspreise einer Stadt.
Aber eines besaß der Ort, was ihn von allen anderen unterschied: ein Arktismuseum. Es wurde von Katis Onkel Martin betrieben, einem kauzigen Mann, der die Region jenseits des Polarkreises liebte, obwohl er noch nie da gewesen war. Er hatte sein Reich »Svenssons Polarwelt« getauft, obwohl er nicht Svensson, sondern Waldstein hieß, aber »Waldsteins Polarwelt« klang einfach nicht authentisch genug.
Seit sie denken konnte, baute er sein Haus mitsamt Garten so um, dass es über dem sechsundsechzigsten Breitengrad lag. Zuerst hatte er die Außenwände seines Hauses mit Holzbohlen verkleidet und ochsenblutrot gestrichen, sodass es an die Fischerhäuser der Lofoten erinnerte. Dann hatte er Schläuche im Garten verlegt, durch die heißer Dampf austrat, der die geothermischen Schlote in Island nachahmte. Mit der Zeit kamen ein Iglu aus Styropor, eine Jurte, eine grasbewachsene Wikinger-Holzhütte (mit Schaufensterpuppen darin, die wie echte Wikinger gekleidet waren) und ein Stockfischgestänge hinzu, an dem Martin tatsächlich Fisch hatte trocknen lassen (aber nur einen Sommer, dann hatte der Gemeinderat es mittels Eilbeschluss untersagt). Die Hauptattraktion waren jedoch zwei lebendige Ausstellungsstücke: Eines davon war grummelig und bockig und etwas schwerhörig, hatte einen Bart, eine sehr breite Oberlippe, die Muffel genannt wurde und weit über die Unterlippe hing, hieß Harald Schönhaar und war ein alter Elch. Das andere war enorm verschmust, ein Rentier, und hörte auf den Namen Bettina. Wie alle weiblichen Rentiere besaß auch dieses ein Geweih.
Mit unterschiedlichen Grassorten hatte Martin die Umrisse aller Länder der Arktis angelegt, wobei Harald Schweden immer wieder auffraß. Niemand wusste, wieso, vermutlich nicht einmal Harald.
Im Erdgeschoss des Hauses – in dessen ausgebautem Speicher Martin nun lebte – hatten sich mit der Zeit folgende Ausstellungsstücke angesammelt: eine kleine Bibliothek, unzählige Bilder und Fotos, ein Aquarium mit nordischen Fischen und Quallen, drei ausgestopfte Tiere (Eisbär, Polarfuchs, Schneehase), eine nachgebaute Walfängerhütte samt kompletter Inneneinrichtung, diverse Gesteinsproben in einer beleuchteten Vitrine, eine Miniatur des Erdkugel-Monuments am Nordkap sowie sämtliche Flaggen der polaren Länder (mit Erläuterungen zu ihrer Bedeutung). Auf dem Boden war sogar eine Linie aufgezeichnet, mit der sich der auf Kreuzfahrtschiffen übliche Polarkreis-Sprung nachahmen ließ. Das neueste Ausstellungsstück war ein Schneeball aus Spitzbergen im Eisfach des Kühlschranks, dessen von einem guten Freund organisierter Transport eine logistische Meisterleistung darstellte. Jedes Jahr kam etwas hinzu, dabei platzte das kleine Museum schon aus allen Nähten.
Die Menschen im Ort sagten, Martin sei eigentlich Versicherungsmakler. Aber das stimmte nicht, Martin war eigentlich Museumsdirektor, seine Arbeit als Versicherungsmakler war das Beiwerk.
Früher waren alle in Katis Straße für sie Onkel und Tanten gewesen. Alle Familie, Verbündete. Eine wundervolle Lüge. Martin aber war ein echter Onkel, der jüngere Bruder ihres vor einigen Jahren verstorbenen Vaters.
Als Kati eintraf, saß er neben der Eingangstür hinter dem geöffneten Fenster des ehemaligen Gäste-WCs, in dem nun das Kassenhäuschen untergebracht war, das gleichzeitig als winziger Museumsshop diente. Am besten liefen die Plüschtiere; für Mutige gab es auch Surströmming, die schwedische Spezialität aus vergorenem Fisch, deren Dosen sich wegen des in ihnen entstandenen Gases gefährlich dellten.
Wenn das Museum geöffnet hatte, trug Katis großer, bäriger Onkel immer einen schweren, kratzigen Norwegerpullover, selbst im Hochsommer – dann allerdings kurze Hosen und Badelatschen dazu. Sein imposanter Bart war von Natur aus nordisch blond, was ihm Geld für Blondierungen sparte.
Als er Kati erblickte, hob Martin abwehrend die Hände. »Wehe, du hast einen Brief für mich! Dann kannst du gleich wieder gehen!«
»Es könnte ja ein sehr, sehr positiver sein«, erwiderte sie und gab ihm zur Begrüßung einen Kuss auf die Wange. »Viel los?«
»Heute Morgen war eine Gruppe vom Kindergarten Sieben Zwerge hier, und Lukas führt gerade ein Ehepaar durchs Museum, das nächste Woche nach Spitzbergen reist und sich einstimmen will. So gut kann es gerne immer laufen!«
Lukas war mit seinen vierzehn Jahren ein wandelndes Lexikon. Informationen zu seinem Lieblingsthema, dem ewigen Eis, saugte er auf wie ein Schwamm, hatte aber auch dessen unangenehme Eigenschaft, das Aufgesaugte ungefragt wieder abzugeben. Lukas war nicht nur ein Neunmalklug, er war mindestens ein Zehnmalklug. Selbst wenn man ihn mitten in der Nacht wecken würde, könnte er sämtliche Polarexpeditionen der letzten zweihundert Jahre herunterrattern. Sowie die Namen ihrer Schiffe. Und der Schlittenhunde. Er verdiente sich als Museumsführer etwas dazu, was eigentlich gar nicht nötig war, da seine Eltern, ein Arzt-Ehepaar mit mehreren Praxen, zu den Reichsten im Ort zählten. Aber sie waren ausgesprochen froh, dass ihr Sohn eine Aufgabe hatte, woanders war und vor anderen Menschen als ihnen referierte. Früher waren Dinosaurier seine Leidenschaft gewesen, aber als Lukas’ Eltern von »Svenssons Polarwelt« erfahren hatten, hatten sie ihre Chance erkannt und über den Umweg von Mammuts in Sibirien die Faszination für die eisigen Landschaften des Nordens bei ihm geweckt. Sie liebten ihren Sohn sehr, aber selbst Liebe hielt nur eine gewisse Menge an Fachvorträgen zu Triceratops und Diplodocus aus. Optisch erinnerte Lukas wegen seiner runden Brille und seines Haarschnittes an Harry Potter.
Kati reichte Martin ein in Papier eingeschlagenes kleines Päckchen. »Hier, deine wöchentliche Lieferung feiner Leberwurst von Hamucher. Monika lässt schön grüßen.«
Martin liebte die feine Leberwurst von Metzger Hamucher, die beste weit und breit, aber er konnte nicht damit umgehen, dass die Metzgereifachangestellte Monika mit ihm zwischen Griebenschmalz und Cervelatwurst flirtete. Beim letzten Mal hatte Monika gefragt, ob sie nicht mal zusammen einen Kaffee trinken könnten. Seitdem musste Kati die Metzgerei-Einkäufe für Martin übernehmen. Monika ließ Martin immer lieb grüßen, wenn Kati bei ihr zweihundert Gramm feine Leberwurst bestellte. Und machte immer zweihundertfünfzig Gramm draus. Kostenlos.
»Grüß sie lieber nicht von mir zurück.«
»Irgendwann musst du alter Grummelbär mir erzählen, warum du ihr keine Chance gibst.«
Martin räusperte sich. »Irgendwann, ja.«
Kati kam einen Schritt näher. »Hast du gerade ein bisschen Zeit für mich? Ich wollte dich etwas fragen.«
»So ernst, wie du jetzt guckst, hab ich auf jeden Fall Zeit für dich. In der Arktis muss man auch immer direkt helfen, sonst ist es schon zu spät. Da geht es oft um Leben und Tod!«
Martin holte das »Bin gleich zurück!«-Schild unter dem Tresen hervor, auf dem ein Eisbär mit Cocktail in der Hand abgebildet war, und hängte es an einen Nagel über der Fensteröffnung.
Sie gingen in die komplett mit Fellen ausgelegte samische Jurte, in der Martin manchmal Oberton-Gesangs-Workshops gab. Sogar der Kirchenchor hatte mal einen besucht, aber sich mehr für den kostenlos gereichten Wodka als die Gesangstechnik interessiert.