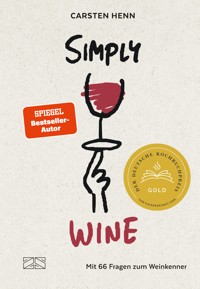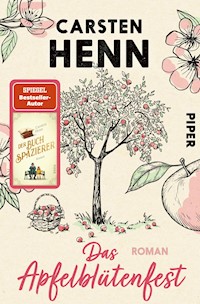Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Oetinger audio
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Bücher können die Welt verändern Als Emily hinter der Bibliothek, in der ihre Oma arbeitet, eine zweite, geheime Bibliothek entdeckt, ahnt sie noch nicht, in was für ein Abenteuer sie geraten ist. In dieser Bibliothek steht nämlich jedes Buch, das je auf der Welt geschrieben worden ist. Und dort steht auch eine magische goldene Schreibmaschine. Emily erfährt: Wenn man auf dieser Schreibmaschine Dinge schreibt und sie in die Bücher in der Bibliothek einklebt, ändert sich deren Handlung – und über diese Änderungen lässt sich auch in die Realität eingreifen. Doch auch Emilys skrupelloser Lehrer Dresskau findet heraus, welche kolossale Macht in der Bibliothek steckt. Kann Emily ihn stoppen, bevor er seine gefährlichen Pläne verwirklicht? Die Goldene Schreibmaschine: Das magische Kinderbuch-Debüt von Carsten Henn - Magischer Realismus: Carsten Henns fantastischer Abenteuerroman für Kinder ab 10 Jahren ist eine faszinierende Mischung aus magischer Fantasy und realistischen Elementen, die die Grenzen zwischen der realen Welt und der Welt der Bücher verschwinden lässt. - Große Bücherliebe: Eine Hommage an die Macht der Geschichten – wie sie uns prägen und unsere Realität gestalten. - Starke Protagonistin: Die kleine Emily zeigt, wie wichtig es ist, für das Gute einzustehen und mutig seine Stimme zu erheben. - Erstes Kinderbuch eines Bestseller-Autors: In seinem ersten Kinderbuch entführt Carsten Henn Kinder ab 10 Jahren in die magische Welt der Bücher und der Literatur. Die einzigartige Geschichte regt zum Nachdenken und Träumen an und ist auch für Erwachsene geeignet.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch
Worte können die Welt verändern …
Als Emily hinter der Bibliothek, in der ihre Oma arbeitet, eine zweite, geheime Bibliothek entdeckt, ahnt sie noch nicht, was für ein Abenteuer auf sie wartet. Denn in dieser steht auch eine magische Goldene Schreibmaschine, mit der man die Handlung der Bücher verändern kann – und damit die Geschehnisse der Welt.
Doch auch Emilys skrupelloser Lehrer Dr. Dresskau findet heraus, welche kolossale Macht in der Goldenen Schreibmaschine steckt. Kann Emily ihn stoppen, bevor er seine gefährlichen Pläne verwirklicht?
Das magische Kinderbuch-Debüt von Bestseller-Autor Carsten Henn.
Eine Hommage an die Macht der Geschichten.
Für Frederick & Charlotte –
meine größten Lehrmeister
Unsere Welt ist gewoben
Aus Geschichten, Gedanken, Ideen
Langlebiger, fester und schärfer sind sie
Als alles Metall, sämtliches Holz, jeder Stein
Beherrschst Du die Worte
Beherrschst Du die Welt
Aber beherrschst Du auch
Dich?
Eurich von Gutenberg
1
Es gibt keine zwei gleichen Regenbögen.
Aufgrund der Lichtbrechung sieht jeder einen anderen, egal, wie nah zwei Menschen beieinanderstehen. Jeder Regenbogen existiert für genau einen Menschen auf dieser Welt, jeder ist einzigartig.
Emily blickte aus dem Fenster von Raum Z08.23 der Johannes-Gutenberg-Schule und suchte den Himmel nach einem Regenbogen ab, der nur für sie dort stand. Mit der Fingerspitze fuhr sie einen Bogen über das kalte Glas, als könnte man damit einen anlocken.
Aber das Universum hatte heute keinen für sie.
Es war sowieso ein Universum der merkwürdigen Sorte. Einerseits war es ausgesprochen geizig, was glückliche Zufälle betraf. Wie Lottogewinne oder Einsen im Sport. Andererseits äußerst freigiebig mit Hirnzellenminimalisten.
Allerdings fand Emily, dass es nicht ganz so viele in ihrer Schule hätten sein müssen.
Die beste Strategie war, nicht in deren Blickfeld zu geraten. Also möglichst unauffällig sein, irgendwie mit dem Hintergrund verschmelzen.
Leider hatte Emily eine Angewohnheit, die das nicht zuließ.
Gleich würde der Unterricht beginnen. Vor jeder Stunde sortierte Emily, was auf ihrem Tisch liegen sollte. Sie holte die neuen Schulbücher aus dem Rucksack, die entsprechenden Hefte, sortierte Stifte und Füller so, dass sie von groß nach klein aufgereiht waren, sie richtete ihr Mäppchen an den Kanten des Tisches aus, exakt fünf Zentimeter von diesen entfernt. Dann legte sie Spitzer und Radiergummi bereit, immer an dieselben Stellen unterhalb des Mäppchens.
Emily machte das nicht, weil sie es schön fand. Sondern weil es sich richtig anfühlte. Sie wusste, dass sie sich genauso gut eine rote Zielscheibe auf die Stirn hätte malen können. Hohn, Spott und manchmal auch Papierkugeln trafen sie dadurch in unschöner Regelmäßigkeit. Aber sie brauchte diese Ordnung so sehr, denn ihr Leben war seit Jahren in Unordnung. Sieben Mal hatten sie schon umziehen müssen, weil ihre Mutter oder ihr Vater einen neuen Job bekommen hatte. Seit gut einem Jahr wohnte sie wieder bei ihren Großeltern, im einzigen Haus, das sich für Emily jemals wie ein Zuhause angefühlt hatte.
Sie blickte wieder aus dem Fenster, immer noch kein Regenbogen. Vielleicht sahen ihre Eltern in Dubai ja gerade einen.
Wobei Regenbögen in Wüsten noch seltener waren als Oasen.
»Entschuldige, wenn ich störe, Emily. Anscheinend findest du den Blick aus dem Fenster interessanter als meinen Unterricht. Vermutlich, weil du so schlau bist und dich meine Erläuterungen langweilen.«
»Nein, ich war nur gerade –«
Dr. Günter Dresskau ließ sie nicht ausreden. Sie hatte ihn nicht nur in Mathe, sondern auch in Geschichte. Das Universum meinte es in diesem Fall überhaupt nicht gut mit ihr. »Wenn du so klug bist, komm doch mal an die Tafel.« Er lächelte. Dresskau konnte gut lächeln, es sah so echt aus. Dabei spuckte er einem damit ins Gesicht.
»Ich habe nie gesagt, dass ich klug bin!«
»Also bist du dumm?« Sein Lächeln wurde breiter. »Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung! Da du dumm bist, solltest du erst recht zur Tafel kommen. Na los, hopp, hopp.«
Emily stand auf, rückte den Stuhl danach wieder ordentlich an den Tisch und trat zur Tafel. Sie blickte fragend zu Dresskau. Wie sehr würde er sie demütigen?
»Was soll ich rechnen?«
»Was darfst du rechnen, wäre korrekter. Ihr dürft auf die Schule gehen. Das ist ein großes Privileg! Kinder in anderen Ländern beneiden euch darum.« Er hob demonstrativ die Augenbrauen. Die Klasse begann zu tuscheln, Emily meinte sogar, das breite Grinsen von dem ein oder anderen hören zu können.
»Was darf ich berechnen?«
»Bestimme rechnerisch die Nullstelle folgender Funktion: y = –2x + 3.« Er schrieb es an die Tafel, die Kreide hart aufsetzend. Tack. Tack. Hack.
»Das haben wir noch gar nicht durchgenommen, das kommt erst in Kapitel acht.«
»Ah, du weißt also, was man wissen muss? Bist du jetzt Lehrerin?«
»Nein …«
»Nein, ganz genau! Was ich gefragt habe, ist Allgemeinwissen. Haben deine Eltern dir nichts beigebracht?«
»Keiner hier kann das wis–«
»Lenk nicht ab!« Dresskaus Stimme wurde spitz wie ein Eispickel. »Es ist gerade völlig egal, was die anderen wissen oder nicht. Es geht nur um dich.«
Auf offiziellen Schulveranstaltungen gab er sich ganz anders, freundlich und charmant, vor allem zu Emilys Mutter, mit der er einst die Schulbank gedrückt hatte. Zuckersüß war er zu ihr. Es war widerlich. »Also, kannst du die Aufgabe lösen, oder kannst du es nicht?«
»Ich kann es nicht«, antwortete Emily leise.
»Ich kann dich nicht hören!«
»Ich kann es nicht!« Diesmal rief Emily fast.
»Dein freches Verhalten ist erschreckend. Setz dich. Und bis zur nächsten Stunde schreibst du einen fünfseitigen Aufsatz über lineare Funktionen.«
»Aber die nächste Stunde ist morgen. Und da haben wir auch eine Arbeit, für die ich lernen muss!«
»Jetzt sind es zehn Seiten. Noch ein Widerwort, und es sind zwanzig. Höre ich noch ein Widerwort?«
Er hörte keines. Emily ging zurück zu ihrem Platz, die meisten ihrer Mitschüler feixten. Lasse hatte den Kopf abgewendet, als wäre er gar nicht da. Vermutlich fremdschämen. Was hätte ihr jetzt ein Lächeln von ihm bedeutet. Seit sie erstmals in die Klasse gekommen war, wünschte sie sich eines. In einem Roman wäre Lasse der Held, der nichts davon wusste, dass er Drachen zähmen konnte, auch Piraten-Anwärter in der Karibik oder Werwolf-Prinz eines mächtigen Clans wären drin, sofern sie als groß, blond und gut aussehend beschrieben wurden.
Frederick dagegen schaute zu ihr und schickte ein Lächeln, das wie eine lindernde Salbe war. Ihre beste Freundin Charly war ganz blass im Gesicht und zu keinem Lächeln mehr fähig, so als hätte sie selbst an der Tafel gestanden. Sie fühlte alles so sehr mit. Das war gut, wenn man jemanden brauchte, der einen verstand. Aber schlecht, wenn man vermeiden wollte, dass jemand sich genauso mies fühlte wie man selbst.
»Das geht auch schneller mit dem Hinsetzen!«, hörte sie Dr. Dresskau hinter sich sagen. Ihr Tisch, ihr Stuhl, ein rettendes Ufer war nur noch wenige Schritte entfernt. »Wobei, wenn ich es recht bedenke, ist es pädagogisch völlig falsch, dass du dich jetzt hinsetzen darfst. Das kommt ja einer Belohnung für dein Nichtwissen gleich. Dabei sind noch so viele weitere Aufgaben zu lösen.«
Emily wurde übel. Ihr Magen verkrampfte sich.
Frederick meldete sich.
»Jetzt nicht«, sagte Dresskau.
»Ich hätte eine Frage zu den Hausaufgaben. Und wollte das gerne klären, bevor die Stunde zu –«
Dr. Dresskau nahm ihn ins Visier. »Ich weiß genau, was du gerade versuchst! Aber mich lenkst du nicht von deiner kleinen Freundin ab! Und an dir werde ich dann nächste Stunde ein Exempel statuieren. Ich lasse mich doch nicht für dumm verkaufen von solchen Blagen wie euch!«
Allerdings war genau das gerade passiert.
Dresskau hatte nämlich nicht mitbekommen, dass Fredericks Wortmeldung eine Ablenkung von einer weiteren Aktion war. Vorher hatte dieser Charly ein Zeichen gegeben, die auf der anderen Seite des Klassenzimmers am Fenster saß. Sie sollte es öffnen und Krümel von ihrem Pausenbrot auf das Sims streuen.
Das Ergebnis flatterte jetzt herein.
Dresskau fuhr herum und zuckte zusammen. »Schmeißt das Drecksvieh sofort raus! Los!« Er lief Richtung Klassentür. »Habt ihr nicht gehört? Sofort!«
Dies war ein weiterer Grund, warum Emily ihn nicht leiden konnte. Dresskau hatte Angst vor Vögeln, weswegen er sie verachtete.
Frederick hatte mittlerweile auch Krümel auf den Boden geworfen, und die Taube flog weiter in den Klassenraum.
Dresskau rannte hinaus, die Tür hinter sich ins Schloss werfend.
Niemand kümmerte sich um die Taube, bis es zum Ende der Stunde klingelte und sie wieder aus dem Fenster nach draußen flog, so als gälte die Pausenglocke auch für vollgefressene Vögel.
Jetzt war es Emily, die lächelte.
2
Als Emily nach Schulende mit Frederick und Charly den Klassenraum verließ, sprach keiner der beiden das Debakel mit Dresskau an – wodurch sie wusste, wie schlimm es gewesen war. Während sie auf dem Bürgersteig standen und warteten, besah Emily sich ihre beste Freundin und ihren besten Freund. Zusammen waren sie echt keine Superheldentruppe. Zumindest keine, mit der man in Kinofilmen viel Geld hätte verdienen können. Mit Charly vielleicht noch am ehesten, weil sie es schon mal geschafft hatte, einen Jungen zu verprügeln, dabei war sie ganz zierlich und sah mit ihren blonden Locken aus wie eine Christkindfigur, die man oben auf den Weihnachtsbaum steckte. Charly hatte allerdings drei ältere Brüder, sie kannte jeden Trick. Und was Charly noch hatte, war eine super Eigenschaft, aber definitiv keine Supereigenschaft: Sie konnte Gefühle schmecken. Sobald sie etwas fühlte, schmeckte es nach etwas. Ob sie wollte oder nicht. Das fiel wohl unter den Begriff Synästhesie, doch Emily kam es wie Magie vor.
Frederick war ein großer Schlacks, wohnte im Haus neben dem ihrer Großeltern und konnte verdammt gut Blockflöte spielen, was wenig half, wenn man die Welt retten wollte. Er war extrem gut in allen naturwissenschaftlichen Fächern, zudem ein Science-Fiction- und Fantasy-Fan, egal ob Bücher, Comics oder Computer-Spiele. Außerdem machte er Triathlon, also Radfahren, Schwimmen, Laufen, wobei Emily nie wusste, in welcher Reihenfolge. Am liebsten wäre er mit einem glänzenden Raumschiff durch die unendlichen Weiten des Weltalls geflogen. Zumindest solange das glänzende Raumschiff auch einen glänzenden Triathlon-Raum inklusive See aufwies. Manche kamen mit ihm nicht gut klar, weil er stets sagte, was er dachte, und Lügen verabscheute. Emily mochte das sehr, denn man wusste immer, woran man bei Frederick war.
Die drei kannten sich noch aus dem Kindergarten, aber dann begann das mit den vielen Umzügen. Seit Emily bei ihren Großeltern wohnte, kam es ihr vor, als wären sie nie getrennt gewesen.
Mit Frederick gab es ein besonderes Ritual: Wenn einer von ihnen Langeweile hatte oder jemanden zum Reden brauchte, stellten sie einfach ein Benjamin-Blümchen-Stofftier ins Fenster, das sie zufälligerweise beide irgendwann mal geschenkt bekommen hatten. Natürlich hörten sie die Geschichten längst nicht mehr, aber sie brachten es nicht übers Herz, den Elefanten mit der roten Mütze wegzuwerfen. Plüschtiere waren eben auch irgendwie Tiere.
»Was guckst du uns so komisch an?«, fragte Frederick und legte die Stirn in Falten.
»Ist irgendwas? Schmeckt auf jeden Fall nach Kiwi«, kam es von Charly. »Und warum lachst du jetzt?«
Definitiv keine Superheldentruppe, kein Geheimbund, keine Gruppe von Privatdetektiven. Einfach nur Freunde. Wobei, was hieß da einfach nur? Freunde zu haben, bedeutete verdammt viel. Und je weniger man hatte, desto wertvoller waren sie. Wie sowieso nur Dinge wertvoll waren, die selten waren. Gäbe es Gold so oft wie Fruchtfliegen, würde niemand einen Cent dafür ausgeben.
Heute holte Emilys Großmutter Rose sie ab (eigentlich hieß sie Heiderose, aber das sagte niemand). Zusammen mit Emily ging es zur Anna-Amalia-Bibliothek. Charly und Frederick nach Hause zu bringen, lag auf dem Weg.
Außerdem fuhren beide gern mit in dem Auto von Emilys Oma, das sie nur das »Rollende Museum« nannten. Rose liebte es, Zimmer einzurichten. Zu Hause hatte sie schon alles komplett vollgestellt, sogar das Gartenhäuschen und den Fahrradschuppen hatte sie mit Bildern, Fotos und Dekorationsobjekten bereichert. Jemand wie sie machte nicht vor einem Auto halt, nur weil es fuhr.
Als Erstes hatte sie ihm einen Namen gegeben. Gertrud. In Erinnerung an ihre Mutter, die erste Frau in der Familie, die jemals den Führerschein gemacht hatte. Dann hatte sie den Wagen innen so gestaltet, wie es Gertrud gefallen hätte: Sie hatte Sitzbezüge in Blumenmustern gestrickt, hatte die Innentüren mit Geranien angemalt (Gertruds Lieblingsblumen) und hatte allerhand auf das Armaturenbrett und die Konsole des Wagens geklebt, unter anderem einen Johannes-Gutenberg-Wackelkopf und eine Miniatur-Anna-Amalia. So bunt und durcheinander das Auto, so bunt und durcheinander war auch Oma Rose gekleidet, was manche denken ließ, sie wäre farbenblind. Dabei kombinierte sie nur einfach munter Kleidungsstücke, die zu ihr passten, selbst wenn sie nicht zueinanderpassten.
Und noch etwas war bei Rose anders als bei normalen Großmüttern. Sie fuhr weder behäbig noch vorsichtig, sondern schnell und mit eingebauter Vorfahrt. Das wütende Hupen anderer Autos schien sie gar nicht zu hören vor lauter Freude am Fahren.
Nachdem sie zuerst einen gut durchgeschüttelten Frederick und dann eine leicht schwindelige Charly nach Hause gebracht hatten, fuhr sie weiter zur Anna-Amalia, wo gleich ihre Schicht begann.
Für Emily der schönste Ort auf der ganzen Welt.
3
Wenig später blickte Emily hinaus in den großen, kunstvoll angelegten Bibliothekspark, wo die Blätter der alten Eichen sich im Sommerwind sanft bewegten und Schatten spendeten.
Sie fühlte sich in diesem Moment sicher und warm und sogar ein bisschen glücklich. So glücklich, wie man sich eben fühlen konnte, wenn man gerade vor der ganzen Klasse auf die Größe einer Briefmarke zusammengefaltet worden war.
Jeder Mensch brauchte einen sicheren Ort. Das konnte ein großer Kleiderschrank sein, in den man komplett hineinpasste, eine morsche Bank an einem abgelegenen See oder ein Schrebergartenhäuschen mit bollerndem Holzkohleofen.
Emily hatte eine Bibliothek.
Und in dieser gab es einen Ohrensessel, der über die Jahre bunte Flicken gesammelt hatte wie andere Manga-Hefte. Er besaß eine Kuhle, die so wunderbar eingesessen war, dass man gar nicht mehr aufstehen wollte.
Und auch nur schwer konnte.
Emily hatte ihre Schuhe ausgezogen, die Knie angezogen und ein Buch in den Händen, das sie für den Deutschunterricht lesen musste. Dabei war es nie gut, etwas lesen zu müssen. Selbst die beste Geschichte verlor dadurch an Zauber. Deshalb blickte Emily lieber aus dem Fenster in den kleinen Park, zu den rauschenden Blätterdächern. Wenn der Wind durchfuhr und man die Augen ein wenig schloss, sahen sie aus wie die Gefieder großer grüner Vögel.
Die Anna-Amalia-Bibliothek war ein wunderschönes, quadratisches Gebäude mit umlaufendem Wassergraben und einer kleinen Hängebrücke, die aber seit Jahrhunderten unten war und sich nicht mehr hochziehen ließ. Die massiven Außenwände waren weiß gekalkt, die Fensterrahmen und -läden himbeerrot und der Wetterhahn auf dem höchsten der fünf Türme aus glänzendem Gold. Alle Räume waren bis oben hin voller Bücher, egal ob der große, strahlend helle Rokoko-Saal, in dem sich jeder fühlte, als wäre er adlig, das Kaminzimmer, der Ankleideraum oder die kleinen Kabuffs, in denen die Untergebenen einst hatten schlafen müssen. Überall waren Regale angebracht und mit katalogisierten Büchern gefüllt.
Emilys Ohrensessel stand in der ehemaligen Küche, wo heute die alten naturwissenschaftlichen Bücher lagerten. Sogar im ehemaligen Ofen waren Regalbretter installiert.
Emily atmete durch und kuschelte sich noch tiefer in den Ohrensessel. Alles war gut in ihrer Bibliothek. Zumindest für den Moment.
Die Bibliothek gehörte natürlich nicht Emily, sondern einer Stiftung, von der sich aber nie einer blicken ließ. Eurich von Gutenberg hatte das schlossähnliche Gebäude Anfang des 18. Jahrhunderts erbauen lassen. Ein Nachfahre Johannes Gutenbergs, dem ebenso legendären wie genialen Erfinder des modernen Buchdrucks.
Den Erzählungen nach war Eurich ein verschrobener Mann gewesen, manche seiner Zeitgenossen hatten ihn sogar für geistig verwirrt gehalten. Irgendwann war er einfach spurlos verschwunden. Nebenan im Rokoko-Saal hing ein prächtiges Gemälde in einem Rahmen aus edlem Kirschholz, das ihn zeigte. Er trug einen imposanten roten Hut mit Pfauenfeder und stand vor der Anna-Amalia-Bibliothek, neben sich einen Tisch mit schweren, ledergebundenen Büchern, aus denen Seiten herausflogen, als wären sie weiße Vögel. Je höher sie stiegen, desto dunkler wurde das Papier, bis es irgendwann nicht mehr vom düsteren Hintergrund zu unterscheiden war. Wenn man näher herantrat, ließ sich erkennen, dass auch die Sätze, die Worte, die Buchstaben von den Seiten flogen, sich drehten, wie Wasser, das von unten nach oben floss und sich schließlich in Dampf auflöste.
Emily blickte in den Rokoko-Saal, wo gerade ein Besucher auftauchte. Sein Schritt war hart und zackig, wie beim Marschieren.
Schnell duckte sie sich, denn es war der vermaledeite Dr. Dresskau. Was machte der denn hier? Konnte er sie nicht wenigstens in ihrer Freizeit in Ruhe lassen? Mit jedem Schritt, den er sich näherte, schlug ihr Herz schneller. Zwar war dies nicht die Schule, aber er würde sicher einen Grund finden, sie auch hier zu demütigen. An ihrem sicheren Ort.
Ihrem ehemals sicheren Ort.
Jetzt blieb er stehen. Emily konnte seinen Atem hören, den er scharf zwischen den Zähnen einzog und ausstieß. Sah er sich gerade nach ihr um? Würde sie gleich sein Gesicht erblicken? Die Sekunden zogen sich wie Kaugummi.
Endlich bewegte er sich wieder ein paar Schritte fort von ihr.
Emily hätte sicher in ihrem Sessel bleiben können. Das wäre naheliegend gewesen und sinnvoll.
Aber sie stand auf, ging leise zum Türrahmen und schaute vorsichtig um die Ecke.
Dresskau stand vor einem hohen Regal und schnalzte mit der Zunge – was er nur tat, wenn er unzufrieden war.
Emily mochte das Geräusch.
Hastig zog er ein Buch heraus, einen alten, staubbedeckten Atlas, und linste dahinter ins Regal, schob es dann schnell wieder zurück. Ein anderes ledergebundenes Buch landete in seinen Händen, wieder ein Blick dahinter, wieder ein Schnalzen, fast wie ein Peitschenknall.
Buch um Buch zog er hektisch hervor, jedes wurde wütender zurückgeschoben.
Beim einunddreißigsten geschah etwas Ungewöhnliches. Die Wolkendecke riss ein wenig auf, und die Sonne schickte einen warmen Strahl durch eines der Fenster. Nur ein, zwei Sekunden lang.
Im Bücherregal glitzerte es golden.
Als Emily genauer hinsah, war es schon wieder verschwunden.
Sie hielt es kaum aus, zu warten, bis Dr. Dresskau die Bibliothek verließ und sie nachschauen konnte, was das Glitzern verursacht hatte. Wenn sie etwas Goldenes fand, gab es bestimmt einen hohen Finderlohn! Und mit einem hohen Finderlohn bräuchten ihre Eltern nicht mehr im Ausland zu arbeiten und konnten zurückkehren.
Aber mit jeder Minute, die verging, wurde sie unsicherer, wo sie es gesehen hatte. Als Dresskau nach siebenundneunzig herausgezogenen Büchern endlich fluchend von dannen zog und sie nachschauen konnte, fand Emily nichts. Egal, aus welchem Blickwinkel sie das Regal auch anschaute.
Wie konnte das bloß sein? Hatte sie sich das Glitzern etwa nur eingebildet?
Sie würde morgen nochmals suchen!
Hoffentlich tauchte Dr. Dresskau dann nicht wieder auf.
4
Das sonnengelbe Haus von Emilys Großeltern lag gegenüber dem alten, einstmals prächtigen, heute verfallenen und größtenteils überwucherten Hallenbad. Das Haus war gleichzeitig klein und groß. Klein, weil es zwischen zwei größeren stand und wirkte, als würde es von diesen gleich in die Mangel genommen. Groß, weil es viele Zimmer hatte – auch wenn sie alle klein waren. Im Erdgeschoss lebten Emilys Großeltern. Früher hatten sie das ganze Haus bewohnt, aber nach und nach immer weniger Platz gebraucht und immer weniger Lust gehabt, Treppen zu steigen, sodass die obere Etage frei gewesen war, als Emilys Eltern eine Bleibe für sich und ihre Tochter gesucht … und kein Geld hatten, um sich etwas Eigenes zu leisten.
Überall war es eng, und da die Wände dünn waren, auch laut. Die Heizung funktionierte nie richtig und klang, als gurgelte jemand mit Mundwasser. Deswegen verbrachte Emily im Winter sogar noch mehr Zeit in der Anna-Amalia. Zwar fehlte der Bibliothek an allen Ecken und Enden Geld, die Farbe blätterte von den Wänden, etliche Glühbirnen waren kaputt, die Abflussrohre in den Toiletten regelmäßig verstopft, aber es war immer gut geheizt, wogegen Emily zu Hause an kalten Tagen mit Pullover und dicken Socken herumlaufen musste.
Trotzdem liebte Emily das Haus ihrer Großeltern von ganzem Herzen. Denn nach sieben Umzügen in drei Jahren war es das erste, das sich wirklich wie ein Zuhause anfühlte.
Als Rose die Tür aufschloss, fiel Emilys Blick auf die Namen über der Klingel. »Rose & Martin Wirich« stand da, und auf einem nachträglich hingeklebten Zettel »Monika & Ralf Paper«. Emily strich sanft über ihre Namen. Ein kleiner Gruß in die Ferne.
Vor etwas über einem Jahr war das Architekturbüro bankrottgegangen, in dem ihre Eltern als Bauzeichner gearbeitet hatten. Ein halbes Jahr später war das Angebot aus Dubai gekommen. Da es in der Stadt keine Jobs für sie gab und es zudem gut dotiert war, hatten sie die weite Reise angetreten. Ein Jahr im Orient. Direkt am Meer, obwohl ihr Vater Angst vor offenem Wasser hatte, seit er als Kind beinahe in der Nordsee ertrunken wäre.
Ihre Tochter wollten sie nicht schon wieder aus der gewohnten Umgebung reißen und hatten sie schweren Herzens zurückgelassen.
Emilys Kopf verstand das, aber ihr Herz verstand es nicht und bekam immer einen kleinen Stich, wenn hinter der Haustür weder ihre Mutter noch ihr Vater auf sie warteten.
Umso schöner war es, dass Wolke sie begrüßte, als Emily die Tür ihres Zimmers im Obergeschoss öffnete.
»Guten! Tag! Emily! Nüsse! Küsse!«
Obwohl er echt gerne Unsinn redete.
Da es Zeit für eine Vogel-Dusche war, holte sie die kleine mit Wasser gefüllte Sprühflasche aus dem Schrank. Wolke spreizte sofort genüsslich die Flügel und schüttelte die langen Schwanzfedern, als der Wassernebel um ihn herum auftauchte.
Die Papers/Wirichs waren eine zoologische Familie. Jeder besaß ein Tier – wobei man Tiere ja nie wirklich besaß. Emilys Großmutter hatte einen Mops namens Churchill, der aussah wie ein zerknautschtes Sofakissen und den man mehr hörte als sah, weil er immer aus irgendeiner Ecke schnarchende Geräusche von sich gab. Emilys Großvater hatte einen Karpfen, einen sogenannten Koi, der im Gartenteich lebte. Der Karpfen trug den Namen Kaiser Wilhelm, hörte aber natürlich nicht darauf, ließ sich jedoch streicheln. Emilys Mutter hatte eine zerzauste Katze namens Campino adoptiert, die manchmal vorbeischaute, und Emilys Vater, nun ja, der hatte kein Tier, aber er wünschte sich schon lange ein Terrarium mit einer Grünen Zwergwüstenkröte. Wenn es nach dem Rest der Familie ging, würde er so ein Ungetüm aber nie bekommen.
Emily hatte einen Vogel.
Und ja, dazu hatte sie sich schon alle Sprüche anhören müssen, die es gab.
Sie ging zur großen Voliere und öffnete diese, damit ihr Indischer Ringelhals herausfliegen konnte. Eine Stunde pro Tag war Pflicht. Der hellblaue Vogel mit dem kleinen orangefarbenen Schnabel landete auf ihrer Schulter – seinem liebsten Platz auf der ganzen Welt.
»Na, wie war dein Tag so?«
»Sonne! Wonne! Hoch!«
Wolke war fasziniert von Sonne und Mond.
Emily sah, dass Wolkes Futterschale schon wieder leer war. Das Geld reichte kaum, um alle Tiere im Haus zu versorgen. Sie holte eine kleine Tüte Nüsse aus der Tasche, die sie in der Pause mit Charly gegen ihr Dinkelbrot mit Gouda getauscht hatte. Deren Vater war überzeugt davon, dass Nüsse gut für die Intelligenz waren, und Charly war überzeugt davon, dass sie nicht gut für ihren Geschmack waren.
»Hier, für dich.« Emily fütterte Wolke aus der Hand, was immer ein wenig kitzelte. Auf die gute Art und Weise. Danach stieß der Ringelhals ein paar glückliche Triller aus und drückte sein fedriges Köpfchen gegen Emilys Hals.