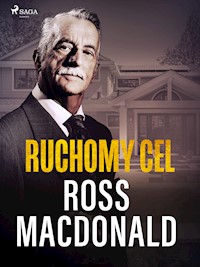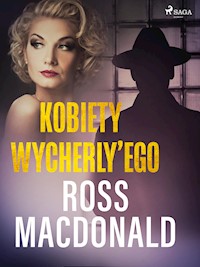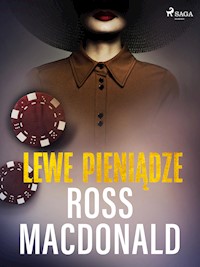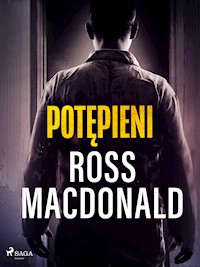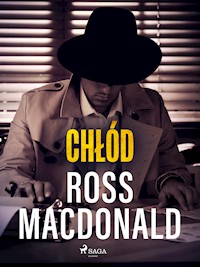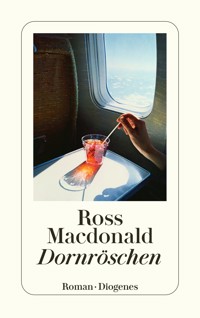
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Privatdetektiv Lew Archer
- Sprache: Deutsch
Als sich an der südkalifornischen Küste – eigentlich ein Surferparadies – ein Ölfilm bildet, kann der Clan des Bohrinselbesitzers, dem das Gelände gehört, seine Familiengeheimnisse nicht länger unter dem Teppich halten. Detektiv Archer aber droht sich in die Frau eines Mandanten zu verlieben. Ross Macdonalds unvergessliche ›Lew-Archer‹-Romane in der Neuübersetzung von Karsten Singelmann. Mit einem Nachwort von Donna Leon.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 417
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Ross Macdonald
Dornröschen
Roman
Aus dem Amerikanischen von Karsten SingelmannMit einem Nachwort von Donna Leon
Diogenes
Für Eudora Welty
1
An einem Mittwochnachmittag flog ich von Mazatlán nach Hause. Während des Landeanflugs auf Los Angeles sah ich aus der Mexicana-Maschine zum ersten Mal den Ölfleck auf dem Meer.
Wie ein unförmiger Teppich, einige Kilometer breit und etliche Kilometer lang, bedeckte er das blaue Wasser vor Pacific Point. Unweit der Küste ragte eine Bohrinsel auf wie der Metallgriff eines Dolches, in den Bauch der Erde gerammt, damit sie schwarzes Blut verströme.
Der mexikanische Flugbegleiter schritt durch den Gang, um zu prüfen, ob wir alle zum Landen bereit waren. Ich fragte ihn, was mit dem Meer passiert sei. Der Latino gestikulierte und zuckte nur die Achseln, als erübrige sich die Frage von alleine angesichts des sattsam bekannten Leichtsinn der Amis.
»Die Explosion war am Montag.« Er beugte sich vor und schielte am Flügel vorbei nach unten. »Heute ist es noch schlimmer als gestern. Schnallen Sie sich bitte an, Señor. Wir landen in fünf Minuten.«
Im Flughafen kaufte ich eine Tageszeitung. Der Ölteppich beherrschte die Titelseite. Ein gewisser Jack Lennox, der das Unternehmen managte, das die Bohrinsel betrieb, prophezeite, das Problem werde innerhalb von vierundzwanzig Stunden unter Kontrolle sein. Lennox war, dem Foto nach, ein gutaussehender Mann, was nicht heißen musste, dass ihm über den Weg zu trauen war.
Pacific Point war einer meiner Lieblingsorte an der Küste. Während ich mich auf den Weg zu meinem Auto machte, drückte die den Strand bedrohende Ölpest wie ein heranziehendes Tief auf meine Stimmung.
Anstatt zu meiner Wohnung nach West Los Angeles fuhr ich südwärts, an der Küste entlang in Richtung Pacific Point. Die Sonne stand schon tief, als ich zur Anhöhe über dem Hafen gelangte, von wo aus ich den riesigen Ölteppich sehen konnte, der das Meer einschwärzte, als wäre die Nacht vor der Zeit angebrochen.
Er hatte sich der Küste bis auf etwa tausend Meter genähert; noch bildete der dunkelbraune Seetang eine natürliche Schutzwehr. Löschboote waren unterwegs, um den Teppich von den Rändern her mit Chemikalien einzusprühen. Weit und breit war sonst kein Boot zu erkennen. Ein weißes Plastikband versperrte den Hafeneingang, darüber tanzten Möwen wie vom Wind aufgewirbelte Schnipsel.
Ich stieg zum öffentlichen Strand hinab und schlenderte die Landzunge mit Blick auf den Hafen entlang. Einige Menschen, vor allem Mädchen und Frauen, standen am Ufer und blickten aufs Meer hinaus. In ihrer Reglosigkeit sahen sie aus, als erwarteten sie den Weltuntergang oder als wäre dieser bereits eingetreten und sie dabei zu Salzsäulen erstarrt.
Die Wellen schwappten träge heran. Ein schwarzer Vogel mit spitzem Schnabel versuchte verzweifelt, sich über Wasser zu halten. Er hatte orangerote, wie in heller Wut glühende Augen, doch war er so verunstaltet vom Öl, dass ich ihn erst auf den zweiten Blick als Renntaucher identifizierte.
Eine Frau in weißer Bluse und langer Hose watete bis zu den Oberschenkeln ins Wasser, um den Vogel zu bergen. Geschickt hielt sie ihn so, dass er nicht nach ihr hacken konnte. Sie war jung und hübsch, wie ich feststellte, als sie sich zum Ufer zurückwandte. Ihre Augen funkelten ebenso zornig wie die des Vogels. Die schmalen Füße hinterließen anmutige Abdrücke im nassen Sand.
Ich fragte sie, was sie mit dem Renntaucher vorhabe.
»Mit nach Hause nehmen und säubern.«
»Ich fürchte, er wird auch dann nicht überleben.«
»Nein, aber ich vielleicht.«
Sie entfernte sich, das zappelnde schwarze Wesen gegen die weiße Bluse gedrückt. Ich folgte ihren zierlichen Abdrücken. Als sie es bemerkte, drehte sie sich um.
»Was wollen Sie?«
»Mich entschuldigen. Es war nicht meine Absicht, Sie zu entmutigen.«
»Schon gut«, sagte sie. »Es stimmt ja, dass die wenigsten Vögel überleben, wenn sie so viel Öl abbekommen. Aber während der Ölpest von Santa Barbara konnte ich einige retten.«
»Sie sind offenbar eine Vogelexpertin.«
»Das ist reiner Selbstschutz. Meine Familie ist im Ölgeschäft.«
Sie deutete mit dem Kopf zur Bohrinsel. Dann drehte sie sich abrupt um und ließ mich stehen. Ich sah ihr nach, wie sie über den Strand eilte. Den ramponierten Renntaucher trug sie im Arm wie eine Mutter ihr Kind.
Ich folgte ihr bis zum Kai am Südende des Hafens. Eins der Arbeitsboote hatte die Sperre geöffnet, um die anderen Löschboote einzulassen. Sie machten längs der Kaimauer fest.
Der Wind hatte gedreht, der Geruch des ausgelaufenen Öls stieg mir in die Nase. Es roch wie etwas Abgestorbenes, das niemals mehr aus der Welt zu schaffen war.
Es gab ein Restaurant auf dem Kai, »Blanche’s Seafood«, wie die blinkende Leuchtschrift auf dem Dach verkündete. Da ich Hunger hatte, hielt ich darauf zu. Auf der anderen Seite des langgestreckten Gebäudes stapelten sich Chemiekalienbehälter, Bohrlochummantelungen und allerlei Gerätschaften. An einem Landesteg stiegen Männer aus ihren Booten.
Ich trat zu einem älteren Arbeiter mit sonnengegerbtem Gesicht unter dem roten Helm und erkundigte mich nach dem Stand der Dinge.
»Wir sollen nicht drüber reden. Das Reden übernimmt die Firma.«
»Lennox?«
»So heißt sie wohl.«
Ein bulliger Vorarbeiter schaltete sich ein. Er hatte schwarze Flecken auf der Kleidung, und seine hochhackigen Cowboystiefel waren über und über mit Öl beschmiert.
»Sind Sie von der Presse?«
»Nein. Bin nur ein normaler Bürger.«
Er musterte mich misstrauisch. »Hier aus der Gegend?«
»L.A.«
»Dann haben Sie hier nichts zu suchen.«
Er bugsierte mich mit seinem dicken Bauch beiseite. Die Männer ringsum verstummten. Es waren rauhe Burschen, müde, frustriert und sichtlich bereit, ihre Wut an allem auszulassen, was sich bewegte.
Ich ging zum Restaurant zurück. Ein Mann, der mit seiner gerippten Wollmütze wie ein Fischer aussah, wartete gleich hinter der nächsten Ecke. Unter der Mütze sahen struppige Haare und der offene Blick eines jungen Menschen hervor.
»Legen Sie sich bloß nicht mit denen an«, sagte er.
»Hatte ich nicht vor.«
»Gut die Hälfte kommt aus Texas, aus dem Landesinnern. Wasser ist für die nur ein Ärgernis, weil man es nicht für zwei oder drei Dollar das Barrel verkaufen kann. Die interessieren sich einzig und allein für das Öl, das ihnen durch die Lappen geht. Die Lebewesen im Meer oder die Menschen hier vor Ort sind ihnen völlig gleichgültig.«
»Läuft immer noch Öl aus?«
»Aber klar. Am Montag, dem Tag der Explosion, dachten sie zuerst, sie hätten alles unter Kontrolle. Es war ein wildes Toben, als Bohrschlamm und Kohlenwasserstoffnebel in die Luft geschossen sind, dreißig, vierzig Meter hoch. Man hat das Gestänge im Bohrloch versenkt und die Absperrschieber darüber geschlossen und war der Meinung, damit wäre alles abgedichtet. Das Hauptbohrloch war es auch. Aber der Meeresboden hat nicht dicht gehalten, und rings um die Plattform ist ein brodelndes Gemisch aus Gas und Öl nach oben gestiegen.«
»Hört sich so an, als hätten Sie’s mit eigenen Augen gesehen.«
Zwinkernd nickte der junge Mann. »Das stimmt. Ich habe einen Reporter in meinem Boot mit rausgenommen – einen Mann namens Wilbur Cox, von der Lokalzeitung. Als wir ankamen, wurde die Plattform gerade evakuiert, wegen der Brandgefahr.«
»Gab es Tote?«
»Nein, Sir. Wenigstens das ist uns erspart geblieben.« Durch die Haare hindurch sah er mich forschend an. »Sie sind nicht zufällig auch Reporter?«
»Nein, es interessiert mich einfach nur. Wissen Sie, was den Blow-out verursacht hat?«
Mit dem Daumen deutete er zuerst zum Himmel, dann aufs Meer. »Es kursieren ganz unterschiedliche Erklärungen. Unzulängliche Ummantelungen zum Beispiel. Aber irgendetwas stimmt auch nicht mit dem Untergrund. Das ist alles porös. Es ist, als würde man ein Stück Kuchen aushöhlen, um darin Wasser zu halten. Man hätte gar nicht erst anfangen dürfen, dort draußen zu bohren.«
Die Ölarbeiter aus den Booten kamen angetrottet wie die versprengten Überreste einer geschlagenen Armee. Der Fischer stand stramm und salutierte mit breitem Grinsen. Er erntete aber nur mitleidige Blicke, als wäre er ein armer Irrer, der nicht kapierte, was auf dem Spiel stand.
Ich betrat das Restaurant. Aus der Bar drangen Stimmen, angeheitert und verhängnisvoll, der Speisesaal dagegen war fast leer. Eingerichtet war er in einer Art Marinelook für Landratten, mit Bullaugen anstelle von Fenstern. Zwei Männer standen an der Kasse und wollten zahlen.
Sie fielen mir auf, weil sie ein seltsames Duo darstellten. Der eine war jung, der andere alt und klapprig. Vater und Sohn schienen sie allerdings nicht zu sein. Sie machten nicht einmal den Eindruck, als ob sie vom selben Stern kämen.
Der Alte hatte fast keine Haare, dafür bleiche Narben auf dem Kopf, die auch die Schläfen seines Gesichts maserten. Er trug einen alten grauen, offenbar maßgeschneiderten Tweedanzug, in dem sein schmächtiger Körper allerdings fast verschwand. Entweder, so meine Vermutung, war der Anzug ursprünglich für jemand anders bestimmt, oder er hatte ihn sich schneidern lassen, als er noch jünger und von kräftigerer Statur gewesen war. Er bewegte sich, als wäre er aus der Welt und aus der Zeit gefallen.
Der jüngere Mann trug Jeans und einen schwarzen Rollkragenpullover, der seinen kräftigen Oberkörper betonte. Über den breiten Schultern wirkte der Kopf geradezu winzig. Als er meinen Blick bemerkte, starrte er zurück. Sein Blick jedoch war der eines Verlierers, wie ich schon so viele gesehen hatte, eines Menschen, der die Welt durch Fenster aus Panzerglas betrachtete, hinter denen er sich verbarrikadierte.
Eine füllige blonde Frau im orangefarbenen Kleid nahm das Geld entgegen und ließ die Kasse klingeln. Der junge Mann, der gezahlt hatte, steckte das Wechselgeld ein. Der Alte im Tweedanzug griff nach dessen Arm wie ein Blinder oder Invalider, der auf die Hilfe eines Pflegers angewiesen ist.
Die Blonde hielt ihnen die Tür auf und zeigte, wie als Antwort auf eine Frage, den Strand hinunter nach Süden.
Als sie mir die Speisekarte brachte, erkundigte ich mich nach den Männern.
»Hab sie noch nie gesehen. Müssen Touristen sein – kennen sich überhaupt nicht aus. Die letzten Tage über hatten wir hier eine Menge Schaulustige.« Sie sah mich scharf an. »Sie selber sind auch neu hier. Sind nicht zufällig einer von diesen Troubleshootern, die sich um das Ölleck kümmern sollen?«
»Nein, ich bin auch nur ein Tourist.«
»Na, hier sind Sie jedenfalls richtig.« Mit deutlichem Besitzerstolz blickte sie sich im Saal um. »Und ja, ich bin Blanche, falls Sie sich das gefragt haben. Etwas zu trinken? Ich schenke nur Doppelte ein, das ist mein Erfolgsgeheimnis.«
Ich orderte einen Bourbon auf Eis. Dann beging ich den Fehler, Fisch zu bestellen. Er schmeckte nach Öl. Nach wenigen Bissen ließ ich mein Essen stehen und ging nach draußen.
2
Die Flut kam mit vermehrter Wucht herein und hatte womöglich das Öl im Schlepp. Bis zum nächsten Tag konnte es den Strand schon erreicht haben. Ich beschloss, einen Abschiedsspaziergang an der Küste entlang nach Süden zu machen. Zufällig war das auch die Richtung, die die Frau mit dem Renntaucher eingeschlagen hatte.
Die untergehende Sonne ergoss sich übers Wasser und ließ den Himmel auflodern, der verschiedene Rottöne durchlief, bevor er in einem weichen, porösen Grau endete. Es war, als befänden wir uns unter der Decke einer gewaltigen Höhle, in der kleine Feuer glommen.
Ich näherte mich einer Stelle, wo die Küste vorgebuchtet und der Strand von einer steilen Klippe überragt war. Draußen auf dem Wasser warteten einige späte Surfer auf eine letzte große Welle.
Ich beobachtete sie, bis die erhoffte Welle sich aus dem immer dunkler werdenden Meer erhob und die meisten von ihnen an Land trug. Ein Kormoran schwebte wie eine Mahnung über dem Wasser.
Ich lief noch einen knappen Kilometer weiter. Der ohnehin schmale Strand wurde noch schmaler, bedrängt von den Wellen, eingepfercht zwischen ihnen und der Klippe. Die Klippe war an diesem Punkt fast zwanzig Meter hoch. Holprige Pfade oder wacklige Holztreppen führten hier und da zu den oben liegenden Häusern hinauf.
Ich redete mir ein, die Flut könne mir nichts anhaben. Aber die Nacht senkte sich herab, und das Meer stieg ihr immer weiter entgegen.
Ein paar hundert Meter vor mir versperrte Felsgeröll den Weg. Ich beschloss, noch bis dorthin weiterzugehen, dann aber umzukehren. Irgendetwas zog mich an. Im schwindenden Licht hatten die Klippe und die Steinhaufen zu ihren Füßen etwas Unwiederbringliches.
Oben zwischen den Felsbrocken steckte etwas Weißes. Im Näherkommen sah ich, dass es eine Frau war, und immer, wenn das Wasser abebbte, konnte ich hören, dass sie weinte. Sie wandte das Gesicht ab, aber ich hatte sie bereits wiedererkannt.
Sie saß vollkommen still, als ich näher trat, als sei sie ein unbelebter Gegenstand, der in der Felsspalte hängengeblieben war.
»Ist etwas nicht in Ordnung?«
Abrupt, als würde sie ihre Tränen hinunterschlucken, hörte sie auf zu weinen. »Doch, es ist alles in Ordnung«, sagte sie, ohne mich anzusehen.
»Ist der Vogel gestorben?«
»Ja, er ist tot.« Sie sprach mit hoher, gepresster Stimme. »Sind Sie jetzt zufrieden?«
»So leicht bin ich nicht zufriedenzustellen. Meinen Sie nicht, dass Sie sich einen sichereren Sitzplatz suchen sollten?«
Sie antwortete zunächst nicht. Dann drehte sich ihr Kopf langsam zu mir. Ihre nassen Augen glänzten im letzten Abendlicht.
»Es gefällt mir hier. Ich hoffe, die Flut kommt und nimmt mich mit.«
»Nur weil ein Renntaucher gestorben ist? Es werden noch viele Seevögel verenden.«
»Hören Sie auf, vom Tod zu sprechen. Bitte.« Sie zwängte sich aus der Felsspalte hervor. »Wer sind Sie überhaupt? Hat man Sie geschickt, um mich zu suchen?«
»Ich bin aus eigenem Antrieb hier.«
»Sie sind mir gefolgt?«
»Das kann man so nicht sagen. Ich mache einen Spaziergang.« Eine Welle schlug gegen einen der Felsblöcke. Ich fühlte die kalte Gischt auf meinem Gesicht. »Sollten wir uns nicht lieber von hier verdrücken?«
Wie in die Enge getrieben, blickte sie hastig in die Runde, dann die Klippe hinauf, wo ein vorkragendes Haus wie eine stille Bedrohung über ihrem Kopf hing. »Ich weiß nicht, wo ich hinsoll.«
»Ich dachte, Sie würden hier in der Gegend wohnen.«
»Nein.« Sie schwieg für einen Moment. »Wo wohnen Sie?«
»Los Angeles. West Los Angeles.«
Ihr Blick bekam etwas Entschlossenes. »Genau wie ich.«
Ich mochte nicht recht an diesen Zufall glauben, war aber bereit, mich auf ihre Behauptung einzulassen und zu sehen, wohin das führte. »Sind Sie motorisiert?«
»Nein.«
»Dann bringe ich Sie nach Hause.«
Ohne Widerspruch schloss sie sich mir an. Sie erzählte mir, sie heiße Laurel Russo, verheiratet mit Tom Russo. Mein Name, sagte ich, sei Lew Archer. Ich hatte allerdings das Gefühl, es sei besser, vorerst zu verschweigen, dass ich Privatdetektiv war.
Noch bevor wir die Klippe hinter uns gelassen hatten, trug eine weitere hohe Welle den allerletzten Surfer an Land und sorgte dafür, dass wir nasse Füße bekamen. Der Surfer setzte sich zu seinen Kameraden, die unter einem Felsdach mit Treibholz ein Feuer gemacht hatten. Ihre eingefetteten Gesichter und Körper glänzten im Feuerschein. Sie erweckten den Eindruck, als hätten sie die Zivilisation abgeschrieben und machten sich auf alles gefasst. Oder auf nichts.
Es waren noch andere Menschen am Strand, die sich leise unterhielten oder stumm abwarteten. Wir stellten uns für eine Weile zu ihnen ins Halbdunkel. Ganz dunkel waren das Meer und seine Küsten ja nie – das Wasser sammelte das Licht wie der Spiegel eines Teleskops.
Die Frau stand so nahe bei mir, dass ich ihren Atem an meinem Hals spürte. Dennoch schien sie weit weg, in teleskopischer Entfernung zu mir und allen anderen. Offenbar empfand sie es selbst so, denn sie griff nach meiner Hand. Ihre Hand war kalt.
Der breitschultrige junge Mann, den ich im Restaurant von Blanche gesehen hatte, war wieder auf dem Kai aufgetaucht. Er sprang auf den Sand hinunter und kam auf uns zu. Seine Bewegungen wirkten unbeholfen und mechanisch, wie per Knopfdruck in Gang gesetzt.
Vor uns blieb er stehen und starrte die Frau aufdringlich, geradezu erregt an. Sie drehte sich um und zog mich an der Hand zur Straße hin. Ihr Griff war fest, ja krampfhaft, wie der eines verängstigten Kindes. Der junge Mann sah uns nach, blieb aber, wo er war.
Im Licht der Straßenlaternen hatte ich Gelegenheit, mir die Frau näher anzusehen. Ihr Gesicht war wie eingefroren, ihr Blick starr vor Schreck. Als wir in mein Auto stiegen, konnte ich ihre Furcht förmlich riechen.
»Wer war das?«
»Ich weiß es nicht. Ehrlich.«
»Warum haben Sie dann Angst vor ihm?«
»Ich habe nur einfach Angst, Punkt. Können wir es dabei belassen?«
»Es war doch nicht etwa Tom Russo? Ihr Mann?«
»Ganz bestimmt nicht.«
Sie zitterte. Im Kofferraum hatte ich immer für alle Fälle einen alten Regenmantel, den ich jetzt hervorholte und ihr über die Schultern legte. Sie sah mich nicht an und bedankte sich auch nicht.
Ich bog auf den Freeway und fuhr nach Norden. Es herrschte wenig Verkehr in unserer Richtung. Dagegen kam uns aus Los Angeles ein ununterbrochener Strom von Scheinwerfern entgegen, als hätte die Stadt ein Loch im Bauch, durch das stetig Licht sickerte.
3
Die Frau saß so vollkommen in ihr Schweigen versunken da, dass ich sie nicht stören wollte. Doch von Zeit zu Zeit warf ich ihr einen Seitenblick zu. Ihr Gesichtsausdruck schien sich beständig zu verändern, wechselte zwischen Kummer, Furcht, Entsetzen und kalter Gleichgültigkeit. Ich fragte mich, woher dieses Schwanken rühren mochte oder ob meine Phantasie und das Scheinwerferlicht mir das Mienenspiel nur vorgaukelten.
An der Abfahrt West Los Angeles verließen wir den Freeway.
Plötzlich meldete sie sich mit leiser, zaghafter Stimme zu Wort: »Wo wohnen Sie, Mister –?« Sie hatte meinen Namen vergessen.
»Archer«, sagte ich. »Mein Apartment ist nur wenige Straßen von hier entfernt.«
»Würde es Sie sehr stören, wenn ich meinen Mann von Ihrer Wohnung aus anrufe? Er rechnet nicht mit mir. Ich war ein paar Tage bei Verwandten.«
Ich hätte sie nach der Adresse fragen und sie hinfahren sollen. Stattdessen nahm ich sie mit zu mir nach Hause.
Barfuß, meinen alten Regenmantel über den Schultern, stand sie in meinem Wohnzimmer und blickte sich um, als hätte es sie sonstwohin verschlagen. Befremdet von diesem gedankenlosen Benehmen, spekulierte ich über ihre Herkunft. Ihre Familie hatte wahrscheinlich viel Geld und tat sich etwas darauf zugute.
Ich zeigte ihr das Telefon auf dem Schreibtisch und ging ins Schlafzimmer, um meine Reisetasche auszupacken. Als ich ins Wohnzimmer zurückkehrte, kauerte sie vor dem Apparat, den schwarzen Hörer seitlich an den Kopf gepresst wie ein Schröpfglas, das ihr alles Blut aus dem Gesicht gezogen hatte.
Dass die Leitung unterbrochen war, begriff ich erst, als sie ganz sanft den Hörer auflegte. Dann ließ sie das Gesicht auf ihre Arme sinken. Ihr Haar fiel über meinen Schreibtisch wie ein schwerer Schatten.
Ich beobachtete sie aus sicherer Distanz. Ich wollte mich nicht in ihre Gefühlswelt drängen, mich vielleicht auch nicht hineinziehen lassen. Die Frau war ein Pulverfass. Dennoch schien sie mir in meiner Wohnung ganz und gar nicht fehl am Platz.
Nach einer Weile hob sie den Kopf. Ihr Gesicht war so unbewegt wie eine Maske. »Tut mir leid. Ich wusste nicht, dass Sie neben mir stehen.«
»Kein Problem.«
»O doch, ich habe sehr wohl ein Problem. Tom will mich nicht hier abholen. Er hat eine Frau bei sich. Sie war es, die ans Telefon gegangen ist.«
»Was ist mit den Verwandten, bei denen Sie sich aufgehalten haben?«
»Nichts ist mit denen.«
Sie sah sich im Zimmer um, als wäre es in ihrem Leben eng geworden.
»Sie haben vorhin Ihre Familie erwähnt. Sie sei im Ölgeschäft tätig, sagten Sie.«
»Das müssen Sie falsch verstanden haben. Und hören Sie doch bitte endlich auf, mich ständig auszuhorchen.« Ihre Stimmung schlug aus wie ein wildgewordenes Pendel, eben noch sichtlich verletzt, war sie im nächsten Moment selber verletzend. »Sie scheinen eine Heidenangst davor zu haben, dass Sie mich nicht mehr loswerden.«
»Im Gegenteil. Wenn Sie wollen, können Sie die ganze Nacht hier verbringen.«
»Mit Ihnen?«
»Sie können das Schlafzimmer haben. Das Sofa da lässt sich ausklappen.«
»Und was würde mich das kosten?«
»Nichts.«
»Sehe ich aus, als wäre ich eine leichte Beute?«
Sie stand auf und schüttelte meinen Regenmantel ab. Es war ein Akt der Auflehnung. Doch unwillkürlich zeigte sie mir dabei ihren Körper. Sie besaß volle Brüste, eine schmale Taille, runde Hüften, volle Oberschenkel. Dunkle Flecken vom Tragen des Vogels waren auf ihrer Bluse zurückgeblieben, und auf meinem Teppich lag Sand, der an ihren zierlichen, beschmutzten Füßen geklebt hatte.
Unversehens sah ich mich selbst im Spiegel – ein Mann mittleren Alters, auf sexuelle Abenteuer aus. Wohl wahr, wäre sie alt oder hässlich gewesen, hätte ich sie kaum mit nach Hause genommen. Sie war weder das eine noch das andere. Trotz ihrer Gereiztheit und ihrer Ängste war und blieb sie eine dunkle Schönheit.
»Ich will nichts von Ihnen«, sagte ich, ohne vom Wahrheitsgehalt dieser Behauptung völlig überzeugt zu sein.
»Irgendwas wollen die Leute immer. Machen Sie sich nichts vor. Ich hätte gar nicht mit Ihnen herkommen dürfen.« Sie sah sich suchend um wie ein Kind, das sich verlaufen hat. »Mir ist hier nicht wohl.«
»Es steht Ihnen frei zu gehen, Mrs. Russo.«
Plötzlich stürzten ihr Tränen aus den Augen, liefen ihr in Strömen übers Gesicht und hinterließen glänzende Spuren. Von Schuldgefühlen oder, wer weiß, Begehren erfasst, streckte ich die Hände nach ihren Schultern aus. Am ganzen Leib zitternd, wich sie zurück.
»Setzen Sie sich doch«, sagte ich. »Sie dürfen gerne bleiben. Niemand wird Ihnen etwas zuleide tun.«
Sie glaubte mir nicht. Vielleicht, dachte ich, hatte sie Schlimmes durchgemacht und bleibende, nicht heilende Wunden davongetragen wie der Renntaucher. Sie betastete ihr tränenverschmiertes Gesicht.
»Kann ich mich hier irgendwo waschen?«
Ich zeigte ihr das Bad. Mit Nachdruck schloss sie die Tür hinter sich ab. Sie ließ sich ziemlich viel Zeit. Als sie wieder auftauchte, war ihr Blick frischer, und sie bewegte sich mit mehr Zutrauen, wie ein Alkoholiker, der heimlich einen Schluck genommen hat.
»Tja«, sagte sie. »Dann mache ich mich mal auf den Weg.«
»Haben Sie Geld?«
»Dort, wo ich hingehe, brauche ich kein Geld.«
»Was soll denn das heißen?«
Die Frage war etwas scharf gestellt, aber sie reagierte übertrieben heftig. »Denken Sie, ich bin Ihnen für die Fahrt noch etwas schuldig? Oh, und dann atme ich hier auch noch Ihre kostbare Luft!«
»Sie suchen ganz offensichtlich Streit. Aber nicht mit mir.«
Jetzt fühlte sie sich endgültig vor den Kopf gestoßen, riss die Wohnungstür auf und stürmte hinaus. Es drängte mich, ihr zu folgen, doch schon am Briefkasten kehrte ich wieder um. Anschließend setzte ich mich an den Schreibtisch und sichtete die Post, die sich während meiner Urlaubswoche angesammelt hatte.
In der Hauptsache waren es Rechnungen. Immerhin befand sich ein Scheck über dreihundert Dollar darunter, ausgestellt von einem Mann, dessen Sohn ich in einem Apartment in Isla Vista gefunden hatte, wo er mit fünf anderen Teenagern untergetaucht war. Von diesem Geld hatte ich mir vorab die Reise nach Mazatlán geleistet. Ferner fand ich einen Brief von einem Insassen eines Hochsicherheitstrakts in Mittelkalifornien, mit sichtlicher Anstrengung per Hand geschrieben. Er sei unschuldig, und ich solle dafür den Beweis liefern. Als Postskriptum fügte er hinzu: »Und selbst wenn ich nicht unschuldig wäre, warum können sie mich nicht gehen lassen? Ich bin ein alter Mann, ich tue doch keinem mehr was zuleide. Warum lassen sie mich nicht einfach gehen?«
Wie bei einer Verbindung, die von Hand gestöpselt wird, brauchte ich eine Weile, um zu schalten. Ich sprang auf, warf dabei fast den Schreibtischstuhl um und rannte ins Bad. Die Tür des Arzneischranks stand halb offen. Ich hatte noch ein Fläschchen Nembutal mit vielleicht fünfunddreißig oder vierzig Kapseln in meiner Hausapotheke gehabt, Überbleibsel aus einer Zeit, als ich nicht mehr schlafen konnte und es erst wieder lernen musste. Es war nicht mehr da.
4
Zehn oder zwölf Minuten waren seit ihrem Aufbruch vergangen, als ich auf die leere Straße hinauslief. Ich sprang ins Auto und fuhr durch die Nachbarschaft. Es waren keine Fußgänger zu sehen, von Laurel Russo weit und breit keine Spur.
Ich fuhr bis zum Wilshire Boulevard, bevor ich mir klarmachte, dass ich nur Zeit vergeudete. Zurück in meiner Wohnung, suchte ich im Telefonbuch nach Thomas Russo. Laut Eintrag wohnte er am Rand von Westwood, nicht mehr als fünf, sechs Kilometer entfernt. Ich notierte mir Adresse und Telefonnummer.
Rhythmisch und rasselnd wie das Röcheln eines Sterbenden klingelte sein Telefon wohl ein Dutzend Mal, bevor jemand abnahm. »Hier bei Russo. Tom Russo am Apparat.«
»Hier ist Lew Archer. Sie kennen mich nicht, aber es geht um Ihre Frau.«
»Laurel? Ist etwas passiert?«
»Noch nicht. Aber ich mache mir Sorgen um sie. Sie hat Schlaftabletten aus meiner Wohnung mitgenommen.«
Seine Stimme wurde misstrauisch. »Sind Sie mit ihr zusammen?«
»Nein, das sind Sie.«
»Was wollte sie in Ihrer Wohnung?«
»Sie anrufen, damit Sie sie abholen. Aber Sie haben sie abblitzen lassen, und kurz darauf ist sie mit meinen Schlaftabletten verschwunden.«
»Was für Schlaftabletten?«
»Nembutal, fünfzig Milligramm.«
»Wie viele davon?«
»Gut drei Dutzend. Genug, um daran zu sterben.«
»Das weiß ich«, sagte Russo. »Ich bin Apotheker von Beruf.«
»Ist ihr zuzutrauen, dass sie sie schluckt?«
»Ich weiß nicht.« Aber in seiner Stimme schwang Angst mit.
»Hat sie schon einmal versucht, sich umzubringen?«
»Ich weiß gar nicht, mit wem ich eigentlich spreche.« Wahrscheinlich also ja.
»Sind Sie von der Polizei?«
»Ich bin Privatdetektiv.«
»Dann sind Sie wohl von ihren Eltern engagiert worden.«
»Mich hat niemand engagiert. Ich bin Ihrer Frau am Strand von Pacific Point begegnet. Die Ölpest hat sie offenbar ziemlich aus der Fassung gebracht, und sie bat mich, sie nach Los Angeles mitzunehmen. Als sie dann bei Ihnen abgeblitzt ist –«
»Bitte, hören Sie auf damit. Ich habe sie nicht abblitzen lassen. Ich habe ihr nur gesagt, dass sie zu einem ernsthaften Neuanfang bereit sein müsse, wenn sie zu mir zurückkommen will. Immer nur Flickschusterei und dann die nächste Trennung, das kann ich nicht länger ertragen. Ich wäre beim letzten Mal schon fast zugrunde gegangen.«
»Wie steht es mit ihr?«
»Ich bedeute ihr nicht so viel wie –. Hören Sie, das sind Familiengeheimnisse, die ich Ihnen da verrate.«
»Verraten Sie mir ruhig noch mehr über die Familie, Mr. Russo. Wen könnte sie anrufen, oder zu wem würde sie gehen?«
»Darüber müsste ich etwas länger nachdenken, und dafür habe ich jetzt keine Zeit. Ich habe Nachtschicht im Drugstore. Ich müsste eigentlich schon längst weg sein.«
»Welcher Drugstore ist das?«
»Save-More in Westwood.«
»Ich werde später dort vorbeikommen. Würden Sie mir eine Liste der Personen erstellen, an die Ihre Frau sich wenden könnte?«
Russo sagte, das wolle er versuchen.
Ich fuhr, immer auf der rechten Spur, den Wilshire Boulevard entlang und hielt unter den Passanten nach Laurel Ausschau. Am Drugstore angelangt, stellte ich mein Auto auf dem Parkplatz ab und betrat das Gebäude durch ein Drehkreuz. Die Neonbeleuchtung erzeugte eine künstlich und fremdartig wirkende Atmosphäre, wie in einer Raumstation.
Etwa ein Dutzend junger Leute schlenderte zwischen den Verkaufsregalen umher, junge Männer mit Langhaarfrisuren wie Johannes der Täufer und junge Mädchen, so schicksalsergeben wie Whistlers Mutter. Der Mann in der verglasten Apothekennische am hinteren Ende des Ladens lag altersmäßig etwa in der Mitte zwischen ihnen und mir.
Seine Haare, weder kurz noch lang, waren schwarz, mit einigen verfrühten grauen Einsprengseln. In dem fluoreszierenden Licht schien sein Kopf über dem sauberen, blendend weißen Kittel wie losgelöst vom Körper in der Luft zu schweben. Ja er hatte so wenig Fleisch am Knochen, dass der hagere Schädel wie eine antike Bronzestatue wirkte.
»Mr. Russo?«
Er blickte wie erschrocken auf und trat dann an den Spalt zwischen Trennscheibe und Kasse. »Was kann ich für Sie tun?«
»Ich bin Archer. Sie haben noch nicht wieder von Ihrer Frau gehört?«
»Nein, Sir. Ich habe im Hollywood Receiving Hospital und den anderen Krankenhäusern eine Nachricht hinterlassen, für alle Fälle.«
»Dann glauben Sie also, dass sie suizidgefährdet ist?«
»Sie hat hin und wieder von Selbstmord gesprochen, in der Vergangenheit, meine ich. Laurel ist kein sehr glücklicher Mensch, war es zeit ihres Lebens nicht.«
»Sie sagte, dass eine Frau ans Telefon gegangen sei, als sie bei Ihnen anrief.«
Er sah mich mit einem treuen Hundeblick aus seinen dunkelbraunen Augen an. »Das war meine Putzfrau.«
»Zu so später Stunde?«
»Eigentlich ist sie meine Cousine. Sie ist länger geblieben und hat mir was zu essen gekocht. Ich hatte keine Lust mehr, ewig ins Restaurant zu gehen.«
»Wie lange sind Sie und Laurel schon getrennt?«
»Ein paar Wochen diesmal. Aber streng genommen sind wir nicht getrennt, nicht im juristischen Sinne.«
»Wo hat sie in der Zeit gewohnt?«
»Hauptsächlich bei Freunden. Und bei ihren Eltern und bei ihrer Großmutter in Pacific Point.«
»Hatten Sie Gelegenheit, die Liste ihrer Freunde und Verwandten anzufertigen, um die ich Sie gebeten habe?«
»Ja, hier.« Als er mir das Stück Papier reichte, trafen sich unsere Blicke erneut. Seine Augen wirkten jetzt kleiner, und härter. »Sie gehen der Sache wirklich gründlich nach, wie?«
»Wenn Sie nichts dagegen haben.«
»Darf ich fragen, warum?«
»Es waren meine Tabletten, mit denen sie sich davongemacht hat. Ich hätte sie noch aufhalten können, aber ich war ein bisschen sauer.«
»Verstehe.« Seine Augen blickten an mir vorbei. »Kennen Sie Laurel gut?«
»Eigentlich nicht. Ich habe sie heute Nachmittag erst kennengelernt. Aber sie hat einen starken Eindruck hinterlassen, wissen Sie.«
»Ja, das geht allen so.« Er holte Luft und stieß sie geräuschvoll wieder aus. »Die Leute, die ich aufgeführt habe, das sind überwiegend Verwandte. Laurel hat mir nie von ihren Lovern erzählt – ich meine, die sie hatte, als sie noch nicht verheiratet war. Und ich weiß nur von einer einzigen echten Freundin. Joyce Hampshire. Sie sind zusammen zur Schule gegangen, irgendwo im Orange County. Privatschule.« Sein Blick kehrte zu mir zurück, nachdenklich und auf der Hut. »Joyce war auf unserer Hochzeit. Und sie war die Einzige aus der ganzen Mischpoke, die Laurel geraten hat, verheiratet zu bleiben. Also, mit mir.«
»Wie lange sind Sie verheiratet?«
»Zwei Jahre.«
»Warum hat Ihre Frau Sie verlassen?«
»Ich weiß es nicht. Sie konnte es mir nicht mal selbst erklären. Irgendwie ist uns alles zwischen den Fingern zerronnen – die Freude, die Zuversicht.« Sein Blick schweifte ab zu den Regalen mit den Medikamenten, verlor sich in der schier unbegrenzten Vielfalt der Schachteln und Fläschchen.
»Wo wohnt Joyce Hampshire?«
»Sie hat ein Apartment nicht allzu weit von hier, in Greenfield Manor. Das gehört zu Santa Monica.«
»Würden Sie sie anrufen und ihr mitteilen, dass ich ihr nächstens einen Besuch abstatte?«
»Das kann ich machen. Meinen Sie, ich sollte die Polizei verständigen?«
»Das würde nicht viel bringen. Wir haben einfach noch nicht genug vorzuweisen. Aber setzen Sie sich ruhig mit denen in Verbindung, wenn Sie möchten. Und am besten auch gleich mit dem Suicide Center.«
Während Russo mit Telefonieren beschäftigt war, nahm ich seine mit der Maschine geschriebene Namensliste in Augenschein.
Joyce Hampshire, Greenfield Manor.
William Lennox, El Rancho (Großvater).
Mrs. Sylvia Lennox, Seahorse Lane, Pacific Point (Großmutter).
Mr. und Mrs. Jack Lennox, Cliffside, Pacific Point (Laurels Eltern).
Captain Benjamin Somerville und Frau, Bel Air (Onkel und Tante).
Ich prägte mir die Namen ein.
Russo sprach ins Telefon: »Ich hatte keinen Streit mit ihr. Ich habe sie den ganzen Tag nicht gesehen. Ich habe mit der ganzen Sache überhaupt nichts zu tun, das kannst du mir glauben.«
Er beendete das Gespräch und kam zu mir zurück. »Sie könnten vermutlich auch von hier aus mit Joyce sprechen, aber ich bin nicht befugt, Sie an dieses Telefon zu lassen.«
»Mir ist es sowieso lieber, persönlich mit ihr zu sprechen. Wenn ich recht verstehe, hat sie nichts von Laurel gehört?«
Russo schüttelte den Kopf und sah mich scharf an. »Wie kommt es, dass Sie sie Laurel nennen?«
»So nennen Sie sie doch auch.«
»Aber Sie sagten, dass Sie sie kaum kennen.« Er war aufgebracht, aber auf sehr zivilisierte Weise.
»Stimmt ja auch.«
»Woher rührt dann Ihr Interesse? Ich will nicht sagen, dass Sie nicht dazu berechtigt seien, aber ich versteh’s nicht. Wo Sie sie doch kaum kennen.«
»Wie gesagt, ich empfinde eine gewisse Verantwortung.«
Sein dunkler Schopf senkte sich. »Ich ja auch. Mir ist jetzt klar, dass ich mich falsch verhalten habe, als sie heute Abend anrief und nach Hause kommen wollte. Ich hätte sie einfach willkommen heißen sollen.«
Er war ein Mensch, der Ärger und Anfechtungen schnell gegen sich selbst richtete. Sein offenes Gesicht nahm einen enttäuschten und verbitterten Ausdruck an, als wäre ihm gerade aufgegangen, dass das Leben nicht mehr vor ihm lag.
»Ist sie schon öfter mal weggelaufen, Mr. Russo?«
»Wir waren auch vorher schon mal getrennt, falls Sie das meinen. Und sie war immer diejenige, von der es ausging.«
»Hat sie Suchtprobleme?«
»Nichts Schwerwiegendes.«
»Und das nicht so Schwerwiegende?«
»Sie nimmt ziemlich oft Barbiturate. Sie hat schon immer schlecht geschlafen, überhaupt fällt es ihr schwer, zur Ruhe zu kommen. Aber sie hat noch nie eine Überdosis genommen.« Er senkte den Blick, um die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, mochte sich ihr aber doch nicht stellen. »Ich halte es schlicht für einen Bluff. Sie will mir Angst einjagen.«
»Also, was mich betrifft, ist es ihr gelungen. Hat sie irgendwas von Selbstmord gesagt, als Sie telefoniert haben?«
Russo antwortete nicht gleich, doch die Schädelknochen unter seiner dünnen Gesichtshaut traten noch deutlicher hervor. »Sie hat irgend so was gesagt.«
»Können Sie sich an den genauen Wortlaut erinnern?«
Er holte tief Luft. »Sie sagte, falls ich sie je in ihrem Leben wiedersehen wolle, sollte ich sie nach Hause kommen lassen. Und dort auf sie warten. Aber das ging nicht, ich musste hierher zur Arbeit und –«
Ich unterbrach ihn. »In ihrem Leben?«
»Das hat sie gesagt. Ich hab das in dem Moment nicht allzu ernst genommen.«
»Das sollte man aber wohl. Sie ist gründlich aus dem Lot. Trotzdem, glaube ich, möchte sie, dass ich sie finde.«
Sein Kopf schoss hoch. »Wie kommen Sie darauf?«
»Sie hat die Tür meines Arzneischranks offen stehen lassen. Es kam ihr also nicht unbedingt darauf an, unbemerkt mit den Tabletten zu verschwinden.« Ich nahm seine Namensliste zur Hand. »Was hat es mit ihrer Familie auf sich? Bel Air, El Rancho und Seahorse Lane, das sind recht exklusive Adressen.«
Russo nickte bedächtig. »Die sind reich.« Und die herabsackenden Schultern ergänzten: Ich bin arm.
»Ihr Vater, ist das derselbe Jack Lennox, dem die auslaufende Ölquelle gehört?«
»Der Eigentümer ist ihr Großvater. William Lennox. Seine Firma besitzt eine ganze Reihe von Ölquellen.«
»Kennen Sie ihn?«
»Ich bin ihm einmal begegnet. Letztes Jahr hat er mich zu einem Treffen in seinem Haus in El Rancho eingeladen. Mich und Laurel und den Rest der Familie. Die Gesellschaft hat sich aber so schnell wieder aufgelöst, dass ich keine Gelegenheit hatte, mich mit ihm zu unterhalten.«
»Hat Laurel ein enges Verhältnis zu ihrem Großvater?«
»Früher ja, bevor er sich eine neue Frau zugelegt hat. Warum?«
»Ich glaube, diese Ölkatastrophe hat sie wirklich tief erschüttert. Die Vögel scheinen ihr sehr am Herzen zu liegen.«
»Ich weiß. Das hängt damit zusammen, dass wir keine Kinder haben.«
»Hat sie das gesagt?«
»Das war gar nicht nötig. Ich wollte gern Kinder haben, aber sie glaubte, der Mutterschaft nicht gewachsen zu sein. Es war leichter für sie, sich um die Vögel zu kümmern. Im Nachhinein bin ich froh, dass wir kinderlos sind.«
Es lag eine gewisse Bitterkeit in seinen Worten, vielleicht nicht einmal ganz unbewusst. Offenbar dämmerte ihm, dass in seinem Leben immer mehr Türen zugeschlagen waren.
»Kennen Sie Laurels Eltern – Mr. und Mrs. Jack Lennox?«
»O ja. – Das Bild ihres Vaters war heute Morgen auf der Titelseite der Times.«
»Ich hab’s gesehen. Würde sie bei ihnen Unterschlupf suchen, oder bei ihrer Großmutter Sylvia?«
»Ich weiß nicht, was sie tun würde. Die ganzen letzten Jahre habe ich versucht, Laurel zu verstehen, aber ich konnte nie vorhersagen, welches ihr nächster Schritt sein würde.«
»Captain Somerville und Frau in Bel Air – wie nahe steht sie denen?«
»Das sind ihre Tante und der dazugehörige Onkel. Soviel ich weiß, hat sie ihnen mal nahegestanden, aber in letzter Zeit weniger. Ich bin in diesem Punkt nicht die beste Informationsquelle, im Grunde kenne ich die Familie gar nicht. Ich weiß nur, dass es immer wieder mal hoch hergegangen ist, seit der alte Herr sein Leben umgekrempelt hat. Laurel hat darunter sehr gelitten.«
»Warum?«
»Sie kann’s nicht ertragen, wenn es Ärger gibt, egal welcher Art. Sie ist immer in Tränen ausgebrochen, wenn sie die anderen hat streiten hören. Sie hat es nicht mal ausgehalten, wenn wir zu Hause eine ganz gewöhnliche Meinungsverschiedenheit hatten.«
»Hatten Sie häufig Meinungsverschiedenheiten?«
»Nein. Das würde ich nicht sagen.«
Eine Frau mit einem Rezept in der Hand trat neben mich an den Tresen. Sie trug hochhackige schwarze Stiefel und eine gelbe Perücke. Russo schien erleichtert über die Kundschaft. Er nahm das Rezept entgegen und schickte sich an, zu den Regalen mit den Medikamenten zu gehen.
»Bis dann also«, sagte ich.
Er kehrte wieder um und beugte sich zu mir. Was er mir zu sagen hatte, sollte vertraulich sein. »Wenn Sie Laurel tatsächlich finden, sagen Sie ihr – bitten Sie sie, nach Hause zu kommen. Keine Bedingungen. Ich will nur, dass sie zurückkommt. Richten Sie ihr das von mir aus.«
Das Telefon in seiner Apothekennische begann zu klingeln. Er nahm ab, hörte dem Anrufer zu und schüttelte dann den Kopf.
»Ich kann nicht hinkommen, das weißt du. Und ich will auch nicht, dass sie hierherkommen. Dieser Job ist alles, was ich habe. Warte mal kurz.«
Russo kam zu mir zurück, sichtlich blass und aufgewühlt. »Laurels Vater und Mutter stehen bei mir vor der Tür. Ich kann hier nicht weg, und ich möchte auf keinen Fall, dass sie hier in das Geschäft kommen. Außerdem habe ich ihnen nichts zu sagen. Sie würden mir einen großen Gefallen tun, Mr. Archer, wenn Sie an meiner Stelle mit ihnen reden. Immerhin waren Sie es, der Laurel zuletzt gesehen hat. Es ist nicht weit von hier. Und ich bin auch gern bereit, Sie für Ihre Mühe zu entschädigen, was immer Ihnen angemessen erscheint.«
»In Ordnung. Dann bekomme ich hundert Dollar von Ihnen.«
Er machte ein langes Gesicht. »Nur dafür, dass Sie sich mit ihnen unterhalten?«
»Ich rechne damit, dass es dabei nicht bleiben wird. Einhundert ist das Honorar, das ich für einen Tag Arbeit nehme.«
»So viel habe ich nicht bei mir.« Er sah in seiner Brieftasche nach. »Ich könnte Ihnen erst einmal fünfzig geben.«
»Ist gut. Was den Rest betrifft, vertraue ich Ihnen.«
Die Frau mit der gelben Perücke sagte: »Kann ich hier jetzt mein Rezept einlösen, oder redet ihr beiden noch die ganze Nacht weiter?«
Russo entschuldigte sich und bat noch um einen Moment Geduld. Er nickte mir nachdrücklich zu und kehrte dann zum Telefon zurück.
Jetzt, wo ich Laurels Mann als Klienten gewonnen hatte, fühlte ich mich legitimiert, weiter am Ball zu bleiben. Russo stammte offensichtlich aus einfachen Verhältnissen und hatte sich ein Studium erkämpft, um beruflich aufzusteigen. Wenn so ein Mann bereitwillig Geld herausrückte, dann war das, auch wenn er unter Druck stand, ein Beweis echter Sorge.
Während ich durch Westwood fuhr, fragte ich mich, woher meine Sorge um seine Frau rührte. Ich fand keine klare Antwort. Vielleicht gehörte Laurel einfach zu den Menschen, auf die man seine eigenen unbestimmten Ängste, seinen unbewussten Kummer überträgt.
Ihre Augen schienen mich aus der Dunkelheit heraus zu beobachten wie der Geist einer längst verstorbenen Frau. Oder wie der Geist eines Vogels.
5
Es war eine etwas heruntergekommene Mittelschichtgegend. Die weißverputzten Flachdachhäuser stammten aus den zwanziger Jahren und standen einander auf der Straße gegenüber wie Gefechtsstände auf einem längst vergessenen Schlachtfeld. Tom Russos Haus unterschied sich von den anderen durch den neuen schwarzen Cadillac, der vor seiner Auffahrt stand.
Ein großgewachsener Mann stieg auf der Fahrerseite aus. »Sind Sie Archer?«
Ich bejahte.
»Jack Lennox, Laurels Vater.«
»Habe Sie gleich wiedererkannt.«
»Oh? Sind wir uns schon mal begegnet?«
»Ihr Bild war in der Morgenzeitung.«
»O je, war das erst heute Morgen? Kommt mir vor, als wär’s schon eine Woche her.« Er wiegte gedankenschwer den Kopf. »Ein Unglück kommt selten allein, sagt man. Das kann ich aus eigener Erfahrung weiß Gott bestätigen.«
Hinter dem gewöhnlichen Gejammer spürte ich eine Unsicherheit, die mich an Laurel erinnerte. Er trat näher und sprach mit deutlich leiserer Stimme weiter.
»Wie ich höre, möchte mein Schwiegersohn« – er sprach das Wort mit leichtem Ekel aus – »uns nicht sehen. Glauben Sie mir, das beruht voll und ganz auf Gegenseitigkeit. Schön von ihm, dass er immerhin einen Abgesandten schickt. Allerdings verstehe ich Ihre Funktion nicht so ganz.«
»Ich bin Privatdetektiv.« Und noch einen draufsetzend, fügte ich hinzu: »Tom Russo hat mich engagiert, um nach Ihrer Tochter zu suchen.«
»Ich wusste gar nicht, dass ihm das so wichtig ist.«
»Das ist es. Er kann nur seinen Arbeitsplatz im Moment nicht verlassen. Da ich der Letzte war, der Laurel gesehen hat, habe ich mich bereiterklärt, herzukommen und mit Ihnen zu sprechen.«
Lennox packte meinen Arm. Als hätte er einen Stromkreis geschlossen, fühlte ich die Spannnug, die ihn durchschoss und auf mich übergriff.
»Der Letzte, der sie gesehen hat? Was meinen Sie damit?«
»Sie ist mit einem Fläschchen Schlaftabletten aus meiner Wohnung verschwunden.« Ich sah auf meine Armbanduhr. »Das war vor etwas mehr als einer Stunde.«
»Was hatte sie in Ihrer Wohnung zu suchen?«
Sein Ton war gebieterisch. Der Griff um meinen Arm wurde noch fester. Ich schüttelte ihn ab.
»Ich bin ihr am Strand von Pacific Point begegnet. Sie bat mich, sie in meinem Auto nach West Los Angeles mitzunehmen, und das habe ich getan. Dann wollte sie mein Telefon benutzen, um ihren Mann anzurufen.«
»Was ist zwischen Laurel und ihrem Mann vorgefallen?«
»Nichts Besonderes. Er konnte sie nicht abholen, weil er zur Arbeit musste. Jetzt macht er sich natürlich Vorwürfe, aber zu Unrecht, wie ich finde. Ihre Tochter war schon äußerst erregt, bevor sie Pacific Point verließ.«
»Worüber?«
»Nicht zuletzt über die Ölpest. Sie hatte einen Vogel an Land geholt, der ihr unter den Händen verendet ist.«
»Kommen Sie mir bloß nicht damit. Das ausgelaufene Öl soll jetzt an allem schuld sein. Verdammt, gerade so, als wäre es der Weltuntergang.«
»Vielleicht war es das für Ihre Tochter. Sie ist ein sehr sensibler Mensch, und sie scheint unter einer enormen Belastung gestanden zu haben.«
Er schüttelte den Kopf. Er schien sich selbst am Rande seiner Belastbarkeit zu bewegen. Im Grunde wollte er gar nicht hören, was ich über seine Tochter zu berichten hatte.
Ich sagte: »Hat sie schon häufiger mit Selbstmordgedanken gespielt?«
»Nicht dass ich wüsste.«
»Wer würde es denn vielleicht wissen?«
»Sie könnten ihre Mutter fragen.«
Mit großen Schritten betrat er das Haus, als gehörte es ihm. In dem beleuchteten Flur standen wir uns für einen Moment auf engem Raum gegenüber und maßen einander. Er hatte wettergegerbte braune Haut, undurchdringliche blaue Augen und dunkles, volles Haar ohne Geheimratsecken. Sein Blick war eine Spur anmaßend, seine Lippen umspielte ein affektierter Zug. Doch da war auch ein Anflug von Schrecken, als spürte er den ersten kalten Hauch des Alters. Auch wenn er jünger wirkte, war er mindestens fünfzig.
Seine Frau wartete im Wohnzimmer zusammen mit Toms Cousine, von der er mir im Drugstore erzählt hatte. Die beiden Frauen saßen einander so steif gegenüber, dass man vermuten musste, ihnen seien schon vor längerer Zeit die Gesprächsthemen ausgegangen.
Toms Cousine, die jüngere von beiden, trug einen hellblauen, zu engen Hosenanzug. Sie sah aus, als säße sie in der Falle. Doch als ich sie mit einem leichten Grinsen begrüßte, erwiderte sie es sofort.
»Ich bin Gloria«, sagte sie. »Gloria Flaherty.«
Die ältere Frau sah so aus wie Laurel vielleicht in zwanzig Jahren, falls sie dann noch lebte. Ihre Schönheit hatte sich weitgehend erhalten, nur die Nasenflügel und Mundwinkel waren durch steile Falten verbunden, und um die Augen hatte sie kohlschwarze Ringe wie von einer Feuerprobe. Ihr Haar war von weißen Strähnen durchzogen.
Sie hielt mir ihre schwarz behandschuhte Rechte schlaff entgegen. »Mr. Archer? Wir begreifen das alles nicht. Können Sie sich einen Reim darauf machen? Ist Laurel wirklich selbstmordgefährdet, wie ihr Mann sagt?«
»Möglicherweise.«
»Aber warum? Ist irgendetwas passiert?«
»Genau das wollte ich Sie fragen.«
»Aber ich habe seit Tagen keine Neuigkeiten von Laurel. Sie war bei ihrer Großmutter, die einen Tennisplatz hat. Sie spielt dort gern, sagt, das sei eine gute Therapie.«
»Hat sie denn eine Therapie nötig?«
»Das war eher so dahingesagt.« Sie starrte die Cousine demonstrativ an, bevor sie sich wieder mir zuwandte. »Ich möchte mich im Moment nicht näher dazu äußern.«
Gloria hatte den Wink mit dem Zaunpfahl begriffen und erhob sich. »Ich muss noch mal in die Küche, um sauberzumachen. Kann ich jemandem was bringen?«
Mr. und Mrs. Lennox verneinten kopfschüttelnd mit angewiderter Miene. Nur schon der Gedanke, in Tom Russos Haus etwas zu essen oder zu trinken, erschien ihnen abwegig. Sie kamen mir wie Astronauten vor, die sich nur mit Mühe auf den Beinen hielten, aber voller Verachtung waren für die unvertraute Umgebung und deren höchst befremdliche Bewohner.
Kaum war die Cousine in der Küche verschwunden, erhob sich Mrs. Lennox und ging rastlos vor dem kalten Kamin auf und ab. Sie war groß und hager und wirkte für ihr Alter sehr umtriebig. Sie fuchtelte mit ihren behandschuhten Händen herum.
»Ich frage mich, was für ein Parfüm sie benutzt. Es riecht wie Mitternacht in Long Beach.«
»Das ist eine Beleidigung für Long Beach«, sagte ihr Mann. »Long Beach ist eine gute alte Ölstadt.«
Vermutlich wollten sie nur locker klingen, doch ihre Worte lasteten wie Blei.
Mrs. Lennox wandte sich an mich: »Ob sie hier mit ihm lebt, was meinen Sie?«
»Das bezweifle ich. Laut Tom ist sie seine Cousine. Und was noch wichtiger ist: Er scheint Ihre Tochter aufrichtig zu lieben.«
»Warum kümmert er sich dann nicht besser um sie?«
»Ich habe den Eindruck, dass das gar nicht so einfach ist, Mrs. Lennox.«
Sie schwieg nachdenklich. »Das ist wahr«, sagte sie dann. »So war es schon immer. Laurel ist und bleibt ein unberechenbares Mädchen. Ich hatte gehofft, dass ihre Ehe –«
»Die Ehe kannst du vergessen«, fiel Lennox ihr ins Wort. »Die ist offensichtlich am Ende. Seit Wochen leben sie nicht mehr zusammen. Russo sagt, er will keine Scheidung, aber er spielt nur auf Zeit, weil er möglichst viel Kohle rausschlagen will. Ich kenne diese Typen.«
»Könnte sein, dass Sie sich in ihm täuschen«, sagte ich. »Laurel scheint ihm genauso sehr am Herzen zu liegen wie Ihnen.«
»Ist das Ihr Ernst? Vergessen Sie nicht, dass ich ihr Vater bin. Ich nehme es übel, wenn man mich mit diesem Apotheker auf eine Stufe stellt.«
In seiner augenblicklichen Stimmung nahm er so gut wie alles übel. Sein Gesicht war erst krebsrot und dann aschfahl geworden. Seine Frau beobachtete die Verfärbungen, als wisse sie die Zeichen zu deuten. Es lag eine gewisse Distanz in ihrem Blick, dennoch beugte sie sich jetzt über ihn und legte ihm beide Hände auf die Schultern.
»Beruhige dich, Jack. Es könnte noch eine lange Nacht werden.« Und zu mir gewandt: »Mein Mann ist furchtbar angespannt. Leicht nachvollziehbar unter diesen Umständen.«
Ich sagte: »Weniger leicht nachvollziehen kann ich, was Sie hierhergeführt hat, Mrs. Lennox.«
»Wir hofften, Laurel hier anzutreffen. Ihre Großmutter sagte, sie habe davon gesprochen, zu Tom zurückzukehren.«
»Sie müssen sich Sorgen um sie gemacht haben.«
»Mein ganzes Leben lang habe ich mir Sorgen um sie gemacht – ihr ganzes Leben lang.«
»Wollen Sie mir sagen, warum?«
»Ich wünschte, das könnte ich.«
»Soll das heißen, Sie können es nicht – oder Sie wollen es nicht?«
Sie sah wieder ihren Mann an, als suchte sie nach einem Zeichen. Sein Gesicht hatte mittlerweile rosa Flecken. Er fuhr sich mit der Hand darüber, doch das änderte nichts daran. Dafür sprach er jetzt mit veränderter Stimme.
»Laurel ist uns sehr wichtig, Mr. Archer. Sie ist ein Einzelkind, das einzige Kind, das wir je haben werden. Falls ihr irgendetwas zustoßen sollte –« Achselzuckend sank er in seinem Sessel zusammen.
»Was, glauben Sie, könnte ihr denn zustoßen?«
Lennox schwieg. Seine Frau blickte zu ihm hinunter, als versuchte sie seine Gedanken durch die Schädeldecke zu lesen. Ich fragte sie beide: »Hat sie schon einmal versucht, Selbstmord zu begehen?«
»Nein«, antwortete ihr Vater.
Aber ihre Mutter sagte: »Ja. In gewisser Weise.«
»Mit Drogen?«
»Darüber weiß ich nichts. Ich habe sie einmal im Zimmer ihres Vaters überrascht, wie sie mit seinem Revolver russisches Roulette spielte.«
Lennox wand sich in seinem Sessel, als wäre er dort festgeschnallt. »Das hast du mir nie erzählt.«
»Es gibt einiges, was ich dir nicht erzählt habe. Es war auch nicht nötig, bis jetzt.«
»Dann beherrsch dich auch weiterhin, ja? Das ist ein verdammt ungeeigneter Moment, um die Schleusen zu öffnen.« Er erhob sich und baute sich, den Rücken mir zugewandt, vor ihr auf. »Was ist, wenn der Alte davon hört?«
»Ja was soll dann sein?«
»Vaters Vermögen steht auf dem Spiel, das weißt du genau. Diese Frau braucht nichts weiter als einen Vorwand, um uns um das Erbe zu bringen. Und den wollen wir ihr doch nicht liefern, oder?«
Er hob den Arm und führte seine flache Hand an ihre Wange. Es war nicht unbedingt eine Ohrfeige, aber auch kein liebevolles Tätscheln. Es klatschte leise, und sie wirkte schockiert.
Ich für mein Teil war jedenfalls erschüttert. Sie gehörten offenbar zu den Paaren, die einfach nicht an einem Strang ziehen können. Die Energie ihrer Ehe floss zwischen ihnen hin und her wie Wechselstrom, der ihnen lähmende Schläge versetzte.
Die Frau hatte lautlos zu weinen begonnen. Ihr Mann suchte sie durch leichtes Tätscheln und leises Murmeln zu beschwichtigen. Ihr trockenes Schluchzen wollte nicht aufhören, wie ein Schluckauf. In den Pausen dazwischen sagte sie: »Es tut mir so leid. Alles mache ich falsch. Ich zerstöre dein Leben.«
»Unsinn. Beruhige dich.«
Er führte sie nach draußen zum Auto und kam dann noch einmal an die Haustür zurück. »Archer?«
Ich wartete im Flur. »Was ist?«
»Wenn Sie auch nur einen Hauch von Anstand und Feingefühl besitzen, dann hängen Sie das hier nicht an die große Glocke.«
»Was soll ich nicht an die große Glocke hängen?«
»Die Probleme meiner Tochter. Ich möchte nicht, dass Sie darüber reden.«
»Ich muss Russo Bericht erstatten.«
»Aber Sie müssen ihm nicht alles weitergeben, was gesagt wurde. Schon gar nicht, wovon jetzt zuletzt die Rede war.«
»Sie meinen das Vermögen Ihres Vaters?«
»Ganz recht. Ich war indiskret. Sie dagegen bitte ich, Diskretion zu wahren.«
Ich erklärte, ich wolle mein Bestes tun.
6
Ich ging in die Küche. Cousine Gloria, die schwarzen Haare mit Schnürsenkeln zu Zöpfen hochgebunden, stand an der Spüle und trocknete Geschirr ab. Sie wandte kurz den Kopf und lächelte mir zu. »Kommen Sie lieber nicht rein. Das ist ein einziges Chaos hier.«
»Finde ich nicht. Es sieht alles sauber aus.«
»Ich arbeite dran«, räumte sie ein. »Muss mir ein bisschen Übung verschaffen, um fit zu sein, wenn ich wieder heirate.«
»Haben Sie den Glücklichen denn schon erwählt?«
Einen Teller in der einen, das Trockentuch in der anderen Hand, drehte sie sich zu mir um. »Das habe ich tatsächlich. Er ist ein wunderbarer Mensch. Die Glückliche bin in Wirklichkeit ich.«
Sie polierte den Teller, als stellte er ein Symbol ihrer Zukunft dar. Ihre Vertrauensseligkeit hatte etwas Rührendes.