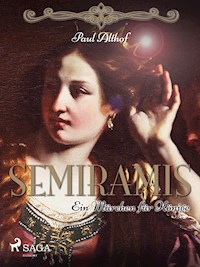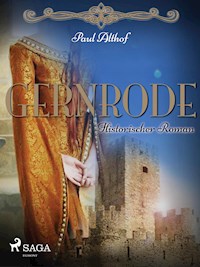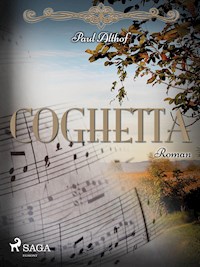Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Fiorenza Bálint, das begabte Kind einer urmusikalischen, aber armen ungarischen Zigeunerfamilie, wird von Baron Amadé gefördert. In Wien wird sie zur Opernsängerin ausgebildet und steht bald am Beginn einer glänzenden Karriere. Der junge Adelige Falco Casalanza wirbt um sie, will sie heiraten, macht aber zur Bedingung, dass sie ihrer Laufbahn als Sängerin entsagt. Und das ist nicht die einzige Enttäuschung, die sie erleben muss. Falco liebte und liebt immer noch die Postwirtin Rosanna, die bald die Macht, die sie über Falco besitzt, zu gebrauchen weiß. Zur Autorin: Die österr. Schriftstellerin u. Journalistin Alice Gurschner (1869–1944) wandte sich nach dem Studium der bildenden Künste in Italien und Paris dem Journalismus zu und schrieb unter dem Pseudonym Paul Althof für verschiedene in- und ausländische Zeitungen (u.a. "Wiener Tageblatt", "Wiener Fremdenblatt", "Neue Freie Presse", "Wiener Journal", "Deutsche Zeitung", "Berliner Börsenkurier"). Daneben veröffentlichte sie Romane, Novellen und dramatische Gedichte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 333
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Paul Althof
Drei Häuser
RomanausAlt-Österreich
Saga
I.
Zu Franz Schuberts Zeiten grünte und blühte neben dem alten Wirtshaus ein Wiesenabhang. Gegenüber klapperte eine Mühle und auf den Ulmen versammelten sich jeden Abend die Krähen, sie krächzten und saßen dort ungestört, bis endlich Taglöhner mit Hacke und Spaten kamen, um auf der Wiesenlehne den Grund für ein Haus zu graben.
Der Fuhrwerkbesitzer Mathias Knöll ließ es für seine Frau Maria, die schöne Bauerntochter aus dem Etschtal, errichten, weil sie sich in der engen Wienerstadt, nach ihren heimatlichen Gebirgsmatten und Lärchenwäldern sehnte.
Hier heraußen „in der Brühl“, wo ein Bächlein durch die Felsenklause rauschte, wo die Hügel mit dunklem Nadelwald bewachsen waren, konnte sich die Frau so halbwegs einbilden, in ihrer Tiroler Heimat zu sein.
Besonders eilig war es dem Mathias Knöll mit dem Bauen zwar nicht, weil das Lohnfuhrwerk gerade während der Schrecken der Revolution von 1848 in Wien viel Nutzen abwarf. Da gab es Fuhren bis St. Pölten, ja sogar bis nach Linz oder Graz, wenn der hohe Adel zuweilen inkognito reiste. Auch flohen viele Wiener Bürger vor der Cholera, die sich allmählich in den niedriger gelegenen Stadtteilen an der Donau ausbreitete.
Maria fürchtete sich ihrer drei Kinder wegen, vor der Seuche, und als das Landhaus im Sommer noch immer nicht ganz vollendet war, beschwor sie ihren Mann, sie mit den Kleinen nach Bozen fahren zu lassen, wo sie bei ihren Eltern eine bessere Zeit abwarten wollte. Das war aber nicht nach seinem Sinn und als sie ihm wieder einmal damit in den Ohren lag, sagte er: „Gut. Fahre weg. Aber du brauchst nicht zurückzukommen.“ Da gab sie diese Hoffnung auf.
Mathias Knöll war ein richtiger Mann: stark und gesund. Und so war ihm auch Maria erschienen, als er sie im Stall und Weingarten ihrer Eltern bei der Arbeit gesehen hatte. Aber reißet einen einfachen Menschen aus dem Heimatboden, den er bearbeitet hat und dessen Früchte ihn genährt haben, versucht es, ihn in einer fremden, fernen Gegend einzupflanzen, wo eine bleichere Sonne scheint und seht zu, ob er nicht langsam verkümmert an Körper, Seele und Geist.
Ja, Mathias Knöll war ein richtiger Mann, ganz ahnungslos, ob Maria litt, und doch gutmütig gegen Mensch und Tier, zwar nicht aus Mitleid, sondern aus Gerechtigkeit. Wenn ihm eine Fuhre gut bezahlt worden war, mochten auch seine müden Rösser eine Extraportion guten Hafer fressen. Und da Maria ihm drei Kinder geboren und auch sonst alle häuslichen Pflichten zur Zufriedenheit erfüllt hatte, mochte sie ein Landhaus bei Mödling haben und dort in ihrem Garten Blumen und Gemüse ziehen. Einen Stall und Wagenschuppen an der seitlichen Gartenmauer hatte er für sein Geschäft schon vorgesehen.
Äußerlich ließ sich Mathias nicht anmerken, daß er von nun an den Bau vorwärts trieb, aber Ende August sagte er plötzlich: „Kannst du dich fertig machen, Mariedl? Morgen früh führ ich dich mit den Kindern und dem ganzen Graffel in die Brühl.“
„Jesus Maria! So schnell?“ rief sie aus. Er hatte sie um die Vorfreude gebracht. Sie verpackte eiligst Bettzeug, Kochgeschirr und anderen Hausrat. Um Mitternacht war sie damit fertig und um fünf Uhr morgens stand der Leiterwagen vor dem Tore. Die zwei starken Eisenschimmel scharrten und stampften, daß es in der Gasse widerhallte. Mathias Knöll und Nazl, sein junger Fuhrknecht, trugen die Kisten aus dem Hause und hoben sie umständlich auf den Wagen. Zuletzt brachten sie die Betten. Maria ging hinterher. Ihre Stirne war wie von einer quälenden Sorge zusammengezogen. „Ich wär’ eigentlich noch gern mit der Mena zum Doktor gegangen“, sagte sie, auf ihr Töchterlein zeigend.
„Komm nur!“ beruhigte sie der Mann. „Draußen, in der guten Luft, wird sie schon wieder rote Wangerln kriegen.“ Die Wagenplache wurde befestigt. Mit einem Zungenschlag ermunterte Mathias seine Pferde, die wacker anzogen. Neben ihm hockte der Knecht Nazl. Maria saß am anderen Ende des Wagens und hielt den acht Monate alten Seppele im Arm. Der dreijährige Hansel hieb mit einer alten Peitschenschnur auf seine Schuhe ein und rief: „Hü!“ Mena hatte den Kopf in den Schoß der Mutter gelegt und schaute mit trüben Augen vor sich hin.
Man mußte mancherlei Umwege machen, weil das Straßenpflaster seit den letzten Barrikadenkämpfen auf einigen Plätzen aufgerissen und noch nicht ausgebessert worden war. Bei der sogenannten Teufelsmühle am Wienerberg wollte Maria anhalten lassen, weil Mena fortwährend nach Wasser verlangte.
„Wasser ist jetzt ungesund“, brummte Mathias und trieb die Pferde zu einem leichten Trab an. Erst in Perchtoldsdorf gestattete er der Frau und den Kindern abzusteigen. Hier kannte er einen Wirt, der einen echten Tropfen ausschenkte und da saßen sie dann unter schattigen Linden. Die Wirtin brachte Backhühner mit Salat, und man trank den säuerlichen, süffigen Weißwein dazu. Als das Mahl beendet war, winkte der Wirt heimlich dem Fuhrwerkbesitzer, in die Stube zu kommen und hier rückte er mit der Frage heraus, ob Mathias ihm heute die Pferde leihen wolle.
Die Rösser? Ja, was glaubte denn der Gevatter? Er mußte doch sehen, daß Mathias heute seine Familie auf das Land fahre. Die paar Weinfasseln, die der Wirt vielleicht auf der Maut liegen hatte, konnten wohl bis morgen oder übermorgen warten ...
Es handle sich nicht um Weinfässer, erklärte der Wirt, sondern um noble Herrschaften, um den Baron und die Baronin Amadé, die sich auf der Reise nach Ungarn befänden. Hier unten an der Brücke sei ihnen gestern abends infolge eines Blitzschlages das Handpferd scheu geworden und gestürzt. Der Baron habe es auf der Stelle erschießen müssen. Und nun suchten sie einen Vorspann für die schwere Kalesche. Im Ort gebe es aber nur magere, abgetriebene Ackergäule und so ein stattliches Gespann, wie es Matthias besaß, käme sehr gelegen.
Knöll schüttelte den Kopf. Heute ging es nicht. Warum hatten es denn die Ungarn so eilig? Am Ende waren es gar politisch Verdächtige?
Ein hochgewachsener Mann in einem dunkelgrünen, verschnürten Rock trat rasch hinzu: „Ich brauche seine Pferde bis nach Neustadt. Was verlangt er?“
Knöll schaute den Sprecher prüfend an. „Nix“, sagte er endlich. „Meine Rösser, mit Verlaub, brauch ich heut selber. Geb sie auch net in fremde Händ. Sie sind keine Hasen, daß man’s etwan abschießen könnt.“
Der Fremde wollte auffahren, doch der Wirt trat dazwischen. „Euer Gnaden verzeihen ... er macht gern G’schpaß, der Knöll.“ Und dem Mathias gab er einen Rippenstoß: „Narrentattel übereinand! Kannst ja selber kutschieren.“
„Der Preis ist nebensächlich“, setzte der Fremde hinzu. „Überleg’ er sich’s rasch.“ Mathias öffnete den Mund, um eine abschlägige Antwort zu geben — da stand plötzlich eine schöne Dame in der Türe. Ihr grauseidenes Reisekleid mit rosenroten Bändern bauschte sich über dem Reifrock, ein Florentinerhut, der mit Blondenspitzen und Rosen verziert war, umrahmte ihr junges Gesicht. Und diese schöne Fremde hielt seinen kleinen Buben, den Seppl in den Armen und wiegte ihn zärtlich. Graf Amadé verwies es ihr, halb unwillig, halb lachend. Jetzt kam Maria hinterdrein. „Addio, carino!“ sagte die anmutige Dame und übergab den Kleinen seiner Mutter. Und dann erzählte sie in einem artigen, welschen Deutsch, daß sie in der Kirche gewesen sei, wo sie Maria mit dem Bübchen getroffen und dieselbe als Tirolerin erkannt habe, denn Trient, woher sie selbst stamme, läge nicht weit von Bozen und so schöne Kinder kämen nur von dort her.
Die Männer schienen über diesen Zwischenfall teils verdrießlich, teils verlegen, aber sie einigten sich darüber, daß Knöll zuerst seine Familie nach Mödling befördern und so schnell als möglich zurückkehren sollte, um die Herrschaften nach Wiener Neustadt zu fahren.
Die Kinder wurden eilig auf den Wagen gehoben. Die schöne Baronin stand dabei, nestelte an ihrem Busentuch und schenkte Maria eine Nadel aus Silberfiligran, auf der eine neunzackige Krone und die Initialen T. und C. in zarter venezianischer Arbeit nachgebildet waren. Maria wollte aus vollem Herzen danken, da setzte sich der Wagen schon in Bewegung. Sie winkte zurück, so lange sie den Strohhut mit den flatternden Rosenbändern sehen konnte. Die Heimat hatte zu ihr gesprochen.
O Sehnsucht! Wenn Maria die Augen schloß, sah sie Weinlauben mit blauen Trauben behängen ... Eidechsen im Dolomitgeröll eines Flußbettes ... blühendes Haidekraut auf Berghalden und hoch oben das glühende Lichtwunder des Rosengartens.
Ein Aufschrei Hansels versetzte sie in die Wirklichkeit zurück. Der Knabe zeigte auf seine Schwester Mena, die das Mittagessen erbrochen hatte.
„Jetzt wird ihr besser werden“, tröstete der Vater. Wenn man mit Kindern fuhr, gab es eben stets Scherereien. Aber nun war das Ziel nahe und als Mathias in den Hauptplatz von Mödling einbog, knallte er laut mit der Peitsche. Die Leute sollten aufpassen und sehen, wer da gefahren kam. Im gleichmäßigen Trab ging es durch die Felsenklause in das freundliche Waldtal der Brühl hinein, bis vor das neue Haus. Dieses hockte mit der Schmalseite gegen die Straße und schaute aus zwei Fenstern, wie aus tiefen Augen auf Maria. An der Gartenseite waren alle Fensterläden noch geschlossen.
Eine Schar von Zuschauern hatte sich um den Wagen der Ankömmlinge versammelt. Der Knecht des Postgasthofes, die Botenfrau, der Müller, der Fleischerjunge — alle standen und gafften. Nur ein sehr junges Mädel mit weißblonden Zöpfen näherte sich und bat schüchtern: „Darf ich tragen helfen?“ Maria nahm die angebotene Hilfe an und das Mädchen schleppte bereitwillig alle kleinen Lasten, die den Männern zu geringfügig waren, vor die Haustüre. Mit einer gewissen Feierlichkeit zog Mathias Knöll den Hausschlüssel aus der Tasche, sperrte auf und ließ seine Frau mit den Kindern in die sehr geräumige erste Stube treten. Maria bekreuzigte sich, dann öffnete sie schnell alle Fensterläden, um ein Gefühl der Beklemmung loszuwerden.
„Na also?“ frug der Mann. Er hatte einen Ausruf der Freude erwartet. Marias tiefes Atemholen hatte aber wie ein Seufzer geklungen.
„Ich will dir gleich Kaffee kochen“, sagte sie, wie um sich zu entschuldigen. Dann faßte sie seine Hand: „Laß dir danken, Mathias. Vergelts Gott viel tausendmal im Himmel oben!“
„Laß gut sein, Mariedl. Auf den Kaffee werd’ ich net warten können.“ Er half ihr aber noch beim Öffnen der Geschirrkiste. Indessen machte sich das fremde Mädchen ans Holzspalten und zündete im Küchenherd Feuer an. Als der Kaffee und die Milch in geblümten Kannen auf dem Gartentisch standen, kam Nazl mit dem Tränkeimer aus dem Stall.
„Höchste Zeit! Satteln!“ schrie Mathias. Maria legte ihrem Mann die Hände auf die Schultern. In ihrem Gesicht zuckte es: „Grad am ersten Tag ...“, sagte sie stockend. „Ich laß dir den Nazl da“, begütigte Knöll, „er soll euch helfen. Aber halt‘ ihn kurz, den Haderlumpen! Morgen komm ich zurück.“
Maria stand am Gartenzaun und schaute ihrem Manne nach. Er ritt die Stute und führte das andere Pferd an den Zügeln mit. Dieser wuchtige Mensch mit dem Stiernacken, war der Vater ihrer Kinder geworden, ohne ihre Liebe zu gewinnen. Heute empfand sie das erste Mal etwas wie Reue darüber, daß sie ihm keine zärtlichere Frau gewesen war. Sie ging ins Haus zurück zu Mena, die auf dem Bett der Mutter eingeschlafen war. Eine halbgeleerte Tasse mit Kamillenabsud verbreitete einen flauen Geruch. Maria beugte sich über das Kind und begann ihm das Kleid aufzuknöpfen. Da bäumte sich Menas kleiner Körper im Krampf und die Zähnchen schlugen aneinander.
Ein jäher Schreck durchfuhr das Herz der jungen Mutter. Sie rief nach dem Fuhrknecht. Als keine Antwort aus dem Hofe kam, rannte Maria hinab, fand aber Stall und Schuppen leer. Das fremde Mädchen, das ihr mit Sepp auf dem Arme gefolgt war, sagte: „Ich möchte nachschauen, ob er vielleicht im Gasthaus sitzt“, und brachte nach einer Weile den Burschen, der ziemlich angeheitert war, in die Stube.
„Lauf’ nach Mödling“, befahl Maria, „frag’, wo der Doktor wohnt und bring ihn schnell mit!“
Bei dem Worte Doktor schien Nazl seine Besinnung wieder erlangt zu haben. Mißtrauisch betrachtete er das Kind, das fahl im Gesicht, sich in Krämpfen wand. „Hat’s am End’ die Cholera?“
„Nein!“ schrie Maria, obwohl er das ausgesprochen hatte, was sie befürchtete. Der Knecht war mit einem Satz aus dem Zimmer. Unten im Hofe machte er plötzlich kehrt, holte sich seinen Rock aus der Futterkammer und rannte in tollen Sprüngen davon.
Maria und das fremde Mädchen warteten. Unerträgliche Schwüle lag über der Gegend und die Grillen zirpten im verbrannten Gras. Die beiden Fenster nach der Straße standen weit offen. Vor dem einen, in der schmalen Kammer, lag Sepp ruhig schlummernd in einem Wäschekorb, den ihm das fremde Mädchen mit Kissen zurecht gemacht hatte. Aber der ältere Bub jammerte über Kälte und warf sich in seinem Bettchen hin und her. Da holte ihn Maria, der eine bange Ahnung aufdämmerte, zu sich und Mena in die angrenzende Stube.
Ein Talglicht schimmerte in der unbewegten Luft. Auf den Ehebetten lagen die beiden kranken Kinder. Maria hatte in einer Pfanne Räucherwerk angezündet. Sie wähnte, damit die Krankheit vertreiben zu können. Der leichte Qualm benahm ihr aber plötzlich den Atem und sie stürzte längsnach hin.
Das fremde Mädchen kam erschrocken aus der Kammer hereingelaufen, holte Wasser und wusch das Gesicht der ohnmächtigen Frau. Endlich bewegte sie die Lippen.
„Wer sind Sie?“ frug Maria benommen. Das Mädchen vermied es aufzublicken.
„Ein Findelkind.“
„Ich meine ... wie du heißt?“
„Agnes.“
„Agnes ... mir ist so bang ... möchtest du das Vaterunser beten?“
„Freilich. Und auch den Glauben.“
Das Mädchen kniete vor dem Licht nieder, das die dürftigen Schultern und mageren Arme der Betenden mit schmerzlicher Klarheit umgab.
Maria richtete sich mühsam vom Boden auf. „Wie lange bin ich da gelegen?“ frug sie. „Ist der Knecht schon zurück?“
„Vielleicht kommt er nimmer ...“ „Himmlischer Vater! ... Die Mena!“ rief Maria, hob das Kind aus dem Bette und trug es ans Fenster. Die Händchen, die sich ans Brusttuch der Mutter anklammerten, schimmerten bläulich.
„Lauf zum Doktor, Agnes!“
„Wollt Ihr denn ganz allein bleiben?“
„Lauf, lauf!“
Agnes sprang die Gartenstufen zur Straße hinab. Sie lief in ihrer blinden Angst einem Vorübergehenden in die Flanke. Er richtete sie auf: „Hast du dir weh getan, Kind?“ „Küß die Hand, Hochwürden“ ... stotterte Agnes, vor dem geistlichen Kleid in Ehrfurcht knixend.
„Nicht Hochwürden ... nur Priesterstudent, Carlo Casalanza“, lächelte der junge Theologe und wehrte den Handkuß des Mädchens ab. „Wohin willst du so spät?“ „Zum Doktor. Dort oben ist eine kranke Frau allein mit zwei kranken Kindern und niemand hilft ...“ Agnes schwang die Arme hoch und rannte, rannte was sie konnte. Eine Weile klang das Aufschlagen ihrer nackten Füße auf der einsamen Landstraße zurück. Casalanza schaute zu den zwei Fenstern empor, die weit aufgerissen, einen schwachen Lichtschein aussandten, der wie ein Hilferuf zu ihm drang. Das Gartentor stand offen, die Haustüre leistete keinen Widerstand. Er trat ein und dämpfte seinen Schritt, so gut er konnte. Maria hörte ihn nicht. Sie lag neben der kleinen sterbenden Mena und erkannte, daß sie selbst von der Seuche ergriffen worden war. Aber mehr noch als die Angst, quälte sie das Heimweh, die Sehnsucht. Nur nicht hier sterben ... Wenn sie noch fort könnte! Fort aus diesem Hause! ... Sie denkt angestrengt nach, es ist so schwer ... die Gedanken fließen ineinander ... ja ... Extrapost bis Wiener Neustadt ... Dort wird sie mit Mathias zusammentreffen ... dann fährt sie mit den eigenen Pferden weiter ... durch Steiermark ... Kärnten ... über die Tiroler Grenze ... endlich!
Sie sitzt mit Vater und Mutter auf der Hausbank. Der Vater raucht aus der alten, zerkauten Pfeife. Die Mutter hat Larchlinge aus dem Wald heimgebracht und reinigt die rötlich gelben Pilze von der Erde und den Tannennadeln. Kühler Moosduft entströmt ihnen. Maria atmet ihn tief ein. Daheim! ... Jetzt stellt der Vater eine Halbliterflasche roten Magdalener auf den Tisch. „Den trink, der macht dich gesund!“ sagt er. Die Mutter schüttelt ihre Schürze aus. „I geh jetzt Mues kochen“, spricht sie. „Wo hascht denn die Kinder?“ — „Jesus! Die Kinder!“ schreit Maria, aus tiefem Traum auffahrend. „Wo ist die Mena? Was ist mit dem Hansel geschehn?“
Die Kinder sind fort. Sie liegt ganz allein in der Stube. Aber nein! ... dort steht jemand am Fenster ... wendet sich um ... Ein junger Student der Theologie tritt behutsam an ihr Bett. „Die Kinder ..., sagt er und seine Stimme klingt klar wie Glas, — eine unbewegte und doch wohltönende Stimme — „die beiden Kinder sind im Himmelreich ...“
„Nein! Das ist nicht wahr!“ ruft Maria, „ich will meine Kinder sehn!“
„Den Jüngsten können Sie sehen, den Bambino. Er ist gesund. Ich werde Ihr Bett an das Fenster rücken.“
Maria schaut ... alle Sehnsucht ist in ihren Augen: dort unten in der Stalltüre steht Agnes mit Seppele auf dem Arm und winkt herüber. „Er ist ganz munter, nicht wahr?“ fährt Casalanza fort. „Aber der Arzt hat verboten, daß er hier im Hause bleibe, solange Sie krank sind.“
„Und Sie haben keine Furcht vor der Krankheit?“ fragt Maria leise und zieht mit einer schamhaften Bewegung ein grünes Tüchlein um ihre Schultern, aber es gleitet wieder herab und ihre feuchte, zitternde Hand tastet in der Richtung der Kommode, auf welcher eine silberne Nadel liegt, mit der sie das Tuch befestigen will. Der junge Theologe errät ihren Wunsch und will ihr die Nadel reichen, doch plötzlich werden seine Augen größer, der ganze Mensch ist verändert, seine Stimme klingt rauh und brüchig. „Woher haben Sie das?“
Maria erinnert sich schwer ..., war es wirklich erst gestern ..., oder vorgestern? Ja, eine wunderschöne Dame hat ihr die Nadel geschenkt.
„Teresa Casalanza“, sagt der Student. „Es ist ihr Wappen.“ Er wendet die Nadel hin und her. „Teresa Casalanza ist ihr Mädchenname ... unsere Väter waren Brüder ...“
„Wollen Sie die Nadel behalten?“ fragt Maria. „Ich werde ja doch sterben. Jetzt erinnere ich mich auch, daß Sie heute Nacht den Herrn Pfarrer zu mir geführt haben und daß ich gebeichtet habe ... Bitte, nehmen Sie nur die Nadel. Meine armen Kinder sind tot. Man hat sie mir fortgenommen. Man wird auch mich forttragen.“
„Sie müssen leben, Frau. Sie haben noch ein Kind. Sehen Sie hinab! Es winkt Ihnen mit Blumen im Händchen.“
Maria richtete sich mühsam auf. „Blumen ..., so schöne Blumen! Heilige Jungfrau ..., er kann sie mir nicht geben ..., ich werde ihn nie mehr küssen, meinen Buben, meinen Seppele! Er wird seine Mutter nicht kennen ...“
Casalanza ist schon im Hofe unten. Er macht Agnes allerhand Zeichen. Sie versteht ihn endlich, legt den kleinen Blumenstrauß auf den Brunnenrand und tritt rasch zurück. Casalanza nimmt die Blumen — es sind Zyklamen mit einigen Büscheln Immergrün — und tritt mit dem stark duftenden Strauß an Marias Bett. Sie röchelt leise. Ihre Finger greifen unbewußt nach den Blumen und schließen sich über den Stielen krampfhaft fest zusammen. Eben kommt der Arzt, ein alter Mann mit dunklen Handschuhen, und verbreitet im Hause einen scharfen Medikamentengeruch. Er betrachtet Maria, deren Gesicht sich verfärbt hat und die jetzt ganz still daliegt, wie eingeschlafen. Der Arzt kennt diesen Schlaf und macht gegen den Theologen eine gewissermaßen auslöschende Bewegung. „Es ist heute schon der dritte Fall mit letalem Ausgang“, sagt er und nimmt schnell eine Prise. „Ich werde die Leichenträger schicken.“
Um die Abenddämmerung kommen zwei Männer mit dem Karren. Zu dieser Zeit haucht der Föhrenwald seinen kühlen Atem ins Tal hinab. Die Rosenstöcke im Garten leuchten mit blaßroten und gelben Kelchen, wie sanfte Lichter am Rande eines dunklen Weges. Die Tote wird auf einer Bahre herabgetragen, die mit einem abgenützten, schwarzen Tuch notdürftig bedeckt ist. Marias rechte Hand ist sichtbar und hält das Sträußchen Alpenblumen noch fest. Sie nimmt es mit auf ihre Fahrt in die Kalkgrube.
Casalanza begleitet die Bahre bis zum Karren, dann schwenkt er nach links ab. Ein unbestimmtes Gefühl zwingt ihn aber, noch einmal den Blick zu den zwei offenen Fenstern emporzuheben, die jetzt dunkel, leer und trostlos auf ihn niederschauen.
In seiner jungen Seele aufgewühlt, schreitet er mächtig aus. Die Nacht bricht herein, als er an einen Teich gelangt, der völlig einsam hinter Binsengräsern verborgen liegt. Carlo Casalanza nimmt seinen Ranzen von den Schultern, trägt Zweige zusammen, macht mit Feuerstein und Zunder ein Feuer an und wirft seine Kleider in die Flammen. Es ist ihm dabei traurig und doch befreit zu Mute, als hätte er mit der Vergangenheit ein Ende gemacht. Er steht einen Augenblick nackt im hervorbrechenden Mondlicht. Dann springt er mit einem jubelnden Schrei in das Wasser, schwimmt kreuz und quer, schreckt die Ufervögel auf, wirft sich auf die Seite und jauchzt zum klaren Nachthimmel empor.
Leben! Leben! ... Teresa Casalanza! Deinethalben wollte ich der Welt entsagen. Aber du lebst ja, du lebst in der Welt und die sollte ich fliehen? Teresa, wir sind beide jung und ich werde dich wiedersehen! Das Schicksal hat mir die Nadel in die Hände gespielt, die Nadel, die du an deinem Kleide getragen hast, Teresa Casalanza, du Traum, du Sehnsucht!
Er steht im Schilf und streift reine Wäsche über, die er aus dem Ranzen genommen hat. Da ist auch der alte Zivilanzug. Schon ein wenig eng geworden. Er trug ihn zum erstenmal auf einem Weinlesefest in den Vignen seines Oheims, im Trentino. Seine Kusine Teresa feierte ihren fünfzehnten Geburtstag und er liebte sie ... Teresa Casalanza!
Die Bäume rauschen auf. Der Wind hat sich gedreht und die Grillen sind verstummt, weil ein kühler Hauch über die Gräser streicht. Casalanza fröstelt es mit einemmal. Wohin hat er gewollt?... Wie lange hat er sich hier verspätet? Mechanisch geht er den Weg zurück, den er gekommen ist. Er geht, wie unter einem Joch.
Um nicht wieder an dem einsamen Hause vorbei zu müssen, macht er einen Bogen um die Wiesen zum Gasthof. Er hat aber schon den Postwagen versäumt und muß zu Fuß weiter wandern. Viele Herbergen stehen an der Landstraße, doch er wandert die ganze Nacht.
Die Sonne geht über einer Gegend auf, die ihm fremd ist. Im nüchternen Lichte des Morgens schwinden alle Träume und nichts bleibt in seiner Seele zurück, als eine bittere, schamvolle Selbstanklage.
Er steht am Ziel und pocht an das Tor des adeligen Knabenkonviktes, in welchem ihm durch die Vermittlung eines hohen Gönners, die Stelle eines Magisters der italienischen Sprache anvertraut werden soll. Er atmet tief ein. Sein Herz schlägt hart, schwer, fast schmerzhaft in seiner Brust. Das Tor geht langsam auf und schließt sich hinter ihm ...
An jenem Morgen kehrte Matthias Knöll aus dem westlichen Ungarn, wohin er die Reisenden gefahren hatte, nach Mödling heim und fand Agnes mit Seppele im Stalle schlafend vor. Nachdem er das Mädchen am Arme wachgerüttelt hatte, gab ihm dasselbe noch ganz benommen und unverständliche Worte stotternd, den Schlüssel zu seinem Hause. Er kam aber gleich wieder aus demselben zurück und schrie Agnes wütend an: was da vorgegangen sei und wo sich seine Frau befände?
‚Die Frau ist gestern begraben worden.“
„Und die Kinder?“
„Auch die Kinder.“
Matthias schob Agnes zur Seite, band das Sattelpferd los und trabte davon. Weit draußen, zwischen Gaaden und Heiligenkreuz machte er vor einem Wirtshause halt, verlangte zu trinken und trank so lange, bis ihm der Wirt den Wein verweigerte. Sodann stieg er wieder zu Pferd und jagte im Galopp über die Straßen, Hecken und Wiesen zurück. Wüste Reden murmelnd, führte er den Eisenschimmel zum Handpferd in den Stall und fiel dort zwischen den beiden Gäulen wie ein Klotz zu Boden. Erst am Mittag kam er wieder zu sich, lud das Kind und Agnes auf seinen Wagen auf und fuhr mit ihnen nach Wien.
Das verlassene Haus — das Haus der Sehnsucht — ist sodann viele Jahre leer gestanden.
II.
Vor dem Winzerhause von Szent Györgyvár wimmelte eine Schar junger Küchlein um die alte Glucke. Kleinen Bällchen gleich überkugelten sie sich, stießen aneinander und plusterten sich auf, als hätten sie das lange geübt und waren doch erst vorige Woche aus dem Ei gekrochen. Alle hatten braun gesprenkelte Federn, bis auf ein einziges, das über und über goldgelb, in der Sonne förmlich leuchtete. Plötzlich gackerte die Henne laut warnend. Das Vierergespann der Gutsherrschaft kam drüben auf der Landstraße vorgefahren.
Eine ältliche Bonne stieg aus, die mit unendlicher Vorsicht — die jungen Pferde standen ja niemals völlig ruhig — einen etwa neunjährigen Knaben aus dem Wagen heben wollte. Er stieß ihr aber den Ellbogen ins Gesicht und sprang mit einem Satz auf den Boden.
„Er ist couragiert, der kleine, gnädige Herr Baron“, sagte der hagere Winzer mit einem verlegenen, meckernden Lachen. Die Winzerin trat hinzu, barfuß, breithüftig, einen schweren Obstkorb tragend. „Ich küsse die Hände, Euere Gnaden, Herr Baron! Schöne reife Kirschen gefällig? Belieben zu kosten, bitte!“
Der Knabe fuhr mit beiden Händen in den Korb und stopfte sich den Mund voll.
„Schlucken Sie keinen Kern, Falco!“ flehte die Bonne.
Ein Sprühregen von Kirschkernen, der auf das demutsvoll geneigte Haupt des Winzers niederprasselte, enthob sie dieser Sorge.
„Jesus Maria!“ rief plötzlich die Winzerin, „Sie bluten ja, Fräulein! Ihre Nase blutet!“
„Wahrhaftig, Falco hat mich beim Aussteigen ein wenig gestoßen.“
„Sie sind auch im Gesicht zerkratzt. Kommen Sie, ich gebe Ihnen Wasser.“ Und sie führte die Bonne in die Küche, in der es nach saurem Rahm und frischem Brot roch. Das alte Fräulein tauchte ihr Taschentuch in einen irdenen Wasserkrug und seufzte: „Der kleine Baron ist so lebhaft! Er kratzt, wenn man ihm nicht gleich seinen Willen tut. Die Gräfin gestattet ihm alles. Und zu Hause, in Trento, sitzt er bei Tisch obenan, weil er einmal Minister werden soll.“
Die Winzerin wiegte den Kopf staunend hin und her.
„Ja“, prahlte die Bonne, „der junge Baron Falco wird einmal sehr reich sein, er erbt nicht bloß die schöne Villa Casalanza bei Trient, sondern auch die großen Weingüter, die sein Vater in Italien besitzt und von seinem Oheim Don Carlo einen Palast in Verona, ganz aus Marmor gebaut!“
„Hörst du, Katicza? Aus Marmor!“ rief der alte Winzer, wie berauscht von dieser Vorstellung. „So reich ist wohl unsere hiesige Herrschaft nicht, aber eine gute, eine großartig gute Herrschaft haben wir. Wenn mir unsere gnädige Frau Baronin sagt: ‚Pista, du bist ein Esel!‘ so geht mir das Herz auf, denn ich weiß, daß sie es aufrichtig mit mir meint. Und trotzdem sie eine Italienerin ist und keine Ungarin, verehrt man sie wie eine Mutter. Ja, und die Bevölkerung verdankt ihr, daß wir ein ordentliches Spital und sogar einen Kindergarten gekriegt haben. Nun, und wie gefällt es dem Herrn Gast, dem kleinen Herrn Baron, drinnen in Kanizsa, in unserer schönen Stadt?“
„Sie stinkt nach Stroh und Enten“, erwiderte der Knabe, eine Grimasse schneidend.
„Na, na!“ fiel da eine Frauenstimme, gutmütig lachend, ein. „Schön braun gebratene Enten wird er aber doch gern schnabulieren, der Bub!“
Die Bonne wendete sich um wie eine Windfahne, wenn plötzlich eine schärfere Luft weht. Wer hatte da ihren kleinen Baron einfach „Bub“ genannt? Mit einem unendlich geringschätzigen Achselzucken stellte sie fest, daß es die Bálint gewesen war, die Frau des Cymbalspielers der Zigeunerkapelle. Vier Kinder umringten das Weib und ein fünftes schien auf dem Wege zu sein.
„Bei Ihnen ist es ja wieder einmal so weit?“ sagte die Bonne mit einem mißbilligenden Blick auf den schwangeren Leib der Bálint. „Wozu brauchen arme Leute so viele Kinder?“
„Das können Sie nicht verstehen, Fräulein“, lächelte Eva Bálint, „denn Sie haben immer bloß für Lohn fremde Kinder gehütet und keine eigenen aufgezogen.“
Die Bonne wurde rot vor Ärger. Der hohe weiße Kragen schien sie plötzlich zu würgen, aber sie richtete sich kerzengerade auf und zischte: „Es ist geradezu unanständig! Haben Sie an vier hungrigen Mäulern nicht genug?“
„Gott hat immer gesorgt, daß sie satt wurden“, entgegnete die Frau des Cymbalspielers. „Mein Mann gibt auch Klavierstunden. Er ist ja der einzige von seiner Musikbande, der nach Noten spielen kann. Und ich hab jetzt die Ausstattung der jungen Baronin Amadé zu sticken bekommen. O, ihre Mutter, die Baronin Teresa ist so gut zu meinen Kindern! Sie hat uns heut zur Kirschenernte in ihren Weingarten eingeladen.“
„Mutter! Komm heraus! Er bringt die Küchlein um!“ schrie einer der Knaben.
Falco hatte draußen mit den Kücken gespielt. War es seine Schuld, daß das Spielzeug so wenig Bestand hatte? Ein Kücken lag tot auf der Erde. Ein zweites klemmte er zwischen seine kleinen, kräftigen Hände fest und beobachtete, wie es die Augen verdrehte und wie sich der Schnabel langsam öffnete. Das mißfiel ihm und er warf es gegen die Planke, daß es nur so klatschte. So wollte er es auch mit dem großen, gelben Kücken machen. Die Henne zeterte laut, aber er fing es schnell.
„Nicht die Hühnchen töten, lieber, goldener, gnädiger Herr Baron!“ rief die Winzerin. Er hörte nicht auf sie.
„Lass’ das arme Hendel los!“ mischte sich Frau Bálint ein und versuchte, das Tierchen zu befreien. Aber nach kurzem Streit, stellte ihr der Knabe ein Bein und sie stürzte auf der feuchten Lehmerde ausgleitend, vornüber gegen den Bretterzaun. Einigermaßen überrascht, ließ Falco das gelbe Kücken fahren. Es war gerettet.